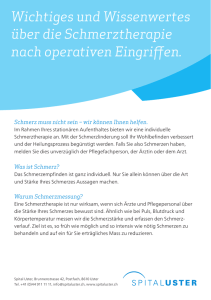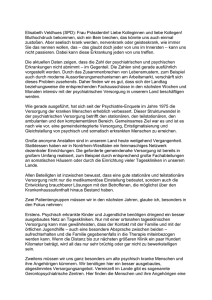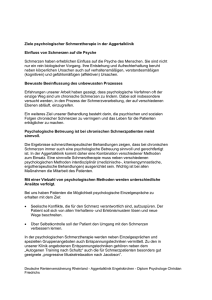Wenn der Vater mit dem Kinde
Werbung

26. Jahrgang . Nummer 1 . September 2003 „Wenn der Vater mit dem Kinde...“ Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung für die Entwicklung psychischer Störungen von Mädchen und Jungen 2 „Heile heile Segen, sieben Tage Regen...“ Schmerz bei Kindern – mehr als nur ein akutes Problem? 5 Die Schizophrenie des Kindes- und Jugendalters 6 Wie Patienten zu Fakiren werden Psychologische Schmerztherapie am Beispiel der Rheumatologie 9 Das Kompetenznetz Demenzen 14 Betrieblich Suchtprävention Projektergebnisse 16 Gewalt in der Psychiatrie Eine interne Bestandsaufnahme 20 Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung psychisch Kranker Gesetzgebung und Praxis in den Mitgliedsländern der Europäischen Union 21 „Wieder-klar-denken-können“ Computergestütztes Training kognitiver Defizite bei schizophren Erkrankten 25 Was kommt nach der Klinik? Die komplementäre psychiatrische Versorgung in Mannheim 27 Der Sucht auf der Spur Biochip-Untersuchungen bieten erste Hinweise auf Kandidatengene 31 Autorinnen und Autoren 32 Impressum 9 „Wenn der Vater mit dem Kinde.......“ Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung für die Entwicklung psychischer Störungen von Mädchen und Jungen ein Drittel der Zeit, die Mütter für ihre Kinder aufwendeten, für ihre Kinder verfügbar, so liegt diese Zahl nach US-amerikanischen Angaben heute durchschnittlich bei 67 % und an Wochenenden sogar bei 87 % (Cabrera et al., 2000). Mit ihren jüngeren Kindern verbringen Väter heute im Mittel zwischen 2.8 und 4.9 Stunden täglich (mit einem deutlichen Gipfel am Wochenende) (Pruett, 1998). Allerdings fungieren Väter weiterhin ganz überwiegend nur als Mithelfer bei der Betreuung ihrer Kinder; nur in dringenden Fällen sind sie dazu bereit, die alleinige Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Wandel der Vaterrolle In den letzten 20 Jahren hat sich in den westlichen Industrienationen ein tiefgreifender Wandel der Rolle des Vaters und der Vorstellungen von Vaterschaft vollzogen (Fthenakis, 1999). Im Gefolge der gesellschaftlichen Veränderungen familiärer Lebensformen wird heute erwartet, dass Väter vermehrt Aufgaben in der Versorgung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder übernehmen und neue Formen einer engagierten Vater-Kind-Beziehung entwickeln. Viele junge Eltern bemühen sich inzwischen, berufliche und familiäre Aufgaben partnerschaftlich zu verteilen und die Verantwortung für ihr Kind gemeinschaftlich zu tragen. Mit dem Wandel im Elternverhalten hat sich auch das väterliche Rollenverständnis verändert. Die „neuen Väter“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem familiären Zusammenleben und den damit verknüpften Werten eine höhere Bedeutung beimessen. So berichten Väter, die sich an der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder aktiv beteiligen, dass sie eine intensivere Beziehung zu ihren Kindern aufgebaut haben und die Teilhabe an deren Entwicklung eine Bereicherung ihres Lebens darstellt. Empirische Vaterforschung In gesellschaftlichen Traditionen verwurzelt, war Sozialisations- und Familienforschung über lange Zeit auf die Rolle der Mutter als Erziehungs- und Betreuungsperson konzentriert. Aus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht galt sie als die „primäre“ Bezugsperson des Kindes und maßgebliche Repräsentantin der Elternschaft. Erst allmählich entwickelte sich in Forschung und Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Bedeutung des Vaters und seiner Rolle in der Entwicklung des Kindes (bezeichnenderweise zunächst aufgrund von Überlegungen zu den Folgen der Vaterdeprivation). Allerdings entspricht das tatsächliche Verhalten der Väter häufig nicht den hochgesteckten Erwartungen (Lamb, 1997). Noch immer verbringen Väter deutlich weniger Zeit mit ihren Kindern als Mütter und engagieren sich auch nur in Teilbereichen elterlichen Handelns stärker als früher. Während Mütter neben der Pflege eher Schutz-, Beaufsichtigungs- und Betreuungsfunktionen übernehmen, konzentrieren sich Väter auf spielerische Aktivitäten. Verstärkten Niederschlag findet die veränderte Vaterrolle zudem allein in den ersten Lebensjahren des Kindes und bei der Gruppe der Männer, die zum ersten Mal Vater werden. Mit fortschreitendem Alter des Kindes und ab der Zweitvaterschaft lassen die väterlichen Betreuungsaktivitäten jedoch offensichtlich wieder nach. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben sich zahlreiche empirische Untersuchungen mit der Frage beschäftigt, wie Väter die Entwicklung ihrer Kinder beeinflussen und ob sich der väterliche vom mütterlichen Einfluss unterscheidet. Die Ergebnisse dieser Forschung lassen sich nach Lamb (1997) in fünf Punkten zusammenfassen: 1. Väter und Mütter nehmen in sehr ähnlicher Weise Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder. Unterschiede zwischen den Eltern sind weitaus weniger bedeutsam als die Ähnlichkeiten zwischen ihnen. Allgemein von Bedeutung für eine positive Entwicklung des Kindes sind elterliche Wärme, Fürsorge und Nähe, unabhängig davon, ob diese Eigenschaften von Müttern oder Vätern verwirklicht werden. 2. Im Zusammenhang mit der späteren Entwicklung des Kindes stehen nicht so sehr bestimmte Eigenschaften von Vätern oder das Ausmaß der mit ihren Kindern verbrachten Zeit als vielmehr die Qualität der Beziehung zwischen Vätern und Kindern. 3. Dyadischen Beziehungen innerhalb der Familie kommt häufig weniger Bedeutung Verschiedene Statistiken und empirische Erhebungen liefern Belege für ein neues Verständnis von Vaterschaft in der jungen Vatergeneration. So ist die Zahl der Väter, die an der Geburt ihres Kindes teilnehmen, rapide angestiegen und liegt inzwischen bei fast 90 % (Werneck, 1998). Im Vergleich zu früheren Generationen hat die Erziehungsbeteiligung der heutigen Väter in Zwei-Eltern-Familien um 30 % und ihre Verfügbarkeit insgesamt um die Hälfte zugenommen. Waren Väter vor 30 Jahren noch ca. 2 zu als Merkmalen des gesamten Familiensystems. Deshalb sind Vater-KindBeziehungen immer im Familienkontext zu sehen. Dabei zeigt sich, dass ein förderlicher Einfluss des Vaters nicht nur mit einer vertrauensvollen Vater-Kind-Beziehung einher geht, sondern zumeist auch mit einer positiven Partnerbeziehung und weiteren günstigen Merkmalen der Familie. 4. Väter übernehmen multiple Rollen innerhalb der Familie. Ihr Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes wird dadurch bestimmt, wie gut es ihnen gelingt, diese verschiedenen Rollen auszufüllen. 5. Individuelle und kulturelle Werte entscheiden darüber, was ein erfolgreicher Vater ist; eine zeitlich und kulturell übergreifende Definition der Vaterrolle, an der Väter und Mütter sich orientieren können, gibt es nicht. tionen, Aufwachsen in benachteiligten familiären Lebensverhältnissen). Dazu begleitet sie eine Kohorte von 384 Familien in der Entwicklung ihres erstgeborenen Kindes von der Geburt bis in die Adoleszenz. In regelmäßigen Abständen wurden umfangreiche Erhebungen durchgeführt, die vom frühen Säuglingsalter (3 Monate) bis zum Alter von 15 Jahren alle wichtigen Stadien der kindlichen Entwicklung einschließen. Das diagnostische Instrumentarium der Studie umfasst neben klassischen Verfahren der Entwicklungs-, Verhaltens- und Familiendiagnostik auch moderne Methoden der Interaktionsdiagnostik. Dazu wurden zu allen Erhebungszeitpunkten Verhaltensbeobachtungen von Eltern-Kind-Paaren (Mutter-Kind und VaterKind) in standardisierten Interaktionssituationen videografisch aufgezeichnet. Erste Ergebnisse Erste Auswertungen, die sich mit der VaterKind-Interaktion im Kleinkindalter befassen, zeigen, dass das väterliche Steuerungsverhalten in der Interaktion mit "schwierigen" (verhaltensauffälligen) 2-Jährigen vom Geschlecht des Kindes beeinflusst wurde: Gegenüber auffälligen Mädchen verhielten sich die Väter deutlich restriktiver (d. h. reagierten häufiger negativ oder abwertend und schränkten ihr Kind öfter unangemessen ein) als gegenüber auffälligen Jungen. Keine Geschlechtsunterschiede ergaben sich dagegen im Umgang mit unauffälligen 2-Jährigen (Abbildung 1). Forschungsdefizit Während die Vaterforschung bezogen auf die normale Entwicklung des Kindes inzwischen ihren Rückstand weitgehend aufgeholt hat, befindet sich die Untersuchung der Rolle des Vaters bei der Entstehung von Störungen der kindlichen Entwicklung noch ganz am Anfang (Phares, 1996). Noch immer steht die MutterKind-Beziehung im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses, wenn es darum geht, Ursachen, Folgen und Begleitumstände von Störungen der kindlichen Entwicklung aufzuklären. Die sich in dieser Selektivität manifestierende Tendenz, vor allem die Mütter für Störungen der Entwicklung ihrer Kinder verantwortlich zu machen und die Rolle der Väter zu ignorieren, ist verschiedentlich heftig kritisiert worden (Caplan, 1989; Phares, 1992). Die Untersuchung des väterlichen „Anteils“ an der Entstehung psychischer Fehlentwicklungen von Kindern leistet einen wichtigen Beitrag zur Überwindung dieses Forschungsdefizits und somit zugleich zu einer weiteren wissenschaftlichen Emanzipation der Vaterrolle. Restriktives Verhalten (sek.) Abb. 1: Psychische Auffälligkeit und Geschlecht des Kindes: Zusammenhang mit dem restriktiven Steuerungsverhalten des Vaters Forschungsprojekt In einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt verfolgt die Arbeitsgruppe Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters das Ziel, zu einem besseren Verständnis der Rolle des Vaters und der eigenständigen Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung für die Entwicklung psychischer Störungen von Mädchen und Jungen beizutragen. Bei diesem Vorhaben stützt sich das Projekt auf das umfangreiche Datenmaterial einer prospektiven Längsschnittstudie zur Entwicklung von Risikokindern (Mannheimer Risikokinderstudie, Laucht et al., 2002). Diese Studie befasst sich mit der Entstehung und dem Verlauf von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern, deren Entwicklung durch frühe Belastungen gefährdet ist (Schwangerschaftsund Geburtskomplika- 80 70 Interaktion p = .029 60 50 40 30 20 Jungen Mädchen 10 0 Psychisch unauffällig Psychisch auffällig In den Abbildungen 2 und 3 ist der Verlauf externaler und internaler Auffälligkeiten (oppositionelles, aggressives und hyperaktives Verhalten bzw. ängstlich-depressives Verhalten) von Jungen und Mädchen über das Alter von 2 bis 8 Jahren dargestellt. 3 Abb.2: Verlauf externaler Symptome von 2 bis 8 Jahren: Einfluss der väterlichen Supportivität im Alter von 2 Jahren Summe externaler Symptome Mädchen Jungen 3 3 2,5 2.5 2 * ** n.s 1,5 n.s n.s . n.s 2 Jahre 4 1/2 Jahre 2 1.5 1 1 0,5 0.5 0 0 2 Jahre 4 1/2 Jahre 8 Jahre Vater supportiv 8 Jahre Vater wenig supportiv Abb: 3: Verlauf internaler Symptome von 2 bis 8 Jahren: Einfluss der väterlichen Supportivität im Alter von 2 Jahren Summe internaler Symptome Mädchen Jungen 4 4 3.5 n.s n.s n.s n.s + + 2 Jahre 4 1/2 Jahre 8 Jahre 3.5 3 3 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 1 1 2 Jahre 4 1/2 Jahre 8 Jahre Vater supportiv Vater wenig supportiv In Abhängigkeit davon, ob Väter sich in der Interaktion mit ihren 2-Jährigen mehr oder weniger supportiv (unterstützend, lobend, anregend) verhielten, variierte die Zahl der kindlichen Auffälligkeiten zu den drei untersuchten Zeitpunkten mit 2, 4 ½ und 8 Jahren. Im Vergleich zu Kindern supportiver Väter wiesen Kinder, deren Väter wenig unterstützend mit ihnen interagierten, deutlich mehr Symptome auf. Dieser ungünstige Verlauf ließ sich bei beiden Geschlechtern und unabhängig von der Art der Symptomatik beobachten. Im Alter von 2 Jahren waren Mädchen wenig unterstützender Väter signifikant häufiger external auffällig als die Vergleichsgruppe. Dieser Unterschied vergrößerte sich im Alter von 4 ½ Jahren, war aber im Alter von 8 Jahren nicht mehr signifikant. Ähnliche Unterschiede bestanden auch bei den Jungen, verfehlten aber das statistische Signifikanzniveau. Ein vergleichbares Verlaufsmuster ließ sich bezüglich internaler Auffälligkeitennachweisen, wobei die Unterschiede bei den Jungen deutlicher ausgeprägt waren als bei den Mädchen. Allerdings waren sie in keinem Fall statistisch signifikant. Die Ergebnisse sprechen dafür, die Bedeutung des frühen väterlichen Interaktionsverhaltens für die Entwicklung späterer Verhaltensauffälligkeiten von Kindern geschlechtsspezifisch zu betrachten. Offensicht- lich scheinen Väter in dieser Entwicklungsphase eher bereit zu sein, einen "schwierigen" Sohn zu akzeptieren als eine "schwierige" Tochter. Aus mehreren Studien ist bekannt, dass sich Väter im Spiel mit ihren Söhnen und Töchtern schon frühzeitig sehr unterschiedlich verhalten. Allerdings wurden diese Unterschiede festgestellt, ohne eine mögliche Verhaltensproblematik des Kindes zu berücksichtigen. Unsere Ergebnisse können ein Hinweis darauf sein, dass sich Väter in ihrem frühen Interaktionsverhalten an traditionellen Geschlechtsrollenstereotypen orientieren. Danach wären die Verhaltensauffälligkeiten eines 2-jährigen Kindes mit dem väterlichen Stereotyp von Weiblichkeit weniger vereinbar als mit ihrem männlichen Rollenverständnis. Patricia Trautmann-Villalba, Manfred Laucht (Literatur bei den Autoren) 4 Heile heile Segen, sieben Tage Regen .... Schmerz bei Kindern – mehr als nur ein akutes Problem? gemacht haben, zu dauerhaften Veränderungen in der Schmerzverarbeitung kommt. Dies untersuchen wir derzeit am ZI. Wer erinnert sich nicht an diesen oder einen ähnlichen Spruch, mit dem man in der Kindheit getröstet wurde, wenn man einmal Schmerzen als Folge von kleineren Verletzungen oder auch mal Bauch- oder Kopfschmerzen hatte. Diese akuten Schmerzen, die fast jedes Kind kennt, sind meist von kurzer Dauer. Im Gegensatz dazu leidet ein beträchtlicher Anteil von Kindern jedoch an immer wiederkehrenden Schmerzen, hier spricht man von einem chronischen Schmerzproblem. Je nach Studie sind zwischen fünf und fünfzig Prozent der Kinder von wiederkehrenden bzw. chronischen Schmerzen betroffen. Vor allem Kopfschmerzen und Migräne sowie wiederholt auftretende Bauchschmerzen zählen mit einer Prävalenz von je etwa 10 % zu den häufigsten Schmerzsyndromen im Kindesalter, wobei die Häufigkeit in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Weitere Krankheiten, die bei Kindern mit häufigen Schmerzerfahrungen verbunden sind, sind z. B. chronische juvenile Arthritis und Schmerzen in Folge einer Krebserkrankung. Auch handelt es sich bei einem großen Teil der Betroffenen nicht um eine vorübergehende Erkrankung: So leiden 40 bis 60 % der Kinder und Jugendlichen mit chronischen Kopfschmerzen im Kindesalter auch als Erwachsene noch unter denselben Beschwerden. Über die Schmerzverarbeitung, das subjektive Schmerzerleben und die Schmerzbewältigung von Kindern besteht bisher nur unzureichendes Wissen. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Kinder ihre Schmerzen nicht so ausdrücken und beschreiben können wie Erwachsene. Auch mangelt es noch an speziellen Erhebungsinstrumenten für Kinder. Ein wichtiger Aspekt für den Umgang mit Schmerz scheint zu sein, was Kinder bei ihren Eltern beobachten: Wie gehen Mutter und Vater mit Schmerzen um? Versuchen sie ihre Schmerzen aktiv zu bewältigen und weiter ihren Alltagstätigkeiten nachzukommen oder reagieren sie eher hilflos und passiv? Das Kind beobachtet dieses Verhalten und entwickelt durch Lernen am Modell sein eigenes Schmerzbewältigungsverhalten. Wie wir in eigenen Studien zeigen konnten, scheinen besonders Kinder von Schmerzpatienten bezüglich ihres Schmerzbewältigungsstils viel von ihren Eltern zu übernehmen. Ein ganz wichtiger Faktor ist, wie Eltern konkret auf Schmerzverhalten ihres Kindes reagieren. Wenn dem Kind sehr viel Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt wird, wenn es Schmerzen zeigt, und wenn das Kind in solchen Situationen von unangenehmen Verpflichtungen (Hausaufgaben, im Haushalt helfen etc.) befreit wird, kann dies dazu beitragen, dass Schmerzverhalten gelernt wird und so dazu führen, dass sich ein chronisches Schmerzproblem entwickelt. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass Eltern Kinder bei akuten Schmerzen nicht trösten und unterstützen sollen – entscheidend ist, dass Aufmerksamkeit und Zuwendung nicht ausschließlich dann gezeigt werden, wenn das Kind Schmerzen äußert. Schmerz gleich Schmerz ? - Was ist anders als bei Erwachsenen? Eine wichtige Frage, die erst in den letzten Jahren Beachtung gefunden hat, ist, ob Schmerzen von Kindern und Erwachsenen gleich erlebt werden. Mögliche Unterschiede im Erleben von Schmerz könnten sich dadurch ergeben, dass sich das kindliche Nervensystem noch in Entwicklung befindet, aber auch durch eine unterschiedliche subjektive Bewertung der Schmerzen. Hinsichtlich des ersten Punktes ging man in der Pädiatrie bis in die 70er Jahre sogar davon aus, dass Neugeborene und Säuglinge aufgrund ihres noch undifferenziert entwickelten Nervensystems gar keine Schmerzen empfinden können. Heute weiß man, dass dies nicht zutrifft. Im Gegenteil: Die Schmerzschwellen bei Früh- und Neugeborenen scheinen niedriger und die Schmerzreaktionen stärker ausgeprägt zu sein als bei Jugendlichen und Erwachsenen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es bei Frühgeborenen, die in ihren ersten Lebenswochen aufgrund intensivmedizinischer Versorgung schon vielfältige Schmerzerfahrungen Was bedeuten wiederkehrende Schmerzen für die betroffenen Kinder? Rezidivierende Schmerzen stellen für Kinder und für ihre Familien eine große Belastung dar: Kinder werden durch ihre chronischen Schmerzen oft daran gehindert, ihren normalen Alltagsaktivitäten wie Schulbesuch und Freizeitgestaltung nachzugehen, Eltern reagieren zumeist mit großer Sorge auf die Schmerzen ihres Kindes. Es gibt Untersuchungen, nach denen Kinder mit regelmäßigen Schmerzerfahrungen ängstlicher 5 Kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierte Kurzzeitintervention für Kinder Am Anfang steht zumeist eine ausführliche und verständliche Information von Kind und Eltern über das jeweilige Schmerzproblem und seine möglichen Ursachen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass das Kind während der Behandlung Häufigkeit und mögliche Auslöser seiner Schmerzen mit einem Schmerztagebuch aufzeichnet. Dabei lernt es, sein eigenes Verhalten in Schmerz-, Stress- und anderen relevanten Situationen genau zu beobachten. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, ungünstige Verhaltensweisen erkennen und ändern zu können. Wichtige weitere Bausteine stellen Schmerz- und Stressbewältigungstechniken dar. Hierbei sollen ungünstige Gedanken der Kinder in Stress- und Schmerzsituationen identifiziert und so verändert werden, dass sie einer aktiven Bewältigung dienen („Ich kann selber etwas gegen meine Schmerzen tun!“). Bewährt hat sich als aktive Bewältigungsmaßnahme auch das Erlernen eines Entspannungsverfahrens wie der progressiven Muskelrelaxation nach Jacobsen oder dem Autogenen Training. Diese Verfahren können je nach Alter der Kinder mit Imaginationsübungen und Suggestionen kombiniert werden. Aufgrund der erläuterten Bedeutung des Elternverhaltens sollte auch dieses in der Behandlung berücksichtigt werden. Ziel ist es dabei, den Eltern zu vermitteln, dass ihr Kind bei Schmerzen möglichst seine normalen Aktivitäten beibehalten soll. Ganz wichtig ist zu vermitteln, dass Maßnahmen wie Ruhe und Auszeit bei akuten Schmerzen sinnvoll, jedoch bei wiederholt auftretenden Schmerzen nicht angebracht sind. und depressiver sind und über mehr erlebte Stresssituationen berichten als ihre gesunden Altersgenossen. Wie lassen sich Schmerzen im Kindesalter behandeln? Eine frühzeitige Intervention bei Schmerzen im Kindesalter ist von großer Bedeutung, denn die Annahme, das sich das Schmerzproblem einfach „auswächst“, ist - wie oben schon erwähnt häufig falsch. Neben medizinischpharmakologischen Maßnahmen gehören Verfahren aus der Verhaltenstherapie und -medizin zu den Standardverfahren. Besonders erfreulich ist, dass Kinder von verhaltenstherapeutischen Programmen sogar noch mehr profitieren als Erwachsene. Die verhaltenstherapeutischen Verfahren lassen sich in zwei große Gruppen unterteilen: Biofeedbackverfahren und kognitives Schmerz- und Stressbewältigungstraining. Ein spezielles Therapieprogramm zur Behandlung kindlicher Kopfschmerzen ist beispielsweise von der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Birgit Kröner-Herwig an der Universität Göttingen aus dem Amerikanischen adaptiert worden und wird erfolgreich eingesetzt. Unsere eigene Arbeitsgruppe hat zur Behandlung rezidivierender Bauchschmerzen ein Therapieprogramm entwickelt, das sich durch ein intensives Elterntraining auszeichnet. Anzumerken ist, dass alle bislang verfügbaren Behandlungsprogramme nach dem Vorbild von entsprechenden Programmen für Erwachsene entwickelt wurden. Inwieweit sich deren Effizienz noch verbessern lässt, wenn verstärkt kindgerechte Maßnahmen integriert werden, ist Gegenstand der laufenden Forschung. Katrin Zohsel, Johanna Hohmeister Die Schizophrenie des Kindes- und Jugendalters Ab dem 13. Lebensjahr findet man allerdings einen kontinuierlichen Anstieg der Erkrankungsrate. Ca. 0.07 % der Jugendlichen erkranken an einer Schizophrenie. Die Angaben über die Geschlechterverteilung in der Erkrankungsrate schwanken zwischen einer gleich häufigen Anzahl beider Geschlechter bis zu einer zweifach höheren Rate männlicher Patienten. Prävalenz Weltweit erkrankt rund 0.7-1 % der Bevölkerung an einer schizophrenen Psychose. Die Schizophrenie tritt selten vor dem 12. Lebensjahr auf. Frühere Studien, die höhere Fallzahlen auch bei vorpubertären Kindern beschrieben, waren durch diagnostische Unschärfen geprägt. Insbesondere autistische Störungen ließen sich nicht so eindeutig von kindlichen Formen der schizophrenen Psychose unterscheiden, was heutzutage durch exaktere Diagnosekriterien besser gelingt. Prävalenzraten für kindliche Schizophrenien liegen nach aktuelleren Untersuchungen im Bereich von 1 von 10000 Kinder. Obwohl das Vollbild der schizophrenen Psychose am häufigsten zwischen dem 20. und 28. Lebensjahr auftritt, beginnen die ersten, funktionell bedeutsamen Prodromalsymptome oft schon im jugendlichen Alter. Infolge dessen 6 beeinflusst die Schizophrenie massiv die frühe akademische und soziale Entwicklung der jungen Patienten, die sich in dieser Lebensphase meist noch in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden, in der Regel keine finanzielle Absicherung besitzen und deren Suche nach einer festen Partnerschaft oder Gründung einer eigenen Familie gerade bevorsteht. Daher ist die Früherkennung und optimale Behandlung dieser jungen Patienten eine große Herausforderung an alle professionellen Helfer. Es ist erforderlich, dass ein Team von Fachleuten, zu denen Ärzte, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Pädagogen und RehaBerater gehören, ein gemeinsames Behandlungskonzept erstellt und die Patienten über einen längeren Zeitraum begleitet. testen Sinne als atrophisch zu wertenden Substanzminderungen schizophrener Gehirne werden bei älteren Patienten mit chronischem Krankheitsverlauf in stärkerer Ausprägung gefunden, was auf einen krankheitsassoziierten Prozess des Hirnumbaus hinweist und damit die Hypothese einer zeitlich begrenzten neuronalen Hirnentwicklungsstörung, z. B. auch infolge perinataler toxischer, traumatischer oder infektiöser Hirnschädigungen, eher unwahrscheinlich macht. Ein solch fortlaufender Prozess, insbesondere bei chronischem oder rezidivierendem Krankheitsverlauf, könnte die Zunahme von Defektsymptomen bzw. Negativ-Symptomen (Sprachverarmung, Motivations- und Antriebsminderung, Affektverflachung, Gedächtnisstörungen) bei einem Teil der Patienten erklären. In einer Verlaufsstudie früh erkrankter schizophrener Patienten konnte eine Progression der Hirnatrophie bereits schon im jugendlichen Alter festgestellt werden, insbesondere bei den jugendlichen Patienten mit Zunahme der Negativ-Symptomatik im gleichen Zeitraum. Ätiologie Die Kenntnisse zur Ätiologie der Schizophrenie entstammen im Wesentlichen der Forschung an erwachsenen Patienten. Man geht dabei von einem Kontinuum der kindlichen bis zur erwachsenen Schizophrenie aus, so dass beide in ihrer Ätiologie nicht getrennt betrachtet werden. Die Hypothesen zur Ätiologie beruhen auf epidemiologischen, morphologischen, neurochemischen und psychopharmakologischen Befunden. Kurz zusammengefasst handelt es sich um eine überwiegend polygenetisch determinierte Erkrankung (70-80 % hereditär). Es wurden eine Reihe möglicher Kandidatengene gefunden, deren Funktionen auf Proteinebene zur Zeit untersucht werden. Im Gegensatz zur früheren Dopaminhypothese wird nun die Rolle mehrerer Transmittersysteme bei der Entstehung und Ausprägung der Schizophrenie postuliert. Nach den letzten genetischen und proteinanalytischen Ergebnissen kommt dabei dem glutamatergen System eine besondere Bedeutung zu. Aus dem Wirkprofil moderner Antipsychotika lässt sich zudem eine dopaminergeserotonerge Fehlregulation vermuten. Intensiv wird derzeit auch die Funktion von funktionell relevanten Polymorphismen eines Enzyms (COMT) des Dopaminabbaus untersucht. Ein Zusammenhang eines dieser Polymorphismen (COMT Val[158] Met) mit den exekutiven Funktionen im Bereich der Sprache und Aufmerksamkeit wurden für schizophrene Patienten belegt. Manifestation Nach dem Konzept der Vulnerabilität wirken biologische und psychosoziale Risikofaktoren additiv hinsichtlich Manifestation der Psychose. So ist anzunehmen, dass die besonders schnell wechselnden sozialen Rollen und Anforderungen während der pubertären Entwicklung in Einklang mit den hormonell eingeleiteten Hirnreifungsprozessen eine erhöhte Vulnerabilität des adoleszenten Gehirns hervorrufen. Dieses Zusammenwirken könnte die deutliche Zunahme der Prävalenzrate schizophrener Psychosen im jugendlichen Alter erklären. Als weiterer Risikofaktor kann der Konsum von Cannabis oder anderen Drogen in manchen Fällen den Ausbruch der akuten Psychose triggern. Viele der in den letzten Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des ZI behandelten jugendlichen Patienten mit schizophrener Psychose wiesen einen komorbiden Cannabiskonsum auf. Bei wiederholtem Konsum, auch unter Schutz antipsychotischer Medikation, kam es in der Regel zu einem Rezidiv psychotischer Symptome. Obwohl es noch nicht eindeutig wissenschaftlich geklärt ist, inwieweit der Konsum von Cannabis nicht nur den zeitlichen „Ausbruch“, sondern auch die Entstehung der Schizophrenie beeinflusst, besteht jedoch kein Zweifel an der grundsätzlich bedrohlichen Allianz. Für die Behandlung Jugendlicher ist die Berücksichtigung eines möglichen Drogenkonsums von großer Bedeutung. Die gefundenen hirnmorphologischen Auffälligkeiten sind zahlreich und spiegeln zum Teil auch Epiphänomene wieder. Konsistent ist aber die Befundlage hinsichtlich einer Reduktion grauer Hirnsubstanz und im gleichen Maße eine Volumenzunahme der inneren Liquorräume. Je nach vertretener Theorie werden strukturellen Veränderungen in Bereichen des Thalamus, Hippocampus, Temporallappens, frontalen Kortex und der entorhinalen Region eine besondere Relevanz zugeschrieben. Die im wei- Diagnostik Die Diagnose einer Schizophrenie erfolgt nach den ICD-10 oder DSM-IV-Kriterien, die sich nur hinsichtlich des Zeitkriteriums unterscheiden. So 7 sung für die Behandlung schizophrener Psychosen unter 18 Jahren. Dieser Missstand lässt sich durch verschiedene Umstände erklären, u. a. ist die geringe Anzahl schizophrener Jugendlicher seitens der Umsatzerwartungen der Pharmaunternehmen nur von geringer Bedeutung und Studien bei Kindern sind vermehrten rechtlichen Auflagen und ethischen Bedenken unterworfen. Dennoch wird von den amerikanischen und europäischen Gesundheitsbehörden allgemein eine Intensivierung von kontrollierten Studien bei Kindern gefordert. Als Anreiz hierfür erhalten die Pharmaunternehmen die Aussicht auf eine Verlängerung der Lizenzfristen für ihre bislang schon erfolgreich verkauften Produkte. Zur Zeit läuft eine multizentrische Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Risperidon bei jugendlichen Patienten mit Schizophrenie, in der die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik des ZI das leitende Prüfzentrum ist. wird in der ICD-10 die Diagnose bereits bei Bestehen der Symptome über einen Monat gestellt, während im DSM-IV eine Dauer von mindestens 6 Monaten gefordert wird. Für Kinder und Jugendliche gibt es keine gesonderten Diagnosekriterien, da das klinische Bild im wesentlichen dem der Erwachsenen entspricht. Für die Symptomerfassung und -quantifizierung werden strukturierte und semistrukturierte Interviews und Beurteilungsbögen (z. B. Interview for Childhood Disorders and Schizophrenia [ICDS] bei Kindern, Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children [K-SADS] bei Jugendlichen) verwendet. Essentieller als beim Erwachsenen ist beim kindlichen Patienten die Befunderhebung mit Hilfe externer Informationsquellen, besonders von Eltern und Lehrer. Die Differenzialdiagnose der früh beginnenden Schizophrenie kann mitunter Probleme bereiten, da Kinder und Jugendliche häufiger einen ausgeprägten Anteil affektiver Auffälligkeiten aufweisen. Dadurch wird die Abgrenzung zu den bipolaren affektiven Psychosen, insbesondere zur manischen Episode mit psychotischen Symptomen, erschwert. Auch wenn man die Patienten auf der symptomatischen Ebene während der primären Krankheitsphase ähnlich behandelt, unterscheiden sich die Vorgehensweisen in der Langzeitbehandlung erheblich, weshalb die exakte Diagnose möglichst frühzeitig gestellt werden sollte. Eine Reihe weiterer Störungsbilder, u.a. Asperger-Störung, dissoziative und Zwangsstörungen, sind mit in die Differenzialdiagnose einzubeziehen. Die Erfassung komorbider Symptome oder Störungen (z. B. Drogenkonsum, Störung des Sozialverhaltens oder depressive Symptome) ist letztendlich für die Ausarbeitung eines optimalen Behandlungskonzeptes erforderlich. Dosierungen der Medikamente sind dem körperlichen Entwicklungsstand der Jugendlichen anzupassen. Bei schon „ausgewachsenen“ Jugendlichen entsprechen die Dosierungen aber denen des Erwachsenenalters. Allerdings ist in mehreren Kasuistiken über eine höhere Bereitschaft von Jugendlichen zur Entwicklung von Nebenwirkungen unter neuroleptischer Behandlung berichtet worden. Ein vorsichtiges Eindosieren der Medikation und eine engmaschige Kontrolle häufiger oder schwerwiegender Nebenwirkungsrisiken ist zu beachten. Während die medikamentöse Behandlung den Hirnstoffwechsel normalisieren und damit die Kernsymptome der Schizophrenie reduzieren soll, sollen die übrigen sozialpsychiatrischen, verhaltenstherapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen der Wiederaufnahme einer adäquaten sozialen und akademischen Entwicklung dienen. Diese Maßnahmen sollten möglichst früh nach Remission der akuten Symptome einsetzen und lange Zeit über den akuten Zustand hinaus fortgeführt werden. Die Reintegration der jugendlichen schizophrenen Patienten in normale Lebens- und Bildungsabläufe wirkt der Entwicklung einer stärkeren Negativ-Symptomatik entgegen, erhöht deren Kooperationsbereitschaft mit den medizinischen und sozialen Helfern und schützt sie vor Krankheitsrückfällen. Bei der Reintegration jugendlicher Patienten gelten allerdings die gleichen Regeln wie bei der Eindosierung der Medikation: Eine langsame, stufenweise Anpassung der Anforderungen ist nötig, um die Patienten nicht unnötigen Belastungen, die wiederum krankheitsfördernd wären, auszusetzen. Hierfür wurden z. B. spezielle berufsvorbereitende Förderlehrgänge für psychisch erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene in Bildungs- Therapie Die Behandlung kindlicher oder jugendlicher schizophrener Patienten stützt sich dabei auf die Grundprinzipien einer modernen psychiatrischen Behandlung: a) Neuroleptische Medikation, b) sozialpsychiatrische Interventionen, c) verhaltenstherapeutische Ansätze zur Reduktion bestehender Negativ-Symptome, d) psychoedukatives Training für den Patienten und dessen Angehörigen, in der Regel die Eltern, e) Einleitung rehabilitativer Maßnahmen. Das Spektrum der neueren, oft wirksameren und besser verträglicheren Antipsychotika wird vom Kinder- und Jugendpsychiater im Rahmen eines „off-label-“Gebrauches angewendet. Bislang besteht für keines der neueren, sogenannten atypischen Antipsychotika, die Zulas8 zentren etabliert. Beim Internationalen Bund (IB) in Mannheim wurde vor über 10 Jahren ein solcher Lehrgang in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Mannheim und dem ZI ins Leben gerufen und in dieser Zeit mehr als 100 erkrankten Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Weg in eine berufliche Ausbildung geebnet. Für die medizinische, psychologische und soziale Betreuung von Jugendlichen bedarf es eines guten Feingefühls, einer gewissen Umsicht und Geduld. Der zum Teil noch nicht sehr reif handelnde, fühlende und denkende Jugendliche erfordert eine Gratwanderung zwischen rein krankheitsgebundenem Vorgehen und pädagogischer Steuerung und Beratung mit dem Ziel diesen zunehmend zum selbstverantwortlichen „Manager“ seiner oft langwierigen Erkrankung zu machen. Mit nicht immer kalkulierbaren Handlungen der Jugendlichen, die letztendlich dann doch jugendtypisch sind, muss gerechnet werden, so werden Medikamente im Urlaub oder bei geplanten Partybesuchen mal weggelassen, ein „Joint“ mit Freunden geraucht oder Alkohol zusammen mit den Medikamenten eingenommen. Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme unter Antipsychotika oder Potenzstörungen werden oft nicht angesprochen, führen aber häufig zum eigenverantwortlichen Absetzen der Medikamente. Ein direktes Ansprechen und Ernst nehmen solcher Probleme bewahrt die Compliance der Patienten. Wie Patienten zu Fakiren werden Psychologische Schmerztherapie am Beispiel der Rheumatologie Trotz der beeindruckenden Erfolge der Pharmaforschung in der Rheumatologie und einer relativ großen Anzahl verschiedenartiger Basisund Schmerzmedikamente, die Krankheitssymptome reduzieren, persistieren bei vielen Patienten Schmerz, Beeinträchtigung, Verstimmung, mangelnde Belastbarkeit und geringe Lebensqualität. Nebenwirkungen der Basismedikamente und nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) führen nicht selten zu einem NonCompliance-Problem (Gotzsche, 1989). Es ist daher nicht überraschend, dass viele RAPatienten die Methoden der Verhaltensmedizin nutzen. Eine Studie (Astin et al., 1999), in der über eine Patientenbefragung die Häufigkeit von verhaltensmedizinischen und alternativmedizinischen Behandlungsverfahren erfasst wurde, wies nach, dass 46 % der Patienten, die sich in rheumatologischer Behandlung befanden, nicht medikamentöse Therapieverfahren anwenden. Dabei sind die am häufigsten von Arthritis-Patienten genutzten Behandlungsverfahren sogenannte im angloamerikanischen Sprachraum bezeichnete Mind-Body-Therapien, definiert als psycho-soziale Methoden zur Gesundheitserhaltung (Eisenberg et al., 1998). Im Unterschied zu den Methoden der Alternativmedizin, bei denen ein wissenschaftlicher Effektivitätsnachweis noch aussteht, sind MindBody-Therapien als multimodale verhaltenstherapeutische Methoden in ihrer Effektivität für Arthritis-Patienten nach strengen wissenschaftlichen Kriterien evaluiert worden. Eine multimodale Verhaltenstherapie besteht aus einer Kombination von Patientenschulung, Entspannungsverfahren (z. B. Progressive Muskelrelaxation), Biofeedback zur Reduktion der Muskelspannung sowie kognitiver Verhaltenstherapie (z. B. kognitive Umstrukturierung, Schmerzverarbeitung). Über den Wissenserwerb hinaus sind Entspannung und Biofeedback, operantund kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie essentiell für die Basistherapie der Rheumapatienten (Raspe, 1996), da nichtmedizinische Ursachen eine bedeutende Rolle hinsichtlich der Morbidität, Behinderung und auch der Mortalität spielen (Neville et al., 1995, Ramos-Remus et al., 2000). Prognose Die Prognose der schizophrenen Psychose ist trotz verbesserter Therapiemethoden nur bei einem kleinen Teil der Patienten günstig. Je stärker ausgeprägt eine Negativ-Symptomatik bei Erkrankungsbeginn besteht, je häufiger Rezidive auftreten und möglicherweise, je länger unbehandelte Krankheitsphasen andauern, desto ungünstiger entwickelt sich der Krankheitsverlauf. Daher werden im Rahmen des Kompetenznetzwerkes Schizophrenie Anstrengungen unternommen, kindliche und jugendliche Populationen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko aufweisen, frühzeitig vor Erstmanifestation der akuten Psychose zu charakterisieren und, im Sinne einer Präventionsmaßnahme, mit Medikamenten oder verhaltenstherapeutischen Programmen zu behandeln. Athanasios Maras Impressum Herausgeber: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Patientenschulung Die Patientenschulung „Arthritis Self-Management Programm (ASMP)“ ist seit 1977 in den USA ein obligater Therapiebaustein zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Mit diesem Programm konnte eine Reduktion von 68159 Mannheim, J 5 Redaktion: Dr. Marina Martini Referat Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0621/17 03-742, -749 Telefax: 06 21/17 03-755 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.zi-mannheim.de Nachdruck nur mit Genehmigung 9 Schmerz und Depression bei Erhöhung der physischen Aktivität erreicht werden, obwohl die medikamentöse Behandlung unverändert war (Lorig et al., 1983). Diese Effekte waren weder über rheumatologische Vorträge (Kaye & Hammond, 1978), noch ein krankheitsspezifisches Handbuch (Vignos et al., 1976) oder schriftliche Materialien, die die Patienten mit nach Hause bekamen (Lorish et al., 1985) zu erzielen. Erst die Gruppendynamik, die unter den Teilnehmern im Seminar entsteht, führt dazu, dass der Wissenserwerb zu Veränderungen im Erleben und Verhalten führt. Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGfRh) entwickelte seit 1989 diagnosespezifische Patientenschulungsprogramme für Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) (Lange et al., 1988), systemischem Lupus erythematodes (Thieme et al., 1996), Fibromyalgie (Brückle et al., 1998), Vaskulitis und juveniler RA, da nachgewiesen werden konnte, dass individualisierte Patientenschulung höhere Effekte als standardisierte Patientenschulung erbringt (Lorish et al., 1985). Die Patientenschulungsprogramme der DGfRh umfassen 5-6 Module, die sich mit Hilfe von standardisierten Materialien mit den Themen: Diagnostik, medikamentöse, physio- und ergotherapeutische sowie psychologische Behandlung der rheumatischen Erkrankung beschäftigen. Alle Programme verfolgen die Methodik der themenzentrierten Interaktion. Rheumatologen und Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten führen die Patientenschulung gemeinsam in ambulanten Kleingruppen durch. Die Kompetenz zur Durchführung der Patientenschulung erlangen die sog. Trainer in einem von der DGfRh zertifizierten Train-the-TrainerSeminar. Der Erkenntnisgewinn durch die Patientenschulung führt zur Erhöhung des selfcare-behaviors im Sinne der Erhöhung der Selbsteffizienz (Lorig et al., 1993), der Verbesserung des psychologischen Status im Sinne der Reduktion der affektiven Verstimmung (Langer & Birth, 1988; Lamparter-Lang, 1989; Lindroth et al., 1989; Lorig et al., 1985, 1987) und Verbesserung des Gesundheitsstatus durch den Aufbau von Gesundheitsverhalten mittels Kenntnis um schubauslösende Bedingungen sowie zur Erhöhung der Compliance, die sich in der regelmäßigen Medikamenteneinnahme und der eigenverantwortlich durchgeführten Krankengymnastik sowie in der Zunahme des Gelenkschutzverhaltens (Wetstone et al., 1985; Lindroth et al., 1989) zeigt. Dies trägt letztlich zu einer Kostensenkung im Gesundheitswesen bei (Lorig et al., 1996). In der Patientenschulung kommt es daher wesentlich darauf an, Grundüberzeugungen der Patienten über die Kontrollierbarkeit ihrer Leiden zu fördern (Basler, 1992). Entspannung und Biofeedback Ausgehend vom Teufelskreis Schmerz – Spannung- Stimmung - Schmerz sind muskuläre Verspannungen bei vielen chronischen Schmerzsyndromen von großer Bedeutung. Die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, das Autogene Training nach J. H. Schulz sowie die Rückmeldung der Muskelspannungswerte mittels EMG (EMG-Biofeedback) gelten als die wichtigsten Verfahren zur Veränderung psychophysiologischer Reaktionsmuster. Als Therapieziel wird eine Reduktion der symptomspezifischen Hyperreagibilität sowie die Löschung der situativ und stressbedingten Auslösung der psychophysiologischen Reaktion angestrebt. Entspannungsund Biofeedbackverfahren werden folglich im Sinne einer Stressbewältigungsmaßnahme vermittelt. Nach nur acht Sitzungen sind signifikante Therapieerfolge zu verzeichnen (Flor et al., 1996). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie In Übereinstimmung mit dem kognitivverhaltensorientierten Modell von Schmerz, das die Bedeutung kognitiver, affektiver und verhaltensbezogener Faktoren sowie von sensorischen Aspekten für das Schmerzerleben hervorhebt, beinhalten kognitiv-verhaltensorientierte Schmerzbehandlungsprogramme in der Regel mehrere therapeutische Verfahren, deren Fokus auf einer der drei Ebenen des Schmerzerlebens liegt. Der Schwerpunkt der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie liegt auf der Vermittlung der Bewältigungsfertigkeiten, die es dem Patienten ermöglich sollen, effektiver mit seinen Schmerzen umzugehen. Dies soll durch eine Veränderung der schmerzauslösenden und - aufrechterhaltenden Kognitionen und Emotionen erreicht werden. Die Modifikation schmerzrelevanter Überzeugungen des Patienten wird sowohl durch kognitive Strategien wie die kognitive Umstrukturierung und Problemlösetraining, durch die Aneignung neuer Schmerzbewältigungsstrategien wie Entspannung, Aufmerksamkeitsumlenkung, Vorstellungsbilder etc. als auch durch die unmittelbare Erfahrung der Beeinflussbarkeit des Schmerzerlebens, die wiederum die Selbstwirksamkeitserwartung des Patienten fördert, angestrebt. Die Therapieziele bestehen in der Reduktion von Gefühlen der Hilflosigkeit und Unkontrollierbarkeit (Flor et al., 1992). Operant-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie Zugrunde liegt das operante Schmerzmodell, das davon ausgeht, dass Schmerz zwar ursprünglich reflexhaft auftritt, aber zunehmend durch entsprechende Verstärkerbedingungen 10 psychologischen Schmerztherapie erreichte Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung über ein Zeitraum von 12 Monaten stabil bleibt, tendieren RA-Patienten zu einer Verringerung der erreichten Therapieeffekte, wie Schmerzreduktion und psychologischer Verstimmung, nach Behandlungsabschluss. Die höhere Rückfallgefährdung der RA- und OA-Patienten erklärt Bradley mit der Erfahrung der progressiven Veränderungen an Gelenken und Synovia. Deshalb, so fordert Bradley, sollte eine größere Anstrengung darauf verwendet werden, Patienten mit RA und OA zu helfen, sich an die Veränderungen anpassen zu können, die bedingt durch die Progression der Erkrankung nach Behandlungsabschluss auftreten werden. Neben diesen interessanten Überblicksarbeiten finden sich in der Literatur zur Effektivität der psychologischen Schmerztherapie bei RA drei Metaanalysen (Mullen et al., 1997, SuperioCabuslay et al., 1996; Astin et al., 2002). Mullen et al. (1997) analysierten 15 Studien. Sie kamen zu dem Schluss, dass psychoedukative Interventionen zu einer Verbesserung der Ergebnisse bei RA- und OA-Patienten beitragen können, obwohl sie feststellten, dass die Effektstärken (0.20 für Schmerzintensität, 0.27 für Depression, 0.09 für Beeinträchtigung) relativ klein waren. Eine 1996 veröffentlichte Metaanalyse (Superio-Cabuslay et al., 1996) verglich in kontrollierten, randomisierten Studien die Effektstärken von Patientenschulungsprogrammen (N=19) und von NSAR-Therapien (N=28). Die gewichtete mittlere Effektstärke der Schmerzintensität nach Patientenschulung betrug 0.17 und 0.66 nach NSAR-Therapie, die Effektstärke der Funktionsfähigkeit nach Patientenschulung 0.13 und 0.34 nach NSARTherapie, die Effektstärke der Anzahl schmerzhafter Gelenke nach Patientenschulung 0.34 und 0.43 nach NSAR-Therapie. Da die Patienten, die an dem Patientenschulungs-programm teilnahmen, auch Medikamente erhielten, repräsentieren die angegebenen Patientenschulungseffektstärken über eine medikamentöse Behandlung hinausgehende zusätzliche Effekte. Wenn die medikamentöse Behandlung mit der Patientenschulung kombiniert wird, erhöhen sich die Behandlungseffekte hinsichtlich der Schmerzintensität um 25.8 %, die der Funktionsfähigkeit um 38 % und die der Anzahl schmerzhafter Gelenke um 79 % im Unterschied zur NSAR-Behandlung an sich. Astin et al. (2002) untersuchten die Effizienz der psychologischen Schmerztherapie bei RA. Einschlusskriterien für die in die Metaanalyse einbezogenen Studien waren: Randomisierung, Warte-Liste-Bedingung oder Kontrollgruppen, die eine gewohnte Behandlung erfuhren, Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift mit operant kontrolliert wird (Fordyce, 1976). Positive (z.B. übermäßige Aufmerksamkeit des Partners auf den gezeigten Schmerz) oder negative Verstärkung (z.B. Vermeidung unangenehmer Aktivitäten) führen zu vermehrtem Schmerzverhalten, zu einer übermäßigen Wahrnehmung der Schmerzintensität, die mit der Entwicklung des Schmerzgedächtnisses einhergeht (Flor, 2002) sowie mit einer Einschränkung der Aktivität, die sekundär physische Probleme, wie Muskelverspannung und Immobilität zur Folge haben. Die Hauptziele einer operanten Schmerztherapie sind daher (a) der Abbau von Schmerzverhalten und (b) der Aufbau von gesundem bzw. schmerzinkompatiblem Verhalten nennen. Zum Erreichen dieser Therapieziele kommen ausschließlich Strategien operanten Lernens in Betracht, wie die systematische positive Verstärkung von gesundem Verhalten, Ausbleiben der positiven Verstärkung von Schmerzverhalten, zeit- statt schmerzkontingente Planung von Aktivitäts- und Ruhephasen sowie der Medikamenteneinnahme. Ein wichtiger Bestandteil des Programms sind definierte physiotherapeutische Übungen zur Wahrnehmungsschulung und Steigerung der Aktivität. Die primären Therapieziele sind die Veränderung des Aktivitätsniveaus, des Vermeidungsverhaltens und der Medikamenteneinnahme. (Flor & Birbaumer, 1994; Thieme et al., 2003). Die Reduzierung der Schmerzintensität ist nicht als primäres Therapieziel definiert worden (Fordyce et al., 1985). Wirksamkeit der Schmerztherapie Rheumatoide Arthritis Verschiedene Übersichtsarbeiten zur Effektivität psychologischer Schmerztherapie bei RA zeigen trotz unterschiedlicher methodischer Qualität der Arbeiten positive Ergebnisse in der Schmerzreduktion (McCraken, 1991; Parker et al., 1993). Bradley und Alberts (1999) schlussfolgern, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention „gut-begründete“ Schmerzverarbeitungsstrategien repräsentieren. Keefe und Van Horn (1993) heben hervor, dass zwar kognitivverhaltenstherapeutische Interventionen in kurzer Zeit Schmerz und Beeinträchtigung reduzieren können, dass aber die Notwendigkeit besteht, effektive Strategien zur Rückfallprävention zu identifizieren, da die Mehrheit der Studien eine Aufrechterhaltung der Therapieziele und -erfolge in der 8-Monatskatamnese nicht demonstrieren konnte. Bradley (1994) differenziert zwischen Patienten mit chronischem Rückenschmerz und Patienten mit RA bzw. Osteoarthritis (OA). Während bei Patienten mit chronischem Rückenschmerz, die mit Hilfe der 11 Wiederaufnahmehemmer, die direkt oder indirekt Auswirkungen auf die HPA-Achse haben sollen, mit dem Ziel, über die Regulation der HPA-Achse die Hauptsymptome des FMS, wie Schmerz, Schwäche, Schlafstörungen und psychologischen Stress zu beeinflussen (Crofford, 1996). Die nicht-pharmakologischen Behandlungsmethoden des FMS umfassen vor allem die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie, Patientenschulung, Physiotherapie sowie Akupunktur. Studien zur Effektivität kognitiv - verhaltenstherapeutischer Behandlungsprogramme konnten eine Veränderung schmerzbezogener Kontrollüberzeugungen und Selbstinstruktionen nachweisen, die wiederum mit einer Reduktion der Schmerzintensität und der Funktionsbeeinträchtigung sowie einer Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit einhergingen (Nicassio et al., 1997; Nielson et al., 1992; Okifuji & Turk, 1999). Begutachtung, ein Behandlungsverfahren, das über die einfache Informationsvermittlung hinausgeht und separate Daten zur Patientenbeschreibung. Von 64 Studien gingen 24 in die Metaanalyse ein. Signifikante Effektstärken wurden unmittelbar nach der Therapie für die Schmerzintensität (0.22), die Funktionsbeeinträchtigung (0.27), den psychologischen Status (0.15), Schmerzbewältigung (0.46) und Selbsteffizienz (0.35) gefunden. In der 8,5Monatskatamnese fanden sich ebenfalls signifikante Effektstärken für schmerzhafte Gelenke (0.33), den psychologischen Status (0.30), Schmerzbewältigung (0.52). Schmerzintensität und Beeinträchtigung sowie die Selbsteffizienz waren über die Zeit nicht stabil. Die Ergebnisse der Metaanalysen, deren gute Ergebnisse stellvertretend auch für zahlreiche deutsche Therapiestudien angesehen werden können, zeigen die Bedeutsamkeit psychologischer Interventionen in der multidisziplinären Behandlung der RA. Eine Meta-Analyse (Rossy et al., 1999) von 49 FMS-Behandlungsstudien untersuchte die Effizienz von pharmakologischen im Vergleich zu nicht-pharmakologischen Therapieformen (kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie und Physiotherapie) hinsichtlich 4 Kriterien: physischer Status, subjektiv geschilderte FMS-Symptome, psychologischer Status und Funktionsfähigkeit in alltäglichen Belastungssituationen. Dabei fanden sich bei den kontrollierten Studien mit Antidepressiva signifikante Verbesserungen hinsichtlich des körperlichen Zustandes und der subjektiv geschilderten FMS-Symptome. Alle Studien zur kognitivverhaltenstherapeutischen Schmerztherapie wiesen signifikante Verbesserungen in allen vier Kriterien auf im Unterschied zur Physiotherapie (primär krankengymnastischen Übungen), die keine signifikanten Verbesserungen der Funktionsfähigkeit erreichte. Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie scheint daher bezüglich der Verbesserung der subjektiv geschilderten FMS-Symptome effektiver zu sein als pharmakologische Therapien. Ein ähnlicher Trend fand sich in Bezug auf die Funktionsfähigkeit. Auch hier zeigte sich die kognitivverhaltenstherapeutische Schmerztherapie den pharmakologischen Therapieformen überlegen. Diese Meta-Analyse legt nahe, dass eine optimale Therapie für FMS den Schwerpunkt auf die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie legen sollte. Zusätzlich zur psychologischen Schmerztherapie sollte die medikamentöse Behandlung zur Beeinflussung der Schlafsymptomatik einbezogen werden. Fibromyalgie-Syndrom Das FMS ist das rheumatische Krankheitsbild, das sowohl hinsichtlich der Ätiopathogenese als auch der Therapie am ungeklärtesten ist. Der FMS-Patient befindet sich in der Situation, nicht nur akzeptieren zu müssen, dass die Ursache seiner Erkrankung durch seinen Arzt nicht geklärt werden kann, sondern auch hinnehmen zu müssen, dass es weder eine medikamentöse noch chirurgische oder anderweitig medizinische Behandlungsmöglichkeit für ihn gibt. Die sofortige Akzeptanz dieser sowohl für den Arzt als auch für den Patienten schwierigen Situation wäre ein Ausdruck der Hilflosigkeit, Resignation, schließlich der Depression. Daher ist es nicht verwunderlich, dass FMS-Patienten versuchen, alles zu unternehmen, um Behandlungsmöglichkeiten für sich zu finden. Die Folge sind eine hohe Anzahl von Arztbesuchen. Die Kosten für das Gesundheitswesen hinsichtlich der Häufigkeit der Arztbesuche sind in Großbritannien und den USA erfasst worden. Der durchschnittliche Jahresbetrag pro FMS-Patient betrug im Jahr 1996 $ 2247 (Wolfe et al.,1996), im Vergleich zur Rheumatoiden Arthritis mit einem Betrag von $ 1372 (Cooper, 2000) im selben Jahr. Ausgehend von den erfolgreichen therapeutischen Interventionen bei chronischem Rückenschmerz und RA, die die Krankheitsaktivität beeinflussen und damit zur Reduktion der Kosten im Gesundheitswesen beitragen, wurden auch für das FMS unterschiedliche Behandlungsstrategien entwickelt und auf ihre Effizienz geprüft. Die Pharmakotherapie des FMS umfasst neben NSAR, Muskelrelaxantien sowie trizyklische Antidepressiva und Serotonin- Eine unkontrollierte Studie (Okifuji & Turk, 1999) zur Effektivität einer ambulanten interdisziplinären Behandlung mit kognitiv-verhaltens12 therapeutischem Schwerpunkt an 67 FMSPatienten wurde über einen Zeitraum von vier Wochen mit insgesamt 18 Sitzungen zu je 90 Minuten durchgeführt. Es zeigten sich signifikante Verbesserungen in der Schmerzstärke, Beeinträchtigung, Lebenskontrolle, der affektiven Verstimmung, der Depression, der wahrgenommenen physischen Beeinträchtigung und auch hinsichtlich des zuwendenden Verhaltens der Bezugsperson. Klinisch signifikante Verbesserungen in der Schmerzreduktion, die über den Reliabilitäts-Veränderungs-Index (Jacobson et al., 1984) erfasst wurden, fanden sich bei 42 % der Stichprobe und konnten auch über 6 Monate aufrechterhalten werden. Therapieerfolg Als Prädiktoren für den Therapieerfolg bei verschiedenen Schmerzsyndrome finden sich für die operante Schmerztherapie eine hohe Schmerzintensität, hohe Beeinträchtigung und Kooperationsbereitschaft der Partner. Für das Biofeedback konnten Flor & Birbaumer (1993) nachweisen, dass Patienten mit einer ausgeprägten Hyperreagibilität schmerzrelevanter Muskeln weniger von der EMG-BiofeedbackBehandlung profitierten als Patienten, die weniger reagibel sind. Für die kognitive Therapie wurden die Dauer der Zeit seit der Diagnosestellung, individuelle Verarbeitungsressourcen, maladaptives und adaptives Schmerzverarbeitungsverhalten (Sinclair & Wallston, 2001) sowie das familiäre Umfeld (regiert es überkontrolliert, desorganisiert, oder bestrafend), des weiteren kognitive Verarbeitungsstrategien und negatives Denken als Prädiktoren erfasst. Dabei korrelierte die Abnahme des negativen Denkens mit der Reduktion der Depression (Tota-Faucette et al., 1993). Eine eigene kontrollierte Studie zur Effektivität einer stationären operant-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie (Thieme et al., 2003) mit 61 FMS-Patienten wurde über einen Zeitraum von fünf Wochen mit täglicher Intervention zu je 90 Minuten durchgeführt und gegen ein medizinisches Standardprogramm, bei dem eine medikamentöse Behandlung (Antidepressiva) mit physiotherapeutischen Methoden, insbesondere Entspannungsübungen kombiniert wurden. Noch nach 15 Monaten zeigten sich für die operant-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie signifikante Verbesserungen mit hohen Effektstärken in der Schmerzintensität (2.14), Beeinträchtigung (2.50), affektive Verstimmung (1.74) sowie in den Verhaltensvariablen, wie Schmerzverhalten (1.66), zuwendenden Partnerreaktionen (0.69), Medikamenteneinnahme (0.90), Schlafverhalten (0.86) im Unterschied zum Standardprogramm. Die operante Schmerztherapie reduzierte die Anzahl der Arztbesuche um 53.5 % (ES=1.16) und die Anzahl der Krankenhaustage um 80.3 % (ES=0.70) verglichen mit dem Zeitpunkt vor der Therapie. Diese Veränderungen führten zu einer Kostenreduktion von $ 3933 pro Patient pro Jahr bzgl. der Krankenhauskosten und zu einer Reduktion von $ 1840 pro Patient pro Jahr bzgl. der Kosten der Arztbesuche. Im Unterschied dazu kam es bei der Gruppe mit dem medizinischen Standardprogramm zu einer Zunahme der Anzahl der Arztbesuche um 32.2 % und der Anzahl der Krankenhaustage um 80.2 %. Die Gruppe mit dem medizinischen Standartprogramm zeigte einen signifikanten Kostenzuwachs von $ 1905.50 pro Patient pro Jahr bzgl. der Krankenhauskosten und $ 442 pro Patient pro Jahr bzgl. der Kosten der Arztbesuche. Klinisch signifikante Verbesserungen in der Schmerzreduktion, die über den Reliabilitäts-Veränderungs-Index erfasst wurden, fanden sich bei 65 % der Stichprobe und konnten auch über 15 Monate aufrechterhalten werden. Zusammenfassung Mit einem zunehmend besseren Verständnis des Phänomens Schmerz ist die Entwicklung zahlreicher neuer medizinisch-somatischer sowie verhaltensmedizinischer Interventionen einhergegangen. Metaanalysen weisen die Rolle und die Bedeutsamkeit der psychologischen Schmerztherapie innerhalb eines interdisziplinären Therapieansatzes nach. Es bleibt allerdings festzustellen, dass über differentielle Indikationen und Effizienz noch wenig bekannt ist. Die Identifikation von weiteren therapiespezifischen Indikationskriterien bleibt zukünftiger Forschung vorbehalten. Aber auch die Umsetzung der bisherigen Forschungsergebnisse sowie die Integration der hochwertigen Therapieprogramme ist in Deutschland nur in Ausnahmefälle gelungen. So stellte das Rheumaforschungszentrum, Berlin (Zink et al., 2001) in ihrer bundesweiten Kerndokumentation fest, dass nur 0.3 % der Rheumapatienten eine psychologische Schmerzbehandlung erfahren, im Unterschied zu den USA, wo 62 % der Patienten systematisch erlernen, mit der Krankheit zu leben. Am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit wird in naher Zukunft dieser Forschungs- und Versorgungsbereich zunehmend ausgebaut. Kati Thieme (Literatur bei der Autorin) 13 Das Kompetenznetz Demenzen Fach- und Hausärzte, Industrieunternehmen und die Deutsche Alzheimergesellschaft. Im Februar 2002 startete das Kompetenznetz Demenzen. Es ist eines von zur Zeit 16 Kompetenznetzen in der Medizin, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Die zunächst vorgesehene Förderung beträgt fünf Jahre mit einer Zwischenbegutachtung nach 2,5 Jahren. Demenzen sind eines der größten Probleme mit denen sich das Gesundheitssystem heute und in Zukunft in Anbetracht der steigenden Lebenserwartung und der starken Altersabhängigkeit von Demenzen auseinandersetzen muss. Zur Zeit lässt sich bei Demenzen das Fortschreiten der Symptome verzögern und der Krankheitsverlauf positiv beeinflussen, eine Heilung ist jedoch in den meisten Fällen nicht möglich. Therapien der Zukunft werden ihre Grundlage im zunehmenden Verständnis der unterliegenden Pathophysiologie haben. Es ist bekannt, dass die Entstehung nicht löslicher Proteinkomplexe, bestehend aus Aß1-42, Synuclein oder Tau-Protein sowohl bei der Alzheimer Demenz, aber auch bei anderen Demenzen, wie der LewyKörperchen Demenz und der frontotemporalen Demenz eine entscheidende Rolle spielt. Hieraus ergeben sich eine Reihe von vielversprechenden therapeutischen Ansätzen auf molekularer Ebene, die jedoch zur Zeit noch nicht zur Verfügung stehen. Ziele Das Kompetenznetz Demenzen verfolgt mehrere Ziele. Es soll bundeseinheitliche Richtlinien für die Diagnostik und Therapie demenzieller Erkrankungen entwickeln, die rasche Etablierung neuer Therapieformen ermöglichen, den Austausch zwischen Wissenschaftlern und Praktikern ermöglichen und ein Höchstmaß an Versorgungsqualität für betroffene Patienten sicherstellen. Ein vertikales Netz soll aufgebaut werden, das pflegende Angehörige, Hausärzte, Nervenärzte, Allgemeinkrankenhäuser, psychiatrische Kliniken und Universitätskliniken, aber auch die allgemeine Öffentlichkeit umfasst und das die Kommunikation und den lückenlosen Informationsfluss zwischen diesen Bereichen sicher stellt. Hier wurde bereits ein Modellprojekt in Niedersachsen durchgeführt, das zunächst die hausärztliche Versorgung in unterschiedlichen Versorgungsregionen (Stadt, Land) erfassen und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen soll. Dieses vertikale Netz wird durch eine sich im Aufbau befindende Infrastruktur im Bereich der Informationstechnologie erweitert. Das Kompetenznetz hat zur Zeit eine vorläufige Homepage, die unter http://www.kompetenznetz-demenzen.de aufgerufen werden kann. Ebenfalls unter dieser Adresse wird die endgültige Homepage in kurzer Zeit zu finden sein. Hier sollen niedergelassenen Ärzten, aber auch pflegenden Berufen und Angehörigen, aktuelle Informationen schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden und es wird die Möglichkeit geben sich mit Fragen an Experten zu wenden. Auf den internen Seiten der Homepage wird den Mitgliedern des Kompetenznetzes eine Kommunikationsplattform geboten, die schnellstmöglichen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Zentren ermöglicht. Schließlich wird mit Hilfe eines Pseudonymisierungsdienstes, der von der ebenfalls BMBF geförderten Telematikplattform zur Verfügung gestellt wird, die elektronische Dateneingabe erfolgen, so dass in Zukunft ganz auf gedruckte CRFs verzichtet werden kann. So wird eine möglichst rasche elektronische Datenauswertung ermöglicht. Organisationsstruktur Im Kompetenznetz Demenzen sind bundesweit 14 universitäre Einrichtungen zusammengeschlossen, die führend auf dem Gebiet der Demenzforschung sind. Mit Prof. Dr. Dr. Fritz A. Henn als Sprecher befindet sich die Leitung des Kompetentnetzes am Zentralinstitut in Mannheim. Hier ist Sitz der Zentrale in der die organisatorischen Belange des Netzes geklärt werden. Die Zentrale des Kompetenznetz Demenzen ist Schnittstelle für den internen und externen Datenaustausch. Sie ist zum einen verantwortlich für alle Netzübergreifenden Aktivitäten: Planung, Konzipierung und Durchführung in enger Kommunikation mit den Kompetenznetz-Teilnehmern (Synchronisierung der Abläufe). Zum anderen ist sie verantwortlich für die Sicherstellung eines reibungsfreien Informationsflusses innerhalb des Netzes und steht als Ansprechpartner für alle Interessierte außerhalb des Netzes zur Verfügung. Forschungsprojekte Die Forschungsprojekte des Kompetenznetzes Demenzen sind in drei Module unterteilt: Ebenfalls am Kompetenznetz beteiligt sind Allgemeinkrankenhäuser, niedergelassene 14 E3 wird eine zentrale DNA Datenbank für Demenzen etabliert, um so genetische Risikofaktoren für verschiedene Demenzformen zu identifizieren und daraus resultierend pharmakogenetische Faktoren zu detektieren, die in Zukunft bei der Behandlung eine wichtige Rolle spielen könnten. Zusammenfassend sieht das Kompetenznetz Demenzen seine Aufgabe darin die Versorgung Demenzkranker zu verbessern, indem diagnostische Methoden verbessert, Therapien optimiert und in unserem Gesundheitssystem Strukturen etabliert werden, die möglichst kurze Wege von der ersten Verdachtsdiagnose bis zur spezifischen Behandlung und optimalen langfristigen Versorgung gewährleisten. Hierbei kommt neuen Methoden aus der Informationstechnologie eine entscheidende Rolle zu, da sie die Möglichkeit schnellster Informationsvermittlung und Zugang zu einem großen Publikum bieten. Modul E1: Früherkennung und Diagnostik Leitung in Erlangen, Prof. Dr. Johannes Kornhuber Im Rahmen dieses Moduls werden mit standardisierten Methoden verschiedene diagnostische Untersuchungen durchgeführt, die psychometrische Verfahren, biochemische Marker und bildgebende Verfahren einschließen. Ziel ist es, Standards zu definieren, die eine Grundlage für bundesweit einheitliche Untersuchungsmethoden bilden können und zur Verbesserung der Diagnostik früher Formen von Demenzen beitragen können. Zusätzlich soll bei leichter kognitiver Störung die prädiktive Wertigkeit der diagnostischen Verfahren für die Vorhersage einer späteren Demenzerkrankung bestimmt werden. Untersucht werden neurochemische Demenzmarker im Blut und Liquor, wobei den Tau-Proteinen und den ß-Amyloiden eine besondere Rolle zukommt. Kernspintomographisch werden neben einer anatomischen Untersuchung auch eine Volumetrie und eine Spektroskopie durchgeführt. Die neurochemisch und kernspintomographisch erhobenen Befunde werden dann mit den psychometrischen Testvariablen korreliert. Weiteres Ziel der umfangreichen Testungen ist der Vergleich verschiedener Testverfahren und die Empfehlung möglichst einfacher und präziser diagnostischer Instrumente für die Praxis. Das Kompetenznetz Demenzen hat aktuell einen Verein gegründet, der in das Vereinsregister Mannheim als e. V. eingetragen ist. Dies schafft eine gute Grundlage, um das Kompetenznetz Demenzen auch nach der Förderung des BMBF weiterführen zu können. Petra Hubrich Modul E2: Therapie Leitung in Berlin, Prof. Dr. Isabella Heuser Hier wird eine Therapiestudie bei Demenzpatienten und bei Patienten mit leichter kognitiver Störung durchgeführt, die synergistische Effekte zwischen zwei etablierten medikamentösen Therapien, Galantamin und Memantine, nachweisen soll. Untersucht werden soll insbesondere, ob bei Patienten mit leichter kognitiver Störung durch eine frühzeitige Behandlung die Konversionsrate zur Demenz statistisch signifikant reduziert werden kann. Für diese Studie wurde eigens eine Firma für das Monitoring und die Qualitätssicherung akquiriert. Außerdem soll eine nationale Infrastruktur etabliert werden, die als Plattform für die rasche und effektive Durchführung von Phase 2- und 3-Studien dienen kann. Kompetenznetz Demenzen Geographische Verteilung der beteiligten Universitäten Modul E3: Epidemiologie und Genetik Leitung in Bonn, Prof. Dr. Wolfgang Maier Im Modul E3 wird die Früherkennung und hausärztliche Versorgung von Demenzkranken an sechs beteiligten Standorten im Längsschnitt erfasst. Studien zeigen, dass Hausärzte die Demenz oder Frühsymptome einer Demenz zu selten diagnostizieren. Daher werden alle Patienten zwischen 75 und 89 Jahren, die den Hausarzt konsultieren, gefragt, ob sie an der Studie teilnehmen wollen und nach 18 und 36 Monaten nachuntersucht. Ebenfalls im Modul 15 Betriebliche Suchtprävention Projektergebnisse pekte zu Suchtmitteln, der betrieblichen Suchtprävention, als auch epidemiologische Daten erfasste. In der letzten Ausgabe von „ZI Information aktuell“ gaben wir einen Überblick über die historische Entwicklung der betrieblichen Suchtprävention bis heute. Wir berichteten über den gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand und hielten fest, dass nach wie vor großer Bedarf an der weiteren Erforschung der Epidemiologie von Substanzkonsum in Betrieben und der Evaluation der Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz besteht. Wie bereits angekündigt, wollen wir nun Ergebnisse einer Fortbildungsmaßnahme in einem großen Chemieunternehmen präsentieren. Ziel der Interventionsmaßnahme war die Vermittlung theoretischer Informationen zu Sucht und betrieblicher Suchtprävention und die praktische Erarbeitung von Gesprächsführungskompetenzen im Umgang mit suchtmittelauffälligen Auszubildenden. Ein Schwerpunkt wurde hierbei entsprechend der Altersklasse auf Designer- und illegale Drogen gelegt. Dies geschah mit der Absicht, Personen, die im direkten Kontakt mit Auszubildenden stehen, zu befähigen, Jugendliche frühzeitig auf negative Konsequenzen ihres Konsumverhaltens aufmerksam zu machen und die Inanspruchnahme entsprechender inner- und außerbetrieblicher Hilfsmaßnahmen zu fördern. Entsprechend dieser Zielsetzung ergaben sich verschiedene Themenschwerpunkte. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die vermittelten Themen und die angewandten Methoden. Methodik Im Rahmen einer Pilotstudie haben wir in einem großen Chemieunternehmen eine Fortbildungsmaßnahme für Führungskräfte zur betrieblichen Suchtprävention bei illegalen Drogen mit Schwerpunkt Designerdrogen (Partydrogen, synthetische Drogen) durchgeführt und evaluiert. Weiterhin haben wir Informationen zu Einstellungen der Teilnehmer zur betrieblichen Suchtprävention sowie zum Kenntnisstand zum Versorgungssystem Sucht erhoben. Dieser Ansatz soll im folgenden Beitrag genauer beschrieben und ausgewählte Ergebnisse berichtet werden. Evaluation Ein Feedbackbogen, der von den Teilnehmern im Anschluss an die Durchführung der Workshops ausgefüllt wurde, erfasst Informationen zum Informationsgehalt, zur Verständlichkeit des Inhalts, zur Präsentation der Inhalte, zur Anwendbarkeit/Praxisbezug, zur Miteinbeziehung der Teilnehmer, zur Übereinstimmung mit den eigenen Erwartungen und zur Arbeitsatmosphäre. Die Teilnehmer gaben hierbei eine anonyme Bewertung ab. Stichprobe Es nahmen insgesamt 53 Führungskräfte an der Untersuchung teil. Hiervon hatten 41 eine der bis dato angebotenen Weiterbildungen zur Suchtprävention besucht und 12 hatten bisher noch nie an Seminaren bzw. Fortbildungen zum Themengebiet betriebliche Suchtprävention teilgenommen. In einem weiteren Fragebogen wurde darüber hinaus erfasst, welche Einstellungen die Mitarbeiter im Hinblick auf die Themen Sucht und Suchtprävention vertreten, wie sie sich im Umgang mit einem suchtmittelauffälligen Mitarbeiter verhalten würden, welchen Stellenwert sie Maßnahmen der betrieblichen Suchtprävention einräumen und welche Informationen über die Häufigkeit dieses Problems im Betrieb ihnen vorliegen. Auch wurde die persönliche Betroffenheit erfasst. Statistisch wurden die Ergebnisse auf Ordinalniveau mit dem Chi-Quadrat-Test überprüft. Interventionsmaßnahme Die Fortbildung wurde als eintägiger Workshop durchgeführt. Die Zielgruppe waren Ausbilder im kaufmännischen, technischen und chemischen Bereich, für welche die Teilnahme an der Veranstaltung Pflicht war. Der Workshop wurde in der Zeit von Oktober bis Dezember 2001 an insgesamt vier Terminen mit jeweils 10-12 Teilnehmern durchgeführt. Direkt im Anschluss an die Durchführung wurden die Teilnehmer gebeten einen kurzen Fragebogen zur Evaluation der Interventionsmaßnahme auszufüllen. Nach Abschluss aller Termine erhielten die Teilnehmer sowie weitere kaufmännische Mitarbeiter des Unternehmens, die nicht an dieser Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen hatten, einen ausführlichen Fragebogen, der verschiedene Einstellungs- und Verhaltensas- Ergebnisse Den eigenen Suchtmittelkonsum bezeichneten insgesamt 29 AusbilderInnen als mäßig, wobei es hier keine signifikanten Unterschiede zwi schen den Seminarteilnehmern und den NichtTeilnehmern gab. Völlig suchtmittelfrei zu leben 16 Methode Einführung in die „Betriebsvereinbarung Sucht“ durch die Sozialberatung des Unternehmens Vorstellung der Abhängigkeitskriterien nach ICD-10 Überblick über stoffgebundene Abhängigkeiten Entwicklung der Abhängigkeit Vermittlung eines Modells der Abhängigkeitsentwicklung; suchtstabilisierende Faktoren Überblick präventiver Maßnahmen Vorstellung des Versorgungsnetzwerks Sucht; Präventive Maßnahmen der Arbeitsorganisation und die Rolle des Vorgesetzten Gemeinsame Erarbeitung der Ziele eines solchen Gesprächs und Vorstellung eines Gesprächsmodells anhand eines Beispiels; Erarbeitung eines Leitfadens für ein Erstgespräch anhand von praktischen Fallbeispielen in Kleingruppen Vorstellung der Veränderungsphasen bei Drogenmissbrauch und Theoretische Einführung in die Gesprächsführungskompetenz; Vorstellung verschiedener Kategorien von Widerstand und Erarbeitung von Lösungsstrategien in Kleingruppen; Rollenspiele vor der Gruppe zur Anwendung der verschiedenen Strategien gaben neun Teilnehmer an. Unter den Seminarteilnehmern waren zwei abstinente Alkoholabhängige, zwei weitere Seminarteilnehmer schätzten ihren eigenen Suchtmittelkonsum als kritisch ein. Suchtmittelkonsum im Dienst verneinten die meisten Befragten. Darüber hinaus waren die meisten der Befragten eindeutig der Meinung, dass Suchtmittel nicht in die Betriebskantine gehören. Weiter geht aus den Ergebnissen hervor, dass Suchtmittelauffälligkeiten wohl relativ lange von Vorgesetzten und Kollegen gedeckt werden. satz zu lediglich 44 % der Seminarteilnehmer. Zwei Drittel der Nicht-Seminarbesucher waren dementsprechend dann auch der Meinung, dass Gespräche mit Mitarbeitern, die im Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch auffällig geworden waren, eher von Fachleuten geführt werden sollten. Darüber hinaus waren Nicht-Seminarbesucher eher der Meinung, dass man Suchtmittelmissbrauch erst beweisen können müsse, bevor man diesen bei einem Mitarbeiter ansprechen könne. Ein weiterer Schwerpunkt der Fragebogenaktion waren die bisherigen Aktivitäten der Ausbilder im Bereich betrieblicher Suchtprävention. Hierbei zeigte sich, dass die Ausbilder, die bisher kein Seminar besucht hatten, eher der Meinung waren, dass man bei Suchtmittelproble- Interessanterweise herrschte bei den Personen, die bisher kein Seminar besucht hatten die Meinung vor, dass Suchtkranke für die Entstehung Ihrer Abhängigkeit hauptsächlich selbst verantwortlich wären. Demgegenüber war der überwiegende Teil der Seminarteilnehmer der Ansicht, dass dies höchstens teilweise zuträfe (Abbildung 1). Mit Bezug auf das Trinkverhalten im Rahmen einer Alkoholabhängigkeitserkrankung herrschte in beiden Gruppen eindeutig die Meinung vor, dass ein kontrolliertes Trinken für einen Alkoholabhängigen nicht möglich ist, sondern dass nur absolute Alkoholabstinenz erfolgversprechend ist. Bei der Frage, ob die Teilnehmer schon einmal mit Suchtmittelproblemen konfrontiert worden waren, gaben die meisten Teilnehmer an, schon einmal im privaten Umfeld und auch direkt bei Kollegen konfrontiert worden zu sein. Auf die Frage nach dem Umgang mit Mitarbeitern mit Suchtmittelproblemen ergaben sich folgende Ergebnisse: Insgesamt sprachen sich beide Gruppen für eine direkte Konfrontation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern mit Suchtmittelproblemen aus. 80 % der Nicht-Seminarteilnehmer gaben an, niemals Gespräche über Suchtmittelprobleme mit ihren Mitarbeitern zu führen, im Gegen- Abbildung 1: „Was denken Sie über Alkoholismus/Suchtmittelabhängigkeit?“ Ein Suchtkranker ist für die Entstehung seiner Krankheit letzlich selbst verantwortlich 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Kein Seminar besucht tz u zu p < 0,05, Chi-Wert: 10,87 17 ga rn ich en ig zu w tri fft tri fft tri fft vo ll z u Seminar besucht fft Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen te ils Verständnis der Ambivalenz im Veränderungsprozess tri 4 zu Vermittlung der Kompetenzen zur Durchführung eines Erstgesprächs bei Verdacht auf Suchtmittelkonsum fft 3 tri 2 Ziel Vermittlung der Rahmenbedingungen betrieblicher Suchtprävention Informationsvermittlung zum Abhängigkeitssyndrom lic h Block 1 Ziele und Methoden der Interventionsmaßnahme zur betrieblichen Suchtprävention zi em Tabelle 1: Wert: 8,25) und auch ganz ohne Beratung würden sie es ebenfalls häufiger probieren. men von Mitarbeitern abwarten sollte, ob sich die Probleme nicht von selbst lösen. Auch waren Nicht-Seminarbesucher eher der Überzeugung, man solle Mitarbeiter mit Suchtmittelproblemen einfach an andere Arbeitsplätze versetzen. Weiterhin fragten wir die Ausbilder, welche drei Weiterbildungsthemen sie sich für ein zusätzliches Seminar am meisten wünschen würden. Vorherrschend waren bei beiden Gruppen die Themen „Umgang mit Mitarbeitern in Krisensituationen“ und „Stressbewältigung“. Die NichtSeminarbesucher wünschten sich darüber hinaus als drittes Thema „Psychische Erkrankungen“ und die Seminarteilnehmer „Gesprächsführung“. Auf die Frage, an wen sich die Ausbilder im Falle von einem Suchtmittelproblem bei einem Mitarbeiter wenden würden, um weitere Hilfestellungen zu bekommen, gaben beide Gruppen an, sich eher an ihren Vorgesetzten, als an die Personalabteilung zu wenden. An den Personalrat sowie an den betrieblichen Suchthelfer würden sich wiederum eher diejenigen Mitarbeiter wenden, die ein Seminar besucht haben. Interessant war, dass eine ganze Anzahl von Nicht-Seminarbesuchern auf keinen Fall den Betriebsarzt einschalten würden (p < 0,1, Chi- Tabelle 2: Eine weitere wichtige Fragestellung waren mögliche Hinderungsgründe für Vorgesetzte, Mitarbeiter mit Suchtmittelproblemen anzusprechen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengestellt (hier im Vergleich zur Erhebung von Fuchs et al., S. 219 [13]). „Nennen Sie die drei wichtigsten Hinderungsgründe für Vorgesetzte, Mitarbeiter mit Suchtmittelproblemen anzusprechen.“ Item Fuchs und Rummel, Landesbank Berlin n = 377 Eigene Untersuchung Chemieunternehmen Mangel an Beweisen Hemmung und Peinlichkeit Angst vor Reaktionen des Mitarbeiters 44 % 36 % 34 % 30 % 38 % 74 % Mangelnde Information über Sucht Zeitmangel Gleichgültigkeit Befürchtung, dem Mitarbeiter zu schaden 28 % 22 % 16 % 13 % 47 % 17 % 4% 10 % eigener Alkoholkonsum mangelnde Unterstützung der eigenen Vorgesetzten Angst, sich unbeliebt zu machen mangelnde Unterstützung der eigenen AG 9% 8% 2% 25 % 8% 0% 17 % 30 % besucher Ihre Mitarbeiter auch seltener über Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Sucht informierten. Interessanterweise meinten Nicht-Seminarbesucher Suchtmittelprobleme etwas besser erkennen zu können als Seminarbesucher (statistisch nicht signifikant), allerdings fühlten sich diese dann wiederum unsicherer im Umgang mit Mitarbeitern, die ein Suchtmittelproblem haben (siehe Abbildung 2). Über das Versorgungssystem „Sucht“ waren Seminarbesucher erwartungsgemäß besser informiert. NichtSeminarbesucher sprachen insgesamt seltener über Sucht mit Mitarbeitern (p < 0,05, Chi-Wert: 10,19), obwohl sie davon ausgehen, Suchtprobleme gut zu erkennen. Die Betriebsvereinbarung Sucht wurde signifikant häufiger von Seminarbesuchern gekannt und diese hielten sich auch signifikant häufiger an diese. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die nicht Seminar- Bei der Frage nach den betrieblichen Belastungen wurden die Mehrkosten durch Leistungsminderung von beiden Gruppen eher als mittel eingestuft, wie auch die Mehrkosten durch materielle Schäden infolge von Fehlern/Fehlverhalten. Eine weitere Frage betraf den Imageverlust einer Firma durch Mitarbeiter mit Suchtmittelproblemen, der insgesamt als ein eher weniger gravierendes Problem eingestuft wurde. Die Frage nach dem Sicherheitsrisiko durch Mitarbeiter mit Suchtmittelproblemen wurde von beiden Gruppen mit einem eher hohen Risiko eingeschätzt. Dies galt auch für 18 die Kosten, die durch Fehlzeiten entstehen. Von den Nicht-Seminarbesuchern wurde die Störung des Betriebsfriedens durch Suchtmittelprobleme sowie die Belastung durch Suchtmittelprobleme für den Betrieb insgesamt interessanterweise höher eingeschätzt. Eine weitere Fragestellung ergab die Notwendigkeit individuell an den jeweiligen Betrieb adaptierter Fortbildungsveranstaltungen hin. Wir fragten nach Hinderungsgründen für Vorgesetzte, Suchtmittelauffälligkeiten überhaupt anzusprechen und fanden in einem Chemieunternehmen im Vergleich zu der Untersuchung von Fuchs und Rummel [2] zur gleichen Frage in einer Landesbank ein deutlich unterschiedliches Antwortprofil. Diese Unterschiede lassen sich am ehesten durch unterschiedliche innerbetriebliche Strukturen, aber gerade auch durch einen unterschiedlichen Kenntnisstand zum Thema betriebliche Suchtprävention bei den Führungskräften und Mitarbeitern der jeweiligen Betriebe erklären. Hier zeigt sich unseres Erachtens auch die Notwendigkeit von individuell an den jeweiligen Betrieb adaptierten Fortbildungsveranstaltungen, um den jeweiligen strukturellen Unterschieden im Rahmen einer Fortbildung gerecht werden zu können. Auch informieren Führungskräfte ohne Fortbildung zum Thema „Sucht“ ihre Mitarbeiter weniger über Fortbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Es zeigt sich, dass mit dem Versorgungssystem „Sucht“ vertraute Vorgesetzte eher den Weg zum betrieblichen Suchthelfer oder zum Betriebsarzt finden. Die Evaluation der Fortbildungsseminare erfolgte anonym mit Schulnoten, wobei die Seminar besucher insgesamt durchweg gute bis sehr gute Bewertungen abgaben. Abbildung 2: „Bitte beschreiben Sie Ihre „Aktivitäten“ im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention.“ Item 1 Ich fühle mich sicher im Umgang mit Mitarbeitern, die Suchtprobleme haben 60,00% 50,00% 40,00% Kein Seminar besucht 30,00% Seminar besucht 20,00% 10,00% 0,00% trifft voll trifft trifft teils trifft trifft gar zu ziemlich zu wenig zu nicht zu zu p < 0,01, Chi-Wert: 11,91 Diskussion Ein wichtiges Ergebnis ist, dass die Interventionsmaßnahme bei den Führungskräften eine gute bis sehr gute Akzeptanz erreichte, und dies, obwohl es sich um eine Pflichtveranstaltung handelte. Tatsächlich waren die Seminare unübersehbar von einem großen Interesse der Teilnehmer getragen. Die Bedeutung von Fortbildungen im Bereich Betriebliche Suchtprävention wird weiterhin dadurch unterstrichen, dass viele Führungskräfte zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Thema Sucht bei Mitarbeitern schon konfrontiert worden waren und damit ein akuter Handlungsbedarf bestand. Inhaltlich muss sicherlich in Seminaren zum Thema „betriebliche Suchtprävention“ ein größeres Augenmerk auf die Früherkennung und Frühintervention von Mitarbeiten mit Suchtmittelproblemen und der daraus resultierenden Folgeschäden gerichtet werden, wie bereits von Schantz und Kollegen [3] empfohlen. Es zeigt sich, dass Substanzkonsum immer noch zu lange von Vorgesetzten gedeckt wird und damit auch eine im Frühstadium möglicherweise erfolgreichere Therapie nicht in Gang kommt. Themen, die darüber hinaus noch vertieft werden müssen, sind der Umgang mit Mitarbeitern in Krisensituationen, die Gesprächführung mit suchtmittelauffälligen Mitarbeitern und die Anwendung geeigneter Copingstrategien bei Stressfaktoren am Arbeitsplatz. Um die Akzeptanz und die Verbreitung der Seminarinhalte im Betrieb noch zu verbessern, sollten Seminare wiederholt stattfinden. Die regelmäßige Wiederholung ist wegen der Personalfluktuation nötig, um neue Mitarbeiter möglichst bald zu informieren und ermöglicht bei bereits geschulten Mitarbeitern eine Vertiefung bzw. Auffrischung der Inhalte. Zudem unterliegen auch die Strategien der Suchtprävention und behandlung einer stetigen Erneuerung und Anpassung an die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, was über regelmäßig stattfindende Seminare zeitnah umgesetzt werden kann. Die Untersuchung gibt einen Hinweis darauf, dass Führungskräfte, die bisher keine Seminare zum Thema „Sucht“ besucht haben, weniger für Suchtmittelauffälligkeiten bei Mitarbeitern sensibilisiert sind. Sie sind häufig nicht oder nur schlecht über die „Betriebsvereinbarung Sucht“ und die Möglichkeiten deren Umsetzung informiert, weisen Defizite im Bereich Gesprächsführungskompetenz mit suchtmittelauffälligen Mitarbeitern auf und kennen außerdem die Hilfs- und Behandlungsangebote im Versorgungssystem Sucht weit weniger, so dass Interventionen bei Betroffenen seltener stattfinden. Das alleinige Implementieren einer „Betriebsvereinbarung Sucht“ reicht also unseren Daten zufolge nicht aus, sondern sollte immer auch begleitet sein von entsprechenden Seminaren zu ihrer praktischen Umsetzung. Bernhard Croissant, Sabine Löber (Literatur bei den Autoren) 19 Gewalt in der Psychiatrie Eine interne Bestandsaufnahme Verwandt wurde ein von der Arbeitsgruppe „Gewalt in der Psychiatrie“ des Hauses konzipierter Fragebogen, der 18 zum Teil unterteilte Fragen vorgab. Bisher war es in psychiatrischen Kliniken eher üblich, aggressive Patientenübergriffe gegen Klinikmitarbeiter als hinzunehmendes Arbeitsplatzrisiko zu behandeln und wenig dagegen zu tun. Dabei zeigen einerseits epidemiologische Untersuchungen, dass bei bestimmten psychiatrischen Krankheitsbildern das Risiko einer aggressiven Handlung im Vergleich zur gesunden Bevölkerung leicht bis mäßig erhöht ist (1,2) und andererseits interne Erhebungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe, dass Patientenübergriffe knapp 40 % der Unfallmeldungen aus psychiatrischen Kliniken ausmachen (3). Das Thema Gewalt in psychiatrischen Kliniken ist bisher in der deutschsprachigen Literatur sehr wenig beachtet und untersucht worden (4,5,6,). Dies ist möglicherweise ein Beleg für das bisher wenig ausgebildete Problembewusstsein und Ausdruck fehlender oder wenig suffizienter Gewaltmanagementstrategien in den einzelnen Häusern. Erst in letzter Zeit ist ein zunehmendes Interesse an diesem Thema zu verzeichnen (3), wobei deutlich wird, dass trotz zunehmendem Interesse weitgehend Handlungskonzepte fehlen und selten ausgearbeitete Richtlinien zum Umgang mit Gewalt bzw. zu Prävention oder Nachsorge der Opfer zur Verfügung stehen. Ergebnisse 149 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gaben den vollständig ausgefüllten Fragebogen ab. Davon waren 61 % Frauen und 39 % Männer; 54,4 % gehörten dem Pflegepersonal an, 30,2 % waren Ärzte oder Psychologen; 15,4 % definierten sich als „sonstiges“ Personal. Mit 44 % war die größte Gruppe der Befragten 30-39 Jahre alt, die Gruppe der 40-49-Jährigen war mit 31 % am zweithäufigsten vertreten. 35 % der Befragten gaben an, mehr als 12 Jahre im Berufsfeld beschäftigt zu sein, 34 % beschreiben eine Berufserfahrung zwischen 5 und 12 Jahren, 31 % gaben eine Berufserfahrung unter 4 Jahren an. Die Ergebnisse im Einzelnen: Item Subjektive Belastung: • 40,3 % der Antworter erleben sich „vereinzelt übermäßig belastet“, 28,9 % erleben sich „öfter im Jahr“ übermäßig belastet, 5,4 % gaben an, sich wöchentlich „übermäßig belastet“ zu fühlen. • Verbaler Aggression oder Androhung von Gewalt waren 25,5 % während eines Jahres öfter, 34,2 % vereinzelt ausgesetzt. 9,5 % waren wöchentlich verbalen Aggressionen ausgesetzt. • Aggressive körperliche Übergriffe (z. B. Kratzen, Schlagen, Beißen, Spucken, Weggestoßen werden) erlebten 32,4 % gelegentlich, 16,2 % öfter im vergangenen Jahr. 0.7 % erlebten wöchentlich solche Übergriffe (n=4,1). 42,6 % erlebten nie körperliche Patientenübergriffe. • 72,3 % gaben an, im Hinblick auf den Umgang mit aggressivem Patientenverhalten nicht ausreichend ausgebildet zu sein. Item Belastungsquellen: • Als eindeutig am meisten belastende Situation wurden aggressive Übergriffe von Patientenseite genannt (70 Nennungen). Als zweithäufigste Belastungsquelle wird eine eingeschränkte Personaldecke mit Überlastung der Mitarbeiter genannt. Erst danach rangieren suizidale Syndrome und psychotische Krankheitsbilder einschließlich der BorderlinePersönlichkeitsstörung. Item Umgang mit Belastungsquellen: • Als bevorzugte Strategie des Umgangs mit Belastungsquellen wird der verbale Aus- Um hier einen eigenen Ansatz zu finden und um ein eigenes Gewaltmanagement zu etablieren wurde im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit im Jahr 2002 eine große anonymisierte Mitarbeiterbefragung mit dem Ziel durchgeführt, festzustellen, in wievielen Fällen Mitarbeiter im Jahr zuvor Opfer aggressiver Patientenübergriffe geworden sind und welche Erfahrungen hier gemacht wurden. Methode Befragt wurden alle Mitarbeiter des Zentralinstitutes für Seelische Gesundheit, die in Kontakt mit Patienten kommen bzw. sich als solche Personen definieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Zentralinstitut vier unterschiedliche Kliniken (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin), daneben aber auch einen großen Forschungs- sowie einen Verwaltungsbereich beinhaltet. 20 tausch mit Kollegen und anderen vertrauten Personen genannt. An zweiter Stelle rangiert der Wunsch nach Entwickeln und Anwenden eines Konzeptes für den Umgang mit Belastungsquellen. • Nur 52,2 % der Mitarbeiter melden einen tatsächlich erfolgten Übergriff, eine Unfallmeldung wird extrem selten ausgefüllt, obwohl bei 34% Verletzungen körperlicher Art aus einem Übergriff resultierten. • 55,3 % berichten, dass sie an ihrem Arbeitsplatz ein Konzept vermissen, welches ihnen allgemein Sicherheit im Umgang mit Patienten vermittelt. • 52,1 % sind der Ansicht, dass sich vorhandene Konzepte nicht zum Umgang mit aggressiven Patienten eignen. • 88,8 % der Antworter wünschen sich dezidiert ein solches Konzept. Item Reaktion auf Übergriff: • Als häufigste Reaktionen auf Übergriffe werden Betroffenheit (64,3 %), Beängstigung (41,3 %) und Wut (35 %) genannt, weniger Enttäuschung oder Gereiztheit. Item Folgen der Belastung: • Von den 59 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berichten 57,7 % über wiederholte und sich aufdrängende Erinnerungen, welche wenige Tage andauern; 5,2 % gaben an, noch über ca. 6 Wochen unter sich aufdrängenden Erinnerungen zu leiden. • Etwas weniger (26) berichten über wiederholte, belastete Träume sowie (30) über Einund Durchschlafstörungen, auf das Belastungsereignis hin auftretend. Item Gewünschte Verbesserungen: • Am häufigsten wird ein besserer Personalschlüssel gewünscht, am zweithäufigsten Fortbildungen, v. a. zum Umgang mit Aggression (Schulungen in Deeskalationstechnik, Konfliktmanagement, Selbstverteidigungstechnik) für die Abwehr/den Umgang mit aggressiven Übergriffen ausgebildet zu sein, • 88,8 % der Antwortenden sich ein Konzept im Umgang mit aggressiven Patienten wünschen. Die Arbeitsgruppe „Gewalt in der Psychiatrie“ erarbeitet derzeit ein für alle Kliniken des Hauses durchführbares und lernbares Konzept zum Umgang mit Gewalt bzw. zu Präventionsstrategien und Nachsorgestrategien für Betroffene. Das Konzept beinhaltet: • Regeln zu Dokumentation und Analyse von aggressiven Übergriffen • Verpflichtung zu regelmässigen Schulungen zu Präventions- und Deeskalationstechniken • Erlernen von Techniken zum Selbstschutz bei körperlichen Übergriffen • Nachbetreuung betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Qualitätskontrolle und -sicherung Hierbei kann auf das in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik (KJP) bereits erfolgreich etablierte Gewaltmanagement und Weiterbildungssystem (Keitel u. Ritter) zurückgegriffen werden, welches neben einer theoretischen Auseinandersetzung mit Gewalt auch das Erlernen von ausschließlich Gewalt abwehrenden Selbstverteidigungstechniken vorsieht. In den bisher in der Arbeitsgruppe durchgeführten Diskussionen haben sich auch auf Grund der positiven Vorerfahrungen im Bereich der KJP Kenntnisse in Selbstverteidigung als wesentlicher, selbstsicherheitsfördernder Punkt herausgestellt. Wir beabsichtigen, hier im Sinne eines lernenden Systems vorzugehen und auf die bereits bestehende Kompetenz in der KJP einerseits und auf die im Haus zweifelsohne bestehende Kompetenz in Gesprächstechnik, Umgang mit Patienten und Gewalt aufzubauen, um in gemeinsamer Arbeit das existierende Expertenwissen zu verbessern, zu vermehren und weiterzugeben. Es ist beabsichtigt, das zu entwickelnde Ausbildungsmodul „Gewaltprävention und –management“ für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pflegerischen und ärztlichen Bereich, analog zur Ausbildung in Notfallmedizin, einzuführen. Schlussfolgerungen Die Erhebung belegt eindrucksvoll, dass • mehr als ein Viertel der Mitarbeiter (27,1 %) häufiger (wöchentlich oder monatlich) mit aggressiven verbalen Äußerungen konfrontiert sind, • die meisten MitarbeiterInnen (72,3 %) der Meinung sind, nicht oder nicht ausreichend Peter Hofmann (Literatur beim Autor) Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung psychisch Kranker Gesetzgebung und Praxis in den Mitgliedsländern der Europäischen Union Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung sind zentrale Themen ärztlicher Ethik und psychiatrischer Praxis, die seit mehr als 100 Jahren kontrovers diskutiert werden. Die ge21 setzlichen Grundlagen zu diesen Maßnahmen sind vor dem Hintergrund unterschiedlicher psychiatrischer Versorgungssysteme und verschiedener kultureller und gesetzlicher Traditionen in den einzelnen europäischen Ländern sehr heterogen. Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie stehen grundsätzlich in einem tripolaren Spannungsverhältnis, das aus folgenden Eckpunkten besteht: Studie und Methode Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission (Health and Consumer Protection Directorate/Public Health) eine systematische Untersuchung der gesetzlichen Regelungen und der Unterbringungspraxis in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Auftrag gegeben. Ziel war die Analyse gegenwärtiger Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Gesetzgebung und Praxis. Die Studie wurde unter Leitung der beiden Autoren am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit vom 01.10.2000 bis zum 01.01.2002 durchgeführt. 1. Sicherung grundlegender Patientenrechte 2. Sicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit 3. Behandlungsbedürftigkeit des Patienten Die starke Betonung der Menschenrechte hat sich in den letzten vierzig Jahren in der Psychiatriegesetzgebung in einer verstärkten Anstrengung niedergeschlagen, grundlegende Patientenrechte zu sichern, um Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Behandlung zu reduzieren und einer stärkeren Kontrolle zu unterwerfen. Die Zurückdrängung medizinisch- paternalistischer Ansätze, die die Behandlungsbedürftigkeit von krankheitsuneinsichtigen Patienten betonen, hat in den letzten fünfzehn Jahren in vielen Ländern Europas zu erheblichen Änderungen der Unterbringungsgesetze geführt, mit dem Ziel, Zwangseinweisungen und Zwangsbehandlungen einzuschränken und eine freiwillige, wo immer möglich ambulante und konsentierte Behandlung zu fördern (Curran 1978). Trotz dieser fortschrittlichen Bestrebungen der Gesetzgeber finden sich in einigen Ländern aber entgegen der ursprünglichen Intention steigende Zahlen für Zwangseinweisungen (Wall et al. 1999, Darsow-Schütte und Müller 2001). Neben Konflikten zwischen Behandlungsbedürftigkeit und Patientenrechten gibt es außerdem Stimmen, die dem das Gefährlichkeitskriterium, das in vielen modernen Psychiatriegesetzen als eine Voraussetzung zur Zwangsunterbringung eingeführt wurde - und dessen Einführung als progressiv galt, weil es die Zwangsunterbringung erschweren sollte ein Potential der Reaktivierung des Stereotyps vom „gefährlichen psychisch Kranken“ zuschreiben (Phelan und Link 1998). Diese Konfliktfelder spielen auch beim Integrationsprozess der Europäischen Union eine Rolle, in der die Tendenz zur Harmonisierung der Gesetzgebung und somit auch der Psychiatriegesetze zunimmt. Voraussetzung für solche Bestrebungen ist die systematische Analyse der gesetzlichen Grundlagen in den EU-Mitgliedstaaten sowie deren Bewertung im Hinblick auf die Praxis. Bisher liegen in dem hier diskutierten Problemfeld jedoch nur unstrukturierte Vergleiche einzelner Länder vor (Laffont und Priest 1992, Legemaate 1995, Forster 1997, Röttgers und Lepping 1999, Van Lysbetten und Igodt 2000) und auch valide epidemiologische Daten sind europaweit sehr rar (Riecher-Rössler und Rössler 1993). Die Arbeitsweise sah die Implementierung eines Netzwerkes von Experten aus jedem der 15 Mitgliedsländer der EU vor, die entsprechende Informationen und Daten aus ihren Heimatländern lieferten. Für diesen Zweck wurde ein umfangreicher Fragebogen entwickelt und ein schriftliches Leitfadeninterview mit den Experten durchgeführt. Die Daten wurden von der Studienzentrale am ZI ausgewertet. Die Ergebnisse hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Mitgliedstaaten wurden in tabellarischer Form sowie einer strukturierten Synopsis dargestellt. Auf einer gemeinsamen zweitägigen Konferenz mit den Experten am 16. und 17. November 2001 im Zentralinstitut erfolgte die Klärung offener Fragen und die allgemeine Diskussion der Ergebnisse. Der ausführliche Schlussbericht wurde am 15.05.2002 der Europäischen Kommission übergeben und wurde vom Projektträger in vollständiger Form ins Internet gestellt. http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/20 00/promotion/fp_promotion_2000_frep_08_en.p df). Zusammenfassung der Ergebnisse Die Untersuchung zeigt, dass die gesetzlichen Regelungen und deren praktische Umsetzung in den Mitgliedsländern der EU ausgesprochen heterogen sind. Auch die interne rechtliche Position des Patienten in einem Zwangsunterbringungsverfahren unterscheidet sich in den einzelnen Ländern deutlich und es ist deshalb nicht verwunderlich, dass auch die Zwangseinweisungsraten und -quoten stark voneinander abweichen. Mit Ausnahme Griechenlands und Spaniens verfügen alle anderen EU Länder über eigenständige (Psychiatrie-) Gesetze, die die Zwangsunterbringung psychisch Kranker regeln. Die meisten dieser Gesetze sind nach 1990 in Kraft getreten, was verdeutlicht, dass die Psychiatriegesetzgebung in den EU Ländern als politische Aufgabe wahrgenommen wird. Bezüglich der Kriterien für Zwangsunterbringungen kann man die EU Länder in drei Grup22 pen einteilen. In Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden muss immer das Kriterium der Eigen- und/oder Fremdgefährdung erfüllt sein. In einer zweiten Gruppe von Ländern reicht die unbedingte Behandlungsnotwendigkeit einer psychischen Erkrankung aus (Italien, Spanien und Schweden). Die dritte Gruppe umfasst Länder, in denen entweder eine unbedingte Behandlungsnotwendigkeit oder alternativ das Gefährlichkeitskriterium vorliegen muss. Dieses Vorgehen findet sich in Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Portugal und Großbritannien. Nur in wenigen nationalen Gesetzen existieren Ausführungen zu bestimmten Diagnosen, bei denen eine Zwangsunterbringung gerechtfertigt ist. In Dänemark findet sich die Formulierung, dass sich die gesetzlichen Regelungen auf Psychosen oder psychische Erkrankungen vom Schweregrad einer Psychose beziehen und in einigen deutschen Landesunterbringungsgesetzen werden diagnostische Kategorien erwähnt, allerdings in einer so allgemeinen Form, dass eine Beschränkung der Zwangsunterbringung auf bestimmte Krankheitsbilder nicht möglich ist. Einen konkreten Bezug zu Diagnosen geben das britische und das irische Gesetz im Hinblick auf die Persönlichkeitsstörungen. In Irland ist die Zwangsunterbringung bei dieser Diagnose ausgeschlossen - in Großbritannien nur dann erlaubt, wenn mit der Unterbringung eine Aussicht auf Besserung verbunden ist. In allen anderen Ländern finden sich keine detaillierten Ausführungen zu Diagnosen. Neben dem regulären Standardverfahren der Zwangsunterbringung sind mit Ausnahme von Dänemark, Finnland und Irland in allen anderen Ländern auch Notfallverfahren vorgesehen, die einen verkürzten Ablauf und die Möglichkeit der vorläufigen oder fürsorglichen Zurückhaltung beinhalten. Die Zeitspannen der fürsorglichen Zurückhaltungen variieren erheblich und reichen von 24 Stunden bis zu zehn Tagen. Die in der Praxis in allen Ländern zahlenmäßig häufige Anwendung des Notfallverfahrens geht mit einer Reduzierung des Schutzes der Patientenrechte einher. Aus der psychiatrischen Perspektive ist jedoch plausibel, dass Notfallverfahren dominieren, da die Zwangseinweisung eine ultima ratio der Krisenintervention ist. Zukünftige Gesetzesreformen sollten sich deshalb stärker auf die Notfalleinweisung konzentrieren und für dieses Verfahren einen hinreichenden Schutz der Patientenrechte gewährleisten. Heterogen sind auch die Bestimmungen zur ärztlichen Begutachtung. Bemerkenswert ist, dass in sechs Ländern der EU das Zeugnis eines Allgemeinarztes für eine Zwangseinweisung ausreichend sein kann. Eine Harmonisierung der europäischen Unterbringungsgesetze hätte hier einen wichtigen Anknüpfungspunkt zur Definition allgemeiner Qualitätsstandards. Einige nationale Gesetze nehmen auch Stellung zu spezifischen Behandlungsmaßnahmen. Diese Bestimmungen sind ausgesprochen heterogen und erscheinen mehr von Erwägungen politischer Korrektheit denn von Erfahrungen des psychiatrischen Alltags geprägt, etwa wenn sich in fünf Ländern detaillierte Regelungen zur Psychochirurgie finden. Dagegen wird die Behandlung mit Psychopharmaka nur in den Gesetzen von vier Ländern angesprochen. Auch die Regelungen für besondere Zwangsmaßnahmen wie z. B. Fixation und Isolation während einer Unterbringung sind in den EU Ländern unterschiedlich ausgestaltet. Nur in fünf Ländern (Österreich, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Schweden) finden sich detaillierte Bestimmungen zu Situationen, in denen der Einsatz solcher Maßnahmen gestattet ist - die übrigen Gesetze enthalten hierzu keine Ausführungen. Auch die Analyse der praktischen Durchführung einer stationären Zwangsbehandlung ergibt erhebliche Unterschiede zwischen den EU Ländern. Die Tendenz zur Differenzierung der früher üblichen Gleichsetzung von Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung bildet sich bisher nicht in allen Mitgliedstaaten ab. Eine grundsätzliche Unterscheidung von Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung findet sich nur in den einschlägigen Gesetzen von Österreich, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Schweden und Großbritannien, die übrigen acht Mitgliedstaaten nehmen eine solche explizite Trennung nicht vor. Unterschiedlich sind auch die Bestimmungen über die Anordnung der Zwangsunterbringung. In Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien erfolgt die Anordnung der Zwangsunterbringung durch eine unabhängige, nicht medizinische Instanz. In den restlichen Mitgliedstaaten verbleibt die Anordnung der Zwangsunterbringung innerhalb der medizinischen Verantwortung (Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Schweden und Großbritannien). Die im Regelverfahren gesetzlich vorgesehene Maximaldauer der Unterbringung variiert erheblich und reicht von sieben Tagen (Italien) bis zu neun Monaten (Finnland). Ein wichtiger Aspekt bei Zwangsunterbringungen ist die Nachbehandlung einschließlich eventueller Möglichkeiten einer ambulanten Zwangsbehandlung. Hier ergibt die Analyse ein deutliches Defizit in den meisten nationalen Gesetzen. Nur in sechs Ländern wird die 23 Weiterbehandlung nach Beendigung der Zwangsunterbringung überhaupt und in eher allgemeiner Form thematisiert (Belgien, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Schweden, Großbritannien). Die Gesetze sind also ganz auf die stationäre Behandlung zentriert und reflektieren nicht das zunehmend geänderte Versorgungsangebot, in dem ambulante und teilstationäre Behandlung in der Gemeinde den Vorrang vor stationären Behandlungsmaßnahmen hat. Möglichkeiten einer ambulanten Zwangsbehandlung, die z. B. in den Gesetzen der USA weit verbreitet sind, sehen nur vier EU Länder vor (Belgien, Luxemburg, Portugal, Schweden). Bezüglich der bei Zwangsunterbringungen erhobenen Diagnosen zeigt sich in allen Ländern ein Überwiegen der diagnostischen Gruppen F0 bis F3 und darunter wiederum eine klare Dominanz der schizophrenen Psychosen. Hinsichtlich des Unterbringungskriteriums, der über die Unterbringung entscheidenden Instanz und der inneren rechtlichen Position des Patienten im Unterbringungsverfahren ergeben sich bei der Diagnosenverteilung in den Ländergruppen keine signifikanten Unterschiede. Bei der Geschlechtsverteilung ist auffällig, dass sich in Ländern, die an der Behandlungsbedürftigkeit ausgerichtete Unterbringungskriterien haben, eine weitgehend ausgeglichene Geschlechtsverteilung zwangsuntergebrachter Patienten findet. Länder, in denen obligat das Gefährlichkeitskriterium vorausgesetzt wird, zeigen ein signifikantes Überwiegen der Männer. Der internen rechtlichen Stellung des Patienten im Zwangsunterbringungsverfahren wird in den EU-Ländern zunehmend Beachtung geschenkt, die gesetzlichen Regelungen sind aber auch diesbezüglich noch recht heterogen. Nur in sechs Ländern (Österreich, Belgien, Dänemark, Irland, Niederlande, Portugal) hat der Patient obligatorisch einen Rechtsbeistand während des Verfahrens. Regelungen für Situationen, in denen das Recht auf freie Kommunikation eingeschränkt werden darf, existieren nur in fünf Ländern und bezüglich potentieller Einschränkungen des Besuchsrechts verfügen nur sieben Länder über detaillierte gesetzliche Bestimmungen. Das Fehlen gesetzlicher Vorschriften zu diesen Aspekten bedeutet nicht, dass im praktischen Vollzug der Zwangsunterbringung solche Grundrechte nicht doch vorübergehend eingeschränkt werden müssen. Zum besseren Schutz der Patientenrechte wären diesbezüglich klare Regelungen in allen EU Ländern wünschenswert. Fazit Alles in allem zeigt die Analyse, dass die gesetzlichen Regelungen und die Praxis der Zwangsunterbringung in den EU-Mitgliedsländern ausgesprochen heterogen sind. Einfache Kategorisierungen der Regelungen etwa in eine legalistische oder medizinische Ausgestaltung der Unterbringungsgesetze bilden die Komplexität der Verhältnisse nur ungenügend ab und können allenfalls einen Hinweis auf eine gewisse Ausrichtung des Gesetzes geben. Insbesondere ist auch eine unidirektionale Beeinflussung der Praxis der Zwangsunterbringung durch Gesetze nicht anzunehmen. Neben den gesetzlichen Regelungen der Zwangsunterbringung sind unterschiedliche nationale Behandlungskulturen, unterschiedliche gesellschaftspolitische Einstellungen gegenüber psychisch Kranken, der Ausbau des Versorgungssystems und auf regionaler Ebene auch administrative Besonderheiten und Verfahrensabläufe und weitere Faktoren für die erheblichen Unterschiede in den Unterbringungsraten und -quoten verantwortlich. Der Eu-weiten Vereinheitlichung von Gesetzgebung und Praxis stehen somit hohe Hürden entgegen. Die Häufigkeit von Zwangsunterbringungen variiert in den EU Ländern erheblich. Die jährlichen Unterbringungsraten (Episoden stationärer Zwangsunterbringung pro 100.000 Einwohner) reichen von 6 in Portugal bis 218 in Finnland. Die Unterbringungsquoten (Anteil der Zwangseinweisungen an allen stationären Behandlungsepisoden) liegen in einer Spannweite von 3,2 % in Portugal bis zu 30 % in Schweden. In einigen Ländern findet sich in den letzten Jahren eine Zunahme der Unterbringungsraten (Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Finnland). Die Unterbringungsquoten zeigen aber in diesen Ländern keinen signifikanten Anstieg, so dass die gestiegenen Unterbringungsraten wesentlich durch veränderte Behandlungsstandards wie verkürzte Verweildauer und häufigere Rehos-pitalisierungen mit Zunahme der Behandlungsepisoden insgesamt erklärt werden können. Eine relative Zunahme von Zwangseinweisungen war entgegen einschlägiger Publikationen, die aus gestiegenen absoluten Unterbringungsraten auf eine Zunahme von Zwang in der Psychiatrie schließen, in keinem Mitgliedstaat festzustellen. Eine vergleichbare Studie über die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Unterbringung und Behandlung psychisch kranker Straftäter in den EU-Mitgliedstaaten wird gegenwärtig unter Leitung der Autoren durchgeführt. Harald Dreßing, Hans Joachim Salize (Literatur bei den Autoren) 24 „Wieder-klar-denken-können“ Computergestütztes Training kognitiver Defizite bei schizophren Erkrankten dieser Übungsaufgabe 40 Paare vorgegeben. Bei der anschließenden Auswertung durch den PC interessieren für die Beurteilung von Leistungsstand und Übungsfortschritt sowohl die Anzahl richtiger Antworten als auch die Bearbeitungszeit. Beim zweiten Illustrationsbeispiel geht es um Rechenfertigkeiten. Cogpack enthält eine ganze Reihe von Rechenaufgaben in unterschiedlicher Gestaltung. Hierzu gehört auch das Kettenrechnen. Beispiel: "93 + 4 − 29 =.....". Der Proband soll die rechte Seite der Gleichung ergänzen, also die Lösung angeben. Nach der Eingabe erhält er umgehend optisch und akustisch eine Rückmeldung im Sinne von "richtig" bzw. "falsch". Bei diesem Übungsteil werden 20 Einzelaufgaben vorgegeben. Wieder interessieren bei der Auswertung die Anzahl richtiger Antworten und die Bearbeitungszeit. Keine technische Entwicklung hat unser Leben während der letzten 10 bis 15 Jahre in dem Maße geprägt, wie die Einführung des Computers. Auch im Bereich der Psychiatrie haben diese Produkte ihren Einzug gehalten. Neben einer vielfältigen Verwendung, ähnlich der in der Organmedizin, stehen die Geräte hier für eine spezielle Aufgabe zur Verfügung. Gemeint ist ihr Einsatz in der psychiatrischen Behandlung und Rehabilitation. Die Idee Mit Bezug auf diesen Einsatzbereich haben wir in der Abteilung Evaluative Psychiatrie ein computergestütztes Trainingsverfahren aufgebaut und evaluiert, das dazu beitragen soll, krankheitsbedingte kognitive Defizite bei psychisch Kranken mit chronifizierten Verläufen und hier insbesondere bei schizophrenen Patienten zu reduzieren. In Hinblick auf das Defizitspektrum dieser Patientengruppen sollte ein Trainingsprogramm in Softwareform zur Anwendung kommen, das mit einer größeren Zahl unterschiedlicher Übungsaufgaben einen breiten Bereich von Zielfunktionen anspricht. Hierzu gehören: Aufmerksamkeit, Vigilanz, Wahrnehmung, Reaktion, Gedächtnis, Konzeptbildung, Rechnen und logisches Denken. Weiterhin sollte der Ablauf des PC-gestützten Trainings auf den einzelnen Patienten abgestellt werden. Im Sinne eines individualisierten Ansatzes wird daher bei bestehenden Defiziten in einer bestimmten Übungsaufgabe gezielt, d. h. über Aufgabenwiederholungen trainiert, während bei einer guten Leistung bereits während des ersten Trainingsdurchgangs eine Aufgabe nicht erneut vorgegeben wird. In das von uns zusammengestellte Trainingsprogramm wurden insgesamt 70 Übungsaufgaben aus Cogpack aufgenommen. In Form von sogenannten „Olbrich-Serien“ sind diese nach dem Prinzip von Funktionswiederholung und Schwierigkeitssteigerung aneinandergereiht. So ist etwa die Funktion „Konzentration“ das vorrangige Trainingsziel in den 16 Aufgaben 1-3, 68, 29-31, 34-36, 58-59 und 62-63 der Gesamtserie. Dabei nimmt die Schwierigkeit der Bearbeitung von einer Aufgabengruppe zur nächsten zu. Jede Übungsaufgabe wird unmittelbar nach dem Training ausgewertet. Abhängig von der Art der Aufgabe wird dabei die Güte der gezeigten Leistung als Prozentanteil richtiger Antworten bzw. die Bearbeitungszeit (als Perzentilwert in Bezug auf vorhandene Standardwerte) ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Auswertungsergebnisses gestaltet sich der weitere Trainingsablauf für diese Aufgabe wie folgt: Die Umsetzung Im Hinblick auf den genannten breiten Bereich an Zielfunktionen haben wir als Übungsmaterial unseres Trainingsprogramms das auf dem Markt erhältliche Softwareprogramm „Cogpack“ von K. Marker herangezogen, da es eine Vielzahl von Aufgaben mit inhaltlich unterschiedlicher Ausrichtung enthält. Beispielhaft sollen zwei Aufgaben aus Cogpack kurz dargestellt werden: • • • Bei der Aufgabe "Vergleiche" hat der Proband per Tastendruck zu entscheiden, ob es sich bei einem auf dem Bildschirm dargestellten Paar von Zeichen um identische (+ Taste) oder disparate (− Taste) Elemente handelt. Beispiel: "bddbdb" und "bddbdd". Bei einer falschen Antwort erfolgt seitens des Computers akustisch eine Fehlermeldung. Insgesamt werden bei • 25 Im Falle eines Deckeneffekts (Prozentsatz richtiger Antworten ≥ 90 bzw. Perzentilwert ≤ 30) wird die Übungsaufgabe nicht noch einmal vorgegeben. Unterhalb des Deckeneffekts wird die Aufgabe in der nächsten Trainingssitzung wiederholt. Wir gehen von einem Übungsfortschritt aus, wenn es jetzt zu einer Erhöhung des Prozentanteils (bzw. Verringerung des Perzentilwerts) um mindestens 10 Punkte kommt. In diesem Fall wird für die betreffende Übungsaufgabe das Training beendet. Bei fehlendem Übungsfortschritt wird die Aufgabe in einer weiteren Trainingssitzung erneut vorgegeben. Der Trainingsablauf, den ein Patient in einer Übungsaufgabe zeigt, wird in Protokollen festgehalten. Trainingsergebnis für den Bereich der Gedächtnisfunktionen. Tab. 1: Ergebnisse computergestützten Trainings bei schizophren Erkrankten Die Evaluation Das hier beschriebene PC-gestützte kognitive Training wurde am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim zunächst auf einer Station mit vorwiegend schizophrenen Patienten mit chronischen Krankheitsverläufen eingesetzt. Es ist inzwischen Teil der Standardbehandlung für eine Reihe von Stationen. Das Training findet im Gruppenformat in einem mit vier Computern ausgerüsteten Arbeitsraum statt. Pro Woche sind fünf Sitzungen von ca. einer Stunde Dauer angesetzt. In einer Trainingssitzung steht die Bearbeitung von 4 bis 6 Übungsaufgaben an. Bei dieser Sitzungsfrequenz benötigt man - unter Berücksichtigung von Aufgabenwiederholungen - für das Durchlaufen des gesamten Trainingsprogramms etwa sechs Wochen. Nicht wenige Patienten beenden (aus unterschiedlichen Gründen) früher ihren Klinikaufenthalt. Nach unseren Erfahrungen profitieren auch sie vom Training, sofern sie mindestens ein Drittel der 70 Übungsaufgaben der "Olbrich-Serie" absolviert haben. Bei der Evaluation des Trainingsansatzes wurde von uns als Erfolgsmaß der Übungsfortschritt herangezogen, definiert als Verbesserung von mindestens 10 % (siehe oben) bei erneuter Bearbeitung einer Übungsaufgabe. In den Analysen wurden Übungsfortschritte getrennt für acht Funktionsbereiche ermittelt. Für schizophren Erkrankte sind die Ergebnisse in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Dabei ist z. B. der Wert für den Funktionsbereich Konzentration so zu verstehen, dass von den 16 Aufgaben, die das Programm zu diesem Bereich enthält, im Mittel 71 % einen Übungsfortschritt , d. h. Leistungsverbesserungen im Zuge des Trainings der Patienten aufwiesen. Funktionsbereich Konzentration Reaktion Verarbeitungsleistung Strategisches Vorgehen Gedächtnis Rechnerische Fertigkeiten Logische Denken Sprache % Aufgaben (M) mit Übungsfortschritt 71 % 81 % 69 % Zahl (N) ausgewerteter Patienten 1463 1143 1143 nicht darstellbar (Ausw.fehler) 55 % 71 % 1171 1028 899 84 % 68 % 720 381 Die Innovation Das Innovative an der Einführung des Computers in das Training schizophren Erkrankter und anderer psychiatrischer Patientengruppen ist unseres Erachtens darin zu sehen, dass dieser Ansatz einige spezifische Vorteile bietet, die etwa die traditionellen Papier-Bleistift-Verfahren nicht besitzen. So hat der Therapeut am Ende einer Übungssitzung einen unmittelbaren und leichten Zugang zu den Trainingsergebnissen des Patienten. Auch ist es möglich, einzelne Übungsaufgaben inhaltlich und hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades zu modifizieren und so dem Defizitspektrum der Patienten besser anzupassen. Des Weiteren entlastet der Computer den Therapeuten, insbesondere in Gruppensitzungen bei der Trainingsdurchführung, weil er einen Teil der Funktionen des Übungsleiters übernehmen kann. Während des Trainings kann das Gerät dem Patienten über den Bildschirm und auf akustischem Wege bei der Bearbeitung einer Übungsaufgabe Hilfestellung bieten, zur Adäquatheit seiner Antworten Rückmeldungen geben und gegebenenfalls dazu auffordern, mit dem Training fortzufahren. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil PCgestützter Verfahren betrifft schließlich den Motivationsaspekt. Durch die Aufnahme von Video-Spiel-Elementen in ein Softwareprogramm können Compliance und positive emotionale Prozesse wie Neugier und Vergnügen erheblich gefördert werden. Ein therapeutisch bedeutsamer Gesichtspunkt gerade bei Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung, deren Krankheitsbild häufig durch eine anhaltende Anhedonie-Symptomatik geprägt ist. Robert Olbrich Die Tabelle enthält nicht nur Trainingsergebnisse des Zentralinstituts in Mannheim. Zahlreiche psychiatrische Kliniken führen ein PC-gestütztes kognitives Training mit dem von uns entwickelten, individualisierten Ansatz durch und haben uns die Trainingsdaten ihrer Patienten zu Auswertungen zugesandt. Die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf die Patienten mit der ICD-10 Diagnose einer Schizophrenie in unserem Datenpool mit Stand August 2001. Zu diesem Zeitpunkt war uns Datenmaterial aus etwa 110 psychiatrische Einrichtungen zugegangen. Die Ergebnisse zeigen, dass es bei den schizophrenen Patienten in nahezu allen trainierten Funktionsbereichen im Mittel zu Leistungsverbesserungen bei mehr als 2/3 der Übungsauf gaben kam. Bemerkenswert, wenn auch nicht unplausibel angesichts der Diagnose der Patienten, ist das vergleichsweise bescheidene Das Projekt erhielt beim Lilly Schizophrenia Awards 2002 den Ehrenpreis des Schwerpunkts Kognition: „Wieder-klar-denkenkönnen“. 26 Was kommt nach der Klinik? Die komplementäre psychiatrische Versorgung in Mannheim Gemeindepsychiatrie, nach heutigem Verständnis definiert, meint Rehabilitation und spezifische (Re-)Integration von überwiegend chronisch psychisch erkrankten Menschen in der Gemeinde. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass Personen mit psychischen Erkrankungen oft Einbußen und Beeinträchtigungen ihrer Fähigkeiten erleiden, derentwegen sie in unterschiedlichem Umfang und verschiedener Art der Unterstützung bedürfen. Außerdem sind sie immer noch stigmatisiert und der Gefahr der Isolierung oder Ausgliederung aus ihrem gewohnten Lebensumfeld ausgesetzt. Ihrem berechtigten Verlangen nach Selbstbestimmung und nach Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird Rechnung getragen durch das Vorhalten eines Hilfesystems, das ausreichende Ressourcen in gut zugänglichen Diensten umfasst. Dieses Hilfs- und Unterstützungssystem wird ganz überwiegend von nicht-ärztlichen Mitarbeitern getragen. Ärzte sind darin nur in geringer Zahl und meist in beratender sowie koordinierender Funktion tätig. Therapie in kassenrechtlicher Form ist die Ausnahme. Die Betreuungsteams bestehen in wechselnder Zahl und Zusammensetzung u. a. aus Sozialarbeitern, psychiatrischen Fachpflegekräften, Psychologen, Ergotherapeuten, Arbeitserziehern, Freizeit- und Familientherapeuten. Betreutes Wohnen Komplementäre Wohnformen sind ein Kernelement der psychiatrischen Versorgung für Menschen mit chronisch psychischen Störungen, die ohne ein solches Angebot überwiegend in klinischer Langzeitbetreuung verbleiben müssten und damit von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wären. Im Verlauf der Zeit haben sich strukturelle und organisatorische Differenzierungen entwickelt, die unterschiedliche Einschränkungen der Selbständigkeit und Abstufungen der Betreuungsintensität berücksichtigen und sich gliedern lassen in: • Therapeutische Wohnheime - Übergangswohnheime - Langzeitwohnheime - (Außen-)Wohngruppen • Therapeutische Wohngemeinschaften • Betreutes Einzel- oder Paarwohnen • Gastfamilien • Pflegeheime Die Abteilung Gemeindepsychiatrie, von Beginn an in die Planung des ZI einbezogen, und dort seit 1975 fest eingerichtet, beschäftigt sich beratend und koordinierend mit der außerklinischen Versorgung psychisch kranker Menschen in konkreter Praxis und evaluierender Forschung. Sie ist aus einer 1969 gebildeten Arbeitsgruppe – damals die erste Einrichtung dieser Art in der Bundesrepublik – hervorgegangen. Ihr Arbeitsfeld entspricht im Wesentlichen dem Auf- und Ausbau sowie der begleitenden Forschung der außerklinischen psychiatrischen Versorgung, dem sogenannten komplementären System. In diesem Artikel werden die Versorgungsmöglichkeiten für erwachsene psychiatrische Patienten beschrieben, deren Krankheitsverlauf längerfristige fachliche Begleitung erfordert. Forschungsaspekte und das Versorgungssystem von Personen mit Suchtkrankheiten sind nicht in die Darstellung einbezogen. In therapeutischen Wohnheimen leben psychisch Kranke, die keine Behandlung mehr in der Klinik brauchen, aber krankheitsbedingt noch intensiver fachlicher Betreuung bedürfen. Bei umfassender, aber nicht überversorgender Hilfe, die tagsüber und zumeist auch während der Nacht zur Verfügung steht, muss die Aufmerksamkeit aller in der Betreuung Tätigen stets auf medizinische, soziale und berufliche Rehabilitationspotenziale gerichtet sein. Wird dieser Grundsatz vernachlässigt, so schwindet das Ziel der Förderung von höchstmöglicher Autonomie und Selbstversorgung zum Nachteil des Betreuten aus dem Blickfeld. Zeitgemäße Konzepte von Wohnheimen für psychisch Kranke müssen personen- und nicht einrichtungszentriert auf die Angleichung an normale Lebensverhältnisse der psychisch Gesunden ausgerichtet sein. So sind heute nur noch Heimgrößen von 15 bis 30 Plätzen zu vertreten, aufgeteilt in Untergruppen von 3 bis maximal 8 Plätzen. Größere Einheiten erschweren oder verhindern ein Lebensumfeld, in dem Komplementäre Einrichtungen und Dienste Der komplementäre Bereich der psychiatrischen Versorgung, der in seiner heutigen Ausformung erst im Rahmen der Psychiatriereform der letzten 30 Jahre entstanden ist, umfasst Einrichtungen, Fachdienste und Initiativen, die der psychiatrischen Vor- und Nachsorge dienen. In orientierender Übersicht handelt es sich um • Betreutes Wohnen • Arbeitsintegration • Freizeitclubs und Tageszentren/ Tagesstätten • Ambulante Beratung und Betreuung • Sonstiges 27 Wohlbefinden und Zufriedenheit entstehen können. Einzelzimmer und für alle nutzbare Aufenthalts- und Wirtschaftsräume sind als Standard zu fordern, ebenso Angebote für die Einübung lebenspraktischer Fähigkeiten, die Teilnahme am öffentlichen Leben, Möglichkeiten von Arbeit oder Beschäftigung sowie von Freizeitgestaltung. Milieu und Unterstützung im Wohnheim dienen der Vorbeugung sozialer Isolation. Sie sollen die Verbindung zum kommunalen Leben erhalten oder herbeiführen und eine Stabilisierung der Lebensverhältnisse, die Zunahme von Selbstbestimmung und eine Verbesserung der persönlichen Lebensqualität fördern. rung in der Rekrutierung von sogenannten Gastfamilien gefunden. Es ist ein meist von einem Familienpflegeteam einer psychiatrischen Klinik begleitetes Versorgungsmodell, das bisher nur an einzelnen Standorten verwirklicht wurde. Therapeutische Wohnheime als Oberbegriff sind in Übergangswohnheime mit mittelfristiger Aufenthaltsdauer (1 bis etwa 5 Jahre) und Langzeitwohnheime aufgeteilt. Letztere, eingerichtet für Personen mit eingeschränktem Rehabilitationspotenzial oder wenig günstigem Entwicklungsverlauf der Erkrankung, bieten, wenn erforderlich, einen lebenslangen Aufenthaltsort, an dem ohne zeitlichen Druck und ohne überfordernde Therapieprogramme noch Lernerfahrungen und Lebensentfaltung stattfinden können. Entwickeln sich die Fähigkeiten zu autonomer Lebensführung nur unvollständig oder in Teilschritten, bieten sogenannte Außenwohngruppen mit geringerem fachlichen Betreuungsumfang ein passendes Umfeld. Der Bezug besteht institutionell noch zum Heim, die Art der Lebensführung ähnelt aber mehr der in einer Wohngemeinschaft. Arbeitsintegration und Integrationsfachdienst Generell gilt, dass der Aufbau einer komplementären Versorgung im Arbeitsbereich bisher wenig zureichend gelungen ist. Diese ungünstige Situation hat sich noch durch eine Verschlechterung der Wirtschaftslage und Veränderungen der Arbeitsabläufe in Richtung größerer Komplexität verschärft. Dabei und daher sind psychisch Kranke überdurchschnittlich oft arbeitslos und schwer zu vermitteln. Wie im Wohnbereich gibt es auch im Arbeitsbereich unterschiedliche Formen von Angeboten, die sich gliedern lassen in: • Werkstatt für behinderte Menschen • Selbsthilfefirmen/Integrationsfirmen • Zuverdienstprojekte • Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke Die größte Zahl langfristiger Arbeits- und Beschäftigungsangebote auf dem geschützten Arbeitsmarkt findet sich in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die ehemalige Bezeichnung „Werkstatt für Behinderte (WfB)“ ist 2001 mit Wirkung des SGB IX in „Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)“ umbenannt worden. Die WfbM ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Zur Erfüllung dieses Auftrags ist sie in einen Eingangs- und Berufsbildungsbereich sowie einen Arbeitsbereich unterteilt. Außerdem stehen begleitende psychosoziale und psychiatrisch-krankenpflegerische Dienste zur Verfügung, deren Mitarbeiter sich um krankheits- und behindertenabhängige Sonderbelange der Werkstattbeschäftigten kümmern. In Mannheim gibt es 145 Plätze in 5 Therapeutischen Wohnheimen, 30 Plätze in Wohngemeinschaften und 80 Plätze in Apartments oder eigener Wohnung. Die Abteilung Gemeindepsychiatrie berät bei Aufnahme und Betreuung in allen Einrichtungen des betreuten Wohnen und hat die Fachverantwortung für 20 Plätze in Wohngemeinschaften und eigener Wohnung. Therapeutische Wohngemeinschaften und betreutes Einzel- und Paarwohnen sind für psychisch kranke Menschen vorgesehen, die ihren Lebensbereich zwar weitgehend selbständig gestalten können, aber immer noch in unterschiedlichem Ausmaß der psychosozialen (Nach-)Betreuung bedürfen. Inhalte der Betreuung sind persönliche Hilfen bei der Krankheitsbewältigung, bei Konfliktlösungen und Unterstützung im Bereich der Arbeit, der Aus- und Fortbildung sowie der Freizeit. Das Ziel der auf durchschnittlich ein bis drei Jahre angelegten Betreuung durch Fachkräfte – meistens Sozialarbeiter/-pädagogen und psychiatrische Fachpflegekräfte besteht in einer Förderung der sozialen und beruflichen Eingliederung. In Wohngemeinschaften leben drei bis fünf Personen im eigenen Zimmer, Küche und Sanitärbereich werden gemeinsam genutzt. Betreutes Einzel- und Paarwohnen ist für solche Personen geeignet, für die das Leben in einer Gruppe eine Überforderung darstellt oder die allein leben wollen. Die WfbM erfüllt zwei Funktionen. Erstens dient sie mit dem Berufsbildungsbereich der beruflichen Rehabilitation. Zweitens ermöglicht sie durch den sich zeitlich anschließenden Arbeitsbereich vielen behinderten Menschen eine langjährige Teilnahme an der Arbeitswelt, von der sie ohne WfbM ausgeschlossen wären. Ist nach Absolvierung des Berufsbildungsbereichs eine Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende berufliche Das Anfang des 20. Jahrhunderts intensivierte Prinzip der Familienpflege hat seine Erneue28 Trainingsmaßnahme oder Ausbildung, z. B in einem Berufsförderungswerk, nicht möglich, kann der Behinderte auf einen Dauerarbeitsplatz in den Arbeitsbereich wechseln. Die monatliche Grund-Entlohnung ist vielfach gering (meist zwischen 50 und 200 Euro), so dass oft noch Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz erforderlich ist. Der Behinderte erwirbt sich allerdings einen Anspruch auf Altersrente. Primär wurden in den Werkstätten geistig Behinderte beschäftigt, seit den 80er Jahren sind für psychisch Behinderte eigene Zweigstellen oder eigene Werkstätten, vor allem in Ballungsgebieten, aufgebaut. ineinandergreifende Kostenübernahme durch Krankenkasse, Rentenversicherung und Arbeitsverwaltung. Das Antragsverfahren und die auf ein bis zwei Jahre begrenzte Rehabilitationsdauer sind an ein aufwändiges Gutachtenverfahren und Berichtwesen mit günstiger Ergebnisprognose gebunden. Hiermit limitieren enge Zugangskriterien die Möglichkeit der Inanspruchnahme für einen erheblichen Teil psychiatrischer Langzeitpatienten. Immerhin ist mit der RPK erstmals die Finanzierung der Rehabilitation für psychisch Kranke sozialrechtlich der Rehabilitation somatisch Kranker angeglichen. Ein Angebot, das dem freien Arbeitsmarkt noch am nächsten steht, sind Selbsthilfefirmen, heute häufig als Integrationsfirmen bezeichnet. Ihr Ziel ist es, für psychisch Kranke Arbeitsplätze mit branchenüblichem Tariflohn zu schaffen, wobei jedoch Rücksicht auf individuelle Belastungsgrenzen zu nehmen ist. Diese Beschäftigungsform ist für solche Personen geeignet, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen unterund auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überfordert sind. In Mannheim gibt es seit 1996 zehn solcher RPK-Plätze, die in ein Übergangswohnheim integriert sind. Die ärztliche Leitung der RPK liegt in den Händen der Abteilung Gemeindepsychiatrie. Des Weiteren gibt es eine Werkstatt für psychisch behinderte Menschen und eine Selbsthilfefirma. Die Abteilung Gemeindepsychiatrie berät den Sozialdienst der WfbM bei der Betreuung der Rehabilitanden und ist Mitglied im Fachbeirat der Selbsthilfefirma und der WfbM. Zuverdienstprojekte, wie beispielsweise Entrümpelungsdienste oder Secondhandläden, ermöglichen psychisch behinderten Menschen, ihr häufig geringes Einkommen durch stundenweisen Arbeitseinsatz etwas aufzubessern. Neben dem materiellen Anreiz sind solche Beschäftigungen oft eine wichtige Hilfe zur sinngebenden Tagesstrukturierung und Förderung sozialer Kontakte. Sie lassen sich aber auch als Vorbereitung oder zur Überbrückung von Wartezeit auf berufliche Rehabilitationsmaßnahmen nutzen. Freizeitclubs und Tageszentren/Tagesstätten Für Freizeitclubs existieren unterschiedliche Bezeichnungen, die geschichtlich oder aus bestimmter Sicht ableitbar sind. Am häufigsten ist immer noch die Bezeichnung ‚Patientenclubs’ zu finden, obwohl die Besucher sich an diesem Ort selbst nicht als Klienten/Patienten erleben und meistens die Freizeitgestaltung Hauptinhalt der Treffen ist, weshalb hier die Bezeichnung Freizeitclub gewählt wird. Der Ausdruck Kontaktclub ist missverständlich und weniger gebräuchlich, obwohl gesellige Begegnung ein weiteres Hauptanliegen der Besucher ist. Freizeitclubs, meist jede Woche oder alle vierzehn Tage zu fester Zeit für ein bis drei Stunden geöffnet, sind seit den 60er Jahren an vielen Orten verwirklicht. In geselliger Runde und freiwilliger Teilnahme bieten sie ohne viel professionelle Eingriffe, oft tatkräftig und aktivierend unterstützt von Bürgerhelfern, einen schützenden Ort der freien Aussprache, des Verständnisses und der Hilfe füreinander und ein Übungsfeld sozialen Verhaltens. Wenn gewünscht, können sich die Clubbesucher von einem Sozialarbeiter, Psychologen oder Arzt beraten lassen. Der Club hat engere Verbindung zum normalen Leben als zu psychiatrischen Institutionen und fördert die Teilhabe an Geselligkeit, gelegentlich auch die Integration in die Gemeinde. Träger der Clubs sind oft psychosoziale Hilfsvereine oder Selbsthilfeinitiativen. 1986 schuf die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation als Zusammenschluss der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger die Empfehlungsvereinbarung Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke und Behinderte (RPK). Durch sie soll der Mangel eines geeigneten Angebots für die Arbeitsintegration chronisch psychisch Kranker und Behinderter verringert werden. Die Verbindlichkeit der Vereinbarung der RPK ist gering, da sie gesetzlich nicht verankert ist. Modellhaft sollte in jedem Bundesland eine derartige Einrichtung mit 50 Plätzen entstehen, bisher ist es aber nur in acht Bundesländern zu solchen Einrichtungen gekommen. Mittlerweile sind verstreut jedoch auch kleinere Abteilungen, teilweise auch mit ambulanten Plätzen ausgestattet, aufgebaut, womit die Forderung eines gemeindenahen Angebots etwas stärker berücksichtigt ist. Insgesamt beläuft sich die Zahl der RPK-Plätze in der gesamten Bundesrepublik auf ca. 800. Das RPK-Konzept enthält eine Vernetzung medizinischer und beruflicher Rehabilitation sowie eine Für Tagesstätten oder Tageszentren, in die Freizeitclubs integriert sein können, ist die Finanzierung in den deutschen Bundesländern 29 unterschiedlich geregelt und damit auch die Palette ihrer Angebote. Die Notwendigkeit von Tagesstätten wird allgemein akzeptiert. Sie ist insbesondere für solche Kranke wichtig, die alleine, bei Angehörigen oder auch in betreuten Wohngemeinschaften ohne Beschäftigung leben. Für diesen Personenkreis besteht bei mangelnder Aktivierung und fehlender Außenanregung die Gefahr einer zunehmenden Isolierung mit der möglichen Folge einer Zustandsverschlechterung und Notwendigkeit der (Re-)Hospitalisierung. Eine festgelegte Organisationsstruktur von Tagesstätten mit einheitlichem Angebot gibt es nicht. In Abhängigkeit regionaler Unterschiede wird auch eine völlige Übereinstimmung solcher Einrichtungen weder notwendig noch wünschenswert sein. Psychiatrische Tagesstätten unterstehen dem Prinzip der Offenheit und der leichten, möglichst kostenfreien Zugänglichkeit für alle psychiatrisch erkrankten Personen, außer es liegt ein Suchtleiden vor. In der Realität hat sich herausgestellt, dass es ein Angebot ist, das vor allem von chronisch psychisch Kranken in Anspruch genommen wird. Eine regelmäßige Teilnahme, auch wenn sie im Auge zu behalten ist, sollte nicht zwingend sein. Allerdings sollten Tagesstätten wenigstens an allen Werktagen durchgängig und für einige Stunden möglichst auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet sein. Die Kontakt-, Beratungs- und Betreuungsangebote sollen für psychisch Kranke und Behinderte leicht zugänglich sein und möglichst tagsüber und auch nachts zur Verfügung stehen. Das sozialpsychiatrische Zentrum ist als Antwort auf die Notwendigkeit einer krankenorientierten außerstationären Versorgung durch Fachpersonal zu verstehen. Die ärztliche Versorgung erfolgt gesondert. In Mannheim gibt es eine Tagesstätte mit zwei Standorten in Mannheim-Mitte und MannheimSüd sowie fünf Freizeitclubs für verschiedene Altersstufen. Die Abteilung Gemeindepsychiatrie bietet in Kooperation mit der Tagesstätte Mannheim-Mitte einen „Sonntag-Brunch“ an und hat die Fachverantwortung für vier Freizeitclubs und die darin tätigen freiwilligen Bürgerhelferinnen. Ambulante Beratung und Betreuung Ein allein für psychisch kranke und behinderte Menschen geschaffener Fachdienst ist der Sozialpsychiatrische Dienst, der allerdings in den einzelnen Bundsländern unterschiedlich aufgebaut und organisiert ist. Die Aufgaben umfassen das Angebot sozialer Hilfe und nachgehender sowie vorbeugender und aufsuchender Betreuung psychisch kranker und behinderter Menschen. In einigen Diensten gehört ein Arzt zum multiprofessionellen Team, das sich ansonsten aus Sozialarbeitern, wahlweise psychiatrischen Krankenpflegekräften und/oder Psychologen zusammensetzt. In den nördlichen Bundesländern sind die Sozialpsychiatrischen Dienste Teil des öffentlichen Gesundheitswesens, damit steuerfinanziert und meist den Gesundheitsämtern zugeordnet. In den südlichen Bundesländern haben die Sozialpsychiatrischen Dienste eigene Träger - oft sind dies Wohlfahrtsverbände – und hauptsächlich den Charakter von psychiatrischen Spezialdiensten, überwiegend unter der Leitung der Berufsgruppe der Sozialarbeiter/-pädagogen. Ärzte in Diensten an Gesundheitsämtern sind häufig mit Begutachtungen in Unterbringungsverfahren nach dem PsychKG des jeweiligen Bundeslandes betraut. Zur Durchführung medizinischer Behandlungsleistungen sind Ärzte grundsätzlich in keiner der verschiedenen Organisationsformen berechtigt, wohl aber zur Beratung, Information und Entwicklung von Lösungsvorschlägen von Problemen und Krisen, die aus psychischen Erkrankungen erwachsen. In Mannheim ist ein Vertreter der Abteilung Gemeindepsychiatrie Mitglied im Vorstand des Sozialpsychiatrischen Dienstes. Das Angebotsspektrum reicht vom alleinigen Freizeitclub bis zu einer Skala differenzierter Aktivitäten, die auch Arbeitsangebote und eine umfassende Einbeziehung der Bürgerhilfe enthalten. Unerlässliche Elemente einer Tagesstätte sind: • Hilfen zur Alltagsgestaltung und Tagesstrukturierung, • Hilfen zum Erhalt und Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, • Arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote, • Hilfen zur Sicherung rechtlicher und materieller Ansprüche. Bezüglich personeller Ausstattung sollten neben professionellen Betreuern freiwillige Helfer mit dem Einsatzschwerpunkt im aktivierenden und kommunikativen Bereich vertreten sein. Mit der Tagesstätte sind die Begriffe sozialpsychiatrisches, psychosoziales oder gemeindepsychiatrisches Zentrum verbunden. Das sozialpsychiatrische Zentrum ist in seiner theoretischen Konzeption mit einer Beratungs- und Betreuungsfunktion ein umfassendes Gebilde, das eigene Bausteine enthält, die örtlich versammelt oder auch räumlich voneinander getrennt ihren Standort haben können. Sonstiges Zur gemeindepsychiatrischen Versorgung gehören noch viele regionale und lokale Angebote, deren Einzeldarstellung den gegeben Rahmen überschreiten würden. Zur Orientie- Bei diesen Bausteinen handelt es sich um Kontakt- und Beratungsstellen, Tagesstätten sowie Initiativen im Bereich Wohnen und Arbeit. 30 rung sind Verbindungen zu kommunalen Ämtern (z. B. Sozialdezernat/Sozialamt) und Behörden (z. B. Betreuungsbehörde, Vormundschaftsgericht) wie auch die Zugehörigkeit zu (Förder-)Vereinen und verschiedenen Gremien (z. B. Sitz in Beiräten) zu nennen. Wichtig sind konstruktive Kontakte zu Psychiatrischen Kliniken und den Niedergelassenen Nervenärzten. Nicht flächendeckend, aber an vielen Orten gibt es Selbsthilfegruppen für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige, Psychoseseminare und Patientenfürsprecher oder Beschwerdestellen. In Mannheim sind alle aufgeführten Angebote vorhanden. Der Sucht auf der Spur Biochip-Untersuchungen bieten erste Hinweise auf Kandidatengene Sucht ist eine komplexe Erkrankung mit einer starken genetischen Komponente. Wir gehen davon aus, dass die Alkoholabhängigkeit eine polygenetische Erkrankung ist, bei der also nicht nur ein einzelnes Gen, sondern eine Vielzahl von Genen zum Krankheitsverlauf beitragen. Fragt man Suchtforscher nach ihrer Meinung, wie viel Gene letztendlich bei der Ätiologie von Suchterkrankungen involviert sind, reichen die Schätzungen von 30 bis 150 Gene. Wie kann die Forschung heute diese Kandidatengene identifizieren? Schlussbemerkung In den letzten Jahren ist eine Verlagerung der Sichtweise von der institutionszentrierten zur personenzentrierten Versorgung in Gang gekommen, deren praktische Umsetzung, bedingt durch unterschiedliche Problembereiche, allerdings auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Beteiligt sind hieran vor allem sozialpsychiatrisch versierte Fachleute im Austausch mit Angehörigen und psychiatrischen Langzeitpatienten, von denen sich ein Teil selbst als Psychiatrie-Erfahrene bezeichnen. Mit dieser Benennung drücken sie ihre eigene Kompetenz hinsichtlich ihrer psychischer Störungen und den in der Psychiatrie gewonnenen Erfahrungen aus. Gelingt ein respektvoller Umgang der in der Psychiatrie Tätigen mit den Erkrankten und deren Angehörigen, resultiert daraus eine Wendung von einer früher eher paternalistischen zu einer heute eher Autonomie achtenden Haltung. In Verbindung mit diesem Wechsel ist verständlich, dass sich zunehmend Betroffene wie Kunden in einem Dienstleistungssystem bewegen möchten. Grundsätzlich ist eine Entwicklung der Versorgung, zu der die erkrankte Person und ihre Angehörigen Stellung nehmen und Vorstellung äußern können zu begrüßen. Eine platte Analogie zum Prinzip Kunde-Dienstleistung greift aber zu kurz, denn bei den meisten versorgungsbezogenen Aktivitäten geht es nicht allein um die Weitergabe von Sachkompetenz, sondern auch um den Aufbau einer Beziehung. Nur wenn diese grundsätzlich positive Qualität gewinnt, sind günstige Folgen zu erwarten. Auch die Meinung „Betroffene“ haben von vornherein mehr recht als „irgendwelche Experten“ verhindert eine Kooperation, in der die Beteiligten zu einer gemeinsam anerkannten Position kommen. Neben dem klassischen, hypothesengeleiteten Ansatz, der seit einigen Jahrzehnten in dem Suchtforschungsbereich verfolgt wird, kam durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms (als Genom bezeichnet man die Gesamtheit aller Gene eines Organismus), aber auch der Genome unterschiedlicher Tierspezies, eine neue Dimension zur Identifikation von sogenannten Kandidatengenen in Betracht. Man kann heute in einem hypothesenfreien Ansatz im Tiermodell mit modernen molekulargenetischen Methoden Kandidatengene identifizieren. Ein Ansatz, der in vielen Laboratorien weltweit zur Zeit benutzt wird sind Biochips. Was ist ein Biochip? Peter Gebicke-Härter hat bereits in der ZI Information aktuell 2/2001 über den Einsatz von DNA Chips bei psychiatrischen Erkrankungen berichtet. Ein Biochip ist eine kleine Glasplatte, z. B in Form eines Objektträgers, auf dem kleine Tropfen einer DNA-Lösung aufgebracht werden. Jeder einzelne Tropfen enthält Moleküle von nur einer ganz bestimmten DNA. Diese DNA repräsentiert ein Teilstück eines bestimmten Transkripts, also letztendlich eines bestimmten Gens und dient als Sonde. Ein Chip ist mit vielen Tausenden dieser verschiedenen DNASonden bestückt und erkennt somit eine Vielzahl von Genen. Der Chip wird für ein Hybridisierungsexperiment eingesetzt. Dabei lagern sich sogenannte „copy“-DNAs (cDNA) an die exakt passenden Sonden auf dem Chip. Zu diesem Zweck ist es nötig, die Gesamtheit aller Transkripte aus erkranktem und gesundem Gewebe zu isolieren und in cDNAs umzuschreiben. Auf einem Chip werden dann die cDNAs von zwei zu untersuchenden Proben aufgebracht. Die eine Probe stammt z. B. von einem gesunden (Kontroll-)Individuum (Versuchstier), während die zweite Probe dem Hirn eines erkrankten (z. B. alkoholabhängigen) Ver- Burkhardt Voges, Jens Bullenkamp 31 einem anderen, deutlich kostengünstigeren Verfahren herzustellen. Damit steht die Affymetrix-Chiptechnologie als Serviceplattform anderen Arbeitsgruppen des Instituts zur Verfügung. Rainer Spanagel, Peter Gebicke-Haerter suchstiers entnommen wird. Die cDNAs aus beiden Proben werden mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen markiert. Nach Bindung (Hybridisierung) dieser gefärbten DNAs an die Sonden auf dem Chip kann man durch Sichtbarmachung (Scanning) der Farbstoffe ein Muster aufleuchtender Sonden erkennen. Das Muster, das sich beim Scanning des einen Farbstoffs zeigt, unterscheidet sich hier und da vom Muster, das beim Scanning des anderen Farbstoffs sichtbar wird. Diese Unterschiede geben Hinweise auf die Gene, die in dem suchterkrankten Hirn hoch bzw. herunterreguliert sind. Autorinnen und Autoren Dr. Jens Bullenkamp ([email protected]), Stellvertr. Leiter der Abteilung Gemeindepsychiatrie Dr. Bernhard Croissant ([email protected]), komm. Ltd. Oberarzt der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin Seit zwei Jahren benutzen wir diese Technik in der Abteilung Psychopharmakologie um Kandidatengene bei Alkoholabhängigkeit zu identifizieren. Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat Fernando Leonardi die sogenannte AffymetrixChiptechnologie am ZI etabliert und die genomische Antwort nach freiwilliger Alkoholaufnahme in Ratten bestimmt. Das Gewebematerial stammte von verschiedenen alkoholpräferierenden Ratten-Zuchtlinien die über ein Jahr die freie Wahl zwischen Wasser und verschieden konzentrierten Alkohollösungen hatten. Es wurden Gehirnproben von diesen alkoholabhängigen Ratten entnommen und die genomischen Veränderungen im Vergleich zu gesunden Tieren mit Hilfe der Affymetrix-Chips identifiziert. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse müssen noch mit quantitativer PCR abgesichert werden. Sobald das Projekt abgeschlossen und in einem internationalen Fachjournal veröffentlicht ist, wird auch hier im ZI aktuell über die Ergebnisse berichtet. Soviel jedoch vorweg: es zeigt sich, dass die Gene, die in den verschiedenen alkoholpräferierenden Rattenlinien im Vergleich zu den Kontrolltieren herauf- oder herunterreguliert sind, nicht identisch sind. Zudem findet man unterschiedliche Expressionsmuster nach freiwilligem Alkoholkonsum, wenn man verschiedene Hirnregionen separat untersucht. Diese Ergebnisse untermauern die Vorstellung, dass Alkoholabhängigkeit einzelne Bereiche des Gehirns in unterschiedlicher Weise erfasst, und dass sie durch unterschiedliche Genotypen verursacht werden kann. Die Affymetrix-Chiptechnologie ist als „state-ofthe-art“-Technologie sowohl im Humanbereich (z.B. in post-mortem Gewebe), als auch in Maus- und Ratten-Untersuchungen ideal einsetzbar. Es handelt sich aber um ein sehr teueres Verfahren. Pro Chip fallen Kosten um die 800 € an, aussagekräftige Experimente können daher leicht einen fünfstelligen Eurobetrag kosten. Angesichts dieser Situation hat die Abteilung Psychopharmakologie die Voraussetzungen geschaffen, selbst DNA-Chips nach Priv.-Doz. Dr. Harald Dreßing ([email protected]), Leiter des Bereichs Forensische Psychiatrie Prof. Dr. Peter Gebicke-Haerter ([email protected]), Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Psychopharmakologie Dr. Peter Hofmann ([email protected]), Oberarzt der Klinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin Johanna Hohmeister ([email protected]), Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuropsychologie Dr. Petra Hubrich ([email protected]), Koordination Kompetenznetz Demenzen Dr. Manfred Laucht ([email protected]), Leiter der Arbeitsgruppe Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters Dipl.-Psych. Sabine Löber ([email protected]), Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin Dr. Athanasios Maras ([email protected]), Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Prof. Dr. Robert Olbrich, emeritiert Priv.-Doz. Dr. Hans J. Salize ([email protected]), Leiter der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung Prof. Dr. Rainer Spanagel ([email protected]), Leiter der Abteilung Psychopharmakologie Dr. Dipl.-Psych. Kati Thieme ([email protected]), Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters cand. psych. Patricia Trautmann-Villalba ([email protected]), ehemals Arbeitsgruppe Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters Priv.-Doz. Dr. Burkhardt Voges ([email protected]), Leiter der Abteilung Gemeindepsychiatrie Dipl.-Psych. Katrin Zohsel ([email protected]), Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Neuropsychologie 32