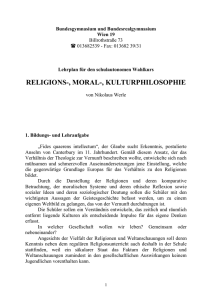Heinz-Dieter Kittsteiner A propos de Samuel Huntington. Oder: Der
Werbung

Heinz-Dieter Kittsteiner A propos de Samuel Huntington. Oder: Der Rückfall hinter die Aufklärung in ein neues Zeitalter der Religionen (Überarbeitete und aktualisierte Fassung) In den täglichen Verlautbarungen der etwas gebildeteren Mitglieder unserer politischen Klasse war es eine Zeit lang Mode, über Samuel P. Huntingtons Buch „The Clash of Civilizations“ herzufallen. Man solle, so hieß es in dem unnachahmlichen Jargon dieser Leute, einen „Kampf der Kulturen“ nicht herbeireden. Dabei war offenbar niemandem aufgefallen, dass schon der deutsche Titel falsch übersetzt ist, denn bekanntlich heißt „clash“ nur Zusammenstoß, nicht aber bereits Kampf der Kulturen. Ganz Kluge, die von Oswald Spenglers Werk der „Untergang des Abendlandes“ wenigstens den Titel gelesen hatten und die vom Hörensagen wussten, dass Spengler irgendwie was mit „Faschismus“ zu tun hätte, murmelten unwillig etwas von NeoSpenglerianismus. Das ging so vor sich hin, bis es einige Probleme am 9. September 2001 gab. Wie wir heute wissen, war das der Auftakt zum 21. Jahrhundert, das ganz anders strukturiert ist als die zweite Hälfte des 20. mit ihren relativ klaren Fronten im „Kalten Krieg“. Inzwischen hat es eine ganze Serie von Zusammenstößen gegeben, Kriege seitens der westlichen Hauptmacht USA gegen Afghanistan und den Irak, den Dauerkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern, Selbstmordattentate in Madrid und London, den Streit um die dänischen Mohammed-Karikaturen, geplante Attentate auch in Deutschland und schließlich, als aktuellster Stand der Dinge, die Rede des Papstes Benedikt XVI. an der Universität Regensburg. Prof. Dr. Joseph Ratzinger hatte eine neue Ausgabe eines Dialogs zwischen dem byzantinischen Kaiser Manuel II. Paleologos und einem schriftkundigen Perser im Winterlager zu Ankara im Jahre 1391 herangezogen, um das schwierige Verhältnis der Religionen darzulegen. Daraus wiederum hatte er eine, wie er selbst sagt, „schroffe“ Formulierung zitiert, in der der Kaiser den Muslim fragt: „Zeige mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst Du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.“ Dieser Satz löste den inzwischen üblichen Proteststurm bei den, wie der SPIEGEL schrieb, „üblichen Beleidigten in der islamischen Welt“ aus. Wie man das auch bewerten will, dem intellektuell schlichter gestrickten Papst Johannes Paul II. wäre ein solcher faux pas nicht passiert. Wir kommen zum Schluss auf diese Kontroverse zurück, wollen nur anmerken, dass das Wochenmagazin schon etwas vorsichtiger mit Huntington umgeht und zu bedenken gibt, ob nicht doch jener „Weltreligionskrieg“ eines Tages ausbrechen könnte, den der amerikanische Professor vor zehn Jahren prophezeit hätte. Doch auch diese Aussage wiederholt nur das vorgefasste Bild von Huntington; wir wollen ihn etwas genauer ansehen. I. Huntington heute Samuel P. Huntington, geboren 1927, ist in den USA so etwas wie ein in Ungnade gefallener Geheimrat. Er war Mitbegründer der Zeitschrift Foreign Affairs und Berater des USAußenministeriums. Wie viele andere, z. B. Franҫis Fukuyama, glaubte auch er zunächst an eine „Friedensdividende“ nach dem Ende der Sowjetunion, sah aber bald ein, dass sich der klassische ideologische „Kalte Krieg“ des 20. Jahrhunderts in eine neue Form der Friedlosigkeit Papst Benedikt XVI: Glaube, Vernunft und Universität, in: FAZ vom 13. September 2006, S. 8. Das Haus des Krieges, in: DER SPIEGEL, 38/2006, S. 68. DER SPIEGEL, ebd., S. 71. verwandelt hatte. Sein 1996 erschienenes Werk ist jetzt, zehn Jahre später, streckenweise schon wieder überholt, so dass wir uns nicht mit seinen strategischen Ratschlägen von damals aufhalten wollen, sondern nur einige Grundzüge auflisten. 1. Der zentrale Gedanke des Buches lautet: die „westliche“ Kultur ist zwar einzigartig, aber sie ist nicht universalisierbar. Diese Einsicht ist nicht wirklich kulturphilosophisch begründet, - insofern sollte man mit dem Hinweis auf Spengler zurückhaltend sein - sondern sie ist für Huntington eine schlichte Machtfrage: „In dem Maße wie die Macht des Westens schwindet, schwindet auch das Vermögen des Westens, anderen Zivilisationen westliche Vorstellungen von Menschenrechten, Liberalismus und Demokratie aufzuzwingen, und schwindet auch die Attraktivität dieser Werte für andere Zivilisationen.“ Deutlich wird damit zugleich, warum Huntington sich in ein relatives Abseits geschrieben hatte, denn die Politik der Bush-Administration ging gerade vom Gegenteil aus: Von einer Universalisierbarkeit der westlichen Werte, die im Ernstfall auch mit Gewalt anderen Kulturen nahegelegt werden dürfen. Inzwischen konstatieren manche eine Hinwendung zu einem neuen Pragmatismus; die „neokonservativen“ Berater, die eine völlig übertriebene Vorstellung von einer Umgestaltung der arabischen Welt verkündet hatten, seien mehrheitlich aus der Regierung verschwunden. Wie dem auch sei, ich will eine Anmerkung zum Begriff „westlich“ machen. Huntington meint damit immer die USA und Europa. Diese Verklammerung ist tatsächlich auf längere Zeit hin unvermeidlich. Die Europäer sollten sich aber dennoch Gedanken machen, welche eigenständige Rolle sie innerhalb dieses „Westens“ spielen können und wollen. 2. Zu Zeiten des „Kalten Krieges“ genügte die Frage: „Auf welcher Seite stehst Du?“ Sie ist nun ersetzt durch die schwierigere Frage: „Wer bist Du?“ An die Stelle ideologischer Konstrukte des 19. und 20. Jahrhunderts wie Nationalismus, Liberalismus und Sozialismus - den Faschismus und den Nationalsozialismus nicht zu vergessen - sind kulturelle Identitäten getreten, die viel weiter in die Geschichte und die Tradition der jeweiligen Gesellschaften zurückreichen. Dass sich europäische Ideologien im 19. und 20. Jahrhundert über die ganze Welt verbreiten konnten, dass ein russischer Prozeß des „Nation-Building“ unter der Fahne des MarxismusLeninismus, ein chinesisches „Nation-Building“ sich unter dem allweisen Lächeln Mao-Tse-Tungs vollziehen konnte, hing mit der Dominanz Europas und seines Denkens auf dem Weltmarkt der Ideen zusammen. Universalistisch war nicht nur der liberale Kapitalismus, universalistisch war auch sein pseudo-marxistischer Gegenspieler. Doch was für beide Varianten Universalismus war, war für den Rest der Welt Imperialismus. Da ist Huntingtons These zuzustimmen: Die Welt wurde 1920 in der Versailler Verträgen zum letzten Male von Europa her aufgeteilt. Auf diese Weise sind mit dem Lineal so schöne Pseudo - Staaten wie der Irak entstanden – mit ihrer sich gegenseitig bekämpfenden Bevölkerung aus Sunniten, Schiiten und Kurden, durch nichts zusammengehalten als durch das damalige Interesse des British Empire. 3. Nur: Diese Welt existiert nicht mehr. Man kann es auch anders sagen: Wir werden es auf dem globalisierten Weltmarkt mit einer je kulturell eingefärbten Varietät von „Kapitalismen“ im Plural zu tun bekommen. Es gibt schon jetzt einen russischen, einen indischen, einen südostasiatischen, einen koreanischen und chinesischen Kapitalismus. An den japanischen haben wir uns längst gewöhnt. Und natürlich gibt es nach wie vor den angelsächsischen Kapitalismus, der wieder anders ist als seine kontinentaleuropäischen Varianten. Insofern ist es nur für bedingt richtig, die Welt noch einmal in „Kulturkreise“ einteilen zu wollen - global kulturkreisfähig sind nur die starken Kapitalismen in ihrem Konkurrenzkampf. Der „clash“ betrifft eben nicht vom jeweiligen Kapital abgelöste „Kulturen“, sondern er färbt die Konkurrenz auf dem Weltmarkt kulturell ein, die nicht nur ein Kampf um Produktion und Absatz ist, Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München Wien 1997, S. 74. Huntington, ebd., S. 138. Andreas Rüesch: Amerika – weiterhin die ‚unentbehrliche Nation‘, in: Neue Zürcher Zeitung, 9./10 September 2006, S. 5. Huntington, ebd., S. 193. Huntington, ebd., S. 22/23. sondern zunehmend auch ein Kampf um die knapper werdenden Ressourcen. Im Grunde haben wir es mit einer Fortschreibung der Annahme Immanuel Wallersteins von den Konflikten der „starken Kerne“ zu tun, die nun nicht mehr „ideologisch“ sondern wieder „kulturell“ aufgeladen sind. 4. Mit dieser letzteren These bin ich schon über Huntington hinausgegangen; ich will aber erst noch seine Quintessenz mitteilen. Huntington selbst mit seiner Rede von den „Blutigen Grenzen des Islam“ und seinen „Bruchlinienkriegen“ hat dafür gesorgt, dass diese Passage meistens übersehen wurde. Er galt als Scharfmacher, ist aber im Grunde friedfertiger, als er sich gibt. Wenn sich die westliche Kultur nicht mehr universalistisch durchsetzen kann, dann ist es das Klügste, auf diesen Universalismus zu verzichten und statt dessen nach den Gemeinsamkeiten innerhalb der verschiedenen Kulturen zu suchen. Ich zitiere Huntington: „Gleichwohl entspringt der gemeinsamen conditio humana doch eine ‚dünne‘ minimale Moral, und es sind in allen Kulturen ‚universale Dispositionen‘ anzutreffen.“10 Nach diesen universalen Dispositionen gilt es zu suchen. Ob die „Weltreligionen“ dafür der rechte Ort zur Diskussion sind, wird sich erst noch zeigen müssen. II. Zurück in die Zukunft - zurück ins 17. Jahrhundert Ich will erläutern, warum diese These Huntingtons für mich als Historiker so interessant ist. Sie kommt mir nämlich bekannt vor. Wir müssen nur „Kulturen“ durch „Konfessionen“ ersetzen und schon sind wir mitten in einer Problemlage, in der sich Herbert v. Cherbury und Benedictus de Spinoza auch befanden. Wie schlichtet man den Streit der friedensunfähigen Konfessionen? Denn im 16. und frühen 17. Jahrhundert waren Katholiken, Lutheraner und Calvinisten sowohl in ihren Glaubensüberzeugungen als auch durch die dahinterstehenden politischen Interessen so ineinander verkeilt, dass nur ein Wechsel des geistigen Terrains helfen konnte, ihren Zusammenstoß zu überwinden. Das ist eine Problemlage, die Carl Schmitt auf den Punkt gebracht hat: „Nach den aussichtslosen theologischen Disputationen und Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts suchte die europäische Menschheit ein neutrales Gebiet, in welchem der Streit aufhörte, und wo man sich verständigen, einigen und gegenseitig überzeugen konnte. Man sah daher von den umstrittenen Begriffen und Argumentationen der überlieferten christlichen Theologie ab und konstruierte ein ‚natürliches‘ System der Theologie, der Metaphysik, der Moral und des Rechts.“11 Man wechselte das Zentralgebiet. Zentralgebiet nannte Schmitt die Diskurse, in denen die gebildete Öffentlichkeit sich über die Probleme ihrer Zeit verständigte. Aus einem theologischen wurde nun ein philosophischer Diskurs. Sie sehen schon, was das für eine Analyse der Gegenwart erbringt: Wir sind (aus guten Gründen) gar nicht mehr gewohnt, einen theologischen Diskurs zu führen; wir sind aber, insbesondere im Fall des Islam gezwungen, uns mit einer Kultur auseinander zu setzen, die ihre Weltsicht in großen Bereichen des Alltags, aber auch in letzten Wertfragen, theologisch deutet. Betrachten wir kurz, in welchen entscheidenden Punkten dieser Übergang im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts verlaufen ist . 1. Die Politik und das „Jus Publicum Europaeum“. Es gibt auf diesem Gebiet eine immanente Dialektik: Weil die Konfessionen zugleich politische Machtfaktoren waren, mussten sie sich zuletzt der politischen Logik beugen. Das geschah beispielsweise im Westfälischen Frieden nach dem Ende des 30-jährigen Krieges. Der Papst 10 11 10 Vgl. dazu den lieblichen Artikel von Gabor Steingart: Weltkrieg um Wohlstand, in DER SPIEGEL 37/2006, S. 44-75. Huntington, ebd., S. 525 f. Carl Schmitt: Der Begriff des Poltischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin 1963, S. 88. protestierte damals gegen den Frieden; es hörte aber niemand mehr auf ihn.12 Das „Silete Theologi in munere Alieno“ des Alberico Gentilis von 1612 war ein Kampfruf, die Religionen auf die Sorge um die Seelen zu beschränken und ihre juristischen Machtansprüche zu begrenzen, vor allem aber, um sie aus der Erörterung des Kriegsbegriffs herauszuhalten.13 Thomas Hobbes erklärte die Konfessionen zur Privatangelegenheit und bewies nebenbei, dass sie in ihrer pluralistischen Friedensunfähigkeit nicht in der „Wahrheit“ stehen könnten, sondern dass sie nur „Meinungen“ seien.14 An die Stelle religiös angefeuerter Kriege um die letzten „Wahrheiten“ trat ein säkularisierter Machtausgleich in der Politik des europäischen Gleichgewichts. Alle Staaten hatten das „ius ad bellum“; sie führten blutige Kriege untereinander, die sogenannten „Kabinettskriege“ des 18. Jahrhunderts um das europäische Gleichgewicht, bei dem jeder mit jedem koalieren konnte – aber sie verteufelten und verketzerten sich nur noch bedingt. Einer war nicht besser als der andere, und jeder hatte sich schon einmal in der Position des Verlierers betrachten dürfen. 2. Die Verinnerlichung der Religionen. Man betrachtet heute den 30-jährigen Krieg als Krieg der europäischen Großmächte, der aber zugleich durch die Konfessionen angeheizt wurde. Am Ende hatten sich alle Konfessionen unglaubwürdig gemacht und es traten neue, verinnerlichte Religionen auf, wie z.B. der Pietismus. Aber auch die Pietisten waren bibelgläubige Streithähne, die für den Buchstaben durchs Feuer gingen, auch wenn sie die Schrift anders auslegten als etwa die protestantische Orthodoxie. Der Pietismus war nur eine kurze Zeit lang kulturell führend; er hat aber nachgewirkt, weil seine Sprache in die Sprache der deutschen Klassik übergegangen ist. Die nachgerade klassisch gewordene Kritik am Pietismus ist der autobiographische Roman von Karl Philipp Moritz, der „Anton Reiser“, der hiermit allen Teilnehmern herzlich ans Herz gelegt werden soll. 3. Der Streit um die Heiligkeit der Texte Erst jene Bewegung, die wir unter dem vagen Sammelnamen „Aufklärung“ zusammenfassen, griff auch die Textgrundlage der „Heiligen Schrift“ an. Luther war noch von der Verbalinspiration der Bibel überzeugt; sie war eben Wort für Wort von Gott eingegeben. Insofern hätte Luther keine Schwierigkeit gehabt, einen gläubigen Muslim zu verstehen, der von der gleichen Grundlage für den Koran ausgeht. Mit der einsetzenden Schriftkritik wurden die „heiligen Texte“ profaniert, bis schließlich Schleiermacher eine Hermeneutik entwarf, in der Text = Text ist. Die heiligen Texte wurden gelesen wie alle anderen Texte auch und durften keine darüber hinausgehende Methode ihrer Auslegung mehr beanspruchen. Wir lassen Schleiermacher beiseite und schauen uns diesen Angriff auf die Heiligkeit der Heiligen Schrift bei Spinoza etwas genauer an. Sein Ausgangspunkt ist von bestürzender Aktualität, und da er exkommunizierter Jude ist, weitet er den Horizont auch gleich über die christlichen Konfessionen hinaus aus: „Ich habe mich oft darüber gewundert, dass Leute, die sich rühmen, die christliche Religion zu bekennen, also Liebe, Freude, Frieden, Mäßigung und Treue gegen jedermann, dennoch in der feindseligsten Weise miteinander streiten und täglich den bittersten Hass gegeneinander auslassen, so dass man ihren Glauben leichter hieran als an jenen Tugenden erkennt. Schon lange ist es so weit gekommen, dass man jeden, ob Christ, Türke, Jude oder Heide, nur an seiner äußeren Erscheinung und an seinem Kult erkennen kann oder daran, dass er diese oder 12 13 14 Reinhard Elze / Konrad Repgen (Hrsg.): Studienbuch Geschichte. Eine europäische Weltgeschichte, Stuttgart 1999, Bd. 2 S.104. Carl Schmitt: Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Eruopaeum, Berlin 1997, S. 131 und S. 212. Vgl. H. D. Kittsteiner: Die Entstehung des modernen Gewissens, Frankfurt/M und Leipzig 1991, S. 229 ff. 11 jene Kirche besucht, oder endlich daran, dass er dieser oder jener Anschauung zugetan ist und auf die Worte dieses oder jenes Meisters schwört. Im übrigen ist der Lebenswandel bei allen der gleiche.“15 Der letzte Satz ist vernichtend, und man sieht auch daran, was Spinoza vom Tragen eines Kopftuches gehalten hätte, wenngleich er einräumt, dass für das gemeine Volk eine Religion bestehen bleiben müsse. Es geht ihm vor allem darum, die kirchlichen Streitereien zu beenden, denn zwar halte man die Heilige Schrift für das Wort Gottes, sie sei aber mit „Hirngespinsten“ der Theologen überwuchert, die damit ihre Machtpositionen verteidigten, Hass und Zwietracht säten.16 Auf die eigentliche Schriftkritik Spinozas kann ich hier nicht eingehen; ich halte mich an seine Konsequenzen. Entkleidet man die Bibel allen rituellen Beiwerks und aller Wundergeschichten, kann man sie auf einen moraltheologischen Kern reduzieren: 1. Es gibt einen Gott 2. Er ist einzig. 3. Er ist allgegenwärtig. 4. Gott hat das höchste Recht, übt es aber in Gnade aus. 5. „Die Verehrung Gottes und der Gehorsam gegen ihn besteht bloß in der Gerechtigkeit und in der Liebe oder Nächstenliebe.“ (NB: Das ist der zentrale Punkt). 6. Wer in dieser Lebensweise Gott gehorcht ist selig, die übrigen sind der Herrschaft der Lüste unterworfen. (NB: Zu den üblen Affekten gehört auch der sogenannte „fromme Eifer“.) 7. Gott verzeiht den Reuigen ihre Sünden.17 Auf diese 7 Punkte sollten sich alle Religionen einigen können. Das ist die „dünne minimale Moral“, nach der auch Huntington sucht. Wohlgemerkt: Das ist nicht Spinozas eigentliche Philosophie; die steht in der „Ethik“. Es ist nur die Grundlage für ein Staatswesen, in dem man frei philosophieren kann. Denn Spinoza zeigt nun, dass zwischen Religion und Philosophie keine Verbindung besteht. Denn der Philosophie geht es um Vernunft und Wahrheit, der Religion aber um Frömmigkeit und Gehorsam.18 Gehorsam aber verlangt auch das weltliche Gesetz. Kommt es mit dem religiösen in Konflikt, wem ist dann zu gehorchen? Spinoza antwortet: Wenn wir eine unbezweifelbare Offenbarung hätten, dann wäre auf jeden Fall Gott zu gehorchen. Weil die Menschen in Religionssachen aber gewöhnlich am meisten irren und ihre eigenen Erfindungen als Gottes Gesetz ausgeben, dann muss um des Friedens Willen dem Staat gehorcht werden.19 Spinoza schlägt sich auf die Seite des Staatswohls, dessen wesentliches Kriterium es für ihn ist, dafür zu sorgen, dass frei über alles gedacht werden darf. Folgt man dieser Linie nicht, dann kommt es dahin – er spricht jetzt von den Theologen –, „dass sie sich deren Autorität und Recht anzumaßen wagen und sich ohne Scheu rühmen, sie seien von Gott auserwählt und ihre Beschlüsse seien göttlich, die der höchsten Gewalten aber nur menschlich und müssten daher den göttlichen, d.h. ihren eigenen Beschlüssen weichen. Niemand kann verkennen, dass dies alles mit dem Staatswohl in völligem Widerstreit steht.“20 Sie sehen, am meisten zuwider war Spinoza ein „Gottesstaat“. Genau in dieser Auseinandersetzung mit sogenannten „Gottesstaaten“ und mit der Neigung, das religiöse Recht (oder wie man es auslegt) über die weltlichen Gesetze zu stellen, stehen wir aber heute wieder. Der machtpolitische Aufstieg des Islam konfrontiert uns mit einer Situation, die Europa im 17. Jahrhundert schon einmal durchgespielt hatte. 15 16 17 18 19 20 12 Baruch de Spinoza: Theologisch-Politischer Traktat, Hg. Günter Gawlick, Hamburg 1976, S. 7 Spinoza, ebd., S. 115 ff. Spinoza, ebd., S. 216 ff. Spinoza, ebd., S. 226. Spinoza, ebd., S. 246. Spinoza, ebd., S. 309. III. Kants „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ Es ist gerade das Buch eines protestantischen Theologen erschienen, der an unserer kleinen Tagung ebenfalls teilnimmt; ich spreche von Friedrich Wilhelm Graf und seinem Buch „Moses Vermächtnis. Über göttliche und menschliche Gesetze“ Er zitiert darin aus der „Enzyklopädie des islamischen Rechts“, abgesegnet durch den „Obersten Rat für Islamische Angelegenheiten“ in Kairo. Darin lesen wir: „Die Scharia ist der Königsweg, die gerade Straße. Gott hat sie aus seinem Wissen gestiftet; er hat die Kenntnis von ihr auf den letzen seiner Propheten herabgesandt und ihr so viel Kraft und Beständigkeit zugemessen, dass sie ewig bleiben wird, geschützt davor, sich zu Nichtigem oder zum Irrtum zu neigen.“21 Das ist eben jene Praktik, die Spinoza angegriffen hatte. Graf zeigt dann, welchen Wandlungen und Auslegungen die christliche lex divina in der Patristik, dem Mittelalter und der Neuzeit erfahren hat. Insofern gibt es einen fließenden Übergang vom göttlichen Gesetz in das Naturrecht. Allerdings muss man auch deutlich hinzufügen, dass dies alles nur möglich war, weil die abendländische Kultur zwei Wurzeln hat: die eine liegt in Athen und die andere in Jerusalem. Diese Grundlagen der europäische Kultur vermischten sich in Rom, insofern war Europa immer in der komfortablen Situation zwischen den beiden Polen: Religion und Philosophie changieren zu können.22 Anders gesagt: die christliche Religionen, die in Europa Fuß fasste, war immer schon philosophisch unterwandert. Wer sich mit philosophisch hochgebildeten Griechen und Römern herumschlagen musste, hatte es nicht leicht die Wahrheit der „Offenbarung“ durchzusetzen.23 Ich möchte mich an einem Punkt ein wenig mit F.W. Graf streiten. Graf schreibt: „In rebus religionis lässt sich kein neutraler Ort des Denkens, keine Vogelperspektive hoch über den konfliktdurchfurchten Glaubenslandschaften der Gegenwart einnehmen.“24 Ich halte diesen Satz für falsch. Sicherlich – er ist eingeschränkt auf die religiösen Dinge. Doch sind die religiösen Dinge die letzten Dinge, jenseits derer es kein Denken mehr gibt? Wenn wir das mitmachen, müssen wir uns auf die eine oder die andere Seite der kämpfenden Parteien schlagen – und stehen dann wieder in der Situation des 16. und 17. Jahrhunderts, die Carl Schmitt beschrieben hatte. Wir sollten doch die vornehmste kulturelle Leistung der europäischen Aufklärung nicht vergessen: Die Bändigung der friedensunfähigen Konfessionen. Das ist eine Aufgabe in der Geschichte. Wenn Graf am Ende seines Buches vorschlägt, den Streit der religiösen Gemeinschaften auf den Jüngsten Tag zu vertagen und er den drei monotheistischen Religionen nahe legt zu bedenken, dass die jeweils menschlichen Auslegungen der lex divina eben nicht die Richtschnur sein werden, „nach dem im letzten Gericht geurteilt wird“25, so ist auch das ein Aufruf zur Toleranz. Nur lässt der „liebe jüngste Tag“ (Luther) auf sich warten; und die vorletzten Dinge müssen in der Zwischenzeit doch auch geregelt werden. Die Position F.W. Grafs erinnert ein wenig an Lessings „Ringparabel“, deren härtere Variante bekanntlich die Schrift „De tribus Impostoribus“ ist – von den drei Betrügern, gemeint sind Moses, Christus und Mohammed.26 Die Wahrheit Gottes ist in die Welt gekommen ist, sie bleibt aber bis zum jüngsten Tag im Verborgenen. In Frage steht: Müssen wir diesen Schritt zurückgehen? Müssen wir, um überhaupt mit 21 22 23 24 25 26 Friedrich Wilhel Graf: Moses Vermächtnis. Über göttliche und menschliche Gesetze, München 2006, S. 23. Rémi Brague: Europa. Eine exzentrische Identität, Frankfurt/M,New York 1993, S. 26 ff. Vgl. dazu das schöne Buch von Peter Brown: Die letzten Heiden. Eine kleine Geschichte der Spätantike, Berlin 1978. Friedrich Wilhelm Graf: Moses Vermächtnis. Über göttliche und menschliche Gesetze, München 2006, S. 20 f. Graf, ebd., S. 91. Vgl. dazu: Friedrich Niewöhner: Veritas sive Varietas. Lessings Toleranzparabel und das Buch Von den drei Betrügern, Heidelberg 1988. 13 Religionen wieder diskutieren zu können, auf die alte Toleranzbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts zurückgreifen? In pragmatischer Absicht würde ich dem zustimmen, denn mit fanatisierten Anhängern einer Religion lässt sich – wenn überhaupt – kein anderer Diskurs führen als ein religiöser. Und doch hat Europa andere Denkformen hervorgebracht. Es ist nie ganz falsch, sich einen Rat bei dem Weltweisen aus Königsberg zu holen. Auf die Umstände der Entstehung seiner Spätschrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ von 1793 kann ich hier nicht eingehen. Nur einige Hinweise. Kants Schrift handelt von ungeheuerlichen Dingen, vom „radikal Bösen“ im Menschen; gemeint ist seine Fähigkeit, aus freiem Willen heraus böse zu sein.27 Das könnte man bei Augustinus auch finden – nicht aber das folgende Lehrstück über die Rückgängigmachung des Sündenfalls aus eigener Kraft.28 Kant braucht diese Möglichkeit für seine Religionskritik; denn hier wie auch an anderen Orten sieht er in der Religion nur einen „Kultus“ zur Gunsterwerbung bei Gott; da wird er ärgerlich und deutlich und spricht von „knechtischer Gemüthsart“, „Andächtelei“ oder von „Frondienst“29 Kant setzt dagegen das Ideal einer „Gott wohlgefälligen Menschheit“30 und einer „unsichtbaren Kirche“. Darunter versteht er die „bloße Idee von der Vereinigung aller Rechtschaffenen unter der göttlichen unmittelbaren, aber moralischen Weltregierung.“31 Das scheint ihm angemessener als die falsche Sicherheit, zu den Auserwählten Gottes zu gehören. In diesem Zusammenhang zitiert er ein persisches Sprichwort über den Hochmut der frommen Pilger: „Ist jemand einmal (als Pilgrim) in Mekka gewesen, so ziehe aus dem Hause, worin er mit dir wohnt; ist er zweimal da gewesen, so ziehe aus derselben Straße, wo er sich befindet; ist er aber dreimal da gewesen, so verlasse die Stadt, oder gar das Land, wo er sich aufhält!“32 Am Ende läuft Kants Schrift auf eine Umkehrung des Verhältnisses von Gnade und Tugend hinaus. Alle Religionen (auch die, die wie der Islam keinen Sündenfall kennen, und daher keine Erlösungsreligionen sind), erhoffen sich Kraft oder „rechte Leitung“ – nichts anderes heißt übrigens: „Sunna“ – vom Befolgen bestimmter Gesetze oder Gebote. Erst muss man von Gott und seinem Gesetz durchdrungen sein, dann kann man tugendhaft oder „richtig“ handeln. Kant kehrt diesen Zusammenhang um: Erst soll man tugendhaft handeln, dann darf man hoffen dass Gott zur Tugend die Begnadigung dazugibt. Es ist diese Eudämonie, die Mithilfe des Gottes, die bei Kant schließlich von der Religionsphilosophie in die Geschichtsphilosophie übergeht.33 Positionen dieser Art wollen wir doch nicht ganz vergessen. Andererseits... IV. Verrecken im Angesicht des abwesenden Gottes Es gibt in der deutschen Literatur viele Varianten des Erschreckens vor der Gott-Losigkeit der Welt. Ich denke an Jean Paul (1763-1825), an seine „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei.“ Darin spricht Christus: „Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels; aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, so weit das Sein seine Schatten wirft, und schaute in den Abgrund und rief: ‚Vater, wo bist du?‘ aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, 27 Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Akademie- Textausgabe, Berlin 1968, Bd. VI, S. 37. 28 Kant, ebd., S. 45 f. 29 Kant, ebd., S. 184. 30 Kant, ebd., S. 61. 31 Kant, ebd., S. 101. 32 Kant, ebd., S. 189. 33 Kant, ebd., S. 202. – Vgl. dazu: H.D. Kittsteiner: Kraft der Vernunft. Religion, Aufklärung und Geschichte in Kants ‚Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft‘, in: Ders.: Listen der Vernunft. Motive geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt/M 1998, S. 73-87. 14 über dem Abgrunde und tropfte herunter. Und als ich aufblickte zur unermesslich Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren bodenlosen Augenhöhle an; und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagete es und wiederkäuete sich. – Schreiet fort, Misstöne, zerschreiet die Schatten; denn Er ist nicht.“34 Doch Jean Pauls Vision ist nur ein böser Traum – im Erwachen findet er Gott und Welt wieder. Vergleichbares gibt es in den „Nachtwachen des Bonaventura“, in Georg Büchners „Woyzeck“ und – mit einem Zeitsprung ins 20. Jahrhundert, bei Martin Heidegger. Als der 1966 von Rudolf Augstein gefragt wurde, wie man denn den Gang der Welt überhaupt noch beeinflussen könne, sagte er, er wolle nun massiv, aber aus langer Besinnung heraus antworten: „Die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken können. Dies gilt nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichen Sinnen und Trachten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Uns bleibt die Möglichkeit, im Denken und im Dichten eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang: dass wir im Angesicht des abwesenden Gottes untergehen.“35 Die Fassung im SPIEGEL ist geschönt. Heidegger hat nicht gesagt „untergehen“, sondern „verrecken“36. Die Welt, so der Denker, ist an das Walten des „GeStells“ übergegangen. Er entschuldigt sich für diesen oft belachten Ausdruck; wer aber seine Schriften einigermaßen kennt weiß, dass „Ge-Stell“ das Heideggersche Äquivalent für der Marxschen Kapitalbegriff ist. Heidegger legt dann noch nach und spricht im Sinne von „Sein und Zeit“ von der Verfallenheit an das Seiende.37 Ich benutze diesen Übergang, um auf Huntington und auf die Rolle der Religionen in der Gegenwart zurückzukommen. Ich hatte zu Anfang gesagt, dass Kulturen und in ihrem Kern die Religionen, die immer kulturprägend gewesen sind, jetzt in den Streit der von den verschiedenen Kapitalen beherrschten Weltmärkte und Weltmächte hineingezogen sind. Was folgt daraus? Man hört oft den Einwand, etwa wenn es um die Bedeutung des Wortes „Jihad“ geht, dies sei gar nicht der „eigentliche“ Islam, sondern eine moderne und im Grunde unzulässige politische Auslegung. „Jihad“ bedeute eben „Bemühung um den Glauben“ (großer Jihad) und erst in abgeleiteter Form einen zulässigen Krieg um die Erweiterung des islamischen Herrschaftsbereiches oder um dessen Verteidigung. Da heißt es dann: „In der Moderne gehört das Konzept des J. zur Rhetorik radialer islamischer Bewegungen und auch muslimischen Staaten bei der Abgrenzung von und der Auseinandersetzung mit dem Westen.“38 Aber sind solche Trennungen zulässig? Eine relativ „reine“ Religion gab es zunächst und zumeist nur bei Religionsstiftern; war sie einmal etabliert, wurde sie immer als Machtfaktor in der Kampf der Mächte hineingezogen. Einen politischen Gebrauch der Religionen hat es immer gegeben; er gehört zu ihrem Wesen und ist nicht etwa ein „Missbrauch“. Ich will es frei nach Heidegger ausdrücken: Alle kirchlich institutionalisierten Religionen sind an das „Seiende“ verfallen. Der Papst war immer ein Machtfaktor; die protestantischen Reichsfürsten waren es auch, der Islam war es von Anbeginn. Daraus folgt: Religionen sind per se nichts, das nur und allein auf eine Transzendenz bezogen wäre; sie sind immer auch diesseitig. Und gerade in dieser Welt können die drei monotheistischen Religionen aggressiv als auch tolerant sein. Ich hatte aus der europäischen Erfahrung der Frühen Neuzeit vier Bedingungen genannt, unter denen Religionen tolerant und daher tolerierbar werden: Sie müssen 1. juristisch entmachtet sein - d.h. sie sollen nicht in das weltliche Recht hineinreden 34 35 36 37 38 Jean Paul: Ehestand Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F.St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel, Hamburg 1964, S. 162. „Nur noch ein Gott kann uns retten“. Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger am 23. September 1966, in DER SPIEGEL 23/1976, S. 209. Martin Heidegger: Speigel-Gespräch, in: Ders. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges, Gesamtausgabe Bd. 16, Frankfurt/M 2000, S. 671. Vgl. dazu: H.D. Kittsteiner: Mit Marx für Heidegger – Mit Heidegger für Marx, München 2004. Ralf Elger/Friederike Stolleis: Kleines Islam-Lexikon, München 2001, S. 146 f. 15 2. gefühlsmäßig verinnerlicht werden - d.h. sie sollen sich um das Heil der Seele und um sonst nichts kümmern 3. philosophisch unterwandert sein - d.h. ihre Sprache muss in andere Denksysteme übertragbar sein 4. hermeneutisch nivelliert werden - d.h. ihre Texte dürfen keine andere Auslegung als die aller Texte beanspruchen. Wohlgemerkt: Das ist die europäische Erfahrung mit den Religionen – gewesen. Denn die Religionen sind wieder im Aufwind. Sie erheben ihr Haupt und werden wieder gefährlicher für das freie Denken. Auf den gegenwärtigen Islam beispielsweise treffen – soweit ich das beurteilen kann – keine dieser Kriterien zu. Aber auch fundamentalistische Christen würden sich vor diesen vier Punkten bekreuzigen und orthodoxe Juden würden sich zornig abwenden. V. Wer soll den Dialog der Kulturen führen? Ich komme auf die Regensburger Vorlesung Papst Benedikts XVI. zurück. Ausdrücklich endet sie mit einer Einladung zu dem großen Dialog der Kulturen „in der Weite der Vernunft“. Das klingt gut – wie konnte es dann kommen, dass die Rede in der islamischen Welt einen solchen Wirbel verursacht hat? Wenn eine islamische Autorität verkündet: „Die Muslime haben das Recht, wütend und verletzt zu sein über diese Kommentare des höchsten christlichen Klerikers“39 dann kann man sich fragen, ob diese Leser der Päpstlichen Rede Zitate von eigenen Aussagen nicht unterscheiden können. Denn der Papst hatte die Kritik am Islam ja einem byzantinischen Kaiser in den Mund gelegt. Andererseits gibt es eine lange Tradition, bestimmte Dinge nicht selbst, sondern eben in Zitaten auszudrücken. Doch bei genauerem Studium der Rede werden die Dinge nicht besser. Ratzinger verficht einen bestimmten Glaubenstypus, dessen Genese im griechisch-christlichen Europa er genau kennt und analysiert hat. Es ist die Entscheidung der frühen Kirche für die Philosophie, die „Option für den Logos gegen jede Art von Mythos“.40 Welche Funktion dieser Primat des Logos für die frühen Christen hatte, muss uns jetzt nicht beschäftigen; wir betrachten nur seine Anwendung in der Regensburger Rede. Und da zieht Ratzinger aus den Worten des oströmischen Kaisers die Konsequenz, dass das gewaltsame Ausbreiten einer Religion nicht vernunftgemäß sei. Anstatt nun aber an die gewaltsame Verbreitung des Christentums etwa in Mittelamerika zur Zeit der Konquistadoren zu denken, folgert Ratzinger, dass der Islam diesen Logos-Gott nicht kenne. „Für die muslimische Lehre hingegen ist Gott absolut transzendent. Sein Wille ist an keine unserer Kategorien gebunden, und sei es an die der Vernünftigkeit.“41 Der Islam ist für ihn eine Form der „Enthellenisierung“ des Glaubens. Das ist ein Prozess, den Benedikt XVI. auch bei Luther und Kant, in der liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts und schließlich in der Gegenwart findet – bei Leuten, die argumentieren, die Hellenisierung des Christentums sei eine „erste Inkulturation“ gewesen, die man anderen Weltkulturen nicht aufdrängen solle, wenn sie denn die Botschaft des Neuen Testamentes aufnehmen und in ihre eigene Tradition stellen wollten. Auch dagegen ist der Papst. Umgekehrt ist er dafür, die „Vernunft“ nicht aus dem Bereich des Glaubens abdrängen zu lassen - sie soll sich dem Göttlichen öffnen. Kants Kritik bedeutet hier gar nichts, bzw. sie wird nach der Formel: „Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“42 bewusst missverstanden. „Eine Vernunft, die dem Göttlichen gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen.“ Das mag so sein – aber die Position des Papstes ist es ebenfalls nicht. Seine Berufung auf die „Vernunft“ hat einen 39 40 41 42 16 Das Haus des Krieges, SPIEGEL 38/2006, S. 70. Joseph Ratzinger: Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, München 1977, S. 90 ff. Benedikt XVI, FAZ, a.a.O. S. 8 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Textausgabe Bd. III, Berlin 1968, S. 19. kleinen Haken. Man kann nicht zum vernünftigen Dialog einladen – und gleichzeitig dem einen Dialogpartner schon von vornherein die Vernunft absprechen, da er eben keinen Logos-Gott, sondern nur einen Willkür-Gott kenne. NB: Mir ist ein Logos-Gott auch lieber als ein WillkürGott – nur ist für einen Dialog damit schon ein unüberwindbares Hindernis aufgebaut. Was hatte Huntington gefordert? Eine dünne minimale Moral und die Suche nach universalisierbaren Gemeinsamkeiten im Dialog der Kulturen. Der Papst scheint dafür nicht besonders geeignet zu sein; er hat eine feste Vorstellung vom Glauben – zu dem er die Anderen einlädt. Viel zu diskutieren gibt es da eigentlich nicht: „‘Nicht vernunftgemäß (,mit dem Logos) handeln ist dem Wesen Gottes zuwider‘, hat Manuel II. von seinem christlichen Gottesbild her zu dem persischen Gesprächspartner gesagt. In diesen großen Logos, in diese Weite der Vernunft laden wir beim Dialog der Kulturen unsere Gesprächspartner ein.“ Das Wort des Lukas 14,23 „nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll werde“ – es hat in der christlichen Zwangsmission und in der Ketzerverfolgung eine fürchterliche Realität erfahren – scheint immer noch nicht überwunden zu sein. Der „Dialog der Kulturen“ darf nicht von den Kirchen und Glaubensgemeinschaften monopolisiert werden. Sie sind wichtig, weil große Teile der islamischen Welt einen religiösen Diskurs führen. Ein solcher Dialog muss jedoch auf allen Gebieten geführt werden, denn es zu befürchten, dass theologische Disputationen so enden werden, wie in dem wunderbaren Gedicht von Heinrich Heine. Der Mönch und der Rabbi führen einen Schaukampf in der mittelalterlichen Aula zu Toledo über die Wahrheit des wahren Gottes. Sie bewerfen sich mit dogmatischen Argumenten, mit Zitaten und Bibelsprüchen, die der andere natürlich nicht anerkennen kann. Erst giftet der Mönch, und der Rabbi antwortet überlegen. Doch dann beruft er sich auf den „Tausves-Jontof“ (wahrscheinlich übrigens ein Missverständnis von Heine, denn eine ähnlich klingende Schrift dieses Namens gibt es erst im 17. Jahrhundert). Und da passiert es: „Aber welche Blasphemie Mußt er von dem Mönche hören! Dieser sprach: der Tausves-Jontof Möge sich zum Teufel scheren. ‚Da hört alles auf, o Gott!‘ Kreischt der Rabbi jetzt entsetzlich, Und es reißt ihm die Geduld, Rappelköpfig wird er plötzlich. Gilt nicht mehr der Tausves-Jontof, Was soll gelten? Zeter! Zeter! Räche Herr die Missetat, Strafe, Herr, den Übeltäter.“43 43 Heinrich Heine: Die Disputation, in: Sämtliche Werke, Leipzig 1913, Bd. III, S. 185 f. 17