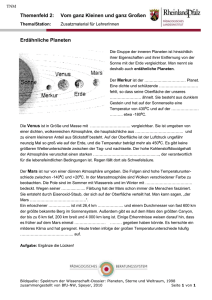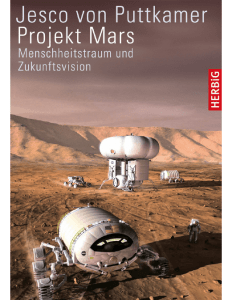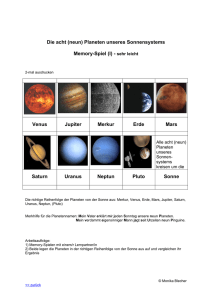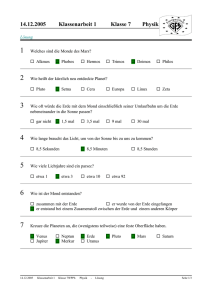Erdchronik B1 - Die Hochtechnologie der Götter
Werbung

Zecharia Sitchin Die Hochtechnologie der Götter Beweise für die Existenz moderner Technologie und Raumfahrt in vorgeschichtlicher Zeit Copyright © 2006, 2004 für die deutschsprachige Ausgabe bei Jochen Kopp Verlag Copyright © 1991 für die deutschsprachige Übersetzung bei Droemer Knaur Verlag, München Aus dem Amerikanischen von Ursula von Wiese Titel der amerikanischen Originalausgabe Genesis Revisited In deutscher Sprache bereits erschienen unter dem Titel Am Anfang war der Fortschritt Copyright © 1990 by Zecharia Sitchin Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Peter Hofstätter, Angewandte Grafik, München Satz und Layout: Agentur Pegasus, Zella-Mehlis Druck und Bindung: GGP Media, Pößneck ISBN 3-930219-62-X Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Pfeiferstraße 52 D-72108 Rottenburg Email: [email protected] Tel.: (0 74 72) 98 06-0 Fax: (0 74 72) 98 06-11 Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter: http://www.kopp-verlag.de 2 Über den Autor Zecharia Sitchin wurde in Rußland geboren und wuchs in Palästina auf, wo er Alt- und Neuhebräisch, weitere semitische und europäische Spra­chen lernte, das Alte Testament sowie die Geschichte und Archäologie des Nahen Ostens studierte. Er ist einer der wenigen Orientalisten, die die sumerische Keilschrift lesen können – die der Schlüssel zum Wissen der menschlichen Schöpfungsgeschichte ist. Nach einem Studium an der London School of Economics war er viele Jahre als einer der führenden Journalisten in Israel tätig. Heute lebt und arbeitet er als anerkannter Altertumsforscher in den USA. Über das Buch Raumfahrt, Gentechnologie, Computertechnik – Leistungen unserer modernen Gesellschaft. Aber neueste Forschungen beweisen, daß schon unsere Vorfahren über diese modernen Erkenntnisse verfügten. Voyager 2 funkte zum Beispiel Bilder von Uranus und Neptun zur Erde, die genau den Beschreibungen der Sumerer von diesen Planeten entsprechen. Findet der moderne Mensch von heute vielleicht nur Anschluß an das Wissen aus der Vergangenheit? Und werden sich Ereignisse aus unserer Historie, wie der Turmbau zu Babel, vielleicht wiederholen? Zecharia Sitchin betrach­tet in diesem Buch die Erkenntnisse unserer Vorfahren im Licht der neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und kommt dabei zu atembe­raubenden Erkenntnissen. Gewidmet meiner Frau Frieda (Rina), geborene Regenbaum, die mich ermutigte, aufzuhören zu reden und anzufangen, über die Nefilim zu schreiben. Inhalt Vorwort4 1 Die Himmelskörper 5 2 Es kam aus dem Weltall 18 3 Im Anfang 30 4 Die Boten der Genesis 43 5 Die Erde - der abgespaltene Planet 58 6 Zeuge der Genesis 71 7 Die Saat des Lebens 88 8 Der Adam - ein Sklave, zum Gehorchen geschaffen 103 9 Die Mutter namens Eva 117 10 Als Weisheit vom Himmel kam 131 11 Eine Raumstation auf dem Mars 148 12 Phobos: Panne oder Krieg der Sterne? 174 13 Geheime Vorbereitungen 191 3 Vorwort In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts sahen wir eine Zunahme des menschlichen Wissens, das die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengt. Unsere Fortschritte auf nahezu jedem Feld der Wissenschaft und Technologie werden nicht mehr in Größenordnungen von Jahrhunderten oder Jahrzehnten gemessen, sondern in Jahren und sogar Monaten. Die erstaunlichsten Errungen­schaften machte der Mensch auf den Gebieten der Astronomie und Raumfahrt einerseits und in der Genetik und in der Entschlüsselung der Geheimnisse des Lebens andererseits. Diese wissenschaftlichen und tech­nologischen Durchbrüche scheinen in ihrer Leistung und Reichweite alles zu übertreffen, was der Mensch je zuvor erreicht hat. Doch ist es möglich, daß die Erdlinge bei ihrem großen Schritt vom Boden des Planeten in den Weltraum, mit dem sie sich auf der Schwelle zum »Gott spielen« befinden und die allem zugrundeliegenden Geheim­nisse des Lebens ergründen, in Wirklichkeit nur antikes Wissen wieder­erlangen – daß wir nichts weiter tun, als erneut in ein Zeitalter einzutre­ten, in dem der Mensch nicht allein auf Planet Erde war? Seit vielen Generationen hat die Bibel mit ihrer Lehre einer suchenden Menschheit als Anker gedient; aber die moderne Wissenschaft schien all das über Bord geworfen zu haben, besonders in der Gegenüberstellung von Entwicklung und Weltschöpfung. In diesem Buch wird gezeigt, daß der Konflikt jeder Grundlage entbehrt, daß die biblische Schöpfungs­geschichte den höchsten Stand wissenschaftlicher Kenntnisse spiegelt. Ist es also möglich, daß all das, was unsere Zivilisation heute über den Planeten Erde und unseren Platz im Weltall sowie über den Himmel entdeckt, nur eine Wiederentdeckung dessen ist, was viel frühere Zivilisa­tionen auf der Erde und auf einem anderen Planet bereits gewußt haben? Diese Frage erhebt sich nicht nur aus wissenschaftlicher Neugier, son­dern sie berührt auch den Kern der Menschheit, ihren Ursprung und ihr Geschick. Sie umfaßt die Zukunft der Erde, eines lebensfähigen Plane­ten, weil sie die vergangenen Ereignisse auf Erden betrifft; sie erhellt, wohin wir gehen, weil sie enthüllt, woher wir gekommen sind. Und die Antwort führt, wie man sehen wird, zu unausweichlichen Schlußfolge­rungen, die von manchen als unglaubhaft angesehen werden, von ande­ren als furchtbar. 4 1 Die Himmelskörper Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Vorstellung vom Anfang aller Dinge beruht auf der modernen Astronomie und Astrophysik. Die Annahme, daß es Leere und Chaos gegeben habe, bevor Ordnung entstand, stimmt mit der neuesten Theo­rie überein, daß Chaos, nicht Stabilität, das Weltall regiert. Außerdem gibt es noch die Behauptung, der Schöpfungsprozeß habe mit einem Blitz begonnen. Bezieht sich das auf den Urknall, das heißt auf die Theorie, das Weltall sei durch eine uranfängliche Explosion entstanden, einen Energieaus­bruch in Form von Licht, so daß die Materie, aus der Gestirne, Felsen und Menschenwesen gebildet sind, in alle Richtungen flog und so die Wunder geschaffen wurden, die am Himmel und auf Erden zu sehen sind? Manche Wissenschaftler haben diese Meinung vertreten. Wie aber konnte der Mensch des Altertums bereits die Theorie vom Urknall kennen? Oder war etwa diese biblische Beschreibung von der Entste­hung unseres kleinen Planeten, der Erde, und des Firmaments schlüs­sig? Konnte der Mensch des Altertums bereits eine Kosmogonie entwickelt haben? Wieviel wußte er wirklich und woher? Es ist nur angemessen, daß wir mit der Suche nach Antworten dort beginnen, wo die Ereignis­se ihren Anfang nahmen – am Himmel. Auch deshalb, weil der Mensch seit unvordenklichen Zeiten das Gefühl gehabt hat, daß dort sein Ursprung, die höheren Werte – Gott, wenn man so will – zu finden seien. So aufregend die Entdeckungen, die ein Mikroskop er­möglicht, auch sind, nur das, was das Teleskop enthüllt, läßt uns die Großartigkeit der Natur und des Weltalls erahnen. Von allen Fortschrit­ten der Moderne sind die Entdeckungen am Himmel zweifellos am eindrucksvollsten. Welche ein überwältigender Fortschritt ist das ge­wesen! Nach nur einigen Jahrzehnten konnte der Erdenbewohner von seinem Planeten abheben, ist meilenweit emporgeflogen und auf sei­nem einzigen Satelliten, dem Mond, gelandet; hat unbemannte Raum­schiffe gestartet, um unsere Nachbarn am Himmel zu erforschen, neue Welten zu entdecken, Satelliten und Ringe. Vielleicht können wir zum erstenmal die Bedeutung der Worte des Psalmisten erfassen: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Eine phantastische Ära planetarischer Erforschung fand einen ange­messenen Abschluß, als im August 1989 die unbemannte Raumsonde Voyager 2 am fernen Neptun vorbeiflog und Aufnahmen und andere Daten zur Erde sandte. Sie wog bloß ungefähr eine Tonne, war aber ausgestattet mit Fernsehkameras, Sensoren, Meßinstrumenten, einem Atomantrieb, mit Sendegeräten und Informati5 onseinheiten (Abb. 1). Die Radioimpulse brauchten selbst bei Lichtgeschwindigkeit über vier Stunden, um die Erde zu erreichen; sie wurden von Radioteleskopan­ tennen auf der Erde eingefangen, die zum Netzwerk der amerikani­ schen National Aeronautics and Space Administration Abb. 1 (NASA) gehö­ren. Dann wurden die Signale in der Forschungsanstalt in Pasadena, Kalifornien (Jet Propulsion Laboratory = JPL), durch elektronische Umwandlung in Fotografien, Tabellen und andere Daten verwandelt. Zwölf Jahre vor der endgültigen Neptun-Mission, im August 1977, hatte man lediglich die Absicht, Voyager 1 und Voyager 2 zum Jupiter und zum Saturn zu entsenden, um die bereits früher von Pioneer 1 und Pioneer 2 erhaltenen Informationen über diese beiden Planeten zu ergänzen. Aber mit bemerkenswerter Erfindungsgabe und Geschick­lichkeit machten sich die JPLPhysiker und -Techniker eine seltene Position der Außenplaneten zunutze und gebrauchten deren Schwer­kraft als »Schleuder«, so daß sie Voyager 2 zuerst von Saturn zu Uranus und dann von Uranus zu Neptun befördern konnten (Abb. 2). So kam es, daß Ende August 1989 in den Medien die üblichen Nach­ richten von Kriegen, politischen Veränderungen, Sportergebnissen und Marktberichten, mit denen die Menschen täglich gefüttert werden, an die zweite Stelle rückten und Schlagzeilen aus einer anderen Welt Priorität bekamen. Einige Tage lang ließ man sich auf der Erde Zeit, eine andere Welt in Augenschein zu nehmen; wir »Erdlinge« Abb. 2 (Quelle: Jet Prosaßen vor unserer Mattscheibe, fasziniert pulsion Laboratory) von Nahaufnahmen eines anderen Pla­ neten, desjenigen, den wir Neptun nennen. Während diese Bilder des bläulichgrünen Himmelskörpers auf dem Fernsehschirm erschienen, betonte der Sprecher wiederholt, daß der Mensch auf der Erde zum erstenmal diesen Planeten sehen könne, der bisher selbst mit den besten Teleskopen nur als mattes Lichtfleckchen in der Dunkelheit des Rau­mes zu erkennen gewesen sei, fast viereinhalbtausend Millionen Kilo­meter von uns entfernt. Er erinnerte die Zuschauer daran, daß der Planet Neptun erst 1846 entdeckt worden ist, nachdem seine Umlauf­bahn aus den Störungen der Bahn des Uranus errechnet worden war, so daß man von seinem Vorhandensein bereits gewußt hatte. Niemand zuvor – weder Isaac Newton noch Johannes Kepler, die im 17. und 18. Jahrhundert die astronomischen Gesetze errechnet hatten, weder Kopernikus, der im 16. Jahrhundert erkannt hatte, daß nicht die Erde, sondern die Sonne der Mittelpunkt unseres planetarischen Systems ist, noch Galileo, der ein Jahrhundert später ein Teleskop benutzte und verkündete, daß Jupiter vier Monde hat –, keiner der großen Astrono­men und 6 bestimmt niemand vor ihnen hatte etwas von Neptun gewußt, wurde uns gesagt. Nicht nur der durchschnittliche Fernsehzuschauer, sondern auch die Astronomen könnten jetzt etwas sehen, was noch niemand erblickt hätte – zum erstenmal konnten wir erkennen, welche Farbe der Neptun hat und wie er beschaffen ist. Aber zwei Monate vor diesem Monat August hatte ich für mehrere amerikanische und europäische Zeitschriften einen Artikel geschrie­ben, der das Gegenteil behauptete: Neptun sei in alter Zeit bekannt gewesen, stand darin, und sollte er entdeckt werden, so würde es nur eine Wiederentdeckung sein. Man werde feststellen, daß er blaugrün ist, daß er wäßrig ist und Flecken aufweist, die wie »sumpfartige Vegetation« wirken! Die elektronischen Signale von Voyager 2 bestätigten dies und noch manches mehr. Sie enthüllten einen schönen blaugrünen Planeten mit einer Atmosphäre aus Helium, Wasserstoff und Methangas, überzogen von rasenden Wirbelwinden, gegen die unsere Hurrikane zahm sind. Unter dieser Atmosphäre kommen geheimnisvolle, riesige »Schmutz­flecken« zum Vorschein, die teils von dunklerem Blau, teils grünlich-gelb sind, vielleicht je nachdem, in welchem Winkel das Sonnenlicht darauf fällt. Wie erwartet liegt die Temperatur der Atmosphäre und der Oberfläche unter dem Gefrierpunkt, aber überraschenderweise hat man festgestellt, daß aus dem Inneren des Planeten Hitze ausstrahlt. Im Gegensatz zu früheren Überlegungen, der Neptun sei ein gasiger Pla­net, ist durch Voyager 2 bekannt geworden, daß er einen felsigen Kern hat, der, wie die JPL-Wissenschaftler es ausdrücken, »in einer dünn­flüssigen Wasser-Eis-Mischung schwimmt«. Diese wässerige Schicht, die den Felsenkern umgibt, während der Planet sich in sechzehn Stun­den einmal um sich selbst dreht, ist wie ein Dynamo, der ein ziemlich großes Magnetfeld erzeugt. Wie sich außerdem herausgestellt hat, umgeben diesen schönen Plane­ ten mehrere Ringe, die aus Felsbrocken, Steinen und Staub bestehen, und er wird von mindestens acht Satelliten oder Monden umkreist. Der größte, Triton, ist nicht weniger spektakulär als sein planetarischer Herr. Voyager 2 bestätigte die Rückläufigkeit dieses Himmelskörpers (der fast so groß wie unser Mond ist): Er umkreist Neptun in einer Richtung, die derjenigen des Neptuns und aller anderen bekannten Planeten unseres Sonnensystems entgegengesetzt ist, nämlich im Uhr­zeigersinn. Abgesehen von seinem Vorhandensein, seiner ungefähren Größe und seiner Umlaufbahn, wissen die Astronomen sonst nichts von Triton. Er ist ein sogenannter »blauer Mond«, da seine Atmosphäre aus Methan besteht. Durch die dünne Atmosphäre ist die Beschaffenheit seiner Oberfläche zu erkennen, eine rötlichgraue Oberfläche mit zacki­gen Erhebungen auf der einen Seite und glatten, fast kraterlosen Flä­chen auf der anderen. Nahaufnahmen lassen auf jüngste vulkanische Tätigkeiten schließen, allerdings sehr merkwürdige: Was das tätige, heiße Innere dieses Himmelskörpers ausspuckt, das ist nicht geschmol­zene Lava, sondern es sind Eisstrahlen. Es war schon vorher angenom­men worden, daß Triton früher fließende Gewässer gehabt hat, mögli­cherweise auch Seen, die es hier, geologisch gedacht, noch vor verhält­nismäßig kurzer Zeit an der Oberfläche gab. Die Astronomen fanden keine andere Erklärung für die Doppelfurchen, die sich 7 Neptun Uranus Abb. 3 meilenweit erstreckten und anscheinend in rechtem Winkel an ein paar Stellen durchschnitten werden, so daß sich rechteckige Flächen ergeben (Abb. 3). Diese Entdeckungen bestätigten also voll und ganz meine Voraussage: Neptun ist tatsächlich blaugrün, besteht größtenteils aus Wasser und weist Flecken auf, die wie »sumpfartige Vegetation« aussehen. Sie sagen mehr aus als eine Farbe, wenn man die eigentliche Bedeutung der Triton-Entdeckungen in Betracht zieht. Die »dunkleren Flecken mit hellerem Halo« lassen die Wissenschaftler der NASA annehmen, daß auf dem Triton »tiefe Tümpel mit organischem Schlick« vorhanden sind. Einer von ihnen, Bob Davis, schrieb im Wall Street Journal, Triton, dessen Atmosphäre ebensoviel Stickstoff enthält, wie auf der Erde vorhanden ist, könnte vielleicht aus tätigen Vulkanen nicht nur Gase und Wassereis schleudern, sondern auch »organische Materie, kohlenstoffhaltige Zusammensetzungen, die anscheinend Triton be­decken«. Diese erfreuliche Bekräftigung meiner Vorhersage war nicht einfach Glückssache. Ich äußerte sie bereits 1976; damals erschien der erste Band meiner Erdchronik-Serie: Der zwölfte Planet. Meine Schlußfol­gerungen beruhten auf jahrtausendealten sumerischen Texten, als ich die rhetorische Frage stellte: »Wenn wir eines Tages Neptun erfor­schen, werden wir dann feststellen, daß seine hartnäckige Verbindung mit Wasser mit den Sümpfen zusammenhängt, die man einstmals dort gesehen hat?« 8 Das wurde ein Jahr vor dem Start von Voyager 2 veröffentlicht und zwei Monate vor der Begegnung mit Neptun von mir in einem Artikel wiederholt. Wie konnte ich denn sicher sein, daß meine Voraussage von 1976 zutreffen würde, wie konnte ich es so kurz vor der Erforschung wagen, etwas erneut zu behaupten, das binnen kurzem vielleicht widerlegt werden würde? Meine Gewißheit basierte auf dem, was im Januar 1986 geschehen war, als Voyager 2 am Uranus vorbeiflog. Uranus ist »nur« ungefähr dreitausend Millionen Kilometer von der Erde entfernt, so weit hinter Saturn, daß wir ihn mit bloßem Auge nicht sehen können. Er wurde 1781 von Friedrich Wilhelm Herschel ent­deckt, einem Musiker und Amateurastronomen, kurz nachdem das Teleskop verbessert worden war. Damals glaubte man, Uranus sei im Altertum unbekannt gewesen und folglich der erste Planet, der in der Neuzeit entdeckt wurde, denn es galt als sicher, daß die alten Völker außer Sonne und Mond nur fünf Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn) gekannt hatten, die sich am Himmelsgewölbe befan­den; von dem, was hinter Saturn lag, habe man nichts gewußt. Aber gerade das, was durch Voyager 2 herausgefunden wurde, bewies das Gegenteil: Zu irgendeiner Zeit mußte ein Volk über Uranus, über Neptun und sogar über den noch entfernteren Planeten Pluto Bescheid gewußt haben! Immer noch analysieren Wissenschaftler die Aufnahmen und Daten von Uranus und seinen erstaunlichen Monden und suchen die Lösung zahlloser Rätsel. Warum rotiert er derart um seine Achse, daß seine Äquatorebene gegen die Bahnebene um 98 Grad geneigt ist, als ob ihm bei einem Zusammenprall mit einem größeren Himmelskörper ein Stoß versetzt worden wäre? Warum wehen seine Winde in umgekehrter Richtung, das heißt im Gegensatz zu der Richtung, die in unserem Sonnensystem normal ist? Warum hat er auf der von der Sonne abge­wandten Seite dieselbe Temperatur wie auf der von der Sonne beschienenen Seite? Und wie sind die ungewöhnlichen Formationen einiger seiner Monde entstanden? Das gilt insbesondere für den Miranda genannten Mond – laut den NASA-Astronomen »einer der rätselhaf­testen Dinge in unserem Sonnensystem« –, auf dem ein erhöhtes flaches Plateau von hundertfünfzig Kilometer langen Klippen abge­grenzt ist, die einen rechten Winkel bilden (die Astronomen bezeichnen es als »Fischgrätenmuster«), und wo auf beiden Seiten dieses Plateaus langezogene Ellipsen mit einer Unzahl von parallelen Furchen zu sehen sind, die man »Rennbahn« nennt (Tafel A und Abb. 4). Zwei Phänomene ragen bei den Uranus-Entdeckungen besonders her­vor, durch die er sich von anderen Planeten unterscheidet. Das eine ist seine Farbe. Dank dem Teleskop und den unbemannten Raumsonden sind wir mit den Farben der anderen Planeten vertraut, mit dem Grau­braun des Merkurs, dem schwefelfarbenen Dunst, der die Venus um­hüllt, dem rötlichen Farbton des Mars, der Mischung aus Rot, Braun und Gelb von Jupiter und Saturn. Aber als die atemberaubenden Bilder des Uranus im Januar 1986 auf den Bildschirmen erschienen, war das verblüffendste seine Farbe: grünlichblau, also eine ganz andere als bei den 9 Tafel A übrigen Planeten. Das zweite Phänomen, ebenso unerwartet, ist seine Beschaffenheit. Die Astronomen hatten angenommen, er sei wie die Riesen Jupiter und Saturn gasig; aber durch Voyager 2 wurde ermittelt, daß er mit Wasser bedeckt ist, doch nicht nur mit einer Eisdecke, sondern mit einem Ozean. Die Atmosphäre besteht zwar aus Gasen, doch darunter rotiert eine ungeheure Schicht – fast zehntausend Kilometer dick! – von überhitztem Wasser, dessen Temperatur etwa 4500 Grad Celsius beträgt. Der Wassermantel umgibt einen geschmolzenen felsigen Kern, wo radioaktive Elemente (oder andere, unbekannte Prozesse) die unge­heuerliche innere Hitze bewirken. Als die Uranus-Bilder auf dem Bildschirm immer größer wurden, je mehr Voyager 2 sich dem Planeten näherte, wies der Moderator auf die ungewöhnliche 10 grünblaue Farbe hin. Unwillkürlich rief ich laut: »Mein Gott, so haben die Sumerer ihn ja beschrieben!« Ich lief in mein Arbeitszimmer, holte mein Handexemplar von Der zwölfte Planet her­vor und blätterte mit zitternden Händen darin, bis ich die betreffende Stelle fand. Ja, da stand es in den uralten Texten: Obwohl die Sumerer kein Teleskop besaßen, hatten sie die Farbe des Uranus mit »Masch Sig« beschrieben, was ich mit »hellgrünlich« übersetzt hatte. Einige Tage später wurden die Ergebnisse der Analyse der Daten von Voyager 2 veröffentlicht, und auch die sumerische Erklärung, Abb. 4 daß Uranus mit Wasser gefüllt sei, fand ihre Bestätigung. Überdies hatte man herausgefunden, daß alle Uranus-Monde aus Gestein und ge­wöhnlichem Wassereis bestehen. Diese Überfülle, ja überhaupt das Vorhandensein von Wasser auf den vermeintlich »gasigen« Himmels­körpern am Rande des Sonnensystems hatte man nicht erwartet. Hier aber haben wir den Beweis für das, was ich in Der zwölfte Planet beschrieben habe: Daß die Verfasser der sumerischen Texte vor Jahr­tausenden nicht nur über das Vorhandensein des Planeten Uranus Be­scheid gewußt haben, sondern auch über seine Farbe und seine Be­schaffenheit! Was bedeutet das alles? Es bedeutet, daß die modernen Wissenschaftler im Jahre 1986 nicht etwa bisher Unbekanntes ent­deckt, sondern es nur wiederentdeckt und uraltes Wissen ans Tageslicht gebracht haben. Weil damit die Glaubwürdigkeit der sumerischen Tex­te erwiesen war, fühlte ich mich imstande, auch vorauszusagen, was man bei der Begegnung der Raumsonde Voyager 2 mit Neptun entdecken würde. Die Flüge der Raumsonde an Uranus und Neptun vorbei bestätigten, daß die Sumerer nicht nur über das Vorhandensein der beiden Planeten Bescheid gewußt haben, sondern auch wesentlich mehr von ihnen wußten. Die Untersuchungen im Jahr 1989 lieferten noch mehr Über­einstimmungen mit den alten Texten. Die Sumerer führten Neptun vor Uranus auf, wie man es von jemandem erwarten würde, der ins Sonnen­system eindringt und zuerst Pluto sieht, dann Neptun und dann Uranus. In diesen Texten oder planetarischen Listen wird Uranus »Kakkab Schanamma« genannt, das heißt »Planet, der das Doppel von Neptun ist«. Die Voyager-2-Daten stimmen damit überein. Uranus gleicht Nep­tun in bezug auf Größe, Farbe und Wassergehalt; beide Planeten sind von Ringen umgeben und werden von einer Unmenge von Satelliten oder Monden umkreist. Eine unerwartete Ähnlichkeit hat sich auch bei den Magnetfeldern ergeben: Der Winkel zwischen Rotationsachse und magnetischer Achse beträgt bei Uranus 58 Grad, bei Neptun 50 Grad. »Neptun scheint ein magnetischer Zwillingsbruder von Uranus zu sein«, berichtete John Noble Wilford in der New York Times. Beide rotieren auch gleich: Sie drehen sich in sechzehn bis siebzehn Stunden um ihre eigene 11 Achse. Wie bei Uranus zeugen die heftigen Winde und die dünnflüssige Was­ser-EisSchicht auf der Oberfläche des Neptuns von der ungeheuren inneren Hitze. In den Berichten des JPL war sogar zu lesen: »Die Temperatur des Neptuns ist genau gleich wie die des Uranus, der doch der Sonne Milliarden Kilometer näher ist.« Darum nahmen die Wissen­schaftler an, daß Neptun irgendwie mehr innere Hitze erzeugt als Uranus, so daß die größere Entfernung von der Sonne wettgemacht wird und beide Planeten die gleiche Temperatur haben. »So kommt ein weiterer Faktor zur Größe und Beschaffenheit hinzu, der Uranus fast zu einem Zwillingsbruder von Neptun macht.« »Planet, der das Doppel ist«, sagten die Sumerer von Uranus im Vergleich zu Neptun. Die Wissenschaftler der NASA bezeichneten sie als Zwillingsbrüder. Das ist ungefähr dasselbe. Der Unterschied be­steht nur darin, daß die sumerische Aussage ungefähr im Jahr 4000 v. Chr. gemacht wurde und die der NASA im Jahre 1969, nahezu sechstausend Jahre später. Im Falle dieser beiden Planeten hat die moderne Wissenschaft nur uraltes Wissen eingeholt. Das klingt unglaublich, aber die Tatsachen sprechen für sich. Dies ist jedoch nur die erste von einer Serie wissen­schaftlicher Entdeckungen, die seit der Veröffentlichung meines Bu­ches Der zwölfte Planet gemacht worden sind und mit meinen damali­gen Beschreibungen übereinstimmen. Wer meine nachfolgenden Bücher Stufen zum Kosmos und Die Kriege der Menschen und Götter gelesen hat, der weiß, daß sie in erster Linie auf dem Wissen beruhen, das uns die Sumerer hinterlassen haben. Sie waren die ersten Menschen, die eine Zivilisation schufen. Scheinbar plötzlich und aus dem Nichts tauchten sie vor sechstausend Jahren auf und verfügten über alle Erfindungen und Neuerungen, die das Fundament unserer eigenen Kultur bilden, ja aller übrigen Zivilisa­tionen und Kulturen in der ganzen Welt. Das Rad, das von Tieren gezogene Gefährt, Boote und Schiffe, Öfen und Ziegelsteine, mehr­stöckige Gebäude, Schrift und Schulen, Gesetze und Richter, König­tum und Stadträte, Musik, Tanz und bildende Kunst, Medizin und Chemie, Weben und Textilien, Religion, Priesterschaft und Tempel – alles, alles begann dort in Sumer, einem Land im Süden des heutigen Irak, im alten Mesopotamien. Vor allem hatte dort die mathematische und die astronomische Wissenschaft ihren Ursprung. Ja, alle grundlegenden Elemente der modernen Astronomie hatten ihren Ursprung in Sumer: Die Definition einer Himmelskugel, des Horizontes und des Zenits, die Einteilung des Kreises in 360 Grad, die Umlaufbahn der Planeten um die Sonne, die Sternbilder, die aus Grup­pen bestehen und Namen tragen, der Tierkreis, die Zeiteinteilung, der sumerische Kalender, der bis heute die Grundlage unseres Kalenders geblieben ist, all das und noch viel mehr begann in Sumer. Die Sumerer verzeichneten ihre kommerziellen und gesetzlichen Transaktionen und schrieben ihre Lebensgeschichte auf Tontafeln (Abb. 5a), gebrauchten Rollsiegel, in die ihre bildlichen Darstellungen seitenverkehrt ein­geschnitzt wurden, die 12 Abb. 5a und b dann als Positiv erschienen, wenn das Siegel auf feuchtem Lehm abgerollt wurde (Abb. 5b). In den Ruinen der sumeri­schen Städte haben die Archäologen in den vergangenen hundertfünf­zig Jahren Hunderte, wenn nicht Tausende von Texten und Abbildun­gen ausgegraben, die mit Astronomie zu tun haben. Darunter sind Listen von Gestirnskonstellationen, die zweifellos stimmen, und Anleitungen für die Beobachtung der auf- und untergehenden Gestirne. Man fand Texte, die sich im besonderen mit dem Sonnensystem befas­sen, andere, die den Umlauf der Planeten um die Sonne in der richtigen Reihenfolge angeben, sogar einen, auf dem die Entfernung zwischen den einzelnen Planeten verzeichnet ist. Man fand Rollsiegel-Abbildun­gen des Sonnensystems, darunter eine, die mindestens viereinhalb-tausend Jahre alt ist und jetzt in der vorderasiatischen Abteilung eines Berliner Museums unter der Nummer VA/243 zu sehen ist (Tafel B). Auf der Abbildung 6a sieht man das Sonnensystem, bei dem die Sonne (nicht die Erde!) im Mittelpunkt steht, umkreist von all den Planeten, die wir heute kennen. Das Tafel B 13 wird klar, wenn man diese bekannten Plane­ten in ihrer richtigen Größe und Anordnung einträgt (Abb. 6b). Kein Zweifel, die Sumerer kannten bereits die vergleichbaren Planeten Ura­nus und Neptun. Allerdings bestehen einige Unterschiede. Sie beruhen nicht auf einem Irrtum des Künstlers oder auf Unkenntnis; im Gegenteil, die beiden Unterschiede sind sehr bedeutungsvoll. Der erste betrifft Pluto. Er hat eine merkwürdige Umlaufbahn, nämlich auf einer Ellipse, so daß er bisweilen (gegenwärtig bis 1999) nicht hinter, sondern vor Neptun und näher der Sonne steht. Darum nehmen die Astronomen seit seiner Entdeckung in Jahr 1930 an, Pluto sei ursprünglich ein Neptun-Mond gewesen, der »irgendwie« – niemand kann sagen, auf welche Weise – von seiner Bindung an Neptun losAbb. 6a und b gerissen worden sei und dann seine unabhängige (allerdings bizarre) Umlaufbahn um die Sonne ein­geschlagen habe. Das bestätigt die uralte Darstellung, aber mit einem bedeutsamen Un­terschied. Auf der sumerischen Abbildung steht Pluto nicht in der Nähe von Neptun, sondern zwischen Saturn und Uranus. Die kosmologi­schen Texte der Sumerer (mit denen wir uns noch befassen werden) besagen, daß Pluto ein Satellit des Saturns gewesen sei, der sich losgerissen habe, um schließlich sein eigenes »Schicksal« zu haben – seine selbständige Umlaufbahn um die Sonne. Diese alte Erklärung des Ursprungs von Pluto zeigt nicht nur Fachwis­sen, sondern auch Differenziertheit. Dazu gehört ein Verständnis für die komplexen Kräfte, die unser Sonnensystem gebildet haben, und für die Entwicklung astrophysikalischer Theorien, durch die Monde zu Planeten werden können oder werdende Planeten scheitern und doch Monde bleiben. Pluto hat es gemäß der sumerischen Kosmogonie geschafft; unser Mond hingegen, der im Begriff war, ein selbständiger Planet zu werden, wurde durch kosmische Ereignisse daran gehindert, Unabhängigkeit zu erreichen. Die modernen Astronomen sind zu der Überzeugung gelangt, daß ein solcher Prozeß in unserem Sonnensystem stattgefunden hat, und zwar erst nachdem die Raumsonden Pioneer und Voyager erkundet haben, daß Titan, der größte SaturnMond, ein solcher werdender Planet war, dessen Loslösung von Saturn unvollendet blieb. Die Entdeckungen in bezug auf Neptun verstärkten die entgegenge14 setzten Spekulationen über Triton, den Neptun-Mond, dessen Durchmesser nur sechshundert Kilometer kleiner ist als derjenige unseres Mondes. Seine besondere Bahn, die vulkanische Tätigkeit und andere unerwartete Eigenschaften ließen die JPL-Wissenschaftler annehmen, daß »Triton ein Gestirn gewesen sein könnte, das sich vor mehreren Milliarden Jahren durch unser Sonnensystem bewegt hat, bis es Neptun zu nahe kam, von dessen Schwerkraft angezogen wurde und den Planeten seither um­kreist«. Wie weit entfernt ist diese Hypothese von der Erkenntnis der Sumerer, daß Planetenmonde selbst Planeten werden können, entweder ihre Stellung am Himmel ändern oder nicht imstande sind, eine unabhängi­ge Bahn zu erreichen? In der Tat, wenn wir die sumerische Kosmogo­nie weiterverfolgen, wird es offensichtlich, daß viele heutige Entdeckungen nicht nur Wiederentdeckungen uralten Wissens sind, sondern daß das alte Wissen auch Erklärungen für manche Phänomene bietet, die moderne Wissenschaftler noch nicht beantworten konnten. Zuerst, bevor der Beweis für diese Behauptung erbracht wird, erhebt sich die Frage: Wie konnten die Sumerer dies vor so langer Zeit überhaupt wissen? Die Antwort gibt uns der zweite Unterschied zwischen der sumerischen Darstellung des Sonnensystems (Abb. 6a) und derjenigen unseres ge­genwärtigen Wissens (Abb. 6b). Es ist das Vorhandensein eines großen Planeten auf der leeren Stelle zwischen Mars und Jupiter. Wir kennen keinen solchen Planeten; aber die sumerischen kosmologischen, astro­nomischen und historischen Texte besagen klipp und klar, daß es noch einen Planeten in unserem Sonnensystem gibt: das zwölfte Gestirn, denn sie zählten nicht nur die zehn (nicht neun) Planeten dazu, sondern auch Sonne und Mond. In den sumerischen Texten wird er Nibiru (Planet der Kreuzung) genannt. Darunter war weder Mars noch Jupiter zu verstehen (wie manche Wissenschaftler eingewendet haben), son­dern ein anderer Planet, eben der zehnte, der sich alle dreieinhalbtau­send Jahre zwischen ihnen hindurch bewegt. Nach ihm habe ich mei­nem ersten Band der Erdchronik den Titel Der zwölfte Planet gegeben, obwohl es nach unserer Zählweise nur zehn gibt, da wir Sonne und Mond nicht dazurechnen. Von diesem Planeten, von Nibiru, sind, wie es in den sumerischen Texten immer wieder heißt, die Anunnaki auf die Erde gekommen; die wörtliche Übersetzung lautet auch: »Die vom Himmel auf die Erde kamen«. In der Bibel werden sie als Anakim bezeichnet, im sechsten Kapitel der Genesis auch als Nefilim, und diese hebräische Bezeichnung bedeutet dasselbe: »Die vom Himmel auf die Erde herabgekommen sind«. Von den Anunnaki haben die Sumerer – wie sie selbst erklärten, als ob sie unsere Frage vorausgeahnt hätten – alles gelernt, was sie wußten. Das für uns erstaunliche Wissen, das die sumerischen Texte verraten, rührt also von den Anunnaki her, die vom Nibiru gekommen sind; sie müssen demnach über eine sehr fortschrittliche Zivilisation verfügt haben, und zwar, wie den sumerischen Texten zu entnehmen ist, vor ungefähr 445 000 Jahren, denn zu dieser Zeit sind die Anunnaki auf die Erde gekommen. Schon damals konnten sie Raumfahrten unterneh­men. Ihre weite elliptische Bahn beschrieb eine Schlinge (das ist der genaue Ausdruck im Text) rund um die Außenplaneten, so daß ihr Raumschiff 15 gewissermaßen ein bewegliches Observatorium war, von dem aus sie alle diese Planeten untersuchen konnten. Es ist also kein Wunder, daß wir heute Dinge entdecken, die zu sumerischer Zeit bereits bekannt waren. Die Frage, warum sich jemand die Mühe gemacht bat, auf dieses kleine Ding zu kommen, das wir Erde nennen, nicht zufällig, nicht nur einmal, sondern alle dreitausendsechshundert Jahre, diese Frage beantworten die sumerischen Texte. Auf ihrem Planeten Nibiru waren die Anunnaki/Nefilim mit einer Situation konfrontiert, mit der wir auf Erden viel­leicht auch bald zu tun haben werden können: ökologische Probleme bedrohten das Leben in zunehmendem Maße. Die Anunnaki mußten ihre gefährdete Atmosphäre schützen, und die einzige Lösung des Problems bestand darin, Goldstaub als Schutzmaterial hineinzumi­schen. (Die Fenster der amerikanischen Raumfahrzeuge sind zum Bei­spiel mit einer feinen Goldschicht bedeckt, um die Astronauten vor Strahlung zu schützen.) Dieses seltene Metall hatten die Anunnaki auf dem siebenten Planeten – von außen nach innen zählend – entdeckt, und sie starteten eine Erdmission, um sich das Gold zu holen. Zuerst versuchten sie, es aus dem Wasser des Persischen Golfs zu gewinnen, doch als das fehlschlug, betrieben sie in Südostafrika mühsamen Berg­bau. Vor etwa dreihunderttausend Jahren schufteten sich die Anunnaki in den Goldminen ab. Dann aber machten sich der Techniker und die Medizinerin genetische Manipulation zunutze und schufen durch Be­fruchtung in vitro den »primitiven Arbeiter«, den ersten Homo sapiens, bis sie genügend Wesen hatten, die ihnen die Arbeit im Bergwerk abnahmen. Mit den sumerischen Texten, die diese Ereignisse beschreiben, und mit der diesbezüglichen kurzen Darstellung im Alten Testament habe ich mich im Buch Der zwölfte Planet ausgiebig befaßt. Die wissenschaftli­chen Aspekte dieser Entwicklung und die von den Anunnaki angewen­dete Technik bilden den hauptsächlichen Inhalt dieses Buches. Die heutigen Naturwissenschaftler machen erstaunliche Fortschritte, aber ihr Wissen ist vorläufig noch längst nicht so umfangreich wie das der Anunnaki. Als sich die Beziehung zwischen den Anunnaki und den Menschenwesen, die sie geschaffen hatten, änderten, als sie beschlos­sen, der Menschheit die Zivilisation zu geben, vermittelten sie ihr einiges von ihrem Wissen und verliehen ihr die Fähigkeit, eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten. Zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden sollen, gehören unter anderem die immer zahlreicheren Beweise für das Vorhandensein des Planeten Nibiru. Wenn es mein Buch Der zwölfte Planet nicht gäbe, würde die Entdeckung des Nibirus kein bedeutenderes astronomisches Ereignis sein als die Entdeckung des Planeten Pluto im Jahr 1930. Es wäre nett zu wissen, daß unser Sonnensystem »da draußen« noch einen Planeten aufweist, und es wäre nett zu wissen, daß unserem Sonnensystem nicht neun Gestirne angehören, sondern zehn. Das würde vor allem den Astrologen gefallen, die für die zwölf Felder oder Häuser des Tierkrei­ses auch zwölf Gestirne brauchen. Nach der Veröffentlichung des Buches Der zwölfte Planet und den darin ent16 haltenen Beweisen – die seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe im Jahr 1976 unwidersprochen geblieben sind – und auch nach den inzwischen fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkenntnis­sen dürfte die Entdeckung des Nibirus nicht bloß eine Angelegenheit astronomischer Lehrbücher sein. Wenn das, was ich geschrieben habe, stimmt, mit anderen Worten, wenn die Sumerer sich über ihre Berichte im klaren waren, dann würde die Entdeckung des Nibirus nicht nur bedeuten, daß es noch einen Planeten in unserem Sonnensystem gibt, sondern auch, daß es dort oben Leben gibt; daß dort überdies intelli­gente Wesen existieren, geistig so fortgeschritten, daß sie vor fast einer halben Million Jahren imstande waren, sich im Weltraum zu bewegen, also Wesen, die alle dreitausendsechshundert Jahre zwischen ihrem Planeten und der Erde kommen und gehen konnten. Nicht nur, daß es den Planeten Nibiru gibt, ist wichtig, sondern auch die Frage, wer ihn bewohnt; davon könnte es abhängen, was unsere politi­sche, religiöse, gesellschaftliche, wirtschaftliche und militärische Ord­nung auf Erden vielleicht erschüttern wird. Wie wird die Reaktion wohl sein, wenn Nibiru gefunden wird? Über diese Frage – ob man’s glaubt oder nicht – ist bereits nachge­dacht worden. Seit wann wird Gold gesucht? Gibt es Beweise dafür, daß schon in der Altsteinzeit in Afrika Gold gesucht wurde? Ja, archäologische Studien haben erwie­sen, daß dies der Fall war. Als der führende Bergwerksbetrieb in Südafrika, die anglo­amerikanische Mining Corporation, feststellte, daß es dort uralte verlassene Minen geben könnte, wo Gold gefunden worden war, beauftragte sie im Jahr 1970 Archäologen mit der Suche nach diesen Minen. In der Werkzeitung der Gesellschaft, Optima, wurden Berichte veröffentlicht, die ausführlich die Entdeckungen in Swaziland und anderen südafrikanischen Gebieten schilderten: Man hatte große Minen gefunden, deren Schächte in eine Tiefe von zwanzig Metern reichten. Steinerne Gegenstände und Kohlenreste gaben die Daten 35 000, 46000 und 60 000 v. Chr. an. Die Archäologen und Anthropologen, die gemeinsam die Untersuchungen vornahmen, vermute­ten, daß die Bergbautechnik bereits in der Zeit um 100 000 v. Chr. in Südafrika bekannt gewesen war. Im September 1988 kam eine internationale Forschergruppe nach Südafrika, um festzustellen, seit wann die Gebiete Swaziland und Zululand bewohnt sind. Die Befunde ergaben eine Besied­lungszeit von 80 000 bis 115 000 Jahren. Die ältesten Goldminen befinden sich in Monotapa in Südzululand, dem heutigen Zimbabwe. Hier erzählen die Sagen der Zulus, sie hätten »als Sklaven für die ersten Menschen gearbei­tet, die sie aus Fleisch und Blut künstlich geschaffen hätten. Diese Sklaven seien mit dem Affenmenschen in den Krieg gezo­gen, als der große Kriegsstern am Himmel erschien« (aus: Indaba My Children von dem Zulu-Medizinmann Credo Vusamazulu Mutwa). 17 2 Es kam aus dem Weltall »Durch die Voyager-Mission wurden wir auf die Bedeutung der Zu­sammenstöße aufmerksam«, erklärt Edward Stone vom California In­stitut of Technology (Caltech), der die Voyager-Programme leitet. »Durch die Zusammenstöße im Weltall könnte das Sonnensystem entstanden sein.« Schon vor sechstausend Jahren haben die Sumerer dies als Tatsache festgestellt. Im Mittelpunkt ihrer Weltanschauung und Religion stand ein umwälzendes Ereignis, das sie Himmelsschlacht nannten. Darauf weisen verschiedene Texte, Hymnen und Sprichwörter hin, genau wie in den Psalmen, im Buch Hiob und anderen Büchern der Bibel. Sie beschrieben es aber im einzelnen, Schritt für Schritt, in einem langen Text, der sieben Tontafeln umfaßt. Vom sumerischen Original sind nur Fragmente gefunden worden; der vollständige Text liegt in akkadischer Sprache vor, der Sprache der Assyrer und Babylonier, die nach den Sumerern in Mesopotamien lebten. Er handelt von der Bildung des Sonnensystems vor der Himmelsschlacht, von der Natur, den Ursachen und Ergebnissen des furchtbaren Zusammenstoßes, und mit einer ein­zigen kosmogonischen Prämisse löst er Rätsel, die unseren Astrono­men und Astrophysikern immer noch Kopfzerbrechen bereiten. Wenn sie aber eine befriedigende Lösung finden, dann – und das ist noch wichtiger – stimmt sie mit derjenigen der Sumerer überein! Vor den Voyager-Entdeckungen vertraten die Wissenschaftler die An­sicht, das Sonnensystem, wie wir es heute kennen, habe kurz nach seiner Entstehung diese Form angenommen, und zwar aufgrund unver­änderlicher Gesetze der Himmelsbewegungen und der Schwerkraft. Klar, es hat Abweichungen gegeben: Meteoriten, die von irgendwoher kamen, die stabile Himmelskörper trafen und mit Kratern versahen, sowie Kometen, die in verlängerter Bahn umherschweiften, auch aus dem All erschienen und wieder ins All verschwanden. Diese Trümmer, hat man angenommen, lassen sich auf ein Alter von viereinhalb Milliar­den Jahre zurückdatieren und sind nichts anderes als planetare Teilstücke, denen es nicht gelungen ist, Planeten, Ringe oder Monde zu wer­den. Noch rätselhafter war der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dem Bodeschen Gesetz zufolge – eine Theorie, die erklärt, warum die Planeten dort entstanden sind, wo sie sich befinden –, müßte es zwischen Mars und Jupiter einen Planeten geben, der minde­stens doppelt so groß wie die Erde ist. Sind die kreisenden Trümmer des Asteroidengürtels die Überreste eines solchen Planeten? Da erhe­ben sich zwei Einwände: Erstens reicht die ganze Masse der Asteroiden dazu nicht aus, und zweitens gibt es keine einleuchtende Antwort auf die Frage, was den Zusammenbruch dieses hypothetischen Planeten verursacht haben könnte – wenn es ein Zusammenstoß war, wann, mit wem und warum? Wie Dr. Sonne zugegeben hat, stellte es sich nach dem Flug zum Uranus im Jahr 1986 heraus, daß sich die ursprüngliche Form des Sonnensystems infol18 ge eines oder mehrerer Zusammenstöße verändert hat. Daß Uranus auf die Seite gekippt ist, das wußte man schon vorher durch teleskopische und andere instrumentelle Beobachtungen. Aber war das von Anfang an der Fall, oder ist es durch äußere Gewalt, durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Himmelskörper, entstanden? Die Antwort auf diese Frage mußte sich aus einer genauen Prüfung der Aufnahmen ergeben, die Voyager 2 Abb. 7 von den Monden des Uranus gelie­fert hat. Diese Monde kreisen um Uranus in seiner schiefen Lage und bilden alle zusammen sozusagen ein Bullauge mit Blick auf die Sonne (Abb. 7). Für die Wissenschaftler ergab sich nun die Frage: Waren diese Monde schon da, als Uranus kippte, oder bildeten sie sich danach, vielleicht aus Materie, die durch den Zusammenstoß gewaltsam hin­ausgeschleudert wurde? Die theoretische Grundlage für die Antwort hat unter anderen Dr. Christian Veillet vom französischen Centre d’Études et de Recherches Geodynamiques geliefert. Wenn die Monde sich gleichzeitig wie Ura­nus gebildet hätten, dann hätte sich das »Rohmaterial«, aus dem sie zusammengesetzt sind, auf der dem Uranus zugekehrten Seite anhäu­fen müssen; die inneren Monde hätten mehr Gestein und eine dünnere Eisschicht haben müssen, die äußeren mehr Wassereis und weniger Gestein. Nach dem Prinzip der Verteilung im Sonnensystem – größe­rer Anteil schwerer Materie in der Nähe, mehr leichtere Materie (Gas) weiter entfernt – müßten die Monde des weiter entfernten Uranus leichter sein als die des näheren Saturns. Aber die Befunde waren anders als erwartet. In den Berichten über die UranusExpedition, die am 4. Juli 1986 in der Zeitschrift Science erschienen sind, gelangten die Wissenschaftler zu der Schlußfolgerung, daß die Dichte der UranusMonde (mit Ausnahme von Miranda) »viel schwerer ist als die der Eissatelliten des Saturns«. Ferner bewiesen die Voyager-2-Daten – ebenfalls im Gegensatz zu dem, was »hätte sein müssen« –, daß die beiden inneren Uranus-Monde Ariel und Umbriel leichter sind (dicke Eisschicht, kleiner Gesteinskern) als die Außen­ monde Titania und Oberon, die größtenteils aus schwerem Gestein bestehen und nur eine dünne Eisschicht haben. Diese Befunde waren nicht die einzigen Hinweise darauf, daß die Monde sich nicht zur selben Zeit wie Uranus gebildet haben, sondern einige Zeit später infolge ungewöhnlicher Umstände. Eine weitere Entdeckung verwirrte die Wissenschaftler, nämlich die Tatsache, daß die Ringe des Uranus pechschwarz sind, »schwärzer als Kohlenstaub«, also wahrscheinlich »aus kohlenstoffhaltiger Materie bestehen, sozusa­gen aus einem Urteer, der aus dem Weltraum gekommen ist«. Die dunklen, verzerrten, schrägen und »bizarr elliptischen« Ringe sind ganz anders als die symmetrischen Reifen aus Eispartikeln, die den Saturn umgeben. 19 Pechschwarz sind auch sechs der zehn neuen Monde, die bei Uranus entdeckt wurden, metergroße Gesteins- und Eisbrocken, die man Schäfermonde nennt, weil sie die Ringe zusammenhalten. Die Folgerung lag nahe, daß die Ringe und kleinen Monde aus den Trümmern »eines gewaltsamen Geschehens in der Vergangenheit des Ura­nus« entstanden sind. Ellis Miner vom JPL hat es mit den einfachen Worten ausgedrückt: »Wahrscheinlich ist ein Eindringling von außen in das Uranus-System gekommen und hat einen früher größeren Mond so hart getroffen, daß er in Stücke zerborsten ist.« Ein katastrophaler Zusammenstoß, der alle die merkwürdigen Phäno­mene des Planeten Uranus sowie seiner Monde und Ringe erklären würde, gewann an Wahrscheinlichkeit, als man feststellte, daß die schwarzen Brocken, aus denen die Uranus-Ringe bestehen, den Plane­ten alle acht Stunden umkreisen, also doppelt so schnell, wie er selbst rotiert, woraus sich die Frage ergibt: Wodurch entsteht diese größere Geschwindigkeit? Wenn man all dies bedenkt, ist die Möglichkeit eines Zusammenstoßes die einzige Antwort. »Wir haben allen Grund zu der Annahme, daß die Bildung der Satelliten von dem Ereignis herrührt, das die Schräglage des Uranus verursacht hat«, interpretierte eine vierzigköpfige Gruppe von Wissenschaftlern die Ergebnisse. Diese NASA-Wissenschaftler äußerten sich bei Pressekonferenzen noch genauer: »Ein Zusammen­stoß mit einem Himmelskörper von der Größe der Erde, der etwa sechzigtausend Kilometer in der Stunde zurücklegt, hätte die Kollision bewerkstelligen können. Wahrscheinlich hat sie sich vor vier Milliar­ den Jahren zugetragen.« Der Astronom Garry Hunt vom Londoner Imperial College faßte es zusammen: »Uranus erhielt vor langer Zeit einen gewaltigen Stoß.« Aber weder in den Vorträgen noch in den langen schriftlichen Berich­ten wurde der Versuch gemacht zu erklären, woher dieser Himmelskör­per gekommen war und wie es geschehen konnte, daß er mit Uranus zusammenstieß. Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zu den Sumerern zurück­kehren. Bevor wir von den Erkenntnissen, die sich die Wissenschaftler in den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erworben haben, zu dem übergehen, was schon vor sechstausend Jahren bekannt war, müssen wir uns noch mit einem anderen Rätsel befassen: Sind die Merkwürdigkeiten des Neptuns Folgen von Zusammenstößen, die nichts mit Uranus zu tun haben, oder handelt es sich um eine einzige Katastro­phe, von der alle äußeren Planeten betroffen waren? Ehe Voyager 2 an Neptun vorbeiflog, wußte man von diesem Planeten lediglich, daß er zwei Satelliten hat: Nereid und Triton. Nereid hat, wie sich herausstellte, eine merkwürdige Umlaufbahn: Er liegt schräg zum Äquator des Planeten (in einem Winkel von 28 Grad) und ist exzen­trisch, denn er beschreibt keinen Kreis, sondern seine Bahn ist in die Länge gezogen, so daß er sich bis zu neun Millionen Kilometer von Neptun entfernt und sich ihm auf eineinhalb Millionen Kilometer wieder nähert. Obwohl Nereid so groß ist, daß er nach der Regel planetarischer Bildung rund sein müßte, hat er die Form eines verdreh­ten Brötchens. 20 Außerdem ist er auf der einen Seite hell und auf der anderen pechschwarz. Alle diese Besonderheiten ließen Martha W. Schaefer und Bradley E. Schaefer in einer umfangreichen Abhandlung (erschienen am 2. Juni 1987 in der Zeitschrift Nature) den Schluß ziehen, daß »Nereid ursprünglich ein normaler Mond des Neptuns (oder eines anderen Planeten) war, und daß sowohl er als auch Triton durch irgendeinen großen Himmelskörper oder einen Planeten in seine sonderbare Umlaufbahn gestoßen wurde ... Man stelle sich vor, daß Neptun ursprünglich ein gewöhnliches Satellitensystem gehabt hat wie Jupiter oder Saturn und daß dann irgendein massiver Himmelskörper kommt und alles durcheinanderbringt.« Die dunkle Substanz auf der einen Seite des Nereid läßt sich auf zweierlei Weise erklären, aber in beiden Fällen spielt ein Zusammen­stoß eine Rolle. Entweder wurde eine vorhandene dunklere Schicht weggefegt, so daß hellere Materie zutage trat, oder der dunkle Stoff gehörte zu dem aufprallenden Himmelskörper und besprenkelte die eine Seite des Nereid. Die letztgenannte Möglichkeit ist einleuchten­der, weil vom JPL am 29. August 1989 verkündet wurde, daß jüngst entdeckte, neue Monde (sechs an Zahl) »sehr dunkel sind und eine unregelmäßige Form haben«, sogar auch der als 1989 NI bezeichnete, dessen Durchmesser ihn normalerweise kugelrund gemacht hätte. Die Theorien, die Tritons verlängerten und rückläufigen Umlauf um Neptun betreffen, sprechen ebenfalls von einem Zusammenstoß. Kurz vor dem Vorbeiflug am Neptun erschien in der Zeitschrift Science ein Artikel von Caltech-Wissenschaftlern (P. Goldberg, N. Murray, P. Y. Longaretti und D. Banfield), in dem sie erklärten, »Triton sei von seinem heliozentrischen Umlauf (Umlauf um die Sonne) infolge eines Zusammenstoßes mit einem damaligen Neptun-Satelliten abgelenkt worden«. Der ursprünglich kleinere Neptun-Satellit sei »dann von Neptun verschlungen worden«. Aber der Zusammenstoß sei so gewal­tig gewesen, daß Tritons Energie nachließ und er von Neptuns Schwerkraft eingefangen wurde. Eine andere Theorie, nach der Triton ein ursprünglicher Neptun-Satellit war, wurde damit als falsch abgetan. Die von Voyager 2 eingebrachten Daten (nach dem Vorbeiflug an Triton) bestätigten die Theorie der Caltech-Wissenschaftler. Sie stimm­te auch mit anderen Studien wie derjenigen von David Stevenson (Caltech) überein, daß sich Tritons innere Hitze und seine Oberflächen­struktur nur dadurch erklären lassen, daß er nach einem Zusammenstoß in die Bahn um Neptun eingefangen wurde. »Woher sind diese Himmelskörper gekommen?« Diese rhetorische Frage stellte der NASA-Wissenschaftler Gene Shoemaker. Aber sie blieb unbeantwortet. Ebenso unbeantwortet blieb die Frage, ob die Umwälzungen bei Uranus und Neptun ein und dieselbe Ursache hatten oder sich unabhängig voneinander ereigneten. Es ist keine Ironie des Schicksals, sondern eher befriedigend, festzu­stellen, daß alle diese Rätsel in den alten sumerischen Texten ihre Beantwortung finden und daß die bisherigen Entdeckungen durch die Voyager-Flüge mit den sumerischen Informationen und meiner Deu­tung in Der zwölfte Planet übereinstimmen. 21 Die sumerischen Texte sprechen von einem einzigen, aber umfassen­den Ereignis. Sie erklären nicht nur, was die modernen Astronomen hinsichtlich der äußeren Planeten zu erklären versucht haben, sondern auch die für uns näherliegenden Fragen nach dem Ursprung der Erde und ihres Mondes, des Asteroidengürtels und der Kometen, und sie erzählen sodann eine Geschichte, die die Theorie der Anhänger der Lehre von der Weltschöpfung mit der Entwicklungstheorie in Einklang bringt und besser als beide erläutert, was sich auf der Erde zugetragen hat und wie der Mensch und die Zivilisation entstanden sind. Demnach begann alles, als das Sonnensystem noch jung war. Die Sonne (Apsu in den sumerischen Texten, das heißt »Was von Anfang an da war«), ihr kleiner Gefährte Mummu, unser Merkur (»Der geboren wurde«) und etwas weiter entfernt Tiamat (»Mädchen des Lebens«) waren die ersten Gestirne des Sonnensystems; danach wurden allmäh­lich drei Planetenpaare »geboren«, Venus und Mars zwischen Mummu und Tiamat, die beiden Riesen Jupiter und Saturn hinter Tiamat und weiter draußen Uranus und Neptun (Abb. 8). In diesem Sonnensystem, das nach seiner Bildung noch keine Stabilität hatte – meiner Schätzung nach etwa vor vier Milliarden Jahren –, tauchte ein Eindringling auf. Die Sumerer nannten ihn Nibiru, die Babylonier tauften ihn zu Ehren Abb. 8 22 ihres Hauptgottes in Marduk um. Er kam aus dem Weltraum, aus der »Tiefe«, wie es in dem alten Text ausgedrückt wird. Als er sich den äußeren Planeten unseres Son­nensystems näherte, wurde er hineingezogen. Wie erwartet zog ihn Neptun (im Sumerischen Ea, »Dessen Haus Wasser ist«) als erster der Außenplaneten mit seiner Schwerkraft an; der sumerische Text lautet: »Ea brachte ihn hervor.« Nibiru/Marduk bot einen prachtvollen An­blick – lockend, funkelnd, erhaben, großartig, edel, so wird er be­schrieben. Funken und Blitze entsandte er auf Neptun und Uranus, als er an ihnen vorbeizog. Das mochte davon herrühren, daß er bereits von seinen eigenen Satelliten umkreist wurde, die sich infolge der Anzie­hungskraft der Außenplaneten gebildet hatten. Der alte Text spricht von seinen »vollkommenen Mitgliedern ... schwer wahrnehmbar ... Vier waren seine Augen, vier seine Ohren«. Als er sich Ea/Neptun näherte, wölbte er sich an der einen Seite, »als ob er einen zweiten Kopf hätte«. Geschah es da, daß die Wölbung wegge­rissen wurde und Neptuns Mond Triton entstand? Dafür spricht die Tatsache, daß Nibiru/Marduk im Gegensatz zu den anderen Planeten rückläufig (im Abb. 9 Uhrzeigersinn) ins Sonnensystem eintrat (Abb. 9). Nur diese sumerische Einzelheit – eben die Rückläufigkeit im Gegensatz zu allen anderen Planeten – kann die Rückläufigkeit Tritons, die ausgeprägte elliptische Bahn aller übrigen Satelliten und der Kometen sowie die übrigen Merkwürdigkeiten, auf die wir noch zu sprechen kommen, erklären. Noch mehr Satelliten entstanden, als Nibiru/Marduk an Anu/Uranus vorbeizog. Dazu lautet der sumerische Text: »Anu brachte die vier Winde hervor« – ein klarer Hinweis auf die vier größeren Monde des Uranus, die sich, wie wir jetzt wissen, nur beim Zusammenstoß, der Uranus umkippte, gebildet haben können. An einer späteren Stelle des alten Textes ist zu ersehen, daß Nibiru/Marduk infolge dieser Kollision drei Satelliten gewann. Die sumerischen Texte beschreiben zwar, wie Nibiru/Marduk nach seiner endgültigen Gefangenschaft im Sonnensystem den Außenplaneten noch öfter begegnete und ihnen ihre heutige Form und Stellung verlieh, aber schon die erste Begegnung erklärt die mannigfachen Rätsel, vor denen die moderne Astronomie in bezug auf Neptun und Uranus sowie ihre Monde und Ringe steht. Nachdem Nibiru/Marduk an Neptun und Uranus vorbeigekommen war, wurde er mitten ins planetarische System gezogen, als er in die ungeheure Anziehungskraft von Saturn (Anschar, »Vorderster des Him­mels«) und Jupiter (Kischar, »Vorderster des Festlandes«) geriet. Als Nibiru/Marduk »sich näherte und wie zum Kampf« vor Anschar/Saturn stand, »küßten sich die beiden Planeten«. Da 23 wurde »das Schicksal« von Nibiru/Marduk, nämlich seine Bahn, für immer geändert. Da wur­de auch Saturns Hauptsatellit Gaga (vermutlich Pluto) in die Richtung von Mars und Venus gezogen, was nur durch Nibirus rückläufige Kraft möglich war. Auf einer weiten elliptischen Bahn kehrte Gaga dann zur äußersten Reichweite des Sonnensystems zurück. Er »sprach mit« Neptun und Uranus, als er in seinem Lauf ihre Bahn kreuzte. Das war der Anfang des Prozesses, durch den Gaga unser Pluto wurde, dessen besondere elliptische Bahn ihn mitunter zwischen Neptun und Uranus hindurchfährt. Nibirus neues »Schicksal«, seine Bahn, ließ ihn jetzt unwiderruflich auf den alten Planeten Tiamat zusteuern. Diese Zeit, verhältnismäßig früh, was die Bildung des Sonnensystems betrifft, war von Instabilität gekennzeichnet, besonders (das erfahren wir aus dem sumerischen Text) im Bereich von Tiamat. Während andere Planeten auf ihrer Bahn immer noch wackelten, wurde Tiamat von den beiden Riesen hinter sich und den beiden kleineren Planeten zwischen sich und der Sonne hin und her gezogen. Infolgedessen riß sich »eine Heerschar« von Satelliten von ihm los, »wutentbrannt«, wie es die poetische Sprache des Textes (den die Altertumsforscher Epos der Schöpfung nennen) ausdrückt. Diese Satelliten, »tobende Ungeheuer, schrecklich gekleidet und mit einem Halo gekrönt«, wirbelten herum und kreisten torkelnd, als ob sie »Himmelsgötter« (Planeten) wären. Die größte Gefahr für die Stabilität und Sicherheit der anderen Planeten war Tiamats »Heerführer«, ein großer Satellit, der einen fast planeten­artigen Umfang annahm und im Begriff war, sein unabhängiges »Schick­sal« zu erlangen, das heißt seine eigene Umlaufbahn um die Sonne. »Tiamat belegte ihn mit einem Zauber, ersah ihn dazu aus, unter den Himmelsgöttern zu sitzen.« Im Epos der Schöpfung heißt er Kingu, »Großer Gesandter«. Jetzt hebt sich der Vorhang, und das Drama entfaltet sich. Ich habe es Szene um Szene in meinem Buch Der zwölfte Planet geschildert. Wie in der griechischen Tragödie war die »Himmelsschlacht« unvermeid­bar, als Schwerkraft und magnetische Kräfte sich unerbittlich am Spiel beteiligten und zu dem Zusammenstoß zwischen dem herannahenden Nibiru/Marduk samt seinen sieben Satelliten (»Winde« im sumeri­schen Text) und Tiamat, samt seiner »Heerschar« von elf Satelliten, die Kingu befehligte, führten. Obwohl Tiamat, der entgegen dem Uhrzeiger rotierte, und Nibiru/Marduk, der im Uhrzeigersinn rotierte, sich auf Kollisionskurs befan­den, stießen die beiden Planeten nicht zusammen, eine Tatsache von entscheidender astronomischer Bedeutung. Es waren die Satelliten oder »Winde« (wörtliche Bedeutung: »Die an der Seite sind«) von Nibiru/Marduk, die mit Tiamat und dessen Satelliten zusammenprall­ten. Von dieser ersten Begegnung, der ersten Phase der »Himmelsschlacht« (Abb. 10), heißt es im Epos der Schöpfung: »Die vier Winde, denen nichts entrinnen konnte, stellte er auf, den Südwind, den Nordwind, den Ostwind, den Westwind. Dicht an seiner Seite hielt er das Netz, 24 das Geschenk seines Großvaters Anu, den bösen Wind, den Wirbelwind und den Sturm. Er sandte die Winde ab, die er geschaffen, alle sieben, Tiamat zu behelligen. Sie erhoben sich hinter ihm.« Die sieben Satelliten von Nibiru/Marduk waren die hauptsächlichen »Waffen«, mit denen Tiamat in der ersten Phase der »Himmelsschlacht« angegriffen wurde. Aber es gab noch mehr: »Vor sich hatte er den Blitz, mit lodernder Flamme füllte er seinen Körper. Dann machte er ein Netz, Tiamat darin zu fangen. Ein schrecklicher Halo war um seinen Kopf gewunden. Er war eingehüllt in Grauen wie in einen Mantel.« Als die beiden Planeten einander so nahe gekommen waren, daß Nibiru/Marduk »Tiamats Inneres erforschen und Kingus Vorhaben durch­schauen konnte«, griff er sie mit seinem »Netz« (Magnetfeld?) an, um sie einzufangen, und schoß ungeheure elektrische Blitze (»göttliche Blitze«) auf sie ab. »Tiamat war erfüllt von Helligkeit, verlangsamte sich, erhitzte sich und blähte sich.« Große Löcher entstanden in ihrer Kruste, ließen vielleicht Dampf und vulkanische Materie hervorbre­chen. In die sich vergrößernde Öffnung warf Nibiru/Marduk einen seiner Satelliten, den sogenannten »bösen Wind«. »Er zerriß Tiamats Bauch, drang in ihr Inneres ein und spaltete ihr Herz.« Abb. 10 Abgesehen davon, daß Tiamats Herz gespalten wurde, so daß »ihr Leben erlosch«, besiegelte die erste Begegnung auch das Schicksal der sie umkreisenden kleinen Satelliten – außer dem des planetenhaften Kingu. Eingefangen im »Netz« – in der magnetischen Anziehungs­kraft des Planeten Nibiru/Marduk –, zertrümmert, zerbrochen, wur­den Tiamats Satelliten aus ihrer Bahn geschleudert und gezwungen, eine neue Bahn in umgekehrter Richtung einzuschlagen. »Zitternd vor Angst kehrten sie ihr den Rücken.« So entstanden die Kometen, so erhielten sie, wie wir aus einem sechs­tausend Jahre alten Text lernen, ihre stark elliptische und rückläufige Bahn. Was Kingu, Tiamats Hauptsatelliten, betrifft, so belehrt uns der Text, daß er in der ersten Phase der »Himmelsschlacht« lediglich seine erworbene Unabhängigkeit verlor. Nibiru/Marduk raubte ihm sein »Schicksal«; er machte Kingu zu einem Duggae, 25 »einer leblosen Lehmmasse« ohne Atmosphäre, ohne Wasser und ohne radioaktiven Stoff, dazu verurteilt, zusammengeschrumpft, »in Fesseln« um die geschla­ gene Tiamat zu kreisen. Nachdem Nibiru/Marduk Tiamat ausgeschaltet hatte, folgte er seinem neuen »Schicksal«. Der sumerische Text läßt keinen Zweifel daran, daß der ehemalige Eindringling nun die Sonne umkreiste: »Er durchquerte den Himmel und überblickte die Regionen, und er hatte Anteil an Apsus Maß. Der Herr, er hatte Anteil an Apsus Maß.« Nachdem Nibiru/Marduk die Sonne (Apsu) umkreist hatte, bewegte er sich in weite Ferne. Doch da er jetzt für immer an den Umlauf um die Sonne gebunden war, mußte er zurückkehren. Auf seinem Rückweg rund um Ea/Neptun und Anschar/Saturn wurde er als Sieger gefeiert. Dann zwang ihn seine neue Bahn zur Rückkehr zum Kriegsschauplatz, zu Tiamat, »die er gebunden hatte«. »Der Herr hielt inne, um ihren leblosen Körper zu betrachten. Er wollte das Ungeheuer kunstvoll teilen. Dann spaltete er sie wie eine Muschel in zwei Teile.« Mit diesem Akt erreichte »die Schöpfung des Himmels« ihr Ende, und es begann die Schöpfung der Erde und ihres Mondes. Der obere Teil, ihr »Schädel«, wurde von dem Nibiru-Satelliten getroffen, der Nord­wind hieß, und flog mitsamt Kingu zu »einem Ort, den niemand gekannt hatte, auf eine Bahn, wo nie zuvor ein Planet gewesen war«. Die Erde und unser Mond waren erschaffen! (Abb. 11) Der andere Teil wurde kurz und klein geschlagen. Tiamats untere Hälfte, ihr »Schwanz«, wurde »zusammengehämmert zu einem Arm­ band am Himmel«: »Er fügte die Stücke zusammen, als Wächter stellte er sie auf. Er bog Tiamats Schwanz, so daß er das Große Band gleich einem Armreifen bildete.« So wurde das Große Band, der Asteroidengürtel, geschaffen. Nachdem Nibiru/Marduk Tiamat und Kingu erledigt hatte, »durchquer­te er wie26 Abb. 11 Abb. 12 der den Himmel und überblickte die Regionen«. Diesmal befaßte er sich mit den Zwillingen Neptun und Uranus und verlieh ihnen ihre endgültige Gestalt. Laut dem alten Text sorgte er auch für das endgültige »Schicksal« von Gaga/Pluto und wies ihm einen »ver­borgenen Ort zu, einen bisher unbekannten Himmelsteil«. Er war weiter entfernt als Neptuns Standort; er war, wie es heißt, »in der Tiefe«, weit draußen im Weltall. Wegen seiner neuen Stellung als äußerster Planet erhielt er auch einen neuen Namen: Usmi (»Der den Weg weist«); denn er ist der erste Planet, den man treffen würde, wenn man von draußen ins Sonnensystem käme. So kam Pluto auf die Bahn, die jetzt seinen Umlauf bestimmt. Nachdem Nibiru/Marduk den Planeten ihren Standort te, baute er angewiesen hat­ sich selbst zwei »Wohnungen«, eine am »Firmament«, wie der Asteroidengürtel im Epos der Schöpfung genannt wird, und eine zweite weit draußen »in der Tiefe«, die »Große ferne Wohnung« oder Escharra (»Wohnung des Herrschers«) hieß. Das sind die beiden Pla­ netenstellungen, die moderne Astronomen Perigäum (der Sonne am nächsten) und Apogäum (der Sonne am fernsten) nennen (Abb. 12). Der gesamte Umlauf dauert, wie ich im Buch Der zwölfte Planet nachgewiesen habe, dreitausendsechshunAbb. 13 27 dert Jahre. So wurde der Ein­dringling, der aus dem Weltraum gekommen war, der zwölfte Planet des Sonnensystems; er ist gebildet aus der Sonne in der Mitte mit ihrem langjährigen Gefährten Merkur, den drei alten Paaren Venus und Mars, Jupiter und Saturn, Uranus und Neptun, der Erde und dem Mond (den Überresten der großen Tiamat an einem neuen Platz), dem neuerdings unabhängigen Pluto und dem Planeten, der allem die endgültige Form verliehen hat, Nibiru/Marduk (Abb. 13). Die moderne Astronomie und neueste Entdeckungen entsprechen die­ser jahrtausendealten Geschichte und bestätigen sie. 28 Als die Erde noch nicht geformt war Im Jahr 1772 machte Johann Elert Bode ein Gesetz bekannt, das der Wittenberger Professor Joh. Daniel Titius gefunden hatte und das man als die Titius-Bodesche Reihe bezeichnet. Es han­delt sich dabei um die Beziehungen zwischen den Entfernungen von der Sonne. Multipliziert man die Zahlen 0, 2, 4, 8, 16 usw. mit 3, addiert dazu die Zahl 4 und teilt das Ergebnis durch 10, so entsteht eine Zahlenfolge, die den Abstand der Planeten von der Sonne wiedergibt, ausgedrückt in der Astronomischen Einheit (AE), dem Abstand zwischen Sonne und Erde. Nach dieser Formel hätte es zwischen Mars und Jupiter einen Planeten geben müssen (dort wurden die Asteroiden entdeckt) und hinter Saturn ebenfalls einen (dort wurde Uranus entdeckt). Die Formel be­ginnt von Neptun an nicht mehr zu stimmen, aber bis Uranus zeigt sie nur geringe Abweichungen: Planet Merkur Venus Erde Mars Asteroiden Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto Entfernung (AE) 0,387 0,723 1,000 1,524 2,794 5,203 9,539 19,182 30,058 39,400 Bodesches Gesetz Entfernung 0,400 0,700 1,000 1,600 2,800 5,200 10,000 19,600 38,800 77,200 Abweichung 3,4% 3,2% 5,0% 4,8% 2,1% 36,3% 95,9% Die Titius-Bodesche Reihe, zu der man empirisch gelangte, wurde von der Erde aus errechnet. Aber nach der sumerischen Kosmogonie gab es am Anfang zwischen Mars und Jupiter die Tiamat und noch keine Erde. Wenn man bei dieser Reihe von der Arithmetik absieht und nur die geometrische Progression anwendet, ist die Formel auch ohne die Erde gültig – und die sumerische Kosmogonie wird bestätigt: Planet Merkur Venus Mars Asteroiden (Tiamat) Jupiter Saturn Uranus Entfernung von der Sonne (Mill. km) 58 108 227 417 775 1420 2854 Verhältnis der Zunahme – 1,85 2,10 1,84 1,86 1,83 2,01 29 3 Im Anfang Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war formlos und öde, und Dunkelheit war auf dem Antlitz der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sagte: Es werde Licht! Und es ward Licht. Lange Zeit war diese majestätische Darstellung der Erschaffung unse­rer Welt der Kern des jüdisch-christlichen Glaubens und der dritten daraus entstandenen monotheistischen Religion, des Islams. Im 7. Jahr­hundert n. Chr. errechnete der Erzbischof James Ussher von Armagh aus diesen Eröffnungsversen der Schöpfungsgeschichte das Datum der Welterschaffung, nämlich 4004 v. Chr., auch noch den Tag und die Stunde. Viele alte Bibeln enthalten noch Usshers Chronologie, und viele Menschen glauben immer noch, die Erde und das Sonnensystem, dem sie angehört, seien tatsächlich nicht älter. Leider ist die Naturwis­senschaft für viele ein Gegner; aber die Wissenschaft, die in der Evolu­tionstheorie wurzelt, hat den Kampf und die Herausforderung akzep­tiert. Es ist bedauerlich, daß beide Parteien überhaupt nicht beachten, was man schon seit mehr als einem Jahrhundert weiß: daß nämlich die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments eine überarbeitete und gekürzte Fassung viel ausführlicherer mesopotamischer Texte ist, die ihrerseits von einem ursprünglich sumerischen Text abstammen. Der Kampf zwischen Kreationisten und Evolutionisten – übrigens eine ganz und gar unberechtigte Abgrenzung, wie sich noch zeigen wird – wird noch verschärft durch die grundsätzliche Unterscheidung zwi­schen Religion und Staat, die zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung verankert ist, Diese Trennung ist allerdings nicht überall die Norm, und sie war es ganz sicher zu der Zeit nicht, als die biblischen Verse geschrieben wurden. In alter Zeit war nämlich der König auch der Hohepriester; der Staat hatte eine nationale Religion und einen nationalen Gott, die Tempel waren das Zentrum der Wissenschaften, die Priester ihre Diener. Dies war so, weil die Götter, die zu Beginn der Zivilisation verehrt wurden – worunter Religiosität zu verstehen ist –, keine anderen Wesen waren als die Anunnaki/Nefilim, von denen alles Wissen, also alle Wissenschaft, auf Erden stammte. Die Verschmelzung von Staat, Religion und Wissenschaft trat nirgends deutlicher zutage als in Babylonien. Hier wurde das sumerische Epos der Schöpfung übersetzt und so bearbeitet, daß der babylonische Nationalgott die Stellung eines Himmelsherrschers erhielt. Indem man Nibiru in Marduk umtaufte, bemächtigte man sich der Attribute eines obersten »Gottes des Himmels und der Erde«. Diese Version – der unversehrteste Text, der bisher gefunden wurde – wird nach den Eröffnungsworten Enuma elisch (»Als in der Höhe«) genannt. Sie wurde das 30 heiligste religiöse, politische und wissenschaftliche Doku­ ment des Landes. Bei den Neujahrsritualen stand die Vorlesung im Mittelpunkt, und in einem Passionsspiel stellten Schauspieler den In­halt dar, damit er den Menschen verdeutlicht wurde. Die Tontafeln, auf denen die Geschichte geschrieben stand (Abb. 14), waren in alter Zeit der kostbarste Besitz der Tempel und der königlichen Bibliotheken. Die Entzifferung der Schrift auf den Tontafeln, die vor über einem Jahrhundert in den mesopotamischen Ruinen gefunden wurden, führte zu der Erkenntnis, daß die Schöpfungsgeschichte Jahrtausende vor der Abfassung des Alten Testaments erzählt worden ist. Besonders Abb. 14 wichtig waren die Texte, die man in der Bibliothek des assyrischen Königs Asurbanipal in Ninive gefunden hat. Darin ist die Schöpfungsgeschich­te fast wörtlich so wie in der Genesis beschrieben. George Smith vom Britischen Museum hat die Tonscherben zusammengesetzt und den Inhalt 1876 unter dem Titel Die chaldäische Genesis veröffentlicht. Daraus ging schlüssig hervor, daß es einen akkadischen Text im alten babylonischen Dialekt gegeben haben mußte, der mindestens tausend Jahre älter war als der biblische. Bei Ausgrabungen zwischen 1902 und 1914 fand man Tafeln mit der assyrischen Fassung des Epos, auf denen der Name des assyrischen Nationalgottes Asur durch Marduk ersetzt worden war. Weitere Entdeckungen enthüllten nicht nur die Vielzahl der Kopien und Übersetzungen dieses epischen Textes, sondern liefer­ten auch den Beweis für den sumerischen Ursprung. Im Jahr 1902 erklärte L. W. King in seinem Werk Die sieben Tafeln der Schöpfung, daß die verschiedenen Fragmente sieben Tafeln ergeben, von denen sechs den Schöpfungsprozeß schildern; auf der siebten wird »der Herr« gepriesen – in der babylonischen Version Marduk, in der assyrischen Asur. Daraus läßt sich nur vermuten, daß diese Aufteilung der biblischen Zeiteinteilung in sieben Tage zugrunde liegt, bei der sechs Tage der Arbeit Gottes gewidmet sind, der siebte hingegen der Ruhe und der zufriedenen Betrachtung des Geschaffenen. In der auf hebräisch geschriebenen Bibel wird jede Phase mit »Jom« bezeichnet, was gemeinhin »Tag« bedeutet. Bei einem Vortrag fragte mich einmal eine Frau wegen dieses Punktes. Ich erklärte ihr, daß mit dem Wort Tag nicht unser Begriff von vierundzwanzig Stunden ge­meint ist, sondern eben eine Phase im Schöpfungsprozeß. Ich wies sie auch darauf hin, daß die Bibel nicht von unserem 31 Zeitbegriff spricht, sondern von dem des Schöpfers, heißt es doch im 90. Psalm: »Denn tausend Jahre sind vor deinen (Gottes) Augen wie der Tag, der gestern vergangen ist.« Wollte sie nicht wenigstens zugeben, daß die Schöp­fung sechstausend Jahre gedauert haben könnte, fragte ich. Zu meiner Enttäuschung wollte sie das nicht. Sie beharrte darauf: Sechs Tage bedeuten sechs Tage. Ist die biblische Schöpfungsgeschichte ein religiöses Dokument, also nur Sache des Glaubens, wobei es jedem überlassen ist, sie zu glauben oder nicht; oder ist sie ein wissenschaftliches Dokument, das uns wesentliches Wissen über den Anfang der Dinge des Himmels und der Erde vermittelt? Natürlich ist das der Kern der Zwietracht zwischen Kreationisten und Evolutionisten. Beide Parteien hätten ihre Waffen schon längst niedergelegt, wenn sie wüßten, daß die Verfasser, Überset­zer und Bearbeiter der biblischen Geschichte genauso vorgegangen sind wie die Babylonier: Sie haben nur die wissenschaftlichen Quellen ihrer Zeit benutzt, wie auch die Abkömmlinge Abrahams das Epos der Schöpfung gekürzt und bearbeitet haben, so daß es die Grundlage einer nationalen Religion wurde, die Jahwe, »der im Himmel und auf Erden ist«, verherrlichte. In Babylonien war Marduk eine Doppelgottheit. Physisch anwesend, glanzvoll in kostbarem Gewand (Abb. 15), wurde er als Ilu (übersetzt mit »Gott«, bedeutet aber eigentlich »Erhabener«) verehrt. Seine Kämpfe um die Oberherrschaft über die Anunnaki habe ich in meinem Buch Die Kriege der Menschen und Götter ausführlich geschildert. Anderer­ seits war Marduk eine Himmelsgottheit, ein planetarischer Gott, der sich im Himmel die Attribute und das Verdienst des Urschöpfers aneig­ nete, alle die Dinge, die die Sumerer Nibiru zugeschrieben hatten, dem Planeten, den sie symbolisch als geflügelte Scheibe darstellten (Abb. 16). Die Assyrer, die Marduk durch ihren Nationalgott Asur ersetzten, vereinten die beiden Aspekte und stellten Asur als einen Gott auf einer geflügelten Scheibe Abb. 15 dar (Abb. 17). Die Hebräer predigten den Monotheismus und anerkannten – auf­grund sumerischen Wissens – die Universalität Gottes. Sie lösten das Problem der Dualität und der Unmenge von Anunnaki-Gottheiten, die an den Geschehnissen auf der Erde beteiligt waren, recht geschickt, indem sie eine Ganzheit erschufen, nicht »El« (hebräisch für »Ilu«), sondern »Elohim«, einen Plural-Gott, »denn das Wort bedeutet ›Göt­ter‹, der doch nur einer ist«. Diese Abkehr vom babylonischen und assyrischen religiösen Denken läßt sich nur verstehen, wenn man sich folgendes klarmacht: Die Hebräer wußten, daß die Gottheit, die mit Abraham und Moses sprechen konnte, naturkundlich nicht auch der Himmelsherr sein konnte, den die Sumerer Nibiru nannten; sondern Teil eines universellen, ewigen, allgegenwärtigen Gottes – Elohim – sein mußte, nach dessen großartigem Entwurf das Weltall 32 Abb. 16 Abb. 17 beschaffen ist, in dem die Planeten ihren vorbestimmten Schicksalsweg gehen. Auch das, was die Anunnaki auf der Erde getan hatten, war eine vorbestimmte Mission. So manifestierte sich die Arbeit eines Universal­gottes im Himmel und auf Erden. 33 Die tiefsinnigen Vorstellungen, die der biblischen Adaption von Enuma elisch (Schöpfungsgeschichte) zugrunde liegen, konnten nur dadurch erreicht werden, daß man Religion und Naturwissenschaft vereinte und bei der Schilderung und beim Ablauf der Ereignisse die wissenschaftli­che Grundlage beibehielt. Doch um zu erkennen, daß die Genesis nicht nur auf Religion beruht, sondern auch auf Wissenschaft, muß man sich über die Rolle der Anunnaki im klaren sein und es gelten lassen, daß die sumerischen Texte keine Mythen sind, sondern Tatsachenberichte. Manche Gelehrte haben sich mit diesen Dingen gründlich befaßt, ohne so weit zu kom­men. Sowohl die Naturwissenschaftler als auch die Theologen wissen zwar heute über den mesopotamischen Ursprung der biblischen Schöp­ fungsgeschichte Bescheid, streiten aber eigensinnig den wissenschaft­ lichen Wert dieser alten Texte ab. Dabei könnte es sich nicht um Wissenschaft handeln, behaupten sie, weil »es doch nach der Natur der Dinge offensichtlich ist, daß keine dieser Geschichten das Produkt menschlicher Erinnerung sein kann« (N. M. Sarna vom Jüdischen Theologischen Seminar in seinem Buch Das Verständnis der Genesis). Auf diese Herausforderung kann ich nur wiederholen, was ich schon öfters in meinen Schriften gesagt habe: Die Auskunft über den Anfang der Dinge – auch über die Erschaffung des Menschen – entstammt nicht der Erinnerung von Assyrern, Babyloniern oder Sumerern, sondern dem Wissen und der Wissenschaft der Anunnaki/Nefilim. Natür­lich konnten auch sie sich nicht erinnern, wie das Sonnensystem geschaffen wurde oder wie Nibiru/Marduk in das Sonnensystem ein­drang, weil sie selbst zu dieser Zeit auf ihrem Planeten noch nicht erschaffen worden waren. Aber genau wie unsere Naturwissenschaftler erforscht haben, wie das Sonnensystem, ja wie das Weltall entstanden ist – ihre Lieblingstheorie ist der Urknall –, so müßten wohl auch die Anunnaki/Nefilim, die immerhin bereits vor vierhundertfünfzigtausend Jahren Raumfahrten durchführen konnten, imstande gewesen sein, zu vernünftigen Schlußfolgerungen über die Schöpfung zu gelangen, zu­mal ihr Planet, der ihnen als Raumschiff diente und an allen äußeren Planeten vorbeikam, es ihnen ermöglichte, sie sich häufiger und genau­er anzusehen als unsere flüchtigen Voyager-Blicke. Mehrere aktuelle Studien über Enuma Elisch, wie zum Beispiel Die babylonische Genesis von Alexander Heidel vom Orientalischen Insti­tut der Universität Chicago, befassen sich mit den thematischen und strukturellen Parallelen zwischen der mesopotamischen und der bibli­schen Erzählung. Beide beginnen in der Tat mit der Erklärung, daß die Geschichte den Leser (oder den Zuhörer wie in Babylonien) in die Urzeit zurückführt, in der es die Erde und »den Himmel« noch nicht gab. Aber die sumerische Kosmologie handelt von der Erschaffung des Sonnensystems und errichtet erst dann die Bühne für das Erscheinen des himmlischen Herrn (Nibiru/Marduk), wohingegen die biblische Version das alles überspringt und bei der Himmelsschlacht und ihren Nachwirkungen beginnt. Folgendermaßen beschreibt die mesopotamische Version das Bild vom ungeheuren Himmelsraum: »Als in der Höhe der Himmel noch keinen Namen hatte 34 und die Erde drunten noch nicht benannt war, als nichts war, außer dem Urschöpfer Apsu, Mummu und Tiamat, die sie alle gebar. Ihre Wasser wurden gemischt. Kein Schilf hatte sich bisher gebildet, kein Sumpfland war erschienen.« Der Anfang in der Bibel ist sachlicher, kein inspiriertes religiöses Opus, sondern eine Lektion in Urzeitwissen. Der Leser erfährt, daß es tatsächlich eine Zeit gegeben hat, in der Himmel und Erde noch nicht vorhanden gewesen waren, und daß es einer Tat des Herrn bedurfte – sein »Geist« mußte sich über dem Wasser bewegen, damit Himmel und Erde durch einen Blitz entstehen konnten. In der englischen und in der amerikanischen neuen Bibel ist der »Geist Gottes« durch »Wind« ersetzt worden, und in der neuesten deutschen Übersetzung steht bei »Geist« neuerdings als Fußnote: »Andere mögliche Übersetzung: Ein gewaltiger Sturm brauste über das Wasser.« Alle enthalten jedoch immer noch den Begriff »unendliche Tiefe« für das hebräische Wort »Tehom« in der originalen Bibel; aber heute geben sogar Theologen zu, daß es sich auf nichts anderes als die sumerische Bezeichnung Tiamat bezieht. Auch die Wasser, die sich im mesopotamischen Text mischen, sind keineswegs allegorisch gemeint, sondern durchaus real. Es handelt sich dabei um das viele Wasser auf der Erde, die bei ihrer Entstehung, wie sich noch zeigen wird, vollständig mit Wasser bedeckt war. Wenn dies der Fall war, dann nur, weil Tiamat ebenfalls ein Planet mit viel Wasser gewesen war, mindestens zur Hälfte. Diese Beschaffenheit von Tehom/Tiamat wird in der Bibel an mehreren Stellen erwähnt. Der Prophet Jesaja erinnert sich der Tage der Vorzeit, wo der Herr »den Erhabenen schnitzte, das Seeungeheuer durchbohrte und das Gewässer der mächtigen Tehom trockenlegte«. Der Psalmist spricht: »Er türmt die Wasser des Meeres wie Garben auf und legt die Fluten in Vorratskammern.« Und an anderer Stelle: »Als die Wasser dich sahen, erbebten sie, ja Zittern erfaßte die Fluten.« Was war der »Wind des Herrn«, der über das Wasser von Tehom/Tiamat wehte? Nicht der göttliche »Geist«, sondern der Satellit von Nibiru/Marduk, der in den mesopotamischen Texten diesen Namen trägt. Sie beschreiben die Blitze, die er auf Tiamat sendet. Wenn man alles weiß, versteht man, daß der Beginn der biblischen Geschichte lauten müßte: »Als am Anfang der Herr den Himmel und die Erde schuf, war die Erde noch nicht gebildet, und es lag Dunkelheit auf Tiamat. Dann fuhr der Wind des Herrn über ihr Wasser, und der Herr befahl: Es werde hell! Und es ward hell.« In der Bibel steht nichts von der Teilung des Planeten Tiamat und der Verteilung 35 der Heerschar ihrer Satelliten, wovon die mesopotamischen Texte so lebendig erzählen. Doch aus den Worten Hiobs ist deutlich zu ersehen, daß die Hebräer über die ausgelassenen Stellen in der Schöpfungsgeschichte Bescheid wußten. Hiob schildert in seiner Rede, wie der Herr »die Helfer der Hochmütigen« niederwarf und wie er, aus dem äußersten Raum kommend, Tehom (Tiamat) zerhackte und das Sonnensystem veränderte: »Den gehämmerten Baldachin spannte er aus anstelle von Tehom. Die Erde hing in der Leere. Er goß Wasser in ihre Dichte, ohne daß eine Wolke barst. Seine Kraft hielt das Wasser an. Seine Kraft zersprengte die Hochmütige. Sein Wind maß das gehämmerte Band ab. Seine Hand zerdrückte den verzerrten Drachen.« Danach beschrieben die mesopotamischen Texte, wie Nibiru/Marduk den Asteroidengürtel aus Tiamats unterer Hälfte formte: »Ihre andere Hälfte hängte er auf als Schirm für den Himmel, fügte alles zusammen, als Wächter bestellte er sie. Er bog Tiamats Schwanz, um das Große Band gleich einem Armreifen zu formen.« In der Schöpfungsgeschichte wird die Bildung des Asteroidengürtels folgendermaßen beschrieben: »Und Elohim sprach: Es entstehe ein Gewölbe inmitten der Wasser und bilde eine Scheidewand zwischen den Wassern. Und Elohim machte das Gewölbe, das die Wasser, die unter dem Gewölbe sind, von den Wassern trennte, die über dem Gewölbe sind. Und Elohim nannte das Gewölbe Himmel.« Das hebräische Wort »Schama’im« wurde von den Bearbeitern der Genesis als »Himmel« gedeutet, als wäre er infolge der Zertrümme­rung des Planeten Tiamat entstanden, das Wort »Raki’a« als Gewölbe, mit der Erklärung, es gebe im Hebräischen zwei Bezeichnungen für den Himmel. Aber tatsächlich bedeutet »Raki’a«: Er hämmerte den Armreifen. »Schama’im« bedeutet nicht Himmel, sondern es besteht aus zwei Wörtern, nämlich »scham« und »-ma’im«, und bedeutet: Wo die Wasser waren. Es wird also in Wirklichkeit erzählt, daß »der Himmel« eine bestimmte Stelle war, wo Tiamat und ihre Wasser gewe­sen waren und wo nun der Asteroidengürtel »gehämmert« wurde. 36 Dies geschah laut den mesopotamischen Texten, als Nibiru/Marduk zum Ort der Kreuzung zurückkehrte, in der zweiten Phase des Kampfes mit Tiamat. »Am zweiten Tage«, wenn man so will, da es so in der Bibel steht. Die alte Erzählung enthält viele Einzelheiten, die alle erstaunlich sind. Das läßt sich nur damit erklären, was die Sumerer selbst aussagen: Diejenigen, die vom Nibiru auf die Erde kamen, waren die Quelle dieses Wissens. Die moderne Astronomie hat bereits viele dieser Ein­zelheiten bestätigt, somit auch indirekt die sumerische Kosmogonie und Astronomie: die Himmelsschlacht, die mit der Zertrümmerung des Planeten Tiamat endete, die Entstehung der Erde und des Asteroiden­gürtels und die Art und Weise, wie Nibiru/Marduk zu seiner Bahn um die Sonne gezwungen wurde. Betrachten wir nun einen Aspekt der alten Erzählung: die »Heerschar« von Satelliten oder »Winden«, über die die »himmlischen Götter« verfügten. Man weiß heute, daß Mars zwei Monde hat, Jupiter sechzehn sowie mehrere kleine Monde, Saturn einundzwanzig oder mehr, Uranus fünf­zehn, Neptun acht. Bevor Galilei im Jahr 1610 mit seinem Teleskop Jupiters vier hellste und größte Satelliten entdeckte, war es undenkbar, daß ein Himmelskörper mehr als einen solchen Gefährten haben könn­te; die Erde mit ihrem einzigen Mond galt dafür als Beweis. Nun aber steht in den sumerischen Texten, daß bei der Wechselwirkung zwischen der Schwerkraft der beiden Planeten Nibiru/Marduk und Uranus der Eindringling drei Satelliten (»Winde«) benutzte und Anu/Uranus vier derartige Monde hervorbrachte. Als Nibiru/Marduk Tiamat erreichte, hatte er sieben »Winde«, mit denen er sie angriff, und sie hatte »eine Heerschar« von elf, darunter den »Anführer«, der im Begriff war, ein selbständig kreisender Planet zu werden, und schließlich unser Mond wurde. Von großer Bedeutung war es auch für die alten Astronomen, daß die Trümmer von Tiamats unterer Hälfte an der Stelle im Weltraum ausge­streut wurden, wo Tiamat zuvor gewesen war. Sowohl die mesopotamischen Texte als auch die hebräische Fassung der Schöpfungsgeschichte schildern nachdrücklich die Entstehung des Asteroidengürtels, der zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreist, wovon unsere Astronomen bis zum 19. Jahrhundert nichts wußten. Daß der Raum zwischen Mars und Jupiter nicht nur eine dunkle Leere ist, das fand der italienische Astronom Guiseppe Piazzi am 1. Januar 1801 heraus, als er den ersten Planetoiden entdeckte, der den Namen Ceres erhielt. Im Jahr 1807 wurden drei weitere (Pallas, Juno und Vesta) entdeckt, dann keiner mehr bis 1845, wo es bereits mehrere hundert waren, und heute sind es an die zweitausend, die die Lücke in der Titius-Bodeschen Reihe ausfüllen. Nach Meinung der Astronomen dürfte es fünfzigtausend Planetoiden geben, deren Durchmesser min­destens eintausend Meter beträgt, außerdem noch viele Trümmer­stückchen, die wegen ihrer Kleinheit von der Erde aus nicht zu sehen sind, und deren Zahl in die Milliarden geht. Mit andern Worten, die moderne Astronomie hat fast zwei Jahrhunderte gebraucht, um das herauszufinden, was die Sumerer schon vor sechs­tausend Jahren 37 gewußt haben. Trotz dieser Erkenntnis blieb es ein Rätsel, was damit gemeint ist, daß »Schama’im« (der Himmel) »die Wasser, die unter dem Gewölbe sind, von den Wassern trennte, die über dem Gewölbe sind«. Was meinte die Bibel damit? Natürlich weiß man, daß die Erde ein Planet mit viel Wasser war; aber man hat angenom­men, dies sei ein Einzelfall. Vielleicht entsinnt sich mancher noch der utopischen Geschichten, in denen Außerirdische auf die Erde kamen, um sich die einzigartige und lebensspendende Flüssigkeit zu holen: Wasser. Wenn mit dem »Wasser unter dem Gewölbe« das Wasser des Planeten Tiamat und folglich das der Erde gemeint ist, was ist dann mit dem »Wasser über dem Gewölbe« gemeint? Wir wissen, daß die Planeten durch die Asteroiden in zwei Gruppen eingeteilt werden. »Unten« sind die terrestrischen inneren Planeten, »oben« die gashaltigen äußeren Planeten. Aber außer der Erde hatten die inneren eine öde Oberfläche und die äußeren gar keine Oberfläche, und sie besaßen alle kein Wasser, wie allgemein angenommen wurde. Nun, als Ergebnis der unbemannten Raumflüge zu allen Planeten außer zu Pluto wissen wir es heute besser. Merkur, der 1974/75 von Mari­ner 10 in Augenschein genommen wurde, ist zu klein und der Sonne zu nahe, um noch Wasser gespeichert zu haben, sofern er es überhaupt jemals gehabt hat. Aber Venus, die wegen ihrer verhältnismäßig großen Nähe zur Sonne ebenfalls für wasserlos gehalten wurde, bereitete den Wissenschaftlern eine Überraschung. Sowohl amerikanische als auch sowjetische unbemannte Raumsonden enthüllten, daß die extreme Hitze ihrer Oberfläche (ungefähr 280 Grad Celsius) nicht von der Sonnennähe herrührt, sondern von einem Treibhauseffekt: Ihre Atmosphäre besteht zu neunzig Prozent aus Kohlendioxyd, und die Wolken, die sie umgeben, enthalten Schwefelsäure. Infolgedessen sitzt die Sonnen­wärme gewissermaßen in der Falle und kann während der Nacht nicht abstrahlen. Die hohe Temperatur würde alles Wasser verdampfen las­sen, sofern es vorhanden wäre. Aber hat Venus früher kein Wasser gehabt? Die sorgfältige Analyse der Resultate ergab zweifelsfrei, daß dies nicht so ist. Die durch Radargeräte ermittelte Topographie verriet, daß früher Ozeane und Seen vorhanden gewesen sein müssen; außerdem wurde festgestellt, daß die »höllische Atmosphäre«, wie sich die Wissen­schaftler ausdrückten, Wasserdampfspuren enthält. Zwei weitere unbemannte Raumsonden, Pioneer Venus 1 und 2, die von Dezember 1978 an lange unterwegs waren, erbrachten nach der Auswertung der Daten den Befund, daß die Venus »einstmals von zehn Meter tiefem Wasser bedeckt war«. In der Zeitschrift Science wurde am 7. Mai 1982 verkündet, daß sie einstmals »mindestens hundertmal soviel Wasser gehabt hat wie heute in Dampfform«. In darauffolgenden Studien wurde die Meinung geäußert, daß ein Teil des Wassers zur Bildung der Schwefelsäure beigetragen hat und daß durch den Sauer­stoff des anderen Teiles die felsige Oberfläche der Venus oxydiert ist. »Die Spuren der verlorenen Ozeane der Venus lassen sich an ihren Felsen verfolgen.« So lautete der gemeinsame Bericht der amerikani­schen und sowjetischen Analytiker, der in der Mai-Ausgabe von Science im Jahr 1986 erschienen ist. Es 38 Tafel C hat tatsächlich »unter dem Gewölbe« Wasser gegeben, nicht nur auf der Erde, sondern auch auf der Venus. Von den inneren Planeten bleibt nun noch der Mars übrig. Am Ende des 19. Jahrhunderts verkündeten der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli und der Amerikaner Percival Lowell, sie hätten durch teleskopische Beobachtungen merkwürdige »Kanäle« auf dem Mars entdeckt. Sie wurden ausgelacht; man hielt allgemein an der Überzeugung fest, der Mars sei trocken und öde. Die ersten unbemannten Raumsonden bestätigten in den 1960er Jahren, der Mars sei »wie der Mond geologisch leblos«. Das änderte sich, als die Raumsonde Mari­ner 9 im Jahr 1971 in eine Umlaufbahn um den Mars gebracht wurde, so daß man Aufnahmen von seiner gesamten Oberfläche erhielt, nicht nur einen zehnprozentigen Ausschnitt wie bei den vorherigen Er­kundungen. Die Astronomen, die an der Mission beteiligt waren, spra­chen selbst von »erstaunlichen« Ergebnissen. Mariner 9 offenbarte, daß es auf dem Mars nur so wimmelt von Vulkanen, Canyons und ausgetrockneten Flußbetten (Tafel C). »Wasser hat bei der Entwick­lung des Planeten eine aktive Rolle gespielt«, stellte der Geologe Harold Masursky nach der Analyse der Aufnahmen fest. »Der überzeu­gendste Beweis dafür sind die vielen Bilder von tiefen, gewundenen Kanälen, die früher schnellfließende Flüsse gewesen sein müssen ... Wir können nichts anderes folgern, als daß wir es auf dem Mars mit Wasserspuren zu tun haben.« Die Mariner-9-Befunde wurden bestätigt und sogar verstärkt durch die Viking-1- und Viking-2-Missionen, die fünf Jahre später in Angriff genommen wurden. Dabei wurde der Mars sowohl von künstlichen Planetoiden als auch von stationierten Fähren aus untersucht. Man fand mehrere Flußläufe, die einst reichlich Wasser geführt haben mußten (das Gebiet hat den Namen Chryse Planitis erhalten), Wasserkanäle vom Gebiet Vallis Marineris aus, runde Schmelzformationen im Eis­boden der Äquatorregionen, von Wassergewalt verwitterte 39 und ausge­höhlte Felsen und Beweise für ehemalige Seen, Teiche und andere »Wasserbecken«. Die Mars-Atmosphäre enthält Wasserdampf. Charles A. Barth, der Fachmann für ultraviolette Messungen, schätzt, daß die tägliche Verdampfung einer Menge von vierhunderttausend Litern Wasser ent­spricht. Norman Horowitz von Caltech folgert daraus: »In der Vergan­genheit sind große Wassermengen in irgendeiner Form auf die Oberflä­che und in die Atmosphäre des Planeten Mars gelangt.« Seine Atmo­sphäre enthält auch neunzig Prozent Kohlendioxyd. In einem Berichtüber die wissenschaftlichen Ergebnisse der Viking-Mission, der von den American Geographical Union am 30. September 1977 im Journal of Geophysical Research veröffentlicht wurde, hieß es: »Vor langer Zeit hat eine riesige Überschwemmung die Mars-Landschaft zerklüftet. Eine Wassermenge wie die des Erie-Sees hat sich über das Land ergossen und große Kanäle ausgehöhlt.« Die Fähre zeigte Frost auf dem Boden an, auf dem sie gelandet war. Der Frostboden bestand aus Wasser, Wassereis und gefrorenem Koh­lendioxyd. Die Diskussion, ob die Polareiskappen des Mars wohl aus Wassereis oder »Trockeneis« (gefrorenem Kohlendioxyd) bestehen, fand ihr Ende, als im Januar 1979 JPLWissenschaftler beim zweiten Kollo­quium im Caltech (California Institute of Technology in Pasadena) er­klärten, der Nordpol bestehe aus Wassereis, der Südpol hingegen nicht. Der endgültige NASA-Bericht nach den Viking-Missionen schließt mit den Worten: »Der Mars hatte früher einmal soviel Wasser, daß es die ganze Oberfläche des Planeten mit einer mehrere Meter hohen Wasser­schicht hätte bedecken können.« Das hält man heute für möglich, weil der Mars (wie auch die Erde) ein wenig wackelt, während er sich um seine Achse dreht. Dadurch ergeben sich alle fünfzigtausend Jahre einschneidende klimatische Veränderungen. Als der Planet wärmer war, kann er gut riesige, fünf Kilometer tiefe Seen gehabt haben. Die NASA-Wissenschaftler nehmen an, daß unter der Kruste des Mars soviel Wasser verborgen ist, daß es theoretisch den ganzen Planeten mindestens dreihundert Meter hoch bedecken könnte. Sie warnten ihre sowjetischen Kollegen, die eine Landung auf dem Mars planten, denn manche MarsCanyons könnten in der Tiefe immer noch Wasser führen, ebensogut könnte es unter den ausgetrockneten Flußbetten noch fließen. Der Mars, den man noch vor einem Jahrzehnt für trocken und öde hielt, hat sich als ein Planet entpuppt, auf dem Wasser in Überfülle vorhan­den war, nicht einfach stilles Wasser, sondern fließendes Wasser, das die Oberfläche des Planeten geformt hat. Mars gesellt sich zur Venus und zur Erde als »Wasser unter dem Gewölbe«. Die alte Aussage, daß das obere Wasser von dem unteren getrennt wurde, legt den Gedanken nahe, daß es auch weiter draußen wasserhal­tige Himmelskörper gibt. Die Entdeckungen der Raumsonde Voyager 2 bestätigen, wie bereits erwähnt wurde, die sumerische Erklärung, daß Uranus und Neptun »wäßrig« sind. Wie steht es nun mit den beiden anderen äußeren Planeten, Saturn und Jupiter? Von Saturn, dem gashaltigen Riesen, der achthundertmal größer ist als die 40 Erde, wird angenommen, daß er unter einer vierzehntausend Kilo­ meter mächtigen Schicht, die aus Wasser, Methan und Ammoniak besteht, einen festen Kern hat. Über dieser Schicht liegt eine andere aus flüssigem, metallischem Wasserstoff, die von einer Flüssigwasserstoff- und Heliumhülle umgeben ist. An der Wolkenoberfläche des Saturns herrscht eine Temperatur von -178 Grad Celsius. Die Atmosphäre besteht aus kaum veränderter solarer Urnebelmaterie, das heißt aus rund siebzig Prozent Wasserstoff, nahezu dreißig Prozent Helium so­wie geringen MenAbb. 18 gen von Methan, Äther und Ammoniak. Heute weiß man auch, daß sowohl seine Monde als auch die höchst interessanten Ringe (Abb. 18), wenn nicht vollständig, so doch zu einem großen Teil aus Eiswasser und vielleicht sogar aus Wasser bestehen. Eine einmalige Erscheinung unter den Planeten bildet das Ringsystem des Saturns. Von der Erde aus hatte man sieben Ringe erspäht, aber dann hat sich herausgestellt, daß es viel mehr sind, denn die Lücken zwischen den sieben größeren Ringen füllen zahlreiche dünnere und Tausende von kleinen Ringen aus, die alle zusammen wie eine Scheibe wirken. Die Untersuchung durch die unbemannte Raumsonde Pioneer 11 ergab 1979, daß die Ringe aus Eismaterie bestehen, aus lauter Eis­stückchen, die nicht größer sind als Schneeflocken, und man sprach von einem »Karussell glänzender Eispartikel«. Aber 1980 und 1981 wurde anhand der Daten von Voyager 1 und Voyager 2 festgestellt, daß es große Eisblöcke sind, manche so groß wie ein Haus. »Wir sehen ein Meer von funkelndem Eis«, berichteten die JPL-Wissenschaftler. Die­ses Eis war in grauer Vorzeit Wasser gewesen. Mehrere große Monde des Saturns, auf die sich vor allem Voyager 2 konzentrierte, haben noch viel mehr Wasser, nicht nur in gefrorener Form. 1979 ergab die Mission von Pioneer 11, daß die Gruppe der inneren Saturn-Monde – Janus, Minas, Enceladus, Tethys, Dione und Rhea – »Eiskörper zu sein scheinen, größtenteils aus Eis bestehend«. Voyager 1 bestätigte 1980, daß diese inneren Satelliten wie auch die neu entdeckten Kleinmonde »Eiskugeln« sind. Die glatten Flächen des Enceladus, der besonders beobachtet wurde, rühren davon her, daß alte Krater sich mit Wasser gefüllt haben, das an der Oberfläche gefror. Außerdem enthüllte Voyager 1, daß die Außenmonde des Saturns mit Eis be41 deckt sind. Der Iapetus, der den Forschern Rätsel aufgab, weil er dunkle und helle Stellen aufweist, ist, wie sich gezeigt hat, an den hellen Stellen mit Eis bedeckt. Voyager 2 bestätigte 1981, daß Iapetus eine Eiskugel mit Gesteinskern ist. Die Analyse der Befunde ergab, daß Iapetus zu sechzig Prozent aus Eiswasser, zu dreißig Prozent aus Gestein und zu zehn Prozent aus gefrorenem Methan besteht. Bei Saturns größtem Mond, Titan (größer als der Planet Merkur), sind Atmosphäre und Oberfläche reich an Kohlenwasserstoff. Aber darunter ist ein Eismantel und ungefähr hundert Kilometer tiefer, wo es immer wärmer wird, eine dicke Schlammeisschicht. Noch tiefer, so glaubt Seiten 58 & 59 fehlen im Originalscan -- Steelrat Anblick der Sonne Wenn wir am Morgen oder am Abend die Sonne betrachten, erscheint sie dem bloßen Auge als vollkommene Scheibe. Durch das Teleskop betrachtet, hat sie die Form einer vollkommenen Kugel. Die Sumerer aber stellten sie als eine Scheibe mit Strah­len dar, die sich von der runden Oberfläche dreiecksförmig erstrecken, wie auf dem Rollsiegel VA/243 zu sehen ist (Tafel B, Abb. 6a). Warum? Im Jahr 1980 machten die Astronomen des hochgelegenen Observatoriums der Universität von Colorado während einer in Indien beobachteten Sonnenfinsternis Aufnahmen mit einer be­sonderen Kamera. Aus den Bildern war zu ersehen, daß die Korona der Sonne infolge magnetischer Einflüsse den Eindruck erweckt, als entsende sie dreiecksförmige Strahlen, genauso, wie die Sumerer sie vor Jahrtausenden dargestellt haben. Im Januar 1983 machte ich den Herausgeber der Zeitschrift Scientific American auf das sumerische Rollsiegel mit der »rät­selhaften Darstellung« sowie auf die Entdeckung der Astrono­men aufmerksam. Unter anderem schrieb ich ihm: »Erstaunlich ist vor allem, daß die Sumerer bereits die wirkliche Form der Sonnenkorona kannten. Im Vordergrund steht die Frage, woher sie ihr Wissen bezogen haben.« Er fand die Sache »höchst interessant« und erklärte sich bereit, meinen Artikel zu veröf­fentlichen. 42 4 Die Boten der Genesis Im Jahr 1986 war der Menschheit ein einmaliges Erlebnis beschieden: Das Erscheinen eines Boten aus der Vergangenheit, eines Boten der Genesis. Gemeint ist der Halleysche Komet. Unter den vielen Kometen und anderen kleinen Gegenständen, die im All umherschweifen, ist er in mancherlei Hinsicht einmalig, da sich sein Erscheinen um Jahrtausende zurückverfolgen läßt und die heuti­gen Wissenschaftler 1986 zum erstenmal imstande waren, einen Kome­ten und seinen Kern zu untersuchen. Die erste Tatsache unterstreicht die Vortrefflichkeit der uralten Astronomie, die zweite erbrachte Daten, die – wieder einmal – mit dem alten Wissen und der biblischen Schöpfungsgeschichte übereinstimmen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse führten dazu, daß der britische königliche Astronom Edmund Halley (1656-1742) für 1758/59 die Wiederkehr des nach ihm benannten periodischen Kometen voraussa­gen konnte, der 1531, 1607 und 1682 erschienen war, also eine Um­laufzeit von sechsundsiebzig Jahren hat. Dazu gehörte auch Isaac Newtons physikalische Entdeckung des Gravitationsgesetzes, das er für die Ursache der Planetenbewegung hielt. Vorher hatte man die Theorie verfochten, die Kometen bewegten sich in geraden Linien, erschienen am einen Ende des Himmels und verschwänden am entge­gengesetzten, so daß sie nie wiedergesehen würden. Aber Halley schloß aus dem Gravitationsgesetz, daß die Bahn der Kometen elliptisch verläuft, so daß sie dorthin zurückkehren, wo man sie bereits gesehen hat. Die drei Kometen, die 1531, 1607 und 1682 erschienen waren, bewegten sich alle in der »verkehrten« Richtung, nämlich im Uhrzeiger­ sinn, hatten dieselbe Abweichung vom allgemeinen Umlauf der Plane­ten um die Sonne – eine Neigung von siebzehn bis achtzehn Grad – und sahen gleich aus. Demnach hielt er sie für ein und denselben Kometen, dessen Umlaufzeit, wie er ausrechnen konnte, sechsund­siebzig Jahre betragen mußte. So sagte er voraus, daß dieser Komet 1758 wieder erscheinen würde. Er erlebte die Bestätigung seiner Voraussage nicht mehr, aber er wurde dadurch geehrt, daß man den Kome­ten nach ihm benannte. Die Bahn eines Kometen wird durch die Anziehungskraft der Planeten, an denen er vorbeikommt, empfindlich gestört (das ist besonders bei Jupiter der Fall). Jedesmal wenn der Komet sich der Sonne nähert, gewinnt seine gefrorene Materie an Leben; er entwickelt einen Kopf, der aus Kern und Koma besteht, sowie einen Schweif (daher seine Bezeichnung Schweifstern) und beginnt einen Teil seiner Materie zu verlieren, die zu Gas und Dampf wird. All das beeinflußt seine Umlauf­bahn, so daß die Umlaufzeit des Halleyschen Kometen – sechsund­ siebzig Jahre – nur dem Durchschnitt entspricht; sie schwankt in Wirklichkeit zwischen vierundsiebzig und neunundsiebzig Jahren. Die reale Dauer muß man jedesmal neu errechnen, wenn der Komet in Erscheinung tritt. 43 Mit den modernen Hilfsmitteln verfolgt man jetzt jährlich fünf bis sechs Kometen, einige davon auf ihrer Rückreise, andere sind neu entdeckt worden. Die meisten zurückkehrenden haben eine kurze Um­laufzeit; die kürzeste ist die des Enckeschen Kometen, der sich in einem Zeitraum von über drei Jahren der Sonne nähert und hinter dem Asteroidengürtel verschwindet (Abb. 20). Meistens dauert die kurze Umlaufzeit ungefähr sieben Jahre und Abb. 20 führt bis in die Nähe von Jupiter. Kennzeichnend dafür ist der Giacobini-Zinnersche Komet (im allgemeinen tragen Kometen den Namen des Entdeckers), der eine Umlaufzeit von sechseinhalb Jahren hat und zuletzt 1985 von der Erde aus gesehen werden konnte. Dann gibt es noch die Kometen mit sehr langer Umlaufzeit, wie zum Beispiel den im März 1973 entdeckten Kohoutek, der im Dezember 1973 und im Januar 1974 voll sichtbar war und vielleicht erst in fünfundsiebzigtausend Jahren wieder erscheinen wird. Als der Halleysche Komet im Jahr 1910 erschien, wußte man es bereits und erwartete ihn nicht nur mit Spannung, sondern vor allem mit Bangen (Abb. 21). Man befürchtete, daß die Erde den Durchgang durch den »aus giftigen Gasen« bestehenden Schweif nicht überstehen würde, denn es ging das Gerücht, er sei in früherer Zeit stets ein schlimmes Omen gewesen, ein Verkünder von Pestilenz, Kriegen und dem Tod eines Königs. Als der Komet im Mai 1910 seinen höchsten Glanz entfaltete (Abb. 22), starb tatsächlich König Eduard VII. von Großbritannien. In Europa kulminierten die politischen Umwälzungen 1914 im Ausbruch Abb. 21 44 des Ersten Weltkriegs. Der Glaube – oder Aberglaube –, daß das Erscheinen des Halleyschen Kometen mit einschneidenden Ereignissen zusammenhängt, wird ver­ständlich, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen. Im Jahr 1835 lehnten sich die Seminolen-Indianer gegen die weißen Siedler in Flori­da auf, 1755 ereignete sich das große Erdbeben in Lissabon, der Dreißigjährige Krieg brach 1618 aus, 1456 belagerten die Türken Belgrad, 1347 begann der Schwarze Tod, die Beulenpest, die Men­schen hinzuraffen – alles war begleitet oder angekündigt vom Erscheinen eines großen Kometen, des Halleyschen Kometen, der seine Rolle als Bote des göttlichen Zornes spielte. Ob göttlichen Ursprungs oder nicht, am eindrucksvollsten spielte sich das Abb. 22 Zusammentreffen im Jahre 1066 ab, nämlich bei der Schlacht von Hastings, in der die Angelsachsen von Wilhelm dem Eroberer geschla­gen wurden. Diese Schlacht wurde auf dem berühmten gestickten Teppich von Bayeux abgebildet, den Wilhelms Gemahlin Mathilde angefertigt haben soll, um seinen Sieg zu verewigen (Abb. 23). Die Inschrift neben dem Schweif des Kometen, »Isti mirant stella«, bedeu­tet »Sie bewundern den Stern« und bezieht sich auf König Harald II., der in der Schlacht fiel. Nach Ansicht der Astronomen ist der Halleysche Komet in unserem Zeitalter zum erstenmal im Jahr 66 erschienen; diese Behauptung beruht auf chinesischen Beobachtungen. Es war das Jahr, in dem die Juden von Judäa ihren großen Aufstand gegen Rom begannen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus (37-96 Abb. 23 45 Abb. 24 46 n. Chr.) schreibt in sei­nem Werk Die Kriege der Juden die Schuld an dem Fall Jerusalems und an der Zerstörung seines Tempels den Juden zu, die die himmlischen Zeichen falsch gedeutet hätten, nämlich »einen Stern, der, einem Schwert ähnelnd, über der Stadt stand, einen Komet, der das ganze Jahr blieb«. Als erster Hinweis auf die Beobachtung eines Ko­meten galt bis vor kurzem eine Eintragung in den chinesischen chronologischen Schih-chi-Tabellen für das Jahr 467 v. Chr.; sie lautet: »Im zehnten Chi’in Li-kung-Jahr wurde ein Besenstern gesehen.« Eine griechische Inschrift könnte sich, wie manche For­scher glauben, auf denselben Kometen in jenem Jahr beziehen. Die modernen Astronomen sind nicht sicher, ob sich die chinesische Eintragung auf den Halleyschen Kometen bezieht, eher trifft eine ande­re für das Jahr 240 v. Chr. zu (Abb. 24). Im April 1985 berichteten F. R. Stephenson, K. K. C. Yau und H. Hunger in der Zeitschrift Nature folgendes: Eine erneute Überprüfung der babylonischen astronomischen Tafeln, die seit ihrer Entdeckung (in Mesopotamien) im Keller des Britischen Muse­ums gelegen hatten, habe ergeben, daß in den Jah­ren 164 und 87 v. Chr. außergewöhnliche Himmels­ körper – ihrer Meinung nach Kometen – er­schienen seien. Der Zeitraum von siebenundsiebzig Jahren lege den Gedanken nahe, daß es sich bei dem ungewöhnlichen Himmelskörper um den Halleyschen Kometen gehandelt hat. Keiner der Astronomen, die sich mit dem Halleyschen Kometen befaßt haben, war sich darüber im klaren, daß das Jahr 164 v. Chr. für die Juden und die Geschichte des Nahen Ostens von großer Bedeutung gewesen war. Denn das war das Jahr, in dem sich die Juden unter der Führung der Makkabäer gegen die griechischsyrische Herrschaft auf­lehnten, Jerusalem erneut aufbauten und den entweihten Tempel rei­nigten. Noch heute feiern die Juden dieses geschichtliche Ereignis mit ihrem Fest Hanukka (Wiedereinweihung). Die Tafel im Britischen Museum (Abb. 25) mit der Katalognummer WA-41462 zeigt das Da­tum des betreffenden Jahres, in dem Antiochos Epiphanes, einer der syriAbb. 25 schen Könige aus dem Hause der Seleukiden, regierte, er ist der böse König aus dem Buch der Makkabäer. Der ungewöhnliche Him­melskörper soll im Monat Kislimu gesehen worden sein, das entspricht dem jüdischen Monat Kislev, in dem Hanukka gefeiert wird. Josephus’ Vergleich des Kometen mit einem himmlischen Schwert (so sieht er auch auf dem Teppich von Bayeux aus) hat einige Forscher auf den Gedanken gebracht, daß der Engel des Herrn, den König David »zwischen Himmel und Erde stehen sah« und der ein Schwert in der Hand hatte, das er über Jerusalem ausstreckte (1. Chronik 21, 16), in Wirklichkeit ein Komet war, den der Herr ausgesandt hatte, den König zu strafen, weil er eine verbotene Zählung veranlagt hatte. Das war ungefähr im Jahr 1000 v. Chr., einem der Jahre, in denen der Halleysche Komet erschienen sein könnte. In einem 1986 veröffentlichten Artikel habe ich darauf hingewiesen, daß Komet im Hebräischen »Kochhav schavit« heißt, nämlich »Zepterstern«. Das steht, wie ich damals schrieb, in direktem Zusammenhang mit der biblischen Geschichte von dem Seher Bileam. Als die Israeliten ihre Wanderung durch die Wüste beendet hatten und mit der Eroberung Kanaans begannen, verlangte der moabitische König Balak von ihm, die Israeliten zu verfluchen. Aber Bileam, der sich darüber klar war, daß die Israeliten auf göttlichen Befehl hin handelten, segnete sie statt dessen. Das tat er, wie er erklärte, weil er eine Zukunftsvision gehabt hatte: »Ich sehe einen, noch ist er nicht da; ganz fern erblicke ich ihn. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen.« Im meinem Buch Stufen zum Kosmos habe ich in einer Chronologie das Datum des Exodus auf das Jahr 1433 v. Chr. angesetzt. Vierzig Jahre später, also 1393 v. Chr., begann der Einzug der Israeliten in Kanaan. Der Halleysche Komet müßte nach siebenundsiebzigjähriger Umlauf­zeit etwa 1390 v. Chr. erschienen sein. Hat Bileam dieses Ereignis als ein göttliches Zeichen für die Israeliten betrachtet, daß sie sich nicht aufhalten lassen sollten, sondern ihren Einmarsch fortsetzten? Wenn der Komet, den wir als den Halleyschen bezeichnen, in biblischer Zeit der Zepterstern Israels war, könnte dies erklären, weshalb die jüdischen Revolten von 164 v. Chr. und 66 n. Chr. zeitlich mit dem Erscheinen des Kometen zusammenfielen. Es ist doch bedeutungsvoll, daß die Juden, deren Revolte von 66 n. Chr. von den Römern unterdrückt worden war, knapp siebzig Jahre später abermals zu den Waffen grif­fen, in einer heldenhaften Anstrengung, Jerusalem zu befreien und den Tempel wieder aufzubauen. Ihr Anführer Simeon Bar Kosiba wurde von den religiösen Führern in Bar Kochba (Sohn des Sterns) umbe­nannt, wegen der oben zitierten Vision des Sehers Bileam. Seiten 68 & 69 fehlen im Originalscan -- Steelrat liegt. Weil sie aus allen Richtungen erscheinen (geradläufig, rückläufig und mit 47 verschiedener Deklination), sei das Reservoir von Milliarden Kometen kein Gürtel oder Ring wie die Asteroiden, sondern eine Kugel, die das Sonnensystem umgibt. Diese »Oort Wolke«, wie man sie nach der Theorie von Oort nannte, sei hunderttausend Astronomi­sche Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. (AE ist ein astronomi­sches Längenmaß von 149,6 Millionen Kilometer, das der mittleren Entfernung Erde–Sonne entspricht, und ist der Maßstab für alle Entfernungsangakosmi­schen ben.) Infolge der Perturbationen und interkometalen Zusammenstöße könnten einige Kometen nur fünfzig­tausend AE von der Sonne Abb. 27 entfernt sein (was immer noch 10000mal mehr als die Entfernung zwischen Jupiter und Sonne ist). Bei der Begegnung mit Gestirnen würden diese Kometen in ihrem Lauf ge­stört, so daß sie der Sonne zufliegen würden. Manche seien wegen der Anziehungskraft der Planeten, insbesondere der des Jupiters, kurz­periodische Kometen; andere seien wegen Jupiters Masse gezwungen, ihren Lauf zu ändern (Abb. 27). Seither hat die Zahl der beobachteten Kometen um mehr als fünfzig Prozent zugenommen, und die Computertechnik hat es ermöglicht, den Ursprung der rückläufigen Bahn der Kometen zu ermitteln. Entsprechende Studien – wie etwa die einer Forschergruppe vom Harvard-Smithsonian-Observatorium unter Leitung von Brian G. Marsden – zeigen, daß von zweihundert beobachteten Kometen mit mindestens zweihundertfünfzigjähriger Umlaufperiode nicht mehr als zehn Pro­zent vom Weltall ins Sonnensystem eingedrungen sein können; neun­ zig Prozent sind von Anfang an an die Sonne als dem Brennpunkt ihrer Bahn gebunden. Bei der Erforschung der Geschwindigkeit der Kome­ten hat sich folgendes ergeben, wie Fred L. Whipple in seinem neuesten Buch Das Geheimnis der Kometen schreibt: »Wenn die Kometen wirk­lich aus dem Weltraum kämen, müßten sie viel schneller fliegen als nur 0,8 Kilometer in der Sekunde«, was nicht der Fall ist. Er schließt daraus, daß »die Kometen mit wenigen Ausnahmen dem Sonnensy­stem angehören und durch die Schwerkraft daran gebunden sind«. »In den letzten Jahren haben die Astronomen Oorts einfache Anschau­ung der ›Wolke‹ in Frage gestellt«, erklärte Andrew Theokas von der Universität Boston in der Zeitschrift New Scientist (11. Februar 1988). »Manche Astronomen glauben immer noch, es gebe die ›Oort Wolke‹, aber neue Forschungsergebnisse sollten sie deren Größe und Form überdenken lassen. Außerdem erhebt sich die 48 Frage nach dem Ur­sprung der ›Oort Wolke‹ und ob sie ›neue‹ Kometen enthält, die aus dem interstellaren Raum gekommen sind.« Andrew Theokas zitiert Mark Balley von der Universität Manchester, der darauf aufmerksam gemacht hat, daß die meisten Kometen der Sonne verhältnismäßig nahe kommen, nämlich jenseits der Planetenbahnen. Ist das vielleicht die Stelle, könnte man fragen, wo sich Nibirus »ferne Wohnung«, sein Aphel (entferntester Punkt von der Sonne), befindet? Besonders interessant an der Oortschen Wolke und an den neuen Erkenntnissen ist die Tatsache, daß die Kometen im großen und ganzen von jeher ein Teil des Sonnensystems gewesen sind und nicht nur Außenseiter, ein Umstand also, den Jan Oort genauso formuliert hatte. Mit dem Vorhandensein einer Kometenwolke im interstellaren Raum hat er das Problem der parabolischen und hyperparabolischen Kome­tenbahnen gelöst, nicht aber seine Theorie bewiesen. In der Studie, die ihn und die »Oort Wolke« berühmt gemacht hat (Die Struktur der Kometenwolke, die das Sonnensystem umgibt, und eine Hypothese ihres Ursprungs im Bulletin of the Astronomical Institutions, Bd. 11, 13. Januar 1950), nennt er seine neue Theorie »Hypothese eines ge­meinsamen Ursprungs der Planeten und Asteroiden«. Die Kometen sind nicht dort draußen, erklärt er, weil sie dort »geboren« wurden, sondern weil sie »hinausgestoßen« worden seien. Sie seien Fragment größerer Objekte, zerstreut durch die Perturbationen (Störungen) Planeten, besonders durch die des Jupiters – genau wie vor kurzem die Raumsonde Pioneer durch die Gravitation Jupiters und Saturns in den Weltraum katapultiert worden ist. »Hier ist es ein umgekehrter Prozeß«, schrieb Jan Oort. »Aus einer großen Wolke werden die Kometen auf eine kurzfristige Umlaufbahn gebracht. Doch in der Zeit, in der sich die Asteroiden bildeten, muß sich das Gegenteil ergeben haben: Noch viel mehr Objekte wurden aus dem Gebiet der Asteroiden in die Kometenwolke gezogen ... Viel wahrscheinlicher scheint es zu sein, daß die Kometen nicht in weiten Entfernungen entstanden sind, sondern bei den Planeten. Da denkt man natürlich in erster Linie an die Asteroiden. Sie weisen darauf hin, daß die beiden Arten – Kometen und Asteroiden – derselben Gattung angehören ... So kann man wohl annehmen, daß Kometen und Astero­iden gleichzeitig entstanden sind.« Zum Schluß faßt Jan Oort seine Studie folgendermaßen zusammen: »Das Vorhandensein der Kometen­wolke findet seine natürliche Erklärung, wenn man in den Kometen (und Meteoriten) kleinere Planeten sieht, die sich in einem Frühstadi­um des planetarischen Systems aus dem Asteroidengürtel befreit ha­ben.« Es beginnt alles wie Enuma elisch zu klingen ... Bei dieser Betrachtungsweise bleiben immer noch Fragen offen: Wie sind diese Objekte gleicher Art entstanden? Wodurch wurden die Ko­meten »zerstreut«? Was veranlaßte ihre Inklination und ihre rückläufi­ge Bewegung? Eine ausführlichere und realistischere Studie veröffentlichte 1978 Tho­mas C. Van Flandern vom Observatorium in Washington (Icarus 36) unter dem Titel Ein 49 ehemaliger Planet als Ursprung der Planeten. Er anerkannte vorbehaltlos die im 19. Jahrhundert vorgebrachten Erklä­rungen, daß die Asteroiden und die Kometen von einem ehemaligen explodierten Planeten abstammen. Bemerkenswert ist, daß er die Es­senz der Oortschen Theorie erkannt hat: »Sogar der Vater der modernen ›Kometenwolke‹-Hypothese ist aufgrund der damals verfügbaren Be­ weise zu dem Schluß gelangt, daß das Sonnensystem als Ursprung der Kometen, vielleicht in Zusammenhang mit der Entstehung des Asteroi­dengürtels, immer noch die annehmbarste Theorie sei.« Er wies auch auf die 1972 begonnenen Studien von Michael W. Ovenden, einem anerkannten kanadischen Astronomen, hin, der den Begriff eines »Prinzips gegenseitiger Aktion« einführte, nach dem »es zwischen Mars und Jupiter einen Planeten gegeben habe, dessen Masse etwa neunzigmal größer war als die der Erde und der vor verhältnismäßig kurzer Zeit, nämlich vor 107 (10.000.000) Jahren verschwunden sei.« Nur so, er­klärte Ovenden in seinem 1975 in Vistas in Astronomy, Bd. 18, erschie­nenen Aufsatz, könne man der Forderung entsprechen, daß »eine kos­mogonische Theorie sowohl rückläufige als auch direkte Gestirns­bewegungen berücksichtigen müsse«. Van Flandern faßte seine Befunde 1978 folgendermaßen zusammen: »Meine hauptsächliche Schlußfolgerung ist die, daß die Kometen in­folge eines explosiven Ereignisses im inneren Sonnensystem entstan­den sind. Höchstwahrscheinlich sind dabei auch der Asteroidengürtel und die meisten heute sichtbaren Meteore entstanden.« Weniger sicher sei es, daß die Mars-Satelliten und die Jupiter-Satelliten bei diesem explosiven Ereignis entstanden sind, das seiner Schätzung nach vor fünf Millionen Jahren stattgefunden habe. Hingegen zweifle er nicht, daß es innerhalb des Asteroidengürtels vor sich gegangen war. Physikalische, chemische und dynamische Eigenschaften der so ent­standenen Himmelskörper – das betonte er nachdrücklich – deuteten an, daß dort, wo sich der Asteroidengürtel befindet, »ein großer Planet zerfallen« sei. Was aber hat diesen Zerfall verursacht? Auf diese Frage ist Van Flan­dern selbst eingegangen. Er schrieb: »Die häufigste Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wie kann ein Planet explodieren? Darauf gibt es gegenwärtig keine befriedigende Antwort.« Die sumerischen Tontafeln allerdings liefern eine befriedigende Ant­wort: Es ist die Schilderung der Himmelsschlacht zwischen Nibiru/Marduk und Tiamat, bei der Tiamat in zwei Teile zerbrach, die Monde (alias Kingu) zerstört und die Überreste in eine rückläufige Bahn gezwungen wurden. Im Mittelpunkt der Kritik an der Theorie vom zerstörten Planeten steht die Frage, wo denn die Materie dieses Himmelskörpers geblieben sei. Bei der Schätzung der Totalmasse aller bekannten Asteroiden und Kometen ergibt sich nur ein Bruchteil der geschätzten Masse des zersplitterten Planeten. Das trifft besonders dann zu, wenn man bei der Berechnung von einem Planeten ausgeht, der nach Ovendens Schät­zung neunzigmal mehr Masse hat als die Erde. Ovenden erwiderte auf die diesbezügliche Kritik, die fehlende Masse sei wahrscheinlich von 50 Abb. 28 Jupiter »geschluckt« worden. So lasse sich erklären, weshalb er hundertdreißigmal mehr Masse als die Erde und mehrere rückläufige Monde hat. Er zitierte andere Studien, die besagen, Jupiter habe in alter Zeit sogar noch mehr Masse gehabt (in Monthly Notes of the Royal Astro­nomical Society, 173, 1975). Anstatt Jupiter zuerst zu vergrößern, um ihn dann wieder zu verklei­nern, sollte man lieber die geschätzte Größe des zerstörten Planeten verkleinern. Das geht aus den sumerischen Tafeln hervor. Wenn die Erde die eine Hälfte von Tiamat ist, dann war Tiamat ungefähr doppelt, nicht neunzigmal so groß wie die Erde. Die Asteroiden wurden von ihrer mutmaßlichen Position ungefähr 2,8 AE weit geschleudert und nehmen einen Raum zwischen 1,8 und 4 AE ein. Einige wurden zwi­schen Jupiter und Saturn gefunden, ein kürzlich entdeckter (2060 Chiron) befindet sich bei 13,6 AE zwischen Saturn und Uranus. Die Zersplitte­rung des zerstörten Planeten muß also mit ungeheurer Wucht gesche­hen sein – durch einen katastrophalen Zusammenstoß. Außerdem haben die Astronomen festgestellt, daß zwischen den Asteroidengruppen Lücken bestehen (Abb. 28). Nach neuester Theorie wurden die Asteroiden aus den Lücken hinausgeschleudert in Außen­räume, sofern sie unterwegs nicht durch die Anziehungskraft der äuße­ren Planeten wieder eingefangen wurden. Diese Asteroiden müßten »katastrophalen Zusammenstößen« ausgesetzt gewesen sein (McGraw­Hill Encyclopedia of Astronomy, 1983). Da es keine aktuellen Erklärungen für derartige Aus- und Zusammen­stöße gibt, bieten bisher lediglich die sumerischen Texte eine Theorie an, denn sie beschreiben den Umlauf Nibirus als eine weite elliptische Bahn, auf der er periodisch (nach meiner Schätzung alle dreitausendsechshundert Erdenjahre) zum Asteroidengürtel zurückkehrt. Wie die Abbildungen 10 und 11 zeigen, kam Nibiru/ Marduk an Tiamats Au­ßen- oder Jupiterseite vorbei; die wiederholte Rückkehr zu dieser Zone erklärt die Größe der dortigen Lücke. Wenn man das Vorhandensein Nibirus und seine periodische Rückkehr zum Ort der Himmelsschlacht gelten läßt, wird das Rätsel der fehlen­den Materie gelöst. Dadurch wird auch die Theorie erhärtet, daß Jupiter vor verhältnismäßig kurzer Zeit (vor Millionen, nicht vor Milliarden von Jahren) an Größe zugenom51 men habe. Je nachdem, wo Jupiter sich befand, wenn Nibiru/Marduk sein Perihel (sonnennächster Punkt) er­reichte, konnte Jupiter größer werden, das geschah also öfters, nicht nur ein einziges Mal zum Zeitpunkt der Tiamat-Katastrophe. Spektro­graphische Untersuchungen der Asteroiden enthüllen, daß »einige von ihnen in den ersten hundert Millionen Jahren nach der Entstehung des Sonnensystems so heiß wurden, daß sie schmolzen. Bei anderen sank das Eisen in die Mitte und bildete starke Kerne aus Gestein und Eisen, während Basaltlava an die Oberfläche schwamm, so daß kleinere Pla­neten entstanden« (McGraw-Mill Encyclopedia of Astronomy). Die Katastrophe ereignete sich genau zu der Zeit, die ich in meinem Buch Der zwölfte Planet angegeben habe – etwa fünfhundert Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems. Die wissenschaftlichen Fortschritte in Physik und Astrophysik bestäti­gen die sumerische Kosmogonie in bezug auf die gleichzeitige Entste­hung der Kometen und Asteroiden infolge eines Zusammenstoßes, auf den Ort des Geschehens (wo die Asteroiden immer noch kreisen) und sogar auf den Zeitpunkt (vor etwa vier Milliarden Jahren). Sie bestäti­gen auch die alten Texte in bezug auf die wichtige Frage des Vor­handenseins von Wasser. Das Vorhandensein des Wassers, seine Vermischung, die Trennung der Wasser, all das spielt eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Tiamat, Nibiru/Marduk, der Himmelsschlacht und ihren Folgen. Das Rätsel hat teilweise dadurch eine Lösung gefunden, daß die alte Dar­stellung des Asteroidengürtels als eines Teilers zwischen dem Wasser »unten« und dem Wasser »oben« von der modernen Wissenschaft bestätigt wird. Aber es steckt noch mehr dahinter. Tiamat wird als ein »wäßriges Ungeheuer« bezeichnet, und in den sumerischen Texten ist davon die Rede, wie Nibiru/Marduk mit ihrem Wasser umgegangen ist: »Ihre eine Hälfte spannte er aus als Himmelsdecke: am Ort der Kreuzung sollte sie als Schranke wachen; ihr Wasser nicht entweichen zu lassen, befahl er.« Daß der Asteroidengürtel nicht nur als Teiler zwischen dem oberen und unteren Wasser dienen sollte, sondern auch als »Wächter« von Tiamats eigenem Wasser, findet einen Widerhall in der biblischen Schöpfungs­geschichte, in der der »gehämmerte Armreifen« auch Schama’im heißt: »Ort, wo das Wasser gewesen ist«. Im Alten Testament wird oft darauf Bezug genommen, daß dort, wo die Himmelsschlacht, die Erschaffung der Erde und des Schama’im stattgefunden hat, Wasser gewesen sei, was darauf schließen läßt, daß man sogar zur Zeit der Propheten und der judäischen Könige die sumerische Kosmologie gekannt hat. Ein Beispiel bietet der Psalm 104, in dem der Herr als Schöpfer gepriesen wird: »Der den Schama’im ausgespannt hat wie einen Vorhang, der für seinen Aufstieg eine Decke auf die Wasser gelegt hat.« Dieser Vers ist fast eine wörtliche Übersetzung der betreffenden Stelle im Enuma elisch; in beiden Fällen folgt die Entstehung des Asteroiden­gürtels an der Stelle, 52 »wo das Wasser gewesen ist«, der Zertrümmerung Tiamats, deren einer Teil die Erde wird. Die Gewässer der Erde lassen vermuten, wo Tiamats Wasser geblieben ist. Aber was ist mit den Satelliten? Wenn aus ihnen die Asteroiden und die Kometen entstanden sind, müßten sie dann nicht auch Wasser enthalten? Die meisten Asteroiden hat man nach ihrer Zusammensetzung in zwei Klassen eingeteilt. Etwa fünfzehn Prozent gehören dem Typ S an: sie haben eine rötliche Oberfläche, die aus Silikaten und Eisen besteht. Ungefähr fünfundsiebzig Prozent, der Typ C, sind kohlenstoffhaltig und enthalten das Wasser. Das spektrographisch untersuchte Wasser ist nicht flüssig; da Asteroiden keine Atmosphäre haben, würde Wasser in flüssiger Form an der Oberfläche rasch verdunsten. Doch da man in der Oberflächenmaterie Wassermoleküle gefunden hat, ist zu folgern, daß die Mineralien, aus denen die Asteroiden bestehen, Wasser eingefan­gen und sich mit ihm verbunden haben. Die Bestätigung dieser Annah­me ergab sich, als im August 1982 ein kleiner Asteroid der Erde nahe kam, in ihre Atmosphäre geriet und zerfiel. Er erschien als »ein Regen­bogen mit langem Schweif, der über den Himmel zog«. Ein Regenbogen entsteht, wenn Sonnenlicht auf eine Ansammlung von Wassertrop­fen wie Regen, Nebel oder Sprühwasser fällt. Wenn der Asteroid eher das ist, was seine ursprüngliche Bezeichnung »kleiner Planet« andeutet, dann könnte er gut Wasser in flüssiger Form enthalten. Die Untersuchung des infraroten Spektrums von Ceres, dem zuerst entdeckten Asteroiden, hat ergeben, daß er statt des an Minerali­en gebundenen Wassers eher freies Wasser enthalten könnte. Da freies Wasser schnell verdunsten würde, nimmt man an, daß Ceres im Innern eine aufsteigende Wasserquelle hat. »Wenn Ceres diese Quelle seit eh und je gehabt hat«, erklärt der britische Astronom Jack Meadows, »dann muß dieser Asteroid sein Dasein als sehr feuchter Gesteins­brocken begonnen haben. « Er weist darauf hin, daß auch kohlen­stoffhaltige Meteoriten »in vergangenen Zeiten anscheinend stark von Wasser beeinflußt worden sind«. Der als Chiron-2060 bezeichnete Himmelskörper, der in vielerlei Hin­sicht interessant ist, beweist ebenfalls, daß die Überreste der »Himmels­schlacht« Spuren von Wasser enthalten. Als Charles Kowal vom Hale-Observatorium auf dem Palomar in Kalifornien Chiron-2060 im No­vember 1977 entdeckte, wußte er zuerst nicht, was das war. Er bezeich­nete ihn einfach als Planetoiden, gab ihm vorläufig den Namen O-K (Objekt Kowal) und meinte, es könne ein unsteter Satellit von Saturn oder Uranus sein. Mehrere Wochen später ergaben die Beobachtungen, daß seine Bahn elliptischer ist als die der Planeten und Planetoiden, eher ähnlich denen der Kometen. 1981 war die Frage entschieden: Das Objekt war ein Asteroid, vielleicht einer von denen, die bis Uranus, Neptun oder sogar noch weiter zogen, und er erhielt den Namen Chiron-2060. Aber 1989 offenbarten weitere Beobachtungen vom Ob­servatorium in Arizona aus (Kitt Peak), daß Chiron eine ausgedehnte Atmosphäre aus Kohlendioxyd und Staub hat, also ähnlich einem Kometen. Zuletzt wurde festgestellt, daß er im wesentlichen »ein schmut­ziger Schneeball ist, bestehend aus Wasser, Staub und Kohlendioxyd-Eis«. Wenn Chiron eher ein Komet als ein Asteroid ist, dient er nur als weiterer Beweis, daß beide Arten der Überreste des Genesis-Ereignis­ses Wasser enthalten. 53 Wenn ein Komet sehr weit entfernt von der Sonne ist, kann man ihn nicht sehen. In der Nähe der Sonne entwickelt sein Kern Gase, Koma genannt, die bei der Erwärmung einen Schweif aus diesen Gasen und Staub entstehen lassen. Die Beobachtung dieser Emissionen hat im großen und ganzen Whipples Ansicht, Kometen seien schmutzige Schneebälle, bestätigt, denn der Beginn der Aktivität infolge der Erhit­zung des Kerns steht im Einklang mit den thermodynamischen Eigen­schaften von Wassereis sowie mit der spektroskopischen Analyse der Gas­ emissionen, die unweigerlich das Vorhandensein von Wasser anzeigen. Daß Kometen Wasser enthalten, ist durch die schlüssigen Beobachtungen in jüngster Zeit erwiesen. Der Komet Kohoutek (1974) wurde ja nicht nur von der Erde aus aufs Korn genommen, sondern auch von erdumkreisenden Weltraumfahrern sowie von der Sonde Mariner 10, die auf dem Weg zu Merkur und Venus war. Die Befunde erbrachten den ersten direkten Beweis, daß ein Komet Wasser enthält. »Daß sowohl Wasser als auch zwei komplexe Moleküle im Schweif gefunden wurden, ist von größter Bedeutung«, sagte damals Stephen P. Motan, der das wissenschaftliche Programm für die NASA leitete. Die Astrophysiker des MaxPlanck-Instituts in München erklärten, man habe »die ältesten und im wesentlichen unveränderten Materialproben seit der Entstehung des Sonnensystems zu sehen bekommen«. Aber das war noch nichts im Vergleich zu den Befunden, die sich 1986 bei der Beobachtung des Halleyschen Kometen ergaben. Einstimmig wurde erklärt, er sei ein wasserhaltiger Himmelskörper. Abgesehen von mehreren, nur teilweise erfolgreichen Bemühungen der Amerikaner, den Halleyschen Kometen aus der Ferne zu beobachten, beteiligte sich eine internationale Flottille von fünf unbemannten Raum­ sonden an der Begegnung. Die Sowjetunion entsandte Vega 1 und Vega 2 (Abb. 29a), Japan Sakigake und Suisei und die Europäische Weltraumbehörde Giotto (Abb. 29b), so genannt zu Ehren des florenti­nischen Malers Giotto di Bondone (12661337), der von dem zu seiner Zeit erschienenen Halleyschen Kometen so begeistert war, daß er ihn in sein Fresko »Anbetung der Heiligen Drei Könige« einfügte, auf dem der Komet den Abb. 29a und b 54 Stern von Bethlehem verkörpert (Abb. 30). Als der Halleysche Komet im November 1985 Koma und Schweif entfaltete, verfolgten ihn die Astronomen vom Kitt-Peak-Observatori­um aus mit Teleskopen und berichteten dann, er bestehe »bestimmt hauptsächlich aus Wassereis und die ihn umgebende dünne, etwa fünf­hundert Kilometer breite Wolke aus Wasserdampf«. Das wurde von Susan Wyckoff von der Universität Arizona unterstrichen: »Zum ersten Mal ist der Beweis erbracht worden, daß Wassereis vorherrscht.« Die teleskopischen Beobachtungen wurden im Januar 1986 durch infrarote UntersuAbb. 30 chungen von einem Raumschiff aus bestätigt, und man war sich einig, daß der Halleysche Komet hauptsächlich Wasser enthält. In diesem Monat entwickelte der Halleysche Komet einen ungeheuren Schweif und einen Halo aus Hydrogengas, dessen Durchmesser rund zwanzig Millionen Kilometer betrug, also fünfzehnmal größer als der der Sonne war. Hierauf sorgten die NASA-Ingenieure dafür, daß die Sonde Pioneer, die gerade die Venus umkreiste, ihre Instrumente auf den Kometen richtete, der soeben zwischen Venus und Merkur seinem Perihel zuflog. Das Spektrometer der Raumsonde zeigte an, daß der Komet jede Sekunde zwölf Tonnen Wasser verlor. Als er am 6. März 1986 an seinem Perihel anlangte, verlor er zuerst dreißig und dann siebzig Tonnen in der Sekunde. Später erklärte Ian Stewart, der Leiter des NASA-Programms, »selbst da habe der Halleysche Komet immer noch genug Wassereis gehabt, um noch Tausende von Umläufen durch­zustehen«. Die näheren Begegnungen mit dem Halleyschen Kometen begannen am 6. März, als Vega 1 in die strahlende Atmosphäre des Kometen eintauchte und aus weniger als neun Kilometern Entfernung die ersten Aufnahmen von seinem Eiskern machte. Die Presse tat pflichtgemäß kund, daß die Menschheit nun zum erstenmal den Kern eines Himmels­körpers zu sehen bekam, der sich zeitgleich mit dem Sonnensystem entwickelt hat. Am 9. März näherte sich Vega 2 auf achttausend Kilo­meter dem Kern des Halleyschen Kometen und bestätigte den Befund von Vega 1. Diese Sonde ermittelte auch, daß der »Staub« des Kometen felsbrockengroße Materie enthielt und daß diese schwere Kruste oder Schicht einen Kern umhüllte, dessen Temperatur, ungefähr hundert­vierzig Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, dreißig Grad Celsius betrug. Die beiden japanischen Raumsonden, die sich mit der Wirkung des Sonnenwindes auf den Schweif des Kometen und mit seiner großen Wasserstoffwolke befaßten, hielten sich in beträchtlicher 55 Entfernung. Giotto hingegen sollte dem Halleyschen Kometen buch­stäblich frontal begegnen (bis auf einen Abstand von ca. fünfhundert Kilometern) und seinen Kern erforschen. Am 14. März war es soweit; der »geheimnisvolle Kern« war schwarz, größer, als man gedacht hatte (ungefähr 240 Hektar), unregelmäßig geformt (Abb. 31). Abb. 31 Man verglich ihn mit »zwei Erbsen in einer Schote« und einer »knolligen Kartoffel«. Ihm entströmten Staub und zu achtzig Prozent Wasserdampf, der an­zeigte, daß unter der schwarzen Kruste geschmolzenes Eis, also flüssi­ges Wasser, verborgen sein mußte. Der erste ausführliche Bericht über die Ergebnisse dieser Beobachtungen aus der Nähe erschien in einer Sonderausgabe der Zeitschrift Nature im Mai 1986. Die Russen bestätigten, daß der Komet größtenteils aus Wasser besteht, an zweiter Stelle aus Kohlenstoff- und Wasserstoff­verbindungen. Laut Giotto ist H2O (Wasser) das vorherrschende Mo­lekül in der Koma; »Wasserdampf macht achtzig Prozent aller entwei­chenden Gase aus.« Diese vorläufigen Feststellungen wurden im Okto­ber auf einer internationalen Konferenz in Heidelberg bestätigt. Im Dezember 1986 verkündeten Astronomen von der Johns-HopkinsUni­versität, nach Auswertung der im März gesammelten Daten habe der kleine erdumkreisende Satellit IUE (International Ultraviolet Explorer) eine Explosion des Halleyschen Kometen verzeichnet, bei der an die zehn Kubikmeter Eis aus dem Kern geschleudert worden seien. Überall ist Wasser vorhanden auf diesen Boten der Genesis! Wenn die Kometen, aus der Kälte kommend, sich auf drei bis zweiein­halb AE der Sonne nähern, erwachen sie zum Leben, und als erste Substanz taut Eis auf, so daß Wasser entsteht. Wenig Bedeutung hat man der Tatsache beigemessen, daß in dieser Entfernung von der Sonne die Zone des Asteroidengürtels liegt. Man muß sich fragen, ob die Kometen dort zum Leben erwachen, weil sie in dieser Gegend entstan­den sind – aus Tiamat und ihrer wäßrigen Heerschar ... Bei den Entdeckungen, die die Kometen und die Asteroiden betreffen, ist noch etwas zum Leben erwacht: das alte Wissen der Sumerer. 56 Sehende Himmelsaugen Als die Erdmission der Anunnaki vollendet war, lebten sechs­hundert von ihnen auf der Erde, und dreihundert umkreisten sie in den Raumfähren. Diese Raumfahrer nannten die Sumerer Igigi, das heißt »Die beobachten und sehen«. Die Archäologen haben in Mesopotamien Gegenstände gefunden, die sie als »Augenidole« (a) bezeichnen, sowie Schreine, die diesen »Göttern« geweiht worden sind (b). In den Texten wer­den Geräte erwähnt, die die Anunnaki benutzten, um »die Erde von Anfang bis Ende abzuspähen«. Sie wurden von den Sume­rern »sehende Himmelsaugen« genannt – Satelliten, die »beob­achten und sehen«. Vielleicht ist es kein Zufall, daß unsere heutigen Nachrichtenträger, die seit dem Jahr 1957 als Satelliten die Erde umkreisen, wie etwa Intelsat IV und Intelsat IV A (c und d), den jahrtausendealten Abbildungen der Sumerer so ähnlich sind. 57 5 Die Erde - der abgespaltene Planet Warum nennen wir unseren Planeten »Erde«? Erde, im Althochdeutschen Erda, im Englischen Earth, im Isländi­schen Jordh, im Dänischen Jord, im Mittelenglischen Erthe, im Goti­schen Airtha; und geographisch und zeitlich noch weiter entfernt: im Aramäischen Ereds und Aratha, im Kurdischen Erd und Ertz, im Hebräischen Eretz. Herodot nannte das heutige Arabische Meer Erythräisches Meer, und im Persischen heißt eine Siedlung oder Niederlassung noch heute Ordu. Warum? Die Antwort auf diese Frage findet man in den sumerischen Texten, die erzählen, wie die ersten Anunnaki/Nefilim auf die Erde gekommen sind. Es waren fünfzig, angeführt von Ea (Dessen Heim das Wasser ist), einem bedeutenden Naturwissenschaftler und erstgeborenen Sohn des Herrschers von Nibiru, Anu. Sie landeten auf dem Arabischen Meer und wateten zum Ufer des dortigen Sumpflandes, das nach der Erwär­mung des Klimas der Persische Golf wurde (Abb. 32). Im Sumpfland errichteten sie ihre erste Niederlassung auf dem neuen Planeten und nannten sie Eridu (Heimat in der Ferne). So kam es, daß unsere Weltkugel, als sie bewohnt war, nach dieser ersten Siedlung benannt wurde – Erde, Erthe, Earth. Wann immer wir unseren Planeten bei Abb. 32 58 diesem Namen nennen, beschwören wir unwis­sentlich Eridu herauf und ehren die erste Gruppe der Anunnaki, die den Ort gegründet haben. Die sumerische Bezeichnung für die Erde und ihre feste Oberfläche lautete Ki. Piktographisch wurde sie als leicht abgeflachte stellt (Abb. 33a), Kugel darge­ durchzogen von vertikalen LiniAbb. 33a und b en, die unseren Meri­dianen nicht unähnlich sind (Abb. 33b). Da die Erde an ihrem Äquator eine Wölbung aufweist, ist die sumerische Darstellung in wissen­schaftlicher Hinsicht richtiger als unser heutiger Globus, der sie als vollkommene Kugel zeigt. Nachdem Ea die ersten fünf der sieben Ursiedlungen der Anunnaki errichtet hatte, erhielt er den Titularnamen Enki (Herr der Erde). Aber die Bezeichnung Ki hat ihre Bedeutung: das Verb bedeutet abschnei­den, trennen, aushöhlen. Die Ableitungen machen dies klar: Kila heißt Höhle, Grube, Kima ist ein Grab, Kiindar ein Riß oder eine Spalte. In den astronomischen Texten ist Ki mit Mul (Himmelskörper) verbunden. Wenn die Rede von Mulki ist, lautet die Übersetzung: »Der Himmels­körper, der zerrissen worden ist.« Mit der Bezeichnung Ki für Erde beschworen die Sumerer ihre Kosmogonie – die Geschichte von der Himmelsschlacht und der Spaltung des Planeten Tiamat. Ohne es zu wissen, übernehmen wir diese Beschreibung unseres Plane­ten. Irritierend ist nur, daß im Laufe der Zeit – die sumerische Zivilisa­tion hatte bis zum Aufstieg Babyloniens zweitausend Jahre überdauert – die Silbe »ki« in »gi« und manchmal in »ge« abgewandelt wurde. So wurde sie ins Akkadische und die aus diesem Stamm abzweigenden Sprachgruppen (Babylonisch, Assyrisch, Hebräisch) übertragen, wobei sie aber immer ihre geographische und topographische Bedeutung als Spalte, Schlucht, tiefes Tal beibehielt. So stammt zum Beispiel die biblische Ortsbezeichnung Gehenna (Hölle) vom hebräischen Gai-Hinnom ab, von dem Tal Hinnom bei Jerusalem, wohin Tierkadaver und die Leichen von Verbrechern geworfen wurden und wo am Tage des Jüngsten Gerichts die Sünder durch ein ausbrechendes unterirdi­sches Feuer gereinigt werden sollen. Wir haben in der Schule gelernt, daß die Vorsilbe »Geo« immer mit der Wissenschaft von der Erde zu tun hat – Geographie, Geometrie, Geologie und so weiter. Sie entstammt dem Griechischen: Gäa war die Göttin der Erde. Aber es wurde uns nicht gesagt, woher die Griechen diese Vorsilbe hatten und was sie eigentlich bedeutet. Sie hat ihren Ursprung im sumerischen Ki oder Gi. Die Altertumsforscher sind sich darin einig, daß die Griechen ihre Vorstellungen von uranfänglichen Ereignissen und von den Göttern aus dem Nahen Osten übernommen haben, von Kleinasien, wo im Westen die ersten griechischen 59 Niederlassungen wie beispielsweise Troja la­gen, und von Kreta. Nach griechischer Überlieferung flüchtete Zeus, der höchste Gott, nach Kreta, nachdem er die schöne Europa, die Tochter des phönizischen Königs von Tyrus, entführt hatte. Aphrodite kam über Zypern aus dem Nahen Osten, Poseidon zu Pferde aus Kleinasien, und Athene brachte den Olivenbaum aus dem Lande der Bibel nach Griechenland. Zweifellos entwickelte sich das griechische Alphabet aus dem des Nahen Ostens (Abb. 34). Der Sprachforscher Cyrus H. Herdon entzifferte die rätselhafte kretische Schrift, wonach sie einem semitiAbb. 34 schen Sprachstamm angehört. Mit den Göttern und der Terminologie kamen auch die Mythen und Sagen zu uns. Die frühesten griechischen Werke über die Vorzeit und die Angelegenheiten der Götter und Menschen waren die Ilias von Homer, die Oden von Pindar von Theben und vor allem Hesiods Theogonie (Lehre von der Entstehung und Abstammung der Götter), die im achten Jahrhun­dert vor Christus erschienen ist. Hesiod schildert die Ereignisse, die schließlich zu Zeus’ Vorherrschaft führten; es ist eine Geschichte der Leidenschaften, Rivalitäten und Kämpfe, die ich in meinem Buch Die Kriege der Menschen und Götter, dem dritten Band der Erdchronik, beschrieben habe; sie beginnt mit der Entstehung der Götter, des Him­mels und der Erde aus dem Chaos, ähnlich der biblischen Beschrei­bung: »Wahrlich, zuerst war das Chaos, als nächstes die breitbrüstige Gäa, sie, die alle Sterblichen schuf, die die schneebedeckten Gipfel des Olymps festhielt; nach ihr der düstere Tartaros in der Tiefe der vielwegigen Erde, und Eros, der schönste unter den unsterblichen Göttern ... 60 Aus dem Chaos erstanden Erebus und die schwarze Nyx, die Äther und Hemera gebar.« An diesem Punkt im Prozeß der Entstehung der unsterblichen Götter gab es den Himmel noch nicht, genau wie es in den sumerischen Texten steht. Gäa ist also Tiamat, die »alle gebar«, wie es im sumerischen Schöpfungsepos (Enuma elisch) heißt. Homer teilt die Götter, die »Chaos« und »Gäa« folgten, in drei Paare ein – Tartaros und Eros, Erebus und Nyx, Äther und Hemera; die Parallele zu den drei Paaren in der sumerischen Kosmogonie ist offensichtlich. Heute heißen sie Venus und Mars, Saturn und Jupiter, Uranus und Neptun. Erst nach der Erschaffung der Hauptplaneten, die das Sonnensystem bildeten, in das Nibiru eindrang, spricht Hesiod – wie auch die sume­rischen und biblischen Texte – von der Entstehung des Ouranos, des »Himmels«. Wie die biblische Schöpfungsgeschichte erklärt, war die­ser Schama’im der gehämmerte Armreifen, der Asteroidengiirtel. Laut dem sumerischen Schöpfungsepos war er die zertrümmerte Hälfte des Planeten Tiamat, während die andere unversehrte Hälfte die Erde wur­de. All das spiegelt sich in den folgenden Worten der Hesiodschen Theogonie wider: »Und Gäa gebar dann den gestirnten Ouranos, ihr ebenbürtig, sie auf allen Seiten einzuhüllen, ein dauernder Wohnort für die Götter zu sein.« Tiamat gab es nicht mehr. Ihre unversehrte Hälfte wurde auf eine andere Bahn geworfen, wurde die Erde, die das Firmament zertrüm­merte, die Dauerwohnung der Asteroiden und Kometen. Die Erde war Ki oder Gi, die Abgetrennte. Wie sah der abgetrennte Planet, der jetzt als Gaia/Erde seine Bahnen zog, nach der Schlacht aus? Auf der einen Seite gab es feste Land­massen, die die Kruste von Tiamat gebildet hatten; auf der anderen Seite gab es auf dem Planeten eine immens große Spalte, in die die Wassermassen des früheren Tiamat geflossen sein müssen. Hesiod drückte dies so aus: Gaia (nun das halbe Gegenstück zum Himmel) brachte auf der einen Seite »langgestreckte Hügel und schöne Ver­ stecke für die Göttinnen und Nymphen« hervor, und auf der anderen Seite »gebar sie Pontus, die fruchtlose Tiefe mit dem wütenden Rau­schen«. Dasselbe Bild vom abgetrennten Planet zeichnet die biblische Schöp­ fungsgeschichte: »Und Elohim sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem bestimmten Ort, damit das trockene Land erscheine. Und so geschah es. Und Elohim nannte das trockene Land Erde, und das Wasser, das sich gesammelt hatte, nannte er Meer.« Die Erde nahm Form an. 61 Dreitausend Jahre trennten Homer von der Zeit, in der die sumerische Kultur aufgeblüht war, und es ist klar, daß die alten Völker und mit ihnen die Verfasser der Genesis während dieser Jahrtausende die sume­rische Kosmogonie übernahmen. Heute nennt man sie Mythos, Sage oder religiösen Glauben, aber damals war sie Wissenschaft – das Wissen, das die Anunnaki den Sumerern vermittelt hatten. Gemäß diesem alten Wissen war die Erde kein Urglied des Sonnensy­stems, sondern die abgetrennte Hälfte des Planeten, den sie Tiamat nannten. Die Himmelsschlacht, die zur Entstehung der Erde führte, hatte mehrere hundert Millionen Jahre nach der Entstehung des Son­nensystems mit seinen Planeten stattgefunden. Als ein Teil von Tiamat, dem »wäßrigen Ungeheuer«, besaß die Erde viel Wasser. Als die Erde ein selbständiger Planet wurde und infolge des Schwergewichts Kugel­form annahm, sammelte sich das Wasser in der großen Höhlung auf der abgerissenen Seite, und auf der anderen erschien trockenes Land. Daran glaubten die alten Völker. Was hat die moderne Wissenschaft dazu zu sagen? Im allgemeinen gilt die Theorie, daß die Planeten sich kugelförmig gebildet haben, und zwar aus Gasscheiben, die durch die Sonnenstrah­len gewissermaßen geronnen sind. Als sie abkühlten, sank schwerere Materie – im Fall der Erde das Eisen – in die Mitte, so daß sich ein fester Kern bildete. Ihn umgibt eine Schicht aus weniger festem, plastischem oder sogar flüssigem Stoff, der, wie man glaubt, bei der Erde aus geschmolzenem Eisen besteht. Die Bewegungen des Kerns und seiner Hülle wirken wie ein Dynamo und erzeugen das Magnetfeld des Plane­ten. Den Kern und seine Hülle umgibt ein Mantel aus Gestein und Mineralien, den man bei der Erde auf eine Dicke von etwa dreitausend Kilometer schätzt. Die Hitze im Innern – man schätzt sie auf sieben- bis zehntausend Grad Celsius – beeinflußt den Mantel und auch die Erdkruste. Geformt durch das Schwergewicht und am Platz gehalten durch die Rotation um die eigene Achse, hat sich der schalenförmige Aufbau der Erde in schätzungsweise vier Milliarden Jahren vollzogen. Man könnte ihn mit dem einer Zwiebel vergleichen (Abb. 35). Alles ist sehr ordent­lich bis zu einem gewissen Punkt; die hauptsächlichen Abweichungen betreffen die Kruste. Seit der Untersuchung der Gesteinsproben von Mond und Mars in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts rätseln die Geo­ physiker über die Geringfügigkeit der Erdrinde. Bei Mond und Mars beträgt die Kruste zehn Prozent der Gesamtmasse, bei der Erde aber weniger als ein halbes Prozent der Landmasse. Im Jahr 1988 Abb. 35 62 berichte­ten Geophysiker von Caltech und von der Universität Urbana in Illinois bei einem Kongreß der Amerikanischen Geologischen Gesellschaft in Denver, sie hätten die »fehlende Kruste« gefunden. Aus der Analyse der Schockwellen bei Erdbeben sei zu schließen, daß die fehlende Masse etwa vierhundert Kilometer unter der Erdoberfläche liegt. Es sei genügend Materie da, um die Dicke der Kruste zu verzehnfachen. Doch selbst dann würde die Kruste der Erde vier Prozent ihrer Landmasse ausmachen, immer noch nicht einmal die Hälfte der Norm (auf Mond und Mars bezogen). Unbeantwortet bleibe die Frage, welche Kraft bewirkt hat, daß ein Teil der Kruste, die leichter ist als die Mantel­materie, kilometerweit nach unten abgesackt ist. Nach Meinung der Geophysiker besteht die Krustenmaterie aus großen Brocken, die dort verschwunden sind, wo die Rinde Risse aufweist. Aber wodurch könn­ten so große Gesteinsbrocken in die Tiefe gesunken sein? Ebenso ungewöhnlich ist die Ungleichförmigkeit der Erdrinde. Stellen­ weise variiert die Dicke von zwanzig bis fast siebzig Kilometer, aber dort, wo die Ozeane sich befinden, ist die Kruste nur fünf bis acht Kilometer dick, die Durchschnittshöhe der Erdteile beträgt rund sie­benhundert Meter, die Durchschnittstiefe Abb. 36 der Meere hingegen über viertausend Meter. Daraus ergibt sich, daß die viel dickere Kontinental­kruste viel tiefer in den Mantel hinunterreicht, hingegen die Meeres­kruste nur eine dünne Schicht aus verfestigter Materie und Absatz­gestein ist (Abb. 36). Es gibt noch mehr Unterschiede zwischen Land- und Meereskruste. Die Landkruste besteht aus großen, granitähnlichen Felsblöcken, die denen des Mantels gleichen; ihre Dichte ist 2,7 bis 2,8 g/cm3, die des Mantels 3,3. Die Meereskruste ist schwerer und dichter, die Dichte durchschnittlich 3,0 bis 3,1 g/cm3, also dem aus Basalt und anderem dichten Gestein bestehenden Mantel ähnlicher. Es ist bemerkenswert, daß die »fehlende Kruste«, die nach Meinung der Geophysiker in den Mantel abgesunken ist, in der Zusammensetzung mehr der Meeres­kruste gleicht als der Landkruste. Das führt zu einem noch wichtigeren Unterschied zwischen Land- und Meereskruste. Die Landkruste ist stellenweise nicht nur leichter und dicker, sondern auch viel älter. Gegen Ende der 1970er Jahre waren die Wissenschaftler einstimmig der Meinung, daß sich der größte Teil der heutigen Landoberfläche vor etwa drei Milliarden Jahren gebildet hat. Den Beweis dafür, daß die Kruste seit damals dieselbe Dicke beibehal­ten hat, fanden die Geologen in den sogenannten archaischen Schild­gebieten, die auf allen Kontinenten gefunden wurden; aber in diesen Gebieten wurde Gestein entdeckt, das bereits vier Milliarden Jahre alt 63 ist. 1983 fanden Geologen der Australian-National-Universität in West­australien Gesteinsreste der Landkruste, deren Alter auf etwa vier Milliarden Jahre geschätzt wurde. Untersuchungen von Gesteinspro­ben mit neuen Methoden, die von Forschern in Nordkanada vorgenom­men wurden, ergaben ein exaktes Alter von 3,96 Milliarden Jahren. In der Nähe fand man Steine, die 4,1 Milliarden Jahre alt waren. Die Wissenschaftler tun sich immer noch schwer, die Lücke von fünf­hundert Millionen Jahren zwischen dem Alter der Erde, das nach Meteorbrocken, die man im Krater von Arizona gefunden hat, 4,6 Mil­liarden Jahre beträgt, und dem Alter des ältesten bisher entdeckten Gesteins zu schließen. Doch die Tatsache, daß die Erde ihre Landkruste seit mindestens vier Milliarden Jahren hat, ist unbestritten. Anderer­seits hat man kein Stück der Meereskruste gefunden, das älter als zweihundert Millionen Jahre ist. Das ist ein ungeheurer Unterschied, der sich nicht erklären läßt, mag man noch so sehr über aufsteigende und absinkende Kontinente, Bildung und Verschwinden von Meeren nachgrübeln. Irgend jemand hat einmal die Erdrinde proportional mit der Schale eines Apfels verglichen. Wo die Meere sind, da ist die »Haut« frisch, sozusagen gestern entstanden. Wo die Meere in der Urzeit begannen, da scheinen die Schale und ein guter Teil des Apfels selbst abgeschabt worden zu sein. Die Unterschiede zwischen Land- und Meereskruste müssen früher noch größer gewesen sein, weil die Landkruste durch die Naturkräfte fortwährender Erosion ausgesetzt ist und ein Teil der verwitterten, festen Materie in die Meeresbecken geschwemmt wird, so daß die Meereskruste immer dicker wird. Außerdem wird die Meereskruste von aufstoßendem geschmolzenem Basalt und den Silikaten, die vom Mantel durch Verwerfungen im Meeresboden aufsteigen, immerzu vergrößert. Dieser Prozeß, der eine Schicht nach der anderen der Meereskruste hinzufügt, findet seit zweihundert Millionen Jahren statt und hat der Meereskruste ihre jetzige Form verliehen. Was war vorher auf dem Meeresgrund? War gar keine Kruste da, nur eine klaffende »Wunde« auf der Erdoberfläche? Kann man die fortdauernde Bildung der Meereskruste mit der Blutgerinnung vergleichen, die einsetzt, wenn die Haut verletzt worden ist? Versucht Gäa – ein lebender Planet –, ihre Wunden zu heilen? Die offensichtlichste Stelle, wo die Erde »verwundet« wurde, ist der Stille Ozean. Durchschnittlich beträgt der Sturz der Erdkruste ins Meer rund vier Kilometer, aber im Stillen Ozean erreicht er gegenwärtig an manchen Stellen ein Höhe von zehn Kilometern. Wenn man die Kruste, die sich in den letzten zweihundert Millionen Jahren gebildet hat, vom Meeresboden abrechnet, gelangt man in eine Tiefe von achtzehn Kilo­metern unter der Wasseroberfläche und zwischen dreißig und rund hundert Kilometern unter der Landoberfläche. Das ist ein großes Loch. Wie tief war es, bevor sich die Kruste in den vergangenen zweihundert Millionen Jahren gebildet hat? Wie groß war die »Wunde« vor fünf­hundert Millionen Jahren, vor einer Milliarde Jahren, vor vier Milliar­den Jahren? Das läßt sich nicht einmal vermuten, man kann nur sagen, daß sie viel, viel tiefer war. 64 Fest steht auf jeden Fall, daß der Umfang größer und ein weitaus größerer Teil der Erde betroffen war. Der Stille Ozean nimmt heute etwa ein Drittel der Erdoberfläche ein, aber er ist sicher in den zwei­hundert Millionen Jahren eingeschrumpft. Die Schrumpfung rührt da­her, daß die angrenzenden Kontinente – Amerika im Osten, Asien und Australien im Westen – sich einander nähern, so daß der Stille Ozean langsam zusammengedrückt und Jahr um Jahr zentimeterweise ver­kleinert wird. Die Wissenschaft, die sich mit diesem Prozeß und den theoretischen Erklärungen befaßt, nennt man Geotektonik (Lehre vom Bau und den Bewegungen der Erdkruste). Wie beim Studium des Sonnensystems hat man es vorgezogen, die Vorstellung von einem unveränderlichen, stabilen Dauerzustand der Planeten zu verwerfen und statt dessen Katastrophentheorie, Veränderungen und sogar Entwicklungen an­zuerkennen, indem man nicht nur Flora und Fauna, sondern den ge­samten Globus als »lebende« Wesen betrachtet, die wachsen und schrumpfen, gedeihen und leiden, ja geboren werden und sterben kön­nen. Die junge Wissenschaft der Geotektonik ist mittlerweile allgemein anerkannt. Ihr wohl bedeutendster Vertreter ist der Meteorologe Professor Alfred Wegener (1880-1930), der seine bahnbrechende Land­verschiebungstheorie in dem Buch Die Entstehung der Kontinente (1915) dargelegt hat. Er ging von dem augenscheinlichen Zusammen­passen der Landkonturen auf beiden Seiten des südlichen Atlantischen Ozeans aus. Vorher hatte man als Antwort darauf das Verschwinden versunkener Erdteile oder Landbrücken vermutet: Die Kontinente sei­en seit unvordenklichen Zeiten an ihrem Platz gewesen, aber ein mittle­rer Teil sei im Meer versunken, so daß eine Trennung erfolgt sei. Wegener verglich das Vorkommen von Pflanzen und Tieren auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans und erkannte, daß seine Verschiebungs­theorie manchen pflanzen- und tiergeographischen Erscheinungen ent­sprach. Zwischen den beiden Kontinenten mußte es eine Landmasse gegeben haben, einen Superkontinent, den er Pangäa nannte, und der hineinpaßte wie die Teile eines Puzzles. Pangäa hatte fast die Hälfte des Globus eingenommen und war vom ursprünglichen Stillen Ozean umge­ben gewesen. Pangäa schwamm mitten im Wasser wie Treibeis und war als einzige Landmasse Verletzungen und Heilungen unterworfen, bis zum endgültigen Zusammenbruch im Mesozoikum, dem mittleren Zeit­alter der Erdgeschichte, das die Kreide-, Jura und Triasformationen umfaßte, vor 225 bis 65 Millionen Jahren. Allmählich trieben die Teile auseinander. Antarktis, Australien, Indien und Afrika brachen ab (Abb. 37a). Afrika und Südamerika trennten sich (Abb. 37b), während Nordamerika von Europa und Indien abrückte und Indien Asien zuge­ schoben wurde (Abb. 37c). So trieben die Kontinente weiter, bis sie das Erscheinungsbild boten, das wir heute kennen (Abb. 37d). Während Pangäa sich in mehrere Teile spaltete, die dahintrieben, öffne­ten und schlossen sich zwischen ihnen Wassermassen. Mit der Zeit verteilte sich der PanOzean – wenn ich mir diesen Ausdruck erlauben darf – ebenfalls auf einige zusammenhängende und auf abgeschlosse­ne Meere (wie zum Beispiel Mittelmeer, Schwarzes Meer, Kaspisches Meer), und die großen Ozeane wie der Atlantische 65 Abb. 37a bis d und der Indische Ozean nahmen ihre Form an. Aber alle diese Wassermassen waren Teile des ursprünglichen Pan-Ozeans, von dem der Stille Ozean übrig­ geblieben ist. Wegeners Anschauung von den Kontinenten als Stücke einer zerbro­chenen Scholle, die auf einer unstabilen Erdoberfläche verschoben wurden, nahmen die damaligen Geologen und Paläontologen größten­teils mit Geringschätzung oder gar spöttischem Gelächter auf. Es dau­erte ein halbes Jahrhundert, bis die Landverschiebungstheorie in die Hallen der Wissenschaft Einlaß fand. In den 1960er Jahren wurden Untersuchungen des Meeresbodens vorgenommen, die zu einer ande­ren Einstellung führten. Man fand Gebilde wie den Mittelatlantischen Rücken, der sich, wie man annahm, durch aufgestiegenes Magma (Gesteinsschmelzfluß aus dem Erdinnern) gebildet hatte. Das Magma war durch den Riß, der fast die ganze Länge des Ozeans durchzieht, aufgestiegen, hatte sich abgekühlt und war zu einer unterseeischen Basaltgebirgskette erstarrt. Als eine Aufwallung der anderen Gebirge folgte, verlängerte sich das erste Gebirge immer mehr. Einen großen Fortschritt im Studium des Meeresbodens erlangte man mit Hilfe von Seasat, einem ozeanographischen Satelliten, der im Juni 1978 abge­schossen wurde und die Erde drei Monate lang umkreiste. Seine Daten ergaben eine ganz neue Meeresbodenkarte mit Bergrücken, Schluch­ten, Hügeln, Vulkanen und Splitterzonen. Der Entdeckung, daß das abgekühlte und verfestigte Magma die magnetische Position beibehal­ten hatte, folgte die Erkenntnis, daß eine ganze Serie von solchen parallel verlaufenden Linien sowohl eine Zeitbestimmung als auch eine Voraussage der weiteren Ausdehnung des Meeresbodens zuließ. Gera­de durch diese Ausdehnung des Atlantischen Meeresbodens waren Afrika und Südameri66 Abb. 38 ka voneinander getrennt worden, so daß der At­lantische Ozean entstanden war. Noch andere Kräfte, wie die Anziehungskraft des Mondes, die Rotation der Erde um ihre eigene Achse und sogar die Bewegungen des tieferliegenden Mantels, hatten dazu geführt, daß die Landkruste aufge­sprungen war und die Kontinente verschob. Diese Kräfte wirkten sich natürlich auch im Gebiet des Stillen Ozeans aus. Er enthüllte ebenfalls unterseeische Bergrücken, Risse, Vulkane und andere Bergzüge, die zur Ausdehnung des Atlantischen Ozeans beigetragen haben. Doch weshalb sind die Landmassen zu beiden Seiten des Stillen Ozeans nicht auseinandergetrieben, sondern einander näher gebracht warden, so daß sich der Stille Ozean langsam verkleinert hat? Die Erklärung hat man in Wegeners Landverschiebungstheorie gefun­ den. Demnach liegen die Kontinente auf riesigen Platten der Erdkruste, die Meere ebenfalls. Die Ursache des Dahintreibens der Kontinente, der Ausdehnung eines Meeres (Atlantischer Ozean) und der Verkleine­rung (Stiller Ozean) ist die Bewegung der Platten, auf denen sie liegen. Das ist die sogenannte Plattentektonik. Heute kennen die Wissen­schaftler sechs große Platten, von denen einige unterteilt werden: die des Stillen Ozeans, die Amerikanische, die Eurasische, die Afrikani­sche, die Indoaustralische und die Antarktische Platte (Abb. 38). Durch die Ausdehnung des Meeresbodens des Atlantischen Ozeans wird die Entfernung zwischen Nord- und Südamerika und Europa sowie Afrika Zentimeter um Zentimeter immer größer. Man weiß jetzt, daß der Stille Ozean zusammenschrumpft, weil seine Platte von der Amerikanischen überlagert wird; sie gerät darunter. Das ist die primäre Ursache der Krustenverschiebung und der Erdbeben am Stillen Ozean entlang und des ständigen Wachsens der dortigen Bergmassive. Durch den Zusammenstoß zwischen der Indischen Platte mit der Eurasischen sind der Himalaja sowie die Vereinigung von Indien und Asien entstan­den. 1985 entdeckten Geologen von der Cornell-Universität die »Naht«, wo ein Teil der westlichen Afrikanischen Platte an der Amerikanischen hängenblieb, als die beiden vor etwa fünfzig Millionen Jahren ausein­anderbrachen und Nordamerika Florida und Südgeorgia »geschenkt« bekam. Mit einigen Modifikationen lassen die heutigen Wissenschaftler Wegeners Landverschiebungstheorie gelten, nach der die Erde ursprüng­lich aus einer ein67 zigen, von einem allumfassenden Ozean umgebenen Landmasse bestand. Trotz des jungen Alters (200 Millionen Jahre) des gegenwärtigen Meeresbodens geben sie zu, daß die Erde einen Urozean gehabt hat, dessen Spuren nicht in der Tiefe der Meere zu finden sind, sondern auf den Kontinenten. Die archaischen Schildzonen, deren jüngstes Gestein 2,8 Milliarden Jahre alt ist, enthalten zwei Gürtel: einen aus grünem Diarit und einen aus Granitgneis. In seiner Abhand­lung Das älteste Gestein und die Entstehung der Kontinente (erschie­nen März 1977 in Scientific American) schrieb Stephen Moorbath, daß der Grünsteingürtel nach Ansicht der Geologen ursprünglich eine Ab­lagerung in einem Ozean war und daß die Granitgneisgebiete Überreste alter Meere sind. Auf der gesamten Welt wurde ermittelt, daß das untersuchte Gestein vor drei Milliarden Jahren von Wasser bedeckt war. An einigen Orten, so in Zimbabwe in Südafrika, sind seitdem dreieinhalb Milliarden Jahre vergangen, in archaischen Gürteln 3,8 Mil­liarden Jahre (Die dynamische Erde in Scientific American, September 1983). Wie lange hat die Landverschiebung gedauert? Gab es »Pangäa«? Stephen Moorbath gelangt in seiner oben erwähnten Abhandlung zu dem Schluß, daß der Prozeß der Landverschiebung vor ungefähr sechs­ hundert Millionen Jahren begonnen hat: »Davor gab es vielleicht nur den ungeheuren Superkontinent, der Pangäa genannt wird; möglicher­weise gab es zwei Superkontinente: Laurasien im Norden und Gond­wanaland im Süden.« Andere meinen aufgrund von Computersimu­lationen, daß die Landmassen, die schließlich Pangäa oder ihre beiden verbundenen Teile bildeten, vor fünfhundert Millionen Jahren genauso getrennt waren wie heute und daß plattentektonische Prozesse irgendwelcher Art bereits seit mindestens vier Milliarden Jahren vor sich gehen. Aber ob die Landmasse zuerst aus einem einzigen Superkontinent oder aus Teilen, die sich dann zusammenfügten, bestand, ob ein Super­ozean zuerst eine einzige Landmasse umgab oder ob sich zuerst Wasser zwischen den Landteilen ausbreitete, das sei, wie Moorbath sagt, wie die Streitfrage um Huhn oder Ei: »Wer war zuerst da, die Kontinente oder die Meere?« Die moderne Wissenschaft bestätigt zwar das, was die alten sumeri­schen Texte besagen, kann aber nicht weit genug zurückblicken, um die Land-Meer-Abfolge zu enträtseln. Wenn bereits jede Entdeckung die­sen oder jenen Aspekt des uralten Wissens erhärtet, warum sollte man dann nicht auch die alte Erklärung gelten lassen, daß Wasser das Antlitz der Erde bedeckte und daß am dritten »Tag« oder in der dritten Phase das Wasser sich auf der einen Seite der Erde »sammelte« und trockenes Land freigelegt wurde. Bestand nun das trockene Land aus vereinzelten Kontinenten oder aus einem einzigen Superkontinent, dem Pangäa? Obwohl diese Frage wirklich keine Rolle spielt, was die Übereinstim­mung mit dem uralten Wissen anbelangt, ist es bemerkenswert, daß die alten Griechen die Erde für eine feste, von Wasser umgebene Scheibe hielten. Diese Vorstellung mußte wie so vieles, was die Griechen zu wissen glaubten, auf früherem exakterem Wissen beruhen. Das Alte Testament nimmt häufig Bezug auf das Fundament der Erde, und im 24. Psalm, der den Schöpfer preist, finden wir dieses frühere Wissen: 68 »Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was darauf ist, die Welt und alles, was darin ist. Denn er hat sie auf den Meeren gegründet und auf den Wassern errichtet.« Neben dem Wort Eretz, das sowohl Erde als auch Erdboden bedeutet, kommt in der biblischen Schöpfungsgeschichte auch der Ausdruck Jabascha vor – das heißt wörtlich »die ausgetrockneten Landmassen« –, und zwar an der Stelle: »Das Wasser sammelte sich an einem Ort, um Jabascha erscheinen zu lassen.« Im Alten Testament kommt auch das Wort Tebel vor; es wird häufig benutzt, um den bewohnbaren Teil der Erde zu bezeichnen, der anbaufähig und für die Menschheit nütz­lich ist (auch wenn der Boden Erze enthält). Gewöhnlich wird Tebel mit Erde oder Welt übersetzt, aber der Begriff unterscheidet sich deut­lich von dem Teil der Erde, wo Wasser vorhanden ist, und die »Fun­damente« vom Tebel bilden einen Gegensatz zu Meeresbecken. Das kommt deutlich in Davids Dank- und Siegeslied (2. Samuel und 18. Psalm) zum Ausdruck: »Der Herr donnerte vom Himmel her, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Er schoß seine Pfeile ab, sie flogen schnell und weit. Er schleuderte Blitze und erschreckte sie. Da wurde sichtbar das Meeresbett, das Tebelfundament lag bloß.« Aufgrund unseres Wissens über die »Fundamente der Erde« ist es für uns ersichtlich, daß mit Tebel die Kontinente gemeint sind, deren Fundament – tektonische Platten – mitten im Wasser liegt. Wie aufregend, die neuesten geophysikalischen Theorien in einem dreitau­send Jahre alten Psalm zu lesen! In der Genesis steht klar und deutlich, daß das Wasser sich auf der einen Seite der Erde »sammelte«, so daß das trockene Land auftauchen konnte. Dies setzt voraus, daß eine Höhlung vorhanden war, in der das Wasser sich sammelte. Eine solche Höhlung, die über die Hälfte der Erdoberfläche einnimmt, ist immer noch da, wenn auch geschrumpft und verkleinert, in Gestalt des Stillen Ozeans. Warum ist die Erdkruste, die, nach dem Gestein zu urteilen, etwa vier Milliarden Jahre alt ist, jünger als die viereinhalb Milliarden Jahre alte Erde und das Sonnensy­stem? Auf der ersten Konferenz über den Ursprung des Lebens, die 1967 von der NASA und der Smithsonian Institution in Princeton (New Jersey) einberufen wurde, hat man über diese Frage diskutiert. Die einzige Hypothese, zu der man gelangen konnte, lautet: Zu der Zeit, aus der das älteste gefundene Gestein stammt, war die Erde einer verhee­renden Umwälzung unterworfen. In bezug auf den Ursprung der Erdatmosphäre war man sich einig, daß sie nicht durch fortwährend freigesetztes Gas infolge vulkanischer Tätigkeit entstanden sein konn­te, sondern eher plötzlich durch einen gewaltigen Ausstoß, der zur selben Zeit erfolgte wie die am Gestein ablesbare Katastrophe. 69 So läßt sich vieles erklären: Das Zerbrechen der Kruste, der Prozeß der Plattentektonik, der Unterschied zwischen Land- und Meereskruste, das Auftauchen einer unterseeischen Pangäa, der umgebende Urozean – und wieder einmal stimmt die moderne Wissenschaft mit dem alten Wissen überein. Und so sind die Gelehrten aller Disziplinen zu dem Schluß gelangt, daß man sich die Entstehung von Landmassen, Ozeanen und Atmosphäre nur erklären kann, wenn man annimmt, daß vor etwa vier Milliarden Jahren eine gewaltige Umwälzung stattgefunden hat, etwa eine halbe Milliarde Jahre nach der Bildung der Erde als Teil des Sonnensystems. Was war diese erdgeschichtliche Katastrophe? Vor sechstausend Jahren haben die Sumerer es bereits gewußt: Die Himmelsschlacht zwischen Nibiru/Marduk und Tiamat. Die sumerische Kosmogonie stellt die Glieder des Sonnensystems als Götter und Göttinnen dar, deren Erschaffung einer Geburt gleicht und deren Dasein dem lebendiger Geschöpfe entspricht. Im Enuma-elisch-Text wird Tiamat im besonderen als Frau beschrieben, als eine Mutter, die elf Satelliten geboren hat, ihre »Heerschar«, angeführt von Kingu, den »sie erhoben hat«. Als Nibiru/Marduk sich ihr näherte, »schrie sie wütend, ihre Beine zitterten bis in die Wurzeln, ihren Angreifer verfluchte sie«. Als »der Herr sein Netz ausspannte, sie zu umgarnen, und den bösen Wind, der ihm folgte, auf ihr Gesicht losließ, öffnete sie den Mund, um ihn zu verschlingen«. Dann aber griffen noch mehr Winde ihren Bauch an und ließen ihn anschwellen. »Geh und schneide Tiamat das Leben ab«, lautete der Befehl, den die Außenplaneten dem Ein­dringling gaben, und er tat es, indem er »sie durchschnitt und ihr Herz zersplitterte«. Lange Zeit wurde die Anschauung, daß die Planeten und besonders Tiamat Lebewesen seien, die geboren werden und sterben konnten, als primitives Heidentum abgetan. Aber die jüngste Erforschung des Pla­netensystems hat Welten enthüllt, für die das Wort »lebendig« durchaus angemessen ist. Daß die Erde etwas Lebendiges ist, hat James E. Lovelock in seinen Büchern Gäa. Eine neue Anschauung des Lebens auf der Erde und Eine Biographie unserer lebenden Erde nachdrücklich betont. Nach der sogenannten Gäa-Hypothese haben sich die Erde und das Leben aus einem einzigen Organismus entwickelt; die Erde sei nicht nur ein lebloser Körper, auf dem es kein Leben gibt, sondern ein kohärenter, wenn auch komplexer Körper, der durch seine Masse und seine Landoberfläche, seine Meere und seine Atmosphäre, durch Fauna und Flora, die sie alle erhält, und die alle sie erhalten, an sich lebendig ist. »Von allen Geschöpfen auf Erden ist die Erde selbst das größte«, schreibt Lovelock. Insofern entspreche sie dem alten Begriff Mutter Erde und auch dem der Griechen, die Gäa als Urmutter ansahen. All dies aber reicht in sumerische Zeiten zurück, zu dem alten Wissen um den Planeten, der gespalten wurde. 70 6 Zeuge der Genesis Die Wissenschaftler haben, vielleicht als Überreaktion auf den Kreationismus, die biblische Schöpfungsgeschichte als einen Gegen­stand des Glaubens betrachtet, nicht als Tatsachenbericht. Doch als die Apollo-Astronauten Mondgestein zurückbrachten, das sich als fast vier Milliarden Jahre alt erwies, nannte man es Genesisgestein. Auch das Stückchen grünes Glas, das man in den Bodenproben fand, und das wie eine Limabohne geformt war, taufte man Genesisbohne. Es scheint also, daß selbst die Wissenschaftler allen Einwänden und Vorbehalten zum Trotz dem jahrhundertealten Glauben nicht ausweichen können, aber vielleicht beruht dies auf einer genetischen Erinnerung der Spezi­es Mensch, daß die Erzählung im Buch Genesis auf Wahrheit beruht. Wie auch immer der Mond zu einem ständigen Gefährten der Erde geworden sein mag (die verschiedenen Theorien werden noch erörtert werden), gehört er wie die Erde unserem Sonnensystem an, und beide hängen mit seiner Entstehung zusammen. Auf der Erde haben sowohl die durch Naturkräfte verursachte Erosion als auch das Leben, das auf ihr entstanden ist, viele Hinweise auf ihre eigene Entstehung ausge­löscht, ebenso das verheerende Ereignis, das den ursprünglichen Plane­ten verändert und umgestaltet hat. Aber der Mond, so nahm man an, habe seine ursprüngliche Gestalt beibehalten. Da er weder Wind noch Atmosphäre oder Wasser hat, blieb er von Erosion verschont. Er wurde ebenso oberflächlich erforscht wie die Genesis. Man hat den Mond jahrtausendelang in Augenschein genommen, zu­erst buchstäblich, dann mit erdgebundenen Instrumenten. Das Raum­fahrtzeitalter machte es möglich, ihn aus der Nähe zu begutachten. Er wurde zwischen 1959 und 1969 von zahlreichen sowjetischen und amerikanischen unbemannten Raumfahrzeugen, die ihn umkreisten, fotografiert. Am 20. Juli 1969 setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond, nachdem die Raumfähre gelandet war. Der amerikanische Astronaut Neil Armstrong rief, daß alle Welt es hören konnte: »Hou­ston! Hier Meer der Ruhe. Der Adler ist gelandet!« Insgesamt setzten sechs Apollo-Raumschiffe zwölf Astronauten auf dem Mond ab; die letzte Mission war diejenige von Apollo 17 im Dezember 1972. Bei der letzten Landung war der Geologe Harrison Schmitt dabei; das machte sich bezahlt, weil er an Ort und Stelle beim Einsammeln von Gestein, Bodenproben und Staub eine wissenschaftlich nötige Auswahl traf, ebenso bei der Beschreibung topographischer Gebilde – Hügel, Täler, kleine Schluchten, Landstufen und große Felsbrocken –, ohne die das wahre Antlitz des Mondes ungeklärt geblieben wäre (Tafel D). Man ließ Apparate auf dem Mond zurück, die über längere Zeiträume hinweg Messungen vornahmen und die Ergeb­nisse meldeten. Durch Bohrungen wurde tiefliegendes Gestein er­reicht. Aber die wissenschaftlich kostbarste Ausbeute waren die Bo­den- und Gesteinsproben mit einem Gewicht von fast vierhundert Kilogramm, die auf die Erde gebracht wurden. Ihre Untersu71 Tafel D chung dauerte immer noch an, als man 1989 den zwanzigsten Jahrestag der ersten Mondlandung feierte. Die Ansicht, daß auf dem Mond »Genesisgestein« zu finden sei, wurde der NASA von dem Nobelpreisträger Harold Urey übermittelt. Der erste »Genesisstein«, der auf dem Mond aufgelesen wurde, erwies sich im Verlauf des weiteren Apollo-Programms als jüngeres Gestein. Er war »nur« vier Milliarden Jahre alt, wohingegen die weiterhin eingesammelten Steine von drei Milliarden Jahre alten »Jünglingen« bis viereinhalb Milliarden Jahre alten »Greisen« variierten. Sofern in Zukunft nicht noch ältere gefunden werden, fehlen den ältesten auf dem Mond gefundenen Steinen nur hundert Millionen Jahre bis zu dem geschätzten Alter des Sonnensystems, das man vorher aus den auf die Erde gelangten Meteoriten errechnen konnte, nämlich viereinhalb Mil­liarden Jahre. Der Mond ist, wie die Landungen ergeben haben, ein Zeuge der Gene­sis. Infolge der Feststellung des Alters des Mondes – also wann er er­schaffen wurde –, erhob sich in verstärktem Maße die Frage, wie er entstanden ist. »Die Hoffnung, den Ursprung des Mondes ermitteln zu können, stand in den sechziger Jahren bei einem bemannten Apollo-Projekt im Vor­dergrund«, schrieb James Gleick im Juni 1986 in der wissenschaftli­chen Beilage der New York Times. »Aber gerade diese wichtige Frage konnte Apollo nicht beantworten.« Wie ist es möglich, daß die modernen Wissenschaftler nicht imstande waren, diese grundlegende Frage zu beantworten, nachdem sie einem Himmelskörper unseres Sonnensystems so nahe gekommen waren, daß sie ihn gründlich zu un72 tersuchen vermochten? Es scheint daran zu liegen, daß sie an die Auswertung der Befunde mit vielen Vorurteilen herangingen, so daß die Ergebnisse natürlich unzureichend sind. Die früheste wissenschaftliche Theorie über die Entstehung des Mon­des wurde 1879 von Sir George H. Darwin, einem Sohn von Charles Darwin, veröffentlicht. Sein Vater hatte sich mit der Entstehung der Arten befaßt, und seine Abstammungslehre, der Darwinismus, hatte auf Biologie und Geisteswissenschaften umwälzenden Einfluß. Der Sohn entwickelte als erster eine Ursprungstheorie über das Sonne-Erde-Mond-System, die auf mathematischer und geophysikalischer Analyse beruhte. Insbesondere beschäftigte er sich mit dem Studium der Gezeiten; infolgedessen nahm er an, der Mond sei aus Materie gebildet, die die Solargezeiten der Erde entzogen haben. Das Becken des Stillen Ozeans hielt er für die mögliche Narbe des »gestohlenen« Stückes der Erde. Im 20. Jahrhundert wurde diese Annahme aufgrund anderer Feststellungen als unhaltbar abgelehnt. Zu dieser Zeit tauchte die sogenannte Fissionstheorie auf, die eine ganz andere Idee vertrat: Die Erde habe sich, während sie sich bildete, so schnell um ihre eigene Achse gedreht, daß zwei Körper entstanden seien. Ein Teil der Materie sei weggeschleudert worden, habe sich in der Ferne zusammengeballt und schließlich die Umlaufbahn um ihren größeren Zwillingsbruder als ewiger Satellit eingeschlagen (Abb. 39). Die Gelehrten stritten sich wieder einmal. Bei der dritten Konferenz über den Ursprung des Lebens (in Pacific Palisades, Kalifornien, 1970) wurde vorgebracht, Gezeitenkräfte als Ursache der Fission könnten nicht ausreichen für eine Entfernung, die über das Fünffache des Erdradius hinausgeht, während der Mond um das Sechzigfache von der Erde entfernt ist. Die Gegner der Fissionstheorie stützten sich auf eine Studie von Kurt S. Hansen, die schlüssig bewies, daß der Mond der Erde niemals näher als etwa zweihunderttausend Kilometer gewesen sein könnte. Damit sei jegliche Theorie, daß der Mond ein Teil der Erde gewesen sei, für nichtig zu erklären. (Der Mond hat heute einen mittle­ren Abstand von 384 400 km von der Erde.) Die Befürworter der Fissionstheorie brachten etliche Varianten vor, um die Entfernungsfrage abzutun, zu der noch die sogenannte Roche-Grenze gehört (der Abstand, in dem die Gezeitenkräfte die Störungen durch die Schwerkraft überwinden). Aber alle Varianten wurden aufgrund des Energieerhaltungsgesetzes abgelehnt. Die Theorie erfordere einen viel Abb. 39 73 stärkeren Drall als die Energie, die in der Rotation von Erde und Mond um die eigene Achse und im Lauf um die Sonne besteht. John A. Wood vom HarvardSmithsonian Center für Astrophysik faßt in seiner Abhandlung über die Entstehung des Mondes (A Review of Hypotheses of Formation of Earth’s Moon) in Origin of the Moon, 1986, dieses Problem folgendermaßen zusammen: »Die Fissionstheorie wirft schwerwiegende Fragen der Dynamik auf: Für eine Fission müßte die Erde einen ungefähr viermal stärkeren Drall haben. Es gibt keine einzige einleuchtende Erklärung für die Frage, warum die Erde ein solches Übermaß an Drehmoment gehabt haben sollte. Und wo wäre dann nach der Fission der Überschuß an Energie geblieben?« Die Ergebnisse der Mondforschung durch das Apollo-Programm haben dazu beigetragen, daß auch die Geologen und Chemiker die Fissions­theorie als unhaltbar ablehnen. Die Zusammensetzung des Mondes ist derjenigen der Erde in vieler Hinsicht ähnlich, nur in ausschlaggeben­den Punkten eben nicht. Die »Verwandtschaft« genügt, daß man sie als nahe Verwandte bezeichnen kann, doch die Unterschiede beweisen, daß sie keine Zwillinge sind. Das gilt besonders für die Kruste und den Mantel der Erde, aus denen sich der Mond nach der Fissionstheorie gebildet haben müßte. Zum Beispiel hat der Mond einerseits zu wenig siderophile Elemente wie Wolfram, Phosphor, Kobalt, Molybdän, Nickel und andere im Vergleich zum Vorkommen in der Kruste und Mantel der Erde, andererseits jedoch zu wenig schwer schmelzbare Elemente wie Aluminium, Kalzium, Titan und Uran. Das haben die Befunde ergeben, und dazu sagt Stuart R. Taylor in seinem Aufsatz über den Ursprung des Mondes im American Scientist (September/ Oktober 1973): »Aus all diesen Gründen ist es schwer, die Zusammensetzung des Mondes mit der des Erdmantels zu vergleichen.« Der Sammelband, der bei der Konferenz über den Ursprung des Mon­des in Kona (Hawaii im Oktober 1984) von sechzig Wissenschaftlern vorgelegt wurde, enthielt mehrere Artikel, in denen sich Vertreter ver­schiedener Disziplinen einstimmig gegen die Fissionstheorie ausspra­chen. Im Gegensatz zur zwanzig Jahre früher abgehaltenen Konferenz, bei der die Ziele der unbemannten und bemannten Mondflüge bespro­chen worden waren, lagen jetzt die Ergebnisse der Untersuchungen vor. Die Vergleiche zwischen der Zusammensetzung des Erdmantels und der des Mondes führten dazu, daß die Fissionstheorie endgültig abge­lehnt wurde. An den Gesetzen des Drehmoments und an den Vergleichen zwischen der Zusammensetzung der Erde und der des Mondes (nach den Mond­landungen) scheiterte auch die zweitliebste Theorie, die des »Einfan­gens«. Ihr zufolge hat sich der Mond nicht in der Nähe der Erde gebildet, sondern unter oder hinter den Außenplaneten. Irgendwie wur­de er in eine weite elliptische Bahn um die Sonne geschleudert. Dabei näherte er sich der Erde, die ihn mit ihrer Anziehungskraft einfing, und so wurde er ihr Satellit. Diese Theorie erforderte, wie durch zahlreichen Computerstudien be­legt wurde, daß der Mond sich der Erde äußerst langsam näherte. Das heutige Verfahren, Satelliten so abzuschießen, daß sie eingefangen werden und auf einer Umlauf74 bahn bleiben, etwa um Venus und Mars, berücksichtigt nicht die relative Größe von Erde und Mond. Im Verhält­nis zur Erde ist der Mond (dessen Masse ein Achtel derjenigen der Erde beträgt) viel zu groß, um sich auf einer weiten elliptischen Bahn von ihr anziehen zu lassen, es sei denn, er bewegt sich sehr, sehr langsam. Dann aber würde er nicht eingefangen werden, sondern es käme zu einem Zusammenstoß, wie alle Berechnungen beweisen. Diese Theorie wurde zusätzlich wegen des Vergleichs der Zusammensetzung beider Himmelskörper verworfen: Der Mond war der Erde zu ähnlich und unterschied sich von den Außenplaneten so sehr, daß er unmöglich so weit draußen hätte entstanden sein können. Der Mond hätte nur unversehrt bleiben können, wenn er sich der Erde nicht von weit draußen genähert hätte, sondern im selben Himmelsteil wie sie entstanden wäre. Zu diesem Schluß gelangte sogar S. Fred Singer von der Universität George Mason, ursprünglich ein Verfechter der Einfangtheorie, der in einem Vortrag sagte: »Die Abweichung von einer exzentrischen heliozentrischen Bahn durch Einfangen ist weder durchführbar noch notwendig ... Die Zusammensetzung des Mondes läßt sich nur damit erklären, daß er sich auf einer erdnahen Bahn gebildet hat.« Der Mond wurde »eingefangen«, während er sich in der Nähe der Erde bildete. Die Eingeständnisse ehemaliger Befürworter der Fissions- und der Einfangtheorie führten zur Unterstützung der dritten Haupttheorie: der gemeinsamen Entstehung. Diese Theorie entspringt der Hypothese des französischen Astronomen und Mathematikers Pierre Simon Laplace (1749-1827), nach der das Sonnensystem aus einem Urnebel entstan­den ist. Die heutigen Wissenschaftler haben seine Nebulartheorie er­neut aufgegriffen. Laplace bewies, daß die Beschleunigung des Mondes von Exzentrizitäten in der Bahn der Erde abhängt, und schloß daraus, daß beide Himmelskörper sich nebeneinander gebildet haben, zuerst die Erde, dann der Mond. Erde und Mond seien Geschwister, Partner in einem Zweiplanetensystem, das die Sonne umkreist, wobei der eine den anderen »umtanzt«. Da allgemein angenommen wird, daß Satelliten sich aus den Überre­sten derselben Urmaterie gebildet haben wie die Planeten, die sie umkreisen, sollte man diesen Grundsatz auch auf Erde und Mond anwenden. Wie die Pioneer- und Voyager-Sonden analysiert haben, sind die Monde der Außenplaneten zur Genüge miteinander verwandt. Gleichzeitig haben sie wie Kinder im Vergleich mit den Eltern indivi­duelle Eigenschaften. Das erklärt die grundsätzliche Ähnlichkeit zwi­schen Erde und Mond und die ebenfalls bestehende Verschiedenheit, so daß sie dem oben erwähnten Grundsatz Genüge tun, das heißt, sie sind gemeinsam entstanden. Trotzdem lehnen die Wissenschaftler diese Theorie ab, weil der Mond dafür einfach zu groß ist: Nicht nur beträgt seine Masse ein Achtzigstel, sondern sein Durchmesser ist ein Viertel im Verhältnis zur Erde. Das stimmt mit allen Proportionen, die man sonstwo im Sonnensystem gefunden hat, nicht überein. Wenn man die Masse aller Monde eines Planeten als Quotienten für die Masse der Planeten zugrunde legt, erhält man folgendes Ergebnis: 75 Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun 0,0 (keine Monde) 0,0 (keine Monde) 0,012 2 0,000 000 02 (2 Asteroiden) 0,000 21 0,000 25 0,000 17 0,001 30 Vergleicht man das Verhältnis der größten Monde anderer Planeten mit dem des Mondes der Erde, so ist die Abweichung auffällig (Abb. 40). Aus diesem Mißverhältnis ergibt sich, daß im kombinierten Erd-Mond-System ein zu starker Drall vorhanden wäre, so daß auch die Theorie der gemeinsamen Entstehung den Tatsachen nicht standhält. Da alle drei Haupttheorien den erforderlichen Kriterien nicht entspre­chen, mag man sich fragen, wie es nun mit der Erde und ihrem Satelliten weiterging. Einige Leute wiesen darauf hin, daß keiner der anderen Abb. 40 Innenplaneten einen Satelliten hat, denn die beiden kleinen Himmelskörper, die den Mars umkreisen, sind nach einstimmiger Mei­nung eingefangene Asteroiden. Aber wenn das Sonnensystem so beschaf­fen ist, daß sich bei keinem der Innenplaneten ein Satellit gebildet hat – weder durch Fission noch durch Einfangen oder gemeinsame Ent­stehung –, sollte dann die Erde in dieser mondlosen Zone nicht auch ohne Mond sein? Tatsache ist, daß die Erde dort, wo sie sich befindet, einen Mond hat, noch dazu einen verhältnismäßig großen. Muß man das nicht in Betracht ziehen? Eine weitere Entdeckung des Apollo-Programms trägt dazu bei, die Theorie der gemeinsamen Entstehung abzulehnen. Sowohl die Ober­fläche des Mondes als auch sein Mineraliengehalt legen den Gedanken an ein »Magmameer« nahe, das infolge teilweiser Schmelzung des Inneren entstanden ist. Demgemäß müßte dort große Hitze geherrscht haben. Eine solche Hitze kann nur durch ein umwälzendes oder kata­strophales Ereignis entstanden sein, was bei gemeinsamer Bildung undenkbar ist. Wie ließe sich die Hitze, die das Magmameer zur Folge gehabt hat, sonst erklären? Diese Überlegung führte zu einer weiteren Hypothese, zur sogenannten Aufpralltheorie, die auch den Drall berücksichtigt. Sie wurde 1975 von William Hartmann, einem Geochemiker am Planetary Science Insti­tute in Tucson, und seinem Kollegen Donald R. Davis veröffentlicht, die erklärten, daß ein Zusammenstoß oder ein Aufprall bei der Entste­hung des Mondes eine Rolle gespielt 76 habe (Satellite-sized Planetesi­mals and Lunar Origin in Icarus, Bd. 24). Nach ihren Berechnungen ist die Geschwindigkeit, mit der die Planeten im späteren Stadium ihrer Bildung von kleinen und großen Asteroiden bombardiert worden sind, viel größer gewesen als heute, so daß beim Aufprall ein Stück des getroffenen Planeten hätte absplittern können; das sei bei der Erde der Fall gewesen, und das Abb. 41 abgeschlagene Stück sei der Mond. Dieser Gedanke wurde von zwei Astrophysikern aufgenommen: Alastair G. W.. Cameron von der Universität Harvard und William R. Ward vom Caltech-Laboratorium. In ihrer Studie über den Ursprung des Monde (Lunar Science, Bd. 7, 1976) schilderten sie einen Himmelskörper von der Größe eines Planeten – mindestens so groß wie der Mars –, der mit einer Geschwindigkeit von 40 000 km/h auf die Erde zugerast sei. Er kam aus dem Bereich jenseits des Sonnensystems, seine Bahn beschrieb einen Bogen um die Sonne, aber die Erde, deren Umlauf noch nicht festgelegt war, war ihm im Wege (Abb. 41). Durch den Aufprall kippte sie ein wenig um und geriet in ihre ekliptische Schiefe, (gegenwärtig ungefähr 23,5 Grad). Die Außenschicht beider Himmelskörper schmolz, so daß die Erde von einer Wolke aus zerstäubtem und verdampftem Gestein umhüllt wurde. Mehr als doppelt soviel Materie, wie für die Bildung des Mondes erforderlich gewesen wäre, wurde emporgeschleudert, so daß sich die Trümmer unter dem Druck des Dampfes von der Erde entfernten. Einige fielen auf sie zurück, aber in der Ferne blieb noch genug übrig, daß sie verschmelzen und den Mond bilden konnten. Die Aufpralltheorie wurde weiterentwickelt, da verschiedene Einwän­de vorgebracht wurden. Sie wurde auch modifiziert, als andere Wissen­schaftler sie mit Computersimulation prüften. (Die führenden Gruppen waren die von A. C. Thompson und D. Stevenson bei Caltech, H. J. Melosh und M. Kipp von den Sandia-Laboratorien sowie W. Benz und W. L. Slattery vom Laboratorium in Los Alamos.) Abbildung 42 zeigt eine simulierte Sequenz, die achtzehn Minuten dauerte. Bei dem Aufprall entstand ungeheure Hitze – siebentausend Grad Celsius –, so daß beide Körper schmolzen. Der aufprallende Körper sank in die Mitte der geschmolzenen »Erde«; bei beiden ver­dampften einige Teile und wurden hinausgeschleudert. Nach der Ab­kühlung bildete die Erde sich erneut mit dem eisenreichen Klumpen des aufgeprallten Körpers im Innern. Ein Teil der hinausgeschleuderten Materie fiel auf die Erde zurück; der Rest, der größtenteils von dem aufgeprallten Körper stammte, kühlte in einem Abstand ab und schmolz zusammen. Das wurde der Mond, der die Erde umkreist. Gegen die Aufpralltheorie wurde vor allem eingewendet, daß der auf­prallende Himmelskörper, um der chemischen Zusammensetzung Ge­nüge zu tun, aus derselben Himmelszone hätte kommen müssen wie die Erde, nicht aus einem Gebiet außerhalb des Sonnensystems. Aber woher hätte er dann das ungeheure Moment 77 (Bewegungsgröße) gehabt, das beim Aufprall Verdampfung bewirkte? Es besteht darüber hinaus auch die Frage der Glaubwürdigkeit, wie Alastair G. W. Cameron bei der Konferenz in Hawaii selbst einräumte. »Ist es glaubhaft«, fragte er, »daß ein außerplanetarischer Himmelskör­per mit ungefähr gleicher Masse wie der Mars durchs Sonnensystem gerade zur richtigen Zeit wandert, um an unserem vermeintlichen Zusammenstoß teilzunehmen?« Seiner Meinung nach herrschte etwa hundert Millionen Jahre nach der Bildung der Planeten im Abb. 42 (Quelle: Sandia National Laboratories) neugebore­nen Sonnensystem noch genügend Instabilität, und es gab noch so viele »protoplanetarische Überreste«, daß das Vorhandensein des aufprallen­den Körpers und der Zusammenstoß durchaus glaubhaft seien. Die weiteren Berechnungen bewiesen, daß der aufprallende Himmels­körper dreimal größer hätte sein müssen, um eine derartige Wirkung zu erzielen. Das größte Problem sah man in der Frage, wo und wie er sich in der Nähe der Erde hätte bilden können. Der Astronom George Wetherill vom Carnegie-Institut rechnete auf seinem Computer rück­wärts und gelangte zu dem Schluß, daß sich die Innenplaneten aus einem umherschweifenden Band von fünfhundert kleinen Weltraum­körpern hätten entwickeln können. Sie prallten häufig aufeinander, die kleinen Monde agierten als Bausteine der Planeten und waren auch die Körper, die sie weiterhin bombardierten. Die Berechnungen unterstütz­ten die Glaubwürdigkeit der modifizierten Aufpralltheorie, erklärten aber nicht die ungeheure Hitze. »Bei einer derartigen Hitze wären beide Körper geschmolzen«, sagte Wetherill abschließend. Die Hitze­entwicklung aber erklärt, wie die Erde zu ihrem Eisenkern gekommen ist und der Mond zu seinem Magmameer. Obwohl diese letzte Version noch manche Fragen unbeantwortet ließ, waren viele Teilnehmer an der Konferenz in Hawaii bereit, die Auf­pralltheorie gelten zu lassen, weniger, weil sie von der Richtigkeit überzeugt waren, als aus Verzweiflung. »Das geschah hauptsächlich deshalb«, schrieb Wood in seinem Protokoll, »weil mehrere Forscher unabhängig voneinander bewiesen haben, daß die gemeinsame Ent­stehung, auf die man sich fast geeinigt hätte, das Drehmoment nicht berücksichtigte.« Im Grunde zweifelten etliche Teilnehmer, unter ih­nen 78 auch Wood selbst, an der neuen Theorie. Wood bemerkte dazu: »Eisen ist verdampfbar und hätte eigentlich dasselbe Schicksal erleiden müssen wie die anderen verdampfbaren Stoffe, etwa wie Natrium und Wasser.« Mit anderen Worten, es wäre nicht ins Innere der Erde gesun­ken, im Gegensatz zu der Theorie. Das viele Wasser auf der Erde, von dem vielen Eisen in ihrem Mantel gar nicht zu reden, könnte unmöglich vorhanden sein, wenn der Planet geschmolzen wäre. Da jede Variante der Aufpralltheorie die totale Schmelzung der Erde voraussetzt, mußte man weitere Beweise finden. Bei der nächsten Konferenz 1988 in Berkely wurde eingestanden, daß man keine gefun­den hatte. Wenn die Erde schmolz und sich wieder verfestigte, hätten sich etliche Elemente auf unterschiedliche Weise und in verschiedenem Verhältnis kristallisiert, aber dieser Beweis fehlte. Außerdem hätte sich das Chondrit verbogen (das uranfängliche Mineral auf Erden, das in den meisten Meteoriten ebenfalls vorkommt), aber das ist nicht der Fall. Auch dieser Beweis fehlt. A. E. Ringwood von der australischen Staatlichen Universität hat diese Untersuchungen auf mehr als ein Dutzend Elemente ausgedehnt, die sich verändert hätten, wenn die Kruste sich erst nach der Schmelzung der Erde gebildet hätte. Ein weiterer fehlender Beweis. In dem Bericht über die Konferenz (Science, 17. März 1988) steht, daß die Geochemiker die Meinung vertraten, eine Schmelzung der Erde infolge eines Aufpralls sei mit dem geochemi­schen Wissen unvereinbar. »Insbesondere zeigt die Zusammensetzung des Mantels, daß er nie geschmolzen ist ... Die Geochemie scheint für die Aufpralltheorie ein weiterer Stein des Anstoßes zu sein.« Man könnte sogar sagen, sie hat dieser Theorie den Hals gebrochen. Wie bei allen vorherigen Hypothesen ergab es sich zum Schluß, daß die Aufpralltheorie zwar in einigen Punkten zutrifft, in anderen aber voll­ständig versagt. Immerhin schien sie wenigstens das Problem der Mondschmelzung gelöst zu haben. Allerdings doch nicht vollständig. Thermische Untersuchungen erga­ben tatsächlich Hinweise auf eine Schmelzung des Mondes. »Wir haben Grund zu der Annahme, daß der Mond in der Frühzeit seiner Geschichte teilweise oder ganz geschmolzen ist«, behauptete Alan B. Binder von der NASA bei der Konferenz 1984. »Früh, aber nicht uranfänglich«, entgegneten andere Wissenschaftler. Dieser große Unter­schied fußte auf Untersuchungen in bezug auf die Belastungen der Mondkruste (vorgenommen von Sean C. Solomon vom Technischen Institut in Massachusetts) sowie auf dem Isotopen-Verhältnis (wenn Atomkerne desselben Elements verschiedene Masse haben, weil die Anzahl ihrer Neutronen verschieden ist). Die Isotopen-Untersuchun­gen haben D. L. Turcotte und L. H. Kellog von der Universität Cornell durchgeführt. Auf der Konferenz sagten alle drei Forscher, ursprünglich sei der Mond verhältnismäßig kühl gewesen. Was ist nun mit den Beweisen für Schmelzungen auf dem Mond? Zweifellos haben sie stattgefunden: Die großen Krater, deren Durchmesser hundert Kilometer und mehr beträgt, sind für jedermann sichtbare, stumme Zeugen. Da gibt es auch die »Mare«, die, wie man heute weiß, keine Gewässer, sondern dunkle, ebene Flächen sind, entstanden durch hohen Druck. Und es existiert das Mag79 mameer. Im Gestein der Mondoberfläche sind Glas und glasartige Materie eingebettet, und zwar infolge einer Schmelzung durch rasanten Aufprall (im Unter­ schied zu heißer Lava). Bei der dritten Konferenz widmete man einen ganzen Tag dem Thema »Glas auf dem Mond«, so wichtig fand man diesen Hinweis. Eugen Shoemaker von der NASA und von Caltech berichtete, derartige Beweise für »Schockverglasung« und andere ge­schmolzene Stoffe habe man in Hülle und Fülle gefunden; außerdem lasse ihn das Vorkommen von Nickel in der Gegend der Glasfunde vermuten, daß der aufprallende Planet eine andere Zusammensetzung gehabt habe als der Mond, weil Nickel beim Mond fehlt. Wann hat der Schmelzprozeß stattgefunden? Nicht während der Entste­hung des Mondes, sondern – wie die Funde beweisen – etwa fünf­hundert Millionen Jahre später. Da hatte sich, wie es bei der Konferenz 1972 hieß, etwas Wesentliches vollzogen. »Die Umwälzung ereignete sich vor vier Milliarden Jahren, als Himmelskörper, die die Größe einer Großstadt hatten, in den Mond einschlugen und seine Riesenbecken und hohen Berge formten. Die große Menge radioaktiver Stoffe, die zurückblieben, erhitzten das Gestein unter der Oberfläche, brachten es zum Schmelzen und preßten Lavaströme durch die Risse in der Rinde Im Krater Tsiolowsky fand Apollo 15 Felsstürze, die sechsmal größer sind als die auf der Erde. Apollo 16 entdeckte, daß durch den Zusammenstoß, der das Mare Nectaris entstehen ließ, Trümmer eineinhalbtausend Kilometer weit geschleudert wurden. Apollo 17 lan­dete in der Nähe eines steilen Abhangs, der achtmal höher ist als irgendeiner auf der Erde.« Das Alter des ältesten Mondgesteins schätzte man auf 4,25 Milliarden Jahre; Bodenteilchen gaben 4,6 Milliarden Jahre an. Sämtliche Wissen­schaftler, ungefähr zweitausend, die sich mit dem Gestein und dem Boden befaßt haben, datieren die Entstehung des Mondes in die Zeit, in der das Sonnensystem sich bereits gebildet hatte. Dann aber geschah etwas vor rund vier Milliarden Jahren. W. K. Hartmann schrieb im Januar 1977 im Scientific American: »Verschiedene Apollo-Analysen haben ergeben, daß viele Gesteine nur vier Milliarden Jahre alt gewor­den sind, andere jedoch älter.« Die Gesteins- und Bodenproben, die das durch den Aufprall entstandene Glas enthielten, waren 3,9 Milliarden Jahre alt. »Wir wissen, daß älteres Gestein und die Oberfläche in einer umwälzenden Periode durch Bombardement zerstört worden sind«, sagte Gerald J. Wasserburg von Caltech am Vorabend der letzten Apol­lo-Mission. »Es bleibt nur die Frage, was geschah zwischen der Entste­hung des Mondes vor ungefähr viereinhalb Milliarden Jahren und der Katastrophe vor vier Milliarden Jahren.« Der Stein, den der Astronaut David Scott fand und der »Genesisstein« getauft wurde, erhielt seine Form infolge des katastrophalen Ereignis­ses. Es war ein passender Name, denn die biblische Geschichte in der Genesis schildert nicht die Entstehung des Sonnensystems, sondern die Himmelsschlacht zwischen Nibiru/ Marduk und Tiamat vor etwa vier Milliarden Jahren. Einige Wissenschaftler, die sich mit den vorliegenden Theorien über den Ursprung des Mondes nicht zufriedengeben konnten, versuchten die sinnvollsten 80 Abb. 43 Ideen auszuwählen, indem sie die Theorien nach be­stimmten Kriterien einteilten. So stellte Michael J. Drake von der Universität Arizona eine »Wahrheitstabelle« zusammen, auf der die gemeinsame Entstehung Priorität hatte. Im Gegensatz dazu berück­sichtigte John A. Woods Aufstellung alle Kriterien außer dem ErdMond-Drall und der Schmelzung auf dem Mond. Dann einigte man sich wieder auf die Theorie der gemeinsamen Entstehung und über­nahm einige Hypothesen von der Aufprall- und der Fissionstheorie. Auf der Konferenz von 1984 vertraten A. P. Boss vom Carnegie-Institut und S. J. Peale von der kalifornischen Universität die Ansicht, der Mond sei tatsächlich zusammen mit der Erde gleichzeitig aus derselben Urmaterie entstanden, aber der Urnebel, aus dem sie sich gebildet hatten, sei einem Bombardement von kleinen Planeten ausgesetzt ge­wesen, die manchmal den Mond verkleinerten und manchmal seiner Masse fremde Materie hinzufügten (Abb. 43). Infolgedessen habe der immer größer werdende Mond die Kleinmonde, die sich im inneren Kreis bildeten, angezogen und absorbiert – ein Mond, der der Erde vergleichbar und doch in Details verschieden ist. Nach dem Hin und Her von Theorie zu Theorie schreibt die moderne Wissenschaft heute unserem Mond denselben Entstehungsprozeß zu, der den Außenplaneten ihr Multi-Mond-System verliehen hat. Die Hürde, die noch zu überwinden ist, wäre in diesem Fall die Erklärung, warum die kleine Erde statt eines Satellitenschwarmes einen einzigen großen Mond hat. Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir wieder einmal zur sumerischen Kosmogonie zurückkehren. Sie besagt, daß der Mond zu Beginn kein Satellit der Erde war, sondern einer der größeren Tiamat. Jahrtausende bevor Wissenschaftler unserer Zivilisation herausfanden, daß Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun von Mondschwärmen umkreist werden, schrieben die Sumerer dem Planeten Tiamat einen Satelliten­schwarm zu, »im ganzen elf«. Sie plazierten Tiamat, von der Erde aus gesehen, hinter Mars, was Tiamat zu einem Außenplaneten macht, und ihre »Heerschar« erhielt sie auf dieselbe Weise wie die anderen Außen­planeten. Wenn wir die letzten wissenschaftlichen Theorien mit der sumerischen Kosmogonie vergleichen, stellen wir fest, daß die modernen Gelehrten sich nicht nur 81 dem sumerischen Wissen angenähert haben, sondern sogar eine Terminologie verwenden, die den sumerischen Texten ent­spricht. Die sumerische Kosmogonie beschreibt die Szene als ein frühes, unsta­biles Sonnensystem, in dem kleine Planeten und Anziehungskräfte das planetarische Gleichgewicht stören und manchmal unverhältnismäßig große Monde entstehen. Im Buch Der zwölfte Planet habe ich den Zustand folgendermaßen geschildert: »Nach der Geburt der Planeten kommt es im zweiten Akt des Dramas zu einem Himmelsaufruhr. Die neugeschaffene Planetenfamilie ist keineswegs stabil. Die Planeten geraten einander durch Anziehungskräfte in die Umlaufbahn; sie nä­ hern sich Tiamat, stören und gefährden die Urkörper.« Mit den poeti­schen Worten des sumerischen Epos der Schöpfung: »Die göttlichen Brüder rotteten sich zusammen; sie störten Tiamat, als sie hin und her schwankten. Sie stießen an Tiamats Bauch bei ihren Possen in den Himmelswohnungen. Apsu (die Sonne) vermochte ihren Lärm nicht zu dämpfen; Tiamat, sprachlos, konnte ihnen nicht ausweichen. Ihr Treiben war widerlich, störend waren ihre Wege; sie waren nicht zu überwinden.« Dazu schrieb ich: »Offensichtlich handelt es sich hier um unregelmäßige Umlaufbahnen. Die neuen Planeten schwankten hin und her, geraten zu nahe aneinander, schneiden Tiamats Umlaufbahn.« Die Wege sind die Umlaufbahnen; was nicht zu überwinden ist, das ist natürlich die Gravitation. Nachdem die Wissenschaftler die frühere Vorstellung von einem Sonnensystem, das aus einem heißen Urnebel entstanden sei, sich allmählich abgekühlt und seine gegenwärtige Gestalt angenom­men habe, aufgegeben hatten, argumentierten sie mit den entgegenge­setzten Thesen. Richard A. Kerr schrieb in Science Research News (14. April 1989): »Seit schnellere Computer den Himmelsmechanikern zeitlich längere Blicke auf das Verhalten der Planeten erlauben, herrscht allenthalben ein Chaos.« Er zitiert in seiner Abhandlung die Studien von Gerald J. Sussman und Jack Wisdom vom Technischen Institut in Massachusetts, die aufgrund von Computersimulationen herausgefun­den haben, daß »viele Umlaufbahnen zwischen Uranus und Neptun chaotisch sind und daß Plutos Verhalten auf seiner Bahn unberechenbar ist«. J. Laskar vom Bureau des Longitudes in Paris stellte ein »Urchaos« im gesamten Sonnensystem fest, »aber besonders bei den Innenplaneten einschließlich der Erde«. George W. Wetherill (Science, 17. Mai 1985), der zahlreiche Zusam­menstöße von etwa fünfhundert kleinen Planeten errechnete, bezeich­nete den Prozeß im Bereich der Innenplaneten als Zusammenwachsen vieler Brüder und Schwestern, die zusammenstießen und »Versuchs­planeten« bildeten. Sie krachten aneinander, zerbrachen, fingen die Materie anderer ein, bis sie schließlich, immer größer werdend, zu Innenplaneten wurden. Es sei sozusagen ein Königskampf gewesen, der rund hundert Millionen Jahre von der Bildung des Sonnensystems 82 an gedauert habe. Die Worte dieses hervorragenden Wissenschaftlers sind denen der sumerischen Schöpfungsgeschichte erstaunlich ähnlich. Er spricht von »vielen Brüdern und Schwestern«, die durcheinander wimmeln, zusammenstoßen, sich in den Weg geraten, einer des ande­ren Umlauf stören und sogar gefährlich sind. Der alte Text spricht von göttlichen Brüdern, die »stören, hin und her schwanken«, genau in dem Gebiet, wo Tiamat ihre Bahn hat. Wetherill benutzt den Ausdruck »Königskampf«, um den Konflikt zwischen diesen Geschwistern zu beschreiben. Auch im sumerischen Text ist die Rede von einer Schlacht, die sich während der Schöpfung abgespielt hat. Darin bringt Tiamat, als der Kampf immer heftiger wird, ihre Heerschar hervor, um den himmlischen Brüdern zu begegnen, die sie bedrängen: »Sie hat eine Versammlung einberufen, tobend vor Wut. Dazu hat sie elf von dieser Sorte hervorgebracht. Sie scharten sich zusammen und marschierten an Tiamats Seite. Zornig schmieden sie unaufhörlich Ränke, Tag und Nacht. Sie sind entschlossen zum Kampf, schäumend und rasend; sie haben sich versammelt, bereit zum Kampf.« Die Verfasser von Enuma elisch waren von der unverhältnismäßigen Größe des Mondes ebenso irritiert wie die modernen Astronomen, aber sie vermochten zu erklären, wieso »Kingu« solch gewaltige Masse annahm: »Unter den Göttern, die ihre Heerschar bildeten, erhob sie Kingu, den Erstgeborenen. In ihrer Mitte machte sie ihn groß, Anführer ihrer Mannschaft zu sein, ihre Heerschar zu befehligen, die Waffen zum Kampf zu ergreifen, das Kommando zu übernehmen in dem Kampf. All dies vertraute sie Kingu an. Als sie ihn aufrief, sagte sie zu ihm: Ich habe dich verzaubert, ich habe dich groß gemacht in der Versammlung der Götter; herrsche du über die Götter, die dir untergeben sind. Wahrlich, du bist der Höchste!« Laut dieser alten Kosmogonie wuchs einer von Tiamats elf Satelliten wegen der fortwährenden Störungen und chaotischen Zustände im Sonnensystem zu ungewöhnlicher Größe heran. Wie die Erschaffung dieses monströsen Satelliten die Zustände im neugebildeten Sonnensy­stem beeinflußte, geht aus dem Text leider nicht klar hervor. In den rätselhaften Worten, die auf verschiedene Weise gedeutet und übersetzt worden sind, ist die Rede von »Feuer unterdrücken« (nach E. A. Speiser) und »den Feuergott beruhigen« (nach A. Heidel) und von Unterwer­ fung/Erniedrigung der »mächtigen Waffe, deren gewaltiger Schwung so viel vermag«, womit möglicherweise die störende Anziehungskraft gemeint ist. So beruhigend Kingus Vergrößerung auf Tiamat und ihre Heerschar gewirkt 83 haben mochte, so bestürzend muß sie für die anderen Planeten gewesen sein. Besonders war es ein Schlag für sie, daß Kingu in den Rang eines würdigen Planeten erhoben wurde: »Sie gab ihm eine Tafel der Geschicke, heftete sie an seine Brust. Kingu wurde erhoben, hatte eine himmlische Stellung erhalten.« Diese Sünde Tiamats, Kingu eine eigene Bahn (Geschick) zu geben, erboste die anderen Planeten so sehr, daß sie Nibiru/Marduk herbeirie­fen, um Tiamat und ihrem nicht ebenbürtigen Begleiter den Garaus zu machen. Daraus ergab sich die bereits beschriebene Himmelsschlacht, in deren Verlauf Tiamat gespalten wurde. Die eine Hälfte wurde zer­splittert, die andere und Kingu wurden auf eine neue Bahn geschleu­dert, und so entstanden die Erde und ihr Mond. Das ist eine Erklärung, die mit den anerkannten Details der modernen Theorien über Ursprung, Entwicklung und endgültiges Schicksal des Mondes übereinstimmt, diese Details sogar noch bestätigt. Obwohl es unklar ist, was »die mächtige Waffe, deren Schwung soviel« vermag und der Feuergott, die Kingus Anwachsen zu unverhältnismäßiger Größe verursachten, zu bedeuten haben, bleibt die Tatsache bestehen, daß die unverhältnismäßige Größe des Mondes (auch im Verhältnis zu der sehr großen Tiamat) genau geschildert wird. Alles ist da, nur bestätigt nicht die sumerische Kosmogonie die moderne Wissenschaft, sondern die moderne Wissenschaft hat dem alten Wissen nachgeeifert. Kann der Mond wirklich ein neu entstandener Planet sein, wie die Sumerer behaupten? Das ist, wie bereits angedeutet wurde, durchaus denkbar. Hat er tatsächlich planetarische Eigenschaften angenommen? Im Gegensatz zu der lange vertretenen Meinung, er sei von jeher ein träges Objekt gewesen, hat sich in den letzten zwanzig Jahren heraus­gestellt, daß er zwar alle Attribute eines Planeten hat, nur die Sonne nicht selbständig umkreisen kann. Seine Oberfläche weist zerklüftete und ineinander geschobene Berge auf, er hat Ebenen und »Meere«, die nicht von Wasser gebildet worden sind, sondern von geschmolzener Lava herrühren könnten. Zur Überraschung der Wissenschaftler hat sich gezeigt, daß er wie die Erde geschichtet ist. Obwohl er infolge der Katastrophe seines Eisens beraubt worden ist, scheint er den Eisenkern behalten zu haben. Die Wissenschaftler streiten sich, ob der Kern immer noch geschmolzen ist, denn zu ihrer Verwunderung hat man herausgefunden, das er einstmals ein Magnetfeld hatte, das von der Rotation eines geschmolzenen Eisenkerns herrührt, wie es bei der Erde und anderen Planeten der Fall ist. Wie die Studien von Keith Runcon von der englischen Universität Newcastle ergeben haben, ist der Ma­gnetismus – und das ist bedeutungsvoll – »vor vier Milliarden Jahren geschwunden«, also zur Zeit der Himmelsschlacht. Die von Apollo-Astronauten aufgestellten Instrumente meldeten »uner­wartete Hitzewellen unterhalb der Mondoberfläche«, die anzeigen, daß im Innern des »leblosen Himmelskörpers« etwas vorgeht. Dampf – Wasserdampf – entdeckten Wissenschaftler der Universität von Rice. Im Oktober 1971 berichteten sie, sie hätten »Geysire von Wasserdampf durch Risse in der Mondoberfläche hervor84 kommen« gesehen. Bei der Dritten Mondkonferenz 1972 in Houston wurde von unerwarteter vul­kanischer Tätigkeit auf dem Mond gesprochen, die darauf hinweist, daß in der Nähe der Oberfläche Hitze herrscht und Wasser vorhanden ist. 1973 wurden »helle Blitze« auf dem Mond gesichtet, die sich als Emissionen von Gasausstößen im Inneren des Mondes entpuppten. Das berichtete Walter Sullivan, Redakteur der wissenschaftlichen Beilage der New York Times, und bemerkte dazu, der Mond sei offenbar, wenn auch kein lebender Himmelskörper, so doch ein atmender. Solche Gasausstöße und dämmrige Nebel habe man auch in mehreren tiefen Mondkratern beobachtet, und zwar bei der ersten Apollo-Mission und dann in den 1980er Jahren. Die Hinweise, daß auf dem Mond immer noch vulkanische Tätigkeit herrschen könnte, lassen die Wissenschaftler annehmen, daß er einst­mals eine Atmosphäre gehabt hat, die wahrscheinlich aus Wasserstoff, Helium, Argon, Schwefel, Kohlenstoff und Wasser bestand. Die Mög­lichkeit, daß unter der Oberfläche noch immer Wasser vorhanden ist, hat zu der Frage geführt, ob es früher auch auf der Oberfläche flie­ßendes Wasser gegeben haben mag, Wasser, das verdunstet und im Weltraum verschwunden ist. Wenn es keine Einschränkung der finanziellen Mittel gäbe, hätte die NASA durch Bohrungen die Mineralienquellen des Mondes erforschen können. Dreißig Geologen, Chemiker und Physiker, die im August 1977 in der Universität San Diego zusammenkamen, wiesen darauf hin, daß die Erforschung des Mondes sich bisher auf die äquatorialen Gebiete beschränkt hätte; sie wünschten sich eine Untersuchung der Polargebiete, nicht nur um Daten vom ganzen Mond zu erhalten, sondern um auch nach Wasser zu suchen. Man wollte insbesondere kleine Regionen in der Nähe der Pole untersuchen, wo nie die Sonne hinscheint. Nach ihren Theorien könnten dort hundert Milliarden Ton­nen Eis vorhanden sein. James Arnold von der kalifornischen Universi­tät sagte: »Wenn wir im Weltraum große Unternehmungen wie Berg­bau und Fabrikationen gründen wollen, brauchen wir viel Wasser, und da könnten die Polargebiete des Mondes eine gute Quelle sein.« Ob der Mond nach all den umwälzenden Ereignissen immer noch Wasser im Inneren oder an der Oberfläche hat, muß erst bewiesen werden. Aber es wäre keine Überraschung, denn schließlich war der Mond – alias Kingu – der führende Satellit des »wäßrigen Ungeheu­ers« Tiamat. Nach der letzten Apollo-Mission zum Mond wurden die Entdeckungen des Programms im Economist (Science and Technology, 11. Dezember 1972) folgendermaßen zusammengefaßt: »Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis der Mondforschung die Tatsache, daß er keine einfache zusammengesetzte Kugel ist, sondern ein echter planetarischer Him­melskörper.« Ein echter planetarischer Himmelskörper – genau als das haben die Sumerer ihn vor Jahrtausenden betrachtet. Ebenso haben sie festge­stellt, daß der ehemalige Satellit kein Planet mit selbständiger Umlauf­bahn um die Sonne werden konnte, weil er diesen Rang bei der Himmels­schlacht verloren hat. Folgendes hat 85 Nibiru/Marduk ihm nämlich ange­tan: »Und Kingu, den Obersten unter ihnen, ließ er einschrumpfen, zum Gott Duggä machte er ihn. Er nahm ihm die Tafel der Geschicke, die nicht rechtens war. Er setzte darauf sein eigenes Siegel und heftete sie sich an die eigene Brust.« Seiner Umlaufbahn beraubt, hatte Kingu nur noch den Rang eines Satelliten – wie unser Mond. Die Bemerkung, daß Nibiru/Marduk ihn »einschrumpfen« ließ, ist als Verminderung seines Ranges und seiner Bedeutung aufgefaßt worden. Aber die Untersuchungen des Mondes weisen darauf hin, daß er bei dieser katastrophalen Umwälzung sein Eisen einbüßte, so daß er viel von seiner Dichte verlor. »Es gibt zwei Himmelskörper im Sonnensy­stem, deren ungewöhnliche Dichte wahrscheinlich die Folge außeror­dentlicher Umstände ist«, schrieb Alastair Cameron in Icarus (Bd. 64, 1985), »und das sind Mond und Merkur. Der Mond hat eine sehr geringe Dichte und weist wenig Eisen auf.« Mit anderen Worten, Kingu war wirklich geschrumpft! Wir haben noch einen Beweis dafür, daß der Mond infolge eines starken Aufpralls kompakter geworden ist. Auf der uns abgewandten Seite weist er Berge und eine dicke Kruste auf, aber auf der sichtbaren Seite nur große Ebenen, als ob die Erhebungen weggefegt worden wären. Die Gravitationsschwankungen zeigen kompakte, schwerere Massen in unterschiedlicher Konzentration im Inneren an, besonders unter der abgeflachten Oberfläche. Äußerlich zeigt der Mond zwar eine Kugelform (wie alle Himmelskörper, die größer als die Minimalgröße sind), doch wenn man seine Rinde entfernte, würde er Gurkenform aufweisen, wie eine Computerstudie zeigt (Abb. 44). Diese Form ist das Kennzeichen des Aufpralls, durch den der Mond zusammengepreßt und an seinen neuen Platz am Firmament geschleudert wurde, genau wie die Sumerer es schildern. Die sumerische Aussage, daß Kingu ein »Duggä« wurde, ist ebenfalls interessant. Das Wort bedeutet Bleitopf. Das hielt ich früher für weiter nichts als eine bildliche Darstellung einer »leblosen Bleimasse«. Aber die Apollo-Entdeckungen legen es nahe, daß die sumerische Beschrei­bung nicht nur bildhaft, sonAbb. 44 86 dern auch wissenschaftlich richtig ist. Eines der anfänglichen Mondrätsel war das sogenannte »elternlose Blei«. Beim Apollo-Programm wurde festgestellt, daß die obersten Schichten des Mondes ungewöhnlich reich an radioaktiven Elementen sind, unter anderem an Uran und Radon. Diese Elemente zerfallen und werden bei diesem Prozeß zu Blei. Wie der Mond so reich an radioaktiven Elemen­ten geworden ist, das gehört zu den bisher ungelösten Rätseln; fest steht jedoch, daß sie größtenteils zu Blei zerfallen sind. Die sumerische Aussage, Kingu sei ein »Bleitopf« geworden, ist also wissenschaftlich richtig. Der Mond ist nicht nur ein Zeuge der Genesis. Er bezeugt auch die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Genesis – die Genauigkeit des alten Wissens. Aussagen der Astronauten Fast alle Astronauten haben berichtet, daß sich ihre Anschauung von sich selbst, von anderen Menschen und von der Möglich­keit, daß es außerhalb der Erde intelligente Wesen gibt, geändert hat; sie hätten eine geistige Wandlung durchgemacht. Gordon Cooper, der 1963 bei Mercury 9 als Pilot und 1965 bei Gemini 5 als Copilot teilnahm, sagte, er glaube, daß »intelligen­te außerirdische Wesen vor langer Zeit die Erde besucht hätten«, und er interessiert sich seither für Archäologie. Edward G. Gibson, ein Wissenschaftler an Bord von Skylab 3 (1974), sagte: »Das tagelange Umkreisen der Erde läßt einen etwas mehr über die Frage nachdenken, ob es sonstwo im Weltall Leben gibt.« Besonders bewegt waren die Astronauten der Apollo-Mondmis­sionen. »Da oben geschieht etwas mit einem«, sagte Ed Mitchell, Astronaut von Apollo 14. Jim Irwin, Apollo 15, war »tief bewegt und fühlte die Anwesenheit Gottes«. Sein Kamerad Al Worden trat bei einer Fernsehsendung zum 20. Jahrestag der ersten Mondlandung (Die andere Seite des Mondes, produziert von Michael G. Lemle) auf und verglich die Fähre, die beim Landen und Abheben benutzt wurde, mit dem in Hesekiels Vision be­schriebenen Raumschiff. »Meines Erachtens«, sagte er, »muß das Weltall zyklisch sein. In der einen Galaxie gibt es einen Planeten, der nicht bewohnt ist, und in einer ganz anderen Galaxie einen, auf dem man gut leben kann, und ich sehe intelligente Wesen, wie wir es sind, von Planet zu Planet reisen, wie die Insulaner im Stillen Ozean von einer Insel zur anderen, um die Spezies fortzusetzen. Ich finde, damit hat das Raumprogramm zu tun. Ich denke mir, wir sind vielleicht eine Mischung von Geschöpfen, die in vergangener Zeit hier auf der Erde lebten und von Wesen irgendwoher aus dem Weltraum besucht wurden. Die beiden Gruppen kamen zusammen und pflanzten sich fort. Ja, eine kleine Gruppe von Forschern könnte auf einem Planeten landen und Nachkommen zeugen, die schließlich das ganze übrige Universum bewohnen.« Buzz Aldrin von Apollo 11 erklärte: »Ich glaube, wir können durch kreisende Teleskope wie das Hubble-Teleskop oder durch andere technische Erfindungen eines Tages erfahren, daß wir in diesem wundervollen Weltall tatsächlich nicht allein sind.« 87 7 Die Saat des Lebens Von allen Geheimnissen, denen der wißbegierige Mensch begegnet, ist das größte das sogenannte Leben. Die stammesgeschichtliche Ent­wicklung der Lebewesen von niederen zu höheren Formen wird zwar durch die Evolution von den frühesten einzelligen Lebewesen bis zum Homo sapiens erklärt, aber es wird nicht erklärt, wie das Leben auf der Erde begonnen hat. Dahinter steht die noch schwerwiegendere Frage, ob das Leben auf der Erde einzigartig ist. Gibt es sonst keines in unserem Sonnensystem, in unserer Galaxie, im gesamten Weltall? Nach der Überlieferung der Sumerer wurde das Leben von Nibiru ins Sonnensystem gebracht; Nibiru gab der Erde während der Himmels­schlacht die »Saat des Lebens«. Die moderne Wissenschaft ist auf einem langen Weg zu derselben Schlußfolgerung gelangt. Um herauszufinden, wie das Leben auf der ursprünglichen Erde ent­standen sein könnte, mußten die Wissenschaftler bestimmen oder we­nigstens vermuten, welcher Art die Bedingungen auf der neugeborenen Erde waren. Gab es Wasser? Hatte sie eine Atmosphäre? Wie stand es um die hauptsächlichen Bausteine des Lebens – Molekularverbindun­gen von Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor –, waren sie vorhanden, so daß sich lebende Organismen entwickeln konnten? Heute besteht die trockene Luft der Erde zu neunundsiebzig Prozent aus Stickstoff (N2), zu zwanzig Prozent aus Sauerstoff (O2) und zu einem Prozent aus Argon (Ar) sowie Spuren anderer Elemente (die Atmosphäre enthält außer trockener Luft auch Wasserdampf). Im Welt­raum ist die Zusammensetzung anders; da machen Wasserstoff (87%) und Helium (12%) neunundneunzig Prozent aller Elemente aus. Dar­um – und auch aus anderen Gründen – nimmt man an, daß die gegenwärtige Atmosphäre der Erde nicht die ursprüngliche ist. Sowohl Wasserstoff als auch Helium sind flüchtige chemische Grundstoffe, und ihr geringes Vorkommen in der Erdatmosphäre sowie der Mangel an Edelgasen wie Neon, Argon, Krypton und Xenon (im Verhältnis zu ihrer kosmischen Überfülle) lassen die Wissenschaftler annehmen, daß die Erde vor etwa vier Milliarden Jahren eine sogenannte »heiße Zeit« erlebt hat. Im allgemeinen vermuten die Wissenschaftler, daß die Erdatmosphäre sich aus Gasen gebildet hat, die von der verwundeten Erde unter vulkanischen Eruptionen ausgespien wurden. Als die von Wolken ge­schützte Erde abzukühlen begann, fiel das verdampfte Wasser als strö­mender Regen nieder; durch Oxydation des Gesteins und der Minerali­en entstand das erste Reservoir der höheren Sauerstoffschichten, und schließlich fügte pflanzliches Leben sowohl weiteren Sauerstoff als auch Kohlendioxyd (CO2) hinzu, und es entstand der Stickstoffzyklus (mit Hilfe von Bakterien). Es ist bemerkenswert, daß die sumerischen Texte auch in dieser Hin­sicht der Prüfung der modernen Wissenschaften standhalten. Die fünfte Tafel des Epos 88 der Schöpfung (obwohl stark beschädigt) beschreibt die hervorbrechende Lava als Tiamats »Spucke« und datiert die vulkani­sche Tätigkeit vor die Bildung der Atmosphäre, der Ozeane und der Kontinente. Die Spucke, heißt es, war »geschichtet«, als sie hervorbrach. Die Phase des Erkaltens und der »Versammlung der Wasserwolken« wird ebenfalls geschildert, genau wie in der biblischen Schöpfungsge­schichte. Erst danach erschien Leben auf der Erde: grüne Pflanzen auf den Kontinenten und »Schwärme« im Wasser. Aber lebende Zellen, selbst die der niedersten Entwicklungsstufe, be­stehen aus vielfach zusammengesetzten Molekülen verschiedener or­ganischer Bestandteile, nicht aus einzelnen chemischen Grundstoffen – wie sind sie entstanden? Da man einige dieser Zusammensetzungen anderswo im Sonnensystem gefunden hat, nimmt man an, daß sie sich auf natürliche Weise bilden, wenn sie genügend Zeit haben. 1953 führten Harold Urey und Stanley Miller in der Universität von Chicago ein aufsehenerregendes Experiment durch. Sie mischten in einem Druckbehälter einfache organische Moleküle von Methan, Ammoniak, Was­ serstoff und Wasserdampf und lösten die Mischung in Wasser auf, um die »Ursuppe« herzustellen. Dann wurde die Mischung elektrischen Funken ausgesetzt, die die uranfänglichen Blitze nachahmten. Es erga­ben sich mehrere Amino- und Hydroxydsäuren – die Aufbaustoffe der Proteine, die für lebende Materie wesentlich sind. Andere Forscher setzten ähnliche Mischungen ultraviolettem Licht aus, womit Strahlun­gen oder Hitze ionisiert wurden, so daß die Wirkung der Sonnenstrah­len und verschiedener Strahlungen der ursprünglichen Erdatmosphäre und trüber Gewässer simuliert wurde. Die Ergebnisse waren vergleichbar. Aber es war eine Sache zu zeigen, wie die Natur unter gewissen Bedingungen Bausteine des Lebens hervorbringen kann, nicht nur einfache, sondern sogar komplexe organische Verbindungen. Es war aber eine andere Sache, den so entstandenen Verbindungen, die in der Druckkammer träge und leblos blieben, Leben einzuhauchen. Unter »Leben« versteht man die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen und umzuwandeln, nicht nur zu existieren. Sogar in der biblischen Ge­schichte bedarf es nach der Erschaffung des kompliziertesten aller Geschöpfe, des Menschen, göttlichen Zutuns, damit dem »geformten Lehm der Odem des Lebens eingegeben« wurde. Sonst wäre er, wie genial er auch ersonnen gewesen sein mag, nicht lebensfähig gewesen. Wie die Astronomie im Himmelsraum, so hat auch die Biochemie in den letzten zwei Jahrzehnten viele Geheimnisse des irdischen Lebens enthüllt. Das Innere der Zellen wurde bloßgelegt, der Genkode, der die Fortpflanzung regiert, verständlich gemacht, und viele der Verbindun­gen, die den kleinsten Einzellern sowie den höheren Geschöpfen Leben verleihen, hat man synthetisch nachgebildet. Stanley Miller von der Universität San Diego bemerkte dazu: »Wir haben gelernt, wie aus anorganischen Elementen organische Verbindungen herzustellen sind. Jetzt müssen wir lernen, wie daraus eine fortpflanzungsfähige Zelle wird.« Die Hypothese von der »Ursuppe« als Ursprung des Lebens auf der Erde setzt voraus, daß eine Unmenge dieser frühesten organischen Moleküle infolge von Wellen, Strömen oder Temperaturveränderungen gegeneinanderprallen, schließ89 lich durch natürliche Zellenanziehung aneinanderhaften und Zellengruppen bilden, aus denen sich Polymere entwickeln (Kettenreaktion niedermolekularer Verbindungen). Aber was verleiht diesen Zellen genetische Erinnerung, so daß sie wissen, was sie zu tun haben, um sich zu vermehren und gar den entstandenen Körper wachsen zu lassen? Die Notwendigkeit, den genetischen Kode für die Verwandlung anorganischer Stoffe in lebende Materie zu finden, hat zu der Hypothese »aus Lehm erschaffen« geführt. Dieser Theorie werden Ankündigungen zugeschrieben, die im April 1985 von NASA-Forschern des Ames Research Center in Mountainview vorgebracht wurden; aber daß der Lehmboden an den Küsten der alten Meere bei der Entstehung des Lebens auf der Erde eine wichtige Rolle gespielt hat, wurde erst im Oktober 1977 der Öffentlichkeit bekannt­gegeben, und zwar durch eine ChemikerKonferenz. Da berichtete A. Lawless, der einer Ames-Forschergruppe vorstand, aufgrund von Seiten 126 & 127 fehlen im Originalscan -- Steelrat oder Protoalgen sich auf dem trockenen Land ausgebreitet hatten. Damit diese grünen pflanzenartigen Organismen Sauerstoff abgeben konnten, brauchten sie eine Umgebung aus Gestein, das Eisen enthielt, durch das der Sauerstoff »gebunden« wurde (sonst wären sie durch Oxydation zugrunde gegangen). Nach Ansicht der Wissenschaftler haben sich diese eisengebundenen Gebilde auf dem Meeresboden ab­gelagert, und im Wasser entwickelten sich die einzelligen Organismen dann zu vielzelligen. Mit anderen Worten, ehe die grünen Algen das Land bedecken konnten, mußten sie im Meer leben. Das besagt auch die Bibel: Grüne Pflanzen wurden am dritten Tag erschaffen, lebende Wesen im Wasser erst am fünften. In der dritten Phase – am dritten »Tag« – sprach Elohim: »Die Erde lasse junges Grün sprossen, samentragende Gräser und Obstbäume, die ein jeglicher nach seiner Art Früchte tragen und die Erde besamen sollen.« Der Fortschritt von grünen Gräsern zu Bäumen bedeutet zudem die Entwicklung von asexueller zu sexueller Fortpflanzung. Auch dieser Punkt bezeichnet in der wissenschaftlichen Darstellung der Evolution einen Schritt, der sich nach Meinung der heutigen Forscher bei den Algen vor etwa zwei Milliarden Jahren vollzogen hat. Zu dieser Zeit gab es entsprechend der Genesis noch keine »Kreaturen« auf unserem Planeten, weder im Wasser noch in der Luft oder auf dem trockenen Land. Damit die Entwicklung von Wirbeltieren möglich war, mußte die Erde ein Muster an biologischen Abläufen erstellen, denen der Lebenszyklus aller Geschöpfe unterworfen war und ist. Umlauf und Rotation der Erde mußten sich der Wirkung von Sonne und Mond anpassen, die sich ursprünglich im Wechsel von Licht und Dunkelheit zeigte. In der biblischen Schöpfungsgeschichte wird diese Organisati­on am vierten »Tag« zugewiesen, und es entstanden Jahr, Monat, Tag 90 und Nacht in regelmäßiger Abfolge. Erst als alle himmlischen Bezie­ hungen und Zyklen samt ihrer Wirkung feststanden, erschienen die Geschöpfe des Meeres, der Luft und des Landes. Die moderne Wissenschaft stimmt nicht nur mit diesem Ablauf über­ ein, sondern liefert auch einen Hinweis auf die Ursache, warum die Verfasser der Genesis zwischen der Darstellung der Entwicklung – früheste Lebensformen am dritten »Tag« – und dem Erscheinen der Geschöpfe am fünften die Himmelsschöpfung (am vierten »Tag«) einschalteten. Auch in der modernen Wissenschaft klafft eine Lücke von ungefähr eineinhalb Milliarden Jahren – von zwei Milliarden bis vor fünfhundertsiebzig Millionen Jahren –, da von diesem Zeitraum Abb. 45 wegen nur spärlicher geologischer und fossiler Daten kaum etwas bekannt ist. Man bezeichnet sie als Präkambrisches Zeitalter. Für die alten Weisen war das die Zeit, in der die Himmelsbeziehungen und die biologischen Zyklen entstanden. Obwohl die moderne Wissenschaft das nachfolgende Kambrium (so benannt nach Cambria, dem keltischen Namen für Wales, wo die ersten geologischen Funde gemacht wurden) als die erste Phase des Paläozoi­kums (altes Leben) betrachtet, gab es damals noch keine Wirbeltiere (die in der Bibel »Geschöpfe« heißen). Die ersten Meereswirbeltiere erschienen vor etwa fünfhundert Millionen Jahren, und die Land­ wirbeltiere folgten ungefähr hundert Millionen Jahre später, weshalb man zwischen dem Unteren und dem Oberen paläontologischen Zeital­ter unterscheidet. Als es vor ungefähr zweihundertzwanzig Millionen Jahren endeAbb. 46 91 te, gab es im Wasser sowohl Fische als auch Meerespflanzen, Amphibien wechselten vom Wasser aufs Land, und die Pflan­zen auf dem Land veranlaßten die Amphibien, sich zu Reptilien zu entwickeln (Abb. 45). Die heutigen Krokodile sind ein Überrest dieser Entwicklungsphase. Das folgende Erdzeitalter, Mesozoikum (mittleres Leben) genannt, umfaßt den Zeitraum von vor zweihundertzwanzig bis fünfundsechzig Millionen Jahren, der als Zeitalter der Dinosaurier gilt. Neben vielfälti­gen Amphibien, Eidechsenfischen und Fischen entwickelten sich zwei Hauptgattungen von eierlegenden Reptilien: solche, die fliegen konn­ten (von denen die Vögel abstammen), und eine ebenso große Vielfalt von Dinosauriern (Lindwürmer), die die Erde beherrschten (Abb. 46). Es ist unmöglich, die Schöpfungsereignisse, die den fünften »Tag« der Genesis beschreiben, zu lesen, ohne sich darüber klar zu sein, daß es sich um die obige Evolution handelt: »Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: »Seid fruchtbar und mehret euch und füllet das Wasser im Meer, und das Gefieder mehre sich auf Erden.« Luther hat das hebräische Wort »Taninim« (Plural von »Tanin«) mit Walfischen übersetzt, andere mit »Seeschlangen«, »Seeungeheuern« und »Krokodilen«. In der Encyclopaedia Britannica steht: »Die Kro­kodile sind das letzte lebende Glied der dinosaurierähnlichen Reptilien vorgeschichtlicher Zeiten. Sie sind zugleich die nächsten lebenden Verwandten der Vögel.« Die Folgerung, daß mit »großen Taninim« nicht einfach große Reptilien gemeint sein könnten, sondern Dino­ saurier, ist einleuchtend, nicht etwa weil die Sumerer sie gesehen haben, sondern weil die Gelehrten der Anunnaki die erdgeschichtliche Entwicklung mindestens ebenso gut nachvollzogen haben wie die Wis­senschaftler des 20. Jahrhunderts. Interessant ist die Reihenfolge, in der die alten Texte die drei Zweige der Wirbeltiere auflisten. Lange Zeit nahmen die Wissenschaftler an, die Vögel hätten sich aus den Dinosauriern entwickelt, und zwar durch eine Gleitbewegung, die bei der Nahrungssuche die Sprünge von Ast zu Ast erleichterte, oder (eine andere Theorie) die erdgebundenen schwe­ren Dinosaurier hätten größere Laufgeschwindigkeit erzielt, indem sie hohle (d. h. leichtere) Knochen entwickelten. Die zweitgenannte Theo­rie wurde erweitert: Um rascher vorwärtszukommen, hätten die Vögel dann die Zweibeinigkeit entwickelt. Das schien sich zu bestä92 tigen, als man einen fossilen Deinonychus (Krallenbewehrter) fand, einen schnel­len Läufer, dessen Schwanzskelett federartige Form zeigte (Abb. 47). 1877 wurde der versteinerte Archäopteryx (Alte Feder) gefunden (Abb. 48a), der für die fehlende Entwicklungsstufe zwischen Dinosau­riern und Abb. 47 Vögel gehalten wurde und die Theorie entstehen ließ, beide, die Dinosaurier und die Vögel, hätten einen gemeinsamen Urahnen, der zu Beginn der Triasformation lebte. Aber auch diese Vordatierung des Erscheinens der Vögel wurde in Frage gestellt, als man in Deutschland weitere versteinerte Archäopteryxe fand, die erkennen ließen, daß die­ ses Geschöpf ein vollentwickelter Vogel war und sich nicht aus Dino­sauriern entwickelt hatte, sondern eher aus einem gemeinsamen, aus dem Meer stammenden Vorfahren (Abb. 48b). Die biblischem Quellen scheinen das alles gewußt zu haben. Denn in der Bibel werden die Vögel nicht nach den Dinosauriern aufgeführt (was die modernen Wissenschaftler eine Zeitlang getan haben), son­dern vor ihnen. Da die auf Funden von Versteinerungen beruhenden Erkenntnisse immer noch unvollkommen sind, ist es durchaus Abb. 48a und b möglich, daß die Paläontologen eines Tages den Beweis dafür erbringen werden, daß die Urvögel mit den 93 Meerestieren mehr gemeinsam haben als mit den Landeidechsen. Vor etwa fünfundsechzig Millionen Jahren verschwanden die Dinosau­ rier plötzlich vom Antlitz der Erde. Die Theorien über die Ursache reichen von klimatischen Veränderungen über Epidemien bis zur Ver­nichtung durch einen »Todesstern«. Was für ein Ereignis es auch gewesen sein mag, es bedeutete zweifellos das Ende einer Periode und den Beginn einer neuen. Gemäß der Bibel geschah dies am sechsten »Tag«. Die modernen Gelehrten sprechen vom Cenoman, einer der Entwicklungsstufen der Kreideformation; das ist das Zeitalter, in dem die Säugetiere sich auf der Erde ausbreiteten. Die Bibel schildert das folgendermaßen: Und Elohim sprach: »Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art.« Und es geschah also. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Hier stimmen Bibel und Wissenschaft vollständig überein. Der Kon­flikt zwischen Kreationisten und Evolutionisten erreicht hingegen sei­nen Höhepunkt bei dem, was als nächstes geschah – bei der Entste­hung des Menschen. Damit werden wir uns im nächsten Kapitel befas­sen. Im Augenblick ist es wichtig zu betonen, daß man eigentlich annehmen müßte, der Mensch sei in Anbetracht der Tatsache, daß er allen anderen Lebewesen überlegen ist, das älteste Geschöpf auf Erden und somit das am meisten entwickelte und das klügste. Aber davon ist in der Genesis nicht die Rede. Im Gegenteil, es heißt, der Mensch sei zuletzt auf der Erde erschienen. Auch die moderne Wissenschaft lehrt, daß wir erst auf den letzten Seiten des Geschichtsbuchs der Evolution stehen. Genau das haben bereits die Sumerer in ihren Schulen gelehrt. Erst nach der Erschaffung der schwimmenden Fische, der fliegenden Vögel und aller anderen Tiere auf Erden »schuf Elohim Adam«. Nach dem siebten »Tag« war Gottes Werk auf der Erde getan. »So«, sagt die Genesis, »sind Himmel und Erde entstanden.« Bis zur Erschaffung des Menschen verlaufen moderne Wissenschaft und altes Wissen parallel. Aber in der Entwicklungslehre fehlt die Grundfrage, wie das Leben entstanden ist, wo der Ursprung des Le­bens zu suchen ist. Die Experimente mit der »Ursuppe« und dem »Leben aus dem Lehm« besagen nur, daß unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen Leben spontan entstehen könnte. Diese Beobachtung, nach der die Bausteine des Lebens wie etwa Ammoniak und Methan (die einfach­sten Verbindungen von Stickstoff und Wasserstoff sowie von Kohlen­stoff und Wasserstoff) sich als Teil der Naturpro94 zesse gebildet haben können, scheint durch die jüngste Entdeckung bekräftigt zu werden, daß diese Verbindungen auch auf anderen Planeten, sogar häufig, vor­kommen. Aber wie haben diese chemischen Verbindungen Leben er­halten? – Das es möglich ist, ist offensichtlich, denn die Tatsache besteht, daß es auf der Erde Leben gibt. Die Spekulation, daß es auch anderswo in unserem Sonnensystem Leben in irgendeiner Form geben könnte (wahrscheinlich sogar in anderen Sternensystemen), setzt die Möglichkeit einer Verwandlung von unbelebter Materie in belebte voraus. Die Frage ist also nicht, wie kann es geschehen, sondern wie ist es auf der Erde geschehen? Für das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, sind zwei grundlegende Moleküle notwendig: Proteine (Eiweißstoffe), die für alle die komple­xen metabolischen Funktionen lebender Zellen sorgen, und Nuklein­säuren, die den genetischen Kode tragen und die Instruktionen für die Prozesse in den Zellen liefern. Die Zelle selbst ist ein komplexer Organismus, der sich nicht nur durch Teilung vermehren kann, sondern auch den Ablauf verschiedener Vorgänge ermöglicht. Um Bausteine für Proteine zu werden, müssen die Aminosäuren lange und komplexe Ketten bilden. In der Zelle bewältigen sie ihre Aufgabe gemäß den Anweisungen einer einzigen gespeicherten Nukleinsäure (DNS = Desoxiribonukleinsäure), wobei die RNS (Ribonukleinsäure) als Über­träger fungiert. Könnten Aminosäuren unter den auf der Urerde herrschenden Verhält­nissen Ketten gebildet haben? Allen Versuchen und Theorien zum Trotz – bemerkenswerte Experimente führte Clifford Matthews von der Universität Illinois durch – erforderten alle Möglichkeiten mehr Druck­kraft, als vorhanden gewesen war. Sind also DNS und RNS den Aminosäuren auf der Erde vorausgegangen? Die Fortschritte in der Genetik und die Lösung vieler Rätsel der leben­den Zelle haben die Anzahl der Fragen nicht verringert, sondern eher vermehrt. Als J. D. Watson und Francis H. Crick 1955 die wendelförmige Struktur der DNS entdeckten, enthüllte sich ihre ungeheure Kom­plexität. Ihre verhältnismäßig großen Moleküle bestehen aus fadenförmi­gen Ketten, die mit vier sehr komplexen organischen Verbindungen verknüpft sind. (Man bezeichnet sie nach ihren Anfangsbuchstaben mit A, G, C und T.) Diese vier Nucleotide können sich paarweise in grenzenlosen Variationen verbinden und werden abwechselnd von Zuckermolekülen und Phosphaten festgehalten (Abb. 49). Die RNS, nicht weniger komplex und aus den vier Bausteinen A, G, C, U beste­hend, kann Tausende von Verbindungen enthalten. Wieviel Zeit benö­tigte die Evolution auf der Erde, um derartig komplexe Verbindungen zu entwickeln, ohne die das Leben, das wir kennen, niemals entstanden wäre? Abb. 49 95 Die 1977 in Südafrika gefundenen Algenversteinerungen sind etwa 3,1 bis 3,4 Milliarden Jahre alt. Aber das waren mikroskopisch kleine, einzellige Organismen, und weitere Entdeckungen 1980 in Australien warfen neue Fragen auf. Die Forschergruppe, die J. William Schopf von der Universität Los Angeles leitete, fand fossile Überreste von Organismen, die nicht nur viel älter waren – dreieinhalb Milliarden Jahre –, sondern auch Mehrzeller, die unter dem Mikroskop wie faserartige Ketten aussahen (Abb. 50). Vor dreieinhalb Milliarden Jahren haben diese Orga­nismen bereits sowohl Aminosäuren als auch kom­plexe Nukleinsäuren enthalten, das heißt die geneti­schen Vermehrungsverbindungen. Sie müssen also der Beginn der Lebenskette sein, und zwar in einem bereits fortgeschrittenen Stadium. Man kann sagen, daß diese Funde die Suche nach dem erAbb. 50 sten Gen in Bewegung setzten. Immer mehr Wissenschaftler nehmen an, daß es vor den Algen die Bakterien gab. »Wir haben Zellen vor uns, die direkte morphologische Überreste der Bakterien selbst sind«, sagte Malcolm R. Walter, ein australisches Mitglied der Gruppe. »Sie sehen aus wie heutige Bakterien.« Ja, sie sehen aus wie fünf verschiedene Bakterien­typen, deren Struktur »erstaunlicherweise fast genau so ist wie die der heutigen Bakterien«. Die Feststellung, daß das Leben auf der Erde mit Bakterien begann, die den Algen vorausgingen, schien sinnvoll zu sein, als die Genforschung weiter fortschritt und ergab, daß alles Leben auf der Erde von der einfachsten bis zur kompliziertesten Stufe dieselben genetischen Bestandteile hat und dieselben etwa zwanzig grundlegenden Amino­säuren aufweist. Die meisten Untersuchungen wurden an dem einfa­chen Bakterium Escherichia coli (abgekürzt E. coli) vorgenommen, das bei Menschen und Vieh Durchfall verursacht. Selbst dieser kleine Einzeller, der sich durch Teilung vermehrt, hat fast viertausend ver­schiedene Gene! Daß Bakterien beim Evolutionsprozeß eine Rolle gespielt haben, geht nicht nur daraus hervor, daß viele im Wasser lebende, pflanzliche und höher entwickelte Organismen bei lebensnotwendigen Prozessen von Bakterien abhängen, sondern auch aus der Entdeckung – zuerst im Stillen Ozean, dann in anderen Meeren –, daß Bakterien es den Organismen im Wasser, die nicht von der Photosynthese abhängen, ermöglicht haben und noch immer ermöglichen, in der Tiefe des Mee­ res Schwefelverbindungen umzuwandeln. Man nennt sie Archäobakterien. Eine Forschergruppe, die Carl E. Woese von der Universität Illinois leitete, bestimmte ihr Alter mit dreieinhalb bis vier Milliarden Jahren. Dieses Alter bestätigen Funde von 1984 in einem österreichi­schen See, die Hans Fricke vom Max-PlanckInstitut und Karl Stetter von der Universität Regensburg zu verdanken sind. Ablagerungen vor Grönland weisen chemische Spuren auf, die photo­ synthetisches Leben vor 3,8 Milliarden Jahren bezeugen. Alle diese Funde besagen also, daß es innerhalb weniger hundert Millionen Jahre nach der undurchdringlichen Zeitgrenze von vier Milliarden Jahren auf der Erde fortpflan96 zungsfähige Archäobakterien gab. In neueren Studi­en (Nature, 9. November 1989) gelangt eine Forschergruppe, die von Norman H. Sleep von der Universität Stanford geleitet wurde, zu der Schlußfolgerung, daß das Leben auf Erden innerhalb von zweihundert Millionen Jahren – in der Zeit von vor ungefähr vier und 3,8 Milliar­den Jahren – begann. Zu dieser Zeit öffnete sich sozusagen das »Fenster der Zeit«. »Alles, was heute lebt, entwickelte sich aus den Organismen, als das Fenster der Zeit sich öffnete.« Aber die Forscher machten nicht den Versuch zu ergründen, wie das Leben zu dieser Zeit entstanden ist. Das Leben auf Erden begann also vor vier Milliarden Jahren, wie man bewiesen hat. Aber warum erst dann und nicht früher, als die Planeten sich vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren bildeten? Alle wissen­schaftlichen Untersuchungen auf der Erde und auf dem Mond kommen über dieses Datum nicht hinaus, und als Erklärung dient ihnen ein »katastrophales Ereignis«. Um mehr zu erfahren, müssen wir die sume­rischen Texte zu Hilfe nehmen. Da Versteinerungen und andere Funde darauf hinwiesen, daß es seit Öffnung des »Fensters des Lebens« zweihundert Millionen Jahre lang auf der Erde bereits fortpflanzungsfähige Organismen gegeben hat, machten sich die Wissenschaftler lieber auf die Suche nach der »Es­senz« des Lebens als nach den weiterhin entstehenden Organismen, auf die Suche nach den Spuren von DNS und RNS. Viren, deren Nukleinsäure infektiös wirkt und die sich im Zellstoffwechsel eines Lebe­wesens vermehren, gibt es in Hülle und Fülle nicht nur zu Lande, sondern auch im Wasser, und das hat einige Wissenschaftler veranlaßt anzunehmen, daß die Viren vor den Bakterien existiert haben. Aber woher haben sie ihre Nukleinsäure? Die Theorie, daß die einfachere RNS der viel komplexeren DNS voran­ gegangen sei, trug Leslie Orgal vom Salk-Institut in La Jolla (Kalifornien) vor einigen Jahren bei einer Konferenz vor. Obwohl die RNS nur die genetische Information vom Zellkern ins Zytoplasma überträgt, vertraten andere Forscher, unter ihnen Thomas R. Cech von der Univer­sität in Colorado und Sidney Altman von der Yale-Universität, die Meinung, ein gewisser RNS-Typ könne unter bestimmten Umständen selbst katalysieren. All dies führte zu Computerstudien seitens des Nobelpreisträgers Manfred Eigen. In einer Abhandlung (Science, 12. Mai 1989) schrieben er und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut, sie hätten durch Rückverfolgung des Lebensstammbaumes herausgefun­den, daß der genetische Code auf der Erde nicht älter sein könne als etwa 3,8 Milliarden Jahre, plus oder minus sechshundert Millionen Jahre. »Damals«, sagte Manfred Eigen, »ist vielleicht ein Urgen er­schienen, mit der biblischen Anweisung: Geh hinaus, sei fruchtbar und mehre dich. Wenn der Spielraum auf der Plusseite wäre« – also älter als 3,8 Milliarden Jahre –, »dann könnte das Gen nur außerirdischen Ursprungs sein.« Das betonte dieser bedeutende Gelehrte. Bereits auf der vierten Konferenz über den Ursprung des Lebens hatte Lynn Margulis diesen erstaunlichen Schluß gezogen: »Wenn der Ursprung unserer Fortpflanzungsfähigkeit auf der frühen Erde zu suchen ist, dann muß sie sich ganz plötzlich ergeben haben, nicht vor Milliarden, sondern vor Millionen von Jahren.« Und sie fügte hinzu: 97 »Das Hauptproblem dieser Konferenzen ist, wenn auch in einzelnen Punkten geklärt, so ungelöst wie eh und je. Entstammt unsere organische Materie dem Weltraum? Die neue Wissenschaft der Radioastronomie hat den Beweis erbracht, daß es dort einige kleinere organische Moleküle gibt.« Im Jahr 1908 schrieb der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius (Das Werden der Welten), lebentragende Sporen seien durch den Druck der Lichtwellen vom Gestirn eines anderen planetarischen Systems, wo sich längst Leben entwickelt hätte, zur Erde gebracht worden. Man nannte diese Theorie Panspermia, damals fand man sie unwissen­schaftlich, weil eine fossile Entdeckung nach der anderen die Evoluti­onstheorie als allein gültige Erklärung für den Ursprung des Lebens unterstützte. Aber gerade diese Entdeckungen führten doch zu Fragen und Zweifeln, in solchem Maße, daß der englische Vererbungsforscher Francis Crick, ebenfalls ein Nobelpreisträger, zusammen mit Lesley Orgel 1973 in einer Abhandlung (Icarus, Bd. 19) den Gedanken einer Besamung der Erde mit den ersten Organismen oder Sporen aus dem Weltraum wieder aufgriff; allerdings nicht aufgrund einer zufälligen, sondern aus »gezielter Absicht einer außerirdischen Gesellschaft«. Unser Sonnensy­stem sei zwar erst vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren entstanden, aber andere Sonnensysteme im Weltall hätten sich schon zehn Milliar­ den Jahre früher bilden können. Die Zeit zwischen der Bildung der Erde und dem Erscheinen von Leben sei viel zu kurz; in einem anderen System hätten sechs Milliarden Jahre mehr für den Prozeß zur Verfü­gung gestanden. »Diese verfügbare Zeit macht es möglich, daß es vor der Bildung der Erde irgendwo anders in der Galaxie technisch entwickelte Gesellschaften gegeben hat.« Sie schlugen den Wissenschaftlern vor, eine Theorie der »Infektion« in Betracht zu ziehen, nämlich die einer primitiven Lebensform, die von der technisch fortgeschrittenen Gesellschaft auf einem anderen Planeten absichtlich auf die Erde ver­pflanzt worden sei. Da sie mit dem Einwand rechneten – der auch erfolgte –, Sporen könnten die Strapazen einer Weltraumdurchquerung nicht überleben, meinten sie, die Mikroorganismen seien nicht einfach durch den Raum herabgesegelt, sondern in einem besonders ausgerü­steten Raumschiff mit lebenserhaltenden Bedingungen befördert wor­den. So angesehen Crick und Orgel als Wissenschaftler auch waren, ihre Theorie der gezielten Panspermia wurde mit Unglauben und sogar mit Gelächter aufgenommen. Doch in den letzten Jahren hat sich die Einstellung geändert. Einerseits verschmälerte sich das »Fenster der Zeit« auf nur zweihundert Millionen Jahre, so daß eine Eigenentwicklung der wesentlichen genetischen Materie auf der Erde nicht mehr in Frage kam; andererseits war da auch die Entdeckung, daß von der Unzahl der Aminosäuren nur dieselben zwanzig an der Bildung der lebenden Organismen beteiligt sind, ganz gleich, wie und wann sie entstanden sein mögen, und daß dieselbe einzelne DNS, die aus vier identischen Nukleotiden besteht, bei allen Lebewesen auf Erden als Träger des Erbgutes der wichtigste Bestandteil der Zelle ist. Darum konnte man bei der achten Konferenz über den Ursprung des Lebens, 98 die 1986 in Berkeley, Kalifornien, abgehalten wurde und einen Wendepunkt bildete, das zufällig entstehende Leben der »Ursuppen«- und Lehm-Hypothese nicht mehr gelten lassen, zumal sie der Vielfalt der Lebensformen und der genetischen Codes nicht gerecht wurde. Statt dessen einigte man sich darauf, daß alles Leben auf der Erde, von Bakterien bis zu Mammutbäumen und Menschen, einer einzigen Ur­zelle entstamme. Aber woher ist die Urzelle gekommen? Die fast dreihundert Wissenschaftler aus zweiundzwanzig Ländern pflichteten der vorsichtig geäußerten Meinung, sie sei aus dem Weltall auf die Erde gebracht worden, nicht bei, aber es waren doch viele darunter, die sich bereit erklärten zu erwägen, ob nicht die Vorläufer des organischen Lebens aus dem Weltraum beeinflußt worden sein könnten. Zu guter Letzt bot sich den Wissenschaftlern nur eine Möglichkeit, das Rätsel zu lösen: durch Erforschung des Weltraums. Die Forschung sollte von der Erde auf Mars, Mond und Triton, den Saturn-Satelliten, verlagert werden, weil sich die Spuren des beginnenden Lebens in ihrer unverfälschteren Umgebung besser hätten erhalten können. Das setzte natürlich voraus, daß die Erde nicht als einziger Himmelskörper Leben aufweist. Der Hauptgrund für eine solche Voraussetzung ist die Tatsache, daß es im Sonnensystem und im Weltraum organische Verbindungen gibt. Die Daten der interplanetarischen Untersuchungen wurden schon in einem früheren Kapitel besprochen. Die Daten der das Leben betreffenden Elemente und Verbindungen im Weltraum sind so umfangreich, daß hier einige Beispiele genügen müssen. So entdeckte eine internationale Forschergruppe des Max-Planck-Institutes 1977 Wassermoleküle außerhalb unserer Galaxie; die Dichte des Wasserdampfes war dieselbe wie in der Galaxie der Erde, und Otto Hachenberg vom Bonner Institut für Radioastronomie meinte, daraus sei zu schließen, daß »irgendwo Bedingungen bestehen, die wie diejenigen auf der Erde für Leben geeignet sind«. 1984 fand das Goddard Space Center im interstellaren Raum »eine verwirrende Anzahl von Molekülen, da­bei die Anfänge organischer Chemie«. Es seien »komplexe Moleküle, zusammengesetzt aus denselben Atomen, die lebendes Gewebe ausma­chen«, berichtete Patrick Thaddeus vom Institut für Raumforschung. Man könne annehmen, daß diese Verbindungen zur Zeit der Entstehung der Erde auf sie gelangten und daß das Leben von ihnen abstammt. 1987 stellte man durch NASA-Instrumente fest, daß explodierende Sterne (Supernovae) die meisten der über neunzig Elemente hervor­brachten, darunter auch Kohlenstoff, die in den lebenden Organismen auf der Erde enthalten sind. Wie gelangten diese lebenswichtigen Verbindungen aus dem nahen oder fernen Weltraum auf die Erde? Die in Frage kommenden himmlischen Gesandten sind Kometen sowie aufprallende Meteore, Meteoriten und Asteroide. Von besonderem Interesse für die Wissenschaftler waren die Meteoriten, die Kohlenstoff enthalten; man nimmt an, daß sie aus der uranfänglichen planetarischen Materie unseres Sonnensystems entstanden sind. Einer von ihnen, der in Australien – in der Nähe von Murchison in Victoria – herunterfiel, enthielt zahlreiche organische Verbindungen, auch Aminosäuren und stickstoffhaltige Ba­sen, die alle in der 99 DNS vorhandenen Verbindungen umfaßten. Wie Ron Brown von der MonashUniversität in Melbourne berichtete, wur­de in dem Meteoritengestein eine sehr frühe Zellstruktur isoliert. Bis dahin hatte man die kohlenstoffhaltigen Meteoriten, die 1805 zu­erst in Frankreich gesammelt wurden, als unzuverlässigen Beweis abgetan, weil man ihre lebenbildenden Verbindungen mit Verunreini­gungen durch die Erde erklärte. Aber 1977 wurden zwei Meteoriten dieses Typs in der Antarktis gefunden, eingegraben im Eis, wo keine Verunreinigungen möglich waren. Diese Meteoriten und andere, die japanische Forscher in der Antarktis entdeckten, waren reich an Ami­nosäuren und enthielten mindestens drei Nukleotide (A, G und U des »genetischen Alphabets«), aus denen die DNS und/oder die RNS beste­hen. Im Scientific American (August 1983) stellten Roy S. Lewis und Edward Anders fest, daß »kohlenstoffhaltige Chondriten, die ältesten Meteoriten, außerhalb des Sonnensystems entstandene Materie ent­halten, darunter solche, die von Supernovae und anderen Sternen aus­gestoßen worden ist«. Die Altersbestimmung nach der Radiokarbon­methode hat ein Alter von etwa 4,7 Milliarden Jahren ergeben. Sie sind demnach nicht nur so alt oder noch älter als die Erde, sondern auch außerirdischen Ursprungs. In gewisser Weise auf dem alten Glauben basierend, daß Kometen auf der Erde Seuchen verursachen, vertraten zwei angesehene britische Astronomen, Sir Fred Hoyle und Chandra Wickramasinghe im New Scientist (17. November 1977) die Meinung, daß »das Leben auf der Erde begonnen hat, als abschweifende Kometen, die Bausteine des Lebens trugen, in die Urerde einschlugen«. Trotz Angriffen seitens anderer Wissenschaftler blieben die beiden bei ihrer Anschauung und veröffentlichten sie überall, auf Konferenzen, in Büchern und Zeit­schriften, jeweils mit neuen Beweisen für die Hypothese, daß das Leben vor ungefähr vier Milliarden Jahren von einem Kometen auf die Erde gebracht worden sei. Wie bereits gesagt wurde, enthalten Kometen Wasser und andere le­benswichtige Stoffe. Diese Feststellung hat auch andere Astronomen und Biophysiker auf den Gedanken gebracht, daß aufprallende Kome­ten bei der Entstehung des Lebens auf Erden die entscheidende Rolle gespielt haben. So erklärte Armand Delsemme von der Universität Toledo: »Viele aufprallende Kometen brachten chemische Stoffe mit, die zur Bildung von Aminosäuren notwendig sind. Die Moleküle in unserem Körper waren einstmals dieselben wie die in Kometen.« Als die technischen Fortschritte ein genaueres Studium der Meteoriten, Kometen und anderer Himmelskörper ermöglichten, ergaben sich so­gar noch mehr lebensnotwendige Verbindungen. Eine neue Generation von Wissenschaftlern, die Exobiologen genannt wurden, fanden Isoto­pen, die anzeigen, daß sie vor der Bildung des Sonnensystems entstan­den sind. So schien es einleuchtender zu sein, daß das Leben auf der Erde extrasolaren Ursprungs ist. Der Streit der Gelehrten um die Richtigkeit der Hoyle- und Wickramasinghe-Hypothese verlagerte sich nun auf die Frage, ob die beiden recht hatten mit ihrer Annahme, daß »Sporen« – also Mikroorganismen –, nicht aber wichtigere lebenbildende chemische Verbindungen durch den Aufprall von Kometen/Meteoriten auf die 100 Erde gelangt sind. Konnten Sporen in der Strahlung und Kälte des Weltraums überleben? Der Zweifel wurde durch Experimente zerstreut, die 1985 in der Uni­versität Leiden (Niederlande) vorgenommen wurden. Wie die beiden Astrophysiker J. Mayo Greenberg und Peter Weber in Nature (Bd. 316) berichteten, sei es möglich, wenn die Sporen von Wasser-, Methan-, Ammoniak- und Kohlenmonoxyd-Molekülen eingehüllt wurden, die allesamt auf anderen Himmelskörpern vorhanden waren. Panspermia war also möglich. Wie aber verhielt es sich mit der gezielt durchgeführten Panspermia, mit der vorsätzlichen Besamung der Erde durch eine andere Zivilisati­on, wie Crick und Orgel schon früher vermutet hatten? Ihrer Ansicht nach bestand die schützende Hülle nicht einfach aus den erforderlichen Verbindungen, sondern sie war ein Raumschiff, in dem die Mikroorganis­men in einer Nährlösung schwammen. Mochte ihre Theorie auch an Science-fiction erinnern, sie hielten daran fest. »Wenn es auch ein bißchen ausgefallen klingt«, schrieb Sir Francis Crick in der New York Times (26. Oktober 1981), »so sind doch alle Argumente wissenschaft­ lich plausibel.« Wenn es sich voraussehen lasse, daß die Menschen eines Tages die »Saat des Lebens« einer anderen Welt bringen könnten, warum sollte es dann nicht möglich gewesen sein, daß es eine höhere Zivilisation in ferner Vergangenheit nicht genauso mit der Erde gemacht hat? Lynn Margulis, eine Pionierin bei den Diskussionen über den Ursprung des Lebens und mittlerweile Mitglied der amerikanischen Staatlichen Akademie der Naturwissenschaften, vertrat die Meinung (Newsweek, 2. Oktober 1989), daß viele Organismen unter harten Bedingungen zu festen, zähen kleinen Paketen werden – sie nannte sie Ableger –, die genetische Materie in eine gastfreundlichere Umgebung befördern. Die natürliche Überlebensstrategie habe dafür gesorgt; dies sei in der Ver­gangenheit geschehen, und es werde auch in Zukunft geschehen. In einem detaillierten Bericht in der New York Times (6. September 1988) über alle diese Entwicklungen und die Forschungen der NASA faßte Sandra Blakeslee die neue Position zusammen: »Bei der neuesten Erforschung der Hinweise auf den Beginn des Lebens hat man herausgefunden, daß Kometen, Meteoriten und interstellarer Staub sowohl große Mengen komplexer organischer Stoffe als auch die lebenswichtigen Elemente lebender Zellen enthalten. Die Wissenschaftler vermuten, daß die Erde und andere Planeten aus dem Weltraum mit diesen potentiellen Bausteinen des Lebens besamt worden sind.« Besamt aus dem Weltraum – genau diese Worte haben die Sumerer vor Tausenden von Jahren niedergeschrieben! Es ist bemerkenswert, daß Chandra Wickramasinghe in seinen wissen­ schaftlichen Darstellungen häufig den griechischen Philosophen Anaxagoras (500-428 v. Chr.) zitiert, der glaubte, daß die unveränder­lichen Grundstoffe, die 101 er »Samen« nennt, durchs Universum schwär­men, bereit, zu sprießen und Leben zu erzeugen, wo immer sich eine geeignete Umgebung findet. Er stammte aus Kleinasien, und seine Quellen waren die mesopotamischen Schriften und Überlieferungen. Auf sechstausend Jahre dauernden Umwegen ist die moderne Wissen­schaft zu dem Szenarium der Sumerer zurückgekehrt, nachdem ein Eindringling aus dem Weltall den Samen des Lebens ins Sonnensystem und bei der Himmelsschlacht auf die Erde gebracht hat. Die Anunnaki, die etwa eine halbe Million Jahre vor uns die Raumfahrt beherrschten, haben all das lange vor uns herausgefunden, und in dieser Hinsicht ist die moderne Wissenschaft soeben im Begriff, das alte Wissen einzuholen. 102 8 Der Adam - ein Sklave, zum Gehorchen geschaffen Die biblische Geschichte von der Erschaffung des Menschen ist natür­lich der entscheidende Punkt in dem – manchmal erbitterten – Streit zwischen Kreationisten und Evolutionisten, der sich in den Lehrbü­chern spiegelt. Wie bereits gesagt wurde, würden beide Parteien gut daran tun, die Bibel nochmals zu lesen, und zwar das hebräische Original. Dann würden die Evolutionisten die wissenschaftliche Be­deutung der Genesis erkennen und die Kreationisten sich darüber klarwerden, was der Text wirklich bedeutet. Abgesehen von der naiven Annahme, die »Tage«, in denen die Welt erschaffen wurde, hätten je vierundzwanzig Stunden gedauert – an­statt sich darunter Zeitalter oder Phasen vorzustellen –, stimmt die Beschreibung der Schöpfung mit der modernen Wissenschaft überein. Ein unlösbares Problem aber ergibt sich, wenn die Kreationisten darauf bestehen, daß der Mensch – der Homo sapiens – direkt und ohne Vorfahren von »Gott« erschaffen worden sei. In Luthers Übersetzung heißt es: »Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erden­kloß, und er blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase.« Hermann Menge schreibt in seiner Übersetzung (1927), Gott habe ihn aus Erde vom Ackerboden (!) gemacht; in der Bibel in heutigem Deutsch wird er »aus Erde gebildet«. Daran halten die Kreationisten fest. Hätte einer dieser Übersetzer oder Bearbeiter den hebräischen Text gelesen – der immerhin das Original ist –, so hätte er erstens einmal festgestellt, daß Elohim die Pluralform ist, die mit »Götter« übersetzt werden müßte, nicht mit »Gott«, und zweitens, daß die vorangehenden Verse erklären, warum der Adam erschaffen wurde: »Denn es war noch kein Mensch da, das Land zu bestellen.« Das sind zwei wichtige und unumstößliche Hinweise darauf, von wem und warum der Mensch erschaffen wurde. Natürlich haben wir es mit noch einem Problem zu tun. Im ersten Kapitel heißt es in der deutschen Übersetzung: »Und Gott sprach: Lasset uns (!) einen Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei«, dann wird der Vorschlag ausgeführt: »und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann und Weib schuf er sie.« Die biblische Geschichte wird dadurch noch kom­plizierter, daß Adam im zweiten Kapitel allein ist, bis Gott ihm ein weibliches Gegenstück gibt, erschaffen aus Adams Rippe. Es dürfte den Kreationisten schwerfallen zu entscheiden, welche Versi­on ihrem Dogma entspricht; außerdem gibt es noch das pluralistische Problem. Bei der Erschaffung des Menschen wird von einer Gruppe von mehreren Zuhörern gesprochen. Was geht da vor, mögen sich diejenigen fragen, die an die Bibel glauben. Wie die heutigen Orientalisten und Bibelforscher wissen, wurde der ursprüngliche Text in sumerischer Sprache verfaßt, und zwar in detail­lierterer Form. In diesem Text, den ich in meinem Buch Der zwölfte Planet ausführlich zitiere, 103 wird die Erschaffung des Menschen den Anunnaki zugeschrieben. Das geschah, weil die in den südafrikani­schen Goldminen arbeitenden Anunnaki die schwere Arbeit ver­weigerten. Enlil, der Oberbefehlshaber, und sein Vater Anu, der auf dem Planet Nibiru herrschte, beriefen eine Versammlung der führenden Anunnaki ein, die eine harte Bestrafung forderten. Aber Anu zeigte mehr Verständnis und sagte: »Ihre Arbeit ist schwer, der Mühsal zu­viel.« Ob es denn keine andere Möglichkeit geben würde, das Gold abzubauen? Da hatte sein zweiter Sohn Enki (Enlils Halbbruder und Rivale) einen glänzenden Gedanken. Man könne die Anunnaki von der unerträgli­chen Arbeit entlasten, wenn ein anderer sie übernähme: »Laßt uns einen einfachen Arbeiter erschaffen!« Die Idee gefiel den versammelten Anunnaki. Je länger sie darüber sprachen, desto einhelliger forderten sie einen Adamu, der die Last der Arbeit auf sich nehmen sollte. Aber wie, fragten sie, kann man ein Lebewesen erschaffen, das intelligent genug ist, mit Werkzeug umzu­gehen, und trotzdem Befehlen gehorcht? War das überhaupt möglich? In einem sumerischen Text ist die Antwort verewigt, die Enki den ungläubigen Anunnaki gab, die in der Erschaffung eines Adam die einzige Möglichkeit sahen, das Problem zu lösen: »Das Geschöpf, dessen Namen ihr genannt, es existiert. Wir müssen es nur mit dem Bild der Götter verbinden.« In diesen Worten liegt der Schlüssel zum Rätsel der Erschaffung des Menschen, ein Zauberstab, der den Streit zwischen Evolutionisten und Kreationisten zum Verschwinden bringt. Die Anunnaki – die Elohim in den biblischen Versen – erschufen den Menschen nicht aus dem Nichts. Das Lebewesen, das sie brauchten, gab es bereits auf der Erde, ein Produkt der Evolution. Sie mußten es nur auf eine höhere Stufe der Intelligenz und der Fähigkeiten heben, indem sie es mit dem Bild der Götter – mit ihrer geistigen und genetischen Beschaffenheit – ver­banden. Mit anderen Worten, sie mußten den bereits existierenden Menschenaffen durch genetische Manipulation geistig weiterentwickeln, um so den Menschen, den Homo sapiens, zu erschaffen. Das Wort »Adamu« ist als Name des ersten Menschen von der Bibel übernommen worden, auch das Wort »Bild« in seiner ursprünglichen Bedeutung. Diese Wörter sind aber nicht die einzigen Hinweise auf die Tatsache, daß die biblische Schöpfungsgeschichte sumerisch/mesopo­ tamischen Ursprungs ist. Auch die scheinbar unerklärliche Benutzung des Plurals bei Elohims Worten zeigt, daß man es mit einer Gruppe zu tun hat, die eine Entscheidung trifft. Wenn man die mesopotamischen Quellen als Grundlage nimmt, erhält alles, auch die nachfolgende Handlung, einen Sinn. Weiter wird erzählt, daß die Medizinerin Ninti auf Enkis Vorschlag hin mit der Durchführung des Planes beauftragt wurde: »Sie riefen die Göttin, die Hebamme der Mütter, baten sie: Du, Göttin der Geburt, schaffe Arbeiter! 104 Schaffe einen einfachen Arbeiter, der das Joch tragen soll! Laß den Arbeiter das Joch der Götter tragen!« Es läßt sich also mit Gewißheit sagen, daß die Verfasser der Genesis ihre kurze Darstellung den frühen sumerischen Texten entnommen haben. Hier aber haben wir den Grund, der zu dem Wunsch nach einem einfachen Arbeiter führte, haben die Versammlung der Götter, den Vorschlag und die Entscheidung, einen Menschen zu erschaffen. Erst wenn man die Quellen der Bibel kennt, begreift man, warum Elohim sagt: »Lasset uns einen Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei«, und weshalb es in der Genesis heißt: »Denn es war noch kein Mensch da, das Land zu bestellen.« Bevor die Bibel zur Genealogie und zur Geschichte Adams übergeht, wird der erste Mensch als »der Adam« bezeichnet, in Wirklichkeit also nicht mit einem Namen. Adam bedeutet nämlich wörtlich »der Erdling«, denn Adam hat dieselbe Sprachwurzel wie »Adamah«, das heißt »Erde«. Aber es ist auch ein Wortspiel, da »Darr« Blut bedeutet, und hängt mit der Art, wie Adam »fabriziert« wurde, zusammen. Das sumerische Wort für Mensch ist »Lu«. Es wurzelt aber keineswegs in dem Begriff eines Lebewesens, sondern in dem eines Arbeiters oder Dieners. Für das neugeschaffene Wesen wird in dem betreffenden Text – Atra Hasis – die Bezeichnung »Lulu« angewendet, die an eine Mischung beider Begriffe denken läßt. So bedeutet »Lulu« eigentlich »der Gemischte«. Auch darin tut sich die Erschaffung Adams, des Erdlings, kund. Man hat zahlreiche Tontafeln in mehr oder minder gutem Zustand gefunden, die von der Schöpfung handeln. Auch die Mythen anderer Völker in der Alten und Neuen Welt berichten von einem Prozeß, bei dem sich göttliche Elemente mit irdischen gemischt haben. Das göttli­che Element wird als »Essenz« des Blutes beschrieben und das irdische als Lehm. Zweifellos handelt es sich immer um dasselbe Thema, denn alle Schöpfungsgeschichten sprechen von einem »ersten Paar«, und ebenso zweifellos beruhen sie alle auf der sumerischen Darstellung, die am ausführlichsten und genauesten das wunderbare Geschehen be­schreibt: die Vermischung der »göttlichen« Gene der Anunnaki mit denen der Menschenaffen durch künstliche Befruchtung des Eies eines Menschenaffenweibchens. Ja, es war eine Befruchtung in vitro, wie die Abbildung eines Rollsiegels zeigt (Abb. 51). Heute ist es begreiflich: Adam war das erste »Retorten­baby«. Abb. 51 105 Es ist anzunehmen, daß Enki über die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung Bescheid wußte, als er vorschlug, durch genetische Mani­pulation einen einfachen Arbeiter zu erschaffen und Ninti mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die Fortsetzung der Geschichte vom Menschen auf Erden beginnt mit der Aufteilung der verschiedenen Aufgaben unter den führenden Anunnaki. Da die Rivalität zwischen den beiden Halbbrüdern Enlil und Enki gefährlich zu werden drohte, wurde die Herrschaft über die alten Niederlassungen und Arbeitsgebiete im Edin (im biblischen Garten Eden) Enlil übergeben, und Enki wurde nach Afrika geschickt, um den Abzu, dem Land der Goldminen, vorzustehen. Als großer Naturwissen­schaftler, der er war, dürfte Enki viel Zeit mit dem Studium der Flora und Fauna in seiner Umgebung verbracht haben, wohl auch mit dem der Fossilien, die dreihunderttausend Jahre später von den Paläontolo­gen in Südostafrika entdeckt wurden. Wie die heutigen Naturwissen­schaftler muß er über den Verlauf der Entwicklung auf Erden nachge­dacht haben, denn laut den sumerischen Texten gelangte er zu dem Schluß, daß die »Saat des Lebens« von Nibiru auf die Erde gebracht worden war, und zwar durch einen Zusammenstoß. Am meisten inter­essierte ihn sicher der Menschenaffe, ein Hominid, der über den ande­ren Primaten stand, der bereits aufrecht gehen konnte und scharfe Steine als Werkzeug benutzte, ein Prototyp des Menschen, aber noch kein vollentwickeltes Menschenwesen. Da hat sich Enki wohl heraus­gefordert gefühlt, »Gott« zu spielen, und genetische Experimente durch­geführt. Zu diesem Zweck bat er Ninti, nach Afrika zu kommen und ihm zur Seite zu stehen. Die Begründung war einleuchtend. Sie war die offiziel­le medizinische Beamtin; ihr Name bedeutet »Herrin des Lebens«, doch man nannte sie allgemein Mammi, abgeleitet von Mamma (Mut­ter). Natürlich brauchten die hart arbeitenden Minenarbeiter medizini­sche Versorgung. Aber es steckte noch mehr dahinter. Von Anfang an wetteiferten Enlil und Enki um ihre Gunst, denn beide brauchten einen Erben von einer Halbschwester, und das war Ninti. Alle drei waren Anus Kinder, des Herrschers von Nibiru, stammten aber von verschie­denen Müttern ab, und nach der Erbfolge der Anunnaki (die später von den Sumerern übernommen wurde und sich in der Geschichte der biblischen Erzväter widerspiegelt) mußte der erstgeborene Sohn von einer Halbschwester derselben edlen Linie abstammen, um rechtmäßi­ger Erbe werden zu können. Die sumerischen Texte beschreiben Enkis und Nintis zärtliche Schäferstündchen (die nicht zum erstrebten Ergeb­nis führten, denn alle Sprößlinge waren Mädchen). Enkis Vorschlag, Ninti nach Afrika kommen zu lassen, wurde also nicht nur der Wissen­ schaft halber vorgebracht. Immerhin müssen die beiden zahlreiche Experimente durchgeführt Abb. 52 106 haben, denn Abbildungen zeigen »Stiermenschen zusammen mit nack­ ten Affenmenschen« (Abb. 52), »Vogelmenschen« (Abb. 53), Sphinxe (Stiere und Löwen mit Menschenkopf), die viele alte Tempel schmück­ten und vielleicht nicht nur Phantasiegebilde sind. Der babylonische Priester Berossus, der für die Griechen eine sumerische Kosmogonie und Schöpfungsgeschichten verfaßte, schildert eine Periode vor der Entstehung des Menschen, in der Menschen mit zwei Flügeln, mit einem Körper und zwei Köpfen, mit männlichen und weiblichen Ge­ schlechtsteilen, mit Ziegenbeinen und -gehörn und andere MiAbb. 53 schungen existiert haben sollen. Daß all dies keine Mißbildungen der Natur, sondern das Ergebnis von Enkis und Nintis Experimenten waren, geht aus den sumerischen Tex­ten hervor. Danach brachten die beiden Lebewesen hervor, die weder männliche noch weibliche Geschlechtsorgane hatten, einen Mann, der seinen Urin nicht zurückhalten konnte, eine unfruchtbare Frau und solche, die zahlreiche andere Defekte aufwiesen. Schließlich soll Ninti betrübt gesagt haben: »Wie gut oder wie schlecht ist der Körper des Menschen? Wie mein Herz mir sagt, kann ich ihm ein gutes oder schlechtes Schicksal bescheren.« Nachdem alle Versuche fehlgeschlagen waren, sahen sie nur noch eine Möglichkeit, ihr Ziel zu erreichen: Anstatt mit den Erdgeschöpfen zu manipulieren, mußten sie die Eizelle der Affenmenschenfrau mit dem Sperma eines Anunnaki vereinen. Mit all ihrem Wissen machten sich die beiden Elohim daran, der Evolution vorzugreifen. Sicher wäre die Entwicklung auf der Erde fortgeschritten, wie es auf dem Nibiru ge­schehen war, aber welch unendlich lange Zeit erforderte das! Alle Lebewesen sowohl auf dem Nibiru als auch auf der Erde entstammen ja derselben »Saat des Lebens«, doch die Anunnaki waren den Geschöp­fen auf der Erde um Millionen Erdenjahre voraus. Kamen die Anunnaki der Entwicklung auf der Erde um eine oder zwei Millionen Jahre zuvor? Niemand vermag zu sagen, wie lange es gedauert hätte, bis der Homo sapiens sich auf natürliche Weise aus den Hominiden entwickelt haben würde, aber mit Millionen von Jahren müßte man wohl rechnen. Im sumerischen Text erklärt sich Enki bereit, den »Tät« zu beschaffen. Er ist abgeleitet von »dem, was Leben ist«. Dieses Wort bedeutet Lehm und Ei. Luther hat es mit »Erdenkloß« übersetzt; die Bearbeiter der Übersetzung haben daraus Erde und Staub gemacht. Der irdische Be­standteil, der mit dem Sperma und dem Blut eines jungen Anunnaki »gemischt« werden sollte, um beides zu verbinden, war also das Ei eines Menschenaffenweibchens, das Enki, wie der Text besagt, »von weiter oben« holen wollte, weiter nördlich vom Abzu. Das dürfte Südrhodesien, das heutige Zimbabwe, gewesen sein. Das Blut des Anunnaki wird mit »Teema« bezeichnet. Der Sinn dieses Wortes wird am besten mit »Persönlichkeit« wiedergegeben, doch damit wird man der wissenschaftlichen Bedeutung nicht gerecht, denn die genaue Über­setzung lautet: »Worin 107 das ist, was die Erinnerung bindet.« Heute sprechen wir von Genen. An anderer Stelle ist die Rede von »Kisru«, dem männlichen Glied, das in diesem Zusammenhang auch als Sperma zu deuten ist. Der Name des einfachen Arbeiters, »Lulu« (Gemischter, Mischling), rührt daher, daß die künstliche Vereinigung Abb. 54 von Ei und Sperma in den alten Texten als »Mischen« bezeichnet wird. Wir würden den Lulu heute als Hybride bezeichnen. Alle Prozeduren wurden unter strengen hygienischen Bedingungen vorgenommen. Es wird beschrieben, wie Ninki sich zuerst die Hände wusch. Das Gebäude – das Laboratorium, könnte man sagen – hieß »Haus, wo der Wind des Lebens eingeatmet wird«. Zweifellos ist daraus die biblische Darstellung entstanden, daß »Gott seinen lebendi­gen Odem Adam in die Nase blies«. Die Abbildung eines Rollsiegels zeigt Enki und Ninti bei ihrer Arbeit. Enki sitzt vor Ninti, die an ihrem Symbol, der Nabelschnur, zu erken­nen ist, hinter ihr stehen Flaschen, die als Retorten dienen (Abb. 54). Mit dem »Mischen« war das Verfahren noch nicht beendet. Das be­fruchtete Ei wurde in eine »Form« gelegt, in der die eigentliche Verbin­dung vor sich gehen sollte. Wie lange es darin blieb, wird nirgends gesagt. Es sollte danach in eine Gebärmutter eingepflanzt werden, aber nicht etwa in die der Spenderäffin, sondern in die einer »Göttin«, einer Anunnaki! Konnten Enki und Ninti sicher sein, daß sie nach all den Bemühungen und Irrtümern einen vollkommenen Lulu erschaffen würden, wenn sie das befruchtete Ei einer Anunnaki einpflanzten? Was, wenn diese ein Ungeheuer gebären würde? Setzte sie am Ende ihr Leben aufs Spiel? Nein, sie konnten nicht sicher sein. Ähnlich wie Wissenschaftler, die beim ersten Experiment sich selbst als Versuchsobjekt zur Verfügung stellen, ging Enki vor. Er verkündete den versammelten Anunnaki, daß seine Frau Ninki (Herrin der Erde) sich freiwillig angeboten hatte. Sie würde das Schicksal des Kindes bestimmen: »Ninki wird ihm das Bild der Götter aufprägen, und es wird ein Mensch sein.« Die Anunnakifrauen, die als Geburtsgöttinnen auserwählt wurden, sollten sich um sie kümmern. Es wurde, wie die Texte enthüllen, keine leichte Geburt: »Die Geburtsgöttinnen blieben beisammen. Ninti zählte die Monate. Der entscheidende zehnte Monat näherte sich, 108 der zehnte Monat kam. Die Zeit der Öffnung des Schoßes war vergangen.« Das Drama der Erschaffung des Menschen zeichnete sich offenbar durch eine Spätgeburt aus. Ein Eingriff war vonnöten. Als es Ninti klar wurde, was getan werden mußte, machte sie mit einem Instrument, dessen nähere Beschreibung auf dem Fragment der Tafel fehlt, eine Öffnung. »Das, was der Schoß enthielt, kam hervor.« Von Freude überwältigt, hob sie das Neugeborene in die Höhe, so daß alle es sehen konnten (Abb. 51), und rief frohlockend: »Ich habe erschaffen! Meine Hände haben es gemacht!« Der erste Adam war geboren. Der Erfolg der künstlichen Befruchtung bewies die Gültigkeit des Verfahrens, und er öffnete den Weg zur Wiederholung. Vierzehn Geburts­göttinnen wurden auf dieselbe Weise gleichzeitig geschwängert. Ver­mutlich kannten die Anunnaki bereits das Verfahren des Klonens, denn sie regelten die Geschlechtsbestimmung, um möglichst gleich viele Knaben und Mädchen hervorzubringen. Im Text heißt es, Ninki habe die vierzehn befruchteten Eizellen geteilt: »Sieben legte sie nach rechts, sieben legte sie nach links. Dazwischen legte sie die Form.« Die genetische Steuerung hatte Erfolg, denn auf einer anderen Tafel steht: »Die weisen und gelehrten doppelsieben Geburtsgöttinnen waren versammelt. Sieben gebaren Männer, sieben gebaren Frauen. Die Geburtsgöttinnen brachten den Wind des Lebensodems hervor.« Es besteht also kein Widerspruch zur biblischen Schöpfungsgeschichte: Zuerst wird Adam selbst erschaffen, in der nächsten Phase wurden männliche und weibliche Lulus erschaffen. Wie oft die »Massenproduktion« des einfachen Arbeiters fortgesetzt wurde, wird im Epos der Schöpfung nicht gesagt. In einem anderen Text wird folgendes berichtet: Die Anunnaki verlangten noch mehr, sie zogen schließlich von Edin (Mesopotamien) nach dem Abzu in Afrika und fingen viele Lulus ein, die die manuelle Arbeit in Mesopotamien verrichten mußten. Mit der Zeit war es Enki leid, ständig Geburts­göttinnen in Anspruch zu nehmen, und er nahm eine zweite genetische Manipulation vor, so daß die Hybriden selbst Nachwuchs erzeugen konnten (doch diese Entwicklung gehört ins nächste Kapitel). Wenn man bedenkt, daß diese alten Texte einen Zeitraum von Jahrtau­senden überbrückt haben, muß man die alten Schreiber bewundern, die die frühesten Texte vervielfältigten und übersetzten, ohne, wie man annehmen darf, wirklich zu wissen, was dieser oder jener Ausdruck und gar eine technische Bezeichnung zu bedeuten hatte, die aber stets der Tradition treu blieben, die eine genaue Wie109 dergabe verlangte. Zum Glück steht uns heute die moderne Wissenschaft bei. Wir kennen die Mechanismen der Zellteilung, die künstliche Befruch­tung, die Funktion der Gene – die Ursache vieler Erbkrankheiten und Defekte – und andere biologische Prozesse, vielleicht noch nicht vollständig, jedoch gut genug, um die alten Texte beurteilen und ihre Daten auswerten zu können. Wie werden nun in Anbetracht unserer Kenntnisse die alten Darstellungen eingeschätzt? Beruhen sie auf Phan­tasie, oder werden die beschriebenen Prozesse und Prozeduren von der modernen Wissenschaft bestätigt? Wir wissen heute, daß ein Lebewesen (sei es ein Baum, eine Maus oder ein Mensch), das »nach einem Bild« geschaffen werden soll, dieselben Gene haben muß, sonst kann etwas ganz anderes entstehen. Wir kennen die Chromosomen, die in jedem Zellkern vorhandenen fadenförmigen Gebilde, die das Erbgut transportieren, und wir wissen, daß sie die DNS enthalten. Wir wissen auch, daß Enzyme außerordentlich ge­schäftig sind: Sie lösen chemische Prozesse aus, lassen die RNS ihre Arbeit tun, erzeugen Eiweißstoffe, die Muskeln aufbauen, bewirken den Abbau der Bau- und Betriebsstoffe, übernehmen bei der Biokatalyse wichtige Funktionen und sind an der Verdauung und am Immunsystem beteiligt. Natürlich helfen sie auch bei der Erzeugung des Nachwuch­ses »nach einem Bild«. Der Begründer der Genetik ist der österreichische Botaniker und Mönch Gregor Johann Mendel (1822-1884), der in achtjährigen Kreuzungs­versuchen mit verschiedenen Erbsenrassen 1866 die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Vererbung, nach ihm die Mendelschen Gesetze genannt, entdeckte. Sie wurden fast vierzig Jahre lang nicht beachtet, fanden aber später in der Chromosomentheorie ihre Bestätigung. Als großer Fortschritt ist der Klon begrüßt worden. Darunter versteht man die Gesamtheit aller Einzelwesen, die durch vegetative Vermeh­rung aus einem Individuum hervorgegangen sind (also ungeschlecht­lich); sie sind tatsächlich erbgleich, denn sie haben alle dieselben Zellstrukturen, sind also genetisch identisch. Die Möglichkeiten des Klonens erforschte man mit Experimenten an Pflanzen, um das Veredeln durch ein fortschrittlicheres Verfahren zu ersetzen. Tatsächlich ist das Wort vom griechischen Klon abgeleitet, das heißt Zweig. Zuerst pflanzte man nur eine Zelle ein. Dann gelangte man zu einem Stadium, in dem man keine Empfängerpflanze mehr benötigte; man brauchte die gewünschte Zelle nur in einer Nährlösung wachsen zu lassen. In den 1970er Jahren erhoffte man sich Wälder, die so entstehen würden. Lauter identische Bäume einer bestimmten Art würden in einer Retorte wachsen und in einem Paket an den Bestim­mungsort versandt werden, wo man sie dann einpflanzen könnte. Die Erweiterung der Versuche von den Pflanzen auf die Tiere erwies sich als schwieriger. Erstens ist Klonen eine ungeschlechtliche Fort­pflanzung. Bei den höheren Lebewesen, die sich durch Befruchtung einer Eizelle fortpflanzen, unterscheiden sich Eizelle und Samenfaden von allen anderen Zellen dadurch, daß 110 die Geschlechtschromosomen, die Träger der Erbanlagen, nicht in doppelter, das heißt paarweise in gleicher Ausführung vorhanden sind, sondern nur einzeln. Beim be­fruchteten Ei des Menschen gibt es sechsundvierzig Geschlechts­ chromosomen; die erforderlichen dreiundzwanzig Paare stammen zur Hälfte von der Mutter und zur anderen Hälfte vom Vater. Beim Klonen müssen die Chromosomen der Eizelle chirurgisch entfernt und nicht etwa durch Sperma, sondern durch irgendeine andere Zelle ersetzt werden. Das ausgetragene Kind würde dann das vollkommene Eben­bild derjenigen Person sei, von dem die einzelne Zelle stammt. Es waren noch andere Schwierigkeiten zu beheben, allzu technischer Natur, um hier erklärt zu werden; aber sie wurden experimentell all­mählich überwunden, teils mit verbesserten Instrumenten, teils infolge neuer genetischer Erkenntnisse. Besonders interessant war die Feststel­lung, daß die Erfolgsaussichten um so größer waren, je jünger die eingepflanzte Zelle war. Im Jahr 1975 gelang es britischen Genetikern, Frösche mit Kaulquappenzellen zu klonen, indem sie die Eizellen des Froschweibchens durch eine Kaulquappenzelle ersetzten. Dabei arbei­tete man in mikrochirurgischen Bereichen. Vielleicht beruhte der Er­folg darauf, daß die fraglichen Zellen beträchtlich größer waren als zum Beispiel die des Menschen. 1980 und 1981 wurden in China Fische geklont. Auch mit Fliegen wurde experimentiert. Bei den Säugetieren experimentierte man mit Mäusen und Kaninchen, weil ihr Fortpflanzungszyklus sehr schnell verläuft. Schwierigkeiten bereitete dabei nicht nur die Komplexität ihrer Zellen und Zellkerne, sondern auch die Notwendigkeit, das befruchtete Ei in die Gebärmutter einzubringen. Bessere Ergebnisse wurden erzielt, als man das Ei nicht mehr chirurgisch entfernte, sondern durch Strahlung inaktivierte. Und noch bessere Ergebnisse erhielt man, als das Ei chemisch »abgetrie­ben« und auch die Ersatzzelle chemisch eingepflanzt wurde. Dieses Verfahren, das J. Derek Bromhall von der Oxford-Universität mit Kanincheneizellen entwickelte, wurde chemische Fusion genannt. Beim Klonen mit Mäusen ergaben sich Hinweise darauf, daß bei der Differenzierung des Eis, das heißt, sobald die Zelle bestimmte Körper­teile bildete, mehr Chromosomen vonnöten waren. Clement L. Markert, der in Yale experimentierte, schloß daraus, daß das Sperma außer den Chromosomen noch etwas anderes enthalten müsse, das diesem Prozeß Vorschub leistet und die Entwicklung der Eizelle anregt. Während Markert seine Forschungen weiter betrieb, verkündeten Peter C. Hoppe und Karl Illmensee, die im Jackson-Laboratorium in Bar Harbor (Maine) arbeiteten, 1977 die erfolgreiche Geburt von sieben identischen Mäu­sen. Die Forscher der A & M-Universität in Texas bewiesen, daß es möglich war, den Embryo eines Säugetiers (in diesem Fall eines Pavians) inner­halb einer fünftägigen Ovulation in die Gebärmutter einer anderen Äffin zu verpflanzen, wo er ausgetragen und in der Folge geboren wurde. Andere Forscher befaßten sich damit, kleinen Säugetieren Ei­zellen zu entnehmen und sie in vitro (im Glas) zu befruchten. Die beiden Prozesse – In-vitro-Befruchtung und Embryoverpflanzung – waren bei dem Ereignis eingesetzt worden, das im Juli 1978 medizini­ 111 sche Geschichte machte: Die Geburt von Louise Brown im Oldham and District General Hospital im Nordwesten von England. Als erstes vieler Retortenbabys wurde sie nicht von ihren Eltern gezeugt, sondern von Dr. Patrick Steptoe und Dr. Robert Edwards. Sie hatten neun Monate zuvor vom Eierstock der Mutter eine reife Eizelle abgesaugt, die in einer Nährlösung mit dem Sperma des Vaters gemischt wurde, wie Dr. Edwards sich ausdrückte. Nachdem die Befruchtung gelungen war, wartete man ab, bis das besamte Ei sich nach fünfzig Stunden in der Nährlösung zu einem Achtzeller entwickelt hatte, worauf es in die Gebärmutter der Mutter verpflanzt wurde. Die Schwangerschaft verlief normal, entbunden wurde durch einen Kaiserschnitt, und das Ehepaar freute sich über die Geburt einer gesun­den Tochter. »Wir haben ein Mädchen, und es ist vollkommen!« rief der Gynäkolo­ge, der den Kaiserschnitt vorgenommen hatte, und hielt das Kind in die Höhe. »Ich habe erschaffen, meine Hände haben es gemacht!« rief Ninti, nachdem sie vor einem Äon den Adam durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht hatte. Wie Enki und Ninti mußten die englischen Forscher einen langen Weg, der mit Fehlern und Irrtümern gepflastert war, zurücklegen. Erst als sie entdeckten, daß der Nährlösung Blutserum beigefügt werden mußte, kam der Durchbruch, der die Medienwelt in Aufregung versetzte (Abb. 55). Damit hatten sie genau dieselbe Technik wie Enki und Ninti angewendet. Das Ereignis gab zwar vielen Menschen neue Hoffnung, war aber nur entfernt vergleichbar mit Enkis und Nintis Meisterstück. Die verschlüs­selten alten Texte beschreiben dasselbe Verfahren und erwähnen auch, daß der Samenspender jung sein muß. Der offensichtlichste Unterschied besteht darin, daß bei der Erzeugung eines Abb. 55 112 Retortenbabys die natürliche Befruchtung nachgeahmt wird, wo­hingegen bei der Erschaffung des Adams das Erbgut von zwei verschie­denen Arten gemischt wurde, wodurch ein neues Lebewesen entstand, gewissermaßen ein Zwischengeschöpf. Die moderne Wissenschaft hat in den letzten Jahren wesentliche Fort­schritte bei der genetischen Manipulation gemacht. Mit immer ausge­klügelterer Ausrüstung konnten die Forscher den genetischen Code der lebenden Organismen, auch des Menschen, ablesen. Es wurde nicht nur möglich, die Buchstaben des DNS und des genetischen »Alphabets« sowie die des genetischen Kodes zu lesen, sondern auch zu erkennen, welche Verknüpfungen die genetische Funktion der DNS bewirken und zum Beispiel die Augenfarbe, das Wachstum und Erbkrankheiten be­stimmen. Zudem haben die Wissenschaftler herausgefunden, daß die Kodewörter dazu dienen, den Reproduktionsprozeß zu befehligen, das heißt, wann er beginnen und wann er aufhören soll. Nach einiger Zeit konnten sie den Kode einem Computer eingeben und die Anfangs- und Endzeichen feststellen (Abb. 56), nicht zuletzt dank der Computer­grafik. Der nächste Schritt bestand darin, die Funktion eines jeden Gens herauszufinden. Die Bakterie E. coli hat ungefähr viertausend Gene, der Mensch verfügt über hunderttausend. Heute ist man damit beschäf­tigt, das Genom des Menschen aufzustellen, das heißt die Summe aller auf den Chromosomen angeordneten Gene. Das ungeheure Ausmaß dieser Aufgabe und das des bereits gewonnenen Wissens kann man an folgendem Denkmodell ermessen: Wenn die DNS aller Zellen des Menschen in eine Schachtel gelegt würde, bräuchte die Schachtel nicht größer als ein Eiswürfel zu sein; aber wenn die verknüpften faden­ förmigen Kettenmoleküle ausgestreckt würden, hätten sie eine Ge­samtlänge von siebzig Millionen Kilometern. Trotz dieser Komplexität ist es möglich, mit der Hilfe von Enzymen ein Gen zu entfernen und durch ein fremdes zu ersetzen, um auf diese Weise eine unerwünschte Eigenschaft (die zum Beispiel eine Krankheit verursacht) auszumerzen oder eine erwünschte (etwa wachstumsför­ dernd) einzuführen. Für die Fortschritte im Verständnis und Manipulie­ ren der grundlegenden Körperchemie Abb. 56 113 wurden 1980 Walter Gilbert an Harvard, Paul Berg von der Universität Stanford und Frederick Sanger von der Universität Cambridge mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ihnen ist es zu verdanken, daß man das genetische Material durch Rekombination bis zu den einfachen Bausteinen hinab analysieren und behandeln kann. Daraus hat sich die Gentherapie entwickelt, ferner das biogenetische Verfahren, das dazu dient, durch genetische Manipulation Medikamen­te (etwa Insulin) herzustellen. Die Rekombinationstechnik ist möglich, weil sich die DNS in allen lebenden Organismen auf dieselbe Weise zusammensetzt, was beweist, daß alle Lebewesen auf der Erde – Menschen, Fliegen, Würmer, Hühner und Frösche – gleichen Ur­sprungs sind. Hybride nennt man die durch geschlechtliche Kreuzung entstandene Nachkommenschaft von Eltern, die verschiedenen Arten angehören, wie zum Beispiel Maultier und Maulesel, die Bastarde von Pferd und Esel. Sie können entstehen, weil sie dieselben Chromosomen haben, können sich aber nicht fortpflanzen. Schaf und Ziege, obwohl ander verwandt, paaren sich nicht; doch mitein­ infolge ihrer genetischen Verwandtschaft ist es Abb. 57 gelungen, experimentell einen Bastard zu »er­ schaffen«, der die Behaarung eines Schafes und das Gehörn einer Ziege hat (Abb. 57). Derartige Mischlinge werden Chimären genannt (nicht zu verwechseln mit Schimären = Hirngespinste), nach dem Ungeheuer der griechischen Sage, das den Oberkörper eines Löwen, den Körper einer Ziege und den Schwanz einer Schlange hat (Abb. 58). Es besteht kein Zweifel, daß die Ungeheuer der griechischen Sage, darunter der berühmte Minotaurus (halb Stier, halb Mensch), auf den von Berossus Abb. 58 überlieferten Geschichten beruhen. Seine Quellen waren bekanntlich die sumerischen Texte, die schildern, was für Chimären Enki und Ninti bei ihren Experimenten hervorbrachten. Die Fortschritte in der Genetik haben nicht nur zu den un­vorhersehbarsten Ergebnissen der Biotechnik, den Chimären, geführt, sondern die moderne Wissenschaft hat natürlich auch den gleichen Weg wie Enki und Ninti eingeschlagen. Mit der Rekombinationstechnik lassen sich vorsätzlich Eigenschaften ausmerzen, vertauschen und er­zielen. So kann man Pflanzen auf diese Weise resistent gegen be­stimmte Krankheiten machen. 1982 verpflanzten Genetiker von der University of Pennsylvania unter der Leitung von Ralph L. Brinster und vom Howard Hughes Medical Institute unter der Leitung von Richard D. Palmiter das Wachstumsgen einer Ratte in den genetischen Code einer Maus, worauf eine Riesenmaus von der doppelten Größe einer normalen Ratte entstand. 1985 wurde 114 in Nature (27. Juni) berichtet, daß es in verschiedenen Laboratorien gelungen sei, funktionierende menschliche Wachstumsgene in Kaninchen, Schweine und Schafe zu verpflanzen, und 1987 schufen schwedische Wissenschaftler einen Riesenlachs (New Scientist, 17. Juni). Bei Säugetieren muß die veränderte befruchtete Eizelle in die Gebär­mutter einer Ersatzmutter eingepflanzt werden. Laut den sumerischen Texten übernahmen die »Geburtsgöttinnen« diese Funktion. Aber vor­her muß die gewünschte genetische Eigenschaft des männlichen Spen­ders der Eizelle eingeimpft werden. Gewöhnlich geschieht das in vitro. Nach kurzer Inkubationszeit wird die Verpflanzung in die Gebärmutter vorgenommen. Die Prozedur ist schwierig – viele Hindernisse müs­sen überwunden werden, und der Prozentsatz der Erfolge ist klein –, aber die Sache funktioniert. Man hat es auch mit Viren versucht, die natürliche Zellen angreifen und mit dem Kern verschmelzen, die neue Eigenschaft wird auf komplizierte Weise dem Virus übertragen, das dann als Träger dient; aber dabei besteht das Problem darin, daß sich nicht bestimmen läßt, wie die Gene auf den Chromosomen angeordnet sind, und bisher sind fast nur Chimären entstanden. Im Juni 1989 meldete eine Gruppe italienischer Genetiker, die vom Corrado Spadafora (Institut für biomedizinische Technik in Rom) geleitet wurde, einen Erfolg: Sie hatten Sperma als Träger des neuen Gens benutzt, nachdem ihm sein natürlicher Widerstand gegen fremde Gene durch ein bestimmtes Verfahren genommen worden war. Es kam in eine Lösung, das die neuen Gene enthielt, die in die Zellkerne eindrangen. Mit dem veränderten Sperma wurden Mäuse geschwän­gert. Die Chromosome der Nachkommenschaft enthielten tatsächlich das neue Gen (in diesem Fall ein bestimmtes bakterielles Enzym). Die Benutzung des natürlichsten Mittels, nämlich Sperma, erstaunte die Wissenschaftler wegen der Einfachheit des Verfahrens und machte Schlagzeilen auf der ersten Seite der New York Times und anderer Zeitungen. Aber dann meldete Science am 11. August einige Fehlschlä­ge von anderen Forschern, die es den Italienern gleichgetan hatten, und es mußten weitere Versuche unternommen werden. Doch nach etlichen Modifikationen und Verbesserungen hatte sich eine neue Technik ent­wickelt, die als einfachste und natürlichste anzusehen ist. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Fähigkeit des Spermas, fremde DNS aufzunehmen, bereits 1971 von Forschern entdeckt worden war, und zwar bei Experimenten mit Kaninchen. Kaum jemand wußte, daß gerade diese Technik noch früher beschrieben worden ist, nämlich im sumerischen Epos der Schöpfung, in dem geschildert wird, wie Enki und Ninti bei der Erschaffung des Adams die Eizelle eines Men­schenaffenweibchens mit dem Sperma eines jungen Anunnakis in einer Lösung mischten, die auch Blutserum enthielt. Im Jahr 1987 entfachte der Dekan der anthropologischen Fakultät in Florenz bei Geistlichen und Humanisten einen Sturm der Entrüstung, als er enthüllte, die dortigen Experimente könnten zur »Erschaffung einer ganz neuen Sklavenrasse führen, eines Anthropoiden, der eine Schimpansenmutter und einen Menschenvater hat«. Einer meiner Leser schickte mir den betreffenden Zeitungsausschnitt und bemerkte 115 dazu: »Siehst Du wohl, Enki, genau wie Du.« Das dürfte die Errungenschaften der modernen Mikrobiologie am be­sten zusammenfassen. Wespen, Affen und biblische Patriarchen Vieles von dem, was auf der Erde geschah – und besonders die ersten Kriege –, beruhte auf dem Erbfolgegesetz der Anunnaki, demzufolge dem erstgeborenen Sohn die Nachfolge versagt blieb, wenn dem Herrscher von einer Halbschwester ein zweiter Sohn geschenkt wurde. Dieses Erbfolgegesetz, das von den Sumerern übernommen wur­de, spiegelt sich in den Geschichten von den hebräischen Patri­archen. Die Bibel erzählt, wie Abraham, der von der sumeri­schen Hauptstadt Ur gekommen war, seine Frau Sara (Prinzes­sin) bat, sich bei der Begegnung mit fremden Königen lieber als seine Schwester und nicht als sein Weib auszugeben. Das war keine Lüge, denn Abraham erklärt es selbst dem König Abime­lech: »Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, so konnte sie mein Weib werden.« Abrahams Nachfolger wurde nicht sein erstgeborener Sohn Ismael, dessen Mutter die Magd Hagar war, sondern Isaak, der viel später geborene Sohn von der Halbschwester Sara. Die strikte Befolgung dieses Erbfolgegesetzes, das an allen alten Königshöfen galt, sowohl im Ägypten der Alten Welt als auch im Reich der Inkas in der Neuen Welt, scheint unvereinbar mit der Annahme zu sein, daß von der Heirat unter nahen Verwand­ten abzuraten sei. Wußten die Anunnaki am Ende etwas, was die moderne Wissen­schaft erst noch entdecken muß? Im Jahr 1980 fanden Hannah Wu und ihre Mitarbeiter von der Universität Washington heraus, daß Äffinnen, wenn sie die Wahl haben, ihre Halbbrüder bevorzugen. »Besonders interessant dar­an ist«, heißt es in dem Bericht, »daß die bevorzugten Halbbrü­der immer denselben Vater, jedoch eine andere Mutter haben.« In der Zeitschrift Discover (Dezember 1988) hieß es, Studien hätten ergeben, daß »Wespenmännchen sich gewöhnlich mit ihren Schwestern paaren«. Da die Wespenmännchen etliche Weib­chen befruchten, entstehen viele Halbschwestern, die denselben Vater, aber jeweils eine andere Mutter haben. 116 9 Die Mutter namens Eva Wenn man den hebräischen Wörtern in der Bibel zu ihrem akkadischen und sumerischen Ursprung nachspürt, ist es möglich, den wahren Inhalt der biblischen Geschichten zu verstehen, besonders den der Schöpfungsgeschichte. Da so viele sumerische Wörter mehr als eine Bedeutung haben, die meistens aber nicht immer von ein und demsel­ben Piktogramm abgeleitet sind, muß man den Text sorgfältig im Zusammenhang lesen, sonst ist es schwer, Sumerisch zu verstehen. Andererseits macht die Neigung der sumerischen Schreiber, sich häu­fig in Wortspielen zu ergehen, das Lesen zu einem Vergnügen. Bei der Schilderung der »Emporschleuderung« von Sodom und Gomorrha in meinem Buch Die Kriege der Menschen und Götter weise ich darauf hin, daß Lots Frau angeblich zu einer »Salzsäule« erstarrte, als sie stehenblieb, um zurückzuschauen und zu sehen, was hinter ihr geschah. In Wirklichkeit aber wurde sie zu einer »Dampfsäule«. Da die Sumerer durch Verdampfung der Sümpfe Salz gewannen, bedeutete in ihrer Sprache »Nimur« sowohl Salz als auch Dampf. Die arme Frau verdampfte in dem Luftdruck der atomaren Explosion, mit der die Städte auf der Ebene zerstört wurden, zu Salz wurde sie gewiß nicht. Was nun die biblische Geschichte von Eva betrifft, so erklärte der bedeutende Sumerologe Samuel N. Kramer als erster, daß ihr Name, der auf Hebräisch »Sie, die Leben hat« bedeutet, und daß die Erklä­rung, Eva sei aus Adams Rippe geschaffen worden, wahrscheinlich auf ein sumerisches Wortspiel zurückzuführen ist: Ti bedeutet sowohl Le­ben als auch Rippe. Einige Übersetzungsfehler oder Doppelbedeutungen wurden bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt. In bezug auf Eva und ihre Ursprünge findet man noch mehr, wenn man die biblischen Texte mit dem sumerischen Text vergleicht und die sumerische Terminologie analysiert. Enki und Ninti nahmen ihre genetischen Manipulationen in einem Gebäude vor, das in der akkadischen Version Bit Schimti heißt, »Haus, in dem der Wind des Lebens eingeatmet wird«. Das vermittelt eine Vorstellung davon, wozu dieses Laboratorium diente. Das akkadische Wort ist aus dem Sumerischen entlehnt, dem zusam­ mengesetzten Wort Schi Im Ti. »Schi« steht für das hebräische Wort »Nephesch«, das gewöhnlich mit »Seele« übersetzt wird, aber »Atem des Lebens« bedeutet. »Im« hat mehrere Bedeutungen, je nach dem Zusammenhang, »Wind« oder »Seite«. In der astronomischen Termino­logie bezeichnete es einen Satelliten »an der Seite« eines Planeten, in der geometrischen die Seite eines Quadrats oder Dreiecks, im anatomi­schen Zusammenhang eine Rippe. Noch heute bedeutet das entspre­chende hebräische Wort »Tzela« sowohl die Seite einer geometrischen Figur als auch die anatomische Rippe. Und siehe da, »Im« hat noch eine ganz andere Bedeutung, nämlich Lehm ... 117 Als ob die dreifache Bedeutung von »Im« – Seite/Rippe/Lehm – nicht genügte, kommt noch »Ti« hinzu. Es bedeutet, wie schon er­wähnt, sowohl Leben als auch Rippe, verdoppelt – Ti Ti – jedoch Bauch (in dem der Fötus ist), und im Akkadischen wurde daraus »Titu«, das heißt Lehm, woraus das heute im Hebräischen gebräuchli­che »Tit« entstanden ist. So ist der sumerische Name des Laboratori­ ums aus vielerlei Bedeutungen zusammengesetzt. Da die ursprüngliche sumerische Version der Genesis, nach der die Verfasser der Bibel ihre Übersetzung hergestellt haben, nicht vorliegt, läßt sich nicht bestim­men, ob sie das Wort »Rippe« gewählt haben, weil es sowohl »Im« als auch »Ti« entspricht oder weil damit eine soziale Aussage gemacht werden konnte, die in den folgenden Versen ihren Ausdruck findet: »Da ließ Jahwe Elohim einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schloß die Stätte zu mit Fleisch. Und Jahwe Elohim baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin heißen (im Hebräischen ›Ischscha‹ = Weib), darum daß sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib hangen, und sie werden sein ein Fleisch.« Diese Geschichte von der Erschaffung der Frau als Ergänzung des Mannes besagt, daß der Adam, der bereits in den »Edin« versetzt worden war, damit er den Garten und die Obstbäume bearbeiten und pflegen sollte, ganz allein war. »Und Jahwe Elohim sprach: Es ist nicht gut, daß der Adam allein ist. Ich will ihm eine passende Gefährtin machen.« Das entspricht offenbar der Version, nach der der Adam allein erschaffen wurde, nicht aber einer anderen Version, daß Mann und Frau gleichzeitig erschaffen wurden. Um diesen Widerspruch zu klären, muß man bedenken, in welcher Reihenfolge die Erdlinge geschaffen wurden. Zuerst wurde der Lulu, der »Gemischte«, vervollkommnet; dann wurden die befruchteten Ei­zellen der Affenmenschfrauen in zwei Gruppen eingeteilt und in eine »Form« gelegt, in der sie entweder männliche oder weibliche Eigen­schaften annahmen. Nach der Einpflanzung in die Gebärmutter einer Geburtsgöttin entstanden jeweils sieben Knaben und sieben Mädchen. Aber das waren Hybriden, die sich nicht fortpflanzen konnten. Um mehr Lulus zu erhalten, mußte das Verfahren immerzu wiederholt werden. Schließlich hatte man dieses mühsame Verfahren satt, und es mußte die Möglichkeit gefunden werden, mehr Menschen auf die Welt zu brin­gen, ohne die Hilfe der weiblichen Anunnaki in Anspruch zu nehmen. Das wurde mit einer 118 zweiten genetischen Maßnahme erreicht, die bewirkte, daß die Erdlinge sich selbst fortpflanzen konnten. Um Kinder zu bekommen, mußte der Adam sich mit einem ebenbürtigen Weib vereinigen. Wie und warum es erschaffen wurde, das ist der Inhalt der Geschichte von der Rippe und dem Garten Eden. Die Geschichte von der Rippe kommt einem vor, wie ein in zwei Sätzen zusammengefaßter Bericht einer medizinischen Zeitschrift. Unumwun­den beschreibt sie einen größeren Eingriff, der heute Schlagzeilen macht, wenn zum Beispiel ein Blutsverwandter ein Organ spendet. In zunehmendem Maße nimmt man heute Verpflanzungen von Knochen­mark vor, wenn Krebs oder eine Schwächung des Immunsystems diagnostiziert wurde. In der Bibel ist Adam der Spender. Es wird eine Rippe entfernt. Die Wunde wird mit Fleisch geschlossen, und Adam kann sich von der Operation erholen. Aber damit ist das Werk noch nicht getan. Elohim formt nun aus dem Knochen eine Frau (nur von Luther richtig übersetzt, sonst als »mach­te« oder »bildete«). Der terminologische Unterschied ist bedeutsam; sie wird nicht geschaffen, sondern geformt, aufgebaut. Damit wird angedeutet, daß sie bereits existiert, aber konstruktiver Manipulation bedarf, um eine passende Gefährtin für Adam zu werden. Was dazu nötig war, erhielt sie von der Rippe. Der springende Punkt ist jedoch, daß »Im« und »Ti« auch noch Leben, Bauch und Lehm bedeuten. Wurde das Mark von Adams Knochen durch den Bauch in den »Lehm« einer einfachen Arbeiterin transplantiert? Leider sagt die Bibel nicht, was mit der Frau, der Adam den Namen Eva gibt, geschehen ist, und die sumerischen Texte, die ihre Geschichte schildern, sind bisher noch nicht gefunden worden. Nur auf einer Scherbe der assyrischen Überset­zung der Atra Hasis (aus der Zeit um 850 v. Chr.) kommen Zeilen vor, die insofern mit der biblischen Geschichte übereinstimmen, als sie besagen, daß der Mann das Haus seines Vaters verlassen muß, und daß Mann und Frau ein Fleisch werden, wenn sie zusammen im Bett liegen. Aber dank der modernen Wissenschaft weiß man heute, daß Sexualität und die Fähigkeit der Fortpflanzung in den Chromosomen verankert sind. Beim Mann sind die Geschlechtshormone formverschieden oder unpaarig (XY Chromosomen), bei der Frau paarig (XX-Chromoso­ men) (Abb. 59). Die Geschlechtszellen (bei der Frau das Ei, beim Mann das Sperma) enthalten aber nur einen Satz Chromosomen, nicht paarweise angeord­nete. Abb. 59 119 Die Paarung ergibt sich bei der Befruchtung der Eizelle, so daß der Embryo die dreiundzwanzig Chromosomenpaare erhält, die zur einen Hälfte von der Mutter, zur anderen vom Vater stammen. Die Mutter, die zwei X-Chromosomen hat, fügt immer ein X hinzu. Der Vater, der sowohl X als auch Y hat, kann nur das eine oder das andere hinzufügen; wenn es ein X ist, wird das Kind ein Mädchen sein, wenn es ein Y ist, ein Knabe. Insofern wird das Geschlecht vom Vater bestimmt. Der Schlüssel zur Fortpflanzung liegt also in der Fusion der beiden Chromosomensätze. Wenn Anzahl und genetischer Kode verschieden sind, vereinigen sie sich nicht, es kommt zu keiner Zeugung. Da es den männlichen und weiblichen einfachen Arbeiter bereits gab, beruhte die Sterilität der Lulus nicht auf einem Mangel an X- oder Y-Chromoso­men. Die Notwendigkeit eines »Knochens« – in der Bibel heißt es, Eva sei aus Knochen von Adams Knochen – besagt, daß bei den Lulus eine immunologische Abstoßung des Spermas vorlag. Elohim überwindet die Schwierigkeiten mit irgendeiner Maßnahme. Adam und Eva ent­decken ihre Sexualität, sie sind »wissend« geworden: »Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie empfing und gebar Kain.« Eva kann also von jetzt an von Adam geschwängert werden, nachdem sie von der Gottheit den Segen erhalten hat, der allerdings mit einem Fluch verbun­den ist: »Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären.« Damit sei Adam, sagt Elohim, »wie einer von uns« geworden. Es ist ihm »Wissen« verliehen worden. Der Homo sapiens konnte sich fort­pflanzen und sich vermehren. Aber obwohl ihm ein Teil der geneti­schen Eigenschaften der Anunnaki mit auf den Weg gegeben wurde, nach deren Bild er erschaffen war, blieb ihm doch eine genetische Eigenschaft versagt, und das war die Langlebigkeit der Anunnaki. Von der Frucht des »Lebensbaumes«, die ihn so alt hätte werden lassen wie die Anunnaki, durfte er nicht kosten. Das besagen die sumerischen Texte von der Erschaffung des vollkommenen Menschen durch Enki klar und deutlich: »Großes Verständnis vervollkommnete er für ihn ... Weisheit hatte er ihm verliehen. Ihm hatte er Wissen gegeben; ewiges Leben hat er ihm nicht gegeben.« Die Unsterblichkeit ist natürlich das Ergebnis unterschiedlicher Lebens­zyklen. Der Mensch lebt soundso viele Jahrzehnte; manche Fliegen­arten zählen ihr Dasein nach Tagen. Aber was besagen alle diese Ausdrücke eigentlich? Ein Tag ist die Zeit, in der sich unser Planet um die eigene Achse dreht; ein Jahr dauert es, bis er seinen Umlauf um die Sonne vollendet hat. Die Dauer der Anwesenheit der Anunnaki auf der Erde wurde in der Einheit »Sar« gemessen, und zwar entspricht ein Sar dreitausendsechshundert Erdenjahren. Der Sar war auf dem Nibiru der Zeitraum seines Umlaufs um die dortige Sonne. Wenn es also in den sumerischen Königslisten heißt, dieser oder jener Anunnaki habe sechs­ unddreißigtausend Jahre in einer Stadt geherrscht, so sind zehn Sars gemeint. Eine Menschengeneration, die wir auf zwanzig Jahre berech­nen, entspricht hun120 dertachtzig Menschengenerationen in einem Anunna­ki-Jahr, so daß diese also scheinbar ewig leben, sozusagen unsterblich sind. Die alten Texte erklären, daß diese Langlebigkeit nicht auf die Men­schen übertragen wurde, wohl aber die Intelligenz. Das legt den Gedan­ken nahe, daß man in alter Zeit glaubte oder wußte, die zwei Eigenschaften Intelligenz und Langlebigkeit könnten dem Menschen von seinem genetisch überlegenen Schöpfer vorsätzlich verliehen oder vor­enthalten werden. Die moderne Wissenschaft bejaht dies, was nicht verwunderlich ist. »Seit sechzig Jahren häufen sich die Beweise, daß es für Intelligenz eine genetische Komponente gibt«, konnte man im März 1989 im Scientific American lesen. Abgesehen von Beispielen von Künstlern, deren Kinder oder Enkel dasselbe Talent geerbt hatten, enthielt der Artikel vor allem einen Bericht der Genforscher David W. Fulker, John C. DeFries und Robert Plomin. Sie hatten bei besonderen geistigen Fähigkeiten, die genetischer Vererbung zuzuschreiben waren, eine »nahe biologische Wechselbeziehung« festgestellt. Der Artikel trug den Titel: Wieder ein Beweis für den Zusammenhang zwischen Genen und Intelligenz. Andere Studien, die ergaben, daß »Erinnerun­ gen aus Molekülen bestehen«, legten den Gedanken nahe, daß Compu­ter, die menschlicher Intelligenz vergleichbar sein sollten, Molekularcomputer sein müßten. Weitere Vorschläge in dieser Richtung legten andere Forscher mit dem Entwurf eines biologischen Computers vor (Science, Bd. 241). Für den genetischen Ursprung der Lebenszyklen aller lebenden Orga­nismen wurden ebenfalls Beweise vorgebracht. Die verschiedenen Ent­wicklungsstadien der Insekten und ihre Lebensdauer sind genetisch vorprogrammiert, auch das Phänomen, daß viele Lebewesen – Säuge­tiere ausgenommen – nach der Paarung sterben. Zum Beispiel fand Jerome Wodinsky von der Brandeis-Universität heraus, daß Kraken nach der Paarung sozusagen Selbstmord begehen, und zwar durch ein Gift in ihrer Sehdrüse, da sie genetisch entsprechend programmiert sind. Jedes Lebewesen hat eine durch die Gene festgesetzte Lebensdau­er; bei der Eintagsfliege beträgt sie, wie schon der Name sagt, einen Tag, beim Frosch rund sechs Jahre, beim Hund etwa fünfzehn Jahre. Beim heutigen Menschen liegt die Lebenserwartung bei neunzig Jah­ren, aber in früherer Zeit war die Lebensdauer des Menschen viel länger. Laut der Bibel lebte Adam neunhundertdreißig Jahre, sein Sohn Seth neunhundertzwölf und dessen Sohn Enos neunhundertfünf. Es besteht allerdings Grund zu der Annahme, daß die Bearbeiter der Genesis die Daten der Sumerer durch sechzig teilen; dennoch wird in der Bibel betont, daß die Menschen vor der Sintflut eine viel längere Lebenser­wartung hatten. Mit der Zeit verkürzte sie sich. Tera, Abrahams Vater, wurde zweihundertfünf Jahre alt. Abraham selbst lebte hundertfünf­undsiebzig Jahre, sein Sohn Jakob hundertvierundsiebzig, aber Jakobs Sohn Joseph starb im Alter von hundertzehn Jahren. Man nimmt zwar an, daß genetische Fehler, die während der Vermeh­rung der DNS in den Zellen entstehen, den Alterungsprozeß beschleu­nigen können, doch bei allen Lebewesen bestimmt eine biologische »Uhr« mit eingebautem Gen den Ablauf der Lebensspanne. Wie dieses Gen oder diese Gengruppe beschaffen ist 121 und wie es funktioniert, das ist immer noch Gegenstand intensiver Forschung. Enki muß das alles gewußt haben; denn als er den Homo sapiens schuf, verlieh er ihm, um ihn zu vervollkommnen, Intelligenz und Wissen, aber nicht die Langlebigkeit, die die Gene der Anunnaki bewirkten. Während sich der Mensch von der Zeit seiner Erschaffung als »Lulu« – als ein »Mischling« mit dem genetischen Erbe von Himmel und Erde – immer mehr entfernte, verlor er nicht nur von Generation zu Generation einen Teil seiner Langlebigkeit, sondern er büßte auch seine göttlichen Elemente ein, während das »Tier in uns« mehr und mehr die Oberhand gewann. Unsere genetische Beschaffenheit änderte sich – Bestandteile der DNA erfüllten nicht mehr ihren Zweck –, aber die DNS an sich blieb offenbar von der ursprünglichen »Mi­schung« übrig. Die beiden unabhängigen, wenn auch miteinander ver­bundenen Hälften unseres Großhirns, die ganz verschiedenen Zwecken dienen, bezeugen den gemischten genetischen Ursprung des Men­schen. Die Übereinstimmung aller alten Schöpfungsgeschichten findet aber bei der genetischen Manipulation nicht ihr Ende. Es kommt noch mehr, und zwar handelt es sich um Eva. Die moderne Anthropologie (Lehre von der Entstehung des Menschen) hat dank den Funden von Versteinerungen in der Rückverfolgung zum Ursprung des Menschen große Fortschritte gemacht. Die Frage »Wo­her sind wir gekommen?« hat eine klare Antwort gefunden: aus Südost­afrika. Die Geschichte des Menschen – das wissen wir jetzt – beginnt nicht mit dem Menschen, sondern das Kapitel »Primaten« (Herrentiere) führt uns um vierzig bis fünfzig Millionen Jahre zurück, in eine Zeit, wo der gemeinsame Urahn der Menschen und Affen in Afrika lebte. Etwa dreißig Millionen Jahre später – so langsam drehen sich die Räder der Evolution – zweigte ein Vorläufer der großen Affen vom Primatenstamm ab. In den 1920er Jahren fand man auf einer Insel im Victoria-See (siehe Landkarte) zufällig Versteinerungen dieser Vorform, worauf sich Louis und Mary Leakey, das bekannteste Forscher­ehepaar, dorthin begaben. Außer den genannten Fossilien entdeckten sie in dem Gebiet Überreste des Ramapithecus, des ersten auf­rechtstehenden Affen oder menschenähnlichen Primaten. Sein Alter wurde auf vierzehn Millionen Jahre geschätzt, also etwa acht bis zehn Millionen Jahre weiter oben auf dem Stammbaum des Vorgängers. Damit wurden mehr als nur ein paar Versteinerungen ausgegraben; diese Entdeckungen öffneten die Tür zum Geheimlaboratorium der Natur, dem Versteck, wo Mutter Natur die Entwicklung vom Primaten über den großen Affen zum Hominiden vorangetrieben hat. Es ist das verzweigte Tiefland, das sich durch Äthiopien, Kenia und Tansania hinzieht; eine Abzweigung beginnt beim Jordantal und beim Roten Meer in Israel, führt am Roten Meer vorbei und verläuft bis Südafrika (Landkarte, Abb. 60). Zahlreiche Fossilienfunde haben die Gegend berühmt gemacht. Die meisten Funde ergaben sich in dem Olduvai-Tal in Tansania in der Nähe des RudolfSees (jetzt Turkana-See), in Kenia und in der äthiopi­schen Provinz Afar, um nur 122 Abb. 60 die bekanntesten Orte zu nennen. Viele Forscher verschiedener Nationen waren an den Ausgrabungen betei­ligt; wenigstens einige sollen in Anbetracht der bedeutenden Funde hier erwähnt werden: Richard Leakey, der Sohn des Ehepaars Leakey (Kurator der staatlichen Museen in Kenia), Donald C. Johanson (da­mals Kurator des Naturhistorischen Museums von Cleveland), Tim White und J. Desmond Clark (Universität Berkeley), Alan Walker (Johns-Hopkins-Universität), Andrew Hill und David Pilbeam von Har­vard sowie die Südafrikaner Rayomud Dart und Phillip Tobias. Lassen wir die verschiedenen Deutungen der Funde, die Aufteilung in Arten und Unterarten hier beiseite; nur soviel sei gesagt: Der Zweig, der zur Entstehung des Menschen führte, trennte sich vom Stamm der vierbeinigen Affen vor ungefähr vierzehn Millionen Jahren, und da­nach dauerte es noch etwa neun Millionen Jahre, bis der erste Affe mit hominiden Zügen sich entwickelt hatte, von Dart Australopithecus genannt. Zwar sind die Seiten des Berichts von den Funden, was diese zehn Millionen Jahre betrifft, leer, aber die Paläoanthropologen (das ist die Bezeichnung 123 für dieses neue Gebiet der Anthropologie) haben es fer­ tiggebracht, den Bericht über die folgenden drei Millionen Jahre zu­ sammenzusetzen. Mit spärlichen Funden, da einem Kieferknochen, dort einem zerbrochenen Schädel, einem Beckenknochen, Überresten von Fingern oder gar Skelettresten, konnte manches Lebewesen rekon­ struiert werden. Durch andere Funde wie grobgeformte Steinwerk­ zeuge konnten das Entwicklungsstadium und die Gebräuche der Lebe­wesen Abb. 61 nachvollzogen werden. Auch die Gesteinsformation der Fossili­en lieferte Hinweise auf das Datum. Berühmt wurde das zusammengesetzte Skelett einer Frau, die man Lucy taufte, und die vielleicht so ausgesehen hat wie auf Abbildung 61. Man hielt sie für einen dreieinhalb Millionen Jahre alten Australopithe­cus. Die Versteinerung eines männlichen Schädels, der mit der Katalog­nummer »Schädel 1470« bezeichnet und vielleicht zwei Millionen Jahre alt ist, wird als der eines Homo habilis (geschickter Mensch) betrachtet, eine Bezeichnung, die L. S. B. Leakey für die Frühform der Hominiden geprägt hat. Die Skelettüberreste »eines stämmigen jungen Mannes« sind unter der Katalognummer WT. 15 000 als Homo erectus (aufrecht gehend) eingetragen; er hat vor rund eineinhalb Millionen Jahren gelebt und gilt als der erste echte Hominid. Der Homo erectus lebte in der Altsteinzeit, benutzte Steine als Werkzeug und wanderte über die Sinaihalbinsel, die eine Landbrücke zwischen Afrika und Asien bildet, sowohl nach Asien und Südostasien als auch nach Südeu­ropa aus. Danach verliert sich die Spur des Menschengeschlechts; es fehlt das Kapitel zwischen der Zeit von vor eineinhalb Millionen bis vor dreihunderttausend Jahren. Dann aber, vor etwa dreihunderttausend Jahren, erscheint, ohne ein Anzeichen der Entwicklung, der Homo sapiens (wissender Mensch). Zuerst glaubte man, der Neandertaler – so genannt nach dem Tal bei Düsseldorf, wo er 1856 gefunden wurde –, der vor ungefähr hundertfünfundzwanzigtausend Jahren in Europa und in einigen Teilen von Asien gelebt hat, sei der Vorfahre des CroMagnon-Menschen (Homo sapiens sapiens), der sich vor fünfund­dreißigtausend Jahren ausbreitete. Doch dann meinte man, der primiti­ve Neandertaler habe sich aus einem anderen Zweig des Homo sapiens entwickelt, nicht aus der Cro-Magnon-Rasse. Jetzt weiß man, daß die letztgenannte Annahme nahezu richtig ist. Die beiden waren zwar verwandt, jedoch nicht in gerader Linie; sie lebten parallel vor neunzig­tausend oder gar hunderttausend Jahren. 124 Den Beweis fand man in Israel in zwei Höhlen, in einer auf dem Cannel und in einer in der Nähe von Nazareth, die zu den vielen Höhlen in diesem Gebiet gehören, in denen der Mensch in vorge­schichtlicher Zeit gehaust hat. Die ersten Funde hielt man in den 1930er Jahren für siebzigtausend Jahre alt, und nur der Neandertaler paßte zu dieser Theorie. In den 1960er Jahren nahm eine israelischfranzösische Forschergruppe in der Höhle von Qafzeh bei Nazareth weitere Ausgrabungen vor und stellte fest, daß die Überreste nicht nur von Neandertalern stammten, sondern auch dem Cro-Magnon-Typ entsprachen. Die Erdschichten bewiesen, daß die Cro-Magnons hier vor den Neandertalern gelebt hatten, und zwar vor gut siebzigtausend Jahren. Die Wissenschaftler von der Hebräischen Universität (Jerusalem) be­faßten sich nun mit den Überresten der Nagetiere in derselben Erd­schicht. Die Untersuchungen ergaben das gleiche Datum: Der Cro‑Magnon, der Homo sapiens sapiens, von dem man angenommen hatte, er habe vor fünfunddreißigtausend Jahren gelebt, hatte vor mehr als siebzigtausend Jahren den Nahen Osten erreicht und sich im heutigen Israel niedergelassen und überdies in diesem Gebiet lange Zeit mit dem Neandertaler zusammengelebt. Am Ende des Jahres 1987 wurden die Funde in Qafzeh und auf dem Cannel mit neuen Methoden untersucht, unter anderem mit Thermolumineszenz, die eine weiter zurückreichende Altersbestimmung er­laubt als das Radiokarbonverfahren. In zwei Artikeln berichtete Helene Vallades, die Leiterin einer französischen Forschergruppe, in Nature (Bd. 330 und 340), es habe sich zweifelsfrei ergeben, daß sowohl Neandertaler als auch Cro-Magnons schon vor hunderttausend Jahren in dem Gebiet gelebt hätten. Das bestätigten später weitere Funde in einer anderen Gegend von Galiläa. Nature widmete dieser Erkenntnis sogar einen Leitartikel, in dem Christopher Stringer vom Britischen Museum erklärte, die bisherige Annahme, die Neandertaler seien den Cro-Magnons vorausgegangen, müsse revidiert werden. Beide Linien entstammten einem früheren Homo sapiens. Wo immer der Garten Eden gelegen haben möge, die Neandertaler seien aus irgendeinem Grunde als erste vor etwa hundertfünfundzwanzigtausend Jahren nord­wärts ausgewandert. Die Auswanderung nach Norden von dem afrika­ nischen Geburtsort aus wurde bestätigt, als Fred Wendorf von der MethodistenUniversität (Dallas) in Ägypten in der Nähe des Nils einen Neandertaler-Schädel entdeckte, der achtzigtausend Jahre alt war. »Bedeutet das alles einen früheren Beginn der Menschheit?« fragte eine Schlagzeile in Science. Wissenschaftler anderer Disziplinen betei­ligten sich an der Forschung, und die Frage wurde bejaht. Die Neander­taler, so hieß es, waren im Nahen Osten nicht bloß zu Besuch gewesen, sondern hatten dort lange Zeit gesiedelt. Und sie waren keine primiti­ ven Wesen gewesen, wozu man sie bisher abgestempelt hatte. Sie begruben ihre Toten mit Ritualen, die auf religiöse Praktiken hin­wiesen, »zumindest auf ein geistig bedingtes Verhalten, das sie mit den heutigen Menschen verbindet« (Jared M. Diamond von der medizini­schen Fakultät der Universität Los Angeles). Einige Forscher, darunter Ralph S. Solecki von der Columbia-Universität, die die Neandertaler-Überreste in der Schanidar-Höhle entdeckt hatten, vermuteten, 125 daß die Neandertaler Kräuter zu Heilzwecken verwendeten – vor sechzig­tausend Jahren. Skelettfunde in den israelischen Höhlen überzeugten die Mediziner – im Gegensatz zur bisherigen Meinung –, daß die Neandertaler sprechen konnten. »Fossile Gehirnabdrücke zeigen ein gut entwickeltes Sprachzentrum«, erklärte Dr. Falk von der staatlichen Universität in Albany, und der Neurologe Terrence Deacon von Har­vard ergänzte: »Das Gehirn des Neandertalers war größer als das unsrige ... Er war keineswegs schwachsinnig und der Sprache nicht mächtig.« Diese jüngsten Entdeckungen lassen keinen Zweifel daran, daß der Neandertaler ein Homo sapiens war, kein Vorfahr der Cro-Magnon-Menschen, sondern ein früherer Typus desselben Stammbaums. Im März 1987 beriefen Christopher Stringer und sein Kollege Paul Mellars eine Konferenz in der Universität Cambridge ein, bei der das Thema »Ursprung und Verbreitung des Menschen« an Hand der neue­sten Entdeckungen diskutiert wurde. Zuerst erörterte man die fossilen Beweise. Man gelangte zu dem Schluß, daß der Homo sapiens 1,2 bis 1,5 Millionen Jahre nach dem Homo erectus ganz plötzlich erschienen sei, wie aus fossilen Überresten in Äthiopien, Kenia und Südafrika hervorgehe. Aus diesem Homo sapiens hätten sich vor rund zweihundertdreißigtausend Jahren die Neandertaler entwickelt und vielleicht hun­ derttausend Jahre später mit der Auswanderung nach Norden begon­nen, vielleicht sei der Homo sapiens sapiens zufällig zur selben Zeit erschienen. Es wurden noch andere Beweise herangezogen, so zum Beispiel die neuen Daten der Biochemie. Am interessantesten waren die auf Gene­tik beruhenden Befunde. Die Möglichkeit, durch Vergleiche der DNS-Sätze die Elternschaft nachzuweisen, hat sich durch Vaterschaftsprozesse erwiesen. Natürlich wurde diese Technik nicht nur auf die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern angewendet, sondern auch auf die Ab­stammung der Arten. Infolge dieser neuen Molekulargenetik konnten Allan C. Wilson und Vincent M. Sarich von der Berkeley-Universität in Los Angeles mit unbedingter Genauigkeit beweisen, daß die Homini­den sich nicht vor fünfzehn Millionen, sondern vor fünf Millionen Jahren aus Affen entwickelt haben, und zwar sind die nächsten Ver­wandten der Hominiden die Schimpansen, nicht die Gorillas. Da sich die DNS des Mannes in jeder Generation mit demjenigen der Frau mischt, lassen sich nach mehreren Generationen Vergleiche mit der DNS in den Zellkernen (die zur Hälfte vom Vater und zur anderen Hälfte von der Mutter stammen) nicht mehr so gut durchführen. Man hat jedoch entdeckt, daß die Eizelle der Mutter außerhalb des Kerns auch DNS enthält, die sich nicht mit der des Vaters vermischt (Abb. 62). Statt dessen geht sie von der Mutter auf die Tochter über, des weiteren auf die Enkelin und so fort durch alle Generationen. Abb. 62 126 Diese Entdeckung machte Douglas Wallace von der Emory-Universität in den 1980er Jahren, worauf er Vergleiche mit der mt-DNS von achthundert Frauen anstellte. Die überraschende Schlußfolgerung, die er bei einer Konfe­renz im Juli 1986 verkündete, lautete: Alle Frauen haben eine derartig ähnliche mt-DNS, daß sie von ein und derselben Ahnfrau abstammen müssen. Diese Entdeckung nahm Wesley Brown von der Universität Michigan auf, indem er vorschlug, die Ratio der natürlichen Mutation der mt-DNS zu bestimmen, um auf diese Weise zu berechnen, wieviel Zeit seit dem Vorkommen der Ahnfrau vergangen ist. Beim Vergleich von einund­zwanzig Frauen verschiedener geographischer und rassischer Herkunft zeigte es sich, daß sie ihren Ursprung »einer einzigen mitochondrialen Eva« zu verdanken hatten, die zwischen dreihundertund hundertachtzigtausend Jahren vor unserer Zeit in Afrika gelebt hat. Daraufhin begann die Suche nach der »Eva«. Eine führende Rolle nahm dabei Rebecca Cann von Berkeley (später Universität Hawaii) ein. Sie benutzte die Plazenta von hundertsiebenundvierzig Frauen verschiedener geographischer und rassischer Herkunft, die in Kliniken von San Francisco entbunden worden waren, indem sie ihre mt-DNS aus der Plazenta extrahierte und Vergleiche anstellte. Wie sich ergab, hatten alle dieselbe Urahnin, die vor dreihundert- bis hundertfünfzigtausend Jahren gelebt hat (je nachdem, ob die Ratio zwei Prozent oder vier Prozent pro Jahrmillion betraf). »Wir nehmen gewöhnlich zweihundertfünfzigtausend Jahre an«, erklärte Rebecca Cann. Die obere Grenze von dreihunderttausend Jahren fällt nach Meinung der Paläoanthropologen aufgrund der fossilen Beweise mit dem Er­scheinen des Homo sapiens zusammen. »Was kann vor dreihundert­tausend Jahren geschehen sein, das diese Veränderung bewirkt hat?« fragten Rebecca Cann und Allan Wilson. Darauf wußte niemand eine Antwort. Um die sogenannte »Eva-Hypothese« zu erproben, untersuchten Rebecca Cann sowie ihre Kollegen Allan Wilson und Mark Stoneking die mt-DNS von hundertfünfzig Amerikanerinnen, deren Vorfahren in Europa, Afrika, im Mittleren Osten und Asien gelebt hatten oder die sogar von den Eingeborenen in Australien und Neuguinea abstammten. Es stellte sich heraus, daß die afrikanische mt-DNS die älteste war und daß alle diese grundverschiedenen Frauen dieselbe Urahnin hatten, die vor dreihundert- bis hundertvierzigtausend Jahren in Afrika gelebt hat. In einem zusammenfassenden Leitartikel stellte Science (Ausgabe vom 11. September 1987) fest, aufgrund überwältigender Beweise habe sich ergeben, daß »Afrika die Wiege des heutigen Menschen ist ... Die Geschichte, die die Molekularchemie erzählt, besagt, daß die heutige Menschheit vor ungefähr zweihunderttausend Jahren in Afrika entstan­den ist.« Die sensationellen Erkenntnisse – mittlerweile noch durch andere Studien bestätigt – machten damals weltweit Schlagzeilen. »Die Fra­ge, woher wir gekommen sind, ist beantwortet worden«, stand im National Geographic (Oktober 1988), nämlich aus Südostafrika. »Un­ser aller Mutter ist gefunden worden«, betitelte der San Francisco Chronicle den Artikel. »Von Afrika aus: Der Weg 127 des Menschen zur Weltherrschaft«, verkündete der Londoner Observer. Die meistver­kaufte Ausgabe von Newsweek (11. Januar 1988) trug ein Titelbild, auf dem Adam und Eva mit einer Schlange abgebildet waren; der Untertitel lautete: »Die Suche nach Adam und Eva«. Die Schlagzeile paßte gut, denn wie Allan Wilson gesagt hat: »Offen­sichtlich muß dort, wo eine Mutter war, auch ein Vater gewesen sein.« Alle diese neuen Entdeckungen finden in weit zurückliegender Vergan­genheit eine Bestätigung durch das erste Paar des Homo sapiens in der Bibel: »Und Adam nannte sein Weib Chawa (Lebensspenderin, deutsch: Eva), denn sie war die Mutter aller Lebenden.« Die sumerischen Texte lassen mehrere Schlußfolgerungen zu. Erstens war der Aufstand der Anunnaki vor rund dreihunderttausend Jahren die Ursache der Erschaffung des Lulus. Dieses Datum ist die oberste Grenze für das Erscheinen des Homo sapiens, wie die Altertumsfor­scher und andere Wissenschaftler festgestellt haben. Zweitens hat die Erschaffung des Lulus nördlich des Abzus, oberhalb des Bergbaugebiets, stattgefunden. Die frühesten menschlichen Über­reste hat man in Tansania, Kenia und Äthiopien gefunden – nördlich der südafrikanischen Goldminen. Drittens fällt das Erscheinen des ersten Homo sapiens, des Neandertalers – vor ungefähr zweihundertdreißigtausend Jahren –, in den Zeitraum von zweihundertfünfzigtausend Jahren, der durch die mt-DNS-Berech­nungen als Datum für Evas Erschaffung ermittelt worden ist; ihm folgt dann das Erscheinen des Homo sapiens sapiens, des »modernen Men­schen«. Es besteht kein Widerspruch zwischen den letztgenannten Daten und dem Datum des Aufstands vor dreihunderttausend Jahren. Man muß bedenken, daß es sich bei diesen Jahren um Erdenjahre handelt; für die Anunnaki waren aber etwa dreitausendsechshundert Erdenjahre ein Jahr. Außerdem verging eine lange Zeit mit Experimenten, ehe die Anunnaki beschlossen, den »vollkommenen Adam« zu erschaffen. Natürlich ist aus der Entschlüsselung der mt-DNS zu ersehen, daß Eva kein weiblicher Lulu war, der nicht gebären konnte, sondern eine normale Frau. Um der Menschheit die normale Fortpflanzungsfähig­keit zu verleihen, mußten Enki und Ninki eine zweite genetische Mani­pulation vornehmen, die in der Bibel durch die Geschichte von Adam, Eva und der Schlange im Garten Eden versinnbildlicht ist. Hat diese zweite genetische Manipulation vor zweihundertfünfzigtausend Jahren stattgefunden, wie Rebecca Cann annimmt, oder vor zweihundert­tausend Jahren, wie in der Zeitschrift Science zu lesen war? Laut der Genesis bekamen Adam und Eva ihre Kinder erst nach der Vertreibung aus dem Garten Eden. Es ist nicht bekannt, ob Abel, ihr zweiter Sohn, der von seinem älteren Bruder Kain getötet wurde, Nachfahren bekommen hatte. 128 Hingegen steht in der Bibel, daß Kain verbannt wurde und in ein fernes Land zog, wo seine Nachkommen geboren wurden. Waren diese Nachkommen vielleicht die ausgewander­ten Neandertaler? Das ist eine interessante Möglichkeit, die Spekulati­on bleiben muß. Sicher ist dagegen, daß die Bibel das Erscheinen des Homo sapiens sapiens, des neuzeitlichen Menschen, bestätigt. Sie erzählt, daß Seth, der dritte Sohn von Adam und Eva, einen Sohn namens Enos hatte, von dem die Menschheit abstammt. Der hebräische Name Enos bedeutet Mensch, menschliches Wesen – du und ich. Zu Enos’ Lebzeiten begannen die Menschen, wie die Bibel erzählt, »Jahwe anzurufen«. Mit anderen Worten, damals wurden Zivilisation und Gottesverehrung be­gründet. Damit sind alle Aspekte der uralten Geschichte nachgewiesen. 129 Das Symbol der verflochtenen Schlangen In der biblischen Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden ist Gottes Protagonist, der ihnen »Wissen« (die Fähigkeit, sich fortzupflanzen) verleiht, die Schlange, auf hebräisch Nahasch. Das hebräische Wort bedeutet zweierlei: »Der die Geheimnisse kennt« und »Der Kupfer kennt«. Die zwei Bedeutungen besitzt auch Enkis sumerischer Beiname Buzur, der sowohl »Der die Geheimnisse erklärt« als auch »Der von den Metallminen« be­ deutet. Darum ist im ursprünglichen sumerischen Text Enki die Schlange. Sein Emblem waren zwei verflochtene Schlangen, das Symbol (a) seines Kulturzentrums Eridu, (b) seiner afrikani­schen Domäne im allgemeinen und (c) der Pyramiden im beson­deren; es kommt auf den sumerischen Rollsiegel-Illustrationen zu den in der Bibel beschriebenen Ereignissen vor. Was stellte dieses Emblem – noch heute das Symbol für Medi­zin und Heilkunst – dar? Die Entdeckung der doppelspiraligen Molekülstruktur der DNS (Abb. 49) liefert die Antwort: Die verflochtenen Schlangen versinnbildlichen die Struktur des ge­netischen Kodes, das geheime Wissen, das Enki ermächtigte, den Adam zu erschaffen und Adam und Eva dann zeugungsfähig zu machen. Enkis Symbol des Heilens findet sich auch im vierten Buch Mose, wo Moses eine »Nahasch nehoschet« – eine Kupfer­schlange (falsch übersetzt teils als Schlange aus Eisen, teils als Schlange aus Bronze) – herstellt, um die Israeliten von einer Seuche zu heilen. Hatte die Herstellung der Schlange aus Kupfer etwas damit zu tun, daß Kupfer in der Genetik und Heilkunst eine Rolle spielt? Experimente, die kürzlich an den Universitäten von Minnesota und von St. Louis vorgenommen wurden, bestätigen es. Dabei hat sich erwiesen, daß Kupfer-62 Positronen emittiert und so die Blutbildung fördert und daß andere Kupferverbindungen phar­mazeutische Substanzen zu den lebenden Zellen befördern, auch zu den Gehirnzellen. 130 10 Als Weisheit vom Himmel kam Die sumerische Königsliste – eine chronologisch angeordnete Auf­stellung von Herrschern, Städten und Ereignissen – enthält einen vorgeschichtlichen und einen geschichtlichen Teil: zuerst einen langen Bericht von den Geschehnissen vor der Sintflut, dann eine Darstellung von dem, was sich nach der Sintflut ereignet hat. Im ersten Teil wird die Zeit beschrieben, in der die Anunnaki »Götter« waren und ihre Söhne dann als sogenannte »Halbgötter« auf der Erde herrschten, nachdem sie sich mit den Töchtern der Menschen vermählt hatten. Im zweiten Teil vermitteln menschliche Herrscher, von Enlil auserwählte Könige, zwischen den »Göttern« und dem Volk. In beiden Fällen kam die Institution einer organisierten Gesellschaft und einer befugten Re­gierung »vom Himmel herab« auf die Erde, und so ergab sich hier dieselbe gesellschaftliche Struktur wie auf dem Nibiru. Dieses Buch handelt zwar von dem, was wir Wissenschaft nennen und was die Alten Weisheit genannt haben, aber ein paar Worte über das »Königtum« dürften doch angebracht sein, weil ohne gute Ordnung, Organisation der Gesellschaft und ihrer Institutionen wissenschaftli­cher Fortschritt und Bewahrung der »Weisheit« nicht möglich sind. Das Königtum war der Geschäftsbereich Enlils, des Hauptadministra­tors auf Erden. Es ist bemerkenswert, daß wir nicht nur auf vielen wissenschaftlichen Gebieten von der Hinterlassenschaft der Sumerer zehren und darauf aufbauen, sondern daß es auch immer noch die Institution des Königtums gibt, das der Menschheit jahrtausendelang gedient hat. Samuel N. Kramer verzeichnet in seinem Buch Die Ge­schichte beginnt in Sumer viele »Erstlinge«, die dort entstanden sind, unter anderem das Zweikammersystem mit gewählten (oder auser­wählten) Abgeordneten. Verschiedene Aspekte einer organisierten und geordneten Gesellschaft berücksichtigte das Königtum, in erster Linie das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ein König mußte »rechtmäßig« sein und die Gesetze befol­gen, denn die sumerische Gesellschaft lebte nach dem Gesetz. Viele haben in der Schule von dem babylonischen König Hammurabi (um 1780 v. Chr.) und seinem berühmten Gesetzeskodex gehört, aber schon mindestens zweitausend Jahre vor ihm veröffentlichten sumerische Könige einen Gesetzeskodex. Allerdings besteht da ein Unterschied: Hammurabis Kodex handelte von Verbrechen und Bestrafung. Die sumerischen Kodices enthielten Vorschriften für richtiges Verhalten: Du darfst einer Witwe nicht ihren Esel wegnehmen; oder: Du darfst einen Tagelöhner nicht auf seinen Lohn warten lassen. Auch die Zehn Gebote der Bibel enthalten keine Strafandrohungen, sondern zählen auf, was man unterlassen soll. Die Rechtspflege oblag einer Justizverwaltung. Von den Sumerern haben wir das Konzept der Richter, der Geschworenen, der Zeugen und der Verträge übernommen. Die Einheit der Gesellschaft, die wir als Familie bezeichnen und die auf einem Ehevertrag beruht, wurde in Sumer begründet, desgleichen die Regeln 131 und Bräuche der Nachfolge, der Adoption und der Rechte einer Witwe. Auch wirtschaftliche Dinge waren gesetzlich geregelt: Tauschverträge, Arbeitsverhältnisse und Ent­lohnung und – wie könnte es anders sein? – Besteuerung. Wir wissen zum Beispiel viel vom Außenhandel der Sumerer, denn es gab eine Zollstation in einer Stadt namens Drehem, wo genau Buch geführt wurde über alle kommerziellen Transporte von Waren und Tieren. All dies und noch mehr unterstand der Schirmherrschaft des Königs. Als Enlils Söhne und Enkel alt genug waren, um an den Beziehungen zwischen Göttern und Menschen teilzunehmen, wurden ihnen allmäh­lich die königlichen Pflichten übertragen, und Enlil selbst wurde als Wohltäter eine liebe Erinnerung. Doch bis zum heutigen Tage hat die sogenannte zivilisierte Gesellschaft ihr Entstehen der Zeit zu verdan­ken, in der »das Königtum vom Himmel herabkam«. »Weisheit« – Wissenschaft und Künste und alles, was eine Ausbil­dung verlangt – unterstand Enki, dem führenden Gelehrten der Anunnaki, und später seinen Kindern. Aus einem Text, der den Titel Inanna und Enki: Vermittler der Kunst der Zivilisation erhalten hat, ist zu erfahren, daß Enki einzigartige Gegenstände besaß, die »Me« hießen – eine Art Computer oder Datenverarbeitungsgerät – und alle Informationen lieferten, die er für Wissenschaft, Handwerk und Kunst brauchte. Sie umfaßten verschie­dene Gebiete wie Schriftstellerei, Musik, Metallbearbeitung, Bautechnik, Transportwesen, Anatomie, medizinische Behandlung, Überschwem­mungskontrolle, städtischen Verfall, Astronomie, Mathematik und den Kalender. Wie das Königtum kam auch die Weisheit »vom Himmel herab auf die Erde« und wurde den Menschen von den Anunnaki-Göttern verliehen. Es beruhte auf ihrem eigenen Entschluß, die Weisheit den Menschen zu geben, und zwar durch Vermittlung auserlesener Individuen. In der Regel gehörte der Auserwählte dem Priesterstand an – auch ein »Erst­ling«, der sich jahrtausendelang bis zum Mittelalter erhalten hat, wo Priester und Mönche auch immer Gelehrte waren. Ein sumerischer Text schildert, wie Enmeduranki, der erste Priester, von den Göttern geschult wurde: »Sie zeigten ihm, wie Öl und Wasser zu beobachten sind, Geheimnisse von Anu, Enlil und Enki. Sie gaben ihm die göttliche Tafel, die eingeritzten Geheimnisse von Himmel und Erde. Sie lehrten ihn, wie man mit Zahlen rechnet.« Diese wenigen Worte besagen viel. Als erstes wurde Enmeduranki die Kenntnis von »Öl und Wasser« beigebracht, und das betrifft die Medi­zin. Ärzte hießen im sumerischen Sprachgebrauch »Azu« (Der das Wasser kennt) oder »lazu« (Der das Öl kennt); der Unterschied bezieht sich auf das Verfahren, wie die Heilmittel eingegeben wurden: mit Wasser gemischt als Getränk oder mit Öl gemischt und als Klistier verabreicht. Dann bekommt Enmeduranki die »göttliche Tafel« 132 mit den Geheimnissen von Himmel und Erde. Sie enthält die Belehrung über die Planeten, das Sonnensystem und die bekannten Sternbilder sowie »irdisches Wissen« wie Geographie, Geologie, Geometrie und – da zum Tempeldienst die Riten am Neujahrsabend gehörten – Kosmogo­nie sowie Evolution. Um all das zu verstehen, bedurfte es der Mathe­matik, der Kunst, mit Zahlen zu rechnen. In der Genesis wird die Geschichte vom Patriarchen Henoch kurz damit abgetan, daß er nicht starb, sondern im Alter von dreihundertfünfundsechzig Jahren (so viele Tage hat das Jahr) plötzlich nicht mehr da ist, weil Gott ihn weggenommen hat. Aber man erfährt weitaus mehr aus dem Buch Henoch (von dem mehrere Wiedergaben gefunden wor­den sind), was nicht in der Bibel enthalten ist. Die Kenntnisse, die Henoch durch Engel vermittelt werden, sind darin im einzelnen beschrieben; sie umfassen Bergbau und Metallurgie, die Geheimnisse der Unterwelt, Geographie, die Bewässerung der Erde, Astronomie und die Gesetze der himmlischen Bewegungen, die Berechnung des Kalenders, Kenntnisse über Pflanzen, Blumen und Nahrungsmittel und so weiter; alles das wird Henoch durch »göttliche Tafeln« beigebracht. Das biblische Buch der Sprüche widmet einen Teil seiner Belehrungen dem Wissensdurst des Menschen und der Erkenntnis, daß es zum Wohle des Menschen ist, wenn er Weisheit erlangt. Vor allem im achten Kapitel wird sie besungen. Auch im Buch Hiob wird die Tugend der Weisheit gepriesen und gesagt, was der Mensch alles durch sie erlangen kann, jedoch wird spitzfindig gefragt: »Woher kommt sie?« Worauf die Antwort gegeben wird: »Elohim weiß den Weg zu ihr.« Bestimmt waren sumerische und akkadische Sprüche die Anregung, wenn nicht gar die Quelle zu den biblischen Sprüchen, und das sumerische Gegenstück zum Buch Hiob trägt interessanterweise den Titel Ich will den Herrn der Weisheit preisen. Alles Wissen war in alter Zeit zweifellos ein Geschenk der belehrenden Anunnaki. Gerade in Astronomie hatten die Sumerer erstaunliche Kennt­nisse, kannten sie doch das vollständige Sonnensystem, und auch über die Kosmogonie, die den Ursprung der Erde und des Asteroidengürtels erklärte und das Vorhandensein des Planeten Nibiru bewies, wußten sie Bescheid. All das konnten ihnen nur die Anunnaki vermittelt haben. Ich habe zwar die Freude gehabt, von der Fachwelt die Anerkennung des sumerischen Beitrags zu vielen Gebieten – zu Gesetzgebung, Medizin und anderen – zu erleben (wie ich hoffe, in gewissem Aus­maß durch meine Schriften); aber zur Anerkennung des ungeheuren Beitrags zur Astronomie ist es noch nicht gekommen, weil man ver­mutlich zögert, »eine verbotene Schwelle« zum unvermeidlichen näch­sten Schritt zu überschreiten: Wenn man zugibt, was die Sumerer alles über die himmlischen Dinge gewußt haben, muß man auch einräumen, daß es den Planeten Nibiru und seine Bevölkerung, die Anunnaki, gegeben hat. Trotzdem negiert diese Scheu nicht die Tatsache, daß die moderne Astronomie den Sumerern, das heißt den Anunnaki, viel zu verdanken hat: das grundlegende Konzept einer sphärischen Himmels­kunde mit all ihren technischen Eigentümlichkeiten, das Konzept einer Ekliptik als ei133 ner scheinbaren Sonnenbahn, die Sternbilder, die Eintei­lung des Tierkreises in zwölf Häuser oder Felder und die des Jahres in zwölf Monate, was beides davon herrührt, daß das Sonnensystem zwölf Glieder hat und jeder führende Anunnaki einem himmlischen Gegenstück zugeteilt wurde, so daß sie ein Zwölferpantheon bildeten, von dem jeder wiederum einem Sternbild und einem Monat entsprach. Die Astrologen sind den Sumerern sicher dankbar, denn im Nibiru finden sie das zwölfte Glied des Sonnensystems, das ihnen bisher gefehlt hat. Wie das Buch Henoch erzählt und die in der Bibel erwähnte Zahl dreihundertfünfundsechzig bestätigt, entspringt der Kalender der Kennt­nis der Beziehungen zwischen Sonne, Mond und Erde: Danach werden Tage, Monate und Jahre gezählt. Es wird mittlerweile allgemein aner­kannt, daß unser heutiger (westlicher) Kalender auf dem ersten Kalen­der der Menschheit basiert, dem sogenannten Kalender von Nippur. Da er mit der Frühlings-Tagundnachtgleiche im Tierkreiszeichen Stier beginnt, folgerten die Gelehrten, daß er zu Beginn des vierten Jahrtau­sends vor Christus aufgestellt worden ist. Bei einer Tagundnachtglei­che überquert die Sonne den Äquator und scheint den nördlichsten oder südlichsten Punkt erreicht zu haben. Diese Vorstellungen, die in allen Kalendern in der neuen und in der alten Welt zu finden sind, kommen von den Sumerern. Der jüdische Kalender richtet sich immer noch nach dem von Nippur, nicht nur in Form und Struktur, sondern auch in der Zählung der Jahre. Das Jahr 1990 n. Chr. ist zum Beispiel im jüdischen Kalender das Jahr 5750. Er datiert nicht von der »Erschaffung der Welt« an, wie erklärt wird, sondern vom Beginn des Kalenders von Nippur im Jahr 3760 v. Chr. In diesem Jahr kam Anu, der König von Nibiru, zu einem Staatsbesuch auf die Erde. Sein akkadischer Name bedeutet »Himmel« oder »Himm­lischer« und kommt in vielen astronomischen Bezeichnungen vor wie etwa »An Ur« (Horizont) und »An Pa« (Zenit); er bildet auch einen Bestandteil des Namens »Anunnaki« (Die vom Himmel auf die Erde kamen). Die alten Chinesen, deren Silben und Aussprache ihren sume­rischen Ursprung verrieten, bezeichneten mit dem Wort »kuan« einen Tempel, der auch als Observatorium diente. Im Sumerischen bedeutet »Ku An« Öffnung zum Himmel. (Den sumerischen Ursprung der chi­ nesischen Astronomie und Astrologie habe ich in einem Artikel Die Wurzeln der Astrologie (»The Roots of Astrology«) 1985 in der Febru­ar-Ausgabe der Zeitschrift East West Journal behandelt. Zweifellos stammen das lateinische annum (Jahr), das französische année (Jahr) und das englische annual (jährlich) und so weiter aus der Zeit, als der Kalender und das Zählen der Jahre begannen und An seinen Staatsbe­such machte. Natürlich hat sich die chinesische Tradition, Tempel und Observatorium zu verbinden, nicht auf China beschränkt; sie geht zurück auf die Zikkurate von Sumer und Babylon. Ein langer Text befaßt sich mit Anus und Antus Besuch in Sumer und erzählt, wie die Priester auf die oberste Plattform der Zikkurat stiegen, um das Erscheinen des Nibirus am Himmel zu beobachten. Enki gab seine Kenntnisse der Astronomie und anderer Wissenschaften an seinen erstgeborenen Sohn Marduk weiter, und die erneuerte Zikkurat in Babylon wurde, als Marduk 134 in Mesopotamien die Herrschaft übernommen hatte, so umgebaut, daß sie auch als Observatorium dienen konnte (Abb. 63). In die Geheimnisse des Kalenders, der Mathematik und der weihte Schreib­kunst Enki seinen jüngeren Sohn Ningischzidda ein, den die Ägypter Thoth nannten. Er war außerAbb. 63 dem der mittelamerikanische Gott Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Sein sumerischer Name bedeutet Herr des Lebensbaumes, woraus zu ersehen ist, daß Enki ihn mit dem medizinischen Wissen vertraut gemacht hatte, auch mit dem Geheimnis, Tote zum Leben zu erwecken. Daß die Anunnaki das vermochten, wenigstens soweit es sie selbst betraf, geht aus dem Text »Inannas Abstieg in die Unterwelt« hervor, wo ihre Schwester sie umbrachte. Enki legte auf den Leichnam »das, was pulst« und »das, Abb. 64 was strahlt« und brachte sie so zum Leben zurück. Eine mesopotamische Abbildung eines Patienten zeigt eine solche Strahlenbehandlung (Abb. 64). Es hat keinen Zweck, auf die Fähigkeit, Tote zum Leben zu erwecken (in der Bibel ist davon die Rede), näher einzugehen, gewiß ist, daß die Priester in Anatomie und Medizin ausgebildet wurden, wie auch der Enmeduranki-Text besagt. Daß diese Tradition in späterer Zeit fortge­setzt wurde, geht aus dem fünften Buch Mose hervor, wo Jahwe den israelitischen Priestern ausführliche Anweisungen in bezug auf Ge­sundheit, Diagnostik, Behandlung und Hygiene gibt. Die Diätvor­ schriften, die zwischen reiner (koscherer) und unreiner Nahrung unter­scheiden, beruhen zweifellos auf gesundheitlichen und hygienischen Erwägungen, nicht auf religiösen Gebräuchen. Man nimmt an, daß auch die Beschneidung aus medizinischen Gründen erfolgt ist. Alle diese Gebote kommen in früheren mesopotamischen Texten vor, die den azus und lazus als Lehrbücher dienten. Darin werden die Ärzte-Priester angewiesen, zuerst die Symptome zu beachten und dann zu überlegen, welche Heilmittel anzuwenden wären. Sie enthalten außer­dem eine Liste der gebräuchlichen Kräuter, Chemikalien und anderer pharmazeutischer Bestandteile, aus denen die Medikamente hergestellt wurden. Daß diese Belehrungen in der Bibel von Elohim erteilt wer­den, dürfte nicht verwunderlich 135 sein, wenn man bedenkt, was Enki und Ninti in medizinischer, anatomischer und genetischer Hinsicht alles vollbrachten. Grundlegend für die Astronomie, den Kalender, für kommerzielle und wirtschaftliche Tätigkeiten war die Kenntnis der Mathematik, das »Rech­nen mit Zahlen«, wie es im Enmeduranki-Text heißt. Die Sumerer benutzten das Sexagesimalsystem, das auf der Grundzahl sechzig aufbaut, im Unterschied zu unserem Dezimalsystem mit der Grundzahl zehn. Man zählt dabei von eins bis sechzig, nicht wie wir von eins bis zehn. Wenn wir zweihundert sagen, sagten oder schrieben die Sumerer »2 Gesch«, nämlich 2 x 60 = 120. 1/2 bedeutete die Hälfte von 60 = 30, 1/3 von 60 = 20. Das Dezimalsystem entspricht der Anzahl unserer Finger, was einfach erscheint, aber für den Mathematiker ist das Sexagesimalsystem eine reine Freude. 10 ist nur durch 2 und 5 teilbar, 100 nur durch 2, 4, 5, 10, 20, 25; 60 hingegen durch 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30. Da wir die sumerische 12 bei der Anzahl der Tagesstunden, die 60 bei der Zeiteinteilung (60 Se­kunden = 1 Minute, 60 Minuten = 1 Stunde) und in der Geometrie die Zahl 360 bei der Einteilung des Kreises in 360 Grad übernommen haben, ist das Sexagesimalsystem immer noch das einzig vollkomme­ne, was Astronomie, Zeitberechnung und Geometrie betrifft. Die Sum­me aller Winkel eines ebenen Dreiecks beträgt zum Beispiel 180 Grad, die eines Vierecks 360 Grad. Sowohl in der theoretischen Geometrie als auch in der angewandten (etwa beim Abmessen eines Ackers) macht dieses System es möglich, den Inhalt von komplexen Formen zu be­rechnen, etwa einer Fläche oder eines Gefäßes, auch die Länge von Kanälen oder den Abstand von Planeten (Abb. 65). Als die Buchführung begonnen wurde, benutzten die Sumerer einen stumpfen Griffel, um die Schriftzeichen für 1, 10, 60, 600 und 3600 in feuchten Lehm ein- Abb. 65 136 Abb. 66a bis d zudrücken (Abb. 66a). 3600 war die letzte Ziffer, die als großer Kreis dargestellt wurde. Das war ein die Einheit Sar, die »königliche« Zahl der Erdenjahre, die vergingen, bis Nibiru einen Umlauf um die Sonne beendet hatte. Nach der Einführung der Keilschrift, bei der ein keilförmiger Griffel benutzt wurde (Abb. 66b), schrieben die Sumerer auch die Zahlen in Keilschrift (Abb. 66c). Andere Keilschriftzeichen bedeuteten Brüche oder ein Vielfaches (Abb. 66d), und alle diese kombinierten Zeichen für Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation fügten sich zu arithmetischen und algebraischen Rechenaufgaben zusammen. Man muß dabei auch quadrieren, kubieren und die Quadratwurzel errech­nen. Wie F. Thureau-Dangin in seinen Textes mathematiques Babyloni­ens zeigt, rechneten die Alten nach vorgeschriebenen Formeln, mit zwei oder gar drei Unbekannten, die heute noch in Gebrauch sind. Obwohl »sexagesimal« genannt, beruhte das sumerische Rechensystem eigentlich nicht auf der Zahl 60, sondern auf einer Kombination von 6 und 10. Beim Dezimalsystem besteht jeder Schritt darin, die vorange­hende Summe mit 10 zu multiplizieren (Abb. 67a), beim sumerischen System hingegen wird abwechselnd mit 10 und 6 multipliziert (Abb. 67b). Das hat die Forscher verwirrt. Es ist verständlich, daß sich das Dezimalsystem nach unseren zehn Fingern richtet. Die Com­putersprache verwendet den Begriff Digitalrechner, der vom lateini­ schen digitus (Finger) abgeleitet ist. Aber wie sind die Sumerer auf die Zahl 6 gekommen? Abb. 67 137 Es hat noch andere Rätsel gegeben. Unter den Tausenden von mesopo­tamischen mathematischen Rechentafeln hat man Tafeln mit fertigen Rechenaufgaben gefunden. Verwunderlicherweise wird nicht von un­ten nach oben gerechnet (1, 10, 60 usw.), sondern abwärts von einer Zahl, die »astronomisch« genannt werden muß: 12 960 000. Hier ein Beispiel: 1. 2. 3. 4. 12 960 000 2 /3 /2 1 /3 1 /4 1 = = = = 8 640 000 6 480 000 4 320 000 3 240 000 So geht es weiter über 1/80 = 180 000 bis zu 1/400 = 32 400. Auf anderen Tafeln geht es bis zu 1/16000 = 810, und zweifellos ist das Ende 60, nämlich der 216 000ste Teil von der Anfangszahl 12 960 000. Nachdem H. V. Hilprecht an einer babylonischen Expedition der Uni­versität von Pennsylvanien teilgenommen hatte, untersuchte er Tausen­de von mathematischen Tafeln aus den Tempelbibliotheken von Nippur und aus der Bibliothek des assyrischen Königs Asurbanipal in Ninive und gelangte zu der Feststellung, daß die Zahl 12 960 000 buchstäblich eine astronomische Zahl ist: Sie entstammt dem Phänomen der Präzession, der Verlagerung der Punkte der Tagundnachtgleiche auf der Ekliptik, die dadurch verursacht wird, daß die Achse der als Kreisel aufzufassenden Erde in 25 920 Jahren um die Achse der Ekliptik einen Kegel beschreibt, so daß sie nach dieser Zeit ein volles Haus weiter­gerückt ist. Die vollständige Drehung aller zwölf Häuser dauert also 25 920 Jahre, und die Zahl 12 960 000 stellt 500 solcher Platonischen Jahre dar (so nennt man diesen Zeitraum). Die moderne Astronomie kennt natürlich das Vorrücken des Frühlingspunktes und die von den Sumerern errechneten Perioden, aber kein Gelehrter konnte bisher die Verlagerung auch nur eines einzigen Hauses erklären, denn keiner hat sie jemals erlebt. Die Sumerer haben sie errechnet. Mir scheint, eine Lösung all dieser Rätsel kann gefunden werden, wenn man das Vorhandensein des Nibirus und der Anunnaki gelten läßt. Da sie der Menschheit die mathematische »Weisheit« verliehen hatten, entwickelten sie die Grundzahl der Astronomie und das Sexagesimal­system zu ihrem eigenen Nutzen und von ihrem Standpunkt aus und arbeiteten es dann für menschliche Bedürfnisse um. Hilpert hat durchaus richtig erkannt, daß die Zahl 12 960 000 der Astronomie entstammt. Es ist der Zeitraum (25 920 Jahre), den ein voller Präzessionszyklus erfordert. Aber dieser Zyklus läßt sich mensch­lichen Bedingungen anpassen, und zwar durch die Verlagerung eines einzigen Tierkreishauses. Auch eine 2160 Jahre dauernde Verschie­bung geht weit über die Lebensspanne des Menschen hinaus, aber die Verschiebung um ein Grad alle zweiundsiebzig Jahre kann der Mensch erleben. Die Priester-Astronomen erlebten sie ebenfalls und fügten sie als irdisches Element ihren Formulierungen bei. Dann gab es noch die Umlaufzeit des Nibirus, die von den Anunnaki mit 3600 138 Erdenjahren gleichgesetzt wurde. Es lagen also zwei grundle­gende, unverrückbare Phänomene vor, Zyklen von einer Dauer, die das Verhältnis der Bewegungen von Nibiru und Erde auf 3600 und 2160 festlegte. Dieses Verhältnis läßt sich auf zehn zu sechs kürzen. Nibiru vollendete seinen Umlauf in 21 600 Jahren sechsmal, und die Erde verlagerte sich um zehn Tierkreishäuser. Ich bin der Meinung, daß so das 6 x 10 x 6 x 10, das sogenannte Sexagesimalsystem, entstand. Das Sexagesimalsystem ist, wie gesagt, immer noch die Grundlage der modernen Astronomie und der Zeitberechnung. Das ist das Vermächt­nis der Anunnaki. Die Griechen wandten bei der Vervollkommnung ihrer Bau- und Bildhauerkunst einen Maßstab an, der Goldener Schnitt genannt wird und ideale Proportionen ergibt. Die Regel lautet: Man teilt eine Strecke so ein, daß die Strecke A sich zum größeren Teil B genauso verhält wie der größere Teil B zum kleineren A-B, also A:B = B:(A-B). Es scheint, daß die Architektur den Goldenen Schnitt nicht den Griechen zu verdanken hat, sondern den Anunnaki (über die Sume­rer), denn das ist das Verhältnis zehn zu sechs, auf dem das Sexagesi­malsystem basiert. Das gleiche läßt sich von dem mathematischen Phänomen der Fibonacci-Reihe sagen: Eine Zahlenreihe nimmt insofern zu, als jede folgende Zahl aus der Summe zweier vorhergehender Zahlen besteht; zum Bei­spiel ist 5 die Summe von 2 + 3, 8 die Summe von 3 + 5 und so weiter. Der italienische Mathematiker Luca Pacioli (Mitte des 15. Jahrhun­derts bis 1508) fand die algebraische Formel für diese Serie und nannte den Quotienten – 1,618 – die Goldene Zahl und seinen reziproken Wert – 0,618 – die Göttliche Zahl. Womit wir wieder bei den Anunnaki wären ... Nach diesen Erklärungen über die Entstehung des Sexagesimalsystems wollen wir zu Hilprecht zurückkehren und einmal sehen, zu welchen Schlußfolgerungen er in bezug auf die obere Grundzahl des Systems, nämlich 12 960 000, gelangt ist. Es ist leicht zu zeigen, daß sie die Quadratzahl der eigentlichen Grund­zahl der Anunnaki, 3600, ist, die den Erdenjahren von Nibirus Umlauf­bahn entspricht (3600 x 3600 = 12 960 000). Teilt man 3600 durch 10, so erhält man die 360 Grade des Kreises. 3600 ist außerdem die Quadratzahl von 60, die Anzahl der Minuten in einer Stunde und der Sekunden in einer Minute. Der zodiakale Ursprung der astronomischen Ziffer 12 960 000 erklärt meiner Ansicht nach ein rätselhaftes biblisches Wort. Im Psalm 90 steht, der Herr habe seine Wohnung seit zahllosen Generationen und seit einer Ewigkeit im Himmel gehabt, »bevor die Berge hervorge­bracht wurden, bevor die Erde und die Welt erschaffen wurde ... Denn tausend Jahre sind in seinen Augen ein Tag, der gestern vergangen ist«. Wenn wir 12 960 000 durch 2160 teilen (die Anzahl der Jahre, nach denen ein Tierkreishaus sich verschiebt), erhalten wir 6000 = 1000 x 6. Die Zahl sechs ist uns aus der biblischen Schöpfungsgeschichte be­kannt: In sechs »Tagen« wurde die Erde erschaffen. Ob der Psalmist wohl die mathematischen Tafeln kannte, auf denen stand, was der 2160ste Teil von 12 960 000 ist, nämlich 1000 x 6? Es ist wirklich eine interessante Feststellung, daß in einem 139 Psalm die Zahlen vorkommen, mit denen die Anunnaki gespielt haben. Das Wort Generation, das im Psalm 90 und an anderen Stellen der Bibel vorkommt, heißt im Hebräischen »Dor« und ist abgeleitet von »dur«, was »rund sein, einen Kreislauf durchmachen« bedeutet. In bezug auf Menschen ist eine Generation gemeint, aber in bezug auf Himmelskörper bedeutet es einen Umlauf um die Sonne. Wenn man sich das klarmacht, versteht man die wahre Bedeutung des Psalms 102, des bewegenden Bußgebets eines Sterblichen: »Du aber, Herr, bleibst ewiglich und die Erinnerung an dich von Kreis zu Kreis ... Denn er blickt von seiner heiligen Höhe: Vom Himmel aus hat Jehowa die Erde betrachtet ... Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht hinauf in der Mitte meiner Tage, du, dessen Jahre in einem Kreislauf der Kreisläufe sind ... Du bist unwandelbar, deine Jahre werden kein Ende haben.« Wenn man das alles auf die Umlaufzeit des Nibirus, auf seine 3600 Jahre und auf die Präzession der Erde in ihrer Umlaufbahn um die Sonne bezieht, dann erkennt man das Geheimnis der Zahlen, das die Anunnaki vom Himmel auf die Erde gebracht haben. Bevor der Mensch mit »Zahlen rechnen« konnte, mußte er Lesen und Schreiben meistern. Wir finden es selbstverständlich, daß Menschen sprechen können, daß wir eine Sprache haben, mit der wir uns verstän­digen. Aber für die Wissenschaftler ist es nicht selbstverständlich. Bis vor kurzem glaubten die Linguisten, der »sprechende Mensch« sei ein ziemlich spät aufgetretenes Phänomen, und das könne der Grund sein, warum die Cro-Magnons – die sprechen und sich untereinander ver­ständigen konnten – den Vorrang vor den Neandertalern gehabt hätten. Das ist nicht die Ansicht der Bibel. Sie hielt es zum Beispiel für selbstverständlich, daß die Elohim, die lange vor dem Adam auf der Erde gewesen waren, miteinander sprechen konnten. Denn der Adam wurde als Ergebnis eines Meinungsaustauschs zwischen den Elohim erschaffen, in dem gesagt wurde: »Lasset uns den Adam nach unserem Bilde und uns ähnlich erschaffen.« Das schließt nicht nur die Fähigkeit des Sprechens mit ein, sondern auch eine Sprache, die Verständigung ermöglicht. Schauen wir uns nun einmal den Adam an. Er wird in den Garten Eden gebracht und erhält Anweisungen, was er essen darf und was nicht. Der Adam versteht diese Belehrung durchaus, wie aus dem nachfolgenden Gespräch zwischen der Schlange und Eva hervorgeht. Die Schlange fragt: »Hat Elohim wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von den Früchten dieses Baumes, sonst müßt ihr sterben?« Eva bejaht dies; aber die Schlange versichert ihr, dies sei nicht wahr, worauf Eva und Adam von der verbotenen Frucht essen. Dann folgt ein langer Dialog. Adam und Eva verstecken sich, als sie die Schritte Jahwes hören, der in der Abendkühle im Garten lustwandelt. Jahwe ruft Adam: »Wo bist du?« und nun kommt es zu folgendem Wortwechsel: 140 Adam: Als ich deine Schritte im Garten hörte, fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Jahwe: Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und ich habe gegessen. Jahwe: (zu der Frau) Warum hast du das getan? Eva: Die Schlange hat mich verführt, und ich habe gegessen. Nicht nur die Gottheit kann sprechen, sondern auch Adam und Eva, und sie können die Sprache der Gottheit verstehen. In welcher Sprache haben sie sich unterhalten, denn es muß ja eine gegeben haben (laut Bibel)? Wenn Eva die erste Mutter war, gab es dann auch eine erste Sprache – eine Muttersprache? Wieder stimmten die Wissenschaftler mit der Bibel nicht überein. Sie nahmen an, die Sprache sei eher ein kulturelles Erbe als ein Merkmal der Entwicklung. Ihrer Ansicht nach entwickelte der Mensch die Spra­che von Urlauten zu sinnvollen Rufen (beim Anblick einer Beute oder bei der Witterung einer Gefahr), dann zu einer rudimentären Sprache, als er Sippen bildete. Aus Wörtern und Silben entstanden Sprachen, viele Sprachen gleichzeitig, während sich Sippen und Stämme bilde­ten. Diese Theorie vom Ursprung der Sprachen mißachtet nicht nur die Bedeutung der biblischen Erzählungen von der Gottheit und dem Vor­fall im Garten Eden, sondern auch die biblische Erklärung, daß vor dem Turmbau zu Babel »die Erdbevölkerung nur eine Sprache hatte und dieselben Wörter«, und daß Elohim absichtlich und vorsätzlich die Erdbevölkerung »zerstreute und die Sprache verwirrte, so daß keiner mehr die Sprache des anderen verstand«. Es ist geradezu wohltuend, daß die heutigen Gelehrten zu der Ansicht gelangt sind, daß es tatsächlich eine Muttersprache gab und der Homo sapiens von Anfang an sprechen konnte, sowohl der Cro-Magnon als auch der Neandertaler. Daß viele Sprachen Wörter enthalten, die ähnlich klingen und dieselbe Bedeutung haben, weiß man längst, und daß man deswegen bestimmte Sprachen gruppieren, das heißt in Sprachgruppen und -stämme eintei­len kann, haben deutsche Forscher bereits vor über hundert Jahren erklärt und Wortstämme wie »indogermanisch«, »semitisch«, »hami­tisch« und so weiter vorgeschlagen. Aber gerade diese Gruppierung verhinderte die Anerkennung einer Muttersprache, weil sie davon aus­ging, daß sich ganz verschiedene und nicht in Beziehung stehende Sprachgruppen unabhängig voneinander in unterschiedlichen »Kern­zonen« entwickelten, aus denen die Auswanderer ihre Sprache in ande­re Länder mitnahmen. Alle Erklärungen, daß sogar zwischen entfern­ten Gruppen sprachliche Verwandtschaft besteht (als Beispiel sei der Pastor Charles Foster genannt, der im 19. Jahrhundert in seinem Buch über die Ursprache darauf hinwies, daß die mesopotamische Sprache ein Vorläufer der hebräischen ist), alle diese Versuche wurden mit dem Vorwurf abgetan, die Theologen wollten nur den Status der Bibel­sprache, des Hebräischen, erhöhen. Es waren hauptsächlich die Fortschritte auf anderen Gebieten wie Anthropo141 logie, Biogenetik, Geologie und auch Informatik, die dem Studium der sogenannten linguistischen Genetik den Weg öffneten. Die Ansicht, die sprachliche Verständigung habe sich beim Zivilisations­prozeß des Menschen erst verhältnismäßig spät entwickelt, etwa vor fünftausend Jahren, mußte aufgegeben werden, als die Archäologen bewiesen, daß die Sumerer schon vor sechstausend Jahren schreiben konnten. Russische Forscher, die unter der Leitung von Wladislaw Ilitsch-Switytsch und Aaron Dolgopolsky in den 1960er Jahren eine frühe Verwandtschaft zwischen den slawischen Sprachen suchten, fanden eine Proto-Sprache, die sie Nostratisch nannten (nach dem lateinischen nostras = aus unserem Lande, einheimisch); sie war der Kern aller europäischen Sprachen, auch der slawischen. Später erbrachten sie den Beweis für eine zweite Proto-Sprache, die sie als Kernsprache der fernöstlichen Länder Dene-Kaukasisch nannten. Nach den linguisti­schen Veränderungen zu schätzen, war sie etwa zwölftausend Jahre alt. In den Vereinigten Staaten fanden Joseph Greenberg und Merritt Ruhlen von der Stanford-Universität eine dritte Proto-Sprache, die sie Amerind nannten. Ohne auf die Bedeutung dieser Entdeckungen einzugehen, möchte ich doch erwähnen, daß diese Proto-Sprachen nach der Sintflut entstanden sind, die vor dreizehntausend Jahren stattgefunden hat. Das stimmt mit der biblischen Darstellung überein, nach der sich die Menschheit nach der Sintflut in drei Stämme verzweigt hat, die Linien der Nachkommen der drei Söhne Noahs. Die Zeit der Auswanderungen wurde von den Archäologen immer mehr nach hinten datiert, was im Hinblick auf die Einwanderung in Amerika besondere Bedeutung hat. Als ein Zeitraum von zwanzig- und sogar von dreißigtausend Jahren erwähnt wurde, sorgte Joseph Greenberg 1987 für eine Sensation, indem er schrieb, daß die Vielzahl von Sprachen in der Neuen Welt in nur drei Stämmen gruppiert werden könne, die er Eskimo Aleut, Na-Dene und Amerind nannte. Aber schier unglaublich ist folgendes: Diese drei wurden von Einwanderern aus Afrika, Europa, Asien und von den Pazifischen Inseln mitgebracht, konnten also nicht als Proto-Sprachen betrachtet werden, sondern wa­ren Sprachzweige aus der Alten Welt. Wie die Bezeichnung Na-Dene nahegelegt, bezieht sich Greenberg damit auf die Dene-kaukasische Gruppe der russischen Gelehrten. Diese Gruppe scheint, wie Merritt Ruhlen in Natural History (März 1987) schrieb, der Sprachgruppe »genetisch am nächsten verwandt« zu sein, der die toten Sprachen Etruskisch und Sumerisch angehören. Eskimo-Aleut sei den indoger­manischen Sprachen am ehesten verwandt. Aber gab es »echte« Sprachen wirklich erst vor ungefähr zwölftausend Jahren, erst nach der Sintflut? Nicht nur die Bibel beweist, daß der Homo sapiens (Adam und Eva) von Anfang an sprechen konnte, son­dern auch die Tatsache, daß die sumerischen Texte zum Teil vor der Sintflut geschrieben worden waren. Der assyrische König Asurbanipal rühmte sich, Tafeln lesen zu können, die aus der Zeit vor der Sintflut stammten. Demnach hat es schon viel früher als angenommen entwickelte Sprachen gegeben. 142 Paläontologische und anthropologische Entdeckungen führten die Lin­guisten in ferne Vergangenheit zurück. Die Funde in der bereits er­wähnten Kebara-Höhle zwangen die Sprachforscher zum radikalen Umdenken. Man fand einen erstaunlichen Hinweis. Bei den Skelettüberresten eines sechzigtausend Jahre alten Neandertalers befand sich ein unversehrtes Zungenbein, das erste, das man bisher gefunden hatte. Abb. 68 In diesem hornförmigen Knochen, der zwischen Kinn und Kehlkopf liegt (Abb. 68), sind die Muskeln verankert, die Zunge, Unterkiefer und Kehlkopf in Bewegung setzen und so die menschliche Sprache ermögli­chen. Zusammen mit anderen Skeletteilen lieferte das Zungenbein den uner­ schütterlichen Beweis, daß der Mensch vor mindestens sechzigtausend Jahren und wahrscheinlich noch viel früher genauso wie wir heute sprechen konnte. Der Neandertaler hatte, wie die Gruppe der sechs internationalen Forscher, die Baruch Arensburg von der Universität in Tel Aviv leitete, in Nature (27. April 1989) veröffentlichte, »die mor­phologische Beschaffenheit für die menschliche Sprechfähigkeit«. Wie konnte da dem Indogermanischen, dessen Ursprung nur ein paar tausend Jahre zurückzuverfolgen ist, eine so bevorzugte Stellung am Sprachenstammbaum eingeräumt werden? Die russischen Forscher, die durch dieses Vorurteil weniger eingeengt wurden als ihre westli­chen Kollegen, machten sich nun auf die Suche nach einer Proto-Proto-Sprache. An ihrer Spitze standen Aaron Dolgopolsky, heute an der Universität Haifa, und Vitaly Scheworoschkin, heute an der Universität Michigan. Hauptsächlich von Scheworoschkin angeregt, wurde im November 1988 eine »Durchbruch«-Konferenz in der Universität Mi­chigan abgehalten; das Thema lautete: »Sprache und Vorgeschichte«. Über vierzig Linguisten, Anthropologen, Archäologen und Genetiker aus sieben Ländern nahmen daran teil. Man einigte sich darauf, daß es eine Mono-Genesis der menschlichen Sprache gibt – eine Mutterspra­che in einem Proto-Proto-ProtoStadium vor ungefähr hunderttausend Jahren. Auch Vertreter anderer wissenschaftlicher Gebiete (wie Philip Lieberman von der Brown-Universität und Dean Falk von der staatlichen Universi­tät in Albany), die sich auf die Anatomie des Sprechens spezialisiert haben, betrachten das Sprechen als eine Fähigkeit, die dem Homo sapiens von Anfang an eigen gewesen ist, seit diese »denkenden und wissenden« Menschen auf der Erde erschienen sind. Gehirnspezialisten wie zum Beispiel Ronald E. Myers, der für Kommunikations­ störungen zuständig ist, sind der Ansicht, daß die menschliche Sprache spontan entstanden ist, unabhängig von den Lauten anderer Primaten, sobald die Men143 schen ihr zweiteiliges Gehirn erhalten hatten. Allan Wilson, der an den genetischen Untersuchungen teilgenommen hatte, die zu der alleinigen Urmutter führten, gelangte auch in diesem Fall zu »Eva«: »Die menschliche Fähigkeit des Sprechens dürfte von einer genetischen Mutation herrühren, die sich bei einer Frau vollzogen hat, die vor zweihunderttausend Jahren in Afrika lebte«, sagte er im Januar 1989 bei einem Vortragsabend der Amerikanischen Gesellschaft für den Fortschritt der Wissenschaft. »Die Gabe eines guten Mundwerks rührt von Eva her«, lautete die Überschrift des Berichts einer Zeitung. Nun ja, von Eva und Adam, wie die Bibel besagt. So sind wir nun bei der letzten Errungenschaft, beim Schreiben. Heute ist man der Meinung, daß viele Formen und Symbole, die man in europäischen Eiszeithöhlen gefunden hat und die aus einer Periode von vor zwanzig- bis dreißigtausend Jahren stammen, grobe Piktogramme sind, das heißt Bilderschriften. Zweifellos hat der Mensch erst lange nach dem Sprechen das Schreiben gelernt. Die mesopotamischen Texte erklären, daß bereits vor der Sintflut geschrieben wurde, und es besteht kein Grund, das nicht zu glauben. Aber die früheste Schrift, die man heute kennt, ist die piktografische Schrift der Sumerer. Es dauerte einige Jahrhunderte, bis sich daraus die Keilschrift entwickelte (Abb. 69), die in allen alten Sprachen Asiens benutzt wurde, bis das Alphabet sie Tau- Abb. 69 144 sende von Jahren später ersetzte. Auf den ersten Blick sieht die Keilschrift wie ein unmögliches Durch­ einander von langen, kurzen und einfach keilförmigen Zeichen aus (Abb. 70). Ihre Zahl geht in die Hunderte, und man staunt, daß die alten Schreiber sich merken konnten, wie sie zu schreiben sind und was sie bedeuten. Drei Generationen von Gelehrten haben sich abgemüht, sie in eine logische OrdAbb. 70 nung zu bringen, so daß man schließlich imstande war, Lexika und Wörterbücher der alten Sprachen – Sumerisch, Baby­lonisch, Assyrisch, Hetitisch, Elamitisch und so weiter –, die von der Keilschrift Gebrauch machten, zu schreiben. Die moderne Wissenschaft aber behauptet, daß hinter der Erschaffung einer solchen Vielfalt von Zeichen mehr steckt als nur logische Ord­nung. Die Mathematiker, die sich mit grafischer Darstellung befassen – mit dem Studium der Punkte, die durch Linien verbunden sind –, kennen die Theorie, die der englische Mathematiker Frank P. Ramsey im Jahr 1928 in einem Vortrag vor der Londoner Mathematischen Gesellschaft erläuterte. Demnach ist es möglich, die Zahl der Variationen auszurech­nen, in der sich Punkte verbinden lassen, so daß Formen entstehen. Die Ramseysche Theorie, die sowohl bei Spielen und Rätseln als auch in Naturwissenschaft und Architektur angewandt wird, ermöglicht es zum Beispiel, folgendes zu zeigen: Wenn sechs Punkte, die Personen dar­stellen, durch rote Linien verbunden werden (zwei, die einander ken­nen) oder durch blaue (zwei, die einander nicht kennen), kommt immer ein rotes oder blaues Dreieck heraus. Die Berechnung der Möglichkei­ten, Punkte zu verbinden (oder es zu vermeiden), läßt sich am besten mit Beispielen erklären (Abb. 71). Den Formen, die sich ergeben, liegen die sogenannten Ramsey-Zahlen zugrunde, die bei der Umwandlung Dutzende von grafischen Darstel­lungen ergeben, deren ÄhnAbb. 71 145 lichkeit mit den mesopotamischen Keilschrift­zeichen nicht zu bestreiten ist (Abb. 72). Die hier abgebildeten fast hundert Zeichen sind einfache grafische Darstellungen, die auf nur einem Dutzend Ramsey-Zahlen beruhen. Wenn also Enki oder seine Tochter Nidaba, die Göttin des Schreibens, soviel gewußt haben wie Frank P. Ramsey, darin ist es ihnen nicht schwergefallen, für die sumerischen Schreiber ein mathematisch voll­ kommenes System der Keilschriftzeichen zu entwickeln. »Ich will dich reichlich segnen und deinen Samen mehren wie die Sterne am Himmel«, sagt Jahwe zu Abraham. Und in diesem einen Satz finden mehrere Elemente des Wissens, Abb. 72 das vom Himmel herabkam, ihren Ausdruck: Sprache, Astronomie und das Rechnen mit Zahlen. Die moderne Wissenschaft ist auf dem Weg, all das zu bestätigen. 146 Die Früchte von Eden Was war der Garten Eden, an den sich die Bibel als an einen Ort erinnert, wo vielerlei Pflanzen wuchsen und Adam Tiere gezeigt wurden, die noch keinen Namen trugen? Die heutigen Wissen­schaftler lehren, daß die besten Freunde des Menschen, Getreide und Haustiere, kurz nach dem Jahr 10 000 v. Chr. gezüchtet wurden. Weizen und Gerste, Hunde und Schafe (um nur einige zu nennen) erschienen in ihren kultivierten und gezähmten For­men innerhalb von nur zweitausend Jahren. Das ist ein Bruchteil der Zeit, die allein die natürliche Selektion erfordern würde. Die sumerischen Texte bieten eine Erklärung. Darin heißt es, daß noch keine gezüchteten Pflanzen und keine gezähmten Tiere auf der Ende waren, als die Anunnaki hier landeten. Die Anunnaki brachten sie in ihrer »Schöpfungskammer« mit. Mit Lahar (wol­liges Vieh) und Anschan (Getreidekörner) schufen sie »eine Vegetation, die gedieh und sich vermehrte«. Das geschah in Edin, und als der Adam erschaffen war, wurde er dorthin ge­ bracht, um alles zu hegen und zu pflegen. Der erstaunliche Garten Eden war also ein biogenetischer Gutsbetrieb, eine Enklave, wo Getreide, Früchte und Tiere gezüchtet wurden. Nach der Sintflut versahen die Anunnaki die Menschen aber­mals mit Pflanzen- und Tiersamen, die sie bewahrt hatten, so daß die Erdlinge erneut anfangen konnten. Aber diesmal mußte der Mensch selbst Landwirt sein. Das steht in der Bibel, die Noah die Ehre zuerkennt, der erste Landmann gewesen zu sein. Darin steht auch, daß Noah als erstes einen Weinberg anlegte. Die moderne Wissenschaft bestätigt das Alter der Rebe; sie fand außerdem heraus, daß die Trauben nicht nur als Nahrung dien­ten, sondern daß der Wein zudem als wirksames Heilmittel gegen Magen- und Darmkrankheiten galt. Noah nahm also, als er Wein trank (im Übermaß), gewissermaßen seine Medizin ein. 147 11 Eine Raumstation auf dem Mars Nach der Landung auf dem Mond sind die Erdlinge erpicht darauf, den Fuß auch auf den Mars zu setzen. Anläßlich des 20. Jahrestages der ersten Mondlandung entwarf der Präsident der Vereinigten Staaten ein Bild von den Sprungbrettern zum nächsten Außenplaneten der Erde. Im Raumfahrtmuseum von Wa­shington, flankiert von den drei Apollo-11-Astronauten Neil A. Arm­strong, Edwin E. Aldrin und Michael Collins, skizzierte George Bush Zwischenstationen zum Mars. An erster Stelle stand der Fortschritt des Shuttle-Programms zur Errichtung einer ständig die Erde umkreisenden Raumstation, wo die notwendigen größeren Raumschiffe zusammen­ gesetzt werden sollten. Dann kam die Errichtung einer Station auf dem Mond, wo Materialien, Ausrüstung und Treibstoff für die langen Raum­fahrten entwickelt und erprobt würden, wodurch man auch Erfahrun­gen sammeln würde, wie lange der Mensch im Weltraum leben und arbeiten konnte. Und schließlich eine Expedition zum Mars. Mit dem Versprechen, die Vereinigten Staaten zu »einer raumfahrenden Nation« zu machen, sagte der Präsident, das Ziel werde sein, »zurück zum Mond, zurück zur Zukunft und dann eine Reise ins Morgen, zu einem anderen Planeten: eine bemannte Mission zum Mars«. »Zurück zur Zukunft.« Ob diese Wortwahl Zufall war oder nicht, mag dahingestellt bleiben; die Voraussetzung, daß Zukünftiges nur in An­griff genommen werden kann, wenn man in die Vergangenheit zurück­geht, könnte mehr als nur die zufällige Wortwahl eines Redners gewe­sen sein. Denn es verhält sich so, daß die Überschrift dieses Kapitels, eine Raumstation auf dem Mars, nicht für Diskussionen über zukünftige Pläne gilt, sondern auf etwas hinweist, was sich in der Vergangenheit zugetragen hat: Es ist erwiesen, daß es in alter Zeit auf dem Mars eine Raumstation gegeben hat, und, was noch bestürzender ist, daß sie vor unseren Augen reaktiviert werden könnte. Wenn der Mensch sich in den Weltraum hinauswagen will, ist es nur logisch und technisch auch machbar, den Mars als ersten der Planeten auszusuchen. Nach den Gesetzen der Himmelsbewegungen und wegen Behinderungen durch Schwerkraft und Energie muß man auf dem Weg zu anderen Welten Zwischenstationen anlegen. Das bedingen auch die Grenzen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit des Men­schen. Ein Raumschiff, das eine Astronauten-Mannschaft zum Mars und zurück zu befördern vermag, dürfte etwa zweihundert Millionen Kilo wiegen. Allein um von der Erde abgehen zu können, ist zusätzli­ches Gewicht von Treibstoff und Behältern erforderlich. Die jetzigen amerikanischen Shuttles haben eine Nutzlast von dreißigtausend Kilo. Die Start- und Treibstoffprobleme vermindern sich beträchtlich, wenn das Raumschiff im schwerelosen Umlauf um die Erde zusammenge­setzt wird. Es läßt sich also eine kreisende 148 bemannte Raumstation denken, zu der Shuttle-Fähren die einzelnen Teilstücke des Raum­schiffs bringen. In der Zwischenzeit befassen sich die auf dem Mond stationierten Astronauten mit den technischen Belangen des menschli­chen Überlebens im Weltraum. Die Reise zum Mars wird dann gemein­sam angetreten. Die Rundreise könnte zwei bis drei Jahre dauern, je nach der Flugbahn und den Erde-Mars-Konstellationen. Auch die Aufenthaltsdauer auf dem Mars ist Einschränkungen unterworfen, angefangen mit mehreren Umläufen bis zu einem langen Aufenthalt in einer Kolonie, die von wechselnden Raumschiffen bedient wird. Viele befürworten den »Fall Mars«, wie man diesen Plan nach zahlreichen Konferenzen genannt hat, mit der Einschränkung, daß eine bemannte Mission nur gerechtfer­tigt ist, wenn man dort eine permanente Raumstation errichtet, die sowohl als Startplatz für bemannte Missionen zu noch ferneren Plane­ten als auch als Dauersiedlung der Erdlinge in einer neuen Welt benutzt werden kann. Die Errichtung einer Raumstation auf dem Mond, die ihrerseits als Startplatz und Zwischenstation zum Mars dient, ist in Szenarien be­schrieben worden, die sich wie Science-fiction-Romane lesen, aber auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und machbarer Technik beruhen. Stationen auf dem Mond und dem Mars, sogar eine Kolonie auf dem Mars, sind schon lange geplant und gelten als durchführbar. Gewiß ist es nicht einfach, menschliches Leben auf dem Mond zu ermöglichen, doch Studien zeigen, daß es sich durchführen läßt. Auf dem Mars ist es noch schwieriger, weil die Belieferung von der Erde aus noch mehr Anforderungen stellt und kostspieliger ist. Trotzdem sind die nötigen Voraussetzungen auf dem Mars gegeben, und die Wissenschaftler glau­ben, daß der Mensch dort alles finden würde, was er zum Leben braucht. Der Mars ist bewohnbar, denn er ist in der Vergangenheit bewohnt gewesen. Mars erscheint heute als kalter Planet, allem Lebendigen feindlich gesinnt, mit bitterkalten Wintern und, außer am Äquator zur wärmsten Jahreszeit, mit einer Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt, bedeckt von Frostboden oder verrostetem Eisengestein (das ihm die rötliche Farbe verleiht), ohne flüssiges Wasser und ohne Sauerstoff zum Atmen. Aber vor nicht allzulanger Zeit – geologisch gesprochen – hatte er verhältnismäßig angenehme Jahreszeiten, Flüsse und Meere, einen bewölkten Himmel (blaue Farbtönung!) und vielleicht sogar einfache einheimische Pflanzenformen. Bei all den verschiedenen Studien ist man zu der Folgerung gelangt, daß der Mars momentan eine Eiszeitphase durchläuft, ähnlich den Eiszeiten, von denen die Erde periodisch heimgesucht worden ist. Die Ursache der Eiszeiten auf der Erde, die vielen Faktoren zugeschrieben worden ist, sieht man heute in drei grundlegenden Phänomenen, die mit der Umlaufbahn um die Sonne zusammenhängen. Da ist die Umlauf­bahn an sich, die in einem Zyklus von hunderttausend Jahren zwischen kreisförmig und elliptisch wechselt, so daß die Erde der Sonne manch­mal näher und manchmal ferner ist. Die wechselnden Jahreszeiten beruhen darauf, daß ihre Umdrehungsachse auf der Erdbahnebene nicht senkrecht steht, sondern gegen sie geneigt ist, so daß die nördli­che Halbkugel im Sommer dem Einfluß der Sonnenstrahlen stärker ausgesetzt ist, die Südhalbkugel hingegen im 149 Abb. 73 Winter und umgekehrt. Aber diese Neigung, ungefähr im Winkel von 23,5 Grad, ist nicht stabil; die Erde ist wie ein schlingerndes Schiff, die Neigung schwankt um etwa drei Grad vor und zurück, in einem Zyklus, der etwa vierzig­tausend Jahre dauert (Abb. 73). Je größer die Neigung ist, um so extremer sind Sommer und Winter; die Bewegung von Luft und Wasser ändert sich und bewirkt die klimatischen Veränderungen, die wir Eis­zeit und Interglazialzeit (wärmere Periode) nennen. Als nächstes kommt hinzu, daß die Erde bei ihrer Drehung um die eigene Achse schlingert; dabei behält die Erdachse zwar ihre Neigung bei, aber sie beschreibt eine Kegelfläche um die Achse der Ekliptik. Das ist das Phänomen der Präzession, deren Zyklus ungefähr sechsundzwanzigtausend Jahre dauert. Auch Mars ist diesen drei Zyklen unterworfen, nur bewirken seine größere Bahn um die Sonne und die noch stärkere Neigung extremere klimatische Veränderungen. Beim Mars dauert der Zyklus etwa fünfzig­tausend Jahre (er wird auch länger oder kürzer eingeschätzt). Wenn Mars seine Interglazialzeit – die warme Periode – erlebt, fließt er von Wasser über, und die Atmosphäre ist für den Menschen nicht so unfreundlich wie momentan. Wann war die letzte Interglazialzeit auf dem Mars? Es kann nicht allzulange her sein, da sonst die Staubstürme die jetzt sichtbaren Beweise auf der Oberfläche, daß es auf dem Mars Flußbetten, Meeresküsten und Seebecken gibt, verwischt oder ganz ausgelöscht hätten, und die Atmosphäre würde keinen Wasserdampf mehr enthalten, wie es heute der Fall ist. »Es muß auf dem roten Planeten vor verhältnismäßig kurzer Zeit Flüsse gegeben haben«, lau­tete die Aussage des amerikanischen Geologen Harold Masurski. Man­che meinen, die letzte Veränderung sei vor zehntausend Jahren ge­schehen. Die Leute, die Landungen und längere Aufenthalte auf dem Mars planen, erwarten nicht, daß das Klima sich dort innerhalb der nächsten zwei Dekaden ändern wird; aber sie glauben, daß die grundlegenden Bedingungen für ein Leben 150 und Überleben auf dem Mars mancherorts erfüllbar sind. Wasser steht in den großen Gebieten mit Frostboden in Form von Eis zur Verfügung und ist auch im Schlamm der anscheinend ausgetrockneten Flußbetten zu finden. Als die für die NASA arbeitenden Geologen der staatlichen Universität Arizona den sowjetischen Wissenschaftlern eine Landung vorschlugen, bezeichneten sie den gro­ßen Canyon im Lunae-Planum-Becken als den Ort, wo man in den Ablagerungen eines Deltas nach Wasser graben sollte. Wasseradern und unterirdische Seen sind nach Meinung vieler Geologen eine siche­re Wasserquelle. Durch Auswertungen neuer Daten, die sowohl durch Sonden als auch durch Instrumente auf der Erde ermittelt worden waren, gelangte eine Forschergruppe, die von Robert L. Huguenin von der Universität Massachusetts geleitet wurde, im Juni 1980 zu der Schlußfolgerung, daß es südlich des Äquators nur mehrere Zentimeter unter der Marsoberfläche zwei große Wasserreservoirs geben muß. Später im Jahr berichteten Stanley H. Ziks vom Haystack-Observatori­um in Westford (Massachusetts) und Peter J. Mouginis-Mark von der Brown-Universität auf Rhode Island in Science and Nature (November 1980), daß bei Radaruntersuchungen in Gebieten auf der Südhalbkugel »feuchte Oasen mit viel Wasser« unter der Oberfläche entdeckt worden seien. Zudem gibt es ja auch all das Wasser, das in den Polarkappen des Nordpols gespeichert ist, das im nördlichen Sommer am Rande schmilzt, so daß große dunkle Flecken sichtbar werden (Abb. 74). Morgennebel, die man auf dem Mars beobachtet hat, legen den Gedanken nahe, daß es dort Tau gibt, der in den Trockengebieten der Erde vielen Pflanzen und Tieren als Wasserquelle dient. Sogar die Marsatmosphäre, die man auf den ersten Blick als lebensfeindlich und sogar giftig betrachtet, kann in Wirklichkeit lebenswichtige Stoffe liefern. Sie enthält, wie man ermittelt hat, Wasserdampf, der durch Kondensierung gewonnen wer­den könnte. Sie könnte auch Sauerstoff zum Atmen und Verbrennen liefern. Die Marsatmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxyd und einem kleinen Prozentsatz von Stickstoff und Argon sowie Spuren von Sauerstoff. (Die Gashülle der Erde besteht aus 1/5 Sauerstoff und 4/5 Stickstoff, dazu kommen in geringen Mengen noch andere Gase sowie Wasserdampf.) Die wichtige Umwandlung von Kohlendioxyd in Kohlenmonoxyd, bei der Sauerstoff freigesetzt wird, könnte leicht von Astronauten oder Siedlern bewerkstelligt werden. Kohlenmonoxyd würde dann als einfacher Raketentreibstoff dienen. Die rötlichbraune Farbe des Planeten weist ebenfalls auf das Vorkom­ men Abb. 74 151 von Sauerstoff hin. Auf dem Mars gibt es sogenanntes Limonit (Brauneisen), eine Verbindung von Eisenoxyd und mehreren Wasser­molekülen. Mit den geeigneten Geräten ließe sich viel Sauerstoff ge­winnen. Der Wasserstoff, den man dabei gewinnt, könnte zur Herstellung von Nahrungsmitteln und sonstigen Materialien benutzt werden, von denen viele auf Verbindungen von Kohlenwasserstoff beruhen. Der Marsboden hat zwar einen verhältnismäßig hohen Salzgehalt, aber die Wissenschaftler meinen, er könnte an den Stellen, die sich für Treibhäuser eignen, ausgewaschen werden; man müßte dann Getreide- und Gemüsearten wählen, die sich durch Salzresistenz auszeichnen, und als Düngemittel menschliche Ausscheidungen verwenden, wie es in vielen Ländern der dritten Welt geschieht. Stickstoff, den Pflanzen benötigen, ist auf dem Mars knapp, aber immerhin vorhanden: Die Atmosphäre enthält ihn zu fast drei Prozent. Die Bedeckung der Treib­häuser würde aus aufblasbarem Plastik bestehen, zur Stromversorgung könnten Sonnenbatterien benutzt werden, die außerdem die Fahrzeuge antreiben würden. Nicht nur Wasser liefert der Mars, sondern auch Heizung, die durch die frühere Tätigkeit der dortigen Vulkane ermöglicht wird. Der höchste, noch tätige Vulkan auf der Erde, der Mauna Loa auf Hawaii, ragt bis 4201 Meter auf, der Nix Olympica auf dem Mars überragt die umge­bende Fläche um 24 135 Meter; der obere Durchmesser des Kraters beträgt 92 705 Meter. Die Tätigkeit dieses und anderer Vulkane deutet auf einen geschmolzenen heißen Kern hin; folglich könnte es unter der Oberfläche warme Stellen geben, außerdem heiße Quellen und andere Erscheinungen, die von innerer Hitze herrühren. Mit seinem Tag, der fast ebensolang ist wie der auf Erden, seinen Jahreszeiten (allerdings doppelt so lang), seinen Äquatorialgebieten, den vereisten Polen, den einstigen Meeren, Seen und Flüssen, den Gebirgen und Ebenen, den Vulkanen und Schluchten ist der Mars in vielerlei Hinsicht der Erde ähnlich. Manche Wissenschaftler meinen sogar, daß der Mars, obwohl er zur selben Zeit wie andere Planeten entstanden ist, nämlich vor viereinhalb Milliarden Jahren, jetzt in dem Stadium sei, in dem die Erde an ihrem Beginn war, bevor die Pflanzen Sauerstoff abgaben und damit die Gashülle der Erde veränderten. Diese Auffassung hat als Grundlage für die Gäa-Theorie gedient. In einem Buch über die Bewohnbarkeit des Mars benutzten James Lovelock und Michael Allaby die Science-fiction-Methode, um zu beschreiben, wie Mikroorganismen und »Halogase« von der Erde aus in Raumschiffen zum Mars geschickt werden, die einerseits die biolo­gische Kette beginnen und andererseits ein Schutzschild um die Mars­atmosphäre bilden sollen. Dieses Schild aus »Halokohlenstoffgasen«, das in der Atmosphäre über dem kalten, unfruchtbaren Mars hängt, hindert die Abstrahlung der Wärme, die Mars von der Sonne erhält, bewahrt seine eigene innere Hitze und schafft einen künstlichen Treib­hauseffekt. Infolge der Erwärmung und der verdichteten Luft taut das Eis auf, Pflanzen wachsen und erhöhen den Sauerstoffgehalt auf dem Mars. Jeder Schritt in dieser künstlich erzeugten Entwicklung verstärkt den Prozeß, und dadurch, daß Leben auf dem Mars entsteht, wird er lebensfreundlich. 152 Diese Schilderung von der Verwandlung des Mars in einen bewohnba­ren Planeten veröffentlichten die beiden Wissenschaftler im Jahr 1984. Ob zufällig oder nicht, wieder einmal holte die moderne Wissenschaft das alte Wissen ein. Denn ich habe 1976 im Buch Der zwölfte Planet beschrieben, wie die Anunnaki vor etwa vierhundertfünfzigtausend Jahren auf die Erde gekommen sind, um sich Gold zu holen. Sie brauchten es zum Schutz des Lebens auf ihrem Planeten Nibiru. Schwe­bende Goldpartikel wurden der schwindenden Atmosphäre wie ein Schild beigefügt, so daß Wärme, Luft und Wasser bewahrt blieben. Derartige Pläne der Befürworter der Gäa-Theorie beruhen auf Annah­men und Mutmaßungen: Erstens habe der Mars keine eigenen Lebens­formen; zweitens hätten Geschöpfe eines Planeten das Recht, ihre Lebensformen einer anderen Welt aufzuzwingen, einerlei, ob sie ihr eigenes Leben hat oder nicht. Aber hat Mars Leben, oder – wie manche lieber fragen – hat er es in einer anderen Periode einmal gehabt? Diese Frage beschäftigt alle diejenigen, die eine Mission zum Mars planen oder bereits durchge­führt haben. Nach allem Untersuchen und Fotografieren ist es offen­sichtlich, daß es ein Leben, wie wir es kennen – Bäume und Wälder, Sträucher und Gräser, fliegende Vögel und umherstreifende Tiere –, dort einfach nicht gibt. Doch was ist mit niedrigen Lebensformen, mit Flechten, Algen und den Bakterien? Obwohl der Mars viel kleiner ist als die Erde – seine Masse etwa ein Zehntel, sein Durchmesser ungefähr die Hälfte –, ist seine Oberflä­che, heute nur trockenes Land, den trockenen Landgebieten der Erde vergleichbar. Das zu erforschende Gebiet ist also vergleichbar dein der Erde mit all ihren Kontinenten, Bergen, Tälern, äquatorialen und pola­ren Zonen, den warmen und kalten Gegenden, den Abb. 75 153 Feuchtgebieten und den Wüsten. Vergleicht man die Umrisse der Vereinigten Staaten von Küste zu Küste mit dem Antlitz des Mars, so bekommt man eine Vorstellung davon, wieviel es dort zu erforschen gibt (Abb. 75). Kein Wunder, daß die ersten unbemannten Sonden Mariner 4, 6 und 7 (19651969), die im Vorbeiflug Aufnahmen von der Oberfläche des Mars machten, einen Planet enthüllten, der viele Krater aufwies, die nichts von der früheren vulkanischen Tätigkeit verrieten. Zufällig wa­ren es lauter Aufnahmen von den vulkanischen Bergen auf der südli­chen Halbkugel. Dieses Bild eines leblosen Planeten änderte sich vollständig, als Mariner 9 im Jahr 1971 in eine Umlaufbahn um den Mars gebracht wurde und fast die ganze Oberfläche fotografierte. Man bekam einen lebendigen Planeten mit geologischer Vergangenheit, Vul­kanismus, Flächen und Bergen, Schluchten, die den amerikanischen Grand Canyon verschlucken könnten, und den Spuren fließenden Was­sers zu sehen. Es war nicht nur ein lebendiger Planet, sondern sogar einer, auf dem Leben existieren könnte. Die Viking-Missionen galten nun in erster Linie der Suche nach Leben. Viking 1 und Viking 2 wurden von Cape Canaveral aus im Sommer 1975 abgeschossen und erreichten ihr Ziel im Juli und August 1976. Beide bestanden aus einer Sonde, die zur Übermittlung von Meßdaten und Fernsehaufnahmen in eine Marsumlaufbahn gesteuert wurde, und einem Landegerät, das auf der Oberfläche abgesetzt wurde. Um eine sichere Landung auf der verhältnismäßig flachen Gegend der nördlichen Halbkugel zu gewährleisten, mußten biologische Kriterien, das heißt mögliches Leben, in Betracht gezogen und nicht zu weit vonein­ander entfernte Landestellen ausgesucht werden. Das bestimmte die Entscheidung, welcher Breitengrad gewählt werden sollte. Die Sonden brachten eine reiche Ernte von auswertbarem Material ein, das noch immer nicht vollständig bearbeitet ist; viele neue Einzelheiten und Einsichten haben sich, ergeben. Die Landegeräte übermittelten aufre­gende Bilder, auch Großaufnahmen von der Marslandschaft, und führ­ten auf der Suche nach Leben etliche Experimente durch. Außer den Instrumenten zur Untersuchung und den Kameras hatte jedes Landegerät einen Gaschromatografen für die Untersuchung der Oberfläche nach organischer Materie und drei Instrumente zur Suche nach metabolischer Tätigkeit irgendwelcher Organismen im Boden an Bord. Die entnommenen Bodenproben lieferten keinen lebenden Orga­nismus, nur Kohlendioxyd und eine geringe Menge Wasserdampf. Sosehr die Forscher auch darauf erpicht waren, auf dem Mars Leben zu finden und damit eine Bestätigung ihrer Theorie, daß die Erde aus einer »Ursuppe« entstanden sei, sie mußten leider feststellen, daß es ein hoffnungsloses Unterfangen war. Norman Horowitz von Caltech faßte die vorherrschende Meinung zusammen, als er im Scientific American (November 1977) abschließend schrieb: »Jedenfalls weisen die bisher erforschten Gebiete keine Spur von Leben auf. Möglicherweise gilt das für den ganzen Planeten; aber das Problem ist so kompliziert, daß sich noch nichts Endgültiges sagen läßt.« In den folgenden Jahren ahmten die Forscher, so gut sie konnten, im Laborato154 rium die Bodenbeschaffenheit des Mars nach, und dabei erga­ben sich tatsächlich biologische Reaktionen. Besonders interessant waren die Experimente, die 1980 vom raumbiologischen Institut der Moskauer Universität vorgenommen wurden. Dabei wurden dem nach­empfundenen Marsboden irdische Lebewesen zugesetzt. Vögel und Säugetiere verendeten in wenigen Sekunden, Schildkröten und Frösche blieben viele Stunden am Leben, Insekten wochenlang; Pilze, Flechten, Algen und Moose paßten sich rasch der neuen Umgebung an; Hafer, Roggen und Bohnen gediehen und wuchsen, konnten sich jedoch nicht fortpflanzen. Lebensformen konnten also auf dem Mars existieren, aber war das auch früher der Fall? Viereinhalb Milliarden Jahre hatten der Entwick­lung auf dem Mars zur Verfügung gestanden, und wenn es dort auch einige Mikroorganismen gegeben haben mag (was immerhin fraglich ist), wieso haben sich dann keine höheren Lebensformen entwickelt? Sollten die Sumerer am Ende recht haben mit ihrer Behauptung, auf der Erde sei bald nach ihrer Bildung Leben erschienen, weil ihr die »Saat des Lebens« vom Nibiru gebracht wurde? Der Boden des Mars gibt immer noch Rätsel auf, da man ja nicht einmal weiß, ob die Testreaktionen chemischer oder biologischer Natur oder von lebenden Organismen verursacht worden sind; doch dazu kommen die noch rätselhafteren Gesteine. Am besten beginnt man mit der Forschung auf der Erde. Von den tausenden Meteoriten, die man hier gefunden hat, wurden acht in Indien, Ägypten und Frankreich zwischen 1815 und 1865 entdeckt. Man nennt sie die SNC-Gruppe nach den Initialen der Fundorte. Sie sind insofern einzigartig, als ihr Alter nur etwas über eine Milliarde Jahre beträgt, wohingegen Meteoriten im allgemeinen viereinhalb Milliarden Jahre alt sind. Als man 1979 in der Antarktis noch weitere entdeckte, war die Zusammensetzung der Marsatmosphäre bereits be­kannt. Vergleiche zeigten, daß die SNC-Meteoriten Spuren von isotopischem Stickstoff-14, Argon-40, Neon-20, Krypton-84 und Xenon-13 enthielten, und diese seltenen Gase kommen auch auf dem Mars vor. Wie sind diese Meteoriten auf die Erde gelangt? Warum sind sie nur 1,3 Milliarden Jahre alt? Hat eine Katastrophe bewirkt, daß sie der Anziehungskraft des Mars widerstanden haben und zur Erde geflogen sind? Die in der Antarktis gefundenen Meteoriten sind noch rätselhafter. Eine Aufnahme, die am 1. September 1987 in der New York Times veröffent­licht wurde, zeigt, daß sie nicht fußballförmig sind, wie man sie be­ schrieben hatte, sondern wie ein abgebrochener Felsblock aussehen (Abb. 76), der aus vier künstlich geformten und zusammengesetzten Steinen besteht. Man hätte eher erwartet, sie in den Ruinen der Inka-Zeit im Heiligen Tal von Peru zu finden (Abb. 77), Abb. 76 155 Abb. 77 Abb. 78 aber nicht auf dem Mars. Noch rätselhafter wurde die Sache, als Aufnahmen von der Marsober­fläche Erscheinungen enthüllten, bei deren Anblick die Astronauten sie »Inka-Stadt« getauft hatten. Sie befinden sich auf dem südlichen Teil des Planeten. Es sind abgestufte Mauern aus viereckigen und rechteckigen Steinen (Abb. 78), die Mariner 9 fotografiert hat. John McCaul­ley, ein NASA-Geologe, erklärte, daß sie keine Einbrüche aufweisen und unter den Flächen und kleinen Hügeln wie die Mauern alter Ruinen hervorragen. Diese ungeheuren Mauern aus zusammenhängenden Steinblöcken äh­neln in auffallender Weise den kolossalen Steinblöcken, welche die Basis der großen 156 Plattform in Baalbek in Libanon bilden (Abb. 79), und den gröberen, aber ebenso eindrucksvollen parallelen Mauern von Sacsahuaman über Cusco in Peru (Abb. 80). Diese beiden Strukturen auf der Erde schreibe ich den Anunnaki/Nefilim zu. Die Steingebilde auf dem Mars lassen sich vielleicht durch natürliche Phänomene erklä­ren, und die Größe der fünf bis acht Kilometer langen Blöcke weist eher auf die Hand der Natur als die eines Menschen hin. Doch da es keine einleuchtende natürliche Erklärung für sie gibt, kann man sie ebensogut für die Überreste künstlicher Bauten halten, vorausgesetzt, die Abb. 79 sagenhaften Riesen des Nahen Ostens haben auf dem Mars ge­haust ... Die »Kanäle«, die der italienische Astronom Schiaparelli 1882 auf dem Mars entdeckt hat, wurden lange Zeit als Einschnitte abgetan, bis sich herausgestellt hat, daß es tatsächlich ausgetrocknete Flußläufe sind. Man fand aber noch an- Abb. 80 157 dere Gebilde, die sich nicht erklären ließen. Dazu gehören weiße Streifen, die sich kilometerweit in gerader Linie erstrecken, teils parallel, teils gewinkelt und manchmal überlagert von schmaleren Streifen (Abb. 81 ist eine skizzierte Fotografie). Wieder einmal meinten die NASA-Forscher, Staubstürme könnten die Erschei­nungen verursacht haben. Das mag sein, aber die Abb. 81 Regelmäßigkeit und vor allem die Kreuzungen weisen doch eher auf einen künstlichen Ursprung hin. Wenn man eine vergleichbare Erscheinung auf der Erde sucht, muß man sich die berühmten Nasca-Linien in Südperu ansehen, die den »Göttern« zugeschrieben worden sind (Abb. 82). Sowohl der Nahe Osten als auch die Anden sind berühmt für ihre verschiedenen Pyramiden, die ungeheuren und einzigartigen von Gise, die Zikkurate in Mesopotamien und die Pyramiden der nischen Zivilisationen. frühen amerika­ Die Mariner- und Viking-Aufnahmen zeigen, daß es auch auf dem Mars Pyramiden oder etwas ähnlich Aussehendes gibt. Die vermeintlichen dreiseitigen Pyramiden auf dem Elysium-Plateau in Abb. 82 dem Gebiet, das Trivium Charontis heißt (Abb. 83), wurden zuerst auf dem Mariner-9-Rasterbild, aufgenommen am 8. Februar 1972, und dann auf dem sechs Monate später aufgenommenen Bild 4205-78 bemerkt. Man befaßte sich im besonderen mit zwei »dreiseitigen pyrami­denähnlichen Strukturen«, wie die Wissenschaftler sich vorsichtig aus­ drückten, zwei größeren und zwei kleineren, die rautenförmig angelegt zu sein scheinen (Abb. 84). Wieder ließ die Größe der »Pyramiden« – die größte hatte einen Durchmesser von dreitausend Metern und war tausend Meter hoch – an ein natürliches Gebilde denken, und Victor Ablordeppy und Mark Gipson brachten in einer Studie (Icarus, Bd. 22, 1974) vier Theorien für die natürliche Entstehung vor. Aber David Chandler (Leben auf dem Mars) und der Astronom Francis Graham (Frontiers of Science, November/Dezember 1980) erbrachten den Nachweis für die Unhalt­ 158 Abb. 83 barkeit aller vier Theorien. Die Tatsache, daß die Gebilde in einem zeitlichen Abstand von sechs Monaten aufgenommen worden waren, bei unterschiedlicher Beleuchtung und aus verschiedenen Winkeln, und dennoch dieselbe dreiseitige Form hatten, überzeugte viele, daß es künstliche Strukturen Abb. 84 seien, obwohl man keinen Grund für ihre Größe angeben konnte. »Da es vorläufig keine annehmbare Erklärung gibt«, schrieb Chandler, »ist die offensichtlichste Schlußfolgerung nicht von der Hand zu weisen: Vielleicht wurden sie von intelligenten Lebewesen erbaut.« Und Francis Graham sagte: »Die Annahme, daß Marsbewoh­ner sie geschaffen haben, muß unter den Theorien über ihre Entstehung einen Platz einnehmen.« Er fragte sich, ob zukünftige Forscher in den Strukturen wohl innere Kammern, verdeckte Eingänge und Inschriften finden würden, die zehntausend159 Tafel E jähriger Winderosion widerstanden ha­ben. Noch mehr »Pyramiden« mit unterschiedlicher Anzahl von glatten Wänden entdeckte man bei der Auswertung der Marsaufnahmen. Das Interesse und die Kontroversen galten hauptsächlich dem Gebiet Cydonia (siehe Marskarte), weil eine Gruppe von künstlichen Strukturen auf ein östlich liegendes Gebilde ausgerichtet zu sein scheint, das man als »Marssphinx« bezeichnet, wie aus der NASA-Rundaufnahme 035-A-72 (Tafel E) zu ersehen ist. Bemerkenswert ist ein Steingebilde mit den Zügen eines Menschengesichts (Abb. 85), anscheinend mit einer Art Helm auf dem Kopf, mit leicht geöffnetem Mund und Augen, die den Betrachter anblicken, wenn er sich am Himmel über dem Mars befin­det. Wie die anderen, vermeintlich künstlichen Gebilde auf dem Mars hat auch dieses »Monument« übergroße Proportionen: Das Gesicht mißt fast eintausendsechshundert Meter von oben bis unten und ragt schätzungsweise achthundert Meter über das umgebende Plateau empor. Obwohl es heißt, der NASA-Forscher, der diese Aufnahme von Viking 1 am 25. Juli 1976 erhielt, sei »fast vom Abb. 85 160 Stuhl gefallen« und habe so etwas wie »O mein Gott!« ausgerufen, wurde die Aufnahme mit tau­send anderen Fotos zu den Akten gelegt, ohne daß irgend etwas unter­nommen worden wäre, weil die Ähnlichkeit mit einem Menschen­ gesicht auf nichts anderem beruhe als auf einem Spiel von Licht und Schatten infolge einer Erosion durch Naturgewalten (Wasser, Wind). Als einige Journalisten, die das Bild zufällig gesehen hatten, wissen wollten, ob es wirklich ein Menschengesicht sei, wurde ihnen versi­chert, ein anderes, einige Stunden später aufgenommenes Bild zeige kein Gesicht mehr. In späteren Jahren mußte die NASA zugeben, das sei eine falsche und irreführende Auskunft gewesen, denn »einige Stunden später« wäre das ganze Gebiet in nächtliche Dunkelheit ge­hüllt gewesen, und es würde noch andere Aufnahmen geben, die das Gesicht deutlich zeigten. Drei Jahre später stieß Vincent DiPietro, ein Elektrotechniker, der sich erinnerte, das Gesicht in einer Zeitschrift gesehen zu haben, auf die Fotografie, als er im Archiv des Datenzentrums der Raumforschung arbeitete. Das Foto trug die Katalognummer 76-A-593/17384 und war schlicht und einfach als »Kopf« betitelt. Neugierig gemacht durch die Entscheidung, das Bild ohne jede nähere Bezeichnung im Archiv zu vergraben, machte er sich zusammen mit Greg Molenaar, einem Infor­matiker, auf die Suche nach weiteren NASA-Aufnahmen. Sie wurden fündig. Außer dem Foto 070-A-13 (Tafel F) fanden sie mehrere Auf­nahmen des Gebiets Cydonia, die die Viking-Sonde bei verschiedenen Umkreisungen sowohl von der rechten als auch von der linken Seite gemacht hatte. Auf allen waren das Gesicht und pyramidenähnliche Gebilde zu sehen. Mittels Computerauswertung stellten DiPietro und Molenaar Vergrößerungen und deutlichere Bilder her, die sie überzeug­ten, daß das Gesicht eine Bildhauerarbeit sein muß. Mit diesen Bildern nahmen sie an einer Mars-Konferenz teil, aber anstatt von den versammelten Forschern Beifall zu erhalten, erfuhren sie nur Ablehnung, Tafel F 161 zweifellos aus folgendem Grunde: Wenn man zugegeben hätte, daß das Gesicht das Werk eines intelligenten Lebewe­sens ist, müßte man den Schluß ziehen, daß es einstmals Marsmen­schen gegeben hat, und das war eine unannehmbare Mutmaßung. DiPietro und Molenaar veröffentlichten ihre Befunde im Eigenverlag in dem Buch Unusual Mars Surface Features, in dem sie sich von den »wilden Spekulationen« über den Ursprung der ungewöhnlichen Er­scheinungen lossagten. Ihr Anliegen war es, wie es im Nachwort heißt, zu informieren, daß die seltsamen Erscheinungen näher untersucht werden müßten. Aber die NASAWissenschaftler lehnten es strikt ab, sich bei zukünftigen Missionen mit dem Gesicht zu befassen, da es ja nichts weiter sei als ein Felsen, dem Naturgewalten zufällige Ähnlich­keit mit einem Menschengesicht verliehen hätten. Der Fall des Gesichts auf dem Mars wurde dann von Richard C. Hoag­land wiederaufgenommen, einem Sachbuchautor und früheren Berater des GoddardRaumfahrt-Instituts. Er stellte eine Gruppe unabhängiger Marsforscher zusammen, die es sich zur Aufgabe machte, die Erschei­nungen auf dem Mars von Spezialisten untersuchen zu lassen; zu ihr gehörten der Astronaut und Forscher Brian O’Leary und David Webb, früher ein Mitglied der staatlichen RaumfahrtKommission. Auf einer Konferenz waren sie sich einig, daß das »Gesicht« und die »Pyrami­den« auf dem Mars künstliche Gebilde seien, vertraten aber auch die Meinung, daß dies noch auf andere Dinge zutreffen könnte. Mich interessierte an ihrem Bericht besonders die Vermutung, daß das Gesicht und die Hauptpyramide etwa vor einer halben Million Jahren geschaffen worden seien, und zwar in einer Linie mit dem Sonnenauf­gang während einer Sonnenwende auf dem Mars. Als Hoagland und sein Mitarbeiter Thomas Rautenberg, ein Informatiker, von mir wissen wollten, was ich von ihren fotografischen Beweisen hielte, sagte ich ihnen, daß die Anunnaki/Nefilim nach meinen Schlüssen im Buch Der zwölfte Planet das erste Mal vor rund vierhundertfünfzigtausend Jah­ren auf der Erde gelandet seien; vielleicht sei es kein Zufall, daß ihre Zeitangabe für die Entstehung der Monumente auf dem Mars mit meiner Zeittafel übereinstimmte. Da die Veröffentlichungen von DiPietro, Molenaar und Hoagland über­all bekannt waren, sah die NASA sich veranlaßt, darauf zu bestehen, daß sie sich irrten. Das staatliche Raumfahrtzentrum in Greenbelt (Maryland), das dem Publikum die NASA-Daten unterbreitete, unter­nahm einen ungewöhnlichen Schritt: Es fügte den Aufnahmen von dem »Gesicht« den dreiseitigen Aufsatz bei, den Paul Butterworth, der Planetologe des Zentrums, am 6. Juni 1987 verschicken ließ. Darin war zu lesen: »Es besteht kein Grund zu glauben, daß gerade dieser Berg, der Zehntausenden von anderen Bergen auf dem Mars gleicht, nicht das Ergebnis der natürlichen geologischen Prozesse ist, die auch alle anderen Landformen auf dem Mars geschaffen haben. Es ist nicht verwunderlich, wenn unter den vielen dortigen Bergen einige an be­kannte Dinge erinnern, und nichts ist bekannter als das Menschen­gesicht. Ich suche immer noch die ›Hand auf dem Mars‹ und den ›Fuß auf dem Mars‹!« »Kein Grund zu glauben«, daß etwas nicht von der Natur geschaffen sei, das 162 ist natürlich kein sachliches Argument, eine gegenteilige An­sicht zu entkräften, wenn die Widersacher allen Grund haben, die Erscheinungen für künstliche Gebilde zu halten. Immerhin ist es wahr, daß manche Hügel oder Berge auf der Erde wie herausgemeißelte Menschen- oder Tierköpfe aussehen, obwohl die Natur sie geschaffen hat. Das könnte allerdings ein Argument sein, was die Pyramiden auf dem Elysium-Plateau des Mars betrifft. Aber das Gesicht und einige Strukturen in der Nähe, die glatte Mauern haben, bleiben ein Rätsel. Wissenschaftlich bedeutend ist die Studie von Mark J. Carlotto, einem Optiker, die er im Mai 1988 in der angesehenen Zeitschrift Applied Optics veröffentlicht hat. Mit Computergrafik hat er aus vier verschie­denen Viking-Aufnahmen eine dreidimensionale Darstellung des Ge­sichts angefertigt, die erkennen läßt, daß der »Kopf« tatsächlich ein bisymmetrisches Menschengesicht ist, mit einer zweiten Augenhöhle auf der schattigen Seite und einem feingezeichneten Mund, der Zähne zu enthalten scheint. »Das sind«, schrieb Carlotta, »menschliche Züge, das ist kein Phänomen oder Spiel von Licht und Schatten. Wenn die Viking-Daten auch bisher noch nicht erkennen lassen, wie das Gesicht entstanden sein mag, so ist es doch klar, daß die Natur es nicht hervorge­bracht hat.« Die Redaktion der Zeitschrift Applied Optics maß dem Artikel so große Bedeutung bei, daß sie ihn als Titelgeschichte brachte, und das wissen­schaftliche Journal New Scientist veröffentlichte einen Bericht darüber sowie ein Interview mit dem Autor. In dem Bericht stand, die rätselhaf­ten Objekte – das Gesicht und die nahen Pyramiden, die den Namen Inka-Stadt erhielten –, »verdienten ebenso nähere Untersuchungen wie die sowjetische Phobos-Mission«. In der Tat hatte die zensierte sowjetische Presse mehrere Artikel von Wladimir Awinsky veröffentlicht, einem bekannten Geologen und Mi­neralogen, der den Monumenten den natürlichen Ursprung absprach. Bemerkenswert sind zwei Punkte, auf die er hinwies. In Anbetracht der enormen Größe der Marsformationen müsse man bedenken, daß der Mensch wegen der geringen Anziehungskraft des Planeten dort giganti­sche Arbeiten ausführen könne. Außerdem hielt er den dunklen Kreis, der auf dem flachen Gebiet zwischen dem Gesicht und den Pyramiden deutlich zu sehen ist, für sehr wichtig. Die NASA-Wissenschaftler hatten ihn als »einen Wassertropfen auf der Linse der Kamera« abge­tan, aber Awinsky betrachtete ihn als »den Mittelpunkt der ganzen Konstruktion des Marskomplexes und ihrer Anlage« (Abb. 86). Sofern man nicht annimmt, daß die Erdlinge vor Jahrtausenden oder gar Jahrmillionen über eine hohe Zivilisation und eine ausgeklügelte Technik verfügten, so daß sie imstande waren, zum Mars zu fliegen und dort Monumente wie das Gesicht zu errichten, dann bleiben logischer­ weise Abb. 86 163 nur zwei Möglichkeiten. Die erste: Auf dem Mars hatten sich intelligente Lebewesen entwickelt, die nicht nur megalithische Kon­struktionen errichten konnten, sondern uns zufällig auch noch ähnlich sahen. Aber da der Marsboden nicht einmal Mikroorganismen enthält und keine Spur von Pflanzenund Tierleben aufweist, menschen das dem Mars­ Abb. 87 die benötigten Proteine geliefert hätte, ist es höchst unwahr­scheinlich, daß sich eine menschenähnliche Marsbevölkerung entwickelt hat. Es bleibt nur noch die zweite Möglichkeit: Lebewesen, die vor einer halben Million Jahren imstande waren, Raumfahrten zu unterneh­men, sind in diesen Teil des Sonnensystems gelangt und haben sowohl auf der Erde als auch auf dem Mars Monumente hinterlassen. Die einzigen, für die man Beweise gefunden hat – nämlich die sumeri­schen und biblischen Texte, auch alle die alten »Mythologien« –, sind die Anunnaki vom Nibiru. Wir wissen, wie sie aussahen: Sie sahen wie wir aus, denn sie haben uns »nach ihrem Bild, ihnen gleich« erschaffen. Ihre Menschengesichter erscheinen auf zahlreichen alten Abbildungen, auch bei der berühmten Sphinx von Gise (Abb. 87). Das Gesicht ist laut ägyptischen Inschriften das von Hor-em-Achet, dem Falkengott des Horizonts, also von Ra, Enkis erstgeborenem Sohn, der in seiner Himmelsbarke ins Weltall fliegen konnte. Die Sphinx von Gise war so ausgerichtet, daß sie genau ostwärts am 30. Breitengrad entlang zum Flughafen der Anunnaki auf der Sinai­halbinsel blicken konnte. Die alten Texte, die übrigens auch von unter­irdischen Kammern sprechen, schreiben der Sphinx Kommunikations­funktionen zu: »Eine Botschaft ist vom Himmel gesandt; sie wird in Heliopolis gehört und in Memphis vom schönen Gesicht wiederholt. Sie ist zusammengefaßt in einem Schreiben von Thoth im Hinblick auf die Stadt Amens ... Die Götter handeln gemäß dem Befehl.« Die Bezugnahme auf die Botschaften übermittelnde Rolle des »schö­nen Gesichts« – der Sphinx von Gise – führt zu der Frage, welchem Zweck das Gesicht auf dem Mars wohl diente; denn wenn es wirklich das Werk intelligenter Lebewesen gewesen war, dann haben sie sicher nicht grundlos Zeit und Mühe für eine solche Arbeit aufgewendet. Bestand der Zweck darin – wie es nach der ägyptischen Inschrift scheint –, die »Botschaft vom Himmel« der Sphinx auf der Erde 164 zukommen zu lassen, also in einem Befehl, dem die Götter dann folgen würden? Handelt es sich um Mitteilungen von einem Gesicht zum anderen? Wenn das der Zweck des Gesichts auf dem Mars war, braucht man sich nicht zu wundern, daß in der Nähe, genau wie in Gise, Pyramiden stehen. In Gise sind es drei, zwei groAbb. 88 ße und eine kleinere, in Symmetrie zueinander und zu der Sphinx. Auch auf dem Mars sind es drei. In meinen Erdchronik-Büchern habe ich zur Genüge bewiesen, daß die Pyramiden in Gise nicht das Werk von Pharaonen sind, sondern daß die Anunnaki sie geschaffen haben. Vor der Sintflut befand sich ihr Flug­hafen in Mesopotamien, und zwar in Sippar (Vogelstadt). Nach der Sintflut wurde der Flughafen auf die Sinaihalbinsel verlegt, und die beiden großen Pyramiden von Gise, zwei künstliche Berge, dienten als Signaltürme für den Landekorridor, dessen höchster Punkt der Ararat war. Wenn das auch die Funktion der Pyramiden im Cydonia-Gebiet war, dann müßte sich ein Zusammenhang mit dem höchsten Punkt auf dem Mars, nämlich der Nix Olympica, finden lassen. Als die Anunnaki das Zentrum ihrer Goldproduktion von Südostafrika in die Anden verlegten, wurden die metallurgischen Werkstätten am Titicacasee errichtet, dort, wo heute die Ruinen von Tiahuanacu und Puma-Punku sind. Die pyramidalen Monolithbauten in Tiahuanacu, das mit dem See durch Kanäle verbunden Abb. 89 165 Tafel G Tafel H war, hießen Akapana. Darin wurde das Gold verarbeitet. Die Kalasasaja, ein viereckiger, »ausgehöhlter« Bau (Abb. 88), diente astronomischen Zwecken; sie war nach den Sonnenwenden ausgerichtet. Puma-Punku lag am Seeufer; hier lagen die Hauptbauten, »goldene Einfriedungen« mit Mauern aus ungeheuren Steinblöcken an einem Zickzackpier (Abb. 89). Von den ungewöhnlichen Erscheinungen auf dem Mars, die von den kreisen166 den Kameras eingefangen wurden, sind zwei bestimmt künst­lich, und beide gleichen den Bauten am Titicacasee in den Anden. Die eine, die der Kalasasaja gleicht, westlich des Gesichts, ist auf Tafel E zu sehen, über dem geheimnisvollen dunklen Kreis. Wie eine Vergröße­rung (Tafel G) zeigt, besteht der südliche Teil aus massiven, geraden Mauern, die sich in einem Winkel treffen, der auf der Fotografie spitz wirkt, aber in Wirklichkeit ein rechter Winkel ist. Der nördliche Teil des Baus, der unmöglich natürlich sein kann, muß einem katastrophalen Aufprall ausgesetzt gewesen sein, denn er ist total zertrümmert. Die andere Erscheinung, die nicht das Ergebnis natürlicher Erosion sein kann, wurde südlich des Gesichts aufgenommen, in einem chaoti­schen Gebiet. Allgemein herrscht die Ansicht, daß dies das Ufer eines-alten Marsmeeres oder Sees ist (Tafel H). Man darf nicht vergessen, daß alle Aufnahmen aus zweitausend Kilometer Höhe gemacht worden sind, so daß es zweifelhaft scheinen mag, daß man hier Piere vor sich hat. Beide Erscheinungen, die sich nicht mit einem Spiel von Licht und Schatten abtun lassen, gleichen also den Einrichtungen und Bauten am Titicacasee. Aber sie bekräftigen nicht nur meine Annahme, daß sie von denselben Lebewesen – den Anunnaki – geschaffen worden sind, sondern sie erklären auch Zweck und Funktion (Tafel I und J). Die Anlagen des Luftverkehrs der Anunnaki auf Erden bestanden laut den sumerischen und ägyptischen Schilderungen aus Kontrollzentrum, Landungssignalen, einer unterirdischen Raketenabschußrampe und ei­ner natürlichen Fläche für die Pisten. Das Kontrollzentrum und manche Signalanlagen waren ziemlich weit Tafel I 167 Tafel J entfernt vom Flughafen. Als der Flughafen auf der Sinaihalbinsel lag, war das Kontrollzentrum in Jeru­salem und die Hauptsignalanlage in Gise. Die dortige Raketenabschuß­rampe, die auf ägyptischen Grababbildungen zu sehen ist (siehe Vignette am Ende dieses Kapitels) wurde durch Kernwaffen im Jahr 2024 v. Chr. zerstört. Ich vermute, daß die Nazca-Linien in den Anden der sichtbare Beweis dafür sind, daß diese unfruchtbare, vollkommene Fläche als Pisten für Shuttles benutzt worden sind. Auch die gekreuzten Linien auf dem Mars (siehe Abb. 81) könnten denselben Beweis lie­fern. Diese sogenannten Gleise sehen aus wie Kratzer auf Linoleum. Man hat sie als geologische Erscheinungen erklärt, als natürliche Sprünge in der Marsoberfläche. Aber auf Tafel K ist zu erkennen, daß sie von einem erhöhten geometrischen Gebilde ausgehen, das teilweise von Sand 168 Tafel K Abb. 90 bedeckt ist. Eine andere Orbitaufnahme (Abb. 90) zeigt einige »Gleise« auf einer Böschung über dem großen Canyon in der Nähe des Äquators. Sie folgen nicht immer den Gegebenheiten des Terrains, sondern schneiden sich in einem Muster, das nicht natürlich sein kann. Angenommen, ein außerirdisches Raumfahrzeug sucht Lebenszeichen auf der Erde außerhalb der Städte, so würden die Landstraßen und die regelmäßigen Muster der bebauten Flächen die Anwesenheit intelli­ genter Lebewesen verraten. Die NASA selbst hat den Beweis für landwirtschaftliche Tätigkeit auf dem Mars geliefert. Auf Tafel L sind parallel verlaufende Furchen zu sehen, die es vergleichbar auch in den Bergen des Heiligen Tales in Peru gibt. Das Pressebüro Tafel L 169 der NASA ließ bei der Herausgabe der Aufnahme am 18. August 1976 folgendes verlauten: »Auf diesem Marsbild, das Viking 1 am 12. August aus 2053 Kilome­ter Entfernung aufgenommen hat, sind so regelmäßige Markierungen zu sehen, daß sie fast künstlich erscheinen. Sie befinden sich in einer leichten Senke oder einem Becken, das möglicherweise durch Winderosion entstanden ist. Sie sehen fast wie die Luftaufnahme eines gepflügten Ackers aus.« Die Ähnlichkeit mit »einem gepflügten Acker« ist dem Pressechef Michael Carr also aufgefallen. Er bemerkte ferner: »Wir erhalten recht sonderbare Dinge, es ist sehr verwirrend ... Man kann kaum an eine natürliche Ursache glauben, weil die Furchen so regelmäßig sind.« Vielleicht ist die Gegend, von der die Aufnahme stammt, keine Überra­schung: Es ist das Cydonia-Gebiet, wo sich das Gesicht und andere rätselhafte Erscheinungen befinden! Im Elysium-Gebiet, wo die drei­seitigen Pyramiden stehen, sind Erscheinungen fotografiert worden, die an künstliche Bewässerung erinnern (Tafel M); sie werden Waffel­muster genannt. Es heißt, das Muster rühre von »Schmelzwasser-Ablagerungen mit Ausflußkanälen« her, einem »natürlichen Ergebnis der Wechselwirkung zwischen vulkanischer Tätigkeit und Bodeneis«; dadurch sei es zu Einbrüchen gekommen. Aber das Waffelmuster äh­nelt dem kürzlich entdeckten, landwirtschaftlichen Verfahren der alten Zivilisationen in Mittel- und Südamerika: Diese Völker konnten in regenarmen Gebieten nur mit einer Ernte rechnen, wenn sie Humus­inseln aufschichteten, die von Bewässerungskanälen umgeben waren. Gäbe es nicht alle die anderen Beweise für die rätselhaften Erscheinun­gen auf dem Mars, könnte man die übliche Erklärung der NASA, es handle sich um einen natürlichen Pro- 170 Tafel M zeß, gelten lassen; so aber ist es wohl gerechtfertigt, auch in dieser Aufnahme den Beweis für überlegte Tätigkeit auf dem Mars zu sehen. Da die Anunnaki die Planeten von außen nach Abb. 91 innen zählten, war Mars der sechste. Die Sumerer stellten ihn als sechszackigen Stern dar, die Erde als siebenzackigen oder nur mit sieben Punkten. Wenn man diese Symbole kennt, kann man eine erstaunliche sumerische Abbildung eines Rollsiegels deuten (Abb. 91). Darauf ist ein Raumschiff mit Sonnensegeln und ausgefahrenen Antennen zu sehen, das zwischen dem sechsten und siebenten Planeten, das heißt zwischen Mars und Erde, durchfliegt; die Erde wird von einer Mondsichel, dem Mond­symbol, begleitet. Ein geflügelter Anunnaki – so wurden die Astro­nauten dargestellt – hält ein Instrument in der Hand und begrüßt einen anderen, der sich offensichtlich auf dem Mars befindet. Er hat einen Helm auf, an dem ein Apparat befestigt ist, und hält ebenfalls ein Instrument in der Hand. Der eine scheint zum anderen zu sagen: »Das Raumschiff ist jetzt auf dem Weg vom Mars zur Erde.« Die beiden Fische unterhalb des Raumfahrzeugs bedeuten das Tierkreiszeichen der Fische. Zahlreiche sumerische, akkadische und babylonische Gestirnslisten, geschrieben auf Tontafeln, sind von Archäologen gefunden worden. Auch die Gestirne hatten, wie es üblich war, Beinamen, die etwas bedeuteten. Ein Beiname des Planeten Mars war Simug (Schmied), zu Ehren des Gottes Nergal, mit dem der Planet verbunden war. Als Enkis Sohn war er mit der afrikanischen Domäne betraut, wo sich die Gold­minen befanden. Mars trug auch den Namen Utukagaba, das heißt: Licht am Tor der Wasser. Er bezieht sich entweder auf seine Stellung in der Nähe des Asteroidengürtels, der das untere Wasser vom oberen trennt, oder auf die Wasserquelle der Astronauten, die jenseits der gefährlicheren und weniger gastfreundlichen Riesenplaneten Saturn und Jupiter vorbeikamen. Noch interessanter sind die sumerischen Listen mit den Gestirnen, an denen die Anunnaki auf ihrer Raumfahrt zur Erde vorbeikamen. Darauf wird Mars als Mul Apin (Planet, wo der richtige Kurs eingeschlagen wird) bezeichnet. Dieser Name kommt auch auf einer erstaunlich run­den Tafel vor, die nichts anderes ist als eine von Enlil geschaffene Routenkarte für den Flug vom Nibiru zur Erde, auf der beim Mars die Abzweigung nach rechts eingetragen ist. Welche Rolle der Mars und die dortigen Anlagen für die raumfahrenden Anunnaki gespielt haben, macht der babylonische Text für das Akitu-Fest klar. Nach sumerischer Überlieferung wurden dabei die Riten und symbolischen Vorgänge der zehntägigen Neujahrszeremonien aufge­führt. Zu der Akitu-Aufführung gehörte die Darstellung der Raumfahrten vom Ni171 biru/Marduk zur Erde. Jedes Gestirn, an dem die Astronauten vorbeikamen, wurde durch eine Zwischenstation bei der religiösen Prozession versinnbildlicht, und ihre Bezeichnung entsprach der Rolle, die es gespielt hatte. Mars hieß »Schiff des Weitgereisten«. Meiner Meinung nach bedeutet dies, daß die Astronauten hier in kleinere Raumschiffe umstiegen, die sie auf ihrem Weg zur Erde und zurück benutzten. Das Kommen und Gehen zwischen dem Mars und der Erde vollzog sich wohl nicht nur einmal alle dreitausendsechshundert Jahre, sondern viel öfter. Die Raumfähren wurden dann an die Satelliten gekoppelt, in denen die Igigi die Erde umkreisten und die die Raumfah­rer weiterbeförderten. Die heutigen Raumfahrtplaner machen sich fast dasselbe Bild von einer etappenweisen Raumfahrt als der besten Möglichkeit, die Schwerkraft der Erde zu überwinden. Sie wollen sich die Schwerelosigkeit in den kreisenden Satelliten und die geringere Schwerkraft des Mars (sowie des Mondes) zunutze machen. Auch in diesem Punkt holt die moderne Wissenschaft nur das alte Wissen ein. Sowohl die uralten Texte und Abbildungen als auch die fotografischen Daten von der Oberfläche des Mars und die Ähnlichkeit zwischen den Strukturen auf dem Mars und auf der Erde lassen nur einen einleuch­tenden Schluß zu: Der Mars diente irgendwann in seiner Vergangenheit als Raumstation. Es gibt sogar Zeugnisse dafür, daß die alte Raumstation wiederbelebt worden ist – heute, in unserer Zeit. 172 Ein Bild, das Aufmerksamkeit erregt hat Nach dem Tod des ägyptischen Vizekönigs Huy wurde sein Grabmal mit Szenen aus seinem Leben und seinem Werk als Gouverneur von Nubien und Sinai während der Herrschaft des namhaften Pharaos Tut-ench-Amun geschmückt. Darunter war die Abbildung eines Raketenflugzeugs in einem Silo. Die Kom­mandokapsel befindet sich über der Erde, umgeben von Palmen und Affen. Dieses Bild in meinem Buch Der zwölfte Planet zog die Aufmerksamkeit des NASA-Ingenieurs Stuart W. Greenwood auf sich. Er schrieb darüber einen Arti­kel, der in der Zeitschrift Ancient Skies (Juli/August 1977), herausgegeben von der Ancient Astronauts Society, veröffentlicht wur­de. Für ihn hatte es Aspekte, die Kenntnisse von ausgeklügelter Technik verrieten, und er betonte vier »hochinteressante Punkte«: 1. Die Tragflächen­profile, die die Rakete umgeben, scheinen sich dafür zu eignen, als Wände für eine Brennstoffzuleitung zu dienen, die die Schub­kraft bewirkt. 2. Die Kapsel über der Erde erinnert an die Gemini-Kapsel mitsamt ihren Fenstern. 3. Die verkohlte Oberfläche und das abgestumpfte Ende. 4. Der ungewöhnliche Bolzen ähnelt den Bolzen, die von der NASA vergeblich erprobt wurden, um den Strömungswiderstand der Kapsel zu vermindern; aber nach dieser Darstellung zu urteilen, scheint er brauchbar zu sein, und man könnte damit das Überhitzungsproblem lösen, das die NASA nicht zu bewältigen vermochte. Er folgerte: »Wenn das auf dem Bild dargestellte Verhältnis der Anordnung auch für den Flug Gültigkeit hat, würde die Kopf­welle etwa Mach 3 bewirken.« (Mach 3 = dreifache Schallge­schwindigkeit) 173 12 Phobos: Panne oder Krieg der Sterne? Am 4. Oktober 1957 schoß die Sowjetunion den ersten Satelliten ab, Sputnik 1, und eröffnete damit einen Weg, der den Menschen zum Mond und seine Raumfahrzeuge über den Rand des Sonnensystems hinaus führte. Am 12. Juli 1988 schoß die Sowjetunion eine unbemannte Raumsonde namens Phobos 2 ab, wodurch es vielleicht zu einem Krieg der Sterne gekommen ist. Phobos 1 war im Juli 1988 von der Erde abgehoben, das Ziel war der Mars. Zwei Monate später ging die Sonde angeblich infolge eines falschen Radiokommandos verloren. Phobos 2 aber konnte in die Umlaufbahn um den Mars gelenkt werden. Das war der erste Schritt zur Erfüllung seines eigentlichen Zweckes, nämlich den kleinen Mars­satelliten Phobos – daher der Name des Raumflugkörpers – zu umkreisen und mit ihm zusammen um den Mars zu fliegen. Dieser Mond sollte erforscht werden, nicht nur vom Raumschiff aus, sondern auch mit abzusetzenden Geräten. Alles ging soweit gut. Dann aber, am 28. März 1989, bekam die sowjetische Missionskontrolle plötzlich Schwierigkeiten, und die rus­sische Nachrichtenagentur Tass meldete, Phobos 2 habe keine Verbin­dung mehr mit der Erde, nachdem die Raumsonde den Marsmond Phobos umkreist habe. Die Radioverbindung mit der Erde sei abgebro­chen. Das erweckte den Eindruck, als wäre das Problem keineswegs unlös­ bar, sondern die Leute im Kontrollraum wären damit beschäftigt, den Schaden zu beheben und die Verbindung wiederherzustellen. Sowohl die Vertreter des sowjetischen Raumfahrtprogramms als auch die west­lichen Spezialisten wußten, daß die Phobos-Mission einen ungeheuren Aufwand von Geld, Planung, Arbeit und Prestige bedeutete. An dem Vorhaben waren dreizehn europäische Länder beteiligt, und auch amerikanische Wissenschaftler hatten mitgewirkt. Es war also ein interna­tionales Unternehmen unter sowjetischer Führung. Insofern ist es ver­ständlich, daß das »Problem« als Unterbrechung der Verbindung, die in einigen Tagen behoben sein würde, hingestellt wurde. Die sowjetischen Medien, Fernsehen und Presse, verharmlosten den Vorfall und beton­ten, daß man sich bemühte, die Verbindung wiederherzustellen. Nicht einmal die amerikanischen Wissenschaftler, die an dem Projekt mitge­arbeitet hatten, wurden über den wahren Zusammenhang unterrichtet, sondern ihnen wurde erklärt, die Ursache der unterbrochenen Verbin­dung sei eine Panne an einer Sendeeinheit mit niedriger Stromstärke, mit der man den schon vorher zusammengebrochenen Hauptsender ersetzt hatte. Während der Öffentlichkeit immer noch versichert wurde, die Panne werde bald behoben sein, gab Nikolai A. Simjonow, ein hoher Beamter des sowjetischen Raumfahrtamtes, den Hinweis, daß keine solche Hoff­nung bestünde. Er sagte: »Phobos 2 ist zu neunundneunzig Prozent für immer verloren.« Seiner 174 Wortwahl – nicht mit der Verbindung sei es für immer aus, sondern die Sonde selbst sei verloren – schenkte niemand Beachtung. Am 30. März erwähnte Esther B. Fein in einem Sonderbericht von Moskau für die New York Times, in den Abendnachrichten des sowjeti­schen Fernsehens sei »eine schlechte Neuigkeit vom Phobos gemeldet worden« und um so mehr die vielversprechende Suche nach der Sonde betont worden. Sowjetische Wissenschaftler hätten auf dem Bildschirm Aufnahmen gezeigt, aber gesagt, es sei immer noch nicht klar, was für Hinweise sie bedeuteten. Von welchen »Hinweisen« war da die Rede? Das wurde am folgenden Tag klarer, denn europäische Zeitungen (nicht die amerikanischen) sprachen von einem »unbekannten Objekt« auf den letzten Aufnahmen der Sonde, die einen »unerklärlichen« Gegen­stand oder einen »elliptischen Schatten« auf dem Mars zeigten. Die spanische Zeitung La Epoca betitelte zum Beispiel den Bericht des Moskauer Korrespondenten der europäischen Nachrichtenagentur EFE mit der Schlagzeile: »Phobos 2 hat seltsame Fotos vom Mars eingefan­gen, und zwar ein paar Sekunden vor der Unterbrechung der Verbin­dung« (Abb. 92). Der Text lautet folgendermaßen: »In den gestrigen Abendnachrichten des Fernsehens wurde ge­sagt, die Raumsonde Phobos 2, die den Mars umkreiste, hätte, bevor man am Montag die Verbindung mit ihr verlor, ein paar Sekunden vorher ein unbekanntes Objekt auf dem Mars fotogra­fiert. Das Fernsehen widmete den merkwürdigen Bildern eine ausführ­liche Sendung und zeigte die beiden wichtigsten Aufnahmen, auf denen ein Abb. 92 175 großer Schatten zu sehen ist. Wissenschaftler erklärten dazu, die dünne Ellipse auf dem einen Bild sei ›unerklärbar‹. Das Phänomen, hieß es, könne keine optische Täuschung sein, weil es mit gleicher Deutlichkeit sowohl von einer Farbkamera als auch von Kameras, die infrarote Bilder ergeben, aufgenom­men worden ist. Eines der Mitglieder der Bodenkontrolle, die rund um die Uhr die Verbindung mit der verlorenen Sonde wiederherzustellen ver­suchten, sagte im Fernsehen, das Objekt sehe wie ein Schatten auf der Marsoberfläche aus. Nach den Berechnungen der russischen Forscher ist der Schatten auf dem letzten Foto ungefähr zwanzig Kilometer lang. Einige Tage zuvor hatte die Raumsonde bereits ein ähnliches Phänomen gesichtet, nur daß in diesem Fall der Schatten ungefähr dreißig Kilometer lang war. Der Moderator der Sendung fragte ein Mitglied der Sonderkom­mission, ob die Form der Erscheinung nicht an ein Raketenflug­zeug denken lasse, worauf der Wissenschaftler antwortete: ›Das hieße phantasieren.‹« (Hierauf folgen noch Einzelheiten über den Zweck der Mis­sion.) Unnötig zu sagen, daß dieser erstaunliche Bericht, der buchstäblich nicht »von dieser Welt« ist, viele Fragen aufwirft. Die Unterbrechung der Verbindung mit der Sonde wird mit dem Zeitpunkt des Fotografierens in Zusammenhang gebracht: Die Kamera löste »Sekunden vorher« aus. Das Objekt wird als »dünne Ellipse« beschrieben und sowohl ein Phänomen als auch ein Schatten genannt. Es wurde zweimal beobach­tet – der Bericht sagt nicht, ob am selben Ort der Marsoberfläche – und kann seine Größe verändern; das erste Mal ist es etwa dreißig Kilometer lang, dann, beim verhängnisvollen zweiten Mal, etwa zwan­zig Kilometer. Auf die Frage, ob es ein Raketenflugzeug sein könnte, antwortete der Wissenschaftler: »Das hieße phantasieren.« Was war oder ist es also? Die führende Wochenzeitschrift Aviation Week & Space Technology brachte in ihrer Ausgabe vom 3. April 1989 einen Bericht über den Vorfall, der sich auf mehrere Quellen in Moskau, Washington und Paris stützte. In der Aviation Week & Space Technology wurde der Vorfall als Kommunikationsproblem hingestellt, das trotz wochenlanger Bemü­hungen, die Verbindung wiederherstellen, ungelöst geblieben sei. Der Artikel enthielt die Information, daß die Programmierer des Raum­fahrt-Forschungsinstituts in Moskau erklärt hätten, das Problem habe sich nach einer Besprechung ergeben, derzufolge die Ausrichtung der Phobos2-Antenne habe geändert werden müssen. Zu dieser Zeit sei die Sonde in fast kreisförmiger Umlaufbahn um den Mars und in der letzten Vorbereitungsphase fir die Begegnung mit dem Satelliten Phobos gewesen. In diesem Artikel ging es auch noch um das Problem der abgebrochenen Verbindung, aber ein paar Tage später (am 7. April 1989) sprach Science von dem »anscheinenden Verlust der Sonde«, nicht mehr von der abgebrochenen Verbindung. Das sei am 27. März geschehen, »als die Sonde ihre normale Ausrichtung nach der Erde änderte, um sich nach dem eigentlichen Ziel der Mission, 176 dem kleinen Mond Phobos, auszurichten. Als es für die Sonde Zeit wurde abzuschwenken, wobei ihre Antenne sich automatisch wieder der Erde hätte zuwenden müs­sen, war nichts mehr zu hören.« Dann folgte ein Satz, der ebenso unerklärlich war wie der ganze Vorfall und die »dünne Ellipse« auf der Marsoberfläche. Er lautete: »Ein paar Stunden später wurde eine schwache Übermittlung empfan­gen, aber die Kontrolleure konnten das Signal nicht fixieren. In der folgenden Woche wurde nichts mehr gehört.« Das Ereignis galt als plötzlicher Ausfall der Verbindung. Als Ursache wurde angegeben, die Sonde habe ihre Antenne aus irgendeinem Grun­de beim Abschwenken zum Phobos nicht wieder der Erde zugekehrt. Aber wenn die Antenne in einer der Erde abgewandten Richtung klemm­te, wie konnte dann »ein paar Stunden später eine schwache Übermitt­lung« empfangen werden? Und wenn sie doch richtig funktioniert hatte, wie ließ sich dann die stundenlange Stille nach dem Empfang eines nicht zu sondierenden Signals erklären? Die Frage, die sich daraus ergibt, ist einfach: War die Sonde Phobos 2 von etwas getroffen worden, was sie funktionsunfähig machte, bis auf einen letzten Seufzer in Form eines schwachen Signals ein paar Stun­den später? Am 10. April 1989 brachte die Aviation Week & Space Technology noch einen Bericht. Darin hieß es, russische Raumfahrtwissenschaftler mein­ten, die Stabilisierung der Sonde Phobos 2 hätte bei der Ausrichtung nicht genügt, um die Antenne erdwärts zu richten. Das verwirrte den Verfasser des Artikels offenbar, denn er erklärte, Phobos 2 sei dreiach­sig stabilisiert, nach einer neuen Technik, die für die russische Sonde Venera entwickelt worden war und sich bei den Venera-Missionen vorzüglich bewährt hatte. Wieder ein Rätsel: Was hatte die Destabilisierung bewirkt? Eine Panne, oder war es eine äußerliche Ursache – vielleicht ein Zusammenstoß? Die französische Presse lieferte dazu eine beunruhigende Einzelheit: »Ein Kontrolleur im Kontrollzentrum Kaliningrad sagte, die begrenz­ten Signale nach der Datenbesprechung hätten den Eindruck erweckt, als hätte er es mit einem ›Trudler‹ zu tun.« Mit anderen Worten: Die Sonde Phobos 2 benahm sich so, als ob sie abtrudelte. Was »sah« Phobos 2, als der Vorfall sich ereignete? Wir können es uns nach den Presseberichten schon denken. Aber in der Zeitschrift Aviation Week & Space Technology wurde Alexander Dunajew, der Vorsitzende der sowjetischen Raumfahrtbehörde Glawkosmos, zitiert: »Auf einer Aufnahme ist ein sonderbar geformtes Objekt zwischen der Sonde und dem Mars zu sehen. Es könnten Trümmer in der Umlauf­bahn des Mondes Phobos sein oder aber ein abgesprungener Teil der Sonde – wir wissen es einfach nicht.« Diese Erklärung ist geradezu grotesk. Die Viking-Sonden hinterließen keine »Trümmer« bei ihren Missionen, und von einem Teil der Sonde Phobos 2 kann keine Rede sein; man braucht ja nur Form und Struktur von Phobos 2 zu betrachten (Abb. 93): da gibt es keinen Teil, der ellipsenförmig ist. Außerdem sind 177 die Schatten auf den Bildern zwi­schen zwanzig und dreißig Kilometer lang. Freilich, ein Gegenstand kann einen Schatten werfen, der viel länger ist als er selbst, je nach dem Winkel des Lichtes, das ihn trifft, aber ein Teil der Sonde, der Abb. 93 höchstens ein paar Meter mißt, kann kaum einen kilometerlangen Schatten wer­fen. Was da fotografiert wurde, ist weder ein Trümmerstück noch ein abgesprungener Sondenteil. Damals wunderte ich mich, daß bei den offiziell geäußerten Spekula­tionen eine dritte Möglichkeit, die natürlichste und glaubwürdigste, überhaupt nicht erwähnt wurde. Wenn es wirklich ein Schatten war, warum dann nicht der Schatten des Marsmonds Phobos? Phobos ist kartoffelförmig (Abb. 94), und sein Durchmesser beträgt etwa fünfund­zwanzig Kilometer, was der Größe des Schattens entspricht. Ich erin­nerte mich, eine Mariner-9-Aufnahme gesehen zu haben, die eine durch Phobos verursachte Finsternis auf dem Mars zeigte. Könnte das, dachte ich, die »Erscheinung« sein, um die soviel Aufhebens gemacht wurde, wenn es auch nicht den Verlust der Sonde erklärte? Die Antwort kam drei Monate später. Unter dem Druck der internatio­nalen Teilnehmer an den Phobos-Missionen, die klarere Auskünfte verlangten, gab die russische Raumfahrtbehörde die Fernsehbilder frei, die Phobos 2 in den letzten Augenblicken gesendet hatte, außer dem allerletzten, unmittelbar vor dem endgültigen Schweigen. Sie wurden von einigen Fernsehstationen in Europa und Kanada als Kuriosum ausgestrahlt, aber nicht als höchst aktuelle Neuigkeit. Die Bilder wiesen zwei Anomalien auf. Die eine war ein Netzwerk von geraden Linien in der Nähe des Mars-Äquators; einige Linien waren kurz, einige länger, einige dünn, andere so breit, daß sie wie in die Oberfläche eingeprägte Rechtecke aussahen. In zwei Parallelen ange­ordnet, bedeckten sie ein Gebiet von ungefähr sechshundert Quadratkilo­ meter. Sie schienen keineswegs eine natürliche Erscheinung zu sein. Zu dem Fernsehbericht gehörte ein live gesprochener Kommentar von Abb. 94 178 Dr. John Becklake vom Britischen Naturwissenschaftlichen Museum. Er nannte das Phänomen rätselhaft, weil es mit der Infrarotkamera der Sonde aufgenommen worden war, einem Apparat, der Aufnahmen im Dunkeln sowie bei Dunst oder Nebel ermöglicht, indem er die vom Objekt ausgestrahlte Wärme benutzt, nicht das Spiel von Licht und Schatten. Folglich strahlte dieses ganze Gebiet Wärme aus. Es sei höchst unwahrscheinlich, sagte er, daß eine natürliche Wärmestrahlung (zum Beispiel von einem Geysir oder einer Konzentration radioaktiver Mineralien) ein so Abb. 95 vollkommenes geometrisches Muster erzeugen wür­de. Wenn man es immer wieder betrachte, sähe das Muster absolut künstlich aus. »Aber was es ist«, schloß er, »weiß ich wirklich nicht.« Da die genaue Position dieser Erscheinung nicht angegeben wurde, läßt sich nicht beurteilen, ob sie mit einem Phänomen in Beziehung steht, das Mariner 9 aufgenommen hat. Es kommt ebenfalls im Äquator­gebiet vor (Längengrad 186,4) und wurde beschrieben als »ungewöhn­liche Einkerbungen mit strahlig angeordneten Armen, die von einer Nabe in der Mitte ausgehen«, verursacht (nach Meinung der NASA-Wissenschaftler) durch Schmelzung und Zusammenbruch von Dauer­frostschichten. Das Bild erinnert an die Struktur eines modernen Flug­ hafens mit Gebäuden, was besser zu erkennen ist, wenn man es um­dreht (Abb. 95). Die zweite Anomalie ist ein Schatten, den man tatsäch­lich als »dünne Ellipse« bezeichnen kann (Tafel N). Er unterscheidet sich erheblich von dem Schatten, den Mariner 9 achtzehn Jahre früher aufgenommen hat (Tafel O). Das ist eine abgerundete Ellipse mit zerfranstem Rand, den die unebene Oberfläche des kleinen Satelliten werfen würde. Die dünne Ellipse hingegen hat scharfe Spitzen (Juwe­liere nennen diese Form Marquise), und der Rand hebt sich deutlich von einer Art Halo auf der Marsoberfläche ab. Dr. Becklake beschrieb sie als »etwas, das sich zwischen der Sonde und dem Mars befindet, dessen Oberfläche darunter zu sehen ist«. All das erklärt, warum die Russen die Meinung nicht vertreten haben, die dünne Ellipse könnte der Schatten des Satelliten sein. Während die Aufnahme auf dem Bildschirm festgehalten wurde, er­klärte Dr. Becklake, die Sonde habe sich, während die Kamera lief, nach dem Satelliten Phobos 2 ausgerichtet. »Da sahen die Russen«, fuhr er fort, »etwas, das dort nicht hätte sein sollen. Dieses letzte Bild haben sie noch nicht freigegeben, und wir wollen nicht spekulieren, was es sein könnte.« 179 Tafel N Tafel O Da diese letzte Aufnahme nicht einmal zwei Jahre nach dem Vorfall freigegeben worden ist, kann man nur spekulieren, vermuten oder Gerüchten glauben, was dieses Ding ist, »das dort nicht hätte sein sollen«, das auf Phobos 2 zuraste, auf ihn prallte und jählings die Verbindung mit der Erde unterbrach. Denn es kam ja einige Stunden später noch eine Übermittlung, die unverständlich war. Damit ist die Erklärung, die Sonde habe ihre Antenne nicht in Übermittlungsstellung 180 zur Erde bringen können, null und nichtig. Am 19. Oktober 1989 veröffentlichten russische Wissenschaftler in Nature einen Bericht über die technischen Experimente, die Phobos 2 erfolgreich durchgeführt hatte; auf den siebenunddreißig Seiten han­delten nur drei Absätze von dem Verlust der Sonde. In dem Bericht stand, die Sonde sei ins Trudeln geraten, entweder infolge einer Computerpanne oder infolge eines Zusammenstoßes mit einem unbe­kannten Objekt. Die Theorie, sie sei mit Staubpartikeln in Berührung gekommen, wurde verworfen. Womit ist Phobos 2 zusammengestoßen, das heißt, was war das, »das dort nicht hätte sein sollen«? Was ist auf der letzten, geheimgehaltenen Aufnahme zu sehen? Mit sorgfältig gewählten Worten drückte sich der Vorsitzende der sowjetischen Raumfahrtbehörde der Aviation Week & Space Technology gegenüber so aus: »Auf einem Bild ist ein merkwürdig geformtes Objekt zwischen der Sonde und dem Mars zu sehen.« Wenn nicht Trümmer, Staub oder ein abgebrochener Teil von Phobos 2, was war dann das »Objekt«, das – wie jetzt alle Beteiligten zugaben – mit der Sonde zusammenstieß? Ein Gegenstand, der stark genug war, die Sonde zum Trudeln zu bringen, und der auf der letzten Aufnah­me abgebildet wurde? »Wir wissen es einfach nicht«, sagte der Leiter der sowjetischen Mis­sion. Aber die Hinweise auf eine alte Raumstation auf dem Mars und der merkwürdig geformte Schatten auf seiner Oberfläche fügen sich zu einer furchteinflößenden Schlußfolgerung zusammen: Das geheimgehaltene Bild beweist, daß der Verlust von Phobos 2 nicht von einer Panne herrührt, sondern von einem Ereignis. Vielleicht ist es das erste Ereignis in einem Krieg der Sterne – der Abschuß eines Flugkörpers, der von der Erde aus in die Mars-Raum­station der Bewohner eines anderen Planeten eingedrungen war. Ist es dem Leser schon in den Sinn gekommen, daß die Antwort der russischen Raumfahrtbehörde, sie wüßten einfach nicht, was das merk­würdige Objekt zwischen der Sonde und dem Mars sei, dem Einge­ständnis ausweicht, es als Ufo zu bezeichnen, das heißt als ein unbe­kanntes Flugobjekt? Seit Jahrzehnten, seit das Phänomen der fliegenden Untertassen, die später als Ufos bezeichnet wurden, die ganze Welt beschäftigte, wollte sich kein Wissenschaftler von Rang und Namen mit diesem Thema befassen. Das »moderne Ufo-Zeitalter« begann laut Antonio Huneeus, einem international bekannten Ufo-Forscher, am 24. Juni 1947. An diesem Tag sichtete der amerikanische Pilot und Geschäftsmann Kenneth Ar­nold eine Formation von neun silbrigen Scheiben, die über das Kaskaden­gebirge im Staat Washington flogen. Die Bezeichnung »fliegende Un­tertassen«, die damals Mode wurde, beruhte auf Arnolds Beschreibung der rätselhaften Objekte. Diesem Ereignis folgten Beobachtungen überall in den Vereinigten Staaten und in anderen Teilen der Welt. Der berühmteste Fall, über den immer noch gesprochen und der im Fernsehen öfters dramatisiert wird, ereignete sich, als am 2. 181 Juli 1947 – eine Woche nach Arnolds Beob­achtung – ein fremder Flugkörper auf einer Ranch in der Nähe von Roswell (New Mexico) zu Boden krachte. An diesem Abend wurde ein heller, scheibenförmiger Gegenstand in dieser Gegend am Himmel gesichtet. Am folgenden Tage entdeckte der Rancher William Brazel auf einem seiner Felder nordwestlich von Roswell verstreute Trümmer. Die Trümmer und auch das Metall, aus dem sie bestanden, sahen merkwürdig aus, und sie wurden dem in der Nähe stationierten Flieger­korps gemeldet (das damals als einziges in der Welt über ein Kernwaffen­geschwader verfügte). Major Jesse Marcel, ein Abwehroffizier, fuhr zusammen mit einem Offizier vom Spionageabwehrdienst hin, um die Trümmer zu besichtigen. Die verschieden geformten Stücke sahen aus wie Balsaholz und fühlten sich auch so an, bestanden aber nicht aus Holz, denn sie ließen sich weder biegen noch verbrennen. Auf einigen Balken entdeckte man geometrische Zeichen, die später Hieroglyphen genannt wurden. Nach der Rückkehr zur Basis wurde der Pressechef beauftragt, die Medien davon zu benachrichtigen, daß die Luftstreit­kräfte Teile einer »abgestürzten fliegenden Untertasse« gefunden hät­ten. Die Neuigkeit machte am 7. Juli 1947 im Roswell Daily Record Schlagzeilen und wurde von einer Presseagentur in Albuquerque (New Mexico) übernommen (Abb. 96). Ein paar Stunden später wurde sie von einer offiziellen Nachricht verdrängt: Die Trümmer seien Teile eines zur Erde gefallenen Wetter­ballons. Die Zeitungen brachten den Widerruf, und es wurde den Rundfunksendern untersagt, die erste Meldung zu veröffentlichen, mit der Begründung, es gehe um die nationale Sicherheit. Trotzdem halten noch heute viele Personen, die mit dem Vorfall zu tun gehabt haben, an der ersten Meldung fest. Hinzu kommt, daß Zivilisten in einem Gebiet westlich von Socorro (New Mexico) ebenfalls Zeugen eines Unfalls waren. Sie haben nicht nur die Trümmer einer »fliegen­den Untertasse«, sondern sogar die Leichname mehrerer menschen­ähnlicher Gestalten gesehen. Diese Leichen Abb. 96 182 und noch andere sollen in der Luftwaffenbasis Wright-Patterson in Ohio untersucht worden sein. Laut einem Dokument, das in informierten Kreisen unter der Bezeich­nung Majestic-12 bekannt ist, bildete Präsident Truman im September 1947 eine Geheimkommission, die sich mit all diesen Vorfällen befas­sen sollte; aber die Echtheit dieses Schriftstücks ist nicht erwiesen. Tatsache ist jedenfalls, daß Senator Barry Goldwater, der allen mögli­chen militärischen und technischen Ausschüssen angehörte, der Zutritt zum sogenannten Blauen Zimmer in der Wright-Patterson-Basis wie­derholt verwehrt wurde.* Auf eine Anfrage hin schrieb er 1981 einem Bürger: »Ich habe es längst aufgegeben, Zutritt zum sogenannten Blauen Zimmer in Wright-Patterson zu fordern, denn er wurde mir von einem Chef nach dem anderen verweigert. Diese Sache wird so hoch eingestuft, daß es unmöglich ist, etwas darüber zu erfahren.« Zwischen 1947 und 1969 wurden etwa dreizehntausend Meldungen über Ufos von der amerikanischen Luftwaffe überprüft, aber größten­teils als natürliche Erscheinungen wie Ballons, Flugzeuge oder als reine Einbildung abgetan. Doch etwa siebenhundert Beobachtungen wurden nicht erklärt. Im Jahr 1953 berief der amerikanische Geheimdienst eine Sitzung mit Wissenschaftlern und Staatsbeamten ein. Die Versammlung verbrachte zwölf Stunden damit, Ufofilme anzusehen, über Fallgeschichten und andere Informationen zu diskutieren, um dann festzustellen, daß »für die meisten Wahrnehmungen vernünftige Erklärungen zu finden sind«. Die übrigen Fälle könnten zwar nicht erklärt werden, aber »unsere heutigen astronomischen Kenntnisse vom Sonnensystem lassen es als äußerst unwahrscheinlich erscheinen, daß es außer auf der Erde irgend­wo intelligente Lebewesen gibt«. Während das Vorhandensein der Ufos weiterhin abgestritten wurde (unter anderem aufgrund einer Studie der Universität Colorado von 1966 bis 1969), stieg die Anzahl der Beobachtungen an, und in vielen Ländern schlossen sich Amateurforscher zu Gruppen zusammen. Diese Gruppen haben die Wahrnehmungen klassifiziert; die der »zweiten Ordnung« sind Vorfälle mit physikalischen Beweisen (Bodenspuren und Interferenzen), die der »dritten Ordnung« Begegnungen mit Ufo-Insassen. Früher wurden die Ufos verschieden beschrieben, von »fliegenden Untertassen« bis zu »zigarrenförmig«. Neuerdings beschreibt man sie als runde Flugkörper, die nach der Landung auf drei oder vier ausge­ fahrenen Beinen stehen (Abb. 97a). Auch die Beschreibung der Insas­ sen ist einheitlicher geworden: menschenähnlich, neunzig bis hundert­ zwanzig Zentimeter groß, mit großem, kahlem Kopf Abb. 97a und b * Mit »blau« werden in Amerika geheime Dinge bezeichnet. (Anm. d. Übers.) 183 und sehr großen Augen (Abb. 97b). Nach dem angeblichen Augenzeugenbericht eines Geheimdienstoffiziers, der in einer geheimen Basis in Arizona gebor­gene Ufos und Leichen gesehen hat, »sind die Menschenähnlichen schneeweiß und haben weder Ohren noch Nasenflügel. Ihr Mund ist winzig, der Kopf riesig. Sie haben keine Haare, auch kein Schamhaar. Sie sind nackt. Der Größte könnte hundert Zentimeter gemessen haben, vielleicht etwas mehr.« Der Augenzeuge fügte hinzu, er habe keine Geschlechtsteile und Brüste gesehen, obwohl einige männlich und andere weiblich gewirkt hätten. Die Personen, die von Wahrnehmungen oder Kontakten berichten, kommen aus allen Ländern und gesellschaftlichen Schichten. Präsident Jimmy Carter sagte zum Beispiel 1976 in einer Wahlrede, er habe ein Ufo gesehen. In der Sowjetunion veröffentlichte das Institut für Raumfahrtforschung 1979 eine »Analyse der Beobachtungen von ab­normen atmosphärischen Erscheinungen in der UdSSR«, und die so­wjetische Akademie der Naturwissenschaften beauftragte 1948 eine Kommission mit dem Studium der Phänomene. In militärischer Hin­sicht ist der Geheimdienst des Generalstabs (GRU) zuständig; er soll ergründen, ob die Ufos geheime Flugkörper einer ausländischen Macht, unbekannte Naturerscheinungen oder bemannte oder unbemannte außerirdische Sonden sind, die die Erde untersuchen. Von den zahlreichen wahren oder unwahren Berichten aus Rußland stammen einige von sowjetischen Astronauten. Im September 1989 geschah etwas Ungewöhnliches: Die amtliche Nachrichtenagentur Tass schilderte einen Ufo-Vorfall in Woronesch auf eine Art und Weise, die weltweit Aufsehen erregte. Tass ließ sich von der üblichen Skepsis nicht irritieren und blieb bei ihrer Darstellung. Auch die französischen Behörden verhielten sich weniger ablehnend als die amerikanischen. Im Jahr 1977 beauftragte die Raumfahrtbehörde ebenfalls eine Kommission mit dem Studium der Ufos (Service d’Expertise des Phénomènes de Rentrée Atmosphérique), die alle Vor­kommnisse zu prüfen und auszuwerten hat. Die Untersuchung eines Ortes, wo ein Ufo gelandet sein sollte, ergab das »Vorhandensein von Spuren, für die es keine befriedigende Erklärung gibt«. Die meisten französischen Wissenschaftler teilten die Verachtung ihrer Kollegen in anderen Ländern für das Thema, aber diejenigen, die praktisch damit zu tun bekamen, erklärten einstimmig, sie sähen in dem Phänomen »die Manifestation einer Tätigkeit außerirdischer Besucher«. In Großbritannien blieben die Geheimnisses der Ufo-Erscheinungen unerklärt, obwohl man sich auch dort bemüht hat, sie zu erforschen, zum Beispiel seitens einer vom Earl of Clancarty ins Leben gerufenen Forschergruppe im Oberhaus (vor der ich 1980 einen Vortrag halten durfte). Die Erfahrungen in Großbritannien wie auch die in anderen Ländern beschreibt Timothy Good in seinem Buch Above Top Secret (1987). Die vielen in Goods Buch angeführten und zitierten Dokumen­te lassen nur den einen Schluß zu, daß die Regierungen die Befunde in ihren Ländern zuerst verheimlichten, weil sie vermuteten, es handle sich um Flugkörper einer Großmacht, und das Eingeständnis der Über­legenheit eines Feindes diente noch nie dem nationalen Interesse. Doch als dann die außerirdi184 sche Natur der Ufos vermutet (oder erkannt) wurde, erinnerte man sich der Panik in Amerika, die Orson Wells’ Hörspiel War of the Worlds am 30. Oktober 1938 hervorgerufen hatte, und dies war dann der Grund, warum die Verheimlichung beibehalten wurde. Die Problematik der Ufos rührt daher, daß es keine einleuchtende Theorie gibt, die erklären würde, woher und weshalb sie kommen. Ich selbst habe noch nie ein Ufo gesehen, gar nicht zu reden von den menschenähnlichen Wesen mit elliptischem Kopf und großen Augen, mögen sie existent sein oder nicht. Wenn ich bei einer Diskussion gefragt werde, ob ich an die Ufos »glaube«, pflege ich eine Geschichte zu erzählen. Ich sage meinen Zuhörern, sie sollen sich einmal folgen­des vorstellen: Plötzlich wird die Tür des Saales, in dem wir uns befinden, aufgerissen, und ein junger Mann stürzt herein, atemlos und offensichtlich sehr erregt. Ohne sich umzublicken, ruft er: »Unglaub­lich, was ich erlebt habe!« Er war gewandert, und als es dunkelte und er müde wurde, legte er sein Bündel auf einen Stein und streckte sich aus. Er schlief ein. Plötzlich erwachte er, nicht durch ein Geräusch, sondern durch ein helles Licht. Er sah eine Leiter, auf der seltsame Wesen auf und ab stiegen. Die Leiter führte zum Himmel empor, und oben war etwas Rundes mit einer Tür, durch die Licht von innen fiel. Vor dem Licht hob sich eine Gestalt ab, die den Wesen auf der Leiter Befehle erteilte. Der Anblick war so furchterregend, daß er in Ohnmacht fiel. Als er zu sich kam, war nichts mehr zu sehen. Immer noch aufgeregt, sagte er zum Schluß, er sei nicht sicher, ob das Wirklichkeit gewesen sei oder eine Vision, vielleicht nur ein Traum. »Was meinen Sie? Würden Sie ihm glauben?« fragte ich meine Zuhö­rer. Man sollte ihm glauben, wenn man der Bibel glaubt. Denn die Ge­schichte ist nichts anderes als Jakobs Vision im 28. Kapitel der Genesis. Es ist zwar eine Vision in traumhafter Trance, aber Jakob ist überzeugt, daß es Wirklichkeit gewesen sei, denn er sagt: »Wahrlich, Jahwe ist gegenwärtig an dieser Stätte, und ich wußte es nicht ... Ja, hier ist der Wohnsitz der Götter, und dies ist die Himmelspforte.« Bei einer Konferenz, die von Ufos handelte, wies ich darauf hin, daß es so etwas wie unbekannte Flugobjekte nicht gibt. Es gebe nur dem Menschen unerklärliche Erscheinungen, aber diejenigen, die sie erfor­schen, wüßten sehr gut, was sie sind. Das schwebende Flugzeug, das Jakob sah, wurde von ihm ganz richtig als etwas erkannt, was den Göttern gehörte. Was er hingegen nicht wußte, macht die Bibel klar: Die Stelle, wo er geschlafen hatte, war einer der Orte, wo sie landeten und starteten. In der biblischen Erzählung von der Himmelfahrt des Propheten Elia wird das Gefährt als feuriger Wagen beschrieben. Und der Prophet Hesekiel hatte eine ausführlich geschilderte Vision von einem Feuer­wagen, der wie ein Wirbelwind daherkam und auf vier Rädern landete. Aus alten Abbildungen und Beschreibungen geht hervor, daß es zwi­schen fliegenden Maschinen und ihren Piloten 185 Unterschiede gab. Es gab Raketenflugzeuge (Abb. 98a), die als Shuttle und kreisende Sonde dienten, und es gab die »Wirbelvögel« oder »Himmelskammern«, die wir heute Hubschrauber oder Helikopter nennen, Drehflügler, die senk­recht starten und landen können. Wie sie in alter Zeit aussahen, zeigt eine Wandmalerei auf der Ostseite des Jordans in der Nähe der Stelle, wo Elias Himmelfahrt stattfand (Abb. 98b). Die Göttin Inanna/Istar lenkte ihre Himmelskammer gern selbst; sie war dann gekleidet wie die Piloten im Ersten Abb. 98a, b und c Weltkrieg (Abb. 98c). Es wurden aber auch Tonfigurinen gefunden, Darstellungen von menschenähnlichen Wesen mit elliptischem Kopf und Schlitzaugen (Abb. 99); ungewöhnlich an ihnen ist, daß sie bisexuell oder asexuell zu sein scheinen: das männliche Glied wird von einer Vagina überlagert oder durchschnitten. Aus den Zeichnungen derjenigen, die behaupten, die Insassen der Ufos gesehen zu haben, geht hervor, daß sie nicht wie wir aussehen, was besagt, daß sie nicht wie die Anunnaki aussehen. Sie sehen eher aus wie die alten menschenähnlichen Figu­rinen. Diese Ähnlichkeit könnte ein Hinweis auf die Beschaffenheit der kleinen Geschöpfe sein, die angeb­lich die Ufos lenken. Wenn die Berichte wahr sind, dann sind die Ufo-Piloten keine Menschen, keine intelligenten Wesen von einem anderen Planet, sondern ihre Abb. 99 an­thropoiden Roboter. Selbst wenn nur ein kleiner Prozentsatz von den Beobach­tungen wahr ist, dann legt die verhältnismäßig große Anzahl der Raumschiffe, die in letzter Zeit zur Erde geflogen sind, den Gedanken nahe, daß sie unmöglich von einem fernen Planet kommen können. In diesem Fall ist der Mars der einzige glaubwürdige Kandidat – und sein Satellit Phobos. Die Gründe für die Benutzung des Mars als Sprungbrett für Raum­schiffe, die aus der Ferne kommen, dürften inzwischen klar sein. Der Beweis für die Richtigkeit meiner Vermutung, daß der Mars in der Vergangenheit den Anunnaki als Raumstation gedient hat, ist erbracht. Die Umstände, unter denen Phobos 2 verschwunden ist, weisen darauf hin, daß irgend jemand wieder auf dem Mars ist, jemand, der das zerstört, was für ihn ein fremdes Raumschiff sein könnte. Wie paßt da der Satellit Phobos dazu? Schlicht gesagt, er paßt sehr gut dazu. 186 Um das zu verstehen, muß man die Gründe für die Phobos-Mission im Jahr 1988 kennen. Der Mars hat zwei kleine Satelliten, die kleinsten im Sonnensystem: Phobos und Deimos. Beide werden nicht für ursprüng­liche Marsmonde gehalten, sondern für Asteroiden, die der Mars einge­fangen hat, so daß sie ihn nun umkreisen. Sie gehören dem kohlenstoff­haltigen Typ an und enthalten darum recht erhebliche Wassermengen, meistens in Form von Eis direkt unter der Oberfläche. Das Wasser könnte also in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt werden und so als Atemluft und Brennstoff dienen. Aus dem Wasserstoff läßt sich in Verbindung mit dem Kohlenstoff Kohlenwasserstoff machen. Wie alle Asteroiden und wie die Kometen enthalten diese Planetoiden Nitrogen, Ammoniak und andere organische Moleküle. Alles in allem erfüllen die beiden Satelliten die Voraussetzungen für Raumstationen – ein Geschenk der Natur. Deimos eignet sich allerdings dafür weniger. Sein Durchmesser beträgt nur vierzehn Kilometer, und er umkreist den Mars in knapp fünfund­zwanzigtausend Kilometern Entfernung. Phobos hat einen Durchmes­ser von zwanzig Kilometern und ist nur neuneinhalbtausend Kilometer vom Mars entfernt, eine kurze Strecke für einen Pendelverkehr im Shuttle. Da Phobos (ebenso wie Deimos) den Mars auf der Äquatorialebene umkreist, kann er von allen künstlichen Gebilden auf dem Mars aus – die einzige Ausnahme ist die »Inka-Stadt« – beobachtet wer­ den und umgekehrt. Überdies vollendet Phobos wegen seiner Nähe an einem Mars-Tag dreieinhalb Umläufe, so daß er fast immer sichtbar ist. Einen weiteren Vorteil für eine Umkreisung bedeutet seine minimale Schwerkraft im Vergleich zu Mars und Erde. Die Schwerkraft, die beim Abheben von Phobos überwunden werden muß, erfordert lediglich eine Fluchtgeschwindigkeit von über zwanzig Kilometer pro Stunde; dementsprechend ist natürlich auch die Bremskraft beim Landen ge­ring. Das sind die Gründe, warum die beiden russischen Sonden Phobos 1 und 2 dorthin geschickt wurden. Es war ein offenes Geheimnis, daß die Mission eine Kundschafter-Expedition war, weil man plante, im März 1994 einen Roboter auf dem Mars landen zu lassen, dem dann eine bemannte Mission folgen sollte, mit dem Ziel, im nächsten Jahrzehnt dort eine Raumstation zu errichten. Vorzeitige Instruktionen der Mos­kauer Kontrollstation enthüllten, daß die Sonde Instrumente trug, die dazu dienten, »Wärme ausstrahlende Gebiete auf dem Mars aufzuspü­ren und eine bessere Vorstellung vom Leben auf dem Mars zu gewin­nen«. Die Tatsache, daß es sich nicht nur um Infrarotspürgeräte handel­te, sondern auch um Gammastrahlspektrometer, ließ auf eine sehr zweckbewußte Untersuchung schließen. Danach sollten die beiden Sonden sich nur noch mit Phobos befassen. Er sollte sowohl von Radar-, Infrarot- und Gammastrahlenspürgeräten erforscht als auch von drei Fernsehkameras fotografiert werden. Zwei verschiedene Geräte sollten auf der Oberfläche abgesetzt werden, ein stationäres, das sich selbst im Boden verankert, und ein »hüpfendes« mit federnden Beinen, das sich überallhin bewegen und seine Befunde übermitteln würde. Für Phobos 2 waren noch mehr Experimente vorgesehen. Er war mit Ionen- und 187 Laserstrahlern ausgerüstet, die dazu dienen sollten, die Oberfläche des Mondes aufzuwühlen, Material zu pulverisieren und die entstehenden Wolken dann zu analysieren. Die Sonde sollte nur fünfzig Meter vom Boden entfernt schweben, damit die Kameras zehn Zentimeter große Gegenstände aufnehmen konnten. Was erwarteten die Planer in solcher Nähe zu entdecken? Es mußte etwas wichtiges sein, denn zu den Teilnehmern gehörten amerikanische Spezialisten, die bereits Erfahrung mit dem Mars hatten und von den Vereinigten Staaten eigens angefordert worden waren. Außerdem hatte die NASA ihr Netzwerk von Radioteleskopen zur Verfügung gestellt, das nicht nur der Verbindung mit dem Satelliten dienen würde, sondern auch der Suche nach außerirdischer Intelligenz (SETI-Programme), und Wissenschaftler vom JPL in Pasadena sollten sich an der Datenaus­wertung beteiligen. Es wurde auch bekannt, daß die britischen Fachleu­te, die sich an dem Projekt beteiligt hatten, von der englischen Raum­ fahrtbehörde der Mission zugeteilt worden waren. Mit der Beteiligung der französischen Raumfahrtbehörde, des deutschen MaxPlanck-Instituts und einem Dutzend anderer europäischer Staaten bedeutete die Phobos-Mission das Zusammenwirken der mo­dernen Wissenschaft, darauf abzielend, den Mars zu erforschen und die Menschheit auf den Weg in den Weltraum zu bringen. Aber war jemand dort oben auf dem Mars, dem das nicht in den Kram paßte? Es ist bemerkenswert, daß Phobos im Gegensatz zum kleineren und glattkrustigen Deimos Züge aufweist, die schon frühere Astronomen vermuten ließen, er sei künstlich geschaffen und bearbeitet worden. Er hat Gräben, die fast gerade und parallel zueinander verlaufen (Abb. 100). Sie sind ähnlich geformt, etwa dreihundert Meter breit und allesamt etwa dreißig Meter tief (soweit die Viking-Sonden sie messen konnten). Die Möglichkeit, daß fließendes Wasser oder Wind sie geschaffen hat, muß ausgeschaltet werden, da beides auf Phobos nicht vorkommt. Die Gräben scheinen von einem Krater auszugehen oder zu ihm zu führen, dessen Durchmesser ein Drittel so groß ist wie der des Satelliten; sein Rand ist so ebenmäßig, daß er künstlich zu sein scheint (siehe Abb. 94). Abb. 100 188 Was sollen diese Gräben, wie sind sie entstanden, warum führen sie zu dem Krater, und reicht der Krater etwa bis ins Innere des Mondes? Die russischen Wissenschaftler fanden, daß Phobos etwas Künstliches hat, weil seine fast vollkommen kreisförmige Umlaufbahn um Mars in solcher Nähe des Planeten die Gesetze der Bewegungen am Himmel Lügen straft: Phobos und in gewissem Maße auch Deimos müßten eine elliptische Bahn haben, aus der sie vor langer Zeit ins All hinausge­schleudert warden wären oder die sie auf den Mars hätte aufschlagen lassen. Die Vorstellung, daß Phobos und Deimos vorsätzlich in eine Bahn um den Mars gebracht wurde, scheint widersinnig zu sein. Aber man hält es in der Tat für technisch machbar, Asteroiden einzufangen und sie in eine Umlaufbahn um die Erde zu bringen, so daß dieser Plan bei der dritten Konferenz über die Entwicklung der Raumfahrt, die 1984 in San Francisco stattfand, diskutiert wurde. Richard Gertsch von der Berg­werksschule in Colorado, einer der Initiatoren, betonte, daß es im Weltraum eine erstaunliche Vielfalt an Mineralien gibt; Asteroiden seien besonders reich an Elementen wie Chrom, Germanium und Galli­um. Eleanor F. Helin vorn JPL sagte: »Ich glaube, daß wir Asteroiden kennen, die erreichbar sind und ausgebeutet werden könnten.« Haben andere vor langer Zeit Pläne ausgeführt und verwirklicht, die für die moderne Wissenschaft Zukunftsmusik sind? Haben sie zwei einge­fangene Asteroiden, nämlich Phobos und Deimos, in eine Umlaufbahn um den Mars gebracht? In den 1960er Jahren wurde festgestellt, daß Phobos seine Umlaufge­ schwindigkeit beschleunigte. Das ließ die russischen Wissenschaftler annehmen, er sei leichter, als seine Größe rechtfertigt. Der Physiker I. S. Schklowsky behauptete, Phobos sei hohl. Andere Forscher spekulierten, Phobos sei ein künstlicher Satellit, den eine ausgestorbene Menschenrasse vor Millionen von Jahren in die Umlaufbahn um den Mars gebracht hätte. Andere machten sich über die Vorstellung von einem hohlen Satellit lustig und erklärten, Phobos beschleunige, weil er sich dem Mars nähere. Dann aber brachte Nature die Neuigkeit, daß Phobos sogar weniger dicht ist, als man angenom­men hatte, so daß sein Inneres entweder aus Eis bestehen oder hohl sein müsse. Wurde ein natürlicher Krater vergrößert und das Innere ausgehöhlt von »jemandem«, der einen Schutzraum schaffen wollte, in dem man vor Kälte und kosmischen Strahlen sicher war? In dem russischen Bericht steht darüber nichts, aber was er von den Gräben sagt, ist einleuchtend. Sie werden als Furchen bezeichnet, und es heißt, die Ränder seien aus hellerem Material als die Oberfläche des kleinen Mondes. Außerdem – und das ist tatsächlich eine Offenbarung – seien inzwischen in dem Gebiet westlich des Kraters neue Furchen zu sehen, die noch nicht da waren, als Mariner 9 und die Vikings Aufnahmen gemacht hatten. Da auf Phobos keine vulkanische Tätigkeit herrscht – der Krater in seiner natürlichen Form ist durch meteoritische Aufschläge entstanden – und es dort weder Wind noch Regen oder fließendes Wasser gibt, erhebt sich die Frage: Wie 189 können neue Furchen entstanden sein? Wer war seit den 1970er Jahren auf Phobos (und damit auch auf dem Mars)? Wer ist jetzt dort? Denn wenn jetzt niemand dort ist, wie erklärt sich dann der Vorfall am 27. März 1989? Die erschütternde Möglichkeit, daß die moderne Wissenschaft, die im Begriff ist, das urzeitliche Wissen einzuholen, die Menschheit dazu gebracht haben könnte, den ersten Zwischenfall in einem Krieg der Welten zu entfachen, erinnert an eine Situation, die fünfeinhalbtausend Jahre verdrängt worden ist. Dieses Ereignis wird der Turmbau zu Babel genannt. Die Verfasser der Bibel haben es im 11. Kapitel der Genesis beschrieben. Ich habe in meinem Buch Die Kriege der Menschen und Götter darauf sen, daß die mesopotamischen hingewie­ Texte es ausführlicher schildern. Ich habe es ins Jahr 3450 v. Chr. verlegt und erklärt, daß es Marduks erster Versuch war, in Babylon ein Raumfahrtzentrum zu schaffen als einen Akt der Auflehnung gegen Enlil und dessen Söhne. In der Bibel bauen die Leute, die MarAbb. 101 duk angestellt hat, in Babylon eine Stadt »mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reichen soll.« Er sollte der Hangar für einen »Schem« – ein Raketenflugzeug – werden, ähnlich dem, der auf einer Münze von Byblos abgebildet ist (Abb. 101). Aber die anderen Götter billigten diesen Vorstoß der Men­schen ins Raumzeitalter nicht, und so geschah folgendes: »Jahwe fuhr herab, um sich die Stadt anzusehen und den Turm, an dem die Menschen bauten.« Und er sagte zu den anderen Göttern: »Das ist erst der Anfang ihrer Unternehmungen. Von jetzt an wird alles, was sie planen, ihnen nicht mehr unmöglich sein. Kommt, wir wollen hinabfahren und ihre Sprache verwirren, so daß einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen kann.« Fast fünfeinhalbtausend Jahre später taten sich die Menschen zusam­men und »hatten alle dieselbe Sprache« in einer koordinierten interna­tionalen Mission zu Mars und Phobos. Das scheint jemand auch diesmal nicht zu billigen. 190 13 Geheime Vorbereitungen Sind wir einzigartig? Sind wir allein? Um diese Fragen ging es hauptsächlich in meinem 1976 veröffentlichten Buch Der zwölfte Planet, in dem ich den Nachweis erbracht habe, daß es schon in unvordenklicher Zeit die Anunnaki (die biblischen Nefilim) und ihren Planeten Nibiru gegeben hat. Die Wissenschaft hat seit 1976 – wie in den vorhergehenden Kapiteln erklärt worden ist – einen weiten Weg zurückgelegt, um das alte Wissen zu bestätigen. Aber was ist mit den beiden Säulen dieses Wissens und der Antwort auf die zentralen Fragen? Hat die moderne Wissenschaft bekräftigt, daß es noch einen Planeten mehr in unserem Sonnensystem gibt, und hat sie außerhalb der Erde noch andere intelli­gente Wesen gefunden? Daß man nach ihnen gesucht hat, sowohl nach einem anderen Planeten als auch nach Lebewesen, das ist verbürgt. Daß die Suche in den letzten Jahren intensiviert worden ist, kann die Öffentlichkeit aus den Doku­menten ersehen. Jetzt aber liegt es auch klar zutage – wenn man den Nebel von undichten Stellen, Gerüchten und Widerrufen durchdringt –, daß die Staatsoberhäupter schon seit einiger Zeit wissen, daß es noch einen Planeten in unserem Sonnensystem gibt und daß wir nicht allein sind. Nur so lassen sich die Vorbereitungen erklären, die für den Tag – der bestimmt kommen wird – getroffen werden, an dem diese beiden Tatsachen den Menschen auf dieser Erde verkündet werden müssen. Auf einmal scheint all das, was die Großmächte getrennt und entzweit hat, keine so große Rolle mehr zu spielen. Plötzlich, ganz unerwartet und unerklärlich, scheint es für die Staatsoberhäupter viel wichtigere und dringendere Verhandlungsgegenstände zu geben. Aber weshalb? Wenn man darauf eine Antwort sucht, weisen die Anhaltspunkte nur in eine Richtung: Weltraum. Natürlich, die Veränderung in Osteuropa hat sich schon lange angekündigt, die wirtschaftlich mißliche Lage erfor­derte dringend Reformen. War es nur Zufall, daß der Phobos-2-Unfall vom März 1989 im Juni damit erklärt wurde, die Sonde sei infolge eines Zusammenstoßes ins Trudeln geraten? Und daß im selben Monat im Westen die rätselhaften Aufnahmen der Sonde gezeigt wurden, auf denen das Wärme ausstrah­lende Muster auf der Oberfläche des Mars sowie der »dünne elliptische Schatten«, für den es keine Erklärung gab, zu sehen waren? War es in bezug auf die zeitliche Abstimmung reiner Zufall, daß die plötzliche Wende in der amerikanischen Politik eintrat, nachdem Voyager 2 im August 1989 auf seinem Flug zum Neptun Aufnahmen gesandt hatte, die auf dem Neptunmond Triton geheimnisvolle »Wege« zeigten (siehe Abb. 3), die ebenso rätselhaft waren wie die auf anderen Himmels­körpern? Wenn man die politischen Ereignisse und die astronomischen Entdeckungen 191 im Jahr 1989 zueinander in Beziehung bringt, wird ein Zusam­menhang deutlich, denn stets kam es nach den Raumflügen zu ver­mehrter politischer Aktivität. Es ist klar, daß alle diese Entdeckungen die Gemüter in Aufruhr versetzten. Nach dem Verlust von Phobos 2, unmittelbar nach der Panne mit Phobos 1, spekulierten die westlichen Fachleute, ob die UdSSR ihren Plan, die Marserforschung bis zum März 1992 fortzusetzen und 1994 dort mit einem Raumschiff zu landen, wohl weiterverfolgen würde. Aber russische Sprecher machten derartigen Zweifeln ein Ende, indem sie versicherten, in ihrem Raumprogramm stehe der Mars an erster Stelle. Sie seien entschlossen, die Marserforschung fortzusetzen, und zwar gemeinsam mit den Vereinigten Staaten. War es nun Zufall, daß das Weiße Haus kurz nach dem Phobos-2-Desaster darauf drängte, das vom Verteidigungsministerium gestrichene Milliarden-Budget für das Raumflugprogramm doch zu bewilligen? Denn es sollten bis 1994 zwei X-30-Maschinen mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit entwickelt und gebaut werden, zum Zwecke militärischer Raumverteidigung. Das war eine der Entscheidungen, die Präsident Bush zusammen mit Vizepräsident Dan Quayle traf, dem neuernannten Vorsitzenden des nationalen Raumfahrtrates. Dies geschah bei der ersten Ratssitzung im April 1989. Im Juni wies der Raumfahrtrat die NASA an, die Vor­bereitungen für die Errichtung einer Raumstation voranzutreiben, ein Programm, für das im Jahresbudget dreizehn Milliarden Dollar vorge­sehen waren. Im Juli 1989 erstattete der Vizepräsident dem Kongreß und der einschlägigen Industrie Bericht über die spezifischen Vorschlä­ge für die bemannten Flüge zum Mond und zum Mars. Von fünf Möglichkeiten bevorzuge man den Plan, auf dem Mond eine Raumsta­ tion zu errichten und sie als Startbasis zum Mars zu benutzen. Eine Woche später verlautete, daß es gelungen sei, im Rahmen des Abwehrprogramms mit einer militärischen Rakete einen »Todesstrahl« in den Raum zu schießen. Sogar ein Außenseiter konnte merken, daß das Weiße Haus, der Präsi­dent selbst, jetzt die Führung übernommen hatte, was die Koordinie­rung des Raumprogramms, dessen Zusammenhang mit dem »Krieg der Sterne« und die Beschleunigung der Vorkehrungen anbelangte. Es geschah denn auch, daß Bush kurz nach seiner eilig anberaumten Gipfelbesprechung mit Gorbatschow auf Malta dem Kongreß sein nächstes Jahresbudget vorlegte, in dem Milliarden Dollar für den »Krieg der Sterne« vorgesehen waren. Die Medien fragten sich, wie Gor­batschow auf diesen »Schlag ins Gesicht« reagieren würde. Aber statt einer Kritik aus Moskau wurde die Zusammenarbeit verstärkt. Offen­sichtlich wußte das Oberhaupt der UdSSR, was der »Krieg der Sterne« zu bedeuten hatte. Präsident Bush gab in ihrer gemeinsamen Presse­konferenz denn auch zu, sie hätten darüber gesprochen. Fürs Budget wurde außerdem eine vierundzwanzigprozentige Erhö­hung für die NASA gefordert, im besonderen für das, was inzwischen als »Verpflichtung« des Präsidenten bezeichnet wurde, »Astronauten zum Mond zu schicken und des weiteren den Mars von Menschen erforschen zu lassen«. Von dieser Verpflichtung sprach Bush in seiner Rede im Juli 1989 anläßlich des zwanzigsten 192 Jahrestages der ersten Mondlandung. Nach dem Unglück mit dem ChallengerShuttle im Januar 1986 waren alle Raumfahrtarbeiten abgebrochen worden. Aber anstatt sich im Juli 1989, kurz nach dem Verlust der beiden Phobos-Sonden, zu mäßigen, waren die Vereinigten Staaten darauf versessen, zum Mars zu fliegen. Dafür mußte es doch einen zwingenden Grund geben ... Zu diesem Punkt des Budgets erklärte ein Staatsbeamter, die Weltraum­ erforschung sollte gemäß einem Programm vorgenommen werden, das der nationale Raumfahrtrat erarbeitet hatte, und dazu gehöre unter anderem eine neue Startrampe. »Wir müssen neue Grenzgebiete für bemannte und unbemannte Forschung erschließen«, sagte er, »und dafür sorgen, daß das Raumfahrtprogramm zur nationalen militäri­schen Sicherheit beiträgt.« Die Erforschung von Mond und Mars durch Menschen sei eine fest umrissene Aufgabe. In Übereinstimmung mit dieser Entwicklung vergrößerte die NASA ihr Netzwerk von Raumteleskopen sowohl auf dem Boden als auch in der Luft und rüstete einige ihrer Shuttles mit elektronischen Geräten aus, die den Himmel abtasteten. Die Vergrößerung des Netzwerks von Radioteleskopen erfolgte in Zusammenarbeit mit anderen Staaten, wo­bei die Priorität auf der Beobachtung des Südhimmels lag. Bis 1982 bewilligte der Kongreß widerstrebend die Geldmittel für das SETI-Programm (Suche nach außerirdischer Intelligenz), schraubte sie nach und nach zurück, bis sie vollständig gestrichen wurden. Aber 1983 – auch ein entscheidendes Jahr – wurden sie plötzlich wieder bewilligt. 1989 setzte es die NASA durch, daß das Budget für die Suche nach außerirdischer Intelligenz zuerst verdoppelt und dann verdreifacht wur­de, nicht zuletzt dank der Unterstützung des Senators von Utah, John Garn, eines ehemaligen Shuttle-Astronauten, der vom Vorhandensein außerirdischer Wesen überzeugt ist. Die NASA brauchte das Geld für neue Scanner- und Suchgeräte über der Erde, da man die Mikrowellen analysieren wollte. Bisher hatte man nur vom Boden aus auf Radiofrequenzen von fernen Himmelskörpern und sogar von Galaxien gelauscht. In einem von der NASA herausgegebenen Leitfaden wird im Kapitel über Himmels­beobachtung die Formulierung von Thomas O. Paine, ihrem ehemali­gen Administrator, zitiert: »Die Suche nach einem Beweis, daß es außerhalb der Erde Leben gibt – oder gegeben hat –, besteht darin, andere Himmelskörper unseres Sonnensystems zu erforschen, Satelliten zu suchen und auf Signale zu lauschen, die von Intelligenzen irgendwo in der Galaxie gesendet werden.« Mit Bezug auf diese neue Einstellung bemerkte ein Sprecher der Ge­nossenschaft Amerikanischer Naturwissenschaftler in Washington: »Die Zukunft beginnt.« Die New York Times überschrieb am 6. Februar 1990 ihren Bericht über das verstärkte SETI-Programm mit der Schlagzeile: »Jagd auf fremde Wesen im Weltall: Die nächste Entwicklungsstufe.« Eine kleine, bedeutsame Veränderung: Es wird nicht mehr nach außer­irdischer Intelligenz gesucht, sondern nach »fremden Wesen«. 193 Dem Schock von 1989 war eine entscheidende Wende Ende 1983 vorausgegangen. Rückblickend ist es offensichtlich, daß von 1984 an die gemeinsamen Bemühungen der beiden Großmächte nur einem Ziel galten: »Zum Mars fliegen, zusammen.« Es wurde bereits gesagt, in welchem Ausmaß die Vereinigten Staaten an der Phobos-Mission beteiligt gewesen waren. Als bekannt wurde, welche Rolle die amerikanischen Wissenschaftler bei dieser Mission gespielt hatten, hieß es, sie sei »offiziell sanktioniert worden, um die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu verbessern«. Es wurde auch bekannt, daß die amerikanischen Ab­wehrexperten sich Sorgen machten wegen der Absicht der Sowjets, Phobos mit einer gewaltigen Laserwaffe anzugreifen, denn die Ameri­ kaner befürchteten, die Sowjets würden dann in ihrem eigenen »Krieg der Sterne« im Vorteil sein; aber das Weiße Haus wies dieses Argument zurück und willigte ein. Eine derartige Zusammenarbeit war ein erheblicher Unterschied zu dem, was vorher die Norm gewesen war. Als Reagan im März 1983 eine Fernsehrede hielt, überraschte er das amerikanische Volk, alle Staaten und auch, wie später bekannt wurde, seine eigenen höchsten Politiker mit seiner strategischen Abwehrinitiative (SDI) – ein Schutz­schild im Raum gegen Fernlenkgeschosse und Raumschiffe –, und man nahm natürlich an, er verfolge damit lediglich den Zweck, die militärische Übermacht über die Sowjetunion zu gewinnen. Als Michail Gorbatschow 1985 der Nachfolger von Konstantin Tschernenko ge­worden war, hielt er daran fest, daß eine Verbesserung der Ost-West-Beziehungen von der Preisgabe der SDI abhing. Aber – das scheint jetzt klar zu sein – eine Wende trat ein, als die wahren Gründe für das SDI-Programm dem sowjetischen Führer erläutert wurden. In seiner Ausgabe vom 15. Juni 1985 schrieb die Wochenzeitschrift The Economist, die Sowjets hätten ihre Gewohnheit, alle ihre Raumfahrt­programme geheimzuhalten, plötzlich aufgegeben, und zum Erstaunen der westlichen Wissenschaftler sprächen ihre sowjetischen Kollegen ganz offen und begeistert von ihren Plänen. Ihr Hauptthema sei die Mission zum Mars. Die plötzliche Wende war um so rätselhafter, als die Sowjetunion in den Jahren 1982 und 1983 weit auf dem Vormarsch zu sein schien und die Vereinigten Staaten im Kampf um die Vormachtstellung im Weltall nachhinkten. Sie hatte inzwischen eine Serie von Saljut-Raumstationen in die Umlaufbahn um die Erde gebracht, bemannt mit Kosmonauten, die den Rekord der Aufenthaltsdauer im Weltraum hielten und sich darin übten, Raumschiffe anzukoppeln und mit Treibstoff zu versehen. Beim Vergleich der beiden nationalen Programme seien sie, so besagte eine Studie des Kongresses Ende 1983, wie eine amerikanische Schild­ kröte und ein russischer Hase. Aber Ende 1984 erlebte man das erste Anzeichen der erneuerten Zusammenarbeit: Da trug die sowjetische Sonde Vega, die dem Halleyschen Kometen begegnen sollte, ein ameri­kanisches Gerät. 194 Es gab noch mehr halboffizielle und offizielle Anzeichen für den neuen Geist in der Raumfahrt-Zusammenarbeit – trotz SDI. Im Januar 1985 luden Wissenschaftler und Verteidigungspolitiker den hochkarätigen sowjetischen Raumfahrtexperten Roald Sagdejew (den späteren Bera­ter Gorbatschows) zu einer Diskussion über SDI nach Washington ein. Gleichzeitig trafen sich der amerikanische Außenminister George Shultz und sein sowjetischer Kollege in Genf, sie kamen überein, den erlo­schenen Vertrag über die Raumfahrt-Zusammenarbeit zu erneuern. Im Juli 1985 trafen sich amerikanische und sowjetische Wissenschaftler, Politiker und Astronauten in Washington, angeblich um den zehnten Jahrestag des ersten Rendezvous-Manövers zu feiern; in Wirklichkeit aber war es ein Seminar, das einer gemeinsamen Mission zum Mars galt. Eine Woche später sagte der ehemalige Astronaut Brian T. O’Leary, der einer internationalen Forschergruppe angehört, in einem Vortrag vor der Gesellschaft für den wissenschaftlichen Fortschritt in Los Angeles, der nächste Riesenschritt werde der zu den Satelliten des Mars sein. »Wie könnte man das Ende des Jahrtausends besser feiern als mit einer Hin- und Rückreise von Phobos zu Deimos, besonders wenn es eine internationale Mission wäre?« Und im Oktober desselben Jahres wurden mehrere amerikanische Kongreßmitglieder, Politiker und ehemalige Astronauten von der sowjetischen Akademie der Wis­senschaften erstmalig zu einer Besichtigung der sowjetischen Raumfahrt­anlagen eingeladen. War das alles nur ein Entwicklungsprozeß, Teil einer neuen Politik eines neuen Führers in der UdSSR, eine Veränderung der Umstände in Osteuropa? Gab es nicht vielleicht noch eine andere Ursache, eine bedeutsame Erkenntnis, die plötzlich einen Unterschied ausmachte, alles änderte, neue Prioritäten setzte und eine Allianz erforderte wie einst der Zweite Weltkrieg? Wenn dies zutrifft, wer ist dann jetzt der gemeinsame Feind? Gegen wen richtet sich das Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion? Und warum der Ent­schluß beider Staaten, zum Mars zu fliegen? Natürlich gab es auf beiden Seiten Einwände gegen einen derartigen Zusammenschluß. In den Vereinigten Staaten widersetzten sich viele Verteidigungspolitiker und Konservative der »Auflösung der Wache« im kalten Krieg, zumal in der Raumfahrt. Im November 1985 trafen sich Reagan und Gorbatschow und gingen aus dem Gespräch als freundschaftlich Verbündete hervor, die von einem neuen Zeitalter der Zusammenarbeit, des Vertrauens und gegenseitigen Verständnisses kün­deten. Reagan wurde um eine Erklärung für diese Wendung gebeten. Er antwortete, die gemeinsame Sache sei die Raumfahrt. Genauer gesagt, eine Gefahr, die allen Ländern auf der Erde aus dem Weltraum drohe. Er ergriff die erste Gelegenheit, sich öffentlich zu äußern, und sagte am 4. Dezember 1985 in Fallston im Staat Maryland: »Wie Sie wissen, sind Nancy und ich vor zwei Wochen aus Genf zurückgekehrt, wo ich mit dem sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow 195 mehrere lange Gespräche geführt habe. Wir diskutierten über fünfzehn Stunden lang und führten ein fünfstündiges Gespräch unter vier Augen. Ich fand in ihm einen entschlossenen Mann, aber auch einen, der zuhören kann. Ich schilderte ihm Amerikas tiefes Verlangen nach Frieden, sagte, daß wir die Sowjetunion nicht bedrohen wollen und daß ich glaube, beide Völker wünschten dasselbe, nämlich eine bessere und sicherere Zukunft für uns und unsere Kinder. In unserem Privatgespräch sagte ich ihm, er dürfe nicht aufhören, daran zu glauben, daß wir alle Gottes Kinder sind, wo immer wir uns befinden mögen, und dann sagte ich folgendes: Bedenken Sie, wie einfach unsere Aufgabe wäre, wenn unsere Welt plötzlich von Wesen bedroht würde, die von einem anderen Planeten im Weltall kommen. Wir würden all die kleinen Differenzen, die zwischen unseren Ländern bestehen, vergessen, und wir würden erkennen, daß wir alle auf dieser Erde Menschen sind. Ich betonte auch, daß die amerikanische strategische Verteidigungs­initiative nur der Suche nach einem nichtnuklearen Schild dient, das uns vor Raketen schützen und zu Hoffnung, nicht zu Furcht Anlaß geben soll.« War die Erwähnung einer Gefahr aus dem Weltall nur als ein Beispiel gedacht, oder wollte der amerikanische Präsident der Öffentlichkeit absichtlich offenbaren, daß dies der wahre Grund für den Zusammenschluß der beiden Staaten war, auch dafür, daß die Sowjets sich in der Folge nicht mehr dem SDI-Programm widersetzten? Rückblickend ist es klar, daß die »Gefahr« und die Notwendigkeit einer Abwehr im Weltraum den amerikanischen Präsidenten beschäftigten. In Journey Into Space (Reise ins Weltall) schildert Bruce Murray von der NASA-Forschungsanstalt in Pasadena (JPL) und zusammen mit Carl Sagan, Gründer der Planetarischen Gesellschaft, wie bei einer Sitzung im Weißen Haus im März 1986 eine Gruppe von sechs Raumfahrtspezialisten dem Präsidenten über die Voyager-Entdeckun­gen beim Uranus Bericht erstatteten. Reagan fragte: »Sie haben viele Dinge im Weltraum untersucht. Haben Sie Beweise, daß es dort Lebe­ wesen gibt?« Als sie verneinten, schloß er die Sitzung mit den Worten: »Hoffentlich wird es für Sie noch spannender werden.« Rechnete das Staatsoberhaupt damit, daß der »entschlossene« Mann, der damals an der Spitze der Sowjetunion stand, seine Überlegungen mit einem Lächeln abtun würde? Oder hat er Gorbatschow in dem fünfstündigen Gespräch überzeugt, daß die Bedrohung durch Außerir­dische kein Scherz war? Wir wissen allerdings durch Presseberichte, daß Gorbatschow am 16. Fe­bruar 1987 in einer Rede vor einem internationalen Forum im Kreml, wo es um das Thema »Überleben der Menschheit« ging, auf sein Gespräch mit Reagan zurückkam und fast die gleichen Worte wie der amerikanische Präsident benutzte. Er begann die Rede folgenderma­ßen: »Mit dem Schicksal der Welt und der Zukunft der Menschheit haben sich die besten Wissenschaftler beschäftigt, seit der Mensch begonnen hat, über die Zukunft nachzudenken. Bis vor kurzem wur196 den diese und ähnliche Überlegungen als Übungen der Einbildungskraft angesehen, als gedankliche Spekulationen der Philosophen und Theo­logen. Aber seit einigen Jahrzehnten sind sie auf eine realistische Ebene geraten.« Nachdem er auf die Gefährlichkeit der Kernwaffen und auf die gemeinsamen Interessen der »menschlichen Zivilisation« hingewiesen hatte, fuhr er fort: »Bei unserem Gespräch in Genf sagte der amerikanische Präsident, wenn es die Erde mit einer Invasion Außerirdischer zu tun bekäme, würden die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion ihre Streitkräfte vereinigen, um gemeinsam eine solche Invasion abzuwehren. Ich will über die Hypothese nicht diskutieren, weil ich es für verfrüht halte, sich wegen dieser Möglichkeit Sorgen zu machen.« Mit der Wahl seiner Worte, »über die Hypothese nicht diskutieren«, drückte er sich deutlicher aus als Reagan mit seinem spielerischen Ton: Er sprach von einer »Invasion Außerirdischer« und erklärte, Reagan habe bei dem Gespräch unter vier Augen nicht über die Vorteile einer geeinten Menschheit philosophiert, sondern vorgeschlagen, mit verein­ten Kräften eine solche Invasion abzuwehren. Noch bedeutsamer als die Versicherung vor einem internationalen Fo­rum, »die Streitkräfte zu vereinigen«, war der Zeitpunkt. Erst ein Jahr zuvor, am 28. Januar 1986, hatten die Vereinigten Staaten einen furcht­baren Rückschlag erlitten, als das Challenger-Shuttle kurz nach dem Start explodiert war, sieben Astronauten ums Leben kamen und Ame­rikas Raumfahrtprogramm unterbrochen wurde. Andererseits errichte­te die Sowjetunion am 20. Februar 1986 ihre neue Raumstation Mir, ein wesentlich fortschrittlicheres Modell als die vorherigen SaljutSerien. Anstatt sich diese Lage zunutze zu machen und die Unabhängigkeit der Sowjetunion von den Vereinigten Staaten auszubauen, verstärkten die Sowjets in den folgenden Monaten die Zusammenarbeit. Unter ande­rem erlaubten sie dem amerikanischen Fernsehen, dem nächsten Start von ihrem bisher streng geheimgehaltenen Raumflughafen in Baikonur beizuwohnen. Als am 4. März die sowjetische Sonde Vega 1 an der Venus vorbeiflog, um Proben zu holen, und die Begegnung mit dem Halleyschen Komet stattfand, waren die Europäer und die Japaner dabei, aber nicht die Vereinigten Staaten. Immerhin beharrte Roald Sagdejew, der Leiter des Instituts für Raumforschung, darauf, daß der Plan, zum Mars zu fliegen, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten ausgeführt werden sollte. Infolge der Challenger-Katastrophe wurden alle Raumfahrtprogramme aufgeschoben mit Ausnahme des Fluges zum Mars. Die NASA trug einer Forschergruppe unter der Leitung des Astronauten Dr. Sally K. Ride auf, den Plan und seine Durchführbarkeit zu überprüfen. Sie empfahl die Entwicklung von Fähren und Frachtern, die dazu dienen sollten, Astronauten und Ausrüstungen in den Raum zu tragen, »um Siedlungen außerhalb der Erdbahn von den Bergen des Mondes bis zu den Flächen des Mars zu gründen«. Dieser Eifer, zum Mars zu fliegen, erforderte die Zusammenarbeit der amerikanischen und sowjetischen Sachverständigen und die Einheit­lichkeit der Pro197 gramme. Besonders die Abwehrplaner sahen in dem Rückschlag des bemannten Shuttle-Programms die Notwendigkeit, sich mehr auf unbemannte Raketenflugzeuge zu verlassen. Mit Unterstützung des Kongresses und der Öffentlichkeit kam man überein, beim »Krieg der Sterne« die Hilfsantriebe der neuen Raketen der Luftwaffe zu benutzen. Allen Einwänden zum Trotz unterzeichneten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion im April 1987 ein neues Abkommen für die Zusammenarbeit im Weltraum. Kurz darauf befahl das Weiße Haus der NASA, die Herstellung eines Mars-Beobachters, der 1990 hätte starten sollen, einzustellen; von jetzt an müsse die Phobos-Mission der Sowjet­union unterstützt werden. Dennoch erhoben sich in den Vereinigten Staaten weiterhin Stimmen gegen das Vorhaben, Raumfahrtgeheimnisse mit den Sowjets zu teilen, und manche Fachleute betrachteten die wiederholten Aufforderungen der Sowjets, an den Mars-Missionen teilzunehmen, nur als den Ver­such, Zugang zur westlichen Technik zu erhalten. Zweifellos sah sich Präsident Reagan dadurch veranlaßt, nochmals öffentlich von der au­ßerirdischen Gefahr zu sprechen. Seine Rede vor der Generalversamm­lung der Vereinten Nationen am 21. September 1987 bot ihm dazu Gelegenheit. Er sprach von der Notwendigkeit, aus Schwertern Pflug­ scharen zu machen, und sagte: »Wenn wir von einem momentanen Antagonismus besessen sind, vergessen wir oft, wie vieles die Mitglieder der Menschheit vereint. Vielleicht bedarf es einer allgemeinen Gefahr von außen, um diese Gemeinsamkeit zu erkennen. Ich denke manchmal, wie schnell unsere Differenzen verschwinden würden, wenn wir einer Drohung von Fremden, die außerhalb unserer Welt leben, gegenüber stünden.« Wie die Presse berichtete, suchte Präsident Reagan bei einem Mittages­sen im Weißen Haus am 5. September eine Bestätigung seitens des sowjetischen Außenministers und fragte ihn, ob die Sowjetunion bei einer Bedrohung aus dem Weltall mit den Vereinigten Staaten wirklich gemeinsame Sache machen würde, worauf Schewardnadse antwortete: »Ja, unbedingt.« Man kann nur vermuten, wie die Debatten in den nächsten drei Mona­ten im Kreml verliefen; jedenfalls führten sie dazu, daß Reagan und Gorbatschow im Dezember 1987 zu einer zweiten Gipfelkonferenz zusammenkamen. Einige der unterschiedlichen Positionen waren in Washington öffentlich bekannt. Dazu gehörten die Zweifel an den Motiven der Sowjets, die von denjenigen geäußert worden waren, denen es schwerfiel, zwischen Wissenschaft und dem Austausch mi­litärischer Geheimnisse zu unterscheiden. Dann gab es noch jene, die wie der Republikaner Robert A. Roe, Vorsitzender des parlamentari­schen Komitees für Wissenschaft, Raumfahrt und Technik, glaubten, die gemeinsamen Bemühungen, den Mars zu erforschen, werden den internationalen Schwerpunkt vom »Krieg der Sterne« auf »Raumschiff Enterprise« verlegen. Er und andere drängten Reagan, die Entscheidung aufzuschieben. Aber der amerikanische Präsident bevollmächtigte die fünf NASA-Abgeordneten, die Mars-Projekte mit den So198 wjets zu be­sprechen. Trotzdem hörte die erbitterte Debatte in Washington sogar nach dem Gipfel im Dezember 1987 nicht auf. Es verlautete, daß der amerikani­sche Verteidigungsminister Caspar Weinberger zu denjenigen gehörte, die die Sowjetunion beschuldigten, im geheimen ein »Satelliten-Mord­system« zu entwickeln und von ihrer Mir-Raumstation aus Experimen­te mit Laserwaffen durchzuführen. So kam Reagan wieder einmal auf das Thema der geheimen Gefahr zu sprechen. Bei einer Versammlung im Mai 1988 in Chicago mit Mitgliedern des Nationalen Strategie­ forums warf er die Frage auf: »Was würde wohl geschehen, wenn wir alle auf der Erde erfahren sollten, daß wir von außen bedroht werden, von einer Macht im Weltraum, von einem anderen Planeten?« Jetzt war es nicht mehr eine unbestimmte Bedrohung von außen, sondern von »einem anderen Planeten«. Am Ende des Monats kamen die beiden Führer der Großmächte zu ihrem dritten Gipfel in Moskau zusammen, und sie einigten sich auf gemeinsame MarsMissionen. Zwei Monate später wurden die Phobos-Sonden abgeschossen. Der Würfel war gefallen: Die beiden Großmächte auf Erden hatten begon­nen, die Bedrohung von außen – durch »einen anderen Planeten« zu erforschen. Sie warteten gespannt. Das Unternehmen endete mit dem Phobos-2-Vorfall. Was geschah 1983, das diese monumentale Veränderung in den Bezie­hungen zwischen den Großmächten bewirkte und ihre Führer veranlaß­te, sich mit einer Bedrohung durch »einen anderen Planeten« zu befas­sen? Es ist bemerkenswert, daß Gorbatschow in seiner Rede im Februar diese Gefahr zwar erwähnte, aber erklärte, er wolle nicht darüber diskutieren; es sei verfrüht, sich wegen dieser Möglichkeit Sorgen zu machen. Bis zur Phobos-2-Katastrophe und gewiß nicht vor dem Ende des Jahres 1983 wurde die Frage der »Außerirdischen« von zwei Seiten aus betrachtet. Auf der einen Seite gab es diejenigen, die aufgrund der Logik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung annahmen, es gebe eine außerirdische Intelligenz »dort draußen«. Die Vertreter dieser Meinung kannten die Formel, die Frank D. Drake von der Universität Kalifor­nien in Santa Cruz, der Vorsitzende des SETI-Instituts in Mountain View (Kalifornien) und Verfasser des Buches Suche nach außerirdi­ scher Intelligenz (Search for Extra Terrestrial Intelligence), entwickelt hat. Nach dieser Formel müßte die Milchstraße, unsere Galaxis, zehn- bis hunderttausend fortgeschrittene Zivilisationen aufweisen. Im Rah­men des SETI-Projektes hat man verschiedene Radioteleskope dazu benutzt, Radiosendungen aus dem Weltraum aufzufangen, das heißt, in den natürlichen Geräuschen der Gestirne, Galaxien und anderer Him­melserscheinungen zusammenhängende oder wiederholte Signale her­auszuhören, die künstlich zu sein scheinen. Derartige »intelligente« Signale wurden einige Male wahrgenommen, aber die Forscher vermoch­ten sie 199 nicht zu orten oder eine Wiederholung herbeizuführen. Die Arbeit des SETI-Projektes hat zwar bisher nichts eingebracht, aber sie wirft zwei Fragen auf. Die erste – sie war übrigens der Grund, warum der Kongreß das Budget kürzte und dann strich – lautet: Hat es überhaupt einen Sinn, ein Signal empfangen zu wollen, das Lichtjahre braucht, um zu uns zu gelangen und dessen Beantwortung ebensoviel Zeit erfordert? Die zweite, und das ist meine Frage: Wieso ist zu erwarten, daß fortgeschrittene Zivilisationen Radiowellen zur Kommu­nikation benutzen? Hätten wir bei einer Suche vor Jahrhunderten er­wartet, daß brennende Scheiterhaufen benutzt würden, nur weil sich damals Bergvölker auf diese Weise miteinander verständigten? Und was ist mit allen übrigen technischen Fortschritten auf der Erde – von Elektrizität zu Elektromagnetismus und Fiberoptik, Laser- und Pro­tonenstrahlen und Kristalloszillation, gar nicht zu reden von zukünfti­gen Entdeckungen? Unerwarteterweise war die SETI gezwungen, die Suche in größerer Erdnähe fortzusetzen und sich weniger mit außerirdischen Intelligen­zen als mit dem Ursprung des Lebens auf der Erde zu befassen. Die beiden Gruppen trafen sich auf Betreiben des Forschers Philip Morrison vom Technischen Institut in Massachusetts im Juli 1980 in der Univer­sität Boston. Nach einer Diskussion über die Panspermia-Theorie (vor­sätzliche Besamung) vertrat Eric M. Jones, ein führender Physiker vom staatlichen Laboratorium in Los Alamos, die Meinung, wenn es Außer­irdische gäbe, hätten sie schon längst die Galaxie und die Erde besie­delt. Die Verkettung der Suche nach dem Ursprung des Lebens auf der Erde mit der Suche nach Außerirdischen trat bei der internationalen Konferenz 1986 in Berkeley noch stärker zutage. »Die Jagd auf Anzei­chen einer außerirdischen Intelligenz ist für viele Forscher mit der Suche nach dem Ursprung des Lebens verknüpft«, berichtete Erik Eckholm in der New York Times. »Die Chemiker und Biologen erfor­schen jetzt den Mars und den Saturn-Mond, um das Rätsel des Lebens auf Erden zu lösen.« Es wäre naiv anzunehmen, daß es die NASA und andere Institutionen, nur weil der Boden des Mars keine Schlüsse auf dortiges Leben zuläßt, nicht mehr interessiert, was all die seltsamen Erscheinungen auf dem Mars zu bedeuten haben (obwohl offiziell alle diesbezüglichen Speku­lationen eingestellt worden sind). Schon 1968 hatte sich das amerikani­sche Sicherheitsamt in einer Studie über die Ufos mit den Folgen der »Gegenüberstellung einer technisch hochentwickelten, außerirdischen Gesellschaft mit einer unterlegenen auf der Erde« befaßt. Irgend je­mand mußte natürlich eine Vorstellung davon haben, welcher Planet die Heimat einer solchen außerirdischen Gesellschaft sein könnte. War es Mars? Das wäre wohl die einzig einleuchtende (wenn auch unglaubwürdige) Erklärung gewesen, solange die Suche nicht einem anderen Planeten in unserem Sonnensystem galt. Eine Zeitlang zogen Astronomen, die sich die Störungen in der Bahn von Neptun und Uranus nicht zu erklären vermochten, die Möglichkeit in Betracht, daß es weiter entfernt von der Sonne noch einen Planeten geben könnte. Sie nannten 200 Abb. 102 ihn Planet X, was sowohl »unbekannt« als auch »zehn« bedeutet. Im Buch Der zwölfte Planet wird erklärt, daß Planet X und Nibiru ein und dasselbe Gestirn sind, denn für die Sumerer hatte das Sonnensystem zwölf Mitglieder: Sonne, Mond, die neun ursprünglichen Planeten und den Eindringling Nibiru/Marduk. In der Tat hatten die Störungen in den Umlaufbahnen 1930 zur Entdeckung des Planeten Pluto geführt. Als Joseph L. Brady vom Lawrence-Livermore-Laboratorium in Kalifornien 1972 an dem Flugbahnbild des Halleyschen Kometen arbeitete, stellte er fest, daß auch die Bahn des Kometen gestört war. Seine Berechnungen bestätigten das Vorhanden­sein des Planeten X in 64 AE (astronomische Einheit = 149,6 Millionen Kilometer) mit einer Umlaufperiode von tausendachthundert Erdjahren. Seither schätzten er und alle Astronomen, die den Planeten X gesucht hatten, seine Entfernung von der Sonne auf die Hälfte seiner längeren Achse (Abb. 102, Entfernung »a«). Aber laut den sumerischen Texten umkreist Nibiru die Sonne wie ein Komet, so daß die Entfernung von ihr fast die gesamte längere Achse ergibt, nicht nur die Hälfte (Abb. 102, Entfernung »b«). Könnte die Tatsache, daß Nibiru sich auf dem Rück­weg zu seinem Perigäum befindet, der Grund sein, daß Bradys Umlauf­zeit von tausendachthundert Jahren genau die Hälfte von den dreitausendsechshundert Jahren ist, die die Sumerer für die Umlaufbahn errechnet haben? Noch weitere Schlüsse, die Brady gezogen hat, stimmen mit den sume­rischen Daten überein: Der Planet sei rückläufig, seine Bahn elliptisch und nicht ekliptisch. Die Astronomen hatten sich gefragt, ob Pluto die Störungen im Umlauf von Uranus und Neptun verursachen könnte. Aber im Juni 1978 stellte James W. Christie vom Marine-Observatorium in Washington fest, daß Pluto einen Mond (Charon) hat und viel kleiner ist, als man angenom­men hatte. Folglich konnte Pluto nicht die Ursache der Störungen sein. Außerdem enthüllte Charons Bahn um Pluto, daß Pluto genau wie Uranus geneigt ist. All dies erregte den Verdacht, daß eine äußere Gewalt, ein Eindringling, Uranus und Pluto umgekippt habe und die Ursache sei, daß Triton (ein Mond Neptuns) rückläufig ist. 201 Durch diese Feststellungen angeregt, machten sich zwei Kollegen von Christie, Robert S. Harrington und Thomas C. Van Flandern, daran, mit Computersimulationen die Sache zu ergründen. Sie fanden heraus, daß es einen Eindringling geben müsse, einen Planeten, zweimal so groß wie die Erde, mit elliptischer Bahn und einer Halbachse von weniger als hundert AE (Icarus, Bd. 39, 1979). Das war wieder eine Be­stätigung des alten Wissens durch die moderne Wissenschaft: Das ganze Konzept von einem Eindringling, der alle die Merkwürdigkeiten verursacht, steht im Einklang mit der sumerischen Nibiru-Geschichte, und die Entfernung von hundert AE versetzt den Planet X ungefähr an die Stelle, die die Sumerer ihm zugeschrieben haben. Mit den Daten über Jupiter und Saturn, die man durch die beiden VoyagerSonden erhalten hatte, nahmen sich Van Flandern und vier seiner Kollegen nochmals die Bahnen der äußeren Planeten vor. In einem Vortrag vor der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft führte er neue Beweise an – die auf komplexen Vergleichen der Anziehungskräfte beruhten –, daß ein Himmelskörper, der minde­stens doppelt so groß ist wie die Erde, in einer Entfernung von wenig­stens 2,4 Milliarden Kilometern hinter Pluto die Sonne umkreist und daß die Umlaufzeit mindestens tausend Jahre beträgt. Die Zeitung The Detroit News veröffentlichte die Neuigkeit am 16. Januar 1981 auf der Titelseite, zusammen mit der sumerischen Abbildung des Sonnensy­stems und einer Zusammenfassung meiner Hauptthese (Abb. 103). Die NASA beteiligte sich nun an der Suche nach dem Planeten X, unter der Leitung von John D. Anderson vom JPL, der die Pioneer-Flüge vorbereitet hatte. Am 17. Juni 1982 verkündete die NASA, daß die beiden Sonden für die Suche nach dem Planeten X eingesetzt werden sollten. Die Erklärung lautete: »Dauernde Unregelmäßigkeiten in der Bahn von Uranus und Neptun lassen darauf schließen, daß es tat­sächlich ein geheimnisvolles Objekt gibt – weit hinter den äußersten Planeten.« Da die PioneerSonden in verschiedener Richtung fliegen würden, könnten sie bestimmen, wie weit entfernt der Himmelskörper ist: Wenn eine Abb. 103 202 der Sonden stärker angezogen würde, sei der Himmels­körper in der Nähe und müsse ein Planet sein; wenn beide angezogen würden, müsse er zwischen achtzig und hundertsechzig Milliarden Kilometer entfernt sein; er könnte ein »dunkler Stern« oder ein »brau­ner Zwerg« sein, aber kein weiteres Glied des Sonnensystems. Im September 1982 bekräftigte das U.S. Naval Observatory (das Mari­neObservatorium der Vereinigten Staaten), daß die Suche nach dem Planeten X ernsthaft betrieben würde. Dr. Harrington sagte, seine Gruppe beschränke sich auf einen ziemlich kleinen Teil des Himmels, und fügte hinzu: »Es scheint, daß dieser Himmelskörper sich viel langsamer bewegt als alle Planeten, die wir kennen.« (Unnötig zu sagen, daß die oben erwähnten Astronomen, die mit der Suche nach dem Planeten X beschäftigt waren, sehr bald lange Briefe von mir erhielten, zusammen mit einem Exemplar meines Buches Der zwölfte Planet. Ich erhielt ebenso ausführliche und freundliche Ant­worten.) Die Ausdehnung der Suche nach dem Planeten X von einem wissen­schaftlichen Gegenstand zu einer Angelegenheit der NASA zeigte sich darin, daß immer mehr bemannte Raumschiffe für die Suche eingesetzt wurden. Es fanden verschiedene geheime Missionen der amerikani­schen Raum-Shuttles statt, neue teleskopische Geräte tasteten den Him­mel ab, und die sowjetischen Kosmonauten in der Raumstation Saljut wurden insgeheim für die Suche nach dem Planeten eingesetzt. Unter den Myriaden Lichtpunkten am Himmel unterscheiden sich Planeten, Kometen und Asteroiden dadurch von anderen Gestirnen und Galaxien, daß sie sich bewegen. Die Technik besteht darin, denselben Teil des Himmels mehrmals in zeitlichen Abständen zu fotografieren und dann die Aufnahmen zu vergleichen; das geübte Auge erkennt, ob sie sich inzwischen bewegt haben. Natürlich konnte man den Planeten X mit diesem Verfahren nicht finden, weil er zu weit entfernt ist und sich sehr langsam bewegt. Nachdem im Juni 1982 verkündet worden war, welche Rolle die Pioneer-Sonden bei der Suche nach dem Planeten X spielen sollten, schrieb John Anderson in einem Bericht für die Planetarische Gesellschaft, das Rätsel könne, abgesehen von den Pioneer-Forschungen, vielleicht durch eine Infrarotsuche gelöst werden, und zwar mittels des Infrarot-Satelli­ten IRAS. Dieser Satellit reagiere äußerst empfindlich auf die Hitze im Innern von Himmelskörpern, die sich in Form von infraroter Strahlung im Raum verliert. Der wärmeempfindliche Satellit IRAS wurde Ende Januar 1983 in einem amerikanisch-britisch-holländischen Verbund neunhundert Ki­lometer über der Erde abgeschossen. Man nahm an, er werde imstande sein, einen Planeten von Jupiters Größe im Abstand von 277 AE aufzu­spüren. Bevor ihm das kühlende flüssige Helium ausging, hatte er zweihundertfünfzigtausend Gegenstände aufgespürt: Galaxien, Sterne, interstellare Staubwolken sowie kosmischen Staub, Asteroide, Kome­ten und Planeten. Die Suche nach einem zehnten Planeten war sein erklärtes Ziel. In ihrem Bericht mit der Schlagzeile »Die Suche nach Planet 203 X wird warm« zitierte die New York Times am 30. Januar 1983 die Worte des Astronomen Ray T. Reynolds vom Forschungszentrum Ames: »Die Astronomen sind des zehnten Planeten so sicher, daß sie meinen, es bleibe nichts mehr übrig, als ihm einen Namen zu geben.« Hat IRAS den zehnten Planeten gefunden? Obwohl die Spezialisten zugaben, daß es jahrelang dauern werde, bis die sechshunderttausend Aufnahmen, die IRAS auf seiner zehn­monatigen Raumfahrt übermittelt hatte, gesichtet und ausgewertet sei­en, lautete die offizielle Antwort: Nein, der zehnte Planet ist nicht gefunden worden. Aber das ist, milde ausgedrückt, nicht die richtige Antwort. Nachdem IRAS denselben Teil des Himmels mindestens zweimal ab­getastet hatte, so daß die Bilder verglichen werden konnten, wurden – und davon hörte man nichts – Objekte entdeckt, die sich bewegten. Darunter waren fünf bisher unbekannte Kometen sowie mehrere, die man verloren geglaubt hatte, vier neue Asteroiden und »ein rätselhaftes kometenartiges Objekt«. War das vielleicht der zehnte Planet? Allen skeptischen Entgegnungen zum Trotz sickerte gegen Ende des Jahres eine Enthüllung durch. Die Washington Post und andere Zeitun­gen veröffentlichten ein Interview ihres wissenschaftlichen Mitarbei­ters Thomas O’Toole mit IRAS-Forschern unter verschiedenen Über­ schriften: »Geheimnisvoller Himmelskörper im Raum gefunden«, »Ein riesiges Objekt am Rande des Sonnensystems gibt Rätsel auf«, »Ein Riesending verblüfft die Astronomen« (Abb. 104). Die Exklusiv­geschichte begann folgendermaßen: »Ein Teleskop, das IRAS heißt, hat in der Richtung des Sternbildes Orion einen Himmelskörper entdeckt, der möglicherweise so groß ist wie der riesige Jupiter und vielleicht der Erde so nahe, daß er unse­rem Abb. 104 204 Sonnensystem angehören könnte. So rätselhaft ist das Objekt, daß die Astronomen nicht wissen, was es ist, ein Planet, ein Riesenkomet, ein Protostern, der nie heiß genug wurde, um ein Stern zu werden, eine ferne Galaxie, die noch so jung ist, daß die ersten Sterne erst im Begriff sind, sich zu bilden, oder eine Galaxie, die so sehr von Staubwolken umhüllt ist, daß das Licht ihrer Sterne nicht hindurchdringt. ›Ich kann Ihnen nur sagen, daß wir nicht wissen, was es ist‹, bekannte der leitende IRAS-Forscher Gerry Neugebauer.« Aber könnte es ein Planet sein, ein Teil unseres Sonnensystems? Diese Möglichkeit ist der NASA anscheinend in den Sinn gekommen, denn im nächsten Artikel der Washington Post stand: »Als die IRAS-Forscher den rätselhaften Himmelskörper sahen und ausrechneten, daß er nur achtzig Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sein könnte, spekulierten sie, ob er sich wohl auf die Erde zu bewegt.« Der rätselhafte Himmelskörper, hieß es weiter, wurde von IRAS zwei­mal aufgenommen, und zwar im zeitlichen Abstand von sechs Mona­ten; inzwischen schien er sich kaum bewegt zu haben. »Demnach kann es kein Komet sein, denn erstens wäre ein Komet niemals so groß, und zweitens hätte er sich dann bewegt«, sagte James Houck, Radiophysiker und Raumfahrtforscher an der Universität Cornell, der zum Mitarbei­terstab des IRAS-Projektes gehörte. Könnte es ein sehr ferner Planet sein, der sich nur langsam bewegt, falls es nicht ein schnellerer Komet ist? »Denkbar«, lautete die Antwort. »Es könnte der zehnte Planet sein, den die Astronomen bisher vergeblich gesucht haben«, schreibt die Washington Post. Was IRAS eigentlich entdeckt habe, wollte ich im Februar 1984 vom Öffentlichen Informationsbüro des JPL wissen. Hier die Antwort, die ich erhielt: »Die Aussagen des von der Presse zitierten Wissenschaftlers verraten seine Unwissenheit, was die von IRAS übermittelten Daten betrifft. Auf typisch akademische Weise bemerkt er, daß das Objekt, wenn es in der Nähe wäre, so groß wie Neptun sein müßte. Aber wenn es in der Ferne ist, ist es eine Galaxie.« Nichts mehr von einem Vergleich mit der Größe Jupiters; jetzt war es ein Planet von der Größe Neptuns, »wenn das Objekt in der Nähe wäre« – aber eine Galaxie (!), wenn in der Ferne. Hat IRAS also durch Wärmesensoren den zehnten Planeten aufge­spürt? Viele Astronomen glauben es. Zum Beispiel meinte William Gutsch, der Direktor des New Yorker Hayden-Planetariums, es fehle nur die Wahrnehmung durch ein optisches Teleskop, um einen zehnten Planeten katalogisieren zu können. Wenn man die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Großmächten von 1983 an verfolgt, muß man annehmen, daß auch das Weiße Haus zu die205 sem Schluß gelangt ist, zumal in Anbetracht der »hypothetischen« Bemerkungen der Regierungschefs über die aus dem Weltraum drohende Gefahr. Die Entdeckung Plutos im Jahr 1930 war ein großes astronomisches und wissenschaftliches, aber kein umwerfendes Ereignis. Das gleiche könnte für die Entdeckung des Planeten X gelten, wenn ... ja, wenn Planet X und Nibiru nicht ein und dasselbe wären. Denn wenn es Nibiru gibt, dann haben die Sumerer auch mit den Anunnaki recht gehabt. Wenn es Planet X gibt, sind wir nicht allein im Sonnensystem. Die Bedeutung für die Menschheit, ihre Gesellschaften und staatlichen Ordnungen und ihre Rüstungsindustrien wäre so enorm, daß die Politi­ker mit der Zusammenarbeit im Weltraum durchaus richtig gehandelt haben. Noch etwas läßt darauf schließen, daß IRAS keine »ferne Galaxie«, sondern einen »Planeten von der Größe Neptuns« aufgespürt hat, nämlich die Tatsache, daß danach mit vereinten Kräften bestimmte Teile des Himmels mit optischen Teleskopen abgetastet wurden und daß man plötzlich die Priorität auf die Suche am Südhimmel verlegte. Die NASA gab bekannt, daß man begonnen hatte, nicht nur eine, sondern neun »geheimnisvolle Quellen« infraroter Strahlung optisch abzutasten. Der Zweck sei, »unbekannte Objekte« in Himmelsbereichen zu finden, wo man keinerlei Strahlungsquellen kenne, wie etwa in fernen Galaxien und großen Sternansammlungen. Das sollte mit den mächtigsten Teleskopen geschehen, einem riesigen und einem kleine­ren auf dem Palomar in Kalifornien, mit einem außerordentlich starken Teleskop in Cerro Tololo in den chilenischen Anden »und jedem größe­ren Teleskop in der Welt«, einschließlich dem auf dem Mauna Kea auf Hawaii. Bei ihrer Suche nach dem Planeten X berücksichtigten die Astronomen die negativen Ergebnisse der Forschungen des Pluto-Entdeckers Clyde Tombaugh, der über ein Jahrzehnt nach dieser Entdeckung weitergeforscht hat. Seines Erachtens hatte der zehnte Planet »eine stark elliptische und geneigte Bahn und ist jetzt nicht weit von der Sonne entfernt«. Ein anderer bekannter Astronom, Charles T. Kowal, der mehrere Kometen und Asteroiden sowie Charon entdeckt hat, erklärte 1984, es gebe keinen anderen Planeten, dessen Bahn fünfzehn Grad über oder unter der Ekliptik erreiche. Doch da ihn seine eigenen Berechnungen überzeugt hatten, daß es einen zehnten Planeten geben muß, schlug er vor, ihn in einer ungefähr dreißiggradigen Neigung zur Ekliptik zu suchen. Im Jahr 1985 befaßten sich zahlreiche Astronomen mit der »Nemesis-Theorie«, die von dem Geologen Walter Alvarez (Universität Berkeley) und seinem Vater, dem Physiker und Nobelpreisträger Luis Alvarez, vorgebracht worden war. Ihnen war eine bestimmte Regelmäßigkeit beim Aussterben der Arten auf Erden (einschließlich der Dinosaurier) aufgefallen, und sie meinten, ein »Todesstern« oder Planet mit starker Neigung und ungeheurer elliptischer Bahn bewirke einen Schauer von Kometen, die dem inneren Sonnensystem und damit auch der Erde Tod und Verderben brächten. Merkwürdigerweise endeten alle Astronomen und Astrophysiker, darunter Daniel Whitmire und John Matese, die diese Möglichkeit analysierten, nicht bei einem »Todesstern«, sondern beim Planeten X. 206 Mit Thomas Chester, dem Leiter der IRAS-Datenaus­wertung, überprüfte Whitmire die infraroten Übermittlungen und er­klärte im Mai 1985: »Es besteht die Möglichkeit, daß der Planet X bereits verzeichnet ist und jetzt nur noch auf seine Entdeckung wartet.« Der Physiker Jordin Kare vom Berkeley-Laboratorium machte den Vorschlag, das Schmidt-Teleskop in Australien zusammen mit einem Computer-Scannersystem, das »Star Cruncher« genannt wird, zur Be­obachtung des Südhimmels einzusetzen. »Wenn er dort nicht entdeckt wird, können die Astronomen vielleicht zweieinhalbtausend Jahre war­ten, bis er die Ekliptik überquert«, erklärte Whitmire. Mittlerweile flogen die Pioneer-Sonden in entgegengesetzter Richtung jenseits des Gebiets bekannter Planeten durch den Raum und übermit­telten pflichtgemäß die Beobachtungen ihrer Sensoren. Was meldeten sie bezüglich des Planeten X? Am 25. Juni 1987 gab die NASA einen Pressebericht mit der Überschrift »NASA-Forscher glauben, daß es einen zehnten Planeten gibt« heraus. Er basierte auf einer Pressekonfe­renz, auf der John Anderson erklärte, die PioneerSonden hätten nichts gefunden. Das sei eine gute Nachricht, denn damit schied ein für allemal die Möglichkeit aus, daß die Störungen in der Bahn der Außen­ planeten durch einen »dunklen Stern« oder einen »braunen Zwerg« verursacht würden. Aber die Störungen seien nun einmal da, sagte er, immer wieder habe man die Daten überprüft, so daß nicht daran zu zweifeln sei. Ja, die Störungen seien vor einem Jahrhundert noch ausgeprägter gewesen, als Uranus und Saturn sich auf der anderen Seite der Sonne befunden hatten. Daraus zog Dr. Anderson den Schluß, daß es Planet X gibt. Seine Bahn ist noch geneigter als die des Planeten Pluto, und er hat etwa fünfmal mehr Masse als die Erde. Aber das seien vorläufig noch Vermutungen, die sich erst als richtig oder falsch erweisen würden, wenn der Planet tatsächlich beobachtet werden könnte. Über eine neuerliche NASA-Pressekonferenz am 13. Juli 1987 schrieb Newsweek: »Vorige Woche verkündigte die NASA bei einer Pressekon­ferenz etwas Merkwürdiges: Es sei möglich, daß ein exzentrischer zehnter Planet die Sonne umkreist.« Die Zeitschrift erwähnte jedoch nicht, daß die Pressekonferenz vom Jet Propulsion Laboratory (JPL), dem Ames-Forschungszentrum und dem NASA-Hauptsitz in Washington einberufen worden war. Das bedeutete, daß die Nachricht das Siegel der höchsten Raumfahrtautoritäten trug. Auf die Frage, wann denn Planet X gefunden werden würde, antwortete Dr. Anderson: »Ich wür­de mich nicht wundern, wenn er erst in hundert Jahren oder nie gefun­den würde, und ich würde mich nicht wundern, wenn er nächste Woche gefunden wird.« Zweifellos hatten die drei NASA-Behörden deswegen die Pressekonfe­renz veranstaltet: Das war die Neuigkeit. Aus all dem geht hervor, daß jeder, der sich mit der Suche nach Planet X befaßte, überzeugt war, es würde ihn geben, er müsse nur »entdeckt« werden, bevor sein Vorhandensein, seine Position und seine Bahn bewiesen werden könnten. Seit 207 der rätselhaften IRAS-Enthüllung Ende 1983 wurden in den Vereinigten Staaten, in der Sowjetunion und in europäischen Ländern in aller Eile neue Teleskope hergestellt und alte verbessert. Besondere Beachtung fanden die Teleskope in der südlichen Hemisphäre. Das Pariser Observatorium beauftragte eine Sondergruppe mit der Suche nach dem Planeten X, und das europäi­sche Südobservatorium in Cerro La Silla in Chile wurde mit dem neuen Teleskop NTT (New Technology Telescope) ausgestattet. Gleichzeitig befaßten sich die beiden Großmächte mit der Suche im äußeren Raum. Die Sowjets versahen 1987 ihre Raumstation Mir mit mehreren starken Teleskopen sowie mit einem Kvant genannten Modul, das elf Tonnen wog und als hochenergiegeladenes astrophysikalisches Meßinstrument beschrieben wurde. Vier der Teleskope sollten den Südhimmel absu­ chen. Eines davon war das Hubble-Space-Teleskop (HST), geplant für 1983 und schließlich ins All geschickt Anfang 1990. Aber es hatte einen fehlerhaften Meßstab, der zu falschen Ergebnissen führte, und das eineinhalb Milliarden Dollar teure Hubble-Teleskop lieferte un­scharfe Bilder. Die systematische Suche von der Erde aus wurde vom amerikanischen MarineObservatorium fortgesetzt. Die Befunde bestätigten die plane­tarischen Störungen, und die dortigen Astronomen gaben im August 1988 ihrer Überzeugung von dem Vorhandensein des Planeten X in wissenschaftlichen Zeitschriften Ausdruck. Viele Forscher teilten Dr. Harrisons Annahme, daß die Äquatorebene des Planeten um drei­ßig Grad gegen die Bahnebene geneigt ist. Seine Achse beträgt nach Harrisons Berechnungen über 200 AE, seine Masse übertrifft die der Erde wahrscheinlich um das Vierfache. Auf seiner Bahn, die der des Halleyschen Kometen gleichkommt, verbringt Planet X einen Teil seiner Zeit am Nordhimmel über der Ekliptik, die meiste Zeit aber am Südhimmel. In zunehmendem Maße konzentrierte das Marine-Observatorium seine Suche nach Planet X auf den südlichen Sternenhimmel. Die Befunde veröffentlichte Dr. Harrison im Oktober 1988 im Astronomical Journal unter dem Titel »Örtliche Festlegung des Planeten X«. Auf einer Abbildung waren die Punkte im Norden und im Süden angezeichnet, wo Planet X sein könnte. Nach dieser Publikation überzeugten ihn die Daten, die sich beim Flug der Voyager2-Sonde in bezug auf Uranus und Neptun ergeben hatten, daß Planet X sich jetzt am südlichen Sternenhimmel befinden mußte; dafür sprachen die Störungen, die zu diesem Zeitpunkt vorlagen. Er schickte mir ein Exemplar der Zeitschrift und schrieb neben den nördlichen Teil der Abbildung »Not consistent with Neptune« (Nicht vereinbar mit Neptun) und neben den südlichen Teil: »Best area now« (Jetzt bestes Gebiet) (Abb. 105). Am 16. Januar 1990 erklärte Dr. Harrison bei einer Zusammenkunft der Amerikanischen Astrono­mischen Gesellschaft in Arlington (Virginia), daß das MarineObservato­rium seine Suche nach dem zehnten Planeten auf die südliche Hemi­ sphäre beschränke und daß es eine Forschergruppe zum Observatorium Black Birch in Neuseeland geschickt habe. Nach den Daten der Voyager-2-Sonde glaube er, daß der zehnte Planet fünfmal größer als die Erde und dreimal weiter von der Sonne entfernt sei als Neptun oder Pluto. Das sind aufregende Erkenntnisse, 208 Abb. 105 nicht nur weil die moderne Wissenschaft nahe daran ist, etwas zu bestätigen, was die Sumerer bereits vor langer Zeit gewußt haben – daß es nämlich noch einen Planeten in unserem Sonnensystem gibt –, sondern weil sie auch Einzelheiten bestätigen wie die Größe und die Bahn des Planeten. Für die sumerischen Astronomen war der Himmel eine die Erde umge­bende Sphäre, die sie in drei Bänder oder Wege aufteilten. Das mittlere Band war »Anus Weg«, der sich nordwärts und südwärts Abb. 106 um je dreißig Grad erstreckte, darüber »Enlils Weg« und darunter »Enkis Weg« (Abb. 106). Die modernen Astronomen fanden diese Einteilung sinn­los. Ich selbst konnte nur eine Erklärung dafür finden, und zwar einen schriftlichen Hinweis auf die Bahn des Planeten Marduk/ Nibiru, von der Erde aus gesehen: »Planet Marduk: Zuerst erscheint Merkur. 30 Grad hoch am Himmelsbogen: Jupiter. Wenn man am Ort der Himmelsschlacht steht: Nibiru.« Diese Anleitung zur Beobachtung des Planeten weist deutlich auf seine Progression von seiner Ausrichtung auf Merkur zu einer Ausrichtung auf Jupiter durch einen Aufstieg von dreißig Grad hin. Das ist nur möglich, wenn Marduk/Ni209 biru um dreißig Grad zur Ekliptik geneigt ist. Das Erscheinen dreißig Grad über der Ekliptik und das Verschwin­den dreißig Grad darunter, genau das ist »Anus Weg«, der ein Band bildet, das sich dreißig Grad über und dreißig Grad unter dem Äquator erstreckt. So sieht es ein Betrachter in Mesopotamien. Der dreißigste nördliche Breitengrad war eine geheiligte Linie, auf der der Flughafen sowie die großen Pyramiden von Gise lagen und der an der Sphinx vorbeiführte. Es ist einleuchtend, daß die Ausrichtung mit der Stellung des Planeten Nibiru zu tun hatte, wenn er auf seiner Bahn das Perihelium erreichte: dreißig Grad am nördlichen Sternenhimmel. Wenn man annimmt, daß die Neigung des Planeten X dreißig Grad betrug, stimmen die Daten der modernen Astronomen mit denen der sumerischen Astronomen überein. Auch bei den jüngsten Feststellungen, daß der Planet von Südosten her in Richtung Zentaur auf uns zukommt, ist das der Fall. Heutzutage sehen wir dort das Sternbild Waage, aber in babylonisch-biblischer Zeit stand dort das Sternbild Schütze. Ein alter Text, den R. Campbell Thompson in seinem Buch Reports of the Magicians and Astronomers of Nineveh and Babylon zitiert, beschreibt die Bewegungen des nahen­den Planeten auf dem Wege um Jupiter herum zur Himmelsschlacht, dem »Ort der Kreuzung«: »Wenn der Planet von der Station Jupiters nach Westen zieht, wird eine Zeit sicherer Ruhe sein ... Wenn der Planet in Jupiters Nähe an Helligkeit zunimmt und im Tierkreis des Krebses zu Nibiru werden wird, dann wird Akkad im Überfluß schwelgen.« Die Abbildung 107 zeigt, daß der Planet zuerst im Schützen gesichtet wurde, wenn sein Perihelium im Krebs lag. Es ist angebracht, die biblischen Verse aus dem Buch Hiob anzuführen, die das Erscheinen des himmlischen Herrn und seine Rückkehr zur fernen Wohnung schil­dern: »Allein spannt er den Himmel aus und betritt die fernste Tiefe. Er kommt beim Großen Bär an, bei Orion und Sirius und bei den Konstellationen des Südens ... Abb. 107 210 Und der Prophet Amos sagte: Mit lächelndem Angesicht blickt er Stier und Widder an; vom Stier zum Schützen wird er gehen.« Damit wird nicht nur sein Erscheinen aus Südosten (und die Rückkehr dorthin) beschrieben, sondern auch seine rückläufige Bahn. Wenn es Außerirdische gibt, sollten dann nicht die Erdlinge versuchen, zu ihnen zu gelangen? Wenn sie durchs Weltall fliegen und die Erde erreichen können, werden sie dann wohltätig sein oder werden sie – wie H. G. Wells es im Krieg der Welten ausmalt – kommen, um zu erobern, zu zerstören und zu vernichten? Als Pioneer 10 im Jahr 1971 gestartet wurde, trug die Raumsonde eine Gravur, die den Außerirdischen, die die Sonde oder ihre Überreste vielleicht finden würden, sagen sollte, woher sie gekommen war und wer sie in den Raum geschickt hatte. Die 1977 abgeschossenen Voyagers trugen eine ähnlich gravierte, goldene Platte, die der Generalsekretär der Vereinten Nationen und Politiker von dreizehn Staaten mit gleicher Botschaft besprochen hatten. »Wenn Bewohner anderer Welten über die Technik verfügen, diese Botschaften abzufangen«, sagte Timothy Ferris von der NASA damals bei den Vereinten,Nationen, »sollten sie auch dahinterkommen können, wie man Platten abspielt.« Nicht jeder fand das einen guten Gedanken. Der englische Astronom Martin Ryle war gegen jeglichen Versuch, etwas von der Erdbevölkerung verlauten zu lassen. Er meinte, eine andere Zivilisation könnte die Erde und ihre Bewohner als verlockende Quelle von Mineralien, Nah­rungsmitteln und Sklaven ansehen, und gab zu bedenken, daß man unnötige Furcht erwecken würde. Für die Menschheit sei dadurch kaum etwas zu gewinnen. »In Anbetracht der ungeheuren Größe des Weltraums«, kritisierte die New York Times, »dürften die nächsten intelligenten Wesen Hunderte oder gar Tausende von Lichtjahren ent­fernt sein.« Aber wie die Chronologie der Entdeckungen und der Beziehungen zwischen den Großmächten beweist, wußte man schon beim ersten diesbezüglichen Gipfelgespräch, daß derartige intelligente Wesen uns viel näher sind, daß es in unserem Sonnensystem einen zehnten Plane­ten gibt, der in alter Zeit Nibiru hieß, und daß er bevölkert ist, und zwar von Wesen, die in technischer Hinsicht weiter fortgeschritten sind als wir. Einige Zeit nach dem ersten Reagan-Gorbatschow-Treffen im Jahr 1985 trugen die Vereinigten Staaten einer Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern, Fachleuten und Diplomaten auf, sich mit Vertretern der NASA und anderen Institutionen zusammenzutun und sich gemeinsam mit der Frage der Außerirdischen zu beschäftigen. Die Kommission, der auch Vertreter der Sowjetunion und mehrerer anderer Staaten an­gehörten, arbeitete mit dem amerikanischen Amt für fortschrittliche Technik (Office of Advanced Technology) des Außenministeriums zu­sammen. Womit sollte sich die Kommission befassen? Nicht etwa mit der theore­tischen Frage, ob es Lichtjahre entfernt Außerirdische gibt und wie man nach ihnen suchen könnte. Die Aufgabe war viel dringender und unheilvoller: Was sollen wir 211 tun, wenn wir sie entdeckt haben? Nur wenig ist bekannt von den Beratungen und Erwägungen dieser Arbeitsgruppe, aber aus dem, was durchgesickert ist, geht hervor, daß ihre Hauptsorge darin bestand, wie ein Kontakt mit den Außerirdischen herzustellen sei, ohne daß Unbefugte etwas davon erführen. Wie lange ließe sich das geheimhalten? Auf welche Weise sollte es der Öffentlich­keit mitgeteilt werden? Wie könnte man verhindern, daß Gerüchte zu einer weltweiten Panik führten? Wer sollte die lawinenartig anschwel­lenden Fragen, die sich ergeben würden, beantworten? Im April 1989, kurz nach der Phobos-2-Katastrophe, wurden von der internationalen Gruppe Leitlinien ausgearbeitet. Es war ein zweiseiti­ges Dokument: »Grundsätzliches Vorgehen nach der Entdeckung au­ßerirdischer Intelligenzen.« Es enthielt zehn Klauseln und einen An­hang, und natürlich diente es vor allem dem Zweck, nach der Veröffent­lichung dieser Entdeckung bestimmte Ämter mit der Kontrolle zu betrauen. Es galt, panische Reaktionen zu verhüten, mit denen man rechnen müßte, wenn die Öffentlichkeit erfahren würde, daß »wir Menschen nicht allein im Weltraum sind«. Die Leitlinien für das »grundsätzliche Vorgehen« beginnen folgender­maßen: »Wir, die Institutionen und Individuen, die an der Suche nach außerirdischen Intelligenzen teilnehmen, sind uns darüber klar, daß diese Suche ein integraler Bestandteil der Raumforschung ist und daß sie zu friedlichen Zwecken und im gemeinsamen Interesse aller Men­schen vorgenommen wird. Die Beteiligten werden gebeten, die folgen­den Grundsätze zu beachten, die in Kraft treten, sobald die Öffentlich­keit über die Entdeckung außerirdischer Intelligenzen Bescheid weiß.« Die Grundsätze gelten für jeden, ob Einzelwesen oder Mitglied einer Institution, der aufgrund eines Signals oder sonst eines Hinweises annimmt, er habe es mit außerirdischer Intelligenz zu tun. Dem »Ent­decker« ist es verboten, seine Beobachtung öffentlich bekanntzugeben. Hingegen muß er sofort die Arbeitsgruppe davon unterrichten, damit es ihr möglich ist, die weiteren Untersuchungen des Phänomens in An­griff zu nehmen. Klausel acht legt dies ausdrücklich fest: »Kein Signal oder sonst ein Beweis für das Vorhandensein außerirdi­scher Intelligenzen darf beantwortet werden, bevor einschlägige internationale Beratungen stattgefunden haben. Die Beratungen werden Gegenstand einer besonderen Abmachung sein.« Die Arbeitsgruppe zog auch die Möglichkeit in Betracht, daß das Signal nicht einfach das Vorhandensein außerirdischer Intelligenz anzeigt, sondern eine »Mitteilung« ist, die entschlüsselt werden müßte. Das würde Zeit in Anspruch nehmen, und es gelte dann zu verhindern, daß in diesem Zeitraum Gerüchte entstünden und die Lage unkontrol­lierbar würde. Die Kommission sah voraus, daß seitens der Presse, der Öffentlichkeit und der Politiker Druck ausgeübt werden würde, so daß sie gezwungen wäre, eine beruhigende Erklärung abzugeben. Warum rechnet man mit einer weltweiten Panik, wenn verkündet wür­de, daß es vielleicht in einem mehrere Lichtjahre entfernten Sternensystem intelligentes Leben gibt? Wenn zum Beispiel ein solches Signal aus dem ersten Sternensystem 212 käme, zu dem die Voyager-Sonde nach dem Verlassen unseres Sonnensystems gelangt, würde die Begegnung erst in tausend Jahren stattfinden! Deswegen hätte sich die Arbeitsgruppe wahrlich keine Sorgen machen müssen. Es ist klar, daß die Leitlinien aufgesetzt wurden, da man mit einer Botschaft oder Erscheinung rech­nete – in unserem Sonnensystem. In der Tat beruhen die Klauseln der Leitlinien auf einem Abkommen der Vereinten Nationen, das die Erfor­schung und Benutzung des Mondes und anderer Himmelskörper in unserem Sonnensystem regelt. Danach muß auch der Generalsekretär der UNO benachrichtigt werden, sobald die Regierungen Bescheid erhalten und die Möglichkeit gehabt haben, die Beweise zu prüfen und zu beschließen, was unternommen werden soll. Um die Besorgnis der verschiedenen internationalen astronomischen, astronautischen und anderen interessierten Organisationen, die Entdeckung außerirdischer Intelligenzen könnte eine rein politische oder na­tionale Angelegenheit werden, zu zerstreuen, erklärte sich die Arbeits­gruppe mit der Bildung »einer internationalen Kommission von Wissen­schaftlern und Fachleuten« einverstanden. Sie soll nicht nur bei der Überprüfung der Beweise helfen, sondern auch mit beraten, wann und wie die Öffentlichkeit zu unterrichten wäre. Das SETI-Amt der NASA bezeichnete diese Gruppe im Juli 1989 als »Sonderkommission nach der Entdeckung«. Sie untersteht dem Leiter des SETI-Amts der NASA. Im Juli 1989 erfuhren die Großmächte, daß die Phobos-Katastrophe nicht von einer Panne herrührte. Daraufhin traten die Leitlinien des grundsätzlichen Vorgehens nach der Entdeckung außerirdischer Intelli­genz in Kraft. Die moderne Wissenschaft hat in der Tat das alte Wissen vom Planeten Nibiru und den Anunnaki eingeholt. Und der Mensch weiß erneut, daß er nicht allein auf der Welt ist. 213 Und sein Name sei ... Dem Entdecker eines neuen Himmelskörpers wird üblicherweise das Vorrecht eingeräumt, ihm einen Namen zu geben. Am 31. Januar 1983 schrieb ich der Planetarischen Gesellschaft folgenden Brief: Frau Charlene Anderson Planetarische Gesellschaft 110 S. Euclid Pasadena, Kalifornien 91101 Liebe Frau Anderson, in Anbetracht der kürzlichen Presseberichte über die Suche nach dem zehnten Planeten sende ich Ihnen Kopien meines Briefwechsels mit Herrn Dr. John D. Anderson. In der New York Times vom vorigen Sonntag über die ver­stärkte Suche nach dem zehnten Planeten (siehe Beilage) steht: »Die Astronomen sind so sicher, daß es den zehnten Planeten gibt, daß nichts anderes mehr übrigbleibt, als ihm einen Namen zu geben.« Nun, die Alten haben ihn bereits benannt: Nibiru auf sume­risch, Marduk auf babylonisch. Ich glaube, ich bin berech­tigt, darauf zu bestehen, daß er so genannt wird. Mit besten Grüßen Z. Sitchin 214 OCR, Korrektur und Neuformatierung für DIN A5-Ausdruck STEELRAT 2012 Originalscan: unbekannt (2011) Originalseiten: 143 Bild-Doppelseiten Bildseitenexport / Vorbereitung für OCR: Adobe Acrobat X Pro / Photoshop CS5 OCR und Grobkorrektur: Omnipage Professional 18 Grafiknachbearbeitung: Corel Graphics Suite X5 (Photo Paint) Bearbeitet: 125 Bilder + Front-/Backcover Feinkorrektur, Layout und pdf-Export: Adobe InDesign CS5 7.0 Lesezeichen und pdf-Optimierung: Adobe Acrobat X Pro ... and that's it!