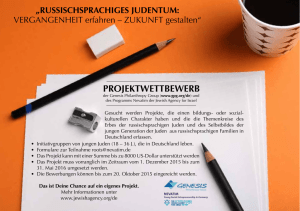Musik in Kirche und Synagoge Das biedermeierliche Wien
Werbung

Spes Christiana 21, 2010,91–124 Musik in Kirche und Synagoge Das biedermeierliche Wien Heinz Schaidinger Zusammenfassung Dieser Aufsatz untersucht, wie die Kultur des biedermeierlichen Wien die Entwicklung der jüdischen Synagoge vor Ort beeinflusst hat. Er stellt die Personen dar, die in jener Zeit die treibenden Kräfte einer Reform waren, durch die die Synagoge auf die Aufbruchsstimmung der damaligen Zeit und Gesellschaft reagierte. Für das Judentum des frühen 19. Jh. ging es um Anpassung und gesellschaftlichen Aufstieg, was sich auch im Gebrauch der Musik in der Synagoge widerspiegelte. Von besonderem Interesse ist dabei auch die Musik selbst, die in Kirche und Synagoge zu den jeweiligen Gottesdiensten verwendet wurde, sowie die Wurzeln dieser jüdischen Gottesdienstmusik. Die Traditionen sind alt, ihr Gebrauch wandelbar, und die Verwandtschaft der christlichen Sakralmusik mit der Musik der jüdischen Synagoge unverkennbar. In der deutschen Literaturwissenschaft wird die Zeit der Restauration nach den napoleonischen Kriegen von 1815 bis 1848 als „Biedermeier“ oder „Biedermeierzeit“ bezeichnet. Dieser Epochenbegriff grenzt sich gegen die vorausgehende Romantik und auch gegen den nachfolgenden Realismus ab. Die liberalen Strömungen dieser Zeit werden dann als Opposition innerhalb des Biedermeier verstanden. Zwar verwendet man in der Musikwissenschaft den Begriff heute auch für denselben Zeitraum, doch setzt er sich nicht wirklich durch, da sich für berühmte Komponisten jener Epoche (Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn) der Begriff der Romantik viel stärker eingebürgert hat. Zugleich ist der Begriff des Biedermeier in der Musik auch viel stärker negativ besetzt als in der Literatur: Symbol für kleinbürgerliche Enge, Bildungseifer, Sentimentalität und Trivialität. Oft haben mit „Biedermeier“ abqualifizierte Musiker nur gemeinsam, dass man sie nicht als Romantiker einordnen will (Conradin Kreutzer, Friedrich Schneider, Friedrich Silcher, Albert Lortzing, Otto Nicolai, Friedrich von Flotow, Stephan Heller, Robert Franz etc. werden als „Kleinmeister des Biedermeier“ bezeichnet). Eine etwas offenere Haltung versucht, gattungs- und stilgeschichtliche Merkmale zu erfassen: Typisch für den Biedermeier wären dann z.B. das Lied, das lyrische Klavierstück, Genreszene in Oper und Singspiel, liedhafte und pittoreske Thematik in der Symphonie. Das aber zerreißt wieder die einzelnen Komponisten: Schumanns Album für die Jugend wäre dann „biedermeierlich“, doch seine Davidsbündler Tänze und die Kreisleriana viel eher „romantisch“. Nach Carl Dahlhaus wäre ein Charakteristikum des musikalischen Biedermeier die im Gegensatz zum romantischen Absolutheits- und Autonomieanspruch stehende Anerkennung gesellschaftlicher Institutionen und Bedürfnisse durch den Komponisten. Es wird also für bestimmte Orte und Gelegenheiten komponiert: für die Singakademie, die Liedertafel, ein Musikfest oder eine Hausmusik.1 Dabei geht es um den Aspekt der gesellschaftlichen Bewährung der Musik, also um das Miteinander von Komponist, Komposition und Gesellschaft.2 Im Wien des Biedermeier lebten über 600 Künstler: Literaten, Maler, Musiker, auch viele Romantiker: die Brentanos, Körner, Eichendorff, ebenso Philosophen und Wissenschaftler wie die Humboldts, Jakob Grimm etc. Musik aber war der Daseinsgehalt des Wiener Biedermeier: 1810 gab es in Wien mehr als 60 Klavierfabriken! Die Musikalität war sehr hoch und weitverbreitet, praktisch jedermann konnte singen oder ein Instrument spielen. Die Freude, Feste zu feiern, lebte gleichzeitig mit der verhärmten Trauer über die damals herrschenden Zustände. Schubert, Raimund, Grillparzer: „Nur dass ihr Schmerz nicht laut wurde und ihr Ersterben leise war, dass alles, was sich sonst im deutschen Sehnsuchtsraum hart drängte und rebellisch aufbegehrte, hier schmerzhaft stille ging, sein Kämpfen in dem eigenen Herzen leidvoll niederzwang und auch seine Größe nur unter der Maske bürgerlichen Biedersinns verborgen tragen durfte“ (Witeschnik 1955, 221–229). 1. Die Kirchenmusik Das Prinzip der biedermeierlich pragmatischen Grundhaltung der Komponisten gegenüber den Bedürfnissen der Gesellschaft führt uns sofort in den Bereich der Kirchenmusik. Die Kirchenmusiker aber waren von jeher Praktiker, die sich in ihren Kompositionen nach dem vorhandenen Aufführungsmaterial richten mussten. In Bezug auf die Kirchenmusik führte die Kirchenreform Josephs II. dazu, dass in der Musik der Gläubige viel enger in den Gottesdienst einbezogen wurde, als dies früher der Fall gewesen war. Die politischen Ereignisse und die geistigen Strömungen am Ende des 18. Jh. wirken sich entscheidend auf die gesamte katholische Kirchenmusik aus, die ja durch die Säkularisation weithin 1 Allerdings wäre die Frage offen, ob man nicht auch Bach oder Händel eine ähnliche pragmatische Grundhaltung zur Komposition zusprechen müsste. Es kann also nicht als Verdienst des Biedermeierkomponisten angesehen werden, die pragmatische Kompositionshaltung erfunden zu haben, das Ganze taugt höchstens zur Abgrenzung gegen die Romantik. 2 Bis hierher nach dem zusammenfassenden Aufsatz von Lichtenhahn 1978. 92 ihrer materiellen Basis beraubt wird. Das höfische Musikleben wird durch das bürgerliche abgelöst. Symphonien, Opern, Kammermusik sind von allgemeinem Interesse; nur selten fühlt sich ein Komponist aufgefordert, sich auf die Komposition einer Messe zu verlegen. Doch der liturgische Bedarf besteht ja nach wie vor, er wird aber vor allem durch den Rückgriff auf die älteren Kompositionen gedeckt. 1.1 Zum biedermeierlichen Wien Alice Hanson weist darauf hin, dass im Biedermeier die überwiegende Mehrzahl der Wiener römisch-katholischen Glaubens war. Für die Musik bedeutete das vor allem die Pflege der katholischen Kirchenmusik. Die anderen christlichen Konfessionen waren sehr gering vertreten. Einen starken Einfluss auf die Förderung der Musik hatte noch die jüdische Synagoge (Hanson 1987, 152), worauf im zweiten Teil des Aufsatzes eingegangen wird. Obwohl der österreichische Kaiser Franz I. die Reformen Kaiser Josephs II. reduzierte, indem er die kirchlichen Feiertage und den Jesuitenorden wieder einführte und Pilgerfahrten und Prozessionen zu den Heiligenschreinen begründete, sorgte er doch dafür, dass die Kirche niemals die Macht der Krone beeinträchtigen konnte. Darum übte die Kirche zu Beginn des 19. Jh. vor allem ihren Einfluss auf dem Gebiet der Kunst, der Religion, der Sozialeinrichtungen und der Bildung aus (ibid., 154). Wien hatte viele Kleriker. Im Jahr 1837 waren es 170 Priester, 450 Mönche, 160 Nonnen; 1840 dann 30 Pfarrer, 160 Diözesan-Weltpriester, 231 Ordenspriester, 138 fremde Geistliche, 287 Nonnen. Trotzdem wird Wien von seinen Besuchern als wenig religiös eingeschätzt. Man sagt, dass die Wiener damals mehr aus Gewohnheit als aus seelischem Bedürfnis in die Kirche gingen und dass ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Religion ihren Widerpart in ihrer Gleichgültigkeit gegenüber der Politik fände. Eine Beurteilung aus dem Jahr 1831: [d]ie große Masse der Menschen gibt sich verhältnismäßig gleichgültig aller Religion gegenüber. Bei der Mehrzahl handelt es sich ohne Zweifel nominell um Katholiken; aber hinter dieser heiligen und strengen Bezeichnung lauert, wie man mir sagt, ein ungeheures Maß an Unglaube und Freidenkerei. Kurz gesagt, es scheint für die Wiener charakteristisch zu sein, daß sie, welchem Glaubensbekenntnis sie auch immer nominell angehören, niemals wirklich gewissenhaft in der Befolgung der entsprechenden Regeln sind. Sogar die Juden leben hier weniger streng in der Befolgung ihrer Vorschriften als in anderen Orten Deutschlands (ibid., 154f.). Die Säkularisierung der Wiener Gesellschaft war also kein Geheimnis. Manche Kirchen dienten offenbar auch noch ganz anderen Zielen als dem Gottesdienst der Gläubigen. Aus dem Jahr 1828: 93 Den größten Zuspruch findet der Geistliche, der in der kürzesten Frist seine Messe fertigmacht. In den Kirchenstühlen ist die schöne Welt versammelt, und im Mittelgang gehen kokettierend die Wiener Dandies ab und zu, und lassen ungeniert nicht allein ihre Blicke, sondern auch ihre Lippen sprechen (ibid., 155). Andere Zustände betrafen die „Hurenmesse“, die um 23.30 Uhr gelesen wurde, so benannt, weil die Prostituierten die Männer in den Kirchen ansprachen, um der in den Straßen patrouillierenden Polizei zu entgehen. Der Wahlspruch der Wiener war: „Bleib ein ehrlicher Kerl, folg’ dein Vatern und glaub’ was d’willst.“ Die Unzufriedenheit des Volkes entzündete sich an der Korruption innerhalb der Kirche und an der Scheinheiligkeit des Klerus, sie fand ihr Objekt vor allem im Widerspruch zwischen dem Armutsgelübde der Kirche und den tatsächlichen Einnahmen der Kirchenfürsten (fünf- bis sechsstellige Guldenbeträge im Jahr). Auch die Moral des Klerus stand sehr in Zweifel (viele illegitime Kinder der Geistlichen). 1.2 Zur damaligen Kirchenmusikpraxis Trotzdem hatten die Wiener nichts gegen die Feierlichkeit und die Pracht kirchlicher Zeremonien. Die großen Feiertage wurden mit Pomp begangen. Wiens liturgische Musik wurde mit Aufmerksamkeit gehört und genossen. Dies war so krass, dass man beobachtete, wie nach dem künstlerischen Teil des Hochamtes, durch Sänger und Orchester ausgeführt, die Menge sofort auf die Ausgänge zulief, um die Kirchen zu verlassen, den Pfarrer, Gottesdienst und alles Übrige ohne große Probleme zurücklassend (ibid., 156). In einem Dekret wurde 1825 festgehalten, dass die Musiker in den Kirchen mehr zur Zerstreuung und Unterhaltung als zur Förderung der Andacht dienten. Frauen durften sich nicht mehr an der Kirchenmusik beteiligen (außer Ehefrau, Tochter oder Schwester des Chorleiters), und man durfte keine Werke mehr aufführen, die mehr für ein Theater geeignet waren. Die liturgischen Hauptwerke stammten aus der Feder von Komponisten wie Schubert, Beethoven, Albrechtsberger, Weigl etc. In einer Quelle aus dem Jahr 1828, einer Kirchenmusikordnung für die Diözese Wien und Linz, wird die Kirchenmusik systematisch eingeteilt in Choral und Figuralmusik. Jeder Tonart wird ein bestimmter Affekt zugeschrieben: B-dur steht für Liebe, Hoffnung, gutes Gewissen, Es-dur für Andacht, Gebet, Trinität (3 b!), cis-moll für Bußklage, Gebet etc. Nach diesem Handbuch musste ein Kirchenmusiker die Musik so auswählen, dass sie dem Tag entsprach. Der Organist musste angemessene Zwischenspiele während der Messe vortragen und den Chor bei der Einhaltung der richtigen Tempi unterstützen. Die Stimmung der Instrumente habe vor dem Gottesdienst zu erfolgen und die Musiker haben sich aller Art von Improvisation zu enthalten. Vorgeschrieben war auch ein mäßiges, 94 schwebendes Zeitmaß, nicht zu schnell und nicht zu langsam. Die Tempi sollten eingehalten werden, ohne in der Gemeinde Verwirrung zu stiften. Verschiedene Arten von Musik waren vorgeschrieben für Begräbnisse, Messen und Prozessionen. Billige Begräbnisse hatten nur ein gesungenes Miserere während des Leichenzuges. Mittlere hatten ein kurzes Equal als Zeichen zum Beginn der Handlung (schon mit Blasinstrumenten), während des Leichenzugs das Miserere, zuletzt das gesungene Requiem aeternam. Bei den teuersten (immer mit Blasinstrumenten) gab es zusätzlich am Ende noch eine Trauermotette. Die Fronleichnamsprozession war die aufwendigste: mit Sängern, Trompeten- und Harmoniechor. Beim Mittragen des „Allerheiligsten“ aber durfte nur das Pange Lingua gesungen werden (so in der Kirchenmusik-Ordnung 1828, zit v. Hanson 1987, 158–162). 1.2.1 Einzelne Zentren der Kirchenmusik im biedermeierlichen Wien Wichtige Zentren der Kirchenmusik im biedermeierlichen Wien waren die folgenden (Hanson 1987, 162–166): Hofkapelle: In Bezug auf die Kirchenmusik sei hier der musikalische Apparat der berühmtesten Kirche Wiens vorgestellt, eine Momentaufnahme aus dem Jahre 1825: 2 Kapellmeister, 1 Hofkomponist, 10 Sänger (5 Tenöre, 5 Bässe) 2 Sängerinnen, 10 Sängerknaben, 1 Organist, 24 Instrumentalisten (12 Geigen, 2 Bratschen, 2 Celli, 2 Kontrabässe, 6 Oboen). Jeden Sonntag um 11 Uhr spielte man vor dem Hof und vor geladenen Gästen. Von 1824 bis 1846 waren Musiker wie Joseph Eybler, Antonio Salieri, Joseph Weigl, Anna Kraus (geb. Wranitzky), Therese Grünbaum, L. Tietze, Benedikt Randhartinger, I. Schuster, A. Fuchs, Jan Vaclav Vorisek, Leopold Jansa, Ignaz Schuppanzigh, Joseph Böhm, Joseph Mayseder und Ignaz Umlauf Mitglieder der Hofkapelle. Meist wurden Kompositionen der eigenen Kapellmeister oder von Joseph und Michael Haydn, Mozart, Beethoven, Preindl, Salieri, Seyfried und Eybler aufgeführt. Diese Musiker sorgten für vielfach gelobte Aufführungen geistlicher Musik, für den „vornehmsten und vollendetsten Gottesdienst in Wien.“ St. Stephan: Das Ensemble war aus den Mitgliedern der zwei Hoftheater zusammengesetzt. Sonntags um 11 Uhr versammelte man sich zum feierlichen Hochamt. Immer wieder jedoch wird das Niveau von Orchester und Sängern beklagt. Gottesdienstbesucher fühlen sich durch das bereits erwähnte rastlose Auf- und Abgehen der vielen Menschen, das mehr an einen Jahrmarkt als an einen Gottesdienst erinnerte, gestört. Zur gleichen Zeit wurden im ganzen Dom gleichzeitig mehrere Messen gelesen, sodass man die Andächtigen, anstatt sie in einer ruhigen Gemütsverfassung zu halten, vielmehr zerstreute. Augustinerkirche: Diese Kirche war berühmt für ihre Aufführungen neuer Musik. Die Größe des Ensembles war mit 2 Tenören, 3 Bässen, einigen Sängerknaben 95 aus St. Dorothea, 5 Violinen, 1 Cello und 2 Posaunen nicht gerade weltbewegend, doch die Qualität der dargebotenen Musik machte die Größe des Ensembles wieder wett. In der Augustinerkirche wurden auch Messen anlässlich wichtiger Staatsfeiern abgehalten, sogenannte „Militärmessen“. Zu den Kirchen, in denen Ensembles zur Darbietung von Kirchenmusik beschäftigt waren, zählten außerdem St. Anna, die Michaelerkirche, die Peterskirche und die Karlskirche. Auch die Kirchen in den Vorstädten unterhielten kleine Chöre und Orchester in Minimalbesetzungen, für die z.B. Schubert schrieb. Er schrieb seine F-dur-Messe D 105 und seine B-dur-Messe D 324 für die Lichtenthaler Kirche, sechs Antiphone zum Palmsonntag D 696 für die Altlerchenfelderkirche, die Es-dur-Messe D 950 für die Dreifaltigkeitskirche im Alsergrund. 1.2.2 Zur Förderung der Kirchenmusik Die Kirche förderte auch den Musikunterricht. Es gab private Musikvereine und Musikschulen, von den Kirchen unterhalten, die die eigene liturgische Musik fördern sollten. Fürst Ferdinand Lobkowitz gründete z.B. 1827 den „Privatverein zur Verbesserung der Kirchenmusik auf dem Lande“. Der Verein unterstützte eine unentgeltliche Musikschule für die Kirche St. Anna. Es wurden in 18 Wochenstunden Kirchenmusik, Chormusik, Choral- und Psalmengesang, Latein, Musiktheorie, bezifferter Bass, Violine und Orgel unterrichtet. 1840 waren dort 78 Schüler eingeschrieben. Eine ähnliche Schule wurde 1823 durch den Pater Honorius Kraus mithilfe des Kirchenmusik-Vereins von Schottenfeld errichtet. Auch die Stadtverwaltung förderte die Musik, indem sie bestimmte Werke und Messen subventionierte. Zu St. Salvator wurden zusätzliche Blechbläser für die Frühmesse aus der Stadtkasse bezahlt. Dies kam auch an anderen Festtagen vor. Der Kapellmeister von St. Stephan wurde ebenfalls von der Stadtverwaltung bezahlt, ebenso besondere Feiern in einzelnen Kirchen. Die Ausbildung der jungen Musiker durch die von der Kirche geförderten Stätten kam z.B. den Brüdern Haydn, aber auch Schubert und Hellmesberger zugute, die alle als Sängerknaben der Hofkapelle begannen. Gleichzeitig war die Kirche Aufführungsort für neue Kompositionen. Schubert schrieb seine Messen für bestimmte Kirchen, auch weil auf diese Weise die Chance der Aufführung sehr groß war. Zudem war die Möglichkeit des zusätzlichen Verdienstes für Komponisten und Sänger in der Kirchenmusik sehr attraktiv. Dies änderte sich erst in der Mitte des 19. Jh., als durch das neu erwachte Interesse an der Polyphonie des 16. Jh. die Kirchenmusik für die zeitgenössischen Komponisten ihre Anziehungskraft verlor (Hanson 1987, 166–168). 96 1.2.3 Allgemeines zur Kirchenmusik des frühen 19. Jh. Die großen Einflüsse kamen in der ersten Hälfte des 19. Jh. grundsätzlich aus der französischen Oper, aus dem Händeloratorium und aus der motivisch-thematischen Arbeit und der Durchführungstechnik der Symphonie (Cherubini, Weber, Schubert, Beethoven; vgl. Honegger und Massenkeil 1978, 295). Ursprünglich sollte nach der Säkularisation die Musik nicht mehr mit großem Aufwand betrieben werden (große Werke im Sinne einer Missa Solemnis des 18. Jh., im Gegensatz zur Missa Brevis), sondern die Aufmerksamkeit der Gläubigen unterstützen, weniger Machtmusik als vielmehr einfühlsame Volksmusik sein. Sehr erfolgreich setzte das z.B. Franz Schubert um, vor allem mit seinem sicher volkstümlichsten Werk, der „Deutschen Messe“. Schubert war jedoch bei Weitem nicht der Erste, der geistliche liturgische Texte in der Volkssprache vertonte. Dies hatte seine uralte Tradition in den vernakularen Bewegungen des Mittelalters (Waldenser, Hussiten etc.) und brach sich endgültig Bahn in der Reformation. Die Choräle eines Luther und seiner Nachfolger, später dann eines Bach etc. sollten sich als sehr volksnah erweisen. In England wurde mit der Abwendung vom Papsttum durch Heinrich VIII. ebenso die Volkssprache zur Kultussprache erhoben: Tudormusic (Byrd, Tomkins, Tallis in seinen English Anthems), später die Anthems eines Purcell oder Händel, wie z.B. auch Händels fünfmalige Vertonung der englischen Textfassung des altkirchlichen Te Deum: „We praise Thee, o God!“ Dies bedeutete jedoch keineswegs, dass nun nur noch in der Volkssprache Kirchenmusik gemacht worden wäre. Das Lateinische wurde bis weit ins 19. Jh. auch in der protestantischen Welt weiterhin verwendet, zudem wurden auch lateinische Texte vertont (noch bei Schütz, Bach, Händel, natürlich auch bei Mozart, Beethoven, Schubert, den beiden Haydn etc.). Während im Zeitalter der Renaissance und des Barock die Musik noch soli Deo gloria eingesetzt wurde, um geistliche Texte nicht nur musikalisch folgerichtig, sondern auch textgemäß zu vertonen, wurde zu Beginn des 19. Jh. die Musik – ganz dem individuellen Zeitgeist der Französischen Revolution gemäß – gewiss individualistischer (Romantik), aber auch volksnäher (Biedermeier). Beide Dinge stehen zwar in scheinbarem Widerspruch zueinander, sind aber auf dem Boden der josephinischen Reform und der restriktiven Politik eines Metternich sehr gut zu verstehen. Kontrastbeispiele: Für die nach alter Tradition komponierte Machtmusik: G. F. Händel: J. S. Bach: We praise Thee, o God! Dettinger Te Deum. Kyrie. Hohe Messe in h. 97 Für die neuere, individualistisch geprägte Kompositionsweise: H. Berlioz: Kyrie. Messe solennelle. Interessante Werksgeschichte, doch vor allem sehr packend die absolut individualistische, aber doch auch bewusst dem Textinhalt verpflichtete musikalische Deutung des religiösen Textes. L. v. Beethoven: Kyrie. Messe in C. Diese Messe fiel bei der Uraufführung durch, vor allem wegen ihres leisen Anfangs (vergleiche die Tradition!) im Kyrie (vgl. Ottenberg 1992, 7f.). Kyrie. Missa solemnis.3 Ursprünglich für den liturgischen Rahmen gedacht,4 sprengte sie diesen jedoch bei Weitem, offenbart aber den noch deutlich sakralen Stil, ganz im Unterschied zur gleichzeitig entstandenen 9. Symphonie. F. Schubert: Wohin soll ich mich wenden. Deutsche Messe.5 Katholische deutsche Liedmesse, für den Volksgesang bestimmt. Der Text besteht aus Paraphrasen und Anspielungen auf die gottesdienstlichen Handlungen. Er wurde zusammengestellt von Johann Philipp Neumann. Dieser fügte der „Deutschen Messe“ noch einen „Anhang“ dazu, das „Gebet des Herrn“ (Paraphrase des Vaterunsers). Man mag sich wundern, warum hier nicht Mozart „zu Klang kommt“. Das hat sowohl Platzgründe als auch sachbezogene: Wiewohl Mozart im Biedermeier sehr beliebt ist,6 passen seine heute sehr bekannten kirchenmusikalischen Werke eigentlich nicht sehr gut in die hier angestellten stilistischen Überlegungen, weil 3 Beethovens wichtige geistliche Werke: Christus am Ölberge, op. 85; Messe C-dur, op. 86; Missa solemnis D-dur, op. 123. 4 Sie war geplant für die Inthronisationsfeier des Erzherzogs Rudolph zum Erzbischof von Olmütz am 9. März 1820, doch wurde erst 1823 beendet. Uraufführung in St. Petersburg am 7. April 1824. Erst am 7. Mai 1824 wurden in Wien zusammen mit der 9. Symphonie einige Sätze aus der Missa solemnis aufgeführt. 5 Schuberts wichtigste geistliche Werke: 6 lateinische Messen: F-dur, D 105 (1814); G-dur, D 167 (1815); B-dur, D 324 (1815); C-dur, D 452 (1816); As-dur, D 678 (1822); Es-dur, D 950 (1828); Deutsche Messe, F-dur, D 872 (1827); Stabat Mater (Jesus Christus schwebt am Kreuze), D 383 (1816); ferner ein Salve Regina, Tantum ergo und Offertorien. Ebenso Hymnus an den Heiligen Geist, D 948 (1828); Gott im Ungewitter, Gott der Weltschöpfer und Hymne an den Unendlichen, D 985, 986 und 232 (1815); Miriams Siegesgesang, D 942 (1828). 6 „O Mozart, unsterblicher Mozart, wie viele, o wie unendlich viele solche wohltätige Abdrücke eines lichten besseren Lebens hast du in unsere Seele geprägt.“ F. Schubert in seinem Tagebuch am 13. Juni 1816, zit. v. Kobald 1929, 210. 98 sie zumeist Gelegenheits- und Auftragswerke sind, mit denen er sich oft selbst nicht identifizierte, die also oft ohne innere religiöse Beteiligung verfasst wurden (Ausnahmen: Große Messe in c-moll, Requiem etc.). Mozarts Messen sind damit leider oft nicht musikalische Deutungen des liturgischen Textes, auch fehlt ihnen allzu oft wirklich sakraler Charakter. Was sie trotzdem auszeichnet und wertvoll macht, ist ihr hoher musikalischer Gehalt. Der bleibt unbestritten, wenn sie sich auch wenig dazu eignen, die religiöse Erfahrung des Hörers zu beeinflussen und zu vertiefen. Damit sind sie ganz anderen Charakters als z.B. die Messen Schuberts oder Beethovens. Das biedermeierliche Lebensgefühl zwischen josephinischer Reform und metternichscher Reaktion wird von ihnen weder dargestellt noch berührt. Sie wurden in der Biedermeierzeit gespielt im Sinne des Rückgriffs auf Altbekanntes. Sehr wichtig sind in der Biedermeierzeit auch die Werke der beiden Brüder Haydn, vor allem die Michael Haydns, der den Zeitgenossen als Kirchenkomponist viel bekannter war als der heute berühmtere Joseph Haydn. Michael Haydn war Ende des 18. Jh. am Hofe des Erzbischofs Colloredo von Salzburg (vor dem Mozart geflohen war) als Reformer der Kirchenmusik bekannt. Er schuf liturgische Werke für Knabenchor mit kleiner instrumentaler Besetzung. Die Verehrung des „ruhigen, klaren Geistes des guten Haydn“ (so F. Schubert über M. Haydn) sowie seine Wertschätzung in Salzburg als „vielleicht größter Tonsetzer der katholischen Kirchenmusik“ hielten sich durch das 19. Jh. Da seine Kirchenmusik sich so gut für die liturgische Musikpraxis eignete, griff man noch lange auf diese Werke zurück. Sein Bruder Joseph Haydn ist vor allem bekannt durch die beiden großen Oratorien Die Schöpfung und Die Jahreszeiten, auch durch einige Messen (Nelsonmesse, Paukenmesse, Harmoniemesse). Während die Messen liturgisch brauchbar sind, waren die Oratorien in händelscher Tradition für konzertante Aufführungen im Konzertsaal bestimmt. Doch zurück zum Problem der sowohl individuellen als auch volksnahen geistlichen Musik der Biedermeierzeit. Die musikalisch bewusste Deutung des Textes einerseits, sowie die immer volksnähere Entwicklung der Vertonung des liturgischen Textes andererseits erreicht mit Schuberts Deutscher Messe sicher einen positiven Höhepunkt.7 Doch auch Schubert bleibt nicht nur bei der deutschen Sprache: An einem Sonntag im Oktober 1814 zum 100-jährigen Bestand der Lichtentaler Kirche dirigiert der 17-jährige Schubert seine F-dur-Messe (D 105), die ihn mit einem Schlag berühmt macht. Kyrie Credo 7 Man spürt schon das Liedhafte, ebenso leiser Anfang wie in der C-dur-Messe Beethovens aus 1808. Völlig untypisch im Vergleich mit den früheren Werken dieser Gattung. Spätere Höhepunkte sakraler Musik finden sich erst wieder bei Liszt, Brahms und Bruckner. 99 Agnus Dei Er singt sich dem Volk ins Herz, etwas, das Beethoven in dieser Form nicht konnte, da er anderen Vorbildern folgte. Dies ist ein Werk, das liturgische Verwendung finden sollte, anders als seine spätere Es-dur-Messe. Interessant in den Messevertonungen Schuberts sind auch seine bewussten Auslassungen, vor allem des: Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, das bereits in diesem Jugendwerk fehlt und auch in keiner anderen seiner lateinischen Messen vertont wurde. Seine Messe in B-dur, D 324, ist ebenfalls ein Jugendwerk (1815) und eher nach der überkommenen Tradition komponiert: Kyrie Credo Wie schon erwähnt, fehlt natürlich auch hier die Zeile: Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Vielleicht hat das mit seinen frühen Erfahrungen im sogenannten Stadtkonvikt zu tun, in dem er seit 1808 als kaiserlicher Sängerknabe mit dem Privileg einer kostenlosen Gymnasialausbildung erzogen wurde, dem er sich aber Ende 1813 fluchtartig entzog (Honegger und Massenkeil 1978, 285). Messe in Ein Werk aus der mittleren Schaffensperiode (1822). As-dur, D 678: Bislang Schuberts dramatischste Ausdeutung des Textes im Credo Credo. Auch hier fehlt: Credo in unam sanctam ... Messe in Es-dur, D 950 (1828): Kyrie Gloria Kurz vor seinem Tod fertiggestellt. Dies ist die Messe, die seinem ersten Jugendwerk aus dem Jahre 1814 im Ausdruck am nächsten kommt, wiewohl sie musikalisch viel ausgereifter ist. Diese letzte Messe Schuberts ist auch seine einzige, die den liturgischen Rahmen sprengt. Harmonische Engführungen, in denen er seiner Zeit weit voraus ist. Dass in diesem Werk im Credo die berühmte, oben erwähnte Zeile ebenfalls fehlt, braucht eigentlich nicht mehr betont zu werden. Der neue Aspekt der geistlichen Musik des frühen 19. Jh. ist die individuelle Seite dieser Musik. Obwohl antijosephinische Strömungen sich für das traditionelle Hochamt einsetzten, die alten Zustände (l’ancien régime in der Kirche sozusagen) auch in der Musik wiederherstellen wollten, war die persönliche romantische Note nicht mehr wegzudenken. Den traditionellen Vorstellungen ist wohl Beethoven am nächsten gekommen, der aber selber völlig von freiheitlichen und republikanischen Ideen durchdrungen war und für seine Schöpfungen sicher nur rein musikalisch-textliche und keineswegs ideologische Hintergründe im Sinne der Antijosephiner bemühte. 100 2. Der Synagogalgesang 2.1 Grundlegendes zur Geschichte der jüdischen Musik Grundsätzlich geht die Tradition der jüdischen Musik zurück in die alttestamentliche Zeit.8 Einerseits sind die Juden als Volk durch die Geschichte gegangen, das seine Traditionen zu bewahren wusste, sodass man, wo immer man auf Juden trifft, in ihrer Musiktradition eine ihnen gemeinsame Art erkennen kann. Gleichzeitig aber stellt man fest, wie assimilationsfähig diese jüdische Musiktradition ist, da man immer auch bemerken kann, wie die jeweils lokalen musikalischen Expressionen an den jüdischen Musiktraditionen ebenso sichtbar geblieben sind. Ein sephardischer Jude hat z.B. Elemente in seiner Musik, die eben aus dem Spanien des 15. Jh. stammen, die dann auch die Musik Nordafrikas beeinflusst haben, wohin die Sepharden vertrieben worden sind (Malm 1977, 59). Die jüdische Tradition ist viel mehr eine bewahrende als eine proselytierende. Die Juden, obwohl assimilationsbereit, blieben doch eine eigene Gruppe, ganz gleich, in welcher Gesellschaft sie lebten. Trotzdem sind die kulturellen Berührungspunkte vor allem in der weltlichen jüdischen Musik sichtbar, während sie sich in ihrer religiösen Musik an die älteren Formen hielten. Die ältesten Formen meint man heute bei den jemenitischen Juden zu finden. Die Juden, die in den deutschen und slawischen Ländern lebten (auch in den Balkanländern), schufen in ihrer religiösen Musik die Aschkenasi-Tradition, jene Mischung aus europäischem, russischem und jiddischem Musikstil, die auf Jahrhunderte den religiösen Musikstil der europäischen Juden bestimmen sollte. 2.1.1 Historische Wurzeln Zuerst gab es bis zur Zerstörung des Herodianischen Tempels 70 n. Chr. einen ziemlich einheitlichen liturgischen Stil. Reste davon sind heute noch überall zu sehen, denn alle jüdischen Kantoren haben, trotz aller kulturellen Anpassung an ihre jeweilige Umgebung, eben jenes typische melismatische, frei-rhythmische Gesangsverhalten (ibid., 84). Idelsohn weist auf die im Altertum diskutierten Unterschiede in den verschiedenen Musikstilen hin: Musik, die den Geist reinigt versus Musik, die aufreizt und unruhig macht. Das hat mit den verwendeten Instrumenten zu tun, deren Wirkungen sowohl im Judentum als auch bei den alten 8 So dargestellt im grundlegenden Werk zur jüdischen Musik von Idelsohn 1975. Das Buch stammt ursprünglich aus dem Jahr 1929 und wird bei Malm 1977, 86, als „standard general reference“ bezeichnet. Vergleiche auch Gradenwitz 1961, 11–53. Sowohl Idelsohn als auch Gradenwitz weisen auf eventuelle Verbindungen zwischen ägyptischer Tempelmusik und hebräischer sakraler Musik hin. 101 Ägyptern und Griechen bekannt sind. So wird z.B. lange Zeit der Aulos von den ägyptischen und griechischen Priestern nicht geduldet ob seiner aufreizenden Tonfolge d, cis, b, a (ibid.). 2.1.2 „Beten“ heißt „Singen“ Idelsohn diskutiert auch die ältesten musikalischen Quellen der jüdischen Musik: die musikalische Notation der hebräischen Bibel und die Gebete. Er weist auf einen interessanten Sachverhalt hin: Die öffentliche Lesung der Bibel wurde im Altertum und wird heute noch in orthodoxen Synagogen nicht in der Weise durchgeführt, wie sie heute in Reformsynagogen (seit 1815) üblich ist. In der letzteren wird sie einfach gesprochen oder deklamiert – ohne musikalische Tönung, während die traditionelle Leseweise die Kantillation ist, ein Psalmodieren des Textes, eine Rezitation, in der Musik eine große Rolle spielt. Diese Art des Bibellesens wird im Altertum bis zum 1. Jh. erwähnt. … Der Talmud sagt, dass die Bibel öffentlich gelesen und den Zuhörern in einer musikalischen, angenehmen Melodie verständlich gemacht werden sollte. Und solche, die den Pentateuch ohne Melodie lesen, zeigen ihre Missachtung ihm gegenüber und gegenüber dem grundlegenden Wert seiner Gesetze. Ein tiefes Verständnis kann nur dadurch erzielt werden, dass die Tora gesungen wird (natürlich in traditionellen Melodien), und „wer die Heiligen Schriften in der Weise weltlicher Lieder singt, schmäht die Tora“ (Idelsohn 1975, 35f. [mit Verweis auf den Talmud B., Megilla 32a und Sanhedrin 101a]). Tatsächlich haben nur jene alttestamentlichen Bücher Musikakzente, die auch öffentlich vorgelesen werden, nämlich: der Pentateuch, die Propheten, Esther, die Klagelieder, Ruth, Prediger (Ekklesiastes), das Hohelied, die Psalmen und in manchen Ausgaben auch das Buch Hiob. Die Sprüche aber, Esra, Nehemia und die Chronikbücher haben keine durch die Akzente notierten Melodien, weil sie nicht im öffentlichen Gottesdienst laut vorgetragen wurden.9 Musikbeispiel: Der hebräische Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte“ – Mitsmor le David, Adonai Roï...), vorgetragen nach der Melodie der Akzente der hebräischen Bibel.10 9 Vergleiche die Synopse der Ausführung der verschiedenen hebräischen Akzente in den verschiedenen jüdischen Traditionen in der Diaspora in Idelsohn 1975, 37.44 ff. Besondere Aufmerksamkeit sollte hier der Aschkenasi-Modus (Nr. 11) erhalten; interessant ist auch das erste Beispiel von Reuchlin, in dem klar wird, dass die Notenschrift gemäß der hebräischen Sprache von rechts nach links zu lesen ist. Vergleiche die moderne Umschrift in der Synopsentabelle (Nr. 12). 10 Wie zu hören auf der CD La Musique de la Bible revélée (Haïk-Vantoura 2000). Frau HaïkVantoura vertritt die Ansicht, dass die hebräischen Melodien über den Weg der Entwicklung der christlichen religiösen Musik der Musik des Abendlandes zugrunde liegen. Aus dem Text des Begleithefts der CD, S. 8: „Diese Art Akzentuierung des Textes beweist die Verbindung zur europäischen Musik, die noch bis zu den ‚Madrigalismen‘ der Komponisten des 16. Jahrhunderts zu 102 Natürlich entfernten sich die späteren Entwicklungen des synagogalen Gesanges von dieser biblischen Vorlage, eben dem kulturellen Umfeld entsprechend, in dem er gepflegt wurde. Der Ursprung der biblischen Melodien ist eindeutig orientalisch. Sie sind modal in Form und Charakter, unrhythmisch,11 was für den Orient typisch ist. Es würde zu weit führen, die einzelnen Charakteristika genau aufzuzeigen; dafür sei auf Idelsohns Werk verwiesen (1975, Kapitel 2 und 3). 2.1.3 Musik ist nicht gleich Musik Man darf auch nicht übersehen, dass historisch gesehen der synagogale Gesang – übrigens genauso wie der christliche Gemeindegesang – ein Gegengewicht gegen die laszive griechische Musik der Mysterienkulte der frühen Jahrhunderte der christlichen Ära sein sollte. Man kämpfte in der Kirche wie auch in der Synagoge um die Einfachheit von Text und Musik, mit so wenig Instrumentaleinsatz wie möglich: Nur ein Instrument sollte verwendet werden, nämlich die menschliche Stimme. In der syrischen, jakobitischen, nestorianischen und griechischen Kirche blieb das so bis ins 20. Jh., in den Synagogen bis zur Reform: 1810 wurde in der deutschen Reformsynagoge von Seesen zum ersten Mal eine Orgel verwendet. Für die Juden bedeutete das noch etwas Besonderes: Sie verwendeten keine Instrumente, weil sie um die Zerstörung des Tempels trauerten und erst wieder Instrumente im Gottesdienst verwenden wollten, wenn der Tempel in Jerusalem wiederaufgebaut sein würde. Ihre Hinwendung im Reformgottesdienst zur Orgelmusik war somit ein Problem der nationalen Identität: Hatten sie die Hoffnung auf einen neuen Tempel aufgegeben? Wenn man bedenkt, dass sogar bei jüdischen Hochzeiten, zu denen die Verwendung von Instrumenten erlaubt war (Freudenfest!), man einen Teller vor Braut und Bräutigam zerschlug,12 um sie an die Zerstörung des Tempels zu erinnern, kann man ermessen, wie sehr Reform des Gottesdienstes auch in musikalischer Hinsicht den orthodoxen Juden Europas eine Häresie sein musste – war doch der Gottesdienst ohne Instrumentalmusik spüren ist. Aber zwischen den Musikern der Bibel und den Madrigalisten gibt es viele Zwischenphasen, namentlich der Gregorianische Gesang, dessen nahöstliche Quellen heute wiederentdeckt werden.“ Als Beleg für diese Behauptung diene der Vergleich zwischen dem babylonischen, aschkenasischen und portugiesischen Pentateuch-Modus und einem gregorianischen Choral auf dem „3. Ton“ bei Idelsohn 1975, 40 ff. Die Ähnlichkeit und damit die tonale Verwandtschaft ist nicht zu übersehen. 11 Erst im 5. Jh. wurde sowohl die kirchliche als auch die synagogale Musik leicht rhythmisiert, war aber von einem strengen Metrum immer noch weit entfernt (Idelsohn 1975, 99 f.). 12 Vergleiche zu dieser Aussage ein kleines Detail aus einer ostjüdischen Geschichte, in der es um einen Heiratsvertrag geht, der abgeschlossen wird. Der Bräutigam wider Willen erzählt: „Die Hochzeit sollte gegen drei Jahre vom heutigen Datum an begangen werden, und alles wurde verbrieft und versiegelt. Die Frauen zerbrachen eilend irgendein tönernes Gefäß, und wie mit Donnerstimme kam es aus ihrem Mund: ‚Zur guten Stunde!‘ “ (Lilienblum 1988, 312). 103 mehr als eineinhalb Jahrtausende das Zeichen der nationalen Trauer über den Verlust des Tempels in Jerusalem gewesen (vgl. ibid., 92–97). 2.1.4 Der chasan Bis ins 5. Jh. n. Chr. kannte die jüdische Synagoge den Vorbeter, der die Gebete des Volkes formulierte, weil er mit der Gabe des Gebets ausgestattet war. Er war immer ein Mann des Volkes, nie der amtierende Priester. Diese Gebete waren improvisiert und bereicherten so den Gottesdienst. Die schönsten Gebete wurden in der Tradition bewahrt. So wuchs ein Gebetsschatz, der immer mehr zur liturgischen Verantwortung wurde. Man brauchte Leute, die fähig waren, diese gewachsene Gebetstradition zu verwalten und liturgisch richtig einzusetzen. Diese Vorbeter mussten in der Meinung des Rabbi Judah ben Illai (Palästina, 2. Jh. n. Chr.) folgende Qualifikationen besitzen: Ein Mann, der Familienpflichten hat, der nicht genug besitzt, ihnen zu entsprechen, der sich für seinen Lebensunterhalt mühen muss, aber sein Haus dennoch rein (ohne Tadel) hält, der ein attraktives Aussehen hat, demütig ist, von den Leuten als angenehm empfunden und gemocht wird, der eine liebliche Stimme und musikalische Gabe besitzt, der sich in den Schriften gut auskennt, fähig ist zu predigen, vertraut ist mit der Halacha (dem Gesetz) und den jüdischen Erzählungen (Aggada), und der alle Gebete und Segenssprüche auswendig kann (zit. b. Idelsohn 1975, 105). Am wesentlichsten war natürlich die gute Stimme, die als göttliche Gabe empfunden wurde, durch die das Volk zur Andacht bewegt werden sollte. Darum war man mit einem Sprachfehler vom Amt des Vorbeters ausgeschlossen. Das ging gut bis ins 5. und 6. Jh. Danach wurde es für die Juden schwierig, da der Antisemitismus ihre Gemeinden verfolgte und zerschlug.13 Die Kenntnis der Tora nahm ab im Volk, gute (improvisierende) Vorbeter waren immer schwerer zu finden. Das führte dazu, dass man dem chasan (dem Aufseher) die Rolle des Vorbeters übertrug: Er sollte nun singen, war er doch gelehrt etc. Diese Entwicklung dauert bis zum Ende des ersten Millenniums. Die chasanim waren tugendhafte Leute und errangen immer mehr Ruhm. So wurden in der Synagoge das Amt des Kantors und das Amt des Lektors in einer Person vereinigt: Es war eine Folge von Notwendigkeiten, die sich aus der historischen Situation (Verfolgung, Zerstörung der jüdischen Gemeinden und Gelehrsamkeit, daraus resultierender Mangel an guten Leuten) ergab. Jede Gemeinde war glücklich, wenn ein einziger Mann alle gottesdienstlichen Funktionen übernehmen konnte. Ein solcher chasan 13 Es geht um die christliche Unterdrückung der Juden in Palästina und um die Unterdrückung der Juden in Babylon durch die fanatische Kaste der Magi. Viele Gemeindezentren wurden zerstört, und zeitweise mussten sie alle ihre Lehrhäuser schließen. 104 war auch Salomon Sulzer in der Wiener Synagoge der Biedermeierzeit, von dem später noch die Rede sein wird. Trotzdem gibt es auch die talentierten Laienvorbeter bis heute in der Synagoge.14 2.1.5 Jüdische Musik an der Wurzel der christlichen Musik Das Christentum hat vieles aus dem Judentum übernommen (war das Christentum doch eigentlich nichts anderes als eine besondere messianische Ausprägung des Judentums), auch das Amt des Kantors. In der Kirche wurde auch das Solorezitativ des Kantors zum wichtigsten Teil des Gottesdienstes. Auch die jüdische responsive Form übernahm die Kirche, die Amens, Hallelujas, Hosannas, die von der Gemeinde als Respons gesungen wurden. Den Vorsänger nannte man in der Kirche cantor, præcentor, pronunciator psalmi. Auch in der Kirche war ursprünglich das Amt des Lektors von dem des Kantors getrennt. Die Kantorfunktion wurde aber später in der Kirche mehr und mehr vom Chor übernommen, Choral und Antiphon ersetzen Solorezitativ und Respons der Gemeinde.15 Weisen, Gesangsvortrag und Aufführungspraxis der Jerusalemer Tempelliturgie und ihre Erbschaft in der Synagoge wurden für die frühe abendländische Musik zu entscheidenden Grundlagen. Die ersten christlichen Vorsänger kamen ursprünglich aus den jüdischen Gotteshäusern und deuteten alte hebräische Gebräuche nur zu neuen Zielen um, wenn sie zu Christen wurden und ihre alten Berufe in neuem Rahmen weiter ausübten. Stilkritische Vergleiche orientalisch-hebräischer Weisen und unsere recht genaue Kenntnis der Liturgie selbst haben die auf rein persönliche Grundlagen zurückführenden Wurzeln der frühen christlichen Psalmodie längst aufgedeckt; in neuerer Zeit sind dazu noch dokumentarische Belege aufgefunden worden. Die Apostolische Constitution und die Zeugnisse des Cyril von Jerusalem und der Pilgerin Ätheria Sylvia deuten darauf hin, dass die Funktion der Vorsänger in der frühen christlichen Liturgie genau der entsprach, die ihnen die rabbinischen Quellen zuweisen ... Die christliche Kirche hat durch ihre eigenen frühen Vorsänger viele altbiblische Texte, die modalen Weisen, das responsoriale und antiphone Singen und manche anderen orientalischen Züge in ihre Liturgie übernommen. Die Akzente und Hand-Zeichen wurden gleichfalls angenommen, und aus den Zeichen ... entwickelte sich zu Beginn des 2. Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung die erste musikalische Notation, die genau die Tonhöhen und Zeitdauer bestimmte, welche der Konzeption einer Melodie zugrunde lagen. Noch in der frühen abendländischen Musik bedeuteten die Akzentzeichen nicht einzelne 14 Vergleiche die Darstellung dieser Entwicklung bei Gradenwitz 1967, 62 f.; ebenso bei Idelsohn 1975, Kap. 6. 15 Zur Entwicklung des chasans siehe ebenfalls Idelsohn 1975, Kap. 6. 105 „Noten“ im modernen Sinne, sondern – wie bei ihren noch älteren Vorbildern – eine Reihe aufeinander bezogener Töne einer Melodiefloskel, deren rhythmische Gestaltung von dem Wortrhythmus des Textes abhing; der vage Charakter der frühen Zeichen war der Grund, dass die verschiedenen christlichen Gemeinden an verschiedenen Orten die Melodien auch verschieden vortrugen, genau wie die alten Bibelakzente in den verschiedenen Zentren der jüdischen Diaspora verschieden interpretiert worden sind ... Von der hebräischen Liturgie hat die christliche Musikpraxis auch die charakteristischen Kadenzen übernommen, die die einzelnen Teile der Rezitation voneinander scheiden. Auch das äußere Bild der Musikübung blieb in der Kirche so, wie es aus der Liturgie Israels bekannt war – vor allem das Aufstellen der Sänger auf den Stufen, die zum Altar führen.16 Tatsächlich hat das Judentum die Entwicklung der christlichen Musik massiv beeinflusst. Die Franken, Gallier und Germanen standen im Ruf, schlechte Sänger zu sein,17 während die Juden gleichzeitig eine hohe Kultur hatten. Karl der Große war der erste germanische Fürst, der versuchte, seinen Leuten das Singen beibringen zu lassen; dazu holte er Musiklehrer aus Rom. Die Menschen sollten beim Gottesdienst im Gesang antworten können, doch viele Kirchenlieder wurden vom Volk korrumpiert. Die Juden aber hatten eine hohe Kultur, die sie das Volk lehrten. Und so kam es, dass die Christen bei den Juden nicht nur ihre Religion und Kultur, sondern auch ihr Singen lernten, sehr zum Leidwesen der christlichen Bischöfe,18 die aus Eifersucht begannen, die Kontakte zwischen Juden und Christen zu verbieten, bis im Hochmittelalter die Juden völlig isoliert waren. Der daraus resultierende Antisemitismus führte zur Entwurzelung vieler chasans, die nun nicht mehr fest stationiert waren, sondern wie die Minnesänger hin- und herzogen. Die Minnesangentwicklung im 10. bis 12. Jh. ist ohne den Einfluss der jüdischen Musik auf das damalige Abendland nicht denkbar. Doch durch den kirchlichen Antisemitismus kamen immer mehr Probleme auf. Die chasanim, bedingt durch ihr andauerndes Flüchtlingsleben, verwilderten ein bisschen. Sie gaben sich sehr extravagant und exaltiert, was manche veranlasste, Regeln herauszugeben, wie ein Gottesdienst abzulaufen habe, und dass der chasan niemals die Würde seines Amtes vergessen sollte. 16 So argumentiert Gradenwitz 1967, 59 f. So das historische Zeugnis von Arminianus Marcellinus (etwa um 330) oder der Kaiser Iulian („Apostata“), die beide besagen, dass germanisches Singen wie quietschende Räder klinge (zit. v. Idelsohn 1975, 131). Ihre Stimmen seien zu heiser vom vielen Trinken, sie klängen wie ein vollbeladener Wagen, der laut einen Hügel hinunterrollt. 18 Bischof Agobard von Lyon beschwert sich in Briefen an Ludwig den Frommen um 825, dass die Christen zu den jüdischen Gottesdiensten gingen und lieber die jüdischen Rabbis hätten, dass sie zu jüdischen Essen am Sabbat gingen und überhaupt mit den Juden Sabbat feierten und am Sonntag arbeiteten, dass die Christen offen sagten, sie wollten auch einen solchen Gesetzgeber haben wie die Juden ... Darum forderte Agobard ein Edikt, dass den Kontakt zwischen Christen und Juden, auch das Sabbatfeiern etc., verbot. 17 106 Dieser ständige Kulturaustausch führt dann zur Entwicklung der verschiedenen musikalischen modi des Diasporajudentums im Spätmittelalter und in der Neuzeit. In Mitteleuropa ist der Aschkenasi-Ritus maßgeblich. Der östliche Ritus ist schon wieder unterschiedlich (das wird später noch erläutert). Je länger die Zeit andauerte, desto größer wurden die Unterschiede. Wenn noch vor dem 10. Jh. kein Unterschied zwischen den einzelnen Riten (modi) festzustellen war, so waren diese Unterschiede doch im 18. und 19. Jh. sehr deutlich geworden. Gleichzeitig war der Kulturaustausch der vergangenen Jahrhunderte ja kein einseitiger gewesen, und so hatte sich ganz naturgemäß die Praxis des Synagogalgesangs vom alttestamentlichen Urbild auch schon einigermaßen entfernt. Dies könnten Gründe für eine notwendige Reform sein – doch die Reform des jüdischen Kultus im 19. Jh. hatte durchaus noch andere Gründe. Wenn man auch die übertriebenen Melismen des östlichen Ritus, der den Aschkenasi-Ritus bereits sehr stark beeinflusst hatte, beseitigen wollte, dann nicht unbedingt, um sich dem alttestamentlichen Vorbild zu nähern. Man wollte vielmehr eine bessere Basis zur zwanglosen Assimilation bereitstellen, indem man sich in der Reform dem (auch musikalischen) Geschmack der damaligen Zeit anpasste. Es hatte Vorläufer einer solchen Bewegung bereits in früheren Jahrhunderten gegeben.19 Alle bisherigen Assimilationsversuche, auch die Bereitschaft zur kulturellen Offenheit der Aschkenasi-Tradition, hatten nicht das Ziel gehabt, jüdische Tradition grundsätzlich infrage zu stellen und zu überwinden. Trotz der Metrisierung der jüdischen Melodien (siehe das Beispiel Salomon Rossis) wurden die originalen Melodien weitestgehend bewahrt, auch ihr orientalisch-semitischer Ursprung nicht verheimlicht. Doch nun war die Reform radikaler geworden, es ging tatsächlich ab dem 19. Jh. um eine Loslösung vom althergebrachten Judentum. Bis dahin wäre keinem Juden in den Sinn gekommen, seine Existenz anders als ein Exil von Palästina aufzufassen, aus dem man eines Tages in seine Heimat zurückkehren würde. Keiner hätte, trotz allen möglichen kulturellen Austauschs, die Idee gehabt (selbst bei allen Versuchen der chasanim im 18. Jh., die Synagogengesänge durch Metrisierung zu „europäisieren“), dadurch das Judentum von seinen Ursprüngen zu lösen oder eine Unterbrechung in der Tradition herbeizuführen. Dies änderte sich aber bei etlichen durch die Französische Revolution und die neuen philosophischen Schulen in Deutschland. Bald war es für die freidenkerischen, irreligiösen Juden klar, dass ihr nationales Elend in ihrer Abgeschlossenheit von der europäischen Kultur der Zeit begründet lag, weil sie einer veralteten asiatischen Religion anhingen, deren Humanismus diese Neohumanisten nicht sehen konnten. Solche aufgeklärten Juden kamen dazu, das Judentum zu hassen 19 So z. B. Salomon Rossi im Italien des 16. Jh., der in hebräischer Sprache, aber doch auf barocke Manier seine musikalischen Werke komponiert, die hebräischen Eigenarten der Melodien aber festzuhalten weiß. Alle Angaben bei Idelsohn, 1975, Kap. 7 bis 11. Siehe auch die sehr eingehende Schilderung des Werkes Rossis bei Gradenwitz 1967, Kap. 6. 107 und sich nicht mehr damit zu identifizieren. Heinrich Heine nannte das Judentum eine Kalamität, die keine Existenzberechtigung hätte. Viele der Freidenker nahmen das Christentum an und wollten vollwertige Staatsbürger von Frankreich oder Deutschland werden. Andere, deren jüdisches Herz lauter schlug, befassten sich mit dem Gedanken an eine radikale Reform. Der Vorschlag dazu kam von den jüdischen Laien; die Rabbis wehrten sich am Anfang heftig dagegen. Doch das Volk setzte sich durch; man wollte den Orientalismus, die Antiquiertheit der jüdischen Rituale etc. loswerden, um so weniger als Außenseiter angeprangert werden zu können. Wer verdiente mehr als die Juden, nun endlich in den Genuss der neuen Menschenrechte zu kommen? Wer litt mehr als sie unter den mittelalterlichen Vorurteilen der sie umgebenden Gesellschaft? Gleichzeitig gab es ja in der Christenheit die Rebellion gegen die lateinische Sprache, die durch die jeweilige Landessprache in den Kirchen ersetzt werden sollte. So ist auch der jüdische Reformversuch zu interpretieren, dass die immer weniger bekannte hebräische Sprache durch die jeweilige Volkssprache ersetzt werden sollte. Das führte sowohl innerhalb des Christentums als auch in den Synagogen zu heftigen Auseinandersetzungen.20 Die ruhigeren Reformer waren für die Komponisten der protestantischen Kirchenmusik, wie z.B. Purcell, Bach, Händel etc. Wie schon erwähnt, versuchten es zuerst die jüdischen Laien. David Friedländer aus Berlin z.B. versuchte, das Gebetsbuch aus dem Hebräischen ins Deutsche zu übersetzen (1787). Er war ein reicher intellektueller Kaufmann, doch solch ein Extremist, dass er sich vorstellen konnte, dass die Juden mit den Christen zusammengehen könnten, aber ohne den Glauben an Jesus und gewisse Zeremonien zu übernehmen (so in einem Schreiben von 1799 an den Oberkonsistorialrat Teller). Er wollte auch die jüdische Religion auf einen ethischen Kodex reduzieren (1813). Darum war er wenig erfolgreich.21 Erfolgreicher war der reiche und einflussreiche Kaufmann Israel Jacobson in Seesen, Westfalen. Dort errichtete er 1801 eine Knabenschule, ebenso in Kassel 1808. Seine Melodien für die Kindergottesdienste, die er in Kassel 1810 veranstaltete, waren den protestantischen Chorälen entnommen, zu denen er die hebräischen Texte von links nach rechts setzte (auch die Noten liefen also von links nach rechts); sie wurden gedruckt.22 In den in Seesen 1810 gegründeten Stadttempel brachte er eine Orgel, er stattete ihn sogar mit einer Glocke aus. Er 20 Als in der Kirche von Rüdesheim 1787 die neuen deutschen Lieder eingeführt werden sollten, kam es zu Ausschreitungen, die 30 Todesopfer forderten, weil der Erzherzog noch seine Soldaten in die Kirche sandte. Es war in Deutschland zu der Situation gekommen, dass zuweilen ein konservativer Priester die Litanei auf Latein anstimmte, die progressive Gemeinde aber auf Deutsch antwortete oder auch umgekehrt. Siehe bei Idelsohn 1975, 232 ff. 21 Roth und Wigader 1972, Bd. 5, 515. David Friedländer wurde später ein großer Bewunderer der Predigtkunst von Mannheimer. Siehe Wolf 1863, 15. 22 Vgl. Israel Jacobsons Druck von protestantischen Gemeindeliedern, die ins Hebräische übersetzt und deren Notenzeilen von rechts nach links gedruckt wurde, bei Idelsohn 1975, 237. 108 führte den Gesang deutscher Choräle ein, drängte das Singen des Pentateuch und der Propheten, wie auch die unrhythmisierten Gebete (und damit praktisch die chasanim) zurück und ließ die Texte einfach lesen, führte die deutsche Predigt in die Synagoge ein, beließ aber die hebräische Sprache bei den Gebeten. 1815 ging er nach Berlin, wo er dieselben Reformbestrebungen in die dort ansässige jüdische Gemeinde brachte. Trotzdem war der chasan nicht wirklich auszurotten; nach dem Weggang von Jacobson gab es auch in Seesen wieder einen chasan. Über Berlin ging dann die Reform nach Hamburg, wo man einen portugiesischen chasan beschäftigte, was zur gänzlichen Auflösung der Aschkenasi-Tradition führte. Es gab vierstimmige deutsche Chormusik in der Hamburger Synagoge etc. Die Hamburger Reform ging so weit, dass ein Sturm der Entrüstung durch das europäische Judentum fegte. Vor diesem Hintergrund ist auch der gemäßigte Reformansatz der Wiener Synagoge im Biedermeier zu sehen. Es war dieser gemäßigte Reformansatz, der sich durchsetzte: zwar Orgel, vierstimmiger gemischter Chorgesang im protestantischen Stil (Bach), Landessprache, aber doch weiterhin auch die chasanim und die traditionellen Melodien, eben für jene konservativen Juden, die sich einen Gottesdienst ohne chasanuth nicht vorstellen konnten. Da der chasanuth aber nicht mehr weiterentwickelt wurde, erstarrte er in seiner Form des 18. Jh.23 Dies führte letztlich doch zum Verlust eines guten Stücks jüdischer Kultur und Identität im 19. Jh., war vielleicht auch nicht zuletzt mitverantwortlich für jene assimilierte Grundhaltung des österreichisch-deutschen Judentums im 20. Jh., in der man sich weniger als Jude denn vielmehr als Österreicher oder Deutscher fühlte und sich darum der am faschistischen Horizont herannahenden Gefahr – von einzelnen wohl rechtzeitig erfasst und begriffen, in der Masse des jüdischen Volkes jedoch nicht klar realisiert – nicht entzog, da man sich längst assimiliert wähnte und die mittelalterliche Ghettosituation überwunden glaubte. Lebte man 1933 nicht bereits fast 150 Jahre nach der Französischen Revolution?24 Diese ganze Einführung soll dazu dienen, die folgende Darstellung der Reform von Mannheimer und Sulzer in einen größeren historischen Zusammenhang zu stellen, damit man die Brisanz dessen, was in der Biedermeierzeit in der jüdischen Synagoge in Wien geschah, besser erfassen kann. 23 Zur ganzen Darstellung dieser Entwicklung durch mehrere Jahrhunderte vgl. Idelsohn 1975, Kap. 11–12. 24 Pulzer 1967 sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den Emanzipationsbemühungen der Juden im Wien (für ihn ist Wien der Geburtsort des modernen Antisemitismus schlechthin) des 19. Jhs. und der schrecklichen Entwicklung im Dritten Reich. Er beginnt im späten 18. Jh. und zeigt die Entwicklung des modernen Antisemitismus bis in die Wiener Nazizeit auf. Vergleiche im selben Buch auch Tur-Sinai 1967. 109 2.2 Die Wiener Juden im Vormärz Die Wiener Juden hatten ein Jahrhunderte altes Problem: Sie durften unter keinen Umständen eine Gemeinde bilden. Was in Provinzstädten erlaubt war, war in Wien verboten. Seit 1670 gab es in Wien keine Judengemeinde mehr, und dieser gesetzliche Zustand dauerte noch bis 1848 an. Das verstand man in Bezug auf die Juden unter der viel gerühmten josephinischen „Toleranz“: Der Kaiser hatte es abgelehnt, die jüdische Nation in den Erblanden sich noch weiter ausbreiten zu lassen, oder da, wo sie nicht toleriert war, neu einzuführen. Neu – und auch wirklich tolerant im Vergleich zur früheren Geschichte – war, dass es keine sakrale Gesetzgebung mehr gab, und der Staat sich die Juden nützlich machen wollte; sie waren also auch von außen einem gewissen Assimilationsdruck ausgesetzt (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 13). In Wien gab es entsprechend dem Geist der Aufklärung zwar kein Ghetto und in diesem Sinne kein finsteres Mittelalter mehr, aber auch keine Judengemeinde. Die Juden lebten unter den anderen: ein Symbol für die aufklärerische Behandlung der Juden vonseiten der Gesellschaft. Beabsichtigt war die Integration in die vormärzliche Gesellschaft, doch eben nur als „tolerierte“ Herrschaften, also: péjorativement. Jüdischer Handel war in Wien verboten, doch von der Polizei geduldet, weil er für die Stadt sehr lukrativ war. Trotz dieser rechtlosen, weil nur geduldeten gesellschaftlichen Situation der Juden gab es doch sehr starke gesellschaftliche Kontakte zwischen den Wienern und den Juden: Metternich lädt Salomon M. Rothschild ein, nach Wien zu übersiedeln, stellt ihn der Wiener Gesellschaft als quasi den zweiten Mann des Staates vor, Rothschild wird in den Freiherrnstand erhoben, seine Brüder in Paris und London zu k.-k. Generalkonsuln ernannt. Diese gesellschaftliche Arriviertheit der Juden in Wien, trotz ihrer gesetzlichen Ausklammerung, ist für Frances Trollope schier zu viel: „I must be schooled in the gymnase of toleration a while longer; such indifference is as yet too excellent for me“ (Trollope 1838, Bd. 2, 220; vgl. Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 14f.). Der hohe Staatsbeamte Graf Joseph Saurau bemerkte um 1810: Überhaupt aber erscheint mir die Frage allerdings Würdigung zu verdienen, ob es nicht ein wahrer Gewinn für den Staat und die bürgerliche Industrie wäre, wenn ... mehreren reichen und zugleich als rechtlich bekannten Juden die Toleranz erteilt würde, weil im Grunde doch bei dieser gebildeten Klasse nicht die Besorgnisse einzutreten scheinen, welche die Staatsverwaltung bewogen haben mögen, das Ansiedeln der dürftigen und daher zum Betrug geneigten Klasse ihrer Glaubensgenossen durch eine wohlthätige Strenge zu verbieten.25 25 Wolf 1876, 104. In seinem Buch über Noa Mannheimer (1863, 12) stellt Wolf fest, dass Graf Saurau um 1821 der oberste Kanzler und Mannheimer sehr gewogen war. 110 Die Juden in Wien hatten seit 1785 einen Friedhof und ein Spital, seit 1792 eingesetzte Vertreter, und seit 1811 bis 1826 betrieben sie die Gründung des Stadttempels. 1785 wurde erstmals rechtens festgestellt, dass die Judenschaft einen gemeinsamen Besitz (Judenspital in der Rossau) hatte, der eine Verwaltungstätigkeit erforderte: Der Kaiser forderte die Judenschaft auf, das Spital zu restaurieren. So suchten die Juden 1791, die Gelegenheit des kaiserlichen Auftrages nutzend, um die Bildung eines Ausschusses an, der die Verwaltungsgeschäfte der Juden übernehmen sollte. Der Spitalsbau war also der Anlass für die Bildung einer administrativ anerkannten Deputation der Judenschaft Wiens. Diese Deputation wurde vom Kaiser am 17. Juni 1792 genehmigt, ebenfalls durch ein Dekret der Landesregierung vom 8. Mai 1794. Seine Majestät habe „allergnädigst zu entschließen befunden, dass aus der hiesigen Judenschaft einige benennet werden sollen, welche jedoch nicht Ausschüsse, da dieses eine Gemeinde, die die hiesige Judenschaft nicht vorstellt, vorauszusetzen scheinen würde, sondern Vertreter zu heißen haben“ (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 17). Diese Vertreter waren natürlich aus der Gruppe der wohlhabenden „Tolerierten“. 1811 erwarben sie ein Haus, in dem sie öffentlich den Gottesdienst feiern konnten. Im April 1826 wurde dann endlich der Wiener Stadttempel in der Seitenstettengasse fertiggestellt und eingeweiht. Er beinhaltete Synagoge, Schule, das Rituelle Bad, alles in allem ein schönes eigenes Gotteshaus. Daneben gab es immer noch im Lazenhof die „Schul’“, den Betort der orthodoxen Juden (eben seit 1811), aber immer noch gab es keine Gemeinde. Der Rabbiner Eleasar Horwitz z.B. durfte sich nicht „Rabbiner“ nennen, sondern wurde von den Behörden als „Ritualienaufseher“ geführt. Auch dies war ein Beispiel für die öffentlich rechtlose Situation der Juden im Wien des Biedermeier.26 Der Stadttempel selbst wies architektonisch Verbindung zu den schönen Künsten auf, doch nicht nur architektonisch, sondern auch musikalisch: Salomon Sulzer, der neue Kantor aus Hohenems, war im Wiener Musikleben bald eine anerkannte Persönlichkeit (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 18f.). So führte rein praktisch die äußerliche Entwicklung von der „tolerierten Judenschaft“ langsam zur „Israelitischen Kultusgemeinde“. Innerlich entwickelten sich die geschlossenen Judengemeinden in der gleichen Zeit zu einer zwar nicht mehr genau definierbaren, aber wohl vorhandenen jüdischen Präsenz. Die Juden säkula- 26 Erst unter Franz Joseph I. durfte die Judenschaft Wiens sich „Gemeinde“ nennen; s. Wolf 1861, 2: Franz Joseph anlässlich der Emanzipation vom 3. April 1849 zu den Vertretern der Judenschaft in Wien: „Es gereicht mir zum Vergnügen, den Ausdruck der Gefühle treuer Ergebenheit und Anhänglichkeit entgegen zu nehmen, welche Sie mir im Namen der israelitischen Gemeinde von Wien darbringen. Durch die Gleichberechtigung aller Völker und aller Stämme, welche die von mir verliehene Verfassung zu einem großen, mächtigen Reiche vereinigt, wird, wie Ich fest vertraue, die Wohlfahrt und das Glück des Ganzen wie des Einzelnen dauernd begründet und einer gedeihlichen Entwicklung zugeführt werden.“ 111 risierten sich immer mehr. Doch trotzdem war ein ständiges Anwachsen des Antisemitismus zu beobachten. Neben Adel, Offizieren und Beamten gab es einen weiteren Stand, den der Juden, der von seinem Wesen her zum Träger der österreichischen Staatsidee berufen war. Solange die Monarchie bestand und der interne Völkerzwist an ihrem Lebensnerv nagte, hieß es von den Juden, gerade sie seien die geborenen Österreicher. Als die Monarchie der Vergangenheit angehörte, wurden sie zu Überlebenden und Chronisten der „Welt von Gestern“ (ibid., 20 f.). 2.3 Planung und Durchführung der liturgischen Reform Ausgelöst wurde alles durch den Aufruf der Vertreter der Wiener Judenschaft an die „Tolerierten“ vom 18. November 1819. Es ging um die Verständlichmachung des israelitischen Gottesdienstes für alle daran Teilnehmenden gemäß dem Vorbild von Hamburg und Berlin. Jugend und Frauen sollten mehr in den Gottesdienst einbezogen werden, nicht mehr in einer ihnen unverständlichen Sprache beten oder von der öffentlichen Gottesverehrung gänzlich ausgeschlossen sein müssen. 50 Mitglieder unterzeichnen diesen Aufruf. Es kommt zum Bittgesuch vom 7. Jänner 1820 an die niederösterreichische Landesregierung. In diesem Gesuch wird ein Kniefall vor der österreichischen Kultur gemacht (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 24f.): Je mehr die Untertanen israelitischer Religion durch die väterliche Fürsorge der höchsten Staatsverwaltung und durch deren weise Maßregeln ... in der Kultur fortschreiten, und sich in Sprache, Kenntnissen, Sitten und Betragen ihren christlichen Mitbewohnern nähern, um so mehr werden andererseits die ehemals gewöhnlichen Unterrichtsgegenstände derselben, als das Studium der hebräischen Sprache, des Talmuds u. dgl. als für das praktische Leben entbehrlich hintangesetzt und vernachlässigt. Die Folge dieser Entwicklung: Der Gottesdienst sei für die heranwachsende Jugend und das weibliche Geschlecht ganz unverständlich. Die Vorbilder der zu unternehmenden Reform seien Hamburg und Berlin. Absicht der Reform: Es bleibe zwar noch die hebräische Sprache im Gottesdienst, aber es solle nun auch Deutsch, Musik mit Orgel und die ganze Predigt in Deutsch dazukommen.27 Doch für niemanden solle es ein Zwang sein, jeder Jude solle so beten können, wie er es wolle. Das Ansuchen schließt mit der Bitte um Erlaubnis zur gottesdienstlichen Reform und zur Möglichkeit der gemeinschaftlichen Besoldung von drei 27 Das z. B. war in Berlin vom preußischen König Friedrich Wilhelm im Winter 1823/24 den Juden verboten worden. Siehe Wolf 1863, 14. 112 Verantwortlichen – für Predigt, Gesang und Gebet (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 23). Die Antwort des Kaisers Franz lässt nicht lange auf sich warten: Sie datiert vom 22. Januar 1820. „Die Vermehrung und Ausbreitung der Juden ist auf keine Weise zu begünstigen und für keinen Fall die Duldung derselben auf andere Provinzen, als wo sie schon dermalen stattfindet, auszudehnen ...“ Trotzdem „erlaubt“ er: (1) kein Rabbiner darf mehr angestellt werden, der nicht philosophisch und jüdisch gebildet ist; (2) die jüdische Vertreterschaft muss für die Kosten aufkommen; (3) Gebete und Gesänge auf Deutsch werden erlaubt; (4) die jüdische Jugend soll zum Schulbesuch gehörig angehalten werden; vor allem soll sie in christlichen Schulen den Unterricht empfangen.28 Das war offensichtlich der Vorstoß der Liberalen unter den Juden Wiens, die dadurch auch erreichen wollten, dass das Judentum gesellschaftsfähiger wurde, was ihnen auch gelang – den Antisemitismus Wiens in der zweiten Hälfte des 19. Jh. (und damit die Vorboten der Katastrophe des 20. Jh.) aber nicht verhindern konnte. So kam es also zur Reform des israelitischen Kultus in einer jüdischen Gemeinde von Wien, die rechtlich gar keine war, eine „typisch österreichische“ Situation.29 Der durch den Rabbiner Isaak Noah Mannheimer und den Kantor Salomon Sulzer herausgebildete Wiener Kultus, der sogenannte „Wiener Minhag“ (jüdische Liturgie) war ein Kompromiss zwischen Konservativen und Modernen, eine typisch österreichische Lösung, getragen vom dänisch-jüdischen Reformrabbiner Mannheimer, der in Wien eben keinen radikalen Reformtempel eröffnen wollte, sondern beabsichtigte, dass „neue Institutionen nicht für einen Theil, sondern für die ganze Gemeinde sein sollten, und in solcher Weise suchte er den Spaltungen 28 Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 26; s. a. Wolf 1863. Er zitiert den kaiserlichen Erlass auf den S. 10 f. wörtlich. Aus dem Erlass wird auch ersichtlich, dass es dem Kaiser um die Integration der Juden ging, um ihre Assimilierung, wobei die Formulierungen doch teils die alten Vorurteile widerspiegeln: „Dieser Gesichtspunkt bezielt den Zweck, die Sitten, sowie die Lebens- und Beschäftigungsweise der Juden unschädlich zu machen und sie, so viel möglich, mit jenem der bürgerlichen Gesellschaft, in welche sie aufgenommen sind, allmälig in gemeinnützige Uebereinstimmung zu bringen. Die Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen, liegen allerdings in der angemessenen Einwirkung auf die religiöse, sittliche und intellectuelle Bildung der Juden, in der Aufmunterung zur Ergreifung solcher Erwerbszweige, welche ihr Interesse mit jenem des Staates in Uebereinstimmung zu bringen geeignet sind; endlich in der allmäligen Beseitigung der Isolierung und Absonderung der Juden in ihren Verhältnissen zu dem Staatsverbande. Allein die Anwendung dieser Mittel läßt verschiedene Stufen zur Entwicklung zu und macht sie bei den oben bemerkten Verhältnissen der Juden in Meinen Staaten sogar nothwendig.“ In seiner Fußnote auf S. 10 bemerkt Wolf, dass der damalige Polizeipräsident Graf Sedlnitzky am 28. Juli 1819 der Hofkanzlei die Anzeige macht, dass ein gewisser Elieser Liebermann ein Journal „Syonia“ herausgeben wolle, was von der Hofkanzlei positiv aufgenommen wird. Der Bericht der Polizeioberdirektion weist auch deutlich die Tendenz auf, dass die Reformen der Judengemeinde begrüßt werden, weil dadurch die Isolierung der Juden ein Ende finden könnte. 29 Zur Emanzipationshoffnung der Juden zu Beginn des 19. Jh. und wie sie vom Wiener Kongress weitgehend enttäuscht und verzögert wurden, siehe Wolf 1861, 9–14. 113 vorzubeugen und das höchste Gut, den Frieden, zu wahren“.30 Für diese Frieden stiftende Kompromisshaltung konnte Mannheimer dann eben auch Salomon Sulzer gewinnen, der ein ausgezeichneter Sänger war. 2.3.1 Isaak Noah Mannheimer Mannheimer selbst war politisch progressiv. Er setzte sich sehr stark für die Emanzipation des Judentums ein. In Dänemark, wo er um seinen Abschied bat, bekam er neben der Gewährung seines Abschieds von der königlichen Kanzlei eine Belobigung: Es hieß, die Kanzlei könne „nicht unterlassen, Ihnen die besondere Zufriedenheit dieses Collegiums mit dem Fleiße, den Kenntnissen und der Tüchtigkeit, mit welcher Sie diesem Amte vorgestanden sind, zu erkennen zu geben“ (Wolf 1863, 13). 1824 kam er dann nach seinem Abschied von Kopenhagen nach Wien, um dort den im Bau befindlichen und 1826 fertiggestellten Stadttempel in der Seitenstettengasse zu übernehmen. Einige der Wiener Juden wollten die Hamburger Reform auch in Wien einführen, darum hatten sie Mannheimer bereits 1821 eingeladen, der Rabbi der Wiener Juden zu werden.31 Schon in Dänemark hatte er in der Landessprache gepredigt, obwohl das Hebräische auch nicht ganz zurückgedrängt, war er doch Sohn eines chasan. Er bekannte freimütig, in der Predigtkunst viel von seinen christlichen Kollegen gelernt zu haben.32 Trotzdem wies er in Wien die radikale Reform zurück, ohne jedoch die, die ihn geholt hatten, damit auf Dauer zu enttäuschen. Er hielt an Hebräisch als Gebetssprache fest, verteidigte die Beschneidung als fundamental und ließ zum Gottesdienst keine Orgel zu. Die Predigt aber war auf Deutsch. Dieser „Wiener Minhag“ fand Nachahmung in den jüdischen Gemeinden Österreichs, Ungarns und Böhmens. Mannheimer engagierte sich auch sozial. Er gründete Wohltätigkeitsorganisationen und Kulturvereine. Er kämpfte für die Rechte der Juden in der Wiener Gesellschaft und wollte die legale Anerkennung 30 So charakterisiert von Wolf 1863, 13. Diese Haltung hatte Mannheimer, als er zwischen 1821 und 1824 gar nicht in Wien war, sondern sich nur brieflich um solche Probleme kümmern konnte. Mannheimer hatte bei seinem ersten Wienaufenthalt den Bau der Synagoge in der Seitenstettengasse angeregt und das Wunder vollbracht, aus vielen streitenden Splittergruppen eine Gemeinde zu bauen. Dann war er wieder nach Dänemark gegangen, um via Berlin 1824 wieder nach Wien zu kommen (ibid., 12 f.). 31 So begründet bei Idelsohn 1975, 246; ebenso Wolf 1863, 12. 32 Diese Haltung teilten auch etliche seiner jüdischen Kollegen. Vergleiche Altmann 1964, 70 –74. Ihre Vorbilder waren Leute wie Schleiermacher und Dräseke. Der neue Predigtstil in der Synagoge legte großen Wert auf Homiletik und korrekte Exegese. Extreme sollten vermieden werden. Der Sinn der Predigt war die Erbauung, und zwar jene Erbauung, die den Menschen besserte, veredelte. Mannheimers Interesse an Erbauung und Andacht war sehr stark; er betrieb es bereits in den einleitenden Gebeten zu seinen Predigten. Im oben zitierten Aufsatz von Alexander Altmann finden sich solche Beispiele aus Mannheimers Gottesdienstlichen Vorträgen aus dem Jahre 1834 (siehe ibid., 101, zur allgemeinen Studie aber schon ab 75). 114 der Judengemeinde durch die Stadt Wien erreichen. Mit 24 anderen Rabbinern aus Österreich erreichte er die Abschaffung des Eides more judaico.33 Dies war ein großer Erfolg, wenn auch sein eigener Eidesformelvorschlag von den Behörden nicht angenommen wurde. Er kämpfte gegen die beschränkte Zulassung von jüdischen Studenten zur Wiener Universität sowie gegen die Judensteuer. Seiner Gemeinde wird er um die Jahrhundertmitte zu gefährlich, da die antisemitischen Gefühle der Bevölkerung zunehmen und man Angst hat, dass Mannheimer die Behörden zu sehr provoziere (so hat er sich z.B. vor dem Reichstag für die Abschaffung der Todesstrafe eingesetzt). Darum bat man ihn, von der Politik Abstand zu nehmen, was er auch tat, obwohl nur widerstrebend (Roth und Wigader 1972, Bd. 11, 890f.). 2.3.2 Salomon Sulzer aus Hohenems Über ihn und seine Wurzeln in Vorarlberg wissen wir nicht wenig, hat doch sein Vater Joseph Sulzer im Jahre 1841 eine Autobiografie verfasst, in der er die Geschichte der Familie Levi-Sulzer bis zum Beginn des 17. Jh. zurückverfolgt (vgl. Purin 1991a). Interessant ist der Stammbaum deshalb, weil es offenbar wird, 33 Auch juramentum judaeorum genannt. Diese Eidesform musste von Juden seit dem Mittelalter in Gerichtssachen mit Nichtjuden geleistet werden. Die Form und die Sprache des Eides hatten es darauf abgesehen, die Juden in der Öffentlichkeit zu demütigen; sie symbolisierten sozusagen eine Art Selbstverfluchung der Juden mit genau detaillierter Aufzählung der verschiedenen Strafen im Falle des Meineids. Die Eidesformel zeigte ganz offen das Misstrauen der Gesellschaft den Juden gegenüber. In Europa gab es solche Eidesformeln speziell für Juden seit Karl dem Großen bis ins 18. Jh., an manchen Orten, wie eben in Wien, auch länger. In Deutsch gibt es noch Manuskripte aus dem 12. Jahrhundert aus Erfurt und Görlitz. Der Eid musste auf die Hebräische Bibel geleistet werden. So ein Beispiel aus dem deutschen Schwabenspiegel (circa um 1275), nachdem ein Jude sagen musste, dass im Falle seines Meineids er sich beim Essen beflecken würde wie der König von Babylon, dass es Feuer und Schwefel auf seinen Nacken regnen würde wie auf Sodom und Gomorra, dass die Erde ihn verschlingen würde wie Korah, Dathan und Abiram, dass er den Aussatz bekäme wie Naëman, dass der Fluch des Christusblutes auf sein Haupt käme am Tag des Gerichts, beim Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Amen. Nicht alle christlichen Eidesformeln für Juden waren so unfreundlich, doch die Tendenz war immer eindeutig. So forderte man z. B., dass der Jude bei der Eidesleistung auf einer Ziegenhaut stehen müsste (Teufelssymbol) oder überhaupt auf der blutigen Haut eines frisch geschlachteten Schweines, das in den letzten 14 Tagen Junge geworfen haben und dessen Haut auf dem Rücken aufgeschnitten sein musste, dass die Zitzen sichtbar seien, auf denen der Jude dann zu stehen käme ... Solcherart Entehrung stieß auch bei Christen auf Widerspruch, und so gab es ein ewiges Hin und Her. Für die Juden zu sprechen war lebensgefährlich, so z. B. für den Erzbischof Ruthard von Mainz Ende des 14. Jh., der von Kreuzfahrern fast getötet worden wäre, weil er für die Juden sprach. Doch die mittelalterlichen Vorurteile hielten sich bis ins 19. und 20. Jh.: So gab es noch im deutschen Kleve des Jahres 1892 einen Ritualmordprozess gegen den jüdischen Schächter des Ortes, in dem der Angeklagte aber wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wurde (Roth und Wigader 1972, Bd. 12, 1302 f.; Keller 1974, 263; der Letztere bringt noch einige andere antisemitische Details aus dem Schwabenspiegel. Ebenso Schilling 1963, 89–92, 138–141, 159 f.). 115 dass praktisch ein Ahnvater für zwei Familien gültig ist, noch eine dritte Familie dazukommt, dieses genetische Erbe aber alles in den Eltern von Salomon Sulzer wieder zusammenfindet (ibid., 20). Die schlechten Geschäfte der Familie Sulzer führen dazu, dass Salomon Sulzer auch wegen der Geldknappheit nach Wien geht (ibid., 23). Am 9. Dezember 1825 erreicht ein Brief Mannheimers Salomon Sulzer in Hohenems. Mannheimer lässt Sulzer die Kriterien für Verwendbarkeit eines chasans wissen. Am 18. Dezember 1825 antwortet Sulzer: In dieser Antwort macht er sich 23 Jahre alt (wegen der 24, die ein chasan mindestens alt sein sollte!) und schreibt über sein beträchtliches Einkommen in Hohenems (das sollte ihm eine gute Ausgangsposition für die Wiener Gehaltsverhandlungen bescheren) – in Wirklichkeit war seine Hohenemser Finanzsituation eher bescheiden. Er lässt Mannheimer auch wissen, dass er mehrere Musikinstrumente beherrscht (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 34). Sulzer verkaufte sich also gut, war auch wirklich kein schlechter Musiker. Und mit dem Alter musste er es aufgrund seiner Erfahrung auch nicht genau nehmen. Er war auch nicht am Rand der Welt aufgewachsen, denn die Hohenemser Judengemeinde hatte ihre eigene Geschichte und erlebte nach 1800 eine außerordentliche kulturelle Blüte. Seit 1617 waren die Juden in Hohenems angesiedelt. Dies war möglich, weil Hohenems staatsrechtlich nicht zu Österreich gehörte. Der Reichsgraf Kaspar von Hohenems hatte 1617 verfügt, dass der Handel der Region 116 durch Ansiedlung von Juden in diesem Gebiet zwischen Österreich und der Schweiz belebt werden sollte. Hohenems war zugleich Land (Grafschaft) und gerichtliche Gemeinde. Es wurde jedoch christlich verwaltet, und die Landammänner erweisen sich leider häufig als bittere Gegner der Juden. Dennoch verdankte man in diesem Gebiet den Juden die Prosperität des Landes. Zuweilen wurde die Ausweisung der Juden gefordert, doch ein administratives Gutachten von 1768 hält fest, „daß die juden ... der grafschaft Hohenems wenigstens für dermalen so zu sagen notwendig seien, wenn man nicht ... den mit christen sehr dünn besetzten flecken Embs nahezu völlig auf einmal veröden will“ (Tänzer 1955 [1905], 155, zit. v. Burmeister 1991, 27). Vor einem solchen historischen Hintergrund gelingt es der jüdischen Gemeinde, sich mehr und mehr zu emanzipieren und es nach 1800 zu einer regelrechten Blüte zu bringen. Ab 1800 gibt es in Hohenems einen Frauenverein der Hebräer, seit 1783 bereits einen Talmud-Tora-Verein, seit 1813 eine Lesegesellschaft, die etwas liberal eingestellt ist und die Zeremonielosigkeit des Gottesdienstes anstrebt (radikale Reform). Es gibt verschiedene Unterrichtsstiftungen, so unterstützt Familie Levi z.B. den Hebräischunterricht. Salomons Kantorberuf hat eine gewisse Familientradition. Er verdankt seine erste Ausbildung dem Kantor von Endingen, als er noch ein pubertärer Knabe war. Mit dem Kantor Lippmann zieht er in seiner Jugendzeit als Hilfssänger durch Frankreich. Das erste Mal wird ihm von seiner Heimatgemeinde die Stelle als Vorsänger in der Synagoge von Hohenems im Alter von 11 Jahren angeboten, nach dem Tod des alten Kantors. Damit ist der Knabe natürlich überfordert, hat er doch das erforderliche Mindestalter von 24 Jahren noch lange nicht erreicht. Ab 1820 aber wird er dann mit 16 Jahren wirklich zum provisorischen Vorsänger von Hohenems. Salomon Sulzer ist also sozusagen im Goldenen Zeitalter der Juden von Hohenems dort aufgewachsen.34 Am 23. Dezember 1825 wird Sulzer durch die Vertreter der Judenschaft Wiens als neuer Kantor angenommen (s. Brief bei Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 28). Der Chor der Synagoge ist schon 1814 gegründet worden (Quellen ibid., 39–43). Sulzers Eintreffen sorgt für folgende Notiz:35 Aufforderung ... an Knaben welche sich beym Chorgesange verwenden wollen. Knaben und studirende Jünglinge israelitischer Religion welche Talent zum Gesange haben, und sich hierin bey dem hiesigen öffentlichen Gottesdienste verwenden wollen, belieben sich deshalb bey Einem der Unterzeich34 Burmeister 1991. Zur Jugend Sulzers in Hohenems, seiner Entwicklung zum Kantor seit frühester Kindheit sowie zur Bedeutung Sulzers in Wien vgl. a. Mandell 1967. 35 Zit. v. Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 43. S. a. Pass 1991. Bald nach seiner Ankunft in Wien heiratet Salomon Sulzer seine Fanny (geboren 1809). Sie wird ihm zwischen 1829 und 1855 sechzehn Kinder gebären, bei der Geburt ihres letzten Kindes stirbt sie. Ihr Portrait bei der Vorarlberger Landesausstellung wurde 1857 posthum nachgemacht (rekonstruiert). Siehe Purin 1991 b , 94f. Siehe dazu auch Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 286 f. 117 neten zu melden, worauf sie von dem Vorbether im Gesange unentgeldlichen Unterricht, und für ihre Verwendung eine verhältnismäßige Remuneration erhalten werden. – Wien, den 1ten März 1826, die Vertreter. Am 9. April 1826 kommt es dann zur Einweihung des Stadttempels. Es erscheint ein Bericht darüber in der Allgemeinen Theaterzeitung und Unterhaltungsblatt für Freunde der Kunst und des geselligen Lebens, Wien, 27. 4. 1826. In diesem Bericht wird die Einweihung sehr wohlwollend beschrieben, der schöne Gesang des Salomon Sulzer (Psalm 84 und 24), eines zweiten Sängers und eines 30stimmigen Chores sehr gelobt. Dazu kommt ein Gebet Mannheimers für den Kaiser, die Kaiserin, den Kronprinzen und die Minister sowie Musik zu den Psalmen von Joseph Drechsler, der ebenfalls sehr gelobt wird (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 45ff.). 2.3.3 Sulzer und seine ökumenische Auswirkung in Wien In Wien war damals das Problem der Judenemanzipation dauernd gegenwärtig: Das Problem bestand auch in der äußeren Kenntlichkeit der Juden wegen gewisser Kleidungsvorschriften. Walter Pass lobt Sulzer in diesem Zusammenhang wegen seines ökumenischen Engagements, wegen seines Eintretens für Humanität und Menschenwürde über soziale Grenzen hinweg – eben durch seine Musik. Sulzer war sehr staatsbürgerlich gesinnt, und mit seinem musikalischen Engagement in Wien überwand er die Glaubensschranken. So soll Sulzer mit seinen Kompositionen einen guten Teil zur Judenemanzipation im Wien des 19. Jh. beigetragen haben (Pass 1991, 52–55, 60). Er war ja von Mannheimer beauftragt worden, den Gottesdienst zu reformieren. Sulzer nahm seine Aufgabe sehr ernst (vergleiche weiter oben das Inserat für die Chorknabensuche). Im Laufe seiner Wiener Zeit bringt Sulzer sein Werk Schir Zion heraus, in dem von 150 Gesängen ganze 37 aus der Feder von christlichen Komponisten stammen. Das musikalische Engagement Sulzers führt dazu, dass auch viele Nichtjuden in Wien in die Synagoge kommen, nur um Sulzer und seinen Chor zu hören.36 Er betreibt einen fünf- bis achtstimmigen a-cappella-Stil. Die wichtigsten Musiker, wenn sie nach Wien kommen, wollen ihn hören – so Meyerbeer und Schumann. Sulzers und Mannheimers Gottesdienste sind als die besten Wiens bekannt (ibid., 63). Es gab wiederholt Bestellungen synagogaler Kompositionen bei christlichen Komponisten: z.B. bei Beethoven im Januar 1825. Aus seinen Konversationsbüchern ist noch die Unterhaltung Beethovens mit seinen Verwandten Karl und Johann zu diesem Thema rekonstruierbar. Die beiden misstrauen den Juden offensichtlich, wollen Beethoven einreden, dass er sich nur ja Honorargarantien 36 Pass 1991, 56. Vgl. die ähnliche Haltung der Wiener zur damaligen Kirchenmusik, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wurde. 118 geben lässt. Die Juden kommen auch und erkundigen sich bei Beethoven, ob ihm der Text gefalle. Wahrscheinlich hat Beethoven sogar die Melodie mancher jüdischer Gesänge erhalten, denn im Streichquartett op. 131, im kurzen Satz Nr. 6, ist die Melodielinie des Kol nidrei nachweisbar. Leider hat Beethoven den Wünschen der jüdischen Gemeinde nicht entsprochen (vgl. Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 48–51). Im Schir Zion aber sind einige der besten Komponisten Wiens vertreten: Seyfried mit zwei Kompositionen, Schubert mit einer, Joseph Fischhof mit sechs, Wenzel Wilhelm Würfel mit drei, Joseph Drechsler sogar mit sechzehn, Franz Volkert mit neun.37 Sehr bald nach seiner Ankunft in Wien ist bereits Sulzers Bekanntschaft mit Schubert nachweisbar, der Sulzer wegen dessen ausgezeichneter Interpretation von Schubertliedern hoch schätzt und für das Werk Schir Zion im Juli 1828 den Psalm 92 vertont (D. 953). Dieses Werk ist musikalisch sehr schön, doch offenbart natürlich Schuberts Unkenntnis der richtigen Betonung in der hebräischen Sprache.38 Sogar an Meyerbeer wandte man sich 1856 um eine Komposition, doch der Jude Meyerbeer rührte sich nicht, es ist keine Reaktion nachweisbar (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 54). Sulzers eigene wichtigste Werke in seiner Wiener Zeit sind die zwei Bände Schir Zion, dann die Dudaim (ein kleines liturgisches Gesangbuch), eine große Anzahl von geistlichen Chorliedern. Zwei weltliche Gesänge sind nachweisbar: das Tyroler Lied (1848), das durch Johann Strauß im Volksgarten aufgeführt wurde und der Verbrüderungsbewegung dienen sollte. 1849 komponiert er für die Frau von Erzherzog Johann ein Männerquartett. Solche Aktionen begründen mit seinen Verdienst um die soziale Anerkennung der Juden in Wien (Pass 1991, 64–67). Sulzer selbst ist mit den Musikerpersönlichkeiten Wiens selbstverständlich in dauernder Verbindung. So sehr sein Schir Zion ein Reformwerk gegen die „polnischen Opernarien und Singsang“ ist,39 so sehr aber strebt er auch nach der westlichen Musik. Von einem Abend, an dem er ein Schubertlied („Die Allmacht“) vortrug, gibt es noch ein historisches Zeugnis: Liszt war auch zugegen gewesen und bedankte sich bei Sulzer mit einer kleinen Karte: aufgeklebte Lorbeerblätter und Überschrift: „An Sulzer, den begeisterten Sänger der ‚Allmacht‘, der dankbare Franz Liszt“ (Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 88). Dies war am 18. 37 So bei Avenary, Pass und Vielmetti 1985, 48–51. Vergleiche auch Pass 1991, 61. Dort wird auf die nichtsdestoweniger präsente Bindung Sulzers an den Aschkenasi-Ritus hingewiesen. 38 Siehe Jacobson 1986, 43. Vielleicht war Schuberts Unkenntnis der hebräischen Sprache auch der Grund, dass dieses Werk erst 76 Jahre später uraufgeführt wurde, nämlich am 12. Mai 1904, anlässlich eines Konzerts zu Ehren des 100. Geburtstags von Salomon Sulzer; s. Mandell 1967, 221–229. Eric Mandell geht von der Komposition des Stücks im Jahre 1827 aus (ibid., 221). 39 In dieser Weise verdeutlicht in seiner Vorrede zum Schir Zion, hier aufgrund meiner Quelle nun in englischer Übersetzung zitiert: „I thought it my duty to consider, as far as possible, the traditional tunes bequeathed to us, to cleanse the ancient and dignified one of the later accretions of tasteless embellishment, to bring them back to their original purity, ant to reconstruct them in accordance with the text and the rules of harmony“ (Gradenwitz 1967, 19). 119 März 1846 – obwohl er schon seit 1839 einem Vertrag zugestimmt hatte, durch den er davon abgehalten werden sollte, woanders als in der Synagoge zu singen. Er stimmte ja alle zur Andacht (nach einer Äußerung der Allgemeinen Zeitung des Judenthums aus dem Jahre 1837), sein Amt machte ihn nicht zu einem gewöhnlichen Sänger, der über sich verfügen konnte, sondern zu einem Geistlichen. In diesem Vertrag fordert Sulzer natürlich gewisse materielle Sicherstellungen, wenn er aufgrund der Bedeutung seines Amtes nur mehr exklusiv für den Stadttempel zur Verfügung stehen sollte. Doch insgeheim hielt er sich nicht daran und fuhr fort, verschiedentlich zu singen. Er unterrichtete auch Gesang im Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde (Pass 1991, 57ff.). 2.3.4 Die Hauptanliegen der Reform Die Hauptanliegen liturgischer Art werden bereits vor der Eröffnung des Wiener Stadttempels in mehreren Ausschusssitzungen niedergelegt. Aus dem Protokoll einer Sitzung vom 23. Jänner 1826 ist zu entnehmen, dass die damaligen Vertreter der Wiener Judenschaft folgende Ziele hatten: (1) Herstellung der Ordnung, Ruhe und feierlichen Stille während des Gottesdienstes. Unreinlich und unanständig gekleideten Personen ist der Eintritt zu untersagen; alles Reden, Lachen etc. ist zu vermeiden. Stille Gebete sind erlaubt, kein lautes Amen, keine Schreie, alles mit mäßiger Stimme. Dem Vorbeter ist nicht stimmlich zuvorzukommen. Jede Beschmutzung und Lärmbelästigung ist verboten. (2) Abstellung der bisherigen Störungen. Kein Vorbeten von Fremden, Ordnung beim Kaddisch, kein Klopfen, keine Verspätungen des Gottesdienstes etc. Dazu kamen noch Bestimmungen über die Dauer des Gottesdienstes (ohne Wortverkündigung nicht mehr als zwei Stunden, mit Wortverkündigung nicht mehr als drei) und andere liturgische Bestimmungen – wie z.B., dass vor jedem Gottesdienst vom Vorbeter vor der Lade im „gehörigen, einfachen, doch feierlichen Tone“ das „ma tobu“ vorzutragen ist (Wolf 1861, 24f.). Aus diesen Vorstellungen kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen in Bezug auf die Probleme, die sie tatsächlich hatten. Vor allem aber ging es um die Qualität des chasan, der folgenden Kriterien genügen musste: (1) Er brauchte eine kräftige, sonore, ausgebildete Stimme, (2) er musste über musikalische Einsicht und Fertigkeiten in Komposition und Chorleitung verfügen, (3) er musste hinreichende Grammatikkenntnis des Hebräischen haben. In dieser Reform wurde das Schir Zion sozusagen zum Gesetzbuch des neuen Synagogalgesangs. Das Ergebnis der Reform führte zu (1) einem gehobenen sozialen Status des Kantors, (2) einem disziplinierten Verhalten im Gottesdienst (keine Schunkeleien), (3) einem schlichten, wenig exzessiven Vortragsstil, (4) einer stärkeren musikalischen Fähigkeit des chasan (Noten, Harmonielehre, Chorleitung) und (5) zur Anhebung der jüdischen Gelehrsamkeit (in der biblischen Sprache, in der Liturgie). Der polnische Schtetl-Stil wurde als orientalisch und slawisch abqualifiziert, da dort nur Emotion und Ausdruck im 120 Zentrum stünden, nicht aber der Text. Aufgrund so vieler Schnörkeleien sei kein genaues Metrum möglich. Nach 1850 schließlich setzte sich die Sulzer-Reform auch im Osten Europas langsam durch (durch die Schaffung der „Chorschul’“). Der Integrator Sulzer wurde letztlich von allen akzeptiert (Dombrowski 1991, 74–83). Nach dreißigjähriger Amtszeit erhielt Sulzer anlässlich des Pessachfestes des Jahres 5616 (das ist unser 1856) folgendes Schreiben von den Vertretern der jüdischen Kultusgemeinde in Wien (Wolf 1861, 56f.): Sehr geehrter Herr Sulzer! Mit dem diessjährigen Osterfeste sind dreissig Jahre vollbracht, innerhalb welcher Sie unausgesetzt Ihr eminentes Talent der Verkündigung des göttlichen Namens in unserer Gemeinde geweihet haben. Allen jetzigen und künftigen Sängern in Israel ein Vorbild, wird es unter uns stets gewürdiget bleiben, dass Sie den Dienst Gottes demjenigen der Welt vorzogen. Empfangen Sie unsern Glückwunsch, dass Sie der Versuchung dazu standhaft widerstanden haben und mögen Sie dafür reichen Segen an Kindern und Kindeskindern erschauen. Repräsentant Israels am Altare des Herrn, stellt sich in Ihnen selbst auch die weite Verbreitung seines Geschlechtes dar. Zerstreut leben die Ihrigen im Süden und Norden, im fernen Ost wie im entlegensten Westen unseres Erdballes; aber sie alle bringen Ihnen Ehre und Freude, so wie Ihr gefeierter Name ihnen zu Glück und Segen verhalf; – heute wie vor dreissig Jahren dringt Ihre klangvolle Stimme mit ungeschwächtem Zauber in die Herzenstiefen und noch lange nach uns werden die erhebenden Melodien Ihres Schir Zion die Gemüther zur Andacht stimmen. Wir freuen uns dessen aufrichtig und wünschen, dass Sie dieses Bewusstsein noch lange in ungeschwächtem Wirken erhalten möge. Musikbeispiele: Das Lied der Lieder (Jüdisches Museum Wien 1993). Einige Lieder Salomon Sulzers: „Ma towu“ („Wie schön sind ...“; oben erwähnt als „ma tobu“): Wie schön sind deine Zelte Jakob, deine Wohnstätten, Israel! Durch die Fülle deiner Gnade darf ich in dein Haus kommen, mich vor deiner heiligen Stätte bücken in Furcht vor dir! Ewiger, ich liebe die Stätte deines Hauses, den Ort, wo deine Ehre thront. Ich bücke mich, werfe mich nieder und knie vor dem Ewigen, meinem Schöpfer. Ich richte mein Gebet zu dir, Ewiger, zur Zeit des Wohlgefallens, Gott, in der Fülle deiner Gnade erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. „Emet“ („Wahrheit“): Das ist wahr und gewiß, daß du bist ihr Bildner, und kennst ihr innerstes Gebilde, wie sie nur Fleisch sind und Blut. Was ist der Mensch? Aus dem Staube der Erde ist er entsprossen, und im Staube löst er sich auf; setzt sein Leben daran, wie er sein täglich Brot gewinne; gleicht dem 121 Scherben, der gebrechlich ist; dem Grase, das verdorrt; der Blume, die verwelkt; dem wandelnden Schatten; der Wolke, die vorüberzieht; dem Wind der verweht; dem Stäubchen, das verfliegt, dem flatterhaften Traum, der verflogen ist. Im Vergleich mit den Aufnahmen der Sänger, die die Melodie nach den hebräischen Akzenten zur sparsamen Kithara singen, fällt deutlich auf, wie europäisiert Sulzers Mehrstimmigkeit anmutet, sehr stark assimiliert; ein gewisser Kulturverlust ist nicht zu leugnen. Gleichzeitig aber muss man festhalten, dass er sein Ziel erreicht hat: Die jüdischen Grundelemente dieser Musik sind bei aller Reform und Assimilierung mit der westlichen Kultur immer noch hörbar. So kann man doch abschließend sagen, dass die Biedermeierzeit in Wien sowohl für die Kirchenmusik wie auch für die Synagogenmusik – und für diese vor allem – eine ziemlich fruchtbare Zeit war, im politischen und gesellschaftlichen Sinne (besonders für die Juden) wohl aber doch nicht die sogenannte „gute, alte Zeit“, die wir zuweilen so gerne bemühen. Jedenfalls wird einmal mehr klar, dass das Studium musikhistorischer Fragen nicht nur die Musik betrifft, sondern auch viele gesellschaftliche Themen berührt – in unserem gegenständlichen Beispiel eben vor allem die soziologischen Gegebenheiten des Biedermeier im Zusammenhang mit der Musik, dem Habsburgerreich und der Wiener Gesellschaft und ihrer Haltung gegenüber dem Wiener Judentum. Literatur Altmann, Alexander: „The New Style of Preaching in Nineteenth Century German Jewry.“ Alexander Altmann (Hg.). Studies in Nineteenth-Century Jewish Intellectual History. Cambridge: Harvard University Press, 1964, 65–116. Avenary, Hanoch, Walter Pass und Nikolaus Vielmetti (Hg.): Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit: Eine Dokumentation. Sigmaringen: Thorbecke, 1985. Burmeister, Karl Heinz: „Hohenems zur Jugendzeit Salomon Sulzers.“ Purin 1991b, 26–37. Dombrowski, Thomas: „Der ‚Sulzer-Kantor‘ – ein Phänomen seiner Epoche.“ Purin 1991b, 74–83. Gradenwitz, Peter: „Jews in Austrian Music.“ Josef Fränkel (Hg.): The Jews of Austria. London: Vallentine, Mitchell & Co., 1967. Gradenwitz, Peter: Die Musikgeschichte Israels: Von den biblischen Anfängen bis zum modernen Staat. Kassel: Bärenreiter, 1961. Haïk-Vantoura, Suzanne: La musique de la Bible revélée: Notation millénnaire décryptée par Suzanne Haïk Vantoura. Audio-CD. Arles: Harmonia Mundi France, 2000 [1976]. 122 Hanson, Alice M.: Die zensurierte Muse: Musikleben im Wiener Biedermeier. Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 15. Graz: Böhlau, 1987. Honegger, Marc und Günther Massenkeil: Das große Lexikon der Musik. 8 Bde. Wien: Herder, 1978. Idelsohn, A. Z.: Jewish Music in Its Historical Development. 3. Aufl. New York: Schocken, 1975 [1929]. Jacobson, Joshua R. (Hg.): Franz Schubert: Tov lehodos. For SATB soli, Baritone Solo, and SATB Chorus a Cappella. New York: Broude, 1986. Jüdisches Museum Wien (Hg.): Das Lied der Lieder: Festgesänge des Wiener Stadttempels. Gesungen von Oberkantor Shmuel Barzilai. Audio-CD. Wien: ORF, 1993. Keller, Werner: Und wurden zerstreut unter alle Völker: Die nachbiblische Geschichte des jüdischen Volkes. Zürich: Droemer-Knaur, 1974. Kirchenmusik-Ordnung: Erklärendes Handbuch des musikalischen Gottesdienstes für Kapellmeister, Regenschori, Sänger und Tonkünstler. Wien: Wallishauser, 1828. Kobald, Karl: Alt-Wiener Musikstätten. Wien: Amalthea, 1929. Lichtenhahn, E.: „Biedermeier“. Marc Honegger und Günther Massenkeil (Hg.): Das große Lexikon der Musik. Bd 1. Wien: Herder, 1978, 276. Lilienblum, M. L.: „Aufstehen, heiraten!“. Ulf Diederichs, Otto M. Lilien und Germania Judaica (Hg.): Dein aschenes Haar Sulamith: Ostjüdische Geschichten. München: Diederichs, 1988, 312. Malm, William P.: Music Cultures of the Pacific, the Near East, and Asia. 2. Aufl. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977. Mandell, Eric: „Salomon Sulzer, 1804–1890.“ Josef Fränkel (Hg.): The Jews of Austria. London: Vallentine, Mitchell & Co., 1967, 221–229. Ottenberg, Hans-Günter: „Ludwig van Beethoven: Messe C-dur.“ Beiheft zur CD-Aufnahme des Monteverdi Choir und des Orchestre Révolutionnaire et Romantique, 1989. Hannover: Deutsche Grammophon Gesellschaft, 1992. Pass, Walter: „Der Liedkomponist und Liedinterpret Salomon Sulzer.“ Purin 1991b, 52–73. Pulzer, Peter G. J.: „The Development of Political Antisemitism in Austria.“ Josef Fränkel (Hg.): The Jews of Austria. London: Vallentine, Mitchell & Co., 1967, 429–443. Purin, Bernhard: „Die Levi-Sulzer: Geschichte einer jüdischen Familie in Vorarlberg.“ Purin, Bernhard (Red.): Salomon Sulzer: Kantor, Komponist, Reformer. Katalog zur Ausstellung des Landes Vorarlberg im Jüdischen Museum der Stadt Wien. Bregenz: Land Vorarlberg, 1991a, 16–25. Purin, Bernhard (Red.): Salomon Sulzer: Kantor, Komponist, Reformer. Katalog zur Ausstellung des Landes Vorarlberg im Jüdischen Museum der Stadt Wien. Bregenz: Land Vorarlberg, 1991b. Roth, Cecil, und Geoffrey Wigader (Hg.): Encyclopedia Judaica. 17 Bde. Jerusalem, Encyclopaedia Judaica, 1972. 123 Schilling, Konrad (Hg.): Monumenta Judaica: 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Köln: Metzler, 1963. Tänzer, Aron: Die Geschichte der Juden in Hohenems und im übrigen Vorarlberg. Bregenz: Lingenhöle, 1955 [1905]. Trollope, Frances: Vienna and the Austrians. 2 Bde. Paris: Baudry’s European Library, 1838. Tur-Sinai, N. H.: „Viennese Jewry.“ Josef Fränkel (Hg.). The Jews of Austria. London: Vallentine, Mitchell & Co., 1967, 311–318. Witeschnik, Alexander: Musik aus Wien. Basel: Desch, 1955. Wolf, Gerson: Geschichte der Juden in Wien (1156–1876). Wien: Alfred Hölder, 1876. Wolf, Gerson: Isak Noa Mannheimer. Wien: Knöpflmacher & Söhne, 1863. Wolf, Gerson: Vom ersten bis zum zweiten Tempel: Geschichte der israelitischen Cultusgemeinde in Wien (1820–1860). Wien: Braumüller, 1861. Abstract This study examines how the culture of Biedermeier Vienna influenced the development of the local Jewish synagogue. It portrays the persons who were then the driving force of a reform in which the synagogue reacted to the spirit of optimism at the time. Early 19th century Jews were aiming at accommodating to and advancing in society; this is also reflected in the use of music in the synagogue. The type of worship music used in the churches and the synagogue is also of special interest in this context, as are the roots of Jewish worship music. The traditions are old, their use varied, and the relationship of Christian sacral music to synagogue music is evident. Résumé Cette étude examine comment la culture de Vienne à l’époque de Biedermeier a influencé le développement de la synagogue locale. Elle présente les personnes qui étaient la force mouvante d’une réforme dans laquelle la synagogue a réagi à l’esprit d’optimisme de l’époque. Au début du 19e siècle, l’objectif des Juifs était de s’adapter et d’avancer dans la société. Cela est aussi présent dans l’utilisation de la musique dans la synagogue. Le type de musique de culte utilisé dans les églises et dans la synagogue est d’un intérêt particulier dans ce contexte, ainsi que les racines de la musique de culte juive. Les traditions sont anciennes, leur utilisation est variée, et la relation entre la musique sacrée chrétienne et la musique de la synagogue est évidente. Heinz Schaidinger, M.T., M.A., Mag. phil., Mag. phil., Dozent für Historische Theologie und Philosophie, Seminar Schloss Bogenhofen, Österreich E-Mail: [email protected] 124