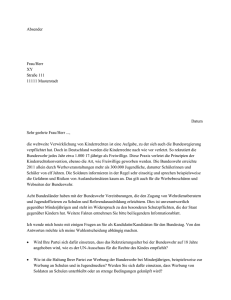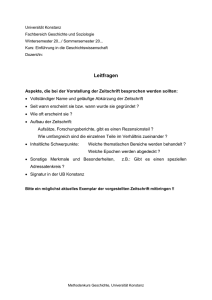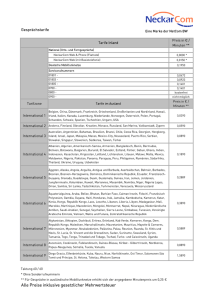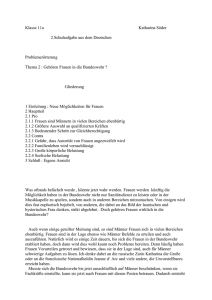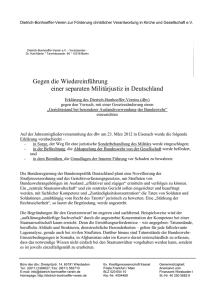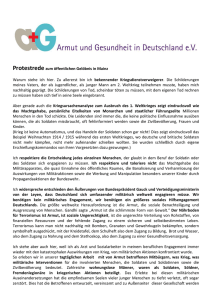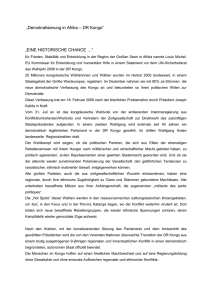1806: Zweierlei Untergang Frühe Kriegsberichterstattung Deutsche
Werbung

Heft 3/2006 ISSN 0940-4163 C 21234 Militärgeschichte im Bild: Generalleutnant Ulrich de Maizière (1912–2006) 1806: Zweierlei Untergang Frühe Kriegsberichterstattung Deutsche Interessen im Kongo »Kriegsmaler« Richard Hohly Impressum Editorial Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Oberst Dr. Hans Ehlert und Oberst i.G. Dr. Hans-Hubertus Mack (V.i.S.d.P.) Produktionsredakteur der aktuellen Ausgabe: Oberstleutnant Dr. Harald Potempa Redaktion: Oberleutnant Julian-André Finke M.A. (jf) Oberleutnant Matthias Nicklaus M.A. (mn) Oberstleutnant Dr. Harald Potempa (hp) Mag. phil. Michael Thomae (mt) Bildredaktion: Dipl.-Phil. Marina Sandig Redaktionsassistenz: Stefan Stahlberg, Cand. Phil. (StS) Lektorat: Dr. Aleksandar-S. Vuletić Layout/Grafik: Maurice Woynoski / Medienwerkstatt D. Lang Anschrift der Redaktion: Redaktion »Militärgeschichte« Militärgeschichtliches Forschungsamt Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam E-Mail: MGFARedaktionMilGeschichte@ bundeswehr.org Telefax: (03 31) 97 14 -507 Homepage: www.mgfa.de Manuskripte für die Militärgeschichte werden an diese Anschrift erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung, Übersetzung usw. Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich Kürzungen eingereichter Beiträge vor. Nachdrucke, auch auszugsweise, fotomechanische Wiedergabe und Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Redaktion und mit Quellenangaben erlaubt. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Die Redaktion hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte derjenigen Seiten, auf die in dieser Zeitschrift durch Angabe eines Link verwiesen wird. Deshalb übernimmt die Redaktion keine Verantwortung für die Inhalte aller durch Angabe einer Linkadresse in dieser Zeitschrift genannten Seiten und deren Unterseiten. Dieses gilt für alle ausgewählten und angebotenen Links und für alle Seiteninhalte, zu denen Links oder Banner führen. © 2006 für alle Beiträge beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) Sollten nicht in allen Fällen die Rechteinhaber ermittelt worden sein, bitten wir ggf. um Mitteilung. Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Am 14. Oktober vor 200 Jahren erlitt die preußisch-sächsische Armee bei Jena und Auerstedt eine vernichtende Niederlage gegen die napoleonischen Truppen. Staat und Heer in Preußen wurden daraufhin weitreichenden Reformen unterzogen, die mit den Namen Gneisenau, Scharnhorst und Clausewitz eng verbunden sind. Die »Preußischen Reformen« bilden seit Bestehen der Bundeswehr eine der drei Traditionslinien unserer Streitkräfte. Das Jahr 1806 bedeutete aber auch das Ende des seit 962 bestehenden Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die Entstehung der Königreiche Bayern, Württemberg und Sachsen sowie die Gründung des Rheinbundes (1806–1813). Diese Entwicklungen haben uns unter anderem bis zum heutigen Tage ein wichtiges Element hinterlassen: den Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Bis 1918 besaß auch die Militärverfassung des Deutschen Reiches föderative Elemente. Es blieben die Erinnerungen an ein kompliziertes Staatsgebilde und an ein einigendes Band zwischen den verschiedenen »deutschen Staaten«. Der erste Großbeitrag der vorliegenden Ausgabe der Zeitschrift Militärgeschichte informiert nicht nur grundsätzlich über das »Alte Reich«, sondern trägt auch insgesamt den Ereignissen des Jahres 1806 Rechnung. Bilder und Berichte über tagesaktuelle kriegerische Konflikte sind im Zeitalter der elektronischen Massenmedien allgegenwärtig. Wie entstehen solche Bilder und Berichte? Welche Bilder sollen oder, vor allem, dürfen gezeigt werden, welche nicht? Der Artikel »No dead bodies« von Klaus-Jürgen Bremm nimmt diese aktuelle Frage auf, indem er über die Anfänge der Kriegsberichterstattung im 19. Jahrhundert informiert. Einen aktuellen Bezug zum weltpolitischen Geschehen hat auch der Artikel »Deutsche Interessen im Kongo« von Wolfgang Petter, der sich ebenfalls auf das 19. Jahrhundert bezieht. Nicht zuletzt der derzeitige Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten zur Absicherung der Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo hat die ehemalige belgische Kolonie und deren Geschichte auch hierzulande ins öffentliche Blickfeld gerückt. Mit der Überschrift »Russland zu sympathisch gesehen, propagandistisch nicht verwertbar«, wurden die Skizzen und Bilder des »Kriegsmalers« Richard Hohly von der Wehrmacht versehen. Dem Leben und Wirken dieses ungewöhnlichen Künstlers widmet sich der Großbeitrag von Eberhard Birk. Ein Wort in eigener Sache: Der uniformierte Teil der Redaktion Militärgeschichte ist durch das Ausscheiden von Heiner Bröckermann inzwischen eine reine »Air-Force-Crew« geworden. Sie bemüht sich allerdings, nicht abzuheben. Ich wünsche Ihnen viel Genuss bei der Lektüre des dritten Heftes 2006. Dr. phil. Harald Potempa Oberstleutnant Inhalt Zweierlei Untergang: Der Zusammenbruch des Alten Reichs (962–1806) und des alten Preußen im Jahre 1806 4 Das historische Stichwort: Ungarn 1956 22 Dr. Martin Rink, geboren 1966 in Kaufbeuren/ Allgäu, Historiker; Dr. Harald Potempa, geboren 1963 in Dorfen, Landkreis Erding/Oberbayern, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am MGFA No dead bodies! Der moderne Krieg und die Anfänge der Kriegsberichterstattung Service 10 Medien online/digital 24 Lesetipp 26 Ausstellungen 28 Geschichte kompakt 30 Militärgeschichte im Bild General Ulrich de Maizière (1912–2006) 31 Dr. Klaus-Jürgen Bremm, geboren 1958 in Duisburg, Oberstleutnant d.R., Lehrbeauftragter für Neuere Geschichte an der Universität Osnabrück Deutsche Interessen im Kongo 14 Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Ulrich de Maizière (links), im Gespräch mit Bundesminister der Verteidigung Kai-Uwe von Hassel und Bundeskanzler Ludwig Erhard anlässlich des Besuches der Heeresunteroffizierschule, ca. 1965. Dr. Wolfgang Petter, geboren 1942 in Erlangen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am MGFA, Potsdam Foto: Bundesregierung/Egon Steiner »Russland zu sympathisch gesehen, propagandistisch nicht verwertbar«. Der »Kriegsmaler« Richard Hohly Dr. Eberhard Birk, geboren 1967 in Heilbronn, Dozent an der Offizierschule der Luftwaffe Fürstenfeldbruck 18 Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Major Heiner Bröckermann M.A., MGFA; Studienreferendar Christian Bunnenberg, Münster; Wiss. Oberrat Dr. Bernhard Chiari, MGFA; Oberstleutnant Dr. Helmut R. Hammerich, MGFA; Oberstleutnant Dr. Dieter H. Kollmer, MGFA; Hauptmann Marcus von Salisch, MGFA; Leiter Abteilung Forschung (komm.) MGFA Dr. Bruno Thoß Zweierlei Untergang Der Zusammenbruch des Alten Reichs (962–1806) und des alten Preußen im Jahre 1806 agk-images Franz II. (1768–1835), der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Gemälde, vor 1806, von Joseph Kreutzinger (1757–1825). 1806–2006: Aspekte eines Jubiläums agk-images/Erich Lessing Napoleon Bonaparte (1769–1821) stand am Anfang der Neuordnung Deutschlands. Seine Siege zertrümmerten die hergebrachte Ordnung. Ölstudie, 1799, von Jacques-Louis David (1748–1825). 4 2006 jährt sich zum 200. Mal die Schlacht bei Jena und Auerstedt. Am 14. Oktober 1806 erlitten die preußischen Truppen eine vernichtende Niederlage gegen die Truppen Napoleons I. Im selben Jahr fand aber auch das »Heilige Römische Reich deutscher Nation« , auch »Altes Reich« genannt, ein eher unrühmliches Ende. Am 6. August 1806 legte Kaiser Franz II. die deutsche Kaiserkrone nieder. So endete ein Staatsgebilde, das bereits im 17. Jahrhundert als »Monstrum« bezeichnet worden war. Weder war es Bundesstaat noch Staatenbund, weder Monarchie noch Aristokratie noch Demokratie – vielmehr war es von allem ein wenig. »Das Reich« umfasste im Revolutionsjahr 1789 nicht weniger als 299 mehr oder weniger faktisch souveräne Reichsstände, be- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 ginnend mit den Kurfürstentümern bis hin zu Reichsstädten und Reichsdörfern, besonders in Schwaben und Franken. Hinzu kamen 1475 Reichsritterschaften. Sie alle waren nur dem Kaiser untertan, sie alle hatten ihren Beitrag zur Reichsarmee zu leisten, die nur im Kriegsfall aufgestellt wurde. Ein »Deutsches« Reich war dies nicht wirklich: Bis 1806 gehörten auch Tschechen, Slowenen, Wallonen und Flamen dazu. Über Jahrhunderte gab es italienische, schweizerische, burgundische, lothringische und niederländische Teile des Reiches. Der Verweis auf das »Heilige« und »Römische« deutete darauf hin, dass der Kaiser mit universalem Anspruch auftrat. Das nationale französische Kaisertum des 19. Jahrhunderts widersprach dieser Reichsidee grundlegend. Napoleon Bonaparte nutzte ab 1799 die Chance der inneren Erneuerung Frankreichs. Seine Krönung zum »Kaiser der agk-images Die Goldene Bulle Kaiser Karl IV. von 1356 bildete ein wichtiges Grundgesetz des Reiches für die nächsten 450 Jahre. Franzosen« 1804 bedeutete einen »modernen« Legitimitätsanspruch: Er war der »Retter« der Nation, die ihm zum Kaiser erhob. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, nach den Siegen von Ulm, Austerlitz und Jena 1805/06, verkörperte der Korse nicht nur gleichsam den »Kriegsgott selbst« (Clausewitz), sondern ordnete auch Deutschland neu. Demgegenüber wirkte das Alte Reich überlebt. Seine großen Territorialmächte, allen voran Österreich und Preußen, hatten sich längst verselbständigt. »Deutsche Stämme« als untaugliche Kategorie: Goldene Bulle 1356 für das Amt des Kaisers aufzustellen und zu wählen. Die im Jahr 1356 erlassene Goldene Bulle Kaiser Karls IV. gab die Antwort für die nächsten 450 Jahre. Sieben Kurfürsten wurden per Reichsgesetz definiert, die zur Wahl des Kaisers berechtigt waren. Statt der Stammesherzöge waren dies nun drei geistliche Würdenträger: die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier. – sowie vier weltliche Herrscher: der König von Böhmen (der einzige dieses Ranges), der Pfalzgraf bei Rhein (Kurfürst von der Pfalz), die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen. 300 Jahre später kamen Bayern (1623/28) und Hannover (1692) als Kurfürstentümer dazu. Die alten Stammesherzogtümer waren verkleinert und verändert worden. Der Aufbau von Landesherrschaft und künftiger Großmächte geschah in den Markgrafschaften, so etwa in der Mark Brandenburg (Preußen) und der »ostwärtigen Mark« (Österreich). Der deutsche König wurde auf Lebenszeit gewählt, der Titel war nicht erblich. Erst die Weihe durch den Papst verlieh dem deutschen König die Kaiserwürde. Den Kurfürsten mussten jeweils Wahlversprechen in Form von Rechten, Ländereien oder schlicht Geld gemacht werden. Seit Maximilian I. nannte sich er neugewählte König auch »Erwählter Römischer Kaiser«, die Krönung durch den Papst entfiel fortan – von einer Ausnahme (Karl. V) abgesehen. Tatsächlich war die Kaiserwürde von 1438 bis 1806 fast durchgängig fest in den Händen der habsburgischen (Erz-)Herzöge von Österreich, die ab 1526 gleichzeitig Könige von Böhmen waren. Als Erben des größten Territorialbesitzes verfügten die Habsburger über eine Hausmacht, die sie mit den Mitteln versah, die Königswahl der Kurfürsten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Allerdings war es einigen von ihnen gelungen, eine Standeserhöhung zu erlangen, was zunächst nur außerhalb des Reichsgebietes möglich war: So trugen zeitweise der sächsische Kurfürst die polnische, der hannoversche ab dem 18. Jahrhundert die englische Königskrone; seit 1701 kam der brandenburgische Kurfürst als »König in Preußen« dazu. Auch benachbarte Groß- oder Regionalmächte wie Frankreich, Schweden und Dänemark spielten ihre Rolle im Reich, da sie in Personalunion ihrer Herrscher über Reichsterritorien verfügten und deshalb in den Reichsgremien unmittelbar ihre Interessen vertreten konnten – natürlich auch bei der Kaiserwahl. Die Sieben Kurfürsten vor dem Kaiserthron. Links die drei geistlichen, rechts die vier weltlichen Kurfürsten. Kolorierter Holzschnitt aus H. Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg 1493; Sign. Inc. 119, fol. 183 v, 184 r, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar, Stiftung Weimarer Klassik. agk-images An der Spitze des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation stand der Kaiser. Mit der Krönung Ottos I. 962 war bewusst an den Frankenkönig Karl den Großen und dessen Anspruch als Erneuerer des (west-)römischen Kaiserreiches angeknüpft worden. Karl hatte sich 800 von Papst Leo III. zum Römischen Kaiser krönen lassen. Neben dem burgundischen und dem italienischen Teil bestand das Reich aus den Stammesherzogtümern Bayern, Franken, Sachsen, Schwaben und Thüringen. Im 13. und 14. Jahrhundert setzten die Schwächung der Zentralgewalt und die Stärkung der Regionalgewalten ein. Die königslose Zeit, aber auch das Auftreten von König und Gegenkönig warfen die Frage auf, wer denn berechtigt sei, einen Kandidaten Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 5 Zweierlei Untergang »Abgeordnete«, Geld und Militär Entscheidungen wurden auf den Reichstagen getroffen. Sie bildeten eine (un-)regelmäßige Versammlung aller Reichsstände in Anwesenheit des Kaisers, deren Beschlüsse man in den »Reichsabschieden« schriftlich niederlegte. Im Gegensatz zu modernen Parlamenten waren die Teilnehmer der Reichstage ebenso wenig vom Volk gewählt wie die Ständevertretungen (Kirche, Adel, Bürger) in den einzelnen Reichsständen. Dies war kein deutsches Phänomen, sondern galt in ganz Europa. Dennoch hat der moderne Parlamentarismus seine Vorläufer in den Ständevertretungen. Die Reichstage wurden bei Bedarf abgehalten, u.a. in den (Reichs-)Städten Augsburg, Nürnberg, Frankfurt a.M., Regensburg, Speyer und Worms. Der Reichstag zu Worms 1495 schuf die organisatorische Zwischenebene der »Reichskreise«. Es gab ihrer zehn, sie waren regional organisiert und hatten in ihrem Bereich Beschlüsse des Reichstages durchzusetzen, u.a. das Steueraufkommen zu organisieren. Sie waren aber auch für die Aufstellung der Kontingente der Reichsarmee im Kriegsfall zuständig. Die Reichsstände hatten die aufgebo- tene Armee zu bezahlen, denn ein Stehendes Reichsheer existierte nicht. Der Landfrieden wurde durch die Reichskreise garantiert. Der Wormser Reichstag von 1521 präzisierte den Umfang und die Leistungen an die Reichsarmee. Diese bestand aus 20 000 Mann Infanterie und 4000 Mann Kavallerie. Die Reichsstände hatten gemäß einer festen Quote entweder Soldaten und Pferde oder aber das Geld für deren Anwerbung und Unterhalt aufzubringen. Der Augsburger Reichstag von 1555, abgehalten unter dem Eindruck der Reformation und des Bauernkrieges in Deutschland, präzisierte die Kreiseinteilung und legte die militärischen Rechte und Pflichten der Mitglieder bezüglich Zahlung und Oberbefehl fest. Auch verstärkte er die Rolle der Reichskreise bei »Reichsexekutionen«, also militärischen Unternehmen einzelner Reichsstände in kaiserlichem Auftrag gegen sich widersetzende Reichsstände. 1681: Reichsheer und Stehende Heere Die »Reichsdefensionalordnung« (Reichsverteidigungsordnung) von 1681 fußte auf zwei Reichsgutachten zur »öffentlichen Sicherheit« und bilde- Der Reichstag als die Versammlung der Reichsstände unter Vorsitz des Kaisers, hier ein Reichstag zu Regensburg unter Ferdinand I. Radierung von Jost Amman (1539–1591). agk-images 6 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 te bis 1806 die Reichskriegsverfassung. Maßgebend waren dabei der Osnabrücker Friedensvertrag von 1648 (also der eine Teil des Westfälischen Friedens) und der sogenannte Jüngste Reichsabschied von 1654. Mit dem Jahr 1681 erfuhr die Organisation der Reichstage eine grundlegende Veränderung. Nun erfolgte in Regensburg die Einrichtung eines dauernden Gesandtenkongresses der Reichsstände, der als »Immerwährender Reichstag« bezeichnet wurde. Das Heeresaufkommen im Kriegsfall wurde von 20 000 Mann auf 40 000 Mann (28 000 Mann Infanterie und 12 000 Mann Kavallerie) erhöht. Diese Truppenstärke bildete das »Simplum«, das bei Bedarf verdoppelt, verdreifacht oder gar vervierfacht werden konnte. Verantwortlich für die Kreiskasse waren die jeweiligen Kreisobristen der Reichskreise. Die Landesherren hatten von nun an die Möglichkeit, Stehende Heere zu unterhalten, d.h. Armeen, die auch im Frieden bestanden. Dazu wurden von den Ständen des Landes Steuern erhoben. Bislang waren Armeen nach Kriegsende aufgelöst oder abgemustert worden. Größere Reichsstände machten von dieser Möglichkeit ohne Zögern Gebrauch. So entwickelten sich Stehende Heere etwa in Brandenburg (ab 1644), in Bayern (ab 1682) und Sachsen (ab 1682). Die Reichsarmee blieb dagegen ein Kontingentheer. Sie wurde nur im Kriegsfall aktiviert, war also kein Stehendes Heer. Im Verlauf des 17. Jahrhunderts erwarben sich die Herrscher der größeren Reichsterritorien mit ihren Stehenden Heeren das Instrument, welches ihnen letztlich die Durchsetzungsfähigkeit innerhalb des Reiches (teils mit Ausstrahlung darüber hinaus) sowie die zunehmende tatsächliche Souveränität innerhalb ihrer Territorien ermöglichte. Zudem erforderte die Aufrechterhaltung stehender Truppen, ihrer Ausrüstung, Personalergänzung, Unterbringung, Verpflegung und regelmäßigen Entlohnung den Aufbau eines zunehmend umfassender werdenden Staats- und Beamtenapparates. Die größeren Reichsfürsten gaben hier das Tempo vor. Der strafferen Staatsorganisation der frühneuzeitlichen Groß- und Regionalmächte entsprach die straffer werdende Disziplin ihrer Heere. Bei Ausbildung und Gefecht kam nun zu dem bekannten Soll-Zusammensetzung der Reichsarmee gemäß Reichsdefensionalordnung Österreichischer Kreis Burgundischer Kreis Kurrheinischer Kreis Fränkischer Kreis Bayrischer Kreis Schwäbischer Kreis Oberrheinischer Kreis Niederrheinisch-Westfälischer Kreis Obersächsischer Kreis Niedersächsischer Kreis Summe Exerzieren geschlossener Formationen die Aufgabe hinzu, Marsch, Bewegung, Ladetätigkeiten und Schussfolge zu koordinieren. Das allgegenwärtige Rezept lautete: Drill. Zum buchstäblichen Paradebeispiel hierzu avancierte der ehemalige Außenseiter Preußen im späten 17. und im 18. Jahrhundert. Reichskriegsherr war der Kaiser, die Armee unterstand dem Reichsgeneralfeldmarschall. Ihm waren ein Reichsgeneralfeldmarschallleutnant, ein Reichsgeneralfeldzeugmeister (Artillerie und Pioniere), ein Reichsgeneral der Kavallerie und ein Reichsgeneralwachtmeister unterstellt. Aufgrund des im Westfälischen Frieden fixierten Religionskompromisses mussten diese Funktionen paritätisch mit evangelischen und katholischen Amtsinhabern besetzt werden. Nur ein einziges Mal, 1707, konnte man sich ohne Komplikationen auf einen Oberbefehlshaber einigen: den überall geachteten Prinzen Eugen von Savoyen als Reichsgeneralfeldmarschall. Kavallerie 2 522 1 321 600 980 800 1 321 491 1 321 1 322 1 322 12 000 Infanterie 5 507 2 708 2 707 1 902 1 494 2 707 2 853 2 708 2 707 2 707 28 000 Bewährung oder Scheitern in der Praxis? 1682–1805 Die Reichsarmee wurde bei Reichskriegen und Reichsexekutionen eingesetzt, so 1674 im Französisch-Niederländischen Krieg, in den Türkenkriegen ab 1683, im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689, ab 1702 im Spanischen Erbfolgekrieg, 1734 im Polnischen Erbfolgekrieg, im Österreichischen Erbfolgekrieg (1740– 1748), im Siebenjährigen Krieg (1756– 1763) gegen Preußen und in den Revolutionskriegen gegen Frankreich ab 1793. Soll- und Ist-Stärke der Truppe wichen dabei immer voneinander ab. Die Ist-Stärke betrug: 1658 10 000 Mann 1686 40 000 Mann 1691 19 000 Mann 1700 14 000 Mann 1702 44 000 Mann 1795 42 400 Mann Diese Schwankungen sind ein deutlicher Beleg dafür, dass es mit der Souveränität des Reiches nicht zum Besten bestellt war. Zum Mentekel für die Reichsarmee geriet die Schlacht bei Roßbach am 5. November 1757, wo sie ruhmlos durch den preußischen »Reichsfeind« Friedrich II. zerschlagen wurde; offenkundig führte der Versuch dieser Reichsexekution zur weiteren moralischen Unterminierung des Rei- Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) im Feld. Er war u.a. Reichsgeneralfeldmarschall und damit Oberbefehlshaber der Reichsarmee. Gemälde von Pietro Longhi (1702–1785). agk-images/cameraphoto ches. Dennoch – trotz aller Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung, der Anwerbung, dem Oberbefehl, der Koalitionskriegführung und vieler anderer Dinge – bildete die Reichsarmee noch immer einen Ordnungsfaktor und zugleich militärisches Potential. Preußen: Aufstieg im Reich – Ausstieg aus dem Reich? Preußen konnte sich im späten 17. Jahrhundert zur Regionalmacht, im 18. Jahrhundert zur Militärmacht und schließlich mit dem geglückten Risikospiel Friedrichs II. zur europäischen Großmacht aufschwingen. Der Schlüssel zum Erfolg lag nicht im Prinzip »Abstimmung und Koordination« mit europäischen Mächten, mit dem Reich und inmitten der eigenen Gebiete. Den Erfolg erzielten die Hohenzollernkurfürsten und -könige durch eine maximale Steigerung der innerstaatlichen Effizienz. Erst durch Vereinheitlichung von Verwaltung, Steuerwesen und Armee wurde aus ihren Herrschaftsgebieten ein preußischer Staat – im Singular. Freilich war das auch in Preußen ein langer Prozess, der erst mit den preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts seinen Abschluss fand. Das auf vielfältigen Ebenen auf dem Prinzip einer ausgewogenen Abstimmung zwischen den politischen Akteuren basierende Reich wurde letztlich durch die rigorose Kräftebündelung innerhalb der größeren Territorialstaaten unterminiert. Preußen schritt hier voran. In den Kriegen zwischen 1740 und 1763 forderte es die drei bisherigen Ordnungsfaktoren Kaiser, Reich und europäische Garantiemächte erfolgreich heraus. In der Schlacht bei Roßbach am 5. November 1757 wurde die militärische Ohnmacht des Reiches demonstrativ zur Schau gestellt und die mit der französischen Armee verbündete Reichsarmee regelrecht niedergeritten. Unter den 10 500 Verlusten der Schlacht befanden sich nur 500 Preußen. Was von deren Gegnern noch übrig war, zerstob in wilder Flucht. Das Bild der Reichsarmee als »Reißaus-Armee« wirkte sehr nachdrücklich und verband sich mit einem preußischen Mythos, der vor allem in Norddeutschland und in der Tradition der preußisch-deutschen Armee wirksam blieb. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 7 Zweierlei Untergang agk-images Am 5. November 1757 siegte König Friedrich II (1712 + 1786) bei Roßbach über die Reichsarmee und die französische Armee. Kupferstich, 1801, von Johann Friedrich Bolt (1769–1836). Unabhängig vom Reich und zum Teil eben gegen das Reich war spätestens nach dem Siebenjährigen Krieg (1756– 1763) Preußens Aufstieg zur europäischen Großmacht geglückt – wenn auch auf Abruf. Friedrich II. verkörperte geradezu den aufgeklärten Absolutismus: Als »erster Diener seines Staates« entsprach er dem neuen Ideal des durch Leistung legitimierten Monarchen. Nicht prunkvolle Schlösser und Hofzeremoniell bildeten den Kristallisationspunkt seiner Herrschaft, sondern die Bürokratie und vor allem das stehende, gedrillte und meist siegreiche Heer. Neben persönlichen Fähigkeiten, rücksichtslosen Ambitionen und purem Glück lag der Grund für Friedrichs Erfolg in einem höheren Grad der inneren Kohäsion seines Territoriums. Der absolutistische Staat setzte sich gegen das ältere Modell des Ständestaats durch. In allen größeren Reichsterritorien vollzogen sich eine Fülle von Reformen in der Binnenorganisation: in Verwaltung, Heer und Bildungswesen. Damit wurden althergebrachte ständische Rechte nach und nach zurückgedrängt. Ende und Anfang: 1806 und die »Deutsche Frage« Mit der Französischen Revolution 1789 vollzog sich ein grundlegender Wandel. Viele Projekte der Reformabsolutisten wurden von der französischen Regierung und ab 1799 von Napoleon umge- 8 setzt. Zugleich aber wurde die Nation als Trägerin des Staates begriffen und die Bevölkerung für die Armee mobilisiert, um die revolutionären Errungenschaften zu sichern. Dem zunehmend ausgehöhlten und von starken Einzelterritorien durchsetzten Reich war nun ein Nachbar entstanden, dessen administrative und militärische Effizienz an der Spitze der Möglichkeiten der Zeit stand; dies alles gepaart mit einem Machtwillen, dem nichts Gleichwertiges gegenüberstand. Das Deutschland links des Rheins fiel mit dem Frieden von Lunéville 1801 an Frankreich. Zusammen mit dem »Reichsdeputationshauptschluss« von 1803 bedeutete dies das Ende vieler weltlicher und aller geistlichen Reichsstände. Die weltlichen Fürsten links des Rheins wurden territorial entschädigt oder entschädigten sich selbst auf Kosten der geistlichen Reichsstände. Im Inneren dieser Staaten begann mit der Säkularisierung der Sturm auf die Besitzungen der Kirchen und Klöster; im Reich wurden Reichsklöster und Hochstifte »verstaatlicht«. Während der folgenden Jahre erfolgte die »Mediatisierung« der meisten Reichsstädte, Reichsritterschaften und Reichsdörfer, also deren Einverleibung durch die Flächenstaaten. Der vielzitierte »Fleckenteppich« des Reiches war durch den verlorenen Krieg des Reiches gegen Frankreich »bereinigt« worden. Mit der Auflösung der Reichsstände war ein wichtiger Teil der traditionellen Hausmacht des Kaisers vernichtet worden. Langfristig profi- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 tierten davon sowohl Frankreich als auch die »modernen« deutschen Staaten. Auf dem Höhepunkt napoleonischer Macht zerbrach jedoch nicht nur das Alte Reich, sondern auch das alte Preußen. Es hatte sich am rücksichtslosesten auf Kosten des Reichs profiliert. Nun steuerte es sich in einen militärischen Konflikt hinein, den es nur zertrümmert überlebte. Aus dem ersten Koalitionskrieg (1792–1797) war Preußen 1795 mit dem Frieden von Basel vorzeitig ausgeschert. Mit der Zusicherung der Rheingrenze an Frankreich konnte sich Preußen sogar nun der Aufteilung Polens widmen und damit sein Territorium erheblich erweitern. Mit dem Ausgreifen Frankreichs über den Rhein, besonders der Besetzung Kur-Hannovers und der preußischen Gebiete Ansbach-Bayreuth einerseits, dem preußischen Schwanken zwischen Frankreich und der Koalition andererseits verspielte es jedoch bald jede Glaubwürdigkeit. Nachdem sich der russische Zar im Herbst 1805 lange persönlich, aber vergeblich um ein preußisch-russisches Bündnis bemüht hatte, zog er an der Seite Österreichs in den Krieg, der am 2. Dezember 1805 mit der Niederlage von Austerlitz endete. Der Friede von Preßburg läutete 1805 die letzte Runde des Alten Reiches ein. Am 1. Januar 1806 wurden Bayern und Württemberg durch Napoleons Gnaden zu Königreichen erhoben. Sie und 14 andere Reichsstände erklärten die Zugehörigkeit zum Reich für beendet und gründeten am 12. Juli 1806 den an Frankreich angelehnten »Rheinbund«. Ihm schlossen sich bis 1808 insgesamt 20 weitere deutsche Staaten an. Wie im Alten Reich existierte auch im Rheinbund eine Kontingentsarmee. Sie umfasste nun 63 000 Mann, die sich aus den einzelnen Armeen speisten, und sie hatte für die napoleonischen Feldzüge Truppen zu stellen. Ausbildung, Einsatz, Kriegsverfassung und Anfänge einer allgemeinen Wehrpflicht orientierten sich am französischen Vorbild. Nur Österreich, Preußen, Hessen und Braunschweig traten dem Rheinbund nicht bei, waren aber zeitweilig Verbündete Frankreichs. Auf ein Ultimatum Napoleons hin legte der letzte »deutsche« Kaiser am 6. August 1806 die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nie- der, die Geschichte des Reiches war beendet. Das Jahr 1805 brachte Preußen Vorteile: Im Frieden von Schönbrunn sicherte es sich die Inbesitznahme Hannovers im Tausch gegen die fränkischen Gebiete. Nie zuvor hatte Preußens Territorium eine solche Ausdehnung erreicht. Umso tiefer war dann der Fall: Preußen musste sich entscheiden. Es führte einerseits Geheimverhandlungen mit dem russischen Zarenhof, andererseits gab es französische Gebietsübertretungen nach Westfalen. Das Misstrauen zwischen Frankreich und Preußen eskalierte in einen von beiden letztlich nicht gewollten Krieg. Am 14. Oktober 1806 wurde die preußische Armee in zwei Schlachten bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen. Im Frieden von Tilsit 1807 wurde Preußens Beute aus den polnischen Teilungen als Großherzogtum Warschau, das gesamte Gebiet westlich der Elbe zusammen mit Braunschweig und Kurhessen als »Königreich Westfalen« abgetrennt. Dazu kam eine riesige Summe an Entschädigungen, die Armee wurde um 80 Prozent reduziert. Die bittere Niederlage wurde erst sechs Jahre später und nur mit russischer Hilfe in den »Befreiungskriegen« überwunden. Sie blieb eine schwärende Wunde im preußischen kollektiven Bewusstsein. Sie war Anstoß für die grundlegende Reform von Militär- und Staatswesen 1807–1813, bildete aber auch den Anknüpfungspunkt für einen preußisch-deutschen Revanchismus, der bis ins 20. Jahrhundert hineinwirkte. Ende und Anfang: bleibende Wirkungen Mit dem Untergang des Alten Reiches ging für Gesamtdeutschland in staatsrechtlicher Hinsicht das »einigende« Band verloren. Die »deutschen« Staaten waren nunmehr vollständig souverän geworden, was im Wiener Kongress 1814/15 auch bestätigt wurde. Der von 1815 bis 1866 existierende Deutsche Bund bildete einen Staatenbund unter letztlich österreichischer Führung, auch er kannte Kontingentstreitkräfte. In der Revolution 1848/49 wurde der (erfolglose) Versuch einer demokratischen Einigung »von unten« gewagt. Während der Einigungskriege 1864, 1866 und 1870/71 wurde die deutsche Frage mit der militärischen Lösung »von oben« beantwortet; Österreich war staatsrechtlich ausgeschlossen. Reste der deutschen Pluralität blieben im Militärwesen des Kaiserreichs ab 1871 erhalten: Bis 1918 existierte eine Kontingentarmee aus preußischen, bayerischen, württembergischen und sächsischen Truppen. Das Alte Reich erlag also letztlich den »modernen« Territorialstaaten wie dem aufkommenden Nationalgefühl. Dennoch erwies es sich trotz großer Schwächen als äußerst langlebig. Es war fast 850 Jahre Bezugspunkt der Politik in Europa, in Deutschland und in den deutschen Einzelterritorien gewesen. Der Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland ist ohne einen Blick auf dieses Reich schwer verständlich. Gleichwohl hat auch die Zerschlagung des Reiches Spuren hinterlassen. Die Grenzen der heutigen Bundesländer, der Regierungsbezirke und andere Verwaltungsgrenzen sind oft solche, die im Zuge der Säkularisierung und Mediatisierung entstanden sind. Das oft komplex wirkende Aushandeln von Interessen durch die betroffenen Gebietskörperschaften, Verbände und berufliche Standesvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland heute erinnert an Mechanismen, die eher dem Verfahrensweisen im Alten Reich ähneln als dem Ideal des bürokratisch-absolutistischen Staates des 19. Jahrhunderts. Gleiches gilt für die Verfahrensweisen im militärischen Aufgabenspektrum des angebrochenen 21. Jahrhunderts: Oft ist hier ein hochkomplexes Gefüge zwischen verbündeten Kontingenten, Teilstreitkräften, zivilen Regierungsstellen und Nichtregierungsorganisationen zu berücksichtigen. Das Alte Reich ist tot, doch Spuren seiner Geschichte sind nach wie vor lebendig. Martin Rink und Harald Potempa Literaturtipps: agk-images In der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt (hier: Jena) wurde die sächsischpreußische Armee am 14. Oktober 1806 von Napoleon vernichtend geschlagen. Zeitgen. Lithographie. Axel Gotthard, Das Alte Reich 1495–1806, Darmstadt 2003 Peter Claus Hartmann, Das Heilige Römische Reich deutscher Nation in der Neuzeit 1486–1806, Stuttgart 2005 Barbara Stollberg-Rilinger, Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Vom Ende des Mittelalters bis 1806, München 2006 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 9 No dead bodies! Der moderne Krieg und die Anfänge der Kriegsberichterstattung No dead bodies! 1855 im Krimkrieg: eine Gruppe britischer Soldaten des 47. (Lancashire) Infanterieregiments in Winterausrüstung, fotografiert von Roger Fenton. D er Krimkrieg von 1853 bis 1856 gilt als erster militärischer Konflikt des Industriezeitalters. Dampfbetriebene Kriegsschiffe, weitreichende Gewehre und Geschütze mit Sprengmunition bestimmten seinen Verlauf. Modern an der Auseinandersetzung zwischen dem zaristischen Russland und den mit dem Osmanischen Reich verbündeten Westmächten Frankreich und Großbritannien war allerdings auch, dass die Öffentlichkeit in London und Paris erstmals zeitnah Nachrichten von der Front erhielt. Telegrafie und Fotografie bedienten im Zeitalter der Massenheere und des aufkommenden Nationalismus ein stetig wachsendes Interesse der Öffentlichkeit an der Kriegführung. Zu Hause wollte man nun wissen, wie es um die Söhne und Ehemänner im Felde stand. Kriegsberichterstatter auf der Krim Noch zu Beginn des Jahrhunderts hatte Arthur Wellesley, der Herzog von Wellington (1769–1852), befürchtet, der Feind könne aus der Presse Informationen über Stärke und Position seiner Armee gewinnen. Die Anwesenheit von Kriegsberichterstattern auf der Krim hätte jedoch auch der »Eiserne Herzog« kaum verhindern können. Der Bekannteste von ihnen war der Ire 10 akg-images/Roger Fenton William Howard Russell (1821–1907), der im Auftrag der Londoner Tageszeitung The Times schrieb. Seine Berichte von den untragbaren Zuständen auf der umkämpften Halbinsel Krim im Winter 1854/55 sorgten in London für ein ungeahntes Aufsehen. Militärische Inkompetenz hatte zu schlechter Verpflegung, haarsträubenden hygienischen Verhältnissen und extrem hohen Krankenständen geführt. Auf den harten Winter vor der belagerten Festung Sewastopol war die britische Armee kaum vorbereitet. Als die Details in London bekannt wurden, richtete das Unterhaus nach heftigen Debatten einen Untersuchungsausschuss ein und Ende Januar 1855 wurde schließlich eine neue Regierung ernannt. Dank der Berichte Russells und anderer Korrespondenten war der Krieg nicht mehr länger eine Angelegenheit ausschließlich der Armee, des Kriegsministeriums und des Kabinetts, sondern Sache der ganzen Nation geworden. Dass Russell seine Berichte noch auf dem Seeweg nach London schickte, wo sie erst zwei oder drei Wochen später eintrafen, minderte kaum ihre Wirkung. Auch als die Telegrafenverbindung von der Krim nach Großbritannien im Frühjahr 1855 endlich zustande kam, verließ sich Russel weiter auf den traditionellen Postweg, der es ihm erlaubte, ausführlichere Berichte zu schicken. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Eine Steigerung des Realismus in der jungen Kriegsberichterstattung versprach eine weitere technische Neuentwicklung: die Fotografie. Alexander Gardner (1821–1882), der bekannte Fotograf des Amerikanischen Bürgerkrieges, glaubte sogar, dass im Vergleich zu den sprachlichen Beschreibungen des Kriegsgeschehens die fotografischen Wiedergaben von der Nachwelt mit »zweifelsfreiem Vertrauen« aufgenommen würden. Vorerst erforderte die Technik jedoch noch eine minutenlange Belichtung, so dass bewegte Szenen und besonders Kampfaufnahmen sich nach wie vor der fotografischen Abbildung entzogen. Unter den ersten 15 Kriegsfotografen auf der Krim machte besonders der Brite Roger Fenton (1819–1869) von sich reden. Seine 360 Fotografien vom Geschehen vor Sewastopol fanden in Großbritannien die weiteste Verbreitung und prägten nachdrücklicher als jede Berichterstattung die Vorstellungen seiner Landsleute vom Krimkrieg. Doch die auf Glasplatten festgehaltenen Aufnahmen des ehemaligen Malers hatten wenig mit den Realitäten im Kampfgebiet zu tun. Unklar ist, ob Fenton tatsächlich vom britischen Königshaus mit der Auflage: »No dead bodies« auf die Krim geschickt wurde, um eine durch Russels Berichte irritierte Öffentlichkeit zu beruhigen. Vor allem die britische Oberschicht schätzte Ein Bild aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg: Alexander Gardner fotografierte nach der Schlacht bei Gettysburg im Juli 1863 einen Gefallenen. akg-images/Alexander Gardner Fentons Aufnahmen in der bildästhetischen Tradition der früheren Genremalerei. Auf ihnen erschien der Krieg als ein gesellig-gemütliches Unternehmen, wobei geschickt hinzu arrangierte Krankenschwestern oder Soldatenfrauen beim Betrachter den Eindruck der völligen Harmlosigkeit der Szenerie hervorriefen. Daher galt der Krimkrieg in Großbritannien schon bald nur noch als »Picknick War«. Couragiertere Fotografen erreichten mit ihren Aufnahmen der zerschossenen Sewastopoler Befestigungen längst nicht Fentons Wirkung. Im Amerikanischen Bürgerkrieg Während Fenton seinem Publikum allenfalls Bilder der Gräber gefallener Offiziere zugemutet hatte, wagte der Amerikaner Mathew B. Brady (1823–1896) im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861– 1865) erstmals die Leichen der Gefallenen unmittelbar auf dem Schlachtfeld aufzunehmen. Die Toten der Schlachten von Antietam (17. September 1862) und Gettysburg (1. bis 3. Juli 1863) waren ein Meilenstein der realistischen Kriegsfotografie. Das gewiss härter gesottene amerikanische Publikum interessierte sich jedoch kaum für Bradys schockierende Aufnahmen von aufgetriebenen und ausgeraubten Toten im Regen. Freilich gelangten seine Kriegsfotografien vorerst auch nicht auf dem direkten Wege zu den Lesern der neuen Illustrierten Zeitungen wie Harper’s Weekly oder The Illustrated London News. Zur drucktechnischen Vervielfältigung mussten die Fotografien anfangs noch aufwendig zu Holzstichen umgearbeitet werden. Dieser Umweg entfiel erst 1881 mit der Erfindung des Verfahrens der Autotypie (Netzätzung). Trotz dieser Beschränkungen kann der Amerikanische Bürgerkrieg als erster Medienkrieg angesehen werden. Damals standen sich Truppen der Nordstaaten (Union) und der abgespaltenen Südstaaten (Konföderierte) gegenüber. Mehr als 500 Kriegsreporter waren zeitweise im Einsatz und belieferten die Zeitungen mit oft übertriebenen oder sogar erfundenen Berichten. Im Sommer 1864 meldete eine Zeitung die Einnahme von Atlanta durch Unionstruppen schon fünf Tage vor dem tatsächlichen Beginn des Kampfes um die Stadt. Im Kriegsgebiet oft ganz auf sich allein gestellt, schlossen sich viele Korrespondenten schließlich zu einem eigenen Verband zusammen, den sie ironisch die »Bohemian Brigade« nannten. Während es vom Krimkrieg vielleicht einige tausend Aufnahmen gab, wuchs nun die Zahl der Kriegsfotografien auf über eine Million. Mit Zensurbestimmungen versuchte der Kriegsminister der Union Edwin M. Stanton (1814–1869) eine allzu realistische Darstellung des Kriegsgeschehens und vor allem die Veröffentlichung auch für den Feind wichtiger Details zu verhindern. Von ständig schlechten Nachrichten geplagt, schreckte er sogar vor Verhaftungen unbequemer Korrespondenten nicht zurück und sorgte vereinzelt auch höchstpersönlich für eine beschönigende Darstellung der Verluste bei den Unionstruppen. Der mit seinen Reportagen von der Krim berühmt gewordene Russell war 1861 ebenfalls von der Londoner Times auf den Kriegsschauplatz geschickt worden, fiel aber durch seine nüchterne und schonungslose Analyse der Niederlage der Union bei Bull Run (21. Juli 1861) im Norden schnell in Ungnade. Da sich zudem sein Londoner Chefredakteur John Thadeus Delane (1817–1879) offen für die Konföderation erklärt hatte, musste der Ire die Vereinigten Staaten vorzeitig verlassen. Europäische Schlachtfelder Anders als vom Amerikanischen Bürgerkrieg gingen von den Deutschen Einigungskriegen der Jahre 1864 bis 1871 kaum neue Impulse für die Kriegsfotografie aus. Fotografen und Kriegsberichterstatter auf preußisch-deutscher Seite standen unter strenger Kontrolle des Militärs. Die wenigen am Krieg von 1864 beteiligten Fotografen handelten im Auftrag der Armee. Hohe Investitionen für eine fototechnische Ausstat- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 11 No dead bodies! tung und die geringen Möglichkeiten, die Aufnahmen zu verbreiten, engten den Kreis der Kriegsfotografen ohnehin stark ein. Auf eigene Rechnung begleitete der Flensburger Fotograf Friedrich Brandt (1823–1891) als einer von vier »Lichtbildnern« das preußisch-österreichische Expeditionskorps auf die Schlachtfelder nach Schleswig. Ganz in Fentons Stil lieferte er Aufnahmen der Düppeler Schanzen nach ihrer Erstürmung oder Fotos der von den Dänen geräumten Festung Fredericia, dazu inszenierte Gruppenaufnahmen siegreicher Kämpfer. Doch nirgendwo finden sich auf den Aufnahmen Hinweise auf die 7500 Toten des Deutsch-Dänischen Krieges von 1864. Dagegen war der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 für die Entwicklung der Kriegsberichterstattung von großer Bedeutung. Otto von Bismarck versorgte über eine eigene Pressestelle die regierungsfreundlichen Zeitungen in Norddeutschland regelmäßig mit Kriegsnachrichten. Auf besondere Einladung Preußens begleitete wiederum Russell die deutschen Armeen auf ihrem Vormarsch nach Paris. Frankreich hatte den Einsatz von ausländischen Kriegskorrespondenten anfangs abgelehnt, während Bismarck die Anwesenheit von britischen Kriegsberichterstattern im eigenen Lager sehr begrüßte. Mit Blick auf die öffentliche Meinung in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten konnte es nach Ansicht des damaligen Kanzlers des Norddeutschen Bundes für Preußen nur von Vorteil sein, wenn ihre beiden einflussreichsten Zeitungen über die Erfolge seiner Armeen berichteten. Genau dies befürchtete aber die britische Regierung. Zu strikter Neutralität entschlossen, wollte sie nach der französischen Weigerung zunächst überhaupt keine Korrespondenten ausreisen lassen. Erst die Intervention Delanes, des einflussreichen Chefredakteurs der Times, beseitigte dieses Hindernis. Doch nicht Russell avancierte diesmal zum Medienstar, sondern sein Konkurrent Archibald Forbes (1838 bis 1900) von den Daily News. Der ehemalige Offizier der Royal Dragoons nutzte konsequent die technischen Möglichkeiten und konnte daher seine Berichte schneller als sein journalistisches Vorbild Russell in London präsentieren. 12 akg-images/ George N. Barnard Der Amerikanische Bürgerkrieg traf die Zivilbevölkerung des Südens besonders hart; hier eine Aufnahme vom Capitol Hill auf die zerstörte Stadt Columbia in South Carolina im Jahr 1865, fotografiert von George N. Barnard. Während der Belagerung von Paris hatte Forbes mit der preußischen Armeeführung vereinbart, dass er seine Nachrichten an jeder beliebigen preußischen Poststation in der Umgebung der Stadt aufgeben könne, so dass sie ein Postzug noch am selben Tage nach Saarbrücken bringen konnte, wo ein sorgfältig instruierter Telegrafist für die sofortige Weiterleitung von Forbes´ Nachrichten nach London sorgte. So hatte der findige Brite sichergestellt, dass seine Nachrichten innerhalb von nur 24 Stunden in London eintrafen. Der bereits kriegserfahrene Amerikaner George W. Smalley (1833–1916) von der New York Tribune organisierte während des Krieges sogar die erste internationale Presseagentur. Die angeschlossenen Korrespondenten durften auch die Informationen anderer Kollegen benutzen, sofern sie selbst ihre Berichte dem Nachrichtenpool zur Verfügung stellten. Sämtliche Nachrichten wurden zunächst auf schnellstem Wege nach London telegrafiert, wo ein Redaktionsteam die verschiedenen Quellen zu vollständigen Beiträgen zusammensetzte. So erreichte die Meldung von der Schlacht von Gravelotte (18. August 1870) bereits zwei Tage später New York. Das Telegramm via Überseekabel hatte immerhin 5000 USDollar gekostet. Die Berichterstattung verlor jedoch an literarischer Qualität, wurde direkter und beschränkte sich zusehends auf das noch heute aktuel- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 le Grundmuster des Wer – Wie – Wo – Wann – Warum. Auch die Zeitungen in Deutschland hatten Korrespondenten nach Frankreich entsandt. Für die Berliner National-Zeitung waren bis zu zehn Berichterstatter tätig und für die Kölnische Zeitung arbeitete der Schriftsteller Hans Wachenhusen (1827–1898), der sich schon 1854 als Kriegskorrespondent im Gefolge der osmanischen Armee an der Donau befunden hatte. Wie Russell hatte Wachenhusen seither über alle militärischen Konflikte in Europa berichtet und 1860 sogar den italienischen Freiheitshelden Giuseppe Garibaldi (1807–1882) in Sizilien begleitet. Vier Jahre später, am 18. April 1864, beobachtete er mit einem Fernglas von einem Sicherungsturm aus den preußischen Sturm auf die Düppeler Schanzen. Auch der Publizist und Schriftsteller Gustav Freytag (1816–1895) reiste für seinen Grenzboten 1870 nach Frankreich und durfte sich dem Hauptquartier des preußischen Kronprinzen anschließen. Typisch für die damalige Berichterstattung war das freie und daher auch gefährliche Herumstreifen von Reportern im Kriegsgebiet. Korrespondenten wurden von der Gegenseite oft als Agenten angesehen und gefangen genommen. Das prominenteste Opfer war wohl der Schriftsteller Theodor Fontane (1819–1898), der als Kriegsberichterstatter am 5. Oktober 1870 bei Domrémy in französische Hände fiel. Literaturtipps: Ute Daniel (Hrsg.), Augenzeugen. Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21. Jahrhundert, Göttingen 2006 Gerhard Paul, Bilder des Krieges – Krieg der Bilder. Die Visualisierung des modernen Krieges, Paderborn 2004 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Geschic hte Die Titelseite der Abendausgabe der Vossischen Zeitung vom 31. August 1914 mit Meldungen vom Kriegsgeschehen unst & Die Niederschlagung der revolutionären Pariser Kommune vom 21. bis 28. Mai 1871 eröffnete ein neues Kapitel der Kriegsfotografie. Aufnahmen von Tod und Zerstörung in den umkämpften Straßen wirkten zwar realistischer, doch ließen sie sich mehr noch als die geschönten Aufnahmen zur Propaganda missbrauchen. Kommunarden und übergelaufene Nationalgardisten ließen sich bereitwillig gemeinsam vor der umgestürzten Napoleon-Säule auf der Place Vendôme ablichten. Geschäftstüchtige Fotografen wie Bruno Braquehais (1823–1875) stellten sogar noch während der Kämpfe ihre Aufnahmen in den Schaufenstern der Pariser Schreibwarenhändler aus. Mit einem Gespür für die neuen Möglichkeiten der Selbstdarstellung posierten selbst Frauen mit ihren Kindern vor den Barrikaden, ohne allerdings zu ahnen, dass die Pariser Polizei später ihre Klaus-Jürgen Bremm iv für K Die Pariser Kommune und die Kriegsfotografie Nach ihren ersten erfolgreichen Ansätzen im Krimkrieg und im Amerikanischen Bürgerkrieg nahm die Kriegsberichterstattung bis zum Ersten Weltkrieg mehr und mehr propagandistische Züge an. Bei Ausbruch des Krieges erließen alle Kriegsparteien sofort strikte Zensurbestimmungen für ihre Korrespondenten. So verschaffte sich die britische Regierung im Ursprungsland der Pressefreiheit durch den berüchtigten »Realm Act« vom 8. August 1914 die Kontrolle über sämtliche ein- und ausgehenden Pressemeldungen vom Kontinent. Wer gegen den Act verstieß, konnte ohne Gerichtsverfahren inhaftiert werden. Das War Office Bureau sorgte dafür, dass Tatsachen propagandistisch entstellt oder verschwiegen wurden. Sogar völlig frei erfundene Berichte wurden veröffentlicht, wie etwa die über abgehackte Kinderhände im besetzten Belgien oder über eine deutsche Leichenverwertungsanstalt. Selbst weltbekannte Autoren wie H.G. Wells (1866–1946) zögerten damals nicht, das unglaubliche Gemetzel an der Westfront zu beschönigen. Er wisse, so beteuerte der Autor des Sience-Fiction-Romans »Krieg der Welten«, dass sein Risiko, von einer Kugel getroffen zu werden, unendlich geringer sei als die Gefährdung der Kampfmoral durch g Arch Schlimmer noch erging es einem Berichterstatter der Londoner Times, der am 1. September 1870 bei Douay von einer französischen Kugel tödlich getroffen wurde. Kein Krieg ohne Presse mmlun Theodor Fontane, Schriftsteller und Kriegsberichterstatter im DeutschFranzösischen Krieg 1870/71. Die Porträtaufnahme entstand um 1874. In dieser Zeit erschien auch Fontanes zweibändiges Werk „Der Krieg gegen Frankreich 1870/71“. ages/Sa akg-images allzu grausame Bilder und übertriebene Ansichten. Mit der Realität des blutigen Grabenkrieges an der Westfront, dem Millionen von Soldaten zum Opfer fielen, hatte das jedoch nichts mehr zu tun. Wenn die Leute tatsächlich die Wahrheit wüssten, wäre der Krieg morgen schon beendet, bemerkte im Dezember 1917 der britische Premier David Lloyd George gegenüber einem befreundeten Zeitungsverleger. Immerhin bewirkte 1915 ein junger australischer Korrespondent mit seiner Berichterstattung den Abbruch des britischen Landungsunternehmens auf der osmanischen Halbinsel Gallipoli und sogar die Ablösung des verantwortlichen britischen Generals. Sein Name lautete Keith Murdoch; er war der Vater des »Medienzaren« Rupert Murdoch. akg-im Aufnahmen zu Ermittlungszwecken nutzen würde. Auch Bildmanipulationen zur politischen Propaganda kamen vor. Der Fotograf Ernest Eugène Appert (1830–1891), ein erklärter Gegner der »Commune«, stellte für seine elfteilige Bilderserie »Crimes de la Commune« einzelne Szenen des Aufstandes mit Hilfe von Schauspielern und Statisten nach. Seine Fotomontagen von Hinrichtungen durch die Kommunarden, die nie stattgefunden hatten, gelten sogar als bekannteste frühe Bildfälschungen. Schließlich verbot die Regierung 1872 die Verbreitung von Aufnahmen der Ereignisse und Beteiligten des Aufstandes. 13 Deutsche Interessen im Kongo Deutsche Interessen im Kongo pa/akg Offizier und Afrikaforscher Hermann von Wissmann verhandelt nach Anlegung eines Stützpunktes (Station Mkwadji) mit den um die »Schauri« (Palaverhütte) versammelten Eingeborenen. D as neu errichtete Deutsche Reich meldete ab 1871 bei der Aufteilung Afrikas in Kolonialgebiete zunehmend seine »Rechte« an. Deutsche Missionare, Wissenschaftler und Reisende waren schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts an der Erschließung des »schwarzen Kontinents« beteiligt. Der Kaiser und die Reichsregierung suchten deren Aktivitäten zu kontrollieren. Als klare wirtschaftliche Interessen erkennbar wurden, griffen beide lenkend ein, insbesondere im Kongobecken. Obwohl für das Deutsche Reich die Bedeutung kolonialer Erwerbungen bis zum Ersten Weltkrieg im Vergleich zu anderen Mächten gering blieb, beschäftigten die Vorgänge in Afrika die deutsche Öffentlichkeit in starkem Maße. Die Deutsche Afrikanische Gesellschaft Erst zwischen 1874 und 1877 wurde das Kongobecken von dem britisch-amerikanischen Journalisten Henry M. Stanley (1841–1904) erforscht und von 1878 bis 1884 teilweise erschlossen. Auf die- 14 ses Gebiet richteten sich große Erwartungen auf reiche Rohstoffvorkommen und tropische Produkte. Von 1874 an erkundete der deutsche Geograph Paul Pogge (1838–1884) gleichzeitig den Südwestteil des Landes. 1876 gründete König Leopold II. von Belgien eine Internationale Afrikanische Gesellschaft (Association Internationale Africaine), die das Kongobecken »im internationalen Interesse« und »nach europäischen Zivilisationsstandards« nutzbar machen sollte. Als deutsche Sektion bildete sich die Deutsche Afrikanische Gesellschaft (DAG). Sie war besonders aktiv und stellte mit Professor Eduard Pechuel-Loesche (1840–1913) in dieser Zeit der Erschließung Stanleys Stellvertreter. Mit den zahlreichen Reisenden der DAG begann 1878 eine regelrechte »deutsche Erforschungsphase« des noch unerschlossenen zentralafrikanischen Gebiets. Reichskanzler Otto von Bismarck unterstützte die DAG und ihre Expeditionen mittels seines »Afrikafonds«, um dem Deutschen Reich gebührenden Einfluss in Zentralafrika zu verschaffen. Zusammen mit dem französischen Regierungschef Jules Ferry Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 förderte Bismarck König Leopolds Projekt, das sich schließlich 1884 zum »Kongo-Freistaat« (État Indépendant du Congo) entwickelte. Die Berliner »Kongokonferenz« 1884/85 Der deutsche Reichskanzler verband mit der Einflussnahme in Afrika weitere Interessen: Eine gemeinsame Politik mit Frankreich im Fall des Kongo kam seiner Politik der Zähmung des westlichen Nachbarn entgegen, der »Revanche« für den verlorenen DeutschFranzösischen Krieg von 1870/71 forderte. Als Portugal mit britischer Unterstützung die Mündung des Kongo unter Berufung auf die Entdeckung Ende des 15. Jahrhunderts als Besitz reklamierte, anberaumte Bismarck in Absprache mit Ferry eine »Kongokonferenz« der europäischen Mächte, des Osmanischen Reichs und der Vereinigten Staaten in Berlin (15. November 1884 bis 26. Februar 1885). Großbritannien, das dank bilateraler Verträge mit Portugal als einzige Wirtschaftsmacht von der Abschottung des Kongobe- ckens profitierte, gab angesichts der deutsch-französischen Koalition nach und gestand die Internationalisierung von Kongomündung und Kongostrom zu, ebenso wie die Übertragung der Landeshoheit und -verwaltung an den »internationalen« Kongo-Freistaat. Die Konferenz von Berlin gab ganz Afrika zur Kolonialisierung durch europäische Mächte frei und legte dafür die Regeln fest. Europäische Konflikte sollten möglichst nicht in Afrika fortgeführt werden (Art. 10 der »Kongoakte«). Darüber hinaus wurde ganz Zentralafrika, wenn die Interessen mehrerer Staaten aufeinander trafen, unbeschadet sei- ner politischen Aufteilung wirtschaftlich als »Kongo-Freihandelszone« für alle Teilnehmer des Kongresses geöffnet. Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt bereits in West-, Südwest- und Ostafrika Fuß gefasst und ließ sich dort Schutzgebiete international garantieren. Es machte seine Interessen allerdings nur mäßig geltend, da Bismarck – zu Recht, wie sich zeigen sollte – den Verwaltungs- und Sicherungsaufwand als unverhältnismäßig hoch einschätzte. Mit dem freien Zugang in ein Gebiet, in dem überwiegend andere Mächte die Kosten für Erschließung und Landfrieden trugen, war er dagegen überzeugt, »etwas Bedeutendes und Haltbares gemacht zu haben«. Deutsche Kongoforscher pa/dpa Hermann von Wissmann Hermann von Wissmann wurde am 4. September 1853 in Frankfurt/Oder geboren. Sein Vater war preußischer Regierungsrat. Wissmann besuchte die Berliner Kriegsschule und gehörte dem dortigen Kadettenkorps an. Ab 1874 studierte er an der Universität Rostock Naturwissenschaften, Geographie und Ethnologie. 1881/82 durchquerte er Äquatorialafrika von West nach Ost und erforschte von 1883 bis 1885 im Auftrag von König Leopold II. die spätere belgische Kolonie Kongo. Nach einer erneuten Reise durch Afrika 1886/87 baute Wissmann als Reichskommissar für Deutsch-Ostafrika zwischen 1889 und 1891 eine Schutztruppe auf, mit der er die Küstenaraber und Sklavenhändler im Krieg um die Herrschaft im Lande besiegte. Für seine Verdienste wurde Wissmann vom deutschen Kaiser geadelt und zum Major befördert. 1895/96 schickte er als Gouverneur Oberst Lothar von Trotha, der 1904 durch die Massakrierung der Herero in Deutsch-Südwestafrika bekannt werden sollte, auf Expedition ins Landesinnere und befriedete Deutsch-Ostafrika während einer neuen Krise durch Autorität und Diplomatie. 1896 kehrte Hermann von Wissmann aus gesundheitlichen Gründen nach Deutschland zurück. Er starb 1905 bei einem Jagdunfall. Bernhard Chiari Die deutsche Mitbestimmung am Kongo ließ Bismarck durch Expeditionen der DAG demonstrieren, die er kontrollierte und bei Eigenmächtigkeiten fallen ließ. Von 1884 bis 1886 erforschten die Leutnante Richard Kund und Hans Tappenbeck sowie der Botaniker Richard Büttner den Kongo flussaufwärts. Die wichtigsten Unternehmungen verbinden sich aber mit dem Namen Hermann von Wissmann, der, nach ersten Expeditionen 1881/82, in den Jahren 1884/85 für den Kongo-Freistaat den Bereich des Kasai erforschte, wo er die Stadt Luluabourg (heu- te Kananga) gründete. Die besondere Bedeutung dieser mit dem deutschen Kronprinzen und Bismarck abgesprochenen Mission lag darin, dass sie trotz Beauftragung durch König Leopold unter der deutschen statt der kongolesischen Flagge erfolgte, um die Internationalität der Kongo-Unternehmungen zu demonstrieren. Als letzter bedeutender deutscher Kongoforscher führte nach Wissmanns Erkrankung der Stabsarzt Ludwig Wolf den Auftrag zu Ende. 1886/87 durchquerte Wissmann das Kongobecken ein weiteres Mal, diesmal, um Erkundigungen über die arabischen Sklavenhändler einzuholen. Sie waren die eigentlichen Machthaber Innerafrikas. Der belgische Major Francis de Dhanis beseitigte später deren Herrschaft, wobei Wissmann im deutschen Tanganjika/Njassa-Seengebiet die Operationen des Belgiers flankierte (1893). Machtverlust des Deutschen Reiches im Kongo Bereits zwei Wochen nach Abschluss der Kongokonferenz setzte sich in Frankreich die populäre »Revanchepartei« wieder durch. Sie wollte sich durch eine Politik unter dem Motto »vom Rhein zum Kongo« nicht ablenken lassen. Die »Boulanger-Krise« – der neu ernannte französische Kriegsminister Georges Boulanger trat als Befürworter ������������������ ��������������� ��������������� ������� ��� �� ����� �� � ���� �� �� ����� � ���� ����� ��������������� ��������������� ���������������� �������������� ������������������ ��������� ��������������� ��������������������� ��������������������� � ��� ���� ���� ������� �������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���� �������� Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 15 Deutsche Interessen im Kongo eines Revanche-Kriegs gegen Deutschland auf –, mit der französische Nationalisten die Phase der Kongoharmonie beendeten, konnte dank der hastigen Ausrüstung der deutschen Armee mit einem (allerdings noch unausgereiften) Mehrlader, dem Gewehr 88, eingedämmt werden. Ohne den französischen Kooperationspartner war aber Bismarck nicht in der Lage zu verhindern, dass König Leopold den KongoFreistaat systematisch von den internationalen Bezügen abtrennte und in sein eigenes, privates Ausbeutungsobjekt umwandelte. Deutschlands afrikanischer Einfluss beschränkte sich bald auf die eigenen vier Schutzgebiete Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika, deren geringe Bedeutung Bismarck nach dem Wiederaufleben militärischer Spannungen in Europa einem eifrigen Kolonialpublizisten gegenüber wie folgt umschrieb: »Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön [...] Aber hier liegt Russland und hier liegt Frankreich, und wir sind in der Mitte – das ist meine Karte von Afrika!« Aus dem Protest gegen die nicht ausreichend gewürdigte Mäßigung in Ostafrika und am Kongo entwickelte sich der chauvinistische »Alldeutsche Verband«, dessen Agitation die deutsche Politik in der Folge schwer belasten und schließlich mit in den Ersten Weltkrieg treiben sollte. Von der Kolonie Belgisch-Kongo bis in die Gegenwart Leopold II. schottete den Kongo-Freistaat derart gegen die Welt ab, dass die dort an der lokalen Bevölkerung begangenen Gräuel, die bis 1908 vermutlich bis zu zehn Millionen Einheimische das Leben kosteten, erst ab 1904 in das öffentliche Bewusstsein traten. Akg Askarikompanie in Deutsch-Ostafrika. Farbdruck nach Aquarell, aus: Deutschland in Waffen, Stuttgart u.a.: DVA [1913]. Askaris: einheimische Soldaten Afrikas im Dienste der Kolonialmächte Askari ist ein an Arabisch und Persisch angelehntes bzw. dem Swahili entliehenes Wort und bedeutet »Soldat«. Es wurde für einheimische Soldaten verwendet, die in Ostafrika und im Mittleren Osten freiwillig den europäischen Kolonialmächten dienten. Der Begriff umfasste aber auch Polizisten und Wachleute im Allgemeinen. Ein herausragendes Beispiel für die Askaris waren jene 11 000 Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in Deutsch-Ostafrika unter dem Kommando des Offiziers Paul Erich von Lettow-Vorbeck trotz erheblicher numerischer Unterlegenheit vier Jahre lang ungeschlagen den Kolonialtruppen des Vereinigten Königreiches widerstanden. Während des Apartheidregimes in Südafrika wurden Rebellen, die durch die südafrikanische Armee zum Wechsel der Seiten bewegt werden konnten, Askaris genannt. Der gleiche Ausdruck war im Zweiten Weltkrieg für russische Überläufer gebräuchlich, die sich freiwillig der SS anschlossen. Dieter H. Kollmer 16 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Der drohenden Re-Internationalisierung, die insbesondere in Großbritannien und Amerika gefordert wurde, kam Leopold durch Übertragung des Landes aus seinem Privatbesitz an das Königreich Belgien zuvor. Der diskreditierte Kongo-Freistaat wurde 1908 in die Kolonie Belgisch-Kongo umgewandelt. In der Phase der Unsicherheit über das endgültige Schicksal des Kongo zeigte Deutschland ein gesteigertes Interesse an der Übernahme des Landes. Im Marokko-Kongo-Vertrag gelang es Deutschland 1911, eine Territorialverbindung von Kamerun zum Kongo zu schaffen. Die Rückführung des Kongo in die Internationalität misslang jedoch, zumal deutsch-britische Gespräche über die Aufteilung der portugiesischen Kolonien im Fall eines Staatsbankrotts die Vision des Projekts »Deutsch-Mittelafrika« erkennbar werden ließen, das die Alldeutschen propagierten. Die deutsche Wirtschaft äußerte sich in diesem Zusammenhang zurückhaltender. In der deutschen Kriegszieldebatte während des Ersten Weltkrieges galt die Übernahme des Kongo dann aber als selbstverständlich. Die Kriegszieldebatte wirkte sich allerdings kontraproduktiv aus, weil Belgien im Gegenzug Deutsch-Ostafrika angriff, um ein Faustpfand zu gewinnen. Die belgische Kongo-Armee (Force Publique) unterstützte die britischen und südafrikanischen Truppen bei den schweren Schlachten um das Deutsche Schutzgebiet. Der Militärkommandeur des Schutzgebietes, Paul Erich von Lettow-Vorbeck (1870–1964), wich mit seinen einheimischen Soldaten, den Askaris, aus. 1917/18 wurde der Kampf schließlich auf portugiesischem und britischem Kolonialboden fortgesetzt. Der Versailler Vertrag sprach Belgien 1919 die deutsch-ostafrikanischen, Residenturen genannten Verwaltungseinheiten Ruanda und Urundi als Mandatsgebiete zu. Umgekehrt sah die nationalsozialistische Kolonialplanung von 1940 bis 1943 konkret den Anschluss des Kongo an »Deutsch-Mittelafrika« vor. Gegen die USA, die sich ab 1942 in Belgisch-Kongo militärisch festsetzten, wäre die Annexion aber kaum durchsetzbar gewesen. Das kongolesische Uran war die Voraussetzung für den Bau der Atombombe, den die Amerikaner bereits betrieben und unter keinen Umständen Hitler ermöglichen wollten. In das Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit rückte der Kongo nach 1945 verstärkt in den 1960er Jahren, als der Deutsche Siegfried Müller, Söldner im kongolesischen Bürgerkrieg, von sich reden machte. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich aus dem Kongo der Nachkolonialzeit und seinen Wirren weitgehend herausgehalten. Deutsche Beteiligungen an Nichtregierungsorganisationen, insbesondere an kirchlich-missionarischen (Franziskaner), bestanden schon in belgischer Zeit; es gab und gibt sie weiterhin im Bildungs- und Gesundheitswesen. Erst in letzter Zeit engagiert sich auch die Bundesregierung in der Demokratischen Republik Kongo. Im Jahr 2003 hat sie 13 Millionen Euro für zivile Projekte, 25 Millionen zur Demobilisierung und Reintegration von Kom- »Kongo-Müller«: Eine deutsche Söldnerkarriere pa/dpa Siegfried Müller (rechts) bei der Ausbildung einer multinationalen, weißen Söldnertruppe im September 1964 im Militärlager Kamina in Katanga. Im Herbst 1964 berichteten westdeutsche Zeitungen wiederholt über den Einsatz weißer Söldner im kongolesischen Bürgerkrieg. Der SPIEGEL meldete am 23. September, dass sich der Deutsche »Siegfried Müller […] Träger des Eisernen Kreuzes I. Klasse […] als einer der ersten für die weiße Söldnertruppe im Kongo« gemeldet habe. Schnell bekam der deutsche Söldneroffizier von der Presse einen Kriegsnamen verliehen: »Kongo-Müller«. Angeworben als »military technical assistance volunteers«, sich selbst als »Kongo-Freiwillige« bezeichnend, kämpften unter den vornehmlich aus Belgien, Großbritannien, Rhodesien und Südafrika rekrutierten modernen Landsknechten auch etwa drei Dutzend Deutsche auf Seiten der Zentralregierung gegen die »Simbas« (Löwen). Deren Anführer hatten 1964 im damaligen Stanleyville (Kisangani) die »Volksrepublik Kongo« ausgerufen und innerhalb weniger Wochen weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Von der ehemaligen Kolonialmacht Belgien und den Vereinigten Staaten unterstützt, koordinierten Ministerpräsident Moïse Tshombé und General Joseph Désiré Mobutu den Einsatz der weißen Söldner und der kongolesischen Nationalarmee. Der Auftrag: 300 Söldner sollten, eingeteilt in sechs »Kommandos«, Stanleyville zurückgewinnen. Am 9. September 1964 begann für die meisten Deutschen der Einsatz im »Kommando 52« – geführt von Hauptmann Müller. Referenz für die Übernahme des Kommandos war Müllers Lebenslauf: 1920 im damals brandenburgischen Crossen an der Oder (heute Krosno Odrzańskie), trat er nach Hitlerjugend, Abitur und Reichsarbeitsdienst 1939 in die Wehrmacht ein, kämpfte in Polen, Frankreich und zuletzt als Panzerjäger an der Ostfront. Als Oberfähnrich geriet er gegen Kriegsende schwer verwundet in amerikanische Gefangenschaft. 1948, ein Jahr nach seiner Entlassung, wurde Müller wieder Soldat battanten sowie fünf Millionen für die Krisenprävention bereitgestellt. Wolfgang Petter Literaturtipps: Bernhard Chiari und Dieter H. Kollmer, Wegweiser zur Geschichte: Demokratische Republik Kongo, Paderborn [u.a.] 2006 Christian Bunnenberg, Der »Kongo-Müller«: Eine deutsche Söldnerkarriere Münster 2006 (= Europa – Übersee, Bd 19) – nun unter amerikanischem Kommando in einer aus Deutschen bestehenden »Labour Service Unit«, zuletzt eingesetzt als Zugführer einer Objektschutzeinheit im Dienstgrad Oberleutnant. Als 1956 eine Übernahme in die Bundeswehr scheiterte, räumte Müller gutbezahlt für eine britische Erdölfirma in der Sahara Minen des Afrikakorps. Inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, wanderte er 1962 nach Südafrika aus. Mit den ersten 38 Söldnern flog Müller 1964 in den Kongo und wurde im Anschluss an einen ersten Einsatz zur Befreiung Albertvilles zum Hauptmann befördert. Aus der Provinzhauptstadt Coquilhatville (Mbandaka) sollte das »Kommando 52« über Ingende auf Boende vorstoßen und dadurch die Provinz Équatorial befreien. Müller urteilte später: »Die ist fast so groß wie die Bundesrepublik. Die habe ich mit meinen 40 Mann und vielleicht weiteren hundertfünfzig Mann Schwarzen erledigt. Die habe ich geschafft. Zehn Wochen.« Dieses »Erledigen« bedeutete, schnelle und tödliche Angriffe mit Jeeps, leichten Radpanzern, Mörsern, Maschinen- und Sturmgewehren durchzuführen. Rasch erwarben sich die Söldner durch ihr schonungsloses Vorgehen bei der Bevölkerung die Bezeichnung »Les Affreux« (Die Schrecklichen). Im November 1964 wurde Müller Major und übernahm bis Mai 1965 die Söldnerbasis in Kamina. Müller beschrieb seinen Einsatz als Kampf gegen den Kommunismus und »für die Idee des Westens«. Die meisten Söldner lockte allerdings das Geld – 1500 Mark plus Gefahrenzulage. Kurzzeitig zurück in Deutschland, wurde Müller zu einem Politikum, nicht zuletzt durch zahlreiche Presseberichte und seine »Schnapsbeichte«, in der er unwissend und stark angetrunken einem Fernsehteam aus der DDR ein Interview gab. Filme und Bücher über »Kongo-Müller« und das auf Schallplatte gepresste Interview unterstützten in der Folge eine breit angelegte Propagandaaktion gegen die Bundesrepublik, die »als Handlanger des US-Imperialismus« bezeichnet wurde. Christian Bunnenberg Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 17 »Kriegsmaler« Hohly »Russland zu sympathisch gesehen, propagandistisch nicht verwertbar.« Der »Kriegsmaler« Richard Hohly Todesmarsch von Stalingrad, 1942/48 Die Kriegsmalerei in der Wehrmacht K unst war in der Geschichte selten frei; die Abhängigkeit des Künstlers von Auftraggebern und vom zeitlichen Kontext zog Grenzen des künstlerischen Gestaltungsanspruches. Diktaturen erkennen in der »freien« Kunst Kritik am politischen Herrschaftssystem und akzeptieren Kunst nur unter Kontrolle von enggesetzten weltanschaulichen Normen. Für autoritäre und totalitäre Staaten, und dies galt insbesondere für das NS-Regime, geht es deshalb nicht um Sinn und Eigenständigkeit von Kunst, sondern primär um deren Zweckgebundenheit; Kunst unterliegt der Ideologisierung, wird manipuliert und als Werkzeug machtpolitischer Ideologien sowie als Mittel der Herrschaftsstabilisierung betrachtet. Dementsprechend wurde im Dritten Reich regimetreue Kunst staatlich gefördert und ihr die »entartete Kunst« gegenübergestellt. Staatliche Reglementierungs- und Repressionsmaßnahmen auf der Basis »völkischer« Kunst- und Kulturauffassung gingen Hand in Hand mit einer geistig-kulturellen »Selbstgleichschaltung« der Künstler. 18 Der totale Staat des Dritten Reiches wollte auch kulturpolitisch nichts dem Zufall überlassen. Sein weltanschaulicher Machtanspruch erstreckte sich – maßgeblich gesteuert über die sogenannte Reichskulturkammer unter dem Vorsitz des Propagandaministers Joseph Goebbels – neben vielen anderen Bereichen auch auf die bildende Kunst, die ihren Beitrag zur »geistigen Mobilmachung« zu leisten hatte. Hierfür stand mit dem Mitteilungsblatt der RKdbK (Reichskammer der bildenden Künste) ein eigenes Publikationsorgan zur Verfügung. Für diese »geistige Mobilmachung« der Soldaten wurde im Frühjahr 1939 unter der Leitung von Oberst Hasso von Wedel die Abteilung Wehrmachtpropaganda im Wehrmachtführungsstab des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW/WPr) eingerichtet. Im Sommer 1940 folgte die Schaffung einer zentralen Ausbildungsstätte in Form einer Propaganda-Ersatz-Abteilung in Potsdam. Dadurch sollte das im Rahmen der Vorbereitungen für das »Unternehmen Barbarossa« zusätzlich gewonnene Personal »geschult« werden. Während des Krieges wurde der Einsatz der Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Maler zentral aus Potsdam gelenkt; sie wurden einzeln oder in Gruppen für mehrere Monate in die Operationsgebiete der Wehrmacht kommandiert. Sie zogen mit Panzern oder Infanterie ins Gefecht, flogen Einsätze der Luftwaffe mit oder fuhren zur See. Ihre während des Kriegseinsatzes angefertigten Skizzen hatten sie in einem anschließenden Arbeitsurlaub zu vervollständigen und zu heroisierenden Schlachtengemälden auszugestalten. Die verfolgte Zielrichtung dieser Werke wurde 1940 treffend in der Zeitschrift Die Kunst im Dritten Reich formuliert: »Die Kunst, die das Kriegserlebnis unserer Generation würdig und gültig gestalten will [...] soll den Widerschein der Seele auf die Feuerbrände der Schlacht in sich tragen [...] mit der Bejahung des soldatischen Einsatzes und seiner letzten Steigerung im Opfer ein Sinnbild unserer Zeit schaffen [...] Das Auge des gestaltenden Künstlers sei berufen [...] die Macht des deutschen Soldatentums, die Entbehrungsbereitschaft der kämpfenden deutschen Nation in Waffen darzustellen, die tausend Zeugnisse der Tapferkeit und der Todesbereitschaft festzuhalten.« Am 10. Juni 1940, gegen Ende des Frankreichfeldzuges, ordnete Goebbels an, »dass wohl die Härte, die Größe und das Opfervolle des Krieges gezeigt werden soll, dass aber eine übertrieben realistische Darstellung, die statt dessen nur das Grauen vor dem Kriege fördern könne, auf jeden Fall zu unterbleiben habe«. Angesichts der relativ geringen Verluste in diesem Krieg scheint seine Wunschvorstellung bereits auf die folgenden Kriege, Feldzüge und Schlachten im Osten Europas zu verweisen. Grundsätzlich war es aber ebenso erwünscht, dass in ruhigeren Zeiten durchaus auch Landschaftsbilder und Porträts gezeichnet werden sollten, wie im Februar 1940 die Propagandakompanien von der Wehrmachtpropagandaabteilung angewiesen wurden. Die Zielrichtung war eine doppelte: Einerseits sollte – wie 1942 formuliert wurde – damit erreicht werden, dass die Kriegsmalerei »der Mitwelt den Kriegsraum vor Augen führt, den heute die deutschen Waffen beherrschen«, andererseits erhoffte man sich eine ideologisierte Motivation der Soldaten, insbesondere der Soldaten der WaffenSS, die damit ein »Sinnbild« ihres gemeinsamen Erlebens, der Treue und Kameradschaft vermittelt bekommen sollten. Diese erste Zielsetzung wurde jedoch aufgrund des sich zu weit vom militärischen Raum entfernenden Sujets (Landschaftsbilder) allmählich zugunsten der rein an der ursprünglichen Absicht ausgerichteten genuinen Kriegsdarstellung in nationalsozialistischem Sinne zurückgedrängt. Demnach galt es für die Kriegsmalerei, »die großen und entscheidenden Aufgaben der Soldaten« – d.h. das Gefecht – propagandistisch zu unterstützen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden gemäß dem Potsdamer Abkommen 1947 über 8000 der angefertigten Werke in die USA verschifft. 1985 wurde ein Teil von ihnen – etliche der NS-Bilder hingen jahrzehntelang in den Büros des Pentagon – als »German-War-Art-Collection«, d.h. Kriegsund Nazikunst aus Deutschland, an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben. Wenngleich beim Gesamtkomplex Wehrmacht, Zweiter Weltkrieg und Kriegsmalerei generell der Aussage zuzustimmen ist, dass »die während Richard Hohly, 1930 des Zweiten Weltkrieges geschaffenen Stücke Bestandteil einer nach innen gerichteten geistigen Kriegführung« waren, »die mit dem Herausstellen der Leistungen deutscher Soldaten die Kampfmoral stützen sollten«, so gilt es andererseits darauf zu verweisen, dass es Beispiele von »Kriegsmalern« gab, die mit ihren geschaffen Werken genau diese Zielsetzung unterliefen. Der Maler Richard Hohly Einer dieser »Kriegsmaler« war der 1902 in der kleinen württembergischen Bergstadt Löwenstein geborene Richard Hohly, dessen Vorfahren sich bis auf einen General Hohly zurück- führen lassen, der sich im 15. Jahrhundert im Umfeld des böhmischen Reformators Jan Hus bewegte. Die alte, 1287 von Rudolf von Habsburg zur Stadt erhobene Ortschaft Löwenstein, die bewaldeten Höhenzüge, die verfallene Burgruine, das nahe gelegene Zisterzienser-Nonnenkloster Lichtenstern und das alte Schloss auf dem schmalen Vorsprung der Löwensteiner Berge erzeugten in dem jungen Künstler eine sein künstlerisches Schaffen prägende Erfahrungs(um)welt: eine Mischung aus »Burgromantik, altbürgerlichen Kleinstadtverhältnissen und einer überaus wild-schönen, unzerstörten, gesunden Landschaft«, die eine lebenslange mentale Verbundenheit mit seiner Heimat schuf. Im Zuge seiner Lehr- und Wanderjahre kam Hohly 1930 in Kontakt mit Edvard Munch sowie den Farbenlehren von Johann Wolfgang von Goethes und Rudolf Steiners. Die Werke des Kunstlehrers und Malers Richard Hohly standen bereits seit 1936 auf der Liste der »entarteten Kunst«, dennoch wurde Hohly am 12. November 1941 nach bereits erfolgter Einziehung zum Zoll in Ludwigsburg durch ein Telegramm nach Potsdam beordert. Ohne sein Wissen hatte seine Ehefrau über verwandtschaftliche Beziehungen zu Oberst von Wedel dafür gesorgt. Unter dessen Schutz sollte Hohly in einem Lehrgang zum sogenannten Wehrmachtspropagandisten ausgebildet werden. Löwenstein, 1978 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 19 »Kriegsmaler« Hohly Nachkriegszeit den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Er starb am 11. April 1995 und wurde in seiner Heimatstadt Löwenstein auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Das Werk des »Kriegsmalers« Hohly Stellungen vor Stalingrad, 1942 Anfang Juli 1942 erhielt Hohly als »Kriegsmaler Sonderführer« (im Rang eines Leutnants) seinen Einsatzbefehl nach Charkow (Ukraine), wo er den Auftrag erhielt, im eroberten Gebiet Land und Leute zu studieren sowie Soldaten und Eroberungszüge in Skizzen festzuhalten. Diese sollten die Grundlage für künstlerisch verarbeitete, idealisierte Schlachtengemälde bilden. Für die Soldaten und Offiziere waren die Kriegsmaler aber nur unmilitärische Anhängsel, die unnötigerweise in den ohnehin nicht ausreichenden Fahrzeugen Platz wegnahmen und störten. Darüber hinaus wurde Hohly von den Soldaten beinahe durchweg als »Verrückter« eingestuft, wenn er sich mit seinem Malzeug auf den Schlachtfeldern bewegte. Versunken in seine Wahrnehmung der Landschaften, wurde Hohly von seiner Einheit sogar einmal vergessen. Ein Offizier einer anderen Einheit nahm ihn mit; er brachte ihn zu General Bruno Ritter von Hauenschild, dem Kommandeur der 24. Panzerdivision. Dieser war sichtlich darüber erfreut, nun einen »eigenen Kriegsberichterstatter« zu haben. Er stellte Hohly ein Fahrzeug mit Chauffeur zur Verfügung, verlangte aber auch, dass der Maler bei den Angriffen seiner Division mitfuhr: »Sie schließen sich dem Nachrichten-Offizier an; das ist derjenige, der bei einem Angriff hinter dem Panzer des Kommandeurs fährt«, was zweimal geschah 20 und Hohly wider Willen beinahe das Eiserne Kreuz einbrachte. Nachdem Hohly von seiner Einheit wieder ausfindig gemacht worden war, wurde ihm am 29. Oktober 1942 mitgeteilt, dass er »um eine Ordnungsstrafe verpasst zu bekommen [...] wegen völlig unmilitärischen Verhaltens sofort zurückzuverfügen« sei, entweder zum Sitz des Armeeoberkommandos oder zur Kompaniestelle nach Charkow. Über die Zwischenstation Charkow wurde Hohly gleich weiterkommandiert – zurück nach Potsdam. Dort gab er seine ca. 50 Studien ab, die negativ beurteilt und bis zur vorgesehenen Vernichtung in den Keller verbannt wurden. Im Zuge eines angeordneten Arbeitsurlaubes sollte Hohly seine Kriegseindrücke komplett neu- und nach den vorgegebenen Gesichtspunkten überarbeiten, was allerdings nie geschah. Im März 1943 wurde Hohly nach Paris kommandiert. Vor seiner Abreise konnte er die abgegebenen Skizzen und Malstudien wieder in seinen Besitz bringen, so dass sie den Krieg unbeschadet überstanden. Das Kriegsende erlebte Hohly nach den »Irrungen und Wirrungen« des sich auflösenden Deutschen Reiches in Bietigheim, wo er sich ein letztes Mal in Uniform beim französischen Stadtkommandanten meldete. Der bis zu Beginn der 1980er Jahre weiter malende Künstler erhielt 1978 für sein umfangreiches künstlerisches Lebenswerk der Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Der Grund für die vernichtende Kritik übergeordneter Stellen war evident: Weder die von Hohly skizzierte Bevölkerung noch die deutschen Soldaten und die dargestellten Kampfhandlungen entsprachen den von der Wehrmachtführung auf der Grundlage »arischer Überlegenheit« gegenüber den als »slawischen Untermenschen« eingestuften Völkern im Osten Europas geforderten ideologischen NS-Kunstdarstellungen. Sie konnten daher in keiner Hinsicht propagandistisch verwertet werden. Seine 1942 angefertigten Bilder zeigen, wie zahlreiche andere angefertigte Studien, seine besondere Wahrnehmung der Bevölkerung in den eroberten Gebieten: Mit den vorrückenden deutschen Truppen nahm Hohly immer mehr neue Eindrücke von dem eroberten Land auf, die er in seiner Autobiographie beschrieb und in seinen Bildern festhielt: fruchtbare Landschaften mit blühenden Wiesen und riesigen Sonnenblumenfeldern, Dörfer mit blau angestrichenen Kirchen, friedliche und vertrauensselige Menschen mit stolzer Zurückhaltung. Ukrainischer Bürgermeister, 1942 Alte Russin mit Kind, 1942 Insbesondere die in fast allen Bauernhäusern gefundenen Ikonen und die Beobachtung, dass russische Flüchtlinge in ihrem Unterschlupf zuerst das orthodoxe Kreuz aufstellten, zeigten ihm, dass das Christentum durch die stalinistische Herrschaft noch nicht vollständig ausgerottet worden war. Hohly konnte in diesen Menschen nicht den »slawischen Untermenschen« erkennen. Für ihn waren sie einfache, christlich-orthodox geprägte Bauern; deshalb zeichnete und malte er sie als das, wofür er sie ansah – als Menschen. Besonders beeindruckend wirkten auf Hohly auch die unvergessenen Sonnenuntergänge in der Steppe und die Nächte unter einem tiefblauen, mit Sternen übersäten Himmel in der unermesslichen Weite des Kosmos. Seine Bilder zeigten den Tod in fremder Erde als ausdruckslos und sinnlos im Gegensatz zu der verklärenden Darstellung toter Wehrmachtssoldaten durch die offizielle Kriegsmalerei, die den Gefallenen meist als schlafenden Jüngling oder heroisch im Kampf sterbenden Frontkämpfer stilisierte. Auch das in den Grundzügen 1942/43 entstandene und 1948 vollendete, eindrucksvolle Gemälde »Todesmarsch von Stalingrad« begreift den Zug zehntausender deutscher Soldaten der 6. Armee nach der Schlacht um Stalingrad in die sowjetische Gefangenschaft als einen kalten kontur- und hoffnungslosen, stets anklagenden Todesmarsch. Dieses wichtige Werk deutscher Kriegsmalerei befindet sich heute im Wehrgeschichtlichen Museum in Rastatt. Im März 1943 wurde Hohly nach Paris kommandiert, wo er nicht mehr als offizieller Kriegsmaler, sondern im Nachrichtendienst eingesetzt war. Hier stand er auch in Kontakt mit Ernst Jünger, der als Hauptmann im Schutze von General der Infanterie Carl-Heinrich von Stülpnagel im Hotel Majestic in Paris stationiert war. Auch hier in Frankreich, wo er bis Ende 1944 blieb, malte Hohly weiter. So riss er, als ihn der »Drang nach malerischer Gestaltung« überkam und da er keine Leinwand besaß, ohne »Gewissensbisse« die auf dem Dach des Hotels Majestic wehende Hakenkreuzfahne ab und benutzte sie als Malfläche für sein Bild »Heimatlos«. Darin skizzierte Hohly einen schemenhaft erkennbaren Flüchtlingszug zum fernen, unbekannten Ort. Die durchschimmernde rote Farbe der Fahne ist noch immer deutlich auf dem Bild erkennbar. Resümee Ein Resümee über das Werk Hohlys im Kriege könnte daher zu folgendem Ergebnis kommen: Im Gegensatz zum offiziellen Auftrag der Darstellung aktionsgetragener Heroisierung, einer Apotheose des Kampfes, einer neuen, auf den Grundlagen nationalsozialistischer Weltanschauung aufbauenden sogenannten germanischen Kunstvorstellung, zeichnete Hohly – fundamental von diesem Auftrag abweichend – defensiv, einfühlsam und emphatisch. Dabei legte er den Blick frei auf die tiefere Wahrheit des von ihm als weiterhin dem christlichen Glauben verbunden eingestuften und wahrgenommenen russischen und ukrainischen Volkes sowie der im Vernichtungskrieg geschundenen Kreatur Mensch im 20. Jahrhundert. Hohly ist somit einer der ganz wenigen bekannten Beispiele für eine die offizielle »Leitkultur»« negierende Haltung. Sein bisher zu wenig beachtetes Oeuvre der Kriegszeit zeigt ihn als kritischen Geist in einer Zeit, in der nur unkritische Blicke ausgezeichnet wurden. Das gültige Urteil über seine Werke dieser Schaffensperiode erfuhr Hohly bereits aus dem Kreise seiner Kameraden, der »einfachen« Soldaten: »So ist es, genauso, wie Sie es malen. Und nicht so, wie es die Illustrierten publizieren.« Und damit wurde auch Hohlys Kunstverständnis verifiziert: danach gilt es – so schrieb er 1972 – »das Lebensgefühl oder die Lebensauffassung seiner Zeitgenossen auf die künstlerische Form [zu] bringen, dass sie nicht nur Gleichschaltung gestaltet, sondern zukunftsweisend ist. Darin liegt das Unverstandensein des Schaffenden und das Vorbeileben seiner Zeitgenossen.« Eberhard Birk Heimatlos, 1943/46 Literaturtipps: Dorothea Rapp, Richard Hohly. Leben und Werk, Stuttgart 1980 Wolfgang Schmidt, »Maler an der Front«. Zur Rolle der Kriegsmalerei und Pressezeichner der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. In: Rolf-Dieter Müller und Hans-Erich Volkmann (Hrsg.), Die Wehrmacht. Mythos und Realität, München 1999, S. 635-684 Bilder von Richard Hohly sind zu sehen in: »Felsengalerie«, Wobachstraße 49, 74321 Bietigheim Tel. Voranmeldung unter (07142) 5 16 69 Abbildungen aus: Richard Hohly. Leben und Werk, Stuttgart 1980 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 21 Service Das historische Stichwort Am 23. Oktober 1956 beginnt in Budapest der Volksaufstand. Demonstranten zerstören das Stalin-Denkmal als sichtbares Zeichen des alten Regimes. Volksaufstand in Ungarn 1956 »Ungarisches Volk! Die Nationalregierung, erfüllt von tiefem Verantwortungsgefühl gegenüber dem ungarischen Volk und der Geschichte, erklärt die Neutralität der Ungarischen Volksrepublik ...« M it diesen Worten verkündete der ungarische Ministerpräsident Imre Nagy (1896–1958) am 1. November 1956 im Rundfunk den Austritt seines Landes aus der Warschauer Vertragsorganisation. Nur zwei Tage später kam es aufgrund sowjetischer Intervention zur Bildung einer Gegenregierung unter János Kádár (1912–1989), der bis dahin ordentliches Regierungsmitglied und Staatsminister gewesen war. Am 4. November 1956 rückten fünf sowjetische Divisionen in Budapest ein, weitere Einheiten überschritten die ungarische Staatsgrenze noch am selben Tag. Hilferufe Nagys an die Westmächte und die Vereinten Nationen blieben ohne Erfolg. Am 12. November verkündete die staatliche Presse die Absetzung Imre Nagys, die Zusammensetzung der neuen Regierung unter Kádár wurde bestätigt. Nagy selbst wurde am 22. November trotz gegenteiliger Zusicherung der Sowjets verhaftet, zunächst nach Rumänien deportiert und schließlich 1958 in Budapest hingerichtet. Die Unruhen in Ungarn hielten jedoch bis in das Jahr 1957 an. Sie wurden schließ- 22 lich von ungarischen Sicherheits- und sowjetischen Streitkräften blutig unterdrückt. Der Versuch, in Ungarn einen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« zu errichten, war gescheitert. Die Ungarn-Krise kam nicht aus heiterem Himmel. Nach dem Tod Josef Stalins (geb. 1878) am 5. März 1953 hatte sich die sowjetische Staatsführung von dessen Personenkult abgewandt und ein System der »kollektiven Führung« eingeführt. Diese politische Neuorientierung der Sowjetunion wurde auf andere Länder des sozialistischen Lagers übertragen. In Ungarn hatte bis dahin Mátyás Rákosi (1892–1971) das Amt des Präsidenten des Ministerrates sowie des Generalsekretärs der Ungarischen Partei der Werktätigen (MDP) in seiner Person vereint. Aufgrund staatlicher Repressionen war Rákosi in der ungarischen Bevölkerung unbeliebt. Die Korrektur der politischen Richtlinien in der Sowjetunion machte auch im stalinistisch geprägten Ungarn eine Revision nötig. Im Juni 1953 wurde daher eine ungarische Delegation im Kreml empfangen. Sie erhielt detaillierte Anweisungen für einen politischen »Neuen Kurs«, der auf Repressionen und überspannte Wirtschaftspläne verzichten sollte. Zwar blieb Rákosi Generalsekretär der MDP, zum Ministerpräsidenten wurde jedoch Imre Nagy ernannt. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Der Verzicht auf eine grundlegende personelle Neubesetzung der politischen Ämter hatte zur Folge, dass die Politik Imre Nagys von den Vertretern des alten Regimes untergraben wurde. Zwar beinhaltete der »Neue Kurs« wesentliche Reformen, wie beispielsweise die Abschaffung des Zwanges zur Kollektivierung in der Landwirtschaft sowie den Aufbau einer gewissen Rechtssicherheit, trotzdem häuften sich im Laufe des Jahres 1954 die Auseinandersetzungen mit dem von Rákosi dominierten Politischen Ausschuss. Imre Nagy sprach sich für eine »Machtteilung« im Staat aus, die einseitige Wechselwirkung zwischen kommunistischer Partei und Gesellschaft sollte überwunden werden. Aus diesem Grund wurde am 24. Oktober 1954 die Patriotische Volksfront neu gegründet, eine Massenorganisation von Parteilosen. Vor allem der daraufhin gegen den Ministerpräsidenten erhobene Vorwurf, nationalistische Politik zu betreiben, erweiterte sich zu der Grundsatzdiskussion, ob politisch lediglich die radikale Rechte oder aber auch die radikale Linke zu bekämpfen sei. Rákosi überzeugte die sowjetischen Parteiführer davon, dass die Politik Nagys eine Gefahr für alle sozialistischen Staaten darstelle. Am 18. April 1955 wurde Nagy vom Amt des Ministerpräsiden- ten entbunden, im Dezember 1955 sogar aus der Partei ausgeschlossen. Rákosi war in der Folge weder willens noch fähig, ernsthafte politische Reformen durchzuführen. Die zunächst noch parteiinterne Opposition zur von Rákosi forcierten stalinistischen Restauration erfasste im Frühjahr 1956 auch Angehörige der Intelligenz und gesellschaftlicher Organisationen. Hauptforum war seit März 1956 der sogenannte PetöfiKreis, ein lockerer Zusammenschluss von Studenten und Schriftstellern. Den kommunistischen Führern in der Sowjetunion blieb die breite gesellschaftliche Front gegen den ungarischen Regierungschef nicht verborgen. Das Präsidium der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) beschloss daher in Folge der Entstalinisierungspolitik am 12. Juli 1956, dass Rákosi von allen politischen Ämtern zu entheben sei. Nachfolger wurde Ernö Gerö (1898–1980). Zwar rehabilitierte Gerö zahlreiche Opfer des Stalinismus, die innenpolitischen Probleme vermochte er jedoch nicht zu lösen. Vor dem Hintergrund der politischen Umwälzungen in Polen im Laufe des Oktobers 1956 kam es in Ungarn zu Sympathiekundgebungen, die anfangs noch solidarischen Charakter hatten, aber rasch eine Eigendynamik gewannen. Am 22. Oktober verabschiedeten Studenten der Budapester Technischen Universität eine 14-Punkte-Resolution, in der u.a. der Abzug der sowjetischen Truppen, Neuwahlen sowie eine neue Regierung unter Imre Nagy gefordert Die Niederschlagung des Volksaufstandes in Ungarn rief international tiefe Bestürzung hervor, ein militärisches Eingreifen wurde allerdings nicht gewagt. Zur Niederschlagung des Aufstandes werden sowjetische Truppen eingesetzt, die am 24. Oktober 1956 in Budapest einrücken wurden. Am 23. Oktober fand in Budapest eine Großdemonstration statt, die nach dem gewaltsamen Eingreifen von ungarischen Sicherheitskräften eskalierte. Das monumentale Stalin-Denkmal in Budapest wurde von den Demonstranten zerstört, es kam zu bewaffneten Zusammenstößen mit der Staatssicherheit. Imre Nagy, seit dem 13. Oktober wieder Mitglied der MDP, hatte zuvor versprochen, sich innerhalb der Partei für die Forderungen der Bevölkerung einzusetzen. Am gleichen Abend wurde er vom Zentralkomitee erneut zum Ministerpräsidenten berufen, gleichzeitig wurde aber eine bewaffnete Niederschlagung des als »Konterrevolution« gewerteten Aufstands der Bevölkerung mit Hilfe der in Ungarn stationierten sowjetischen Streitkräfte beschlossen. Bereits am 24. Oktober rückten erste sowjetische Einheiten in Budapest ein, stießen jedoch auf erbitterten Widerstand der Demonstranten. Überall in Ungarn kam es zu Widerstands- und Protestaktionen, die auch nach Beschwichtigungsversuchen Imre Nagys nicht eingestellt wurden. Die Auseinandersetzung zwischen Bevölkerung und Regierung gewann zunehmend den Charakter eines nationalen Kampfes des ungarischen Volkes gegen die sowjetischen Besatzer. Eine sowjetische Delegation, die die ungarische Regierung bei den Unruhen unterstützen sollte, sprach sich zunächst für eine friedliche Lösung des Konflikts durch die politische Gewinnung der Massen aus. Nagy setzte daraufhin am 30. Oktober die Wiedereinführung des Mehrparteiensystems durch, die MDP wurde aufgelöst und am 31. Oktober unter dem Namen MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) neugegründet. Spätestens die einen Tag später deklarierte Neutralität Ungarns wurde von der sowjetischen Parteiführung nicht mehr toleriert, es kam zur militärischen Intervention und zur Bildung einer sowjetisch gestützten Gegenregierung unter János Kádár, der vorher noch Mitglied der Regierung Nagy gewesen war. Die letzten größeren Kämpfe zwischen sowjetischen Truppen und Aufständischen endeten am 11. November 1956 in Budapest. Insgesamt kostete die Ungarn-Krise mehr als 20 000 ungarischen Staatsangehörigen das Leben, mehr als 200 000 Bürger verließen das Land aufgrund der im November 1956 einsetzenden politischen Verfolgungen und Säuberungen gen Westen. In den Vereinten Nationen boykottierte die Sowjetunion alle westlichen Initiativen in der Ungarn-Krise, so dass seitens der Westmächte lediglich humanitäre Hilfe geleistet wurde. Die internationale Entrüstung war groß, ein militärisches Eingreifen der Westmächte kam jedoch aufgrund der militärischen Lage in Europa nicht in Frage. Das Verhalten der USA in der UngarnKrise bedeutete faktisch die Abkehr der westlichen Supermacht von der aktiven Politik des »roll back« und die Anerkennung der sowjetischen Einflusssphäre in Osteuropa. Ungarn behielt im Ostblock dennoch eine gewisse Sonderstellung: Durch wirtschaftliche Reformen und dem daraus resultierenden »Gulaschkommunismus« konnte ein vergleichsweise hoher Lebensstandard der Bevölkerung garantiert werden. Julian-André Finke Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 23 Service Medien online/digital world wide web http://www.lebensgeschichten.net/ Einzelschicksale Neben Museen und Sonderausstellungen sind es vor allen Dingen Gedenkstätten und Mahnmale, die den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust in der öffentlichen Erinnerung in unserer Gesellschaft wach halten. Einen digitalen Einstieg in das Gedenken und Erinnern versucht ein Projekt des Arbeitskreises NS-Gedenkstätten NRW e.V. mit der Webseite »Das Lebensgeschichtliche Netz«. Die von Martin Rüther redaktionell bearbeitete Seite »ermöglicht aufschlussreiche Einblicke in die Geschichte der Jahre 1933 bis 1945« anhand von Einzelbiographien. Das »Netz« baut die Schicksale der vorgestellten Personen, die exemplarisch ausgewählt wurden, in die Geschichte des Nationalsozialismus ein, verknüpft die relevanten Themenbereiche und bietet dazu unterschiedliche Zugänge an. Momentan sind die Biographien von 28 Tätern und Opfern des Zweiten Weltkrieges auf der Seite zu finden. Die Lebensläufe einzelner Personen erleichtern den Zugang zur Zeit des Nationalsozialismus. Durch die Darstellung der Geschichte der Jüdin Käthe Stern, der einzigen Holocaust-Überlebenden von sieben Geschwistern, der 1939 die Auswanderung gelungen war, oder des SS-Gruppenführers und Generalleutnants der Polizei Otto Schumann, des »Schreibtischtäters«, gelingt es, dem Betrachter ein vielseitiges Bild der Regimezeit zu vermitteln, wodurch diese für ihn »anschaulicher, nachvollziehbarer und verständlicher« wird. Über die vier Hauptmenüpunkte »Einstieg«, »Nachschlagen«, »Dialog« und »Die Idee«, welche die Unterkapitel enthalten, kann man durch die Seite navigieren. Durch einen Klick auf »Lebensgeschichten« öffnet sich eine Seite zur Vorauswahl. Hier lassen sich die gewünschten Personen nach alphabetischer Sortierung, nach den Geburtsjahrgängen und nach Orten aufrufen. Ist die gesuchte Person durch den entsprechenden Link ausgewählt, findet man im mittleren Fenster eine Kurzbiographie und unter dem Porträt im rech- 24 ten Fenster kann man auf die jeweilige Lebensgeschichte zugreifen. In den einzelnen Biographien besteht nun die Möglichkeit, beliebig zwischen den Hauptinformationen, lexikalischen Begriffsdefinitionen, den zum chronologischen Zeitpunkt passenden Hintergrundinformationen und der Regionalgeschichte zu springen. Egal in welchem Kapitel man sich gerade auf der Seite befindet, man gelangt von überall durch einen Link in der oberen linken Ecke in die gewünschte Ebene und zurück auf die Hauptseite. Von »Geschichte« oder »Regionalgeschichte« aus bekommt man auch Zugriff auf chronologisch sortierte Informationen zur Welt- und Lokalgeschichte der Jahre 1914 bis 1990. Besonderer Wert wird natürlich auf die NS-Zeit 1933 bis 1945 gelegt. Jedoch hört die Geschichte der Opfer und Täter nicht immer und überall mit dem Kriegsende auf. Vielmehr zeigt auch hier das »Netz« in verknüpfender Art und Weise, wie politische oder wirtschaftliche Geschehnisse sich in den Einzelschicksalen niederschlagen. Besonders interessant sind die digitalisierten Originaldokumente, aus denen die biographischen Informationen zum Teil stammen. In diesen spiegelt sich dann nicht nur Authentizität der Aussagen wider, sondern dem Leser erscheinen die Personen realer und fassbarer. So ist die Notdienstverpflichtung, durch die der damals 15-jährige Henry Beissel im September 1944 zum Arbeitseinsatz am »Westwall« herangezogen wurde, in digitaler Form ein- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 sehbar; sie macht den Kriegsalltag anschaulicher. »Das Lebensgeschichtliche Netz« ist allerdings noch längst nicht fertig geknüpft. Interessenten sind aufgerufen, sich an dem Weiterbau und der Fortführung des Projektes zu beteiligen. Neben dem moderierten Forum, auf dem zur Kritik aufgerufen und um Beiträge gebeten wird, soll das Projekt eben auch um mehr Biographien erweitert und dadurch stärker vernetzt werden. Hierzu kann man sich direkt an die Redaktion wenden oder eine der beteiligten Einrichtungen kontaktieren. Vietnam Frühjahr 1968: Das militärische Engagement der USA dauerte bereits sieben Jahre an, 15 058 amerikanische Soldaten waren gefallen, weitere 109 527 verwundet worden. In den USA wurden die Stimmen derjenigen immer lauter, die die Beendigung des Krieges forderten. Am 25. April 1968 verließ der junge Gary Canant seine Frau Maxie, mit der er erst 18 Tage verheiratet war. Er wurde benötigt, um Kondolenzbriefe an die Angehörigen gefallener Soldaten zu schreiben. Mit seiner Frau hielt er die ganze Zeit bis zu seiner Rückkehr schriftlichen Kontakt. Der erste Brief an Maxie aus Vietnam stammt vom 7. Mai 1968. Auf den Tag genau 38 Jahre später veröffentlichte Canant nun die Briefe an seine Frau im Internet. Jeden Tag einen, insgesamt über 200 Briefe. digital http://www.dearmaxie.com Fast hautnah bekommt man den Krieg in den Briefen zu spüren. Als Canant am 15. Mai, genau zwei Monate verheiratet, seiner Frau schrieb, musste er während des Schreibens aufgrund eines Alarms in einen Unterstand wechseln und bei Kerzenlicht weiterschreiben, während eine halbe Meile entfernt Geschosse einschlugen. Gleichzeitig »beschwerte« er sich darüber – Krieg macht sarkastisch –, dass die Nordvietnamesen nicht jüdisch seien und keinen Respekt vor dem Sabbath hätten. Von Müdigkeit bis hin zu Aggression liest man aus den Briefen die Erfahrungen und Emotionen des Soldatenlebens heraus. Obwohl Canant nicht einmal direkt in der kämpfenden Truppe an der Front den Kriegsalltag erfährt, wünscht er sich doch nichts sehnlicher, als gesund und heil nach Hause zu kommen. Das Aufsetzen der Kondolenzbriefe macht auch für ihn den Tod alltäglich. Eine simple Menüsteuerung der Seite vereinfacht den Überblick. Direkt nach einer kurzen Vorstellung und Einleitung folgen die beiden wichtigsten Seiten. In »Today‘s Mail« werden jeden Tag die eingescannten und – der Leserlichkeit halber – noch einmal abgetippten Briefe veröffentlicht. Die »Shoe Box« ermöglicht es, vorangegangene Briefe nachzuschlagen. Unter »Maxi« ist ein längerer Kommentar von Canant‘s Frau nachzulesen und unter »Kevin« findet man die ersten Briefe und Bilder von seinem Sohn Kevin aus dem Irak von 2003. In den nächsten Menüpunkten kann sich der Leser neben Gedanken von Deutsche Geschichten Canant über seinen Kameraden Lieutenant Joyner, das Vietnam Memorial in Washington DC und einen ausgewählten Gästebucheintrag eines australischen Vietnam-Veteranen auch die ersten und letzten Einträge des veröffentlichten Buches anschauen. Dieses kann als PDF-Dokument auf CD bestellt werden und enthält neben einer umfangreichen Fotogalerie auf 123 Seiten zahlreiche ausgewählte Briefausschnitte mit Kommentaren. Vietnam wurde bereits in zahlreichen Veröffentlichungen und Filmen thematisiert. Doch die persönlichen und authentischen Zeugnisse dieser Seite lassen die allgegenwärtigen menschlichen Emotionen im Krieg wie Angst, Sehnsucht und Wut anschaulich werden. Ein weiteres Online-Projekt, das sich als »Work in Progress« präsentiert, wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Cine Plus Media Service ins Internet gestellt. Diese auf Mitarbeit der Nutzer ausgelegte Seite versucht neben der Darstellung der historischen Fakten auch über Zeitzeugeninterviews und zeitnahe Aufnahmen über 100 Jahre deutscher Geschichte informativ und anschaulich zugänglich zu machen. Die Jahre 1890 bis 2005 werden in sechs Zeiträumen präsentiert. Darin lassen sich jeweils Informationen zu den wichtigsten und bekanntesten Themengebieten abrufen. Über den Link »Mediathek« erreicht man die im chronologischen Rahmen gewählten, abrufbaren Audio- und Videodateien, die leider bisher nur mit dem Realplayer abgespielt werden können. Gerade dieser zentrale Zugriff auf Tonund Filmdokumente macht eine schnelle und bequeme Information für die politische und historische Bildung möglich. Eine Stichwort-Suchfunktion erleichtert das Auffinden spezieller Themen und lässt auch eine Eingrenzung gewünschter Dateiformate zu. Neben mehreren Veranstaltungshinweisen findet man auf der Hauptseite Links zur Journalseite, die monatlich mit einer Biographie, einem Schlaglicht und Literatur bestückt wird. StS http://www.deutschegeschichten.de Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 25 Service Lesetipp Ungarn 1956 A m 22. Oktober fordern ungarische Studenten in einer 14-Punkte-Resolution Ungeheuerliches, darunter auch den Abzug der sowjetischen Truppen – auf jeden Fall allemal genug, um lange Zeit in kommunistischen Kerkern zu schmachten. Der ungarische Schriftsteller György Dalos führt vor Augen, wie er als Dreizehnjähriger diese Forderungen aufnahm und die Tage des Aufstands 1956 selbst erlebte. Neben einer detailreichen Schilderung der Ereignisse werden anschaulich deren Vor- und Wirkungsgeschichte dargestellt. Den Gang der Dinge erfährt der Leser aus unterschiedlichsten Blickwinkeln: der obersten Führung im Kreml, der sowjetischen Botschaft in Ungarn und natürlich der ungarischen Beteiligten. Auch wie der Mann und die Frau von der Straße die Zeit erlebten, wird eindringlich geschildert. Dalos zitiert zahlreiche Schriftstellerkollegen. Vor allem hier wird immer wieder deutlich, welche Bedeutung der Aufstand im kollektiven Bewusstsein der Ungarn gewonnen hat, das, zumindest bis 1989, »die Zeit automatisch in ›davor‹ und ›danach‹ aufteilte«. Öffentlich über den Aufstand zu sprechen war verboten, weshalb er eine »Privatangelegenheit der Nation« wurde, so der Autor. György Dalos, 1956. Der Aufstand in Ungarn, München 2006. ISBN 3-40654973-X; 247 S., 19,40 Euro 26 Dalos legt ein Buch vor, das abgerundet durch ein kommentiertes Personenregister, eine Zeittafel und 17 Fotos von Erich Lessing zweierlei ist: das Buch eines Historikers mit seiner ganzen traurigen Bilanz sowie eines über das Erinnern – das eigene und das einer ganzen Nation. mt 50 Jahre Luftwaffe K ein bloßer Jubelband präsentiert sich anlässlich 50 Jahre Luftwaffe der Bundeswehr. Der Herausgeber Hans-Werner Jarosch konnte bei der Vorbereitung des Buches auf die Fachkenntnisse und das Engagement von 30 Autoren sowie vieler Berater vertrauen. Gelungen ist das umfangreiche Werk durch die Breite der Darstellung von der Gründung der Luftwaffe bis zur Luftwaffe im Einsatz, aber auch durch das Bemühen, die unterschiedlichen Facetten des »Teams Luftwaffe« mit seinen Menschen und der Technik darzustellen. Dass Flugzeuge und Fliegendes Personal im Mittelpunkt des Buches stehen, verwundert sicher nicht. Menschen, die die Luftwaffe prägten, werden in kleinen Porträts beschrieben, so etwa Johannes Steinhoff, Ludger Hölker (siehe Militärgeschichte, Heft 1+2/2005), Eberhard Eimler und Bernhard Mende. Unteroffiziere und Mannschaften der Luftwaffe werden als Gruppe vorgestellt. Hans-Werner Jarosch (Hrsg.), Immer im Einsatz. 50 Jahre Luftwaffe, Hamburg, Berlin und Bonn 2005. ISBN 3-8132-0837-0; 256 S., 29,90 Euro Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 Darüber hinaus finden sich interessante Beiträge, die über die eher »unbekannten« Verbände und Dienste informieren, sowie Texte zur Flugabwehrraketentruppe, den Führungsdiensten, Logistikverbänden und der Objektschutztruppe. Gerade dort lag die »militärische Heimat« der meisten Soldaten und Reservisten der Luftwaffe. Ein wenig Exotik bieten der Beitrag des deutschen Astronauten Thomas Reiter zur bemannten Raumfahrt und der Aufsatz von Hanspeter Broekelschen zu Luftwaffensoldaten »in der Diaspora«. Trotz aller Historie, der »Spirit« dieses Buches weist auf die Zukunft hin. Heiner Bröckermann Generale und Admirale der Bundeswehr W er sich über die Militärelite der DDR informieren will, findet schnell Hilfe. Wer sich hingegen mit den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr beschäftigen möchte, hat es schwerer. Die wenigen Veröffentlichungen zum Thema gehen oft nicht über eine Zusammenstellung der Lebensdaten hinaus. Bände wie die von Gerd F. Heuer oder von Clemens Range über die höchsten militärischen Führer der Bundeswehr bis 1990 sind die Ausnahme. Dieter E. Kilian, Elite im Halbschatten. Generale und Admirale der Bundeswehr, Bielefeld und Bonn 2005. ISBN 39806268-3-0; 556 S., 28,00 Euro Diese Lücke wurde nun zu einem erheblichen Teil von Oberst a.D. Dieter E. Kilian geschlossen. In seinem Band »Elite im Halbschatten« stellt er nicht nur die Spitzenmilitärs der Bundeswehr, sondern auch die (west-)deutschen Verteidigungsminister vor. Darüber hinaus bietet Kilian im Abschnitt »Licht und Schatten« eine Auswahl von Offizieren, die in die Geschichte der deutschen Streitkräfte eingegangen sind. Die Kurzbiographien basieren allerdings oft nur auf bereits vorliegenden Publikationen. Für den ersten Überblick reicht dies zwar aus, für die Forschung bleibt jedoch ein wissenschaftlicher Sammelband über die Gründergeneration wünschenswert. Vorangestellt ist den über 60 biographischen Skizzen eine ausführliche Einleitung, die das Problem der Bundeswehr als »geduldete Armee« (Clemens Range) thematisiert. Ein nützlicher Anhang mit Tabellen und Übersichten rundet den insgesamt gelungenen Band ab. Helmut R. Hammerich Kriegsverbrechen I n den Jahren 1935/36 griff Mussolinis faschistisch geführtes Italien den letzten unabhängigen afrikanischen Staat an, um sich ebenfalls einen »Platz an der Sonne« zu erobern. Der Schweizer Historiker Aram Mattioli widerlegt die Bilder eines zivilisatorisch geprägten Kolonialismus und eines »sauberen« Krieges in Äthiopien. Er stellt in eindrucksvoller Weise die Leiden des äthiopischen Volkes während des Krieges und der bis 1941 dauernden Besatzungszeit dar, das nicht nur unter völkerrechtswidrigen Exzessen der italienischen Invasoren litt, sondern darüber hinaus vom Völkerbund im Stich gelassen wurde. Der Einsatz moderner Waffen, Panzer, Flugzeuge und von Giftgas, kombiniert mit Kollektivstrafen und Exekutionen, vermittelt eine neue Art von Kriegführung. Hier tritt ein rassenideologischer Vernichtungswille zutage, der weniger zur Geschichte des Kolonialismus passt als vielmehr zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Die These vom »Experimentierfeld der Gewalt« wird gründlich nachgewiesen und historisch eingeordnet. Eine überaus lesenswerte Darstellung, die einen tiefen Eindruck hinterlässt, dem Leser Denkanstöße vermittelt und den Blick zum Teil auch auf aktuelle Krisen lenkt. StS Aram Mattioli, Experimentierfeld der Gewalt. Der Abessinienkrieg und seine internationale Bedeutung 1935–1941. Mit einem Vorwort von Angelo Del Boca (= Kultur – Philosophie – Geschichte. Reihe des Kulturwissenschaftlichen Instituts Luzern, Bd 3), Zürich 2005. ISBN 3-280-06062-1; 239 S., 38,80 Euro Rolf Uesseler untersucht daher in seiner Publikation »Krieg als Dienstleistung« das heutige Söldnerwesen. Schon der Untertitel »Private Militärfirmen zerstören die Demokratie« deutet an, welche Gefahren durch die »Privatisierung der Gewalt in den westlichen Ländern« drohen. Der Band bietet aber weitaus mehr: Im Rahmen der Globalisierung wird die »Kernkompetenz« moderner Söldner als militärische Dienstleister aufgezeigt. Private Militärfirmen und deren Auftraggeber werden analysiert. Einem geschichtlichen Abriss der »privaten Kriegswirtschaft« sowie der heutigen Rahmenbedingungen folgen Ausführungen über Konsequenzen dieser Entwicklung und ein Ausblick, wie Konflikte ohne den Einsatz von Söldnern gemeistert werden könnten. Die im Anhang befindlichen Literaturhinweise sowie eine Auflistung von Websites privater Militärfirmen bieten auch über die Publikation hinaus für jeden Interessierten die Möglichkeit, tiefer in die Materie einzudringen. jf Krieg als Dienstleistung D ie internationale Gemeinschaft sieht sich seit Ende des Ost-WestKonflikts, spätestens aber seit dem 11. September 2001, mit einer neuen Form von Konflikten konfrontiert. Die westlichen Staaten haben auf diese »asymmetrische Bedrohung«, die Kriegführung zwischen einem regulären Staat und irregulären Kräften, bislang eher hilflos reagiert. Aus diesem Grund wird derzeit wissenschaftlich untersucht, ob es derartige Konflikte schon früher gab, und ob Parallelen zur heutigen Situation gezogen werden können. Ein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem vor allem durch den IrakKonflikt in den Medien präsenten Söldnerwesen. Ein Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart kann aber nur dann gelingen, wenn für beides fundierte Analysen vorliegen. Rolf Uesseler, Krieg als Dienstleistung. Private Militärfirmen zerstören die Demokratie, Berlin 2006. ISBN 3-86153385-5; 240 S., 14,90 Euro Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 27 Berlin Boris Ignatowitsch. Fotografien von 1927 bis 1946 Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst Zwieseler Straße 4 (Ecke Rheinsteinstraße) D-10318 Berlin Telefon: 030 / 50 15 08-10 Telefax: 030 / 50 15 08 40 e-Mail: [email protected] Internet: www.museum-karlshorst.de Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt frei 17. November 2006 bis 11. Februar 2007 Eröffnung Donnerstag, 16. November 2006, 18.00 Uhr Verkehrsanbindungen: S-Bahn: bis S-Bahnhof Karlshorst: Ausgang Treskowallee, dann zu Fuß Rheinsteinstraße (ca. 15 min. Fußweg), bis S-Bahnhof Karlshorst (S3), dann Bus 396 oder mit der U-Bahn bis U-Bahnhof Tierpark (U5), dann Bus 396 Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962–1806. Altes Reich und neuer Staat 1495–1806 Deutsches Historisches Museum – PEI Bau Hinter dem Gießhaus 3 10117 Berlin Telefon: (030) 20 30 40 Telefax: (030) 20 30 45 43 website: www.dhm.de täglich 10.00 bis 18.00 Uhr 28. August bis 10. Dezember 2006 Verkehrsanbindungen: S-Bahn: Stationen »Hackescher Markt« und »Friedrichstraße«; U-Bahn: Stationen »Französische Straße«, »Hausvogteiplatz« und »Friedrichstraße«; Linienbus: 100, 157, 200 und 348, Haltestellen: »Staatsoper« oder »Lustgarten« 28 Ausstellungen ������������������ ���� ���������� ���� ��������� Service ��� ����� Karlsruhe ���� ���������� ����� �� ���� Von der Reformation zu den Erbfolgekriegen – 16. und 17. Jh. Badisches Landesmuseum Karlsruhe Schloss D-76131 Karlsruhe Telefon: 0721 / 92 66 514 Telefax: 0721 / 92 66 537 e-Mail: [email protected] Internet: www.landesmuseum.de Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Donnerstag 10.00 bis 21.00 Uhr Eintritt: 4,00 € ermäßigt: 3,00 € Schüler 0,50 € 11. November 2006 bis 11. März 2007 Verkehrsanbindungen: Straßenbahn: Vom Hauptbahnhof (Blickrichtung rechts, Hbf im Rücken) mit den Linien 2, S1, S4, S11 bis Haltestelle »Marktplatz« ��������� ��������� ���� �������� ���� �������� ������������������ ���������� ����� ��������� ��������������������� � �������������� ������������� �������������������������� ����� ������������� ���� ������� ���� ��������� ���� ��������� ���� �������� ����� ���� �������� �������� ������ ����� ����������� ����������� ���������� ���������� ������ ���� ���������� ��������� ����� ����� ������ ������������ 50 Jahre Luftwaffe der Bundeswehr. 1956–2006 Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Kladower Damm 182 D-14089 Berlin-Gatow Telefon: 030 / 36 87 26 01 Telefax: 030 / 36 87 26 10 e-Mail: LwMuseumBw [email protected] Internet: www.Luftwaffenmuseum.com Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 17.00 Uhr Eintritt frei (letzter Einlass 16.30 Uhr) 15. September 2006 bis 31. August 2007 Verkehrsanbindungen: Eintritt zum Museum: Ritterfelddamm/Am Flugfeld Gatow Ingolstadt Garnison Ingolstadt Bayerisches Armeemuseum – Reduit Tilly (Klenzepark) Paradestraße 4 85049 Ingolstadt Telefon: (08 41) 9 37 70 Telefax: (08 41) 9 37 72 00 e-Mail: sekretariat@ bayerisches-armeemuseum website: www.bayerischesarmeemuseum.de Dienstag bis Sonntag 8.45 bis 16.30 Uhr 30. Mai 2006 bis 6. Januar 2007 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 http://www.bwb.org/ 01DB022000000001/ CurrentBaseLink/ W26EJCH3034INFODE; Bahn/Bus: Ab Bahnhof Koblenz (Busbahnhof gegenüber) Linien 5 oder 15 bis »Langemarckplatz« Ludwigsburg Vor 50 Jahren Jahren – Die Bundeswehr kommt nach Ludwigsburg Garnisonmuseum Ludwigsburg im Asperger Torhaus Asperger Straße 52 D-71634 Ludwigsburg Telefon: 07141 / 91 02 412 Telefax: 07141 / 91 02 342 Koblenz Die Maschinenpistole. Entwicklung und Geschichte einer Waffe unter besonderer Berücksichtigung der MP2-UZI Wehrtechnische Studiensammlung Mayener Straße 85–87 D-56070 Koblenz Telefon: 0261 / 40 01 42 3 Telefax: 0261 / 40 01 42 4 e-Mail: [email protected] Internet: www.bwb.org/wts täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr Eintritt: 1,50 € (für Soldaten und Bw-Verwaltung frei) 24. August 2006 bis 9. September 2007 (Rosenmontag und vom 24. Dezember 2006 bis 1. Januar 2007 geschlossen) Verkehrsanbindungen: PKW: Eine Anfahrtsskizze gibt es unter Internet: www.garnison museum-ludwigsburg.de e-Mail: stadtarchiv@ stadt.ludwigsburg.de Mittwoch 15.00 bis 18.00 Uhr Sonnabend 13.00 bis 17.00 Uhr und nach Vereinbarung Eintritt: 2,00 € ermäßigt: 1,00 € 23. September bis 28. April 2007 Verkehrsanbindungen: S-Bahn: Linien S4 und S5 (von Stuttgart bzw. Bietigheim) bis zur Station »Ludwigsburg« Munster Niederstetten 50 Jahre Bundeswehr in Munster Deutsches Panzermuseum Munster Hans-Krüger-Straße 33 D-29633 Munster Telefon: 0519 / 22 55 2 Telefax: 0519 / 21 30 215 e-Mail: [email protected] Internet: www.munster.de/pzm Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 5,00 € Ermäßigt: 2,50 € März bis November 2006 montags geschlossen (letzter Einlass 17.00 Uhr) An den Feiertagen auch montags geöffnet Verkehrsanbindungen: PKW: Eine Anfahrtsskizze gibt es unter www.munster.de/pzm/content/ kontakt/anfahrt.htm Von der Bahn: vom Bahnhof MUNSTER entweder mit Taxi oder zu Fuß über Bahnhofsstraße, Wagnerstraße und Söhlstraße zur Hans-KrügerStraße (ca. 15 Minuten Fußweg) Bundeswehr im Einsatz – Von der Bündnisverteidigung zum Einsatz im Bündnis Hermann-Köhl-Kaserne 97996 Niederstetten Telefon: (0 79 32) 971 - 4154 e-Mail: Westmann/Heer/ BMVg/DE@BUNDESWEHR 25. Oktober bis 8. November 2006 Entschieden für Frieden – 50 Jahre Bundeswehr Soldatenheim Munster »Zum Örtzetal« Danziger Str. 74-76 29633 Munster Telefon: (0 51 92) 12 23 70 11. bis 24. Oktober 2006 Ausstellung an drei Standorten Museum in der Kaiserpfalz Erzbischöfliches Diözesanmuseum Städtische Galerie Am Abdinghof Telefon: (0 52 51) 88 29 80 Telefax: (0 52 51) 88 29 90 e-mail: [email protected] website: www.canossa2006.de Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 20.00 Uhr Nordholz Lili Marleen. Ein Schlager macht Geschichte Aeronauticum Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum Peter-Strasser-Platz 3 D-27637 Nordholz Telefon: 04741 / 18 19 0 Telefax: 04741 / 18 19 15 e-Mail: [email protected] Internet: www.aeronauticum.de Wilhelmshaven Eintritt: 9,00 Euro ermäßigt: 6,00 Euro 21. Juli bis 5. November 2006 Verkehrsanbindungen: Alle drei Objekte sind direkt im Stadtzentrum und zu Fuß sehr gut zu erreichen Sonthofen täglich 10.00 bis 18.00 Uhr (Von November bis Februar letzter Einlass 16.30 Uhr) Eintritt: 6,50 € (Erwachsene) 1,50 € (Kinder) 4. Oktober 2006 bis 6. Januar 2007 Verkehrsanbindung: PKW: Eine Anfahrtsskizze gibt es unter www.aeronauticum.de/ deutsch/service/ anfahrtskarte.html Paderborn Canossa – Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Anfang der Romanik e-Mail: [email protected] Internet: www.koenigreichwuerttemberg.de täglich (außer Montag) 10.00 bis 20.00 Uhr, (während des Weihnachtsmarktes 2006 täglich von 10.00 bis 20.30 Uhr) Eintritt: 10,00 € Ermäßigt: 7,00 € 22. September 2006 bis 4. Februar 2007 Kinder (14–18 Jahre): 2,00 € Kinder bis 14 Jahre frei Entschieden für Frieden – 50 Jahre Bundeswehr Schule für Feldjäger und Stabsdienst Generaloberst-BeckKaserne Hofener Straße 16 87527 Sonthofen Telefon: (0 83 21) 278-54 80 oder 54 82 6. bis 24. November 2006 Stuttgart Das Königreich Württemberg 1806–1918. Monarchie und Moderne Württembergisches Landesmuseum Stuttgart Altes Schloss Schillerplatz 6 D-70173 Stuttgart Telefon: 0711 / 27 93 498 Telefax: 0711 / 27 93 492 Blaue Jungs im Bündnis. 50 Jahre Marine der Bundesrepublik Deutschland Deutsches Marinemuseum Südstrand 125 D-26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 / 41 06 1, Kasse -45 58 65 Telefax: 04421 / 41 06 3 e-Mail: [email protected] Internet: www.marinemuseum.de täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 8,50 € Ermäßigt: ab 4,00 € 24. Mai 2006 bis 30. November 2006 Verkehrsanbindungen: PKW: Über die A29 Richtung Wilhelmshaven bis Ausfahrt Stadtmitte. Über die B210 aus Richtung Jever nach Wilhelmshaven. Innerorts den blauen Hinweisschildern »Maritime Meile« folgen, bis »Deutsches Marinemuseum« ausgeschildert ist. Alternativ der Beschilderung »Südstrand« oder »Helgolandkai« folgen. Stadtpläne befinden sich auf den Infosäulen an den Ortseingängen. Bahn/Bus: Von Mitte Mai bis Mitte September kann man vom ZOB aus mit der Buslinie 8 direkt zum Deutschen Marinemuseum fahren Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 29 Am 4. Juli 1776 erklärten 13 britische Kolonien Amerikas ihre Unabhängigkeit. Ihnen waren hohe Abgaben auferlegt, jegliche Mitspracherechte aber verweigert worden. Der »Kontinentalarmee« unter George Washington standen reguläre Truppen aus Großbritannien, Hessen-Kassel und Ansbach-Bayreuth gegenüber, verstärkt durch Englandtreue Siedler und Indianer. Die Briten waren in Organisation und Ausrüstung über-, an Zahl aber unterlegen. Sie hatten logistische Probleme, zersplitterten ihre Kräfte in der Weite des Raumes und führten keine Entscheidung herbei. Ab 1778 unterstützten Frankreich, Spanien und die Niederlande die Aufständischen militärisch. Im Juli 1781 schuf sich der britische General Charles Cornwallis mit 7500 Mann in der Hafenstadt Yorktown, Virginia, eine feste Operationsbasis. Eine französischen Flotte brachte den Aufständischen Verstärkung, da es der Royal Navy nicht gelang, sie abzudrängen. Yorktown war zudem von See abgeschnitten. Washington belagerte ab 14. September mit ca. 20 000 Mann Yorktown. In der Stadt mangelte es rasch an Nahrung, Krankheiten breiteten sich aus. Es folgten mehrfache vernichtende Kanonaden und vergebliche Ausfallversuche. Am 14. Oktober drangen französische und amerikanische Sturmtruppen mit dem Bajonett in die äußeren Verteidigungswerke ein. Cornwallis kapitulierte am 19. Oktober 1781. Es wurden auf beiden Seiten viele Soldaten aus Deutschland eingesetzt, daher wird Yorktown auch als »deutsche Schlacht« bezeichnet. Der Krieg endete erst 1783, aber die Entscheidung über die Unabhängigkeit der USA war in Yorktown gefallen. Marcus von Salisch 1906–2006 AP Sturm auf Yorktown, Virginia Zeitschrift für historische Bildung Vorschau Seit November 1966 trägt die Bundeswehrkaserne in Hardheim im fränkischen Odenwald den Namen von Carl Schurz. Wer genau war dieser Mann, der vor 100 Jahren im Mai 1906 in New York starb und der vom gescheiterten Revolutionär 1848/49 zum Unionsgeneral und Innenminister der USA aufstieg? Diese Frage wird uns in der nächsten Ausgabe der »Militärgeschichte« Wolfgang Hochbruck beantworten und zugleich aufzeigen, welche Bedeutung Carl Schurz noch heute als demokratisches Vorbild hat. Dabei ist Carl Schurz nicht der einzige emigrierte deutsche Demokrat, der geprägt durch die Revolution von 1848/49 im amerikanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten wieder zu den Waffen griff. Die Geschichte der »Fortyeighter«und ihre Rolle im Amerikanischen Bürgerkrieg 1861-1865 wird Jürgen Dick in einem eigenen Beitrag eingehender beleuchten. General a.D. Johann Adolf Graf von Kielmansegg Graf Kielmansegg trat 1926 in das Reiterregiment 16 (Erfurt) der Reichswehr ein, seine Generalstabsausbildung erfolgte bei der Wehrmacht. Er diente ab 1939 in verschiedenen Truppen- und Stabsverwendungen in Polen, Frankreich und Russland. Als Mitwisser des 20. Juli 1944 inhaftiert, wurde er als Regimentskommandeur zur »Bewährung« an die Westfront versetzt. Von 1946 bis 1950 arbeitete Graf Kielmansegg als Verlagskaufmann und freier Journalist. Danach war er im »Amt Blank« tätig, dem Vorläufer des Bundesministeriums der Verteidigung. Die Himmeroder Denkschrift wurde von Graf Kielmansegg zu Papier gebracht, wobei ihm der Abschnitt über die Innere Führung ein besonderes Anliegen war. 1955 ging der neu ernannte Berufssoldat zum ersten Mal zur NATO. Ab 1958 folgten Verwendungen als Stellv. Divisionskommandeur in Koblenz und als Kommandeur der 10. Panzerdivision in Sigmaringen. Sein Konzept der Inneren Führung bewährte sich in der Praxis. Als Oberbefehlshaber der Alliierten Landstreitkräfte bzw. der Streitkräfte in Europa-Mitte (LANDCENT/CINCENT)) konnte Graf Kielmansegg von 1963 bis 1968 die deutsche Stellung im Bündnis stärken. Nach seiner Pensionierung nahm er als gefragter Experte Einfluss auf die Weiterentwicklung der Streitkräfte. Graf Kielmansegg hat sowohl die innere Verfasstheit und die organisatorische Struktur der Bundeswehr als auch die Operationsplanungen der NATO in den 1960er Jahren maßgeblich beeinflusst. General a.D. de Maizière bezeichnete ihn nicht umsonst als den einflussreichsten Reformer, ja sogar als den wichtigsten »Gründervater« der Bundeswehr. Helmut R. Hammerich 30 Militärgeschichte Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 ullstein bild agk-images 14. Oktober 1781 Militärgeschichte kompakt Heft 4/2006 Service Carl Schurz während des amerikanischen Bürgerkrieges in der Uniform eines Unionsgenerals. Im selben Jahr, in dem die Hardheimer Kaserne ihren neuen Namen erhielt, wurde Generalleutnant Johannes Steinhoff Inspekteur der Luftwaffe. Heute ist er selbst Namenspatron einer Bundeswehrkaserne in BerlinGatow sowie eines Jagdgeschwaders der Luftwaffe. Heiner Möllers wird uns in seinem Beitrag die Person Johannes Steinhoff näher bringen. Der bereits für das Heft 3 angekündigte Artikel von Friedrich Furrer über »Antike Kriegskosten« wird ebenfalls im kommenden Heft erscheinen. mn Militärgeschichte im Bild Ulrich de Maizière (1912–2006) Herausforderungen und Antworten eines Soldaten im Übergang U lrich de Maizière war Soldat in drei deutschen Armeen. Ausgebildet wurde er noch in der Reichswehr (1930–1933), weitere Prägung erfuhr er als Generalstabsoffizier der Wehrmacht (1933–1945), um schließlich bei Planung und Aufbau der Bundeswehr (1951–1972) führend mitzuwirken. Damit verbunden waren einschneidende Übergänge: von der Diktatur zur Demokratie, von der Nationalarmee zur Bündnisstreitmacht, vom Angehörigen eines herausgehobenen Kriegerstandes zum »Staatsbürger in Uniform«. Die »Gründergeneration« neuer und zunächst westdeutscher, seit 1990 gesamtdeutscher Streitkräfte stand somit vor ganz neuen Herausforderungen: Sicherheit würde es nach dem Untergang des Reiches künftig nicht mehr national, sondern nur noch im Bündnisrahmen geben. Die neuen Streitkräfte waren fest in die Ordnung des Grundgesetzes zu integrieren. Die Bundeswehr als Wehrpflichtarmee musste sich aber auch in ihrem inneren Zuschnitt an die gesellschaftlichen Veränderungen anpassen und zu einer kritischen Öffentlichkeit hin öffnen. In der Himmeroder Denkschrift von 1950 hatten die künftigen militärischen Planer zwar ein wichtiges Signal für Reformen gegeben, dass »ohne Anlehnung an die Formen der alten Wehrmacht heute grundlegend Neues zu schaffen ist«. Schaffen musste man dieses Neue aber mit dem Führerkorps aus den Streitkräften vor 1945, denn die Bündnispartner forderten mit Vorrang rasche und effiziente Verstärkungen ihrer Verbände gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner. Dieser Spannungsbogen aus militärischen Forderungen von außen und inneren Vorgaben für eine Integration der Streitkräfte in Staat und Gesellschaft lässt sich an der Laufbahn von Ulrich de Maizière nachzeichnen. Einsatz aus Überzeugung verteidigen Schon der militärische Sachverständige zu wollen. Innere Führung war so gesein den Verhandlungen um einen west- hen kein taktisches Entgegenkommen deutschen Allianzbeitritt orientierte an einen gewandelten Zeitgeist, sonsich an einer Ausgewichtung des trans- dern ein notwendiges Führungsinstruatlantischen und des westeuropäischen ment zur Heranbildung und Führung Pfeilers im Bündnis. Nur so ließ sich des modernen Soldaten unter verändem eigentlichen Dilemma deutscher derten militärischen HerausforderunVerteidigung begegnen: der Abhängig- gen. keit von atomarer Abschreckung zur In den Augen mancher Kritiker der Kriegsverhinderung, aber verbunden Gründergeneration der Bundeswehr mit der Forderung nach einer wirksa- (Heusinger, Graf Kielmansegg, Graf men Verteidigung im Falle eines Krie- Baudissin und de Maizière) stellten solges, um das eigene Territorium vor un- che komplexen Antworten ein zu groannehmbaren Schäden zu bewahren. ßes Entgegenkommen an Politik und Dabei blieb der Rückgriff auf Atom- Öffentlichkeit dar. Sie übersahen, dass waffen aus Sicht der NATO auch dann der Systemkonflikt zwischen Ost und noch notwendig, wenn deutsche Streit- West mit seinen politischen, ökonomikräfte die größten Lücken im mitteleu- schen, gesellschaftlichen und militäriropäischen Verteidigungsschild ge- schen Bedrohungsmustern zu komplex schlossen haben würden. Daraus zog war, um einfache, vermeintlich soldatischon de Maizière als Leiter der Unter- schere Antworten zuzulassen. abteilung Führung im BundesministeBruno Thoß rium für Verteidigung (1955–1958) zwei weitere Folgerungen, denen er seiner ganzen Laufbahn bis hin zum Generalinspekteur (1966–1972) treu blieb: Militärische Verteidigung musste mit dem Zivilschutz schon im Frieden so engmaschig verzahnt werden, dass daraus ein wirksames System der zivil-militärischen Gesamtverteidigung entstand. Und der neue Soldat musste die Werte des Grundgesetzes alltägDie Erprobung der Brigadegliederung während der lich erfahren können, Lehr- und Versuchsübung (LV 58) im Herbst 1958. um sie als »Staatsbür- Brigadegeneral Ulrich de Maizière, Kommandeur der ger in Uniform« im Kampfgruppe A 1 in Hannover, als Kommandeur einer Kalten Krieg wie im Übungsbrigade Bundesregierung/Egon Steiner Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2006 31 NEUE PUBLIKATIONEN DES MGFA Johannes Berthold Sander-Nagashima, Die Bundesmarine 1950 bis 1972. Konzeption und Aufbau. Mit Beiträgen von Rudolf Arendt, Sigurd Hess, Hans-Joachim Mann, KlausJürgen Steindorff, München: Oldenbourg , X, 606 S. (= Sicherheitspolitik und Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland, 4), 39,80 Euro, ISBN 10: 3-486-57972-X, ISBN 13: 978-3-486-57972-7 Rudolf J. Schlaffer Der Wehrbeauftragte 1951 bis 1985 Rudolf J. Schlaffer, Der Wehrbeauftragte 1951 bis 1985. Aus Sorge um den Soldaten, München: Oldenbourg 2006, XIV, 386 (= Sicherheitspolitik und Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland, 5), 26,80 Euro, ISBN 10: 3-486-58025-6, ISBN 13: 978-3-486-58025-9 Aus Sorge um den Soldaten OLDENBOURG ������������������������ ������������� ��������� ����� Wegweiser zur Geschichte: Kongo. Im Auftrag des MgFA hrsg. von Bernhard Chiari und Dieter Kollmer, 2., durchges. Aufl., Paderborn: Ferdinand Schöningh 2006, 216 S. (= Wegweiser zur Geschichte), 12,90 Euro, ISBN 10: 3-506-75745-8, ISBN 13: 978-3-506-75745-6 ���� Wegweiser zur Geschichte: Kosovo. Im Auftrag des MGFA hrsg. von Bernhard Chiari und Agilolf Keßelring, Paderborn: Ferdinand Schöningh 2006, 240 S. (= Wegweiser zur Geschichte), 13,90 Euro, ISBN 10: 3-506-75665-6, ISBN 978-3-506-75665-3 �������������� ������������������� ����������������������� ������������������������ Daniel Niemetz, Das feldgraue Erbe. Die Wehrmachteinflüsse im Militär der SBZ/DDR, Berlin: Ch. Links 2006, X, 345 S. (= Militärgeschichte der DDR, 13), 29,90 Euro, ISBN -10: 3-86153-421-5, ISBN-13: 978-86153-421-1