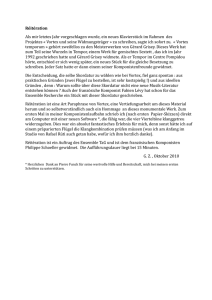Gerald Resch: Ins Innenleben der Klänge
Werbung
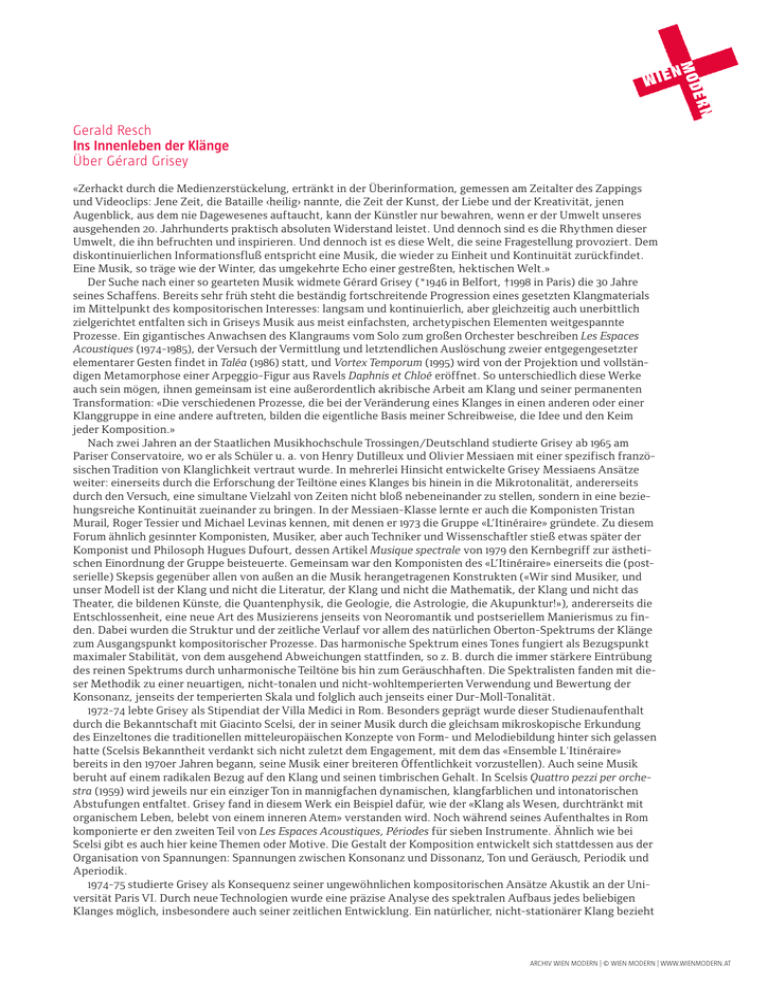
Gerald Resch Ins Innenleben der Klänge Über Gérard Grisey «Zerhackt durch die Medienzerstückelung, ertränkt in der Überinformation, gemessen am Zeitalter des Zappings und Videoclips: Jene Zeit, die Bataille ‹heilig› nannte, die Zeit der Kunst, der Liebe und der Kreativität, jenen Augenblick, aus dem nie Dagewesenes auftaucht, kann der Künstler nur be­wahren, wenn er der Umwelt unseres ausgehenden 20. Jahr­hunderts praktisch absoluten Widerstand leistet. Und dennoch sind es die Rhythmen dieser Umwelt, die ihn befruchten und inspirieren. Und dennoch ist es diese Welt, die seine Fra­ge­stellung provoziert. Dem diskontinuierlichen Informa­ti­ons­fluß entspricht eine Musik, die wieder zu Einheit und Konti­nuität zurückfindet. Eine Musik, so träge wie der Winter, das umgekehrte Echo einer gestreßten, hektischen Welt.» Der Suche nach einer so gearteten Musik widmete Gérard Grisey (*1946 in Belfort, †1998 in Paris) die 30 Jahre seines Schaffens. Bereits sehr früh steht die beständig fortschreitende Progression eines gesetzten Klangmaterials im Mittelpunkt des kompositorischen Interesses: langsam und kontinuierlich, aber gleichzeitig auch unerbittlich zielgerichtet entfalten sich in Griseys Musik aus meist einfachsten, archetypischen Ele­men­ten weitgespannte Prozesse. Ein gigantisches Anwachsen des Klangraums vom Solo zum großen Orchester beschreiben Les Espaces Acoustiques (1974-1985), der Versuch der Ver­mit­tlung und letztendlichen Auslöschung zweier entgegengesetzter elementarer Gesten findet in Taléa (1986) statt, und Vortex Temporum (1995) wird von der Projektion und vollständigen Metamorphose einer Arpeggio-Figur aus Ravels Daphnis et Chloé eröffnet. So unterschiedlich diese Werke auch sein mögen, ihnen gemeinsam ist eine außerordentlich akribische Arbeit am Klang und seiner permanenten Trans­formation: «Die verschiedenen Prozesse, die bei der Ver­änderung eines Klanges in einen anderen oder einer Klang­gruppe in eine andere auftreten, bilden die eigentliche Basis meiner Schreib­weise, die Idee und den Keim jeder Kompo­sition.» Nach zwei Jahren an der Staatlichen Musikhochschule Trossingen/Deutschland studierte Grisey ab 1965 am Pariser Conservatoire, wo er als Schüler u. a. von Henry Dutilleux und Olivier Messiaen mit einer spezifisch französischen Tradition von Klanglichkeit vertraut wurde. In mehrerlei Hinsicht entwickelte Grisey Messiaens Ansätze weiter: einerseits durch die Erforschung der Teiltöne eines Klanges bis hinein in die Mikrotonalität, andererseits durch den Versuch, eine simultane Vielzahl von Zeiten nicht bloß nebeneinander zu stellen, sondern in eine beziehungsreiche Kontinuität zueinander zu bringen. In der Messiaen-Klasse lernte er auch die Komponisten Tristan Murail, Roger Tessier und Michael Levinas kennen, mit denen er 1973 die Gruppe «L’Itinéraire» gründete. Zu diesem Forum ähnlich gesinnter Komponisten, Musiker, aber auch Techniker und Wissenschaftler stieß etwas später der Komponist und Philosoph Hugues Dufourt, dessen Artikel Musique spectrale von 1979 den Kernbegriff zur ästhetischen Einordnung der Gruppe beisteuerte. Gemeinsam war den Komponisten des «L’Itinéraire» einerseits die (postserielle) Skepsis gegenüber allen von außen an die Musik herangetragenen Konstrukten («Wir sind Musiker, und unser Modell ist der Klang und nicht die Literatur, der Klang und nicht die Mathematik, der Klang und nicht das Theater, die bildenen Künste, die Quantenphysik, die Geologie, die Astrologie, die Akupunktur!»), andererseits die Entschlossen­heit, eine neue Art des Musizierens jenseits von Neoromantik und postseriellem Manierismus zu finden. Dabei wurden die Struktur und der zeitliche Verlauf vor allem des natürlichen Oberton-Spektrums der Klänge zum Ausgangspunkt kompositorischer Prozesse. Das harmonische Spektrum eines Tones fungiert als Bezugspunkt maximaler Stabilität, von dem ausgehend Ab­weichungen stattfinden, so z. B. durch die immer stärkere Eintrübung des reinen Spektrums durch unharmonische Teil­töne bis hin zum Geräuschhaften. Die Spektralisten fanden mit dieser Methodik zu einer neuartigen, nicht-tonalen und nicht-wohltemperierten Verwendung und Bewertung der Konsonanz, jenseits der temperierten Skala und folglich auch jenseits einer Dur-Moll-Tonalität. 1972-74 lebte Grisey als Stipendiat der Villa Medici in Rom. Besonders geprägt wurde dieser Studienaufenthalt durch die Bekanntschaft mit Giacinto Scelsi, der in seiner Musik durch die gleichsam mikroskopische Erkundung des Einzeltones die traditionellen mitteleuropäischen Konzepte von Form- und Melodiebildung hinter sich gelassen hatte (Scelsis Bekanntheit verdankt sich nicht zuletzt dem Engage­ment, mit dem das «Ensemble L'Itinéraire» bereits in den 1970er Jahren begann, seine Musik einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen). Auch seine Musik beruht auf einem radikalen Bezug auf den Klang und seinen timbrischen Gehalt. In Scelsis Quattro pezzi per orchestra (1959) wird jeweils nur ein einziger Ton in mannigfachen dynamischen, klangfarblichen und intonatorischen Abstufungen entfaltet. Grisey fand in diesem Werk ein Beispiel dafür, wie der «Klang als Wesen, durchtränkt mit organischem Leben, belebt von einem inneren Atem» verstanden wird. Noch während seines Aufent­haltes in Rom komponierte er den zweiten Teil von Les Espaces Acoustiques, Périodes für sieben Instrumente. Ähnlich wie bei Scelsi gibt es auch hier keine Themen oder Motive. Die Gestalt der Komposition entwickelt sich stattdessen aus der Organisation von Spannungen: Spannungen zwischen Konsonanz und Dissonanz, Ton und Geräusch, Periodik und Aperiodik. 1974-75 studierte Grisey als Konsequenz seiner ungewöhnlichen kompositorischen Ansätze Akustik an der Uni­ versität Paris VI. Durch neue Technologien wurde eine präzise Analyse des spektralen Aufbaus jedes beliebigen Klanges möglich, insbesondere auch seiner zeitlichen Entwicklung. Ein natürlicher, nicht-stationärer Klang bezieht ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT seine Charakte­ri­stik aus den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen sich seine Teiltöne zu verschiedenen Intensitäten entfalten und wieder abbauen. Grisey begann vertieft, derartige mikrostrukturelle Modelle der akustischen Eigenschaften, also inneren Lebendigkeit eines Klanges als Modelle für die Makrostruktur seiner Kompositionen zu verwenden. Der Beginn von Partiels, dem dritten Teil der Espaces Acoustiques beispielsweise, komponiert den natürlichen Einschwingvorgang eines tiefen Grund­­­tones gleichsam in Zeitlupe gedehnt nach: Auf das initiale E von Posaune und Kontrabass reagiert das Ensemble mit der Bildung eines Turms aus ungeradzahligen Teiltönen desselben E. Die Art, in der die Töne aufeinanderfolgen, ist ganz offensichtlich eng an den natürlichen Einschwing­vor­gang angelehnt, allerdings extrem verlangsamt, damit das Ohr dem Prozess folgen kann, der in Wirklichkeit in wenigen Bruch­­teilen einer Sekunde stattfindet. Diese sogenannte synthèse instrumentale, also das annähernde Nachbauen der spektralen Entwicklung eines Einzeltones mit den instrumentalen Möglichkeiten eines Ensembles, ist aber offensichtlich eine Multiplikation der Komplexität des Ausgangsmodells. Bei der Entlehnung naturwissenschaftlicher Modelle ging es Grisey nicht darum, seine Musik außermusikalisch abzusichern, sondern darum, ein Werkzeug für musikalische Erfindung zu gewinnen, das ihm letztendlich die musikalische Nutzbarkeit des stufenlosen Kontinuums zwischen Sinuston und weißem Rauschen eröffnete. In Prologue, dem ersten Teil der Espaces Acoustiques, entfaltet sich in sehr langsam größer werdenden melodischen Phrasen das natürliche Obertonspektrum eines – imaginären, da niemals erklingenden – Kontra-E. Im Laufe der Ausbrei­tung dieser melodischen Wellen werden immer höhere, entlegenere und durch ihre Mikrotonalität vom Grundton scheinbar entferntere Teiltöne des Spektrums erfaßt. Der eindimen­si­onal zielgerichtete Prozess wird durch die Einführung zweier Störelemente zugespitzt und dramatisiert: einerseits durch das immer wiederkehrende herzschlagähnliche Pochen des tiefen H, andererseits durch das eskalierende Einschmuggeln «falscher» (Ober-) Töne, das schließlich in charakteristischen Abwärtskaskaden kulminiert, deren Geräuschhaftigkeit (extremes ponticello-Spiel ohne vorgeschriebene Tonhöhe) gewissermaßen die Konsequenz eines immer tieferen Ein­dringens ins Spektrum darstellt. Noch umfangreicher und in ihrer Anwendung verfeinert finden Prozeduren der akustischen Analyse Eingang in Modulations (1976/77): Sonogramme zahlreicher Instru­men­talklänge, Filterungen verschiedener Spektren, Ring­modula­tionen und Differentialtöne, aber auch die Spiegel­ung des Spektrums von oben nach unten wurden zum Ausgangspunkt großdimensionierter Entwicklungen, die wiederum zwischen den Polen von Ruhe (Harmonik/Period­ik), Spannung (von der Harmonik zur Inharmonik, von der Periodik zur Aperiodik) und Entspannung (entgegengesetzte Bewegung) frei changieren. «In meiner Musik läßt sich der Klang niemals für sich selbst betrachten; er ist immer durch den Filter seiner Geschichte gegangen. Wohin geht er? Woher kommt er? Diese Frage stelle ich mir in jedem Augenblick, bei jeder Partitur, die ich gerade schreibe … Es ist mir nicht länger möglich, die Töne als festgesetzte und untereinander permutierbare Objekte aufzufassen. Sie erscheinen mir eher wie Bündelungen zeitgerichteter Kräfte. Diese Kräfte – ich verwende den Aus­druck mit Bedacht und bediene mich nicht des Wortes Form – sind unendlich beweglich und fließend; sie leben wie Zellen, haben eine Geburt und einen Tod und tendieren vor allem zu einer ständigen Transformation ihrer Energie.» Mit Jour, contre-jour (1978/79) für elektronische Orgel, 13 Musiker und Vierspur-Tonband erreichte Grisey die Grenze, an die eine Ästhetik der immer extremeren Vermitt­lung und potentiell unendlichen Kontinuität von Klangver­läufen vielleicht notwendigerweise stößt. So wurde es für ihn im Verlauf der 80er Jahre notwendig, seine musikalische Sprache um das Prinzip des unvermittelten Kontrasts zu erweitern. Zwar flossen die Erfahrungen der Komposition des Schlagzeug-Stücks Tempus ex Machina I (1979) nur mittelbar in die erweiterte rhythmische Welt von Transitoires (1980/81) ein, dennoch bemerkt man neue Einflüsse in seiner Musik. In einem Artikel mit dem Titel Autoportrait avec L'Itinéraire schreibt Grisey 1984: « … ich entdecke, daß es Zeit ist, zur fixen Idee der Kontinuität und Langsamkeit der Prozesse die Prinzipien von Bruch und Geschwindigkeit hinzuzufügen. Ist das der Einfluß der afrikanischen Musik oder des Jazz, die ich während meines Aufenthaltes in Kalifornien entdeckt habe? Ist es die Entdeckung von Conlon Nancarrow – dem größten Rhythmiker seit Strawinski – und seiner insektenartigen Musik, in der die zusammengedrängte Zeit unsere Wahrneh­mung stark erregt und bis hin zur Verwirrung stimuliert? Ist es die Klarheit Janáceks, dessen Opern ich studiere, und seine fortwährenden und abrupten Unterbrechungen des Tempos?» Auffällig ist, dass die einzelnen Teile der Espaces Acousti­ques, je weiter die Entstehung des Zyklus voranschreitet, immer stärker von der Komposition anderer Werke unterbrochen werden. Auch die Abstände, in denen die letzten Sätze fertiggestellt werden, beginnen größer und größer zu werden. Fast scheint es so, als sei Epilogue (1985) der künstliche Ab­schluss eines Wucherungs-Prozesses, der einmal in Gang gesetzt, kein «natürliches» Ende finden könnte. Viel­leicht sind die Ursachen für dieses offensichtlich immer lang­samere Kom­ponieren an den Espaces Acoustiques im Wechsel der Lebens­orte Griseys begründet (1980-82 war er Stipendiat des DAAD in Westberlin, 1982-87 unterrichtete er an der Uni­versity of California in Berkeley). Vielleicht liegt es aber auch in der Natur eines derartig monumentalen Unterfangens, daß es immer schwieriger wird, die auseinanderstrebenden Kräfte des Werkes zu bündeln und zu einem verbindlichen Schluß zu zwingen. Die Neubestimmung der musikalischen Sprache findet in Taléa (1986) für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier statt, das unmittelbar nach Epilogue entstanden ist. Das bislang streng prozessuale Komponieren bedeutete immer auch die Harmonisierung der Gegensätze. In Taléa aber rückt die Polarität der Elemente ins Zentrum des Interesses: Zwei kontrastierende Gesten – die eine schnell, aufsteigend und laut, die andere langsam, absteigend und leise – werden einander angenähert, ohne dabei ihre Unvereinbarkeit jemals ganz zu verlieren. Ähnlich wie in Prologue machen sich in immer stärkerem Maße Störfaktoren breit, die zu wuchern beginnen und das Stück letztendlich aus den Nähten seines bisherigen Verlaufs platzen lassen. «Vom Gesichtspunkt der Wahrnehmung aus erscheint mir der 1. Teil wie ein unerbittlicher Prozeß, eine wahrhafte Maschine, die die Freiheit, die im 2. Teil auftauchen wird, aufbauen soll. Das Vorgehen dieses 2. Teils wird nämlich von mehr oder weniger irrationalen Erscheinungen durchlöchert, wie Erinnerungen an den 1. Teil, die allmählich durch den neuen Kontext gefärbt werden, bis sie nicht mehr erkennbar sind. Dieses Unkraut, diese wilden Blumen, die in den Zwi­schenräumen der Maschine wachsen, gewinnen an Bedeutung und wuchern, bis sie den Abschnitten, in denen sie sich wie Parasiten hineingeschlichen haben, eine ganz und gar unerwartete Färbung geben.» Grisey nutzt zwar auch hier be­stimmte Modelle aus der akustischen Forschung (neben diversen Spektralklängen z. B. einen Klaviersatz, der zeitweise die Wirkung eines Bandpassfilters simuliert). Entscheidender aber ist die Trennung der Tonhöhen- von der Rhythmus-Behand­lung, ein Verfahren, das aus der mittelalterlichen Talea-Technik entlehnt ist. Es gibt im Werk Griseys zahlreiche Bezüge auf Geschichte: die Proportionierung eines Renaissance-Gemäldes von Piero della Francesca im Orchesterwerk L’Icône Paradoxiale, Auseinandersetzungen mit der altägyptischen Kultur in Jour, contre-jour und Anubis-Nout, in seiner letzten Komposition Quatre Chants pour franchir le seuil schließlich die Vertonung von Texten aus vier verschiedenen Kulturen (christlich-jüdisch, altägyptisch, griechisch und mesopotamisch), die allesamt um die Unvermeidbarkeit des Todes kreisen. Die intensive Auseinandersetzung mit Geschichte ist Konsequenz seines kompositorischen Interesses: Zwar mag die Ästhetik eines beständigen Werdens und Vergehens der Klänge auf den ersten Blick das auffälligste Charakteristikum von Griseys Gesamtwerk sein. Sie kann aber nicht getrennt werden von einer immer neuen Reflexion über die Frage der Zeit. Späte­stens ab Le Temps et l’écume (1988/89) für 4 Schlag­zeuger, 2 Synthesizer und Kammerorchester unterscheidet Grisey auch theoretisch drei verschiedene Geschwindigkeiten des Verge­hens von Zeit: eine Zeit der menschlichen Sprache, eine stark verlangsamte «Spektralzeit» sowie eine extrem beschleunigte, bis an die Grenze des Hörbaren komprimierte Zeit: Wechsel, Überlagerung und Aneinanderreihung dieser verschiedenen Zeitskalen organisieren den musikalischen Ablauf. Vortex Temporum I-III (1994/95) für Flöte, Klarinette, Klavier, Violine, Bratsche und Cello, «Zeitwirbel» also, trägt diese Simultaneität verschiedener Zeiten bereits im Titel. «Denken Sie an die Wale, an die Menschen und an die Vögel. Der Gesang der Wale ist so langgezogen, daß das, was in unseren Ohren wie ein gigantisches, gedehntes, endloses Klagen klingt, für die Tiere vielleicht nur ein Konsonant ist. Mit unserer Zeitkonstante ist es also unmöglich, ihren Diskurs wahrzunehmen. Gleichzeitig haben wir beim Gesang eines Vogels den Eindruck, daß er sehr hoch und unruhig ist. Denn seine Zeitkonstante ist viel kürzer als unsere. Schwer für uns, seine feinen Klangvariationen wahrzunehmen, dabei nimmt er uns womöglich so wahr wie wir die Wale wahrnehmen.» Eine verzerrte Figur aus Ravels Daphnis et Chloé, die das Stück eröffnet, gerät in dramatische Metamorphosen. Das deformierte objet trouvé ist – zumindest anfänglich – die Urzelle sowohl der Meloharmonik als auch der zeitlichen Ordnung des Stückes. Sehr schnell aber verliert sich diese arpeggio-Figur selbst in einer Vielzahl aus Wirbeln und Strömungen und geht auf in einer Musik, die sich über die Satzgrenzen hinweg auf beeindruckende Weise permanent aus sich selbst heraus erneuert. «Das Material zugunsten der reinen Dauer aufzuheben, ist ein Traum, den ich seit vielen Jahren hege.» In seinen letzten Kompositionen ist Gérard Grisey diesem Ideal sehr nahe gekommen. Gerald Resch: Ins Innenleben der Klänge. Über Gérard Grisey, in: Katalog Wien Modern 2000, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2000, S. 105-107.