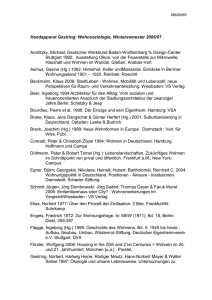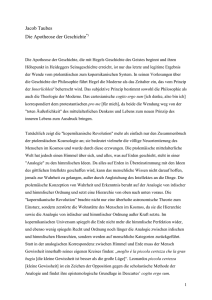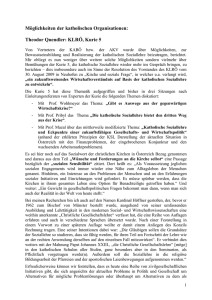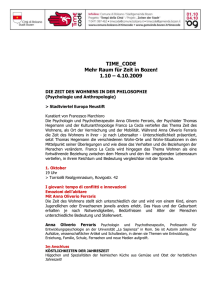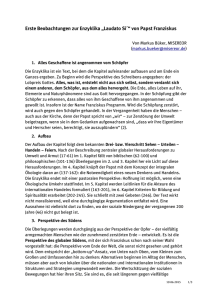Dann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen: Kommt
Werbung
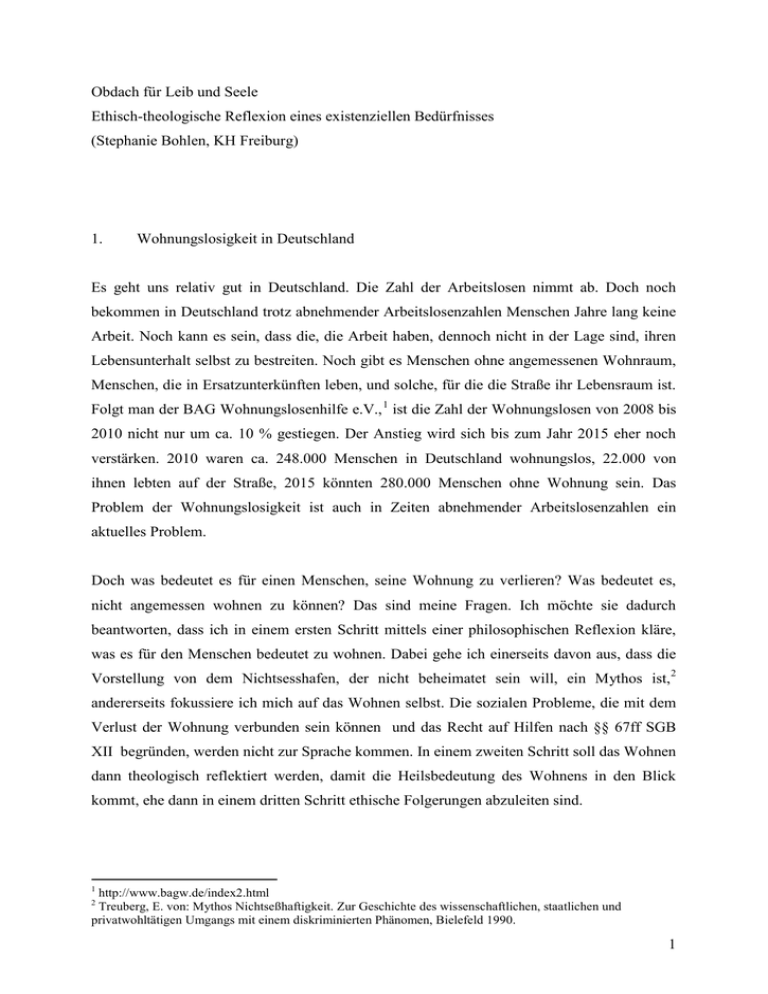
Obdach für Leib und Seele Ethisch-theologische Reflexion eines existenziellen Bedürfnisses (Stephanie Bohlen, KH Freiburg) 1. Wohnungslosigkeit in Deutschland Es geht uns relativ gut in Deutschland. Die Zahl der Arbeitslosen nimmt ab. Doch noch bekommen in Deutschland trotz abnehmender Arbeitslosenzahlen Menschen Jahre lang keine Arbeit. Noch kann es sein, dass die, die Arbeit haben, dennoch nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Noch gibt es Menschen ohne angemessenen Wohnraum, Menschen, die in Ersatzunterkünften leben, und solche, für die die Straße ihr Lebensraum ist. Folgt man der BAG Wohnungslosenhilfe e.V., 1 ist die Zahl der Wohnungslosen von 2008 bis 2010 nicht nur um ca. 10 % gestiegen. Der Anstieg wird sich bis zum Jahr 2015 eher noch verstärken. 2010 waren ca. 248.000 Menschen in Deutschland wohnungslos, 22.000 von ihnen lebten auf der Straße, 2015 könnten 280.000 Menschen ohne Wohnung sein. Das Problem der Wohnungslosigkeit ist auch in Zeiten abnehmender Arbeitslosenzahlen ein aktuelles Problem. Doch was bedeutet es für einen Menschen, seine Wohnung zu verlieren? Was bedeutet es, nicht angemessen wohnen zu können? Das sind meine Fragen. Ich möchte sie dadurch beantworten, dass ich in einem ersten Schritt mittels einer philosophischen Reflexion kläre, was es für den Menschen bedeutet zu wohnen. Dabei gehe ich einerseits davon aus, dass die Vorstellung von dem Nichtsesshafen, der nicht beheimatet sein will, ein Mythos ist,2 andererseits fokussiere ich mich auf das Wohnen selbst. Die sozialen Probleme, die mit dem Verlust der Wohnung verbunden sein können und das Recht auf Hilfen nach §§ 67ff SGB XII begründen, werden nicht zur Sprache kommen. In einem zweiten Schritt soll das Wohnen dann theologisch reflektiert werden, damit die Heilsbedeutung des Wohnens in den Blick kommt, ehe dann in einem dritten Schritt ethische Folgerungen abzuleiten sind. 1 http://www.bagw.de/index2.html Treuberg, E. von: Mythos Nichtseßhaftigkeit. Zur Geschichte des wissenschaftlichen, staatlichen und privatwohltätigen Umgangs mit einem diskriminierten Phänomen, Bielefeld 1990. 2 1 2. Die Bedeutung des Wohnens für den Menschen – philosophische und ethische Reflexion 2.1 Wohnen: ein Menschenrecht Sowohl in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 als auch in dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 wird vom Recht auf eine Wohnung gesprochen. 3 Die Vereinten Nationen verstehen unter Menschenrechten solche Rechte, „die unserer Natur eigen sind und ohne die wir als menschliche Wesen nicht existieren können.“ 4 Damit ist gesagt, dass es sich bei den Menschenrechten um Rechte auf die Befriedigung von Grundbedürfnissen handelt. Werden solche Bedürfnisse nicht befriedigt, kann ein Mensch nicht menschlich oder menschenwürdig leben. Deutschland hat sowohl die Menschenrechtserklärung als auch den Sozialpakt ratifiziert und sich damit auf die Sicherung der dort genannten Rechte verpflichtet. Die Wohnung wird in Artikel 25 der Menschenrechtserklärung genannt als Aspekt eines „Lebensstandards, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet.“ Nun kann man verstehen, dass Gesundheit ein existenzielles Bedürfnis ist. Das gilt auch für die Sicherheit des Menschen, die Unverletzlichkeit seines Körpers. 5 Aber gehört auch das Wohlbefinden (well-being) zu den fundamentalen Bedürfnissen? Kann man nicht menschlich leben, wenn man sich nicht wohlfühlt? Oder darf man das Wohlbefinden auf das Wohl des Körpers und das körperliche Wohlsein auf die Sicherheit reduzieren? Was ist das überhaupt: Wohlbefinden? Um das zu klären, möchte ich nun einen Ausflug in die Philosophie machen. Denn anhand der philosophischen Reflexion auf das Wohnen kann uns bewusst werden, dass die Wohnung nicht nur unser Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt, sondern ein konstitutiver Aspekt der Ausbildung unseres Selbstverständnisses, unserer Identität ist. 3 Spieß, K.: Das internationale Recht auf Wohnen – ein Überblick. In: Schröder, H. (Hg.): Ist soziale Integration noch möglich? Die Wohnungslosenhilfe in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung, Bielefeld 2008 (Materialien zur Wohnungslosenhilfe, Bd. 60), S. 97-103. 4 UN, Human Rights: Questions and Answers, 1987. Zitiert nach Vereinte Nationen – Zentrum für Menschenrechte/ Internationaler Verband der SozialarbeiterInnen / Internationale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit: Menschenrechte und Soziale Arbeit. Weingarten 1997, S. 5. 5 Wo von Grundbedürfnissen die Rede ist, richtet sich der Blick gängig auf die Bedürfnistheorie von Abraham Maslow. Nach Maslow sind die körperlichen Bedürfnisse fundamentale Bedürfnisse. Unter ihnen nennt er neben dem Bedürfnis nach Gesundheit auch das nach Sicherheit. Ihm wird die Wohnung zuordnet. 2 2.2 Die Thematisierung des Wohnens in der Philosophie 2.2.1 Der Dualismus Descartes Im „Historischen Wörterbuch der Philosophie“ wird zum Begriff des Wohnens mitgeteilt, die philosophische Reflexion habe erst mit dem 20. Jahrhundert eingesetzt. 6 Das Wohnen ist lange Zeit kein Thema der Philosophie gewesen sein, weil auch der Körper von der Philosophie „vergessen“ wurde. Aufgrund seines Körpers lebt der Mensch nicht nur in sich, sondern existiert im Raum und erlebt sich selbst als räumlich. 7 Wer wohnt, hat einen Raum inne. Nur dort, wo mit dem Körper des Menschen auch seine Räumlichkeit gedacht wird, kann daher das Wohnen zum Thema werden. Der Körper des Menschen aber war bis ins 20. Jahrhundert kein Thema, dem sich die Philosophie gestellt hätte, sah man doch im Menschen vorrangig das vernunftbegabte Wesen. Auch von den Sozialwissenschaften wurde der Mensch lange Zeit nur als „rational handelnder Akteur“ verstanden, der Körper galt „als unwesentlicher Aspekt sozialen Handelns“. 8 Die „Leibvergessenheit“ 9 sowohl der Philosophie als auch der Sozialwissenschaften führt Robert Gugutzer darauf zurück, dass man dem Dualismus Descartes zum Ausgangspunkt der Reflexion auf den Menschen machte. Der Cartesianismus musste überwunden werden, sollte es zu einer Thematisierung des Körpers und der Leiblichkeit in der Philosophie und dann auch den Sozialwissenschaften kommen. Für Descartes ist der Mensch das denkende, seiner selbst bewusste Ich. Als ego cogito kann er seiner selbst sicher sein. Das macht ihn als Menschen, als Subjekt aus. Er ist denkendes Ich, doch er hat einen Körper. Den Körper denkt Descartes in Analogie zu einer Maschine, die durch das Denken gesteuert wird. In seiner Philosophie wird der Mensch zu einem Wesen, das aus einer denkenden Substanz einerseits, einer körperlichen Substanz andererseits besteht. Dabei hat Descartes zwar erkannt, dass der Körper mit dem Ich „sehr eng verbunden ist.“10 Die Verbundenheit aber zu reflektieren, sah er keinen Anlass, ging es ihm doch darum zu 6 Hahn, A.: Art. „Wohnen“. In: Hist. Wörterbuch der Philosophie, hg. von J. Ritter und K. Gründer, Bd. 12, Basel 2004, Sp. 1015-1018. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass im „Handbuch der Anthropologie“ die Grundbegriffe der Anthropologie besprochen werden ohne dass das Wohnen zur Sprache käme. Vgl. Bohlken, E. / Thies, Ch. (Hg.): Handbuch Anthropologie, Stuttgart 2009. 7 Vgl. dazu die Analysen Otto Friedrich Bollnows zur Leiblichkeit des Menschen. Bollnow, O. F.: Mensch und Raum, 9. Aufl., Stuttgart 2000. 8 Gugutzer, R.: Soziologie des Körpers, Bielefeld 2004, S. 21. 9 Gugutzer, Leib, Körper und Identität. Eine phänomenologisch-soziologische Untersuchung zur personalen Identität, Wiesbaden 2002, S. S. 19 und 57. 10 Vgl. Descartes, R.: Meditationes de prima philosophia, hg. von L. Gäbe, Hamburg 1959, S. 141 (VI, 9). 3 beweisen, dass der Mensch als denkendes Ich auch ohne Körper existieren kann. In einer solchen Konzeption ist der Mensch als denkendes Ich bei sich selbst zu Hause. Der Körper hat im Grunde keine Relevanz für das, was den Menschen ausmacht. Er ist nur eine Art von Maschine. 2.2.2 Menschsein als In-der-Welt-sein und Wohnen Mit seiner Überwindung des Cartesianismus hat Edmund Husserl die Fundamente zu einer gewandelten Thematisierung des Körpers und der Leiblichkeit des Menschen im 20. Jahrhundert begründet. Husserl spricht sowohl vom Körper des Menschen als auch von seinem Leib, um deutlich zu machen, dass der Körper des Menschen nicht nur ein Objekt unter den anderen Objekten ist. In seinem Konzept des „fungierenden Leibes“ kommt zur Sprache, dass der Körper/Leib die Funktion hat, uns für die Welt aufzuschließen. 11 Der Mensch hat nicht nur eine Stelle im physikalischen Raum inne, sondern er lebt aufgeschlossen für die Welt, die ihm leibhaftig zugänglich ist und die sich ihm daher auch von seinem Leib her erschließt. Und die Wohnung ist eine Art der Erweiterung des Raumes, den der Mensch aufgrund seiner Leiblichkeit inne hat. 12 Die Impulse Husserls wurden aufgegriffen unter anderem von Martin Heidegger, der erkannte, dass in der Philosophie Husserls der Überwindung der Vorstellung von einem Subjekt, das als „Ich denke“ in sich selbst verschlossen gedacht wird, vorgegriffen ist. Er verabschiedet die Subjektivitätsphilosophie, indem er nun explizit davon ausgeht, dass Menschsein nur als leibhaftiges In-der-Welt-sein gedacht werden kann. Sofern der Mensch existiert, ist er auch aufgeschlossen für die Welt, die sich ihm leibhaftig erschließt. Heideggers Deutung der menschlichen Existenz durch den Begriff des In-der-Welt-seins macht also deutlich, dass der Mensch aufgrund seiner Leiblichkeit stets eingebunden ist in eine Welt. 13 Welt aber ist anderes als nur ein Raum, in dem der Mensch verortet ist. Welt ist jene Lebenswelt, in der sich ein Mensch bewegt. Heidegger spricht explizit vom „Wohnen“ in der Welt. In seiner Abhandlung „Sein und Zeit“ gibt er zu bedenken, das Sein des Menschen sei als In-der-Welt-sein ein „wohnen bei …, vertraut sein mit“. 14 11 Vgl. u.a. Husserl, E.: Texte aus dem Nachlaß. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, hg. von I. Kern, The Hague 1973 (Ges. Werke, Bd. XIV, 2) S. 57. 12 D. Funke spricht von einem „größeren Umraum“. Vgl. Funke, D.: Die dritte Haut. Psychoanalyse des Wohnens, Gießen 2006, S. 292. 13 Vgl. dazu auch die Analysen von Merleau-Ponty, M.: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966. 14 Heidegger, M.: Sein und Zeit, 15 Aufl., Tübingen 1979, S. 54. 4 Leibhaftig zu existieren bedeutet, sich selbst in Stimmungen zu erleben. Nach Heidegger sind es die Stimmungen, die uns unsere Befindlichkeiten erschließen und uns dadurch Zugang zu unserem eigenen Sein verschaffen. Damit der Mensch danach fragen kann, wer er ist, muss sich ihm sein eigenes Sein, sein Befinden, zu denken geben. Das geschieht durch die Stimmungen. Sie teilen mit, wie es um einen steht. In einem Aufsatz von 1952 teilt Heidegger dazu mit: „Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist […] das Wohnen. Mensch sein heiß: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen.“ 15 Demnach bedeutet Wohnen nicht nur einfach „sein“, sondern hebt auf die Art und Weise ab, in der der Mensch lebt. Sein gibt es für den Menschen nur auf die ein oder andere Art: als Sich-Wohlfühlen, als Beheimatet-Sein, Unbehaust-Sein etc. Noch ehe der Mensch über sich nachdenken kann, erfährt er sich in Stimmungen versetzt. Er fühlt sich wohl „in seiner Haut“ und im Gefühl des Wohlseins erschließt sich ihm sein In-der-Welt-sein als ein Vertrautsein mit dem, was ihn umgibt. Oder er erfährt sich „unbehaust“. Das, was ihn umgibt, ist ihm nicht vertraut. Das macht ihn unsicher. Der Bezug des Menschen zu der Welt, in der er lebt, ist also nicht primär der eines theoretischen Reflektierens, sondern stellt sich dar als „vorreflexives“ Eingestimmtsein auf Welt und Bestimmtsein durch das, was einen als Welt umgibt. 16 Daraus folgt aber nun für unser Thema unmittelbar, dass der Mensch seiner selbst nicht sicher sein kann, erlebt er sich unsicher in seiner Welt. Und die Sicherheit, die Welt gibt, ist das, was einen Menschen seiner selbst sicher machen kann. Wo das Recht auf Wohnen eingefordert wird, geht es also um das Recht darauf, seiner selbst sicher sein zu dürfen oder – anders gesagt: zu wissen, wer man selbst ist und woran man mit sich selbst ist. 2.2.3 Die Bedeutung des Wohnens für die Konstruktion menschlicher Identität Heidegger selbst hat die Frage nach dem Menschen nicht in den Fokus seines Denkens gestellt. Folglich hat er seine Gedanken auch nicht zu einer Anthropologie ausgearbeitet, in der die Frage nach der Identität des Menschen zur Sprache gekommen wäre. Ich möchte aber mit Robert Gugutzer von der Philosophie Heideggers her auf Identitätstheorien blicken, um die Folgen, die sich aus seinem Ansatz für die Frage nach der Identität ergeben könnten, zu benennen. 17 15 Heidegger, M.: Bauen Wohnen Denken, Stuttgart 1978, S. 33. Vgl. auch Merlau-Ponty, M: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, S. 291. 17 Die Bedeutung des Leibes für die Identität des Menschen deutet sich nach Gugutzer an bei Erikson, der von dem „bewusste[n] Gefühl, eine persönliche Identität zu besitzen“ spricht. Zu Erikson vgl. Gugutzer, R.: Leib, 16 5 Aktuelle Identitätstheorien gehen davon aus, dass der Mensch sein Leben lang daran arbeitet, die Frage, wer er selbst ist, zu beantworten. Identitätsarbeit geschieht dabei als narrative Konstruktion von Kohärenz. Der Mensch erzählt von dem, was er erlebt und erfahren hat. Dabei hat das Erzählen die Funktion, sich an das, was geschehen ist, zu erinnern und das Erinnerte auf eine Art zu verknüpfen, die das eigene Leben als in sich kohärente Lebensgeschichte verständlich macht. Unter Identitätstheoretikern gilt als unstrittig, dass es unter den Bedingungen unserer spätoder postmodernen Gesellschaft unmöglich ist, ein Leben ohne Brüche zu leben. 18 Folglich stellt sich jede Identitätskonstruktion dar als Verknüpfung von solchem, das nur bedingt als kohärentes Ganzes zu erzählen ist. Das gilt insbesondere für solche Menschen, die die Frage, wer sie selbst sind, beantworten müssen in der Erinnerung an Erfahrungen, die ihnen ihr Leben als von Grund auf brüchig zu denken geben. Trifft es nun zu, dass die Stimmungen dem Menschen das eigene Befinden erschließen, noch ehe er über sich selbst nachdenken kann, geht das gefühlte Wissen um das eigene Sein der Identität, die durch das Erzählen konstruiert wird, voraus. Gugutzer vertritt daher die These, dass Identität vorrangig zu verstehen sei als ein leibhaftiges Sich-Selbstempfinden. 19 Daraus folge dann aber auch, dass jede konstruierte Identität der „spürbaren Stützung“ bedürfe. „Um eine aus der Sicht des Subjekts echte Selbstidentifikation handelt es sich erst dann, wenn die konstruierte Kontinuität der eigenen Lebensgeschichte auch empfunden wird, wenn sie also eine spürbare Stützung erfährt.“ 20 Wo ein Mensch auf dem Weg zur Ausbildung persönlicher Identität ist, stellt sich ein „Wohlbefinden“ ein. 21 Wohlbefinden aber ist keine Frage des Denkens und der Vernunft, sondern der körperlichen Befindlichkeit. Wo sich ein Mensch „wohl fühlt in seiner Haut“ verknüpft sich die narrativ konstruierte Identität ist mit dem Gefühl, mit sich selbst eins zu sein. Aus der Perspektive der Psychologin thematisiert Antje Flade die Funktion der Wohnung für die Ausbildung von Identität: „Wenn die Wohnung gleich bleibt, die der Mensch als seinen erweiterten persönlichen Raum betrachtet, fällt es ihm leichter, sich als Körper und Identität. Eine phänomenologisch-soziologische Untersuchung zur personalen Identität, Wiesbaden 2002, S. S. 22-28. 18 Keupp, H. u.a.: Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Reinbek 1999. 19 Gugutzer, R.: Leib, Körper und Identität. Eine phänomenologisch-soziologische Untersuchung zur personalen Identität, Wiesbaden 2002, S. 101f. 20 S. 129f. 21 Vgl. Erikson, E.H.: Das Problem der Ich-Identität. In: Ders.: Identität und Lebenszyklus, Frankfurt/M., S. 123212, 147. 6 Ich-Selbst zu fühlen und sich nicht […] zu verlieren.“ 22 Die Wohnung gibt dem Menschen Sicherheit, wobei unter Sicherheit nun die durch das Gefühl gestützte Selbstsicherheit gemeint ist. Von da aus wird auch verständlich, warum wir Wohnungen als solche Orte gestalten, wo alles seinen Platz hat, wo einem „alles vertraut“ ist. 23 Das Gefühl der Kohärenz ist eng verbunden mit dem Gefühl, das Leben im Griff zu haben. Darum brauchen Menschen das, was ihnen vertraut ist, worauf sie sich verstehen. Im Kontext der Gedanken zum Wohnen muss noch ein Aspekt benannt werden, der in den Blick kommt, sobald Identität als narratives Konstrukt gedeutet wird. Wer von sich erzählt, stellt sich vor anderen dar. Dabei stellt auch der Körper ein Mittel dar, auf das man zurückgreifen kann, um sich selbst darzustellen. Will man wer sein, muss man in sein Körperkapital investieren. Man muss an seinem eigenen Körper arbeiten, um ihm die Gestalt zu geben, in der man sich den anderen darstellen will. Was für den Körper gilt, gilt dann auch für die Wohnung. Wer eine Wohnung hat, hat auch die Möglichkeit, sich durch sie darzustellen, sich zu inszenieren. Und auch das ist bedeutend für die Identitätsarbeit, stabilisiert sich Identität doch durch die Anerkennung der anderen. Es versteht sich, dass eine solche Form der Identitätsarbeit daran gebunden ist, dass man überhaupt über einen Wohnraum verfügt, den man gestalten kann und darf. Das Recht auf Wohnen stellt sich uns mithin dar als Recht auf einen vertrauten Lebensraum, den man gestalten kann und darf, um sich dadurch als Selbst zu stabilisieren. 3. Das Wohnen als Thema der Theologie Nachdem deutlich geworden sein dürfte, dass das Wohnen insofern ein Grundbedürfnis des Menschen ist, als es für die Ausbildung menschlicher Identität von Bedeutung ist, möchte ich nun eine theologische Reflexion des Wohnens in Angriff nehmen. Für mich verknüpfen sich die beiden Gedankengänge. Denn die Theologie verstanden werden kann als Explikation einer religiösen Identitätsarbeit des Menschen. Auch in der Religion geht es darum, dass der Mensch die Frage beantwortet, wer er selbst ist, indem er von sich und seinen Erfahrungen erzählt und durch die Deutung der Erfahrungen dem eigenen Leben Kohärenz gibt. Auch für den religiösen Menschen stellt sich die Frage nach dem eigenen Sein und danach, ob er darauf hoffen darf, dass die Brüche in seinem Leben geheilt werden können. Die Frage der Religion ist die Frage nach dem Heil. Und „Wohnen“ ist ein Begriff für das Heil ist, das Gott dem 22 Flade, A.: Wohnen psychologisch betrachtet. Bern, Stuttgart, Toronto 1987, S. 56. 7 Menschen anbietet. Zur Explikation der Heilsbedeutung des Wohnens nehme ich Bezug auf das Alte und Neue Testament und auf Grundaussagen der Katholischen Soziallehre. 3.1 Wohnen im Alten und Neuen Testament 3.1.1 „Wohnen im Hause des Herrn“ Nach Ulrich Thien steht eine „Theologie des Wohnens“ noch aus. 24 Dabei ist das Wohnen kein theologisch unbedeutender Begriff. Denn das Wohnen wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament eng mit der Erwartung von Heil verbunden. Der Beter spricht seine Hoffnung aus: „Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.“ (Ps 23,6. Vgl. Ps 42,3). Wo der Betende das „Haus des Herrn“ nennt, denkt er an das Heiligtum in Jerusalem. Für ihn hat Gott dort seine Wohnung unter den Menschen (Vgl. Ps 84). Doch nicht nur das „Haus des Herrn“ ist Ort des Heils, sondern auch die Wohnung, die der Familie Sicherheit und Geborgenheit bietet. Wer mit seiner Familie in der eigenen Wohnung leben darf, kann das Heil, das Gott dem Menschen zugedacht hat, am eigenen Leib zu spüren (Ps 128; Jer 29,5 u.ö.).Dort, wo Gott mitten unter den Menschen präsent ist, gibt es Frieden und Sicherheit. Die Stadt Jerusalem mit ihrem Heiligtum ist daher für den Juden die ideale Stadt, eine Stadt mit Mauern, die Sicherheit bieten, mit Häusern, in denen man gut leben kann, aber auch mit Toren, durch die alle, die zum Heiligtum wollen, in die Stadt kommen können (Ps 122). Jesus greift solche Vorstellungen auf. „Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen“, sagt er denen zu, die ihm auf seinem Weg folgen (Joh 14, 2). Das Wohnen-dürfen bei Gott, im Haus oder auch in der Stadt Gottes, ist das Ideal, nach dem sich die Menschen sehnen. Denn bei Gott wohnen zu dürfen bedeutet, eine Heimat zu haben, die dadurch als Ort des Heils begründet ist, dass Gott dort präsent ist. Die Sehnsucht nach dem Wohnen in einer Stadt, die Frieden und Sicherheit bietet, ergibt sich im Kontrast zu den Erfahrungen kontrastiert, die mit dem Weg durch die Wüste nach der Befreiung aus Ägypten verbunden waren, einerseits, den Erfahrungen des Lebens im 23 Ebd, Thien, U.: Wohnungsnot im Reichtum. Das Menschenrecht auf Wohnung in der Sozialpastoral, Mainz 1998, S. 148. 24 8 babylonischen Exil andererseits. In Ägypten handelt Gott befreiend an seinem Volk. Doch er will nicht nur, dass sein Volk frei sei. Er möchte das Heil der Menschen. Darum führt er das von ihm befreite Volk durch die Wüste, wo es erfährt, was es bedeutet, keine sicheren Wohnungen zu haben. Er führt es in das gelobte Land, damit es dort Wohnung nehmen kann. Das Wohnen im Haus und damit in Sicherheit wird im Kontrast zu den Wüstenerfahrungen zum Inbegriff des heilen Daseins. Wo man sich an die Zeit im babylonischen Exil erinnert, kommen Gefühle des Fremdseins zur Sprache. Im Gebet erinnern sich die Juden: „An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.“ Das Gebet erinnert daran, was es bedeutet, die Heimat verloren zu haben: „Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde.“ (Ps 137,1-4). Die Erinnerung an die Fremde verbindet sich mit der Sehnsucht nach Heimat, nach dem Heiligtum Gottes auf dem Zion. Es wird deutlich: die Heimat ist für den Juden nicht nur ein Ort auf der Erde sondern der Ort des Heils. 3.1.2 Die Schöpfung der Erde, des Lebensraums für den Menschen Für den Juden hat das Wohnen bei Gott, das er sich als Heil erhofft, ein schöpfungstheologisches Korrelat. Denn die Schöpfung wird in den Schöpfungserzählungen gedeutet als Schaffung eines Lebensraums. Die erste Schöpfungserzählung, mit der das Alte Testament anhebt, geht von einem Urzustand aus, der als Wüste von Wassern gedacht wird. Gott, erzählt man, habe ein Gewölbe gemacht und die Wasser oberhalb des Gewölbes von den Wassern unterhalb des Gewölbes geschieden. Die Scheidung der Wasser schafft Raum. Dann schafft Gott den Menschen. Die Schöpfung vollendet sich darin, dass Gott dem Menschen die Erde als jenen Lebensraum übergibt, in dem ihm alle Mittel zur Verfügung stehen, mit denen er sein Leben gestalten kann. Jene Erzählungen des Alten Testamentes, die an den Anfang der Zeiten erinnern, enden aber nicht damit, dass der Mensch seinen Lebensraum bekommt. Sie erzählen auch davon, dass Gott dem Menschen eine Grenze setzt. Sie wird anschaulich in dem Mythos, in dem erzählt wird, Gott habe verboten, sich an dem Baum in der Mitte des Gartens zu vergreifen. Der Mensch will nicht anerkennen, dass ihm Grenzen gesetzt sind. Er widersetzt sich Gottes Gebot und schafft dadurch Zustände, die man als „tödlich“ begreifen kann. Die Menschen verlieren die Heimat, in der sie alles zur Verfügung hatten, und der Nachkomme Adams tötet den eigenen Bruder. Der Mythos gibt zu denken: Wo sich der Mensch dem Gesetz Gottes, das 9 ein Gesetz des Lebens ist, widersetzt, wird der Tod zur Realität, die das Leben ergreift. Und der Tod ist in dem Fall der Inbegriff für alle die Verhältnisse, die das Leben des Menschen in Frage stellen. 3.1.3 Die prophetische Tradition des Alten Testaments Die Erzählungen vom Anfang sind jenen Erzählungen, in denen sich die Juden an das befreiende Handeln Gottes erinnern, vorangestellt. Betend machen sich die Juden Tag für Tag bewusst, dass die Heimat, die sie nach der Wanderung durch die Wüste im gelobten Land gefunden haben, einen Zustand der Geborgenheit darstellt, den Gott für sie gewollt und ermöglicht hat (vgl. Dtn. 12,10). Aber Sicherheit und Geborgenheit, auch dessen gilt es sich bewusst zu sein, gibt es nur dort, wo sich die Menschen am Gesetz Gottes, dem Gesetz des Lebens, ausrichten. Von daher ist zu verstehen, dass in den prophetischen Texten des Judentums die Sehnsucht nach der Heimat, die man verloren hatte, als jene Grundstimmung greifbar wird, von der her die Aufforderung zur Umkehr zur mächtigen Stimme wird. Umkehr geschieht, wo Menschen ihr Handeln neu am Willen Gottes ausrichten. Dass die Propheten zur Umkehr auffordern, ist nur zu verstehen unter der Bedingung, dass die Orientierung am Willen Gottes faktisch verloren gegangen war. Dafür sprachen den Propheten zufolge die sozialen Probleme, die die Gesellschaft spalteten. Der Prophet Amos nennt die Gründe für die Spaltung der Gesellschaft beim Namen: die Armen werden ausgebeutet, die Reichen häufen allen Besitz an (Am 8,4; Jes 5,8). Von den Armen nimmt man Pacht und Zins, die nicht bezahlbar sind (Am 5,11). Die Reichen leben von dem, was sie den Armen genommen haben (Jes 3,14). Die Reichen bestechen, die Schwachen werden nicht gehört, ihr Recht wird gebeugt. Solche Fakten, die nicht durch Verschulden der Armen, sondern durch Ausbeutung durch die Reichen verursacht sind, widersprechen dem Gesetz Gottes. Dessen ist sich Amos sicher. Zu Zeiten des Propheten Amos gab es eine Sozialgesetzgebung, mittels derer radikale Armut strukturell verhindert werden sollte. Bedeutsam in unserem Kontext sind u.a. die Gesetze, die die Möglichkeiten, Pfand zu nehmen, begrenzten (Dtn 24,6.17), das Zinsverbot oder auch die Verpflichtung zur Abgabe des Zehnten, einer Sozialsteuer (Dtn 14,22). Zu nennen sind die Regelungen zum Schuldenwesen, denen zufolge alle sieben Jahre auch die Schulden brachliegen sollten. Auf Grundbesitz gab es ein Rückkaufrecht (Lev 25,24). Nach 50 Jahren 10 waren die, die sich verschulden mussten, frei zu sprechen, damit sie zu ihrem Besitz heimkehren konnten. Solche Gesetze, die die Möglichkeiten, Besitz anzuhäufen, begrenzten, um die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich zu verhindern, wurden damit begründet, dass Gott zwar dem Menschen die Erde als seinen Lebensraum zugedacht habe, ohne dass die Erde dadurch aber in das Eigentum des Menschen übergegangen wäre (Ps 24,1; Ex 19,5). Da Gott der Herr der Erde ist, kann der Mensch mit der Erde auch nicht machen, was er will, sondern muss sich in seinem Handeln an Gottes Willen orientieren. Dass Gott einerseits der Eigentümer der Erde ist, andererseits will, dass die Armen zu ihrem Recht kommen, hat zur Folge, dass das religiöse Gesetz der Juden primär ein Sozialgesetz ist, das jedem das sichert, was er zum Leben braucht. Darum können sich die Propheten dann auch auf den Willen Gottes berufen und zur Orientierung am Gesetz aufrufen. Im Namen Gottes fordern sie Solidarität ein, die nicht in einem Gefühl fundiert ist, sondern im Wissen um das, was vor Gott rechtens ist und jedem Menschen zusteht. 3.1.4 Die Reich-Gottes-Botschaft Jesu Mit seiner Reich-Gottes-Botschaft greift Jesus die Perspektive der jüdischen Prophetie auf. Auch er verbindet die Botschaft vom Reich Gottes mit der Aufforderung zur Umkehr. Soll das Reich Gottes wachsen, müssen die Menschen umkehren und das Unrecht beseitigen. Dann müssen auch die Armen Zugang bekommen zu dem, was Leben möglich macht. Teilhabe muss allen zugestanden werden. Dabei steht Jesus auf der Seite der Armen. Ihnen sagt er nicht nur im Namen Gottes zu: Ihr werdet das Land erben (vgl. Mt 5,3-5), sondern er realisiert die Zusage durch sein eigenes Handeln, seine Zuwendung zu den Ausgegrenzten der damaligen Gesellschaft. Wo Jesus agiert, werden Grenzen durchbrochen. Und wo es keine Grenzen gibt, gibt es auch keine Spaltung der Gesellschaft, keine Exklusion. An der Stelle komme ich kaum umhin, auf die Möglichkeit auch des Missbrauchs von religiösen Vorstellungen hinzuweisen. Auch Paulus greift die Differenz von Fremde und Heimat auf, um die Hoffnung auf Heil zur Sprache zu bringen. „Wir wissen: wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel“ (2 Kor 5,1). Für uns verbindet sich der Begriff des Himmels gängig mit dem des Jenseits. Dafür, dass es rechtens ist, die Sehnsucht nach einer Heimat mit der Hoffnung auf ein jenseitiges Leben zu verbinden, spricht auch, 11 dass Paulus zu bedenken gibt, solange der Mensch im Leib zu Hause sei, lebe er fern vom Herrn in der Fremde, der Mensch strebe aber danach, aus dem Leib auszuwandern, um dann beim Herrn daheim sein zu können (2 Kor 5,6-8). Bedeutet das nicht, dass wir uns dort, wo es uns nicht gut geht, damit trösten können, dass wir unterwegs sind, um eines Tages bei Gott wohnen zu dürfen? Der Vorwurf, dass die Religion auf das Jenseits vertröste, statt zur Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen aufzufordern, ist der Fokus aller Religionskritik. Es wäre in der Tat problematisch, würden wir uns von der Verantwortung für die Gestaltung unserer Gesellschaft und die Beseitigung der sozialen Probleme dadurch frei sprechen, dass wir unseren Blick nur auf das Jenseits richten. Nun trifft es aber nicht zu, dass der Begriff des Himmels ausschließlich auf das Jenseits bezogen ist. 25 Die Verknüpfung des Himmels mit dem Jenseits ist konstitutiv für die Vorstellungen der Apokalyptik. Die paulinische und deutlicher noch die jesuanische Konzeption des Himmels unterscheiden sich von der der Apokalyptiker darin, dass Jesus den Himmel oder das Himmelreich nicht nur im Jenseits verortet. Ihm geht es in seiner Botschaft um den Anbruch des Gottesreichs im Diesseits. Das Reich Gottes ist bekanntlich wie ein Senfkorn. Das Korn ist in die Erde gelegt, der Baum muss nur noch wachsen, soll er zur Wohnung werden für die Geschöpfe des Himmels. Das Reich Gottes ist demnach für Jesus nicht nur ein jenseitiges Reich, sondern eine Möglichkeit zu leben, die uns Gott zugesagt hat und deren Realisierung nun an der Zeit ist. Darum tut die Kirche gut daran, nicht nur vom jener Heimat zu sprechen, die uns im Himmel erwartet, sondern auch davon, dass in dem Begriff des „Himmel“ eine Vision ausgesprochen ist, die für uns zwar nach dem Tod zur endgültigen Realität werden mag, aber dadurch, dass sie sich in diesem Leben zu erfahren geben will, zum Appell wird, die gesellschaftlichen Strukturen auf die Vision hin zu verändern. Um es einfach zu sagen: Wer nie den „Himmel auf Erden“ erfahren durfte, für den wird der Begriff des Himmels kaum Lebensrelevanz bekommen. Wer nie erfahren durfte, was es bedeutet zu wohnen, wird der „Wohnung im Himmel“ keine Bedeutung für sein Leben, zusprechen. Darum sind wir gefordert, Wohnerfahrungen zu ermöglichen, die als Vorwegnahme des endgültigen Wohnens bei Gott die Relevanz der Botschaft Jesu greifbar machen. 3.2 Das Recht auf Wohnen in der Perspektive der Katholischen Soziallehre 25 So auch Junglas, M.: Das Recht auf Wohnen unter anthropologischen und theologischen Gesichtspunkten. In: Wohnungslos 4/1999, S. 141-144. 12 Die Katholische Soziallehre will Menschen nicht auf das Jenseits vertrösten. Sie will die „Zeichen der Zeit“ erkennen, um von dorther jene Fragen zu stellen, die einer Antwort bedürfen. Solche Antworten ergeben sich für die Katholische Soziallehre im Rückgriff auf das Alte und Neue Testament einerseits, auf philosophische Grundprinzipien andererseits. In der Enzyklika „Rerum novarum“ 26 aus dem Jahr 1891 nimmt Papst Leo XIII. Stellung zu der Frage, ob die Abschaffung des Privateigentums ein Weg ist, um die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich strukturell zu beseitigen. Er wendet sich gegen die Forderung, das Privateigentum abzuschaffen. Das Streben nach Eigentum sei in der Natur des Menschen verwurzelt. Doch dürfe es weder zur Anhäufung von Besitz nur auf Seiten der Reichen kommen, noch auch dazu, dass Menschen unmöglich wird, ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien mittels ihres Lohnes auch zu bestreiten. Die Sicherung des Lebensunterhalts wird in der Enzyklika mit der Möglichkeit verknüpft, Grundbesitz zu erwerben. Gedacht ist daran, dass in der Regel jeder privaten Grundbesitz hat, um dort mit seiner Familie leben zu können. Nun gebe es Menschen, die keinen Grundbesitz haben. Ihre Würde sei zwar nicht in Frage gestellt, doch dürften sie es schwer haben, können sie doch ihrer Familie kein Heim bieten. Der Staat sei daher verpflichtet, ihnen und ihren Familien zu ermöglichen, ein „in Sicherheit hinsichtlich Wohnung, Kleidung und Nahrung […] weniger schweres Leben [zu] führen.“ 27 Die Enzyklika „Rerum novarum“ legt die Basis zur Beantwortung der Wohnungsfrage durch die Katholische Soziallehre. Die Unterordnung des Privateigentums unter das Gemeinwohl, die in „Rerum novarum“ auf den Weg gebracht ist, wird in Folge zu einem der Grundprinzipien der Katholischen Soziallehre, dem Gemeinwohlprinzip, das seine Begründung auch von der alttestamentlichen Aussage her erfährt, dass Gott, der Eigentümer der Erde, wolle, dass alle Menschen die Güter zur Verfügung haben, mittels derer sie ihren Lebensunterhalt sichern können. 28 Die Wohnung wird dort, wo sie in den Enzykliken zum Thema wird, als Aspekt des Lebensunterhaltes benannt. Auch in der Pastoralkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils wird das, was der Mensch zu einem menschlichen Leben braucht, durch die Trias von Nahrung, Kleidung und Wohnung expliziert, ehe andere Grundrechte angefügt werden. 29 In die Pflicht genommen wird der Staat. Es ist an ihm, sowohl zu sichern, 26 Die Enzykliken werden zitiert nach: Texte zur katholischen Soziallehre, hg. vom Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands, 5. Aufl., Kevelaer 1982. 27 Rerum novarum 27. 28 Vgl. U.a. die Enzyklika Sollicitudo rei socialis 39. 29 Pastoralkonstitution Gaudium et spes 26. 13 dass das Gemeinwohl dem Privateigentum vorgeordnet wird, als auch dort zu helfen, wo ein Mensch seinen Lebensunterhalt nicht selbst erarbeiten kann. Er ist aufgefordert zu einer Politik, die den Wohnungsbau fördert. 30 In der Enzyklika „Sollicitudo rei socialis“ wird eigens bedacht, dass die Ausrichtung auf das Gemeinwohl sowohl die Gemeinschaft als auch den Staat dazu verpflichtet, die Benachteiligten eigens in den Blick zu nehmen und das Handeln in dem Willen zu fundieren, auch ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. In der genannten Enzyklika ist von der „Option für die Armen“ die Rede, die fortan als Grundprinzip in der Katholischen Soziallehre fungiert. Die Armen, das sind alle Benachteiligten in der Gesellschaft, die Enzyklika nennt eigens „die unzähligen Scharen von Hungernden, Bettlern, Obdachlosen.“ 31 Ein Dokument, das das Problem der Wohnungslosigkeit eigens in den Blick nimmt, wurde erarbeitet von der Päpstlichen Kommission „Justita et Pax“. Das Wohnungsproblem wird dort nicht nur als „eine der schwersten sozialen Fragen unserer Zeit“ beurteilt, 32 sondern auch als „Beweis für ungerechte Verteilung der Güter, die ursprünglich für alle bestimmt waren.“ 33 Zwar sei der Verlust der Wohnung ab und an die Folge eines persönlichen Scheiterns. Auf das Ganze gesehen aber handele es sich um ein strukturell verursachtes Problem, dass vor allem darin bestehe, dass der Lohn der Arbeit die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und die der Familie nicht sichert. Das Problem der Wohnungslosigkeit, betont die Kommission, müsse von den fundamentalen Bedürfnissen eines Menschen her verstanden werden. Genannt werden: Erziehung, Nahrung, Wohnung, Kleidung und Beschäftigung. Der Verlust der Wohnung wird dadurch als Verletzung eines menschlichen Grundrechts bestimmt. Auch im Fortgang wird deutlich, dass die Kommission von dem Rechtsanspruch auf Wohnung ausgeht. In der ethischen Beurteilung wird explizit darauf verwiesen, dass das Recht auf Wohnung ein Menschenrecht sei. Wo von einem Menschenrecht ausgegangen wird, kommen die Verpflichtungen der Gesellschaft in den Blick. Es sei erforderlich, gegen jeden Gebrauch von Eigentum vorzugehen, in dem Wohnraum seiner Funktion, dem menschlichen Leben zu dienen, entzogen wird. Auch sich selbst sieht die Kirche in der Pflicht. Ihr Einsatz für die Realisierung des Wohnrechtes der benachteiligten Menschen sei ein „Zeichen der Solidarität, 30 Populorum progressio 53. Sollicitudo rei socialis 42. 32 Päpstliche Kommission „Justita et pax“: Was hast du für deinen obdachlosen Bruder getan? In: L´osservatore romano 18 (1988), Nr. 11, Beilage 10. I, 1. 33 Ebd. I, 3. 31 14 des Heiles und der Befreiung, eine Vorwegnahme des Reiches Gottes unter uns.“ 34 Das ist ein hoher Anspruch, den die Kirche an sich selbst stellt, darum wissend, dass die Benachteiligten in unserer Gesellschaft „konkrete Antworten“ erwarten. Um welche Antworten könnte es sich handeln? Ich nenne Impulse, die sich für mich ergeben: Jeder Mensch hat ein Recht auf angemessenen Wohnraum. Es kann sein, dass auch dort, wo ein Mensch unterkommen kann, das Menschenrecht auf eine angemessene Wohnung verletzt wird. Denn nicht jede Unterkunft ist eine Wohnung. Eine Wohnung ist nur dann angemessen, wenn sie die Ausbildung von Identität dadurch fördert, dass sich ein Mensch in ihr wohlfühlen kann. Dazu ist auch erforderlich, dass ein Mensch sich durch seine Wohnung selbst darstellen kann. Das Recht auf eine Wohnung ist daher verknüpft mit dem Recht auf die Gestaltung des eigenen Wohnraums. Es braucht eine Politik, die den Bau solcher Wohnungen fördert, die den Bedürfnissen der Menschen angemessen sind. Dabei ist der Privatbesitz dem Gemeinwohl unterzuordnen und die nur an ökonomischen Interessen orientierte Nutzung von Wohnraum strukturell zu verhindern. Ich schließe ab mit einem Gedanken, der zu kurz gekommen ist. Wo es um das Wohnen geht, ist aktuell auch die Rede vom „cocooning“, dem Rückzug in die eigene Wohnung, die einen vor der Welt draußen, die eine unheimliche Welt ist, absichert. 35 Nicht nur von unseren Wohnungen, auch von unseren Städten fordern wir, dass sie unser Sicherheitsbedürfnis befriedigen. Doch auch unser Sicherheitsbedürfnis könnte ein „Zeichen der Zeit“ sein, das einer Antwort bedarf. In den Gebeten und Erzählungen des Alten Testaments wird Jerusalem als die ideale Stadt vor Augen gestellt. Jerusalem ist kein Ort des Rückzugs von der Welt. Die Mauern Jerusalems haben Tore. Man sieht der Stadt an, dass sie zugängig ist für andere. Ich verstehe die Vision der idealen Stadt Jerusalem, in der Gott mitten unter den Menschen lebt, als eine Herausforderung, in der Gestaltung unserer Städte nicht einseitig am Bedürfnis nach Sicherheit zu orientieren. Wir sollten der Gastfreundschaft Raum zu geben sowohl in unseren Wohnungen als auch in unseren Städten. Auch der, dem wir nur auf Zeit einen Ort bieten dürfen, an dem er sich auch wohlfühlen kann, hat ein Recht, unter uns zu leben und an dem teilzuhaben, was die Stadt zu bieten hat. Ich sage dass nicht nur im Wissen, dass jeder Mensch das Recht auf einen solchen Lebensraum hat. Es sage das auch als Theologin, die sich dessen 34 Ebd. IV, 1. Vgl. Funke, D.: Die dritte Haut. Psychoanalyse des Wohnens, Gießen 2006, S. 232f. Vgl. auch König, H.: Trautes Heim – Glück allein? In: Psychologie heute 1/2012, S. 30-34. 35 15 bewusst ist, dass sich der Gast, den man beherbergt, am Ende als ein besonderer Gast erweisen könnte. 16