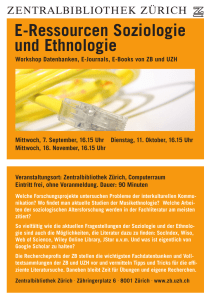MARKETING I - E
Werbung

MarketingPraxis Student Edition Prof. Dr. H.P. Wehrli, 2004 1 Inhalt MARKETING I 1. Entwicklung des Marketing .................................................................6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Idee des Marketing ........................................................................................... 6 Erste Marketing-Ansätze................................................................................... 6 Marketing-Management .................................................................................... 7 Marketing-Vertiefung......................................................................................... 9 Marketing-Ausweitung .................................................................................... 11 Megamarketing ............................................................................................... 12 Strategisches Marketing.................................................................................. 13 Beziehungsmarketing ..................................................................................... 15 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. Customer Relationship Marketing .................................................................................. 15 Netzwerke ..................................................................................................................... 18 Konzept Marketing......................................................................................................... 19 2. Markt....................................................................................................20 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Marktmorphologie ........................................................................................... 20 Bedürfnisse..................................................................................................... 21 Marktdimensionen........................................................................................... 24 Marktgrössen .................................................................................................. 25 Marktverhalten ................................................................................................ 26 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Marktverhalten Unternehmung....................................................................................... 27 Marktverhalten Konsumenten ........................................................................................ 28 Relevanter Markt............................................................................................. 34 Marktsegmentierung ....................................................................................... 35 Positionierung ................................................................................................. 37 Elektronische Märkte ...................................................................................... 38 2.9.1. 2.9.2. 2.10. Electronic Business ....................................................................................................... 40 Electronic Commerce .................................................................................................... 41 Verbraucherschutz ...................................................................................... 45 3. Marketing Management......................................................................47 3.1. Management................................................................................................... 47 3.1.1. 3.1.2. 3.2. Strukturen ....................................................................................................... 50 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.3. Stellen ........................................................................................................................... 50 Strukturtypen ................................................................................................................. 51 Marktorientierte Strukturen............................................................................................. 53 Prozesse ....................................................................................................................... 55 Instrumente ................................................................................................................... 55 Kultur .............................................................................................................. 56 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. Problemlösungsprozess................................................................................................. 48 Management-Konzept ................................................................................................... 49 Unternehmungskultur .................................................................................................... 57 Unternehmungskultur erfassen und gestalten ................................................................ 57 Marketing-Kultur ............................................................................................................ 59 Politik .............................................................................................................. 60 3.4.1. 3.4.2. Situationsanalyse .......................................................................................................... 61 Strategie........................................................................................................................ 62 2 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. 3.4.7. 3.4.8. 3.4.9. 3.4.10. 3.4.11. 3.4.12. 3.4.13. 3.4.14. 3.4.15. 3.4.16. 3.4.17. Marketing-Strategie ....................................................................................................... 63 Strategiefindung ............................................................................................................ 64 Frühwarnsysteme .......................................................................................................... 65 Produkt-Markt-Strategien............................................................................................... 65 Portfolio-Strategien........................................................................................................ 67 Wettbewerbsstrategien .................................................................................................. 70 Kernkompetenzen ......................................................................................................... 74 Zeitstrategien................................................................................................................. 80 Co-opetition ................................................................................................................... 81 Netzwerkstrategien........................................................................................................ 82 Endspielstrategien ......................................................................................................... 84 Europäische Strategien.................................................................................................. 85 Globale Strategien......................................................................................................... 86 Marketing-Mix ................................................................................................................ 90 Gesamtsicht .................................................................................................................. 93 MARKETING II 4. Marktforschung ..................................................................................96 4.1. Markt- und Marketingforschung....................................................................... 96 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. Phasen der Marktforschung ............................................................................ 98 Primärforschung.............................................................................................. 99 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. Zufallsauswahl............................................................................................................... 99 Bewusste Auswahl....................................................................................................... 100 Sekundärforschung....................................................................................... 101 Erhebungstechniken ..................................................................................... 102 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.6. Explorative Studien........................................................................................................ 97 Deskriptive Studien........................................................................................................ 98 Kausalanalytische Studien............................................................................................. 98 Befragung.................................................................................................................... 103 Panel........................................................................................................................... 104 Test ............................................................................................................................. 104 Beobachtung ............................................................................................................... 105 Durchführung der Erhebung......................................................................................... 105 Auswertung Marktforschung ......................................................................... 106 5. Produktpolitik ...................................................................................107 5.1. 5.2. Produkt ......................................................................................................... 107 Qualität ......................................................................................................... 109 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.4. Produktlebenszyklus ..................................................................................... 114 Dienstleistung ............................................................................................... 116 5.4.1. 5.4.2. 5.5. Dienstleistungsqualität................................................................................................. 118 Rationalisierung........................................................................................................... 120 Innovation ..................................................................................................... 120 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.6. Qualität verstehen ....................................................................................................... 110 Qualität umsetzen........................................................................................................ 111 Qualität messen........................................................................................................... 112 Produktinnovation........................................................................................................ 121 Innovationserfolg ......................................................................................................... 124 Innovationsmanagement.............................................................................................. 125 Technologie .................................................................................................. 128 5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. Just in Time-Konzepte (JIT) ......................................................................................... 128 Technologie-Lebenszyklus .......................................................................................... 129 Lizenzen...................................................................................................................... 131 3 5.7. 5.8. Design .......................................................................................................... 131 Marke............................................................................................................ 132 5.8.1. 5.8.2. 5.8.3. 5.8.4. Markenbildung............................................................................................................. 133 Markenausprägungen.................................................................................................. 134 Markenpolitik ............................................................................................................... 135 Markenwert.................................................................................................................. 135 5.9. Verpackung................................................................................................... 136 5.10. Sortiment................................................................................................... 137 5.11. Experiences .............................................................................................. 139 5.12. Ökologie .................................................................................................... 140 6. Preispolitik ........................................................................................142 6.1. 6.2. 6.3. Preis ............................................................................................................. 142 Grundlagen Preispolitik ................................................................................. 143 Preisbildung .................................................................................................. 144 6.3.1. 6.3.2. 6.4. Markteintritt ................................................................................................... 148 6.4.1. 6.4.2. 6.5. 6.6. 6.7. Marktabschöpfung ....................................................................................................... 148 Marktdurchdringung..................................................................................................... 148 Preisdifferenzierung ...................................................................................... 149 Break-Even-Analyse ..................................................................................... 150 Konditionen................................................................................................... 153 6.7.1. 6.7.2. 6.7.3. 6.7.4. 6.8. Ziele Preisbildung ........................................................................................................ 144 Vorgehen Preisbildung ................................................................................................ 146 Rabatte........................................................................................................................ 153 Factoring ..................................................................................................................... 154 Kredite......................................................................................................................... 154 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ........................................................................ 154 Ökologie........................................................................................................ 155 7. Distributionspolitik...........................................................................156 7.1. 7.2. 7.3. Aufgaben Distributionspolitik......................................................................... 156 Logistik ......................................................................................................... 156 Handelsbetrieb.............................................................................................. 158 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. Vertriebsformen ........................................................................................................... 158 Handelsbetriebsformen................................................................................................ 158 Vertikales Marketing .................................................................................................... 159 Franchising ................................................................................................... 161 Ladengestaltung ........................................................................................... 161 Regaloptimierung.......................................................................................... 163 Warenwirtschaftssysteme ............................................................................. 164 Efficient Consumer Response....................................................................... 165 Ökologie........................................................................................................ 166 Stadtmarketing .......................................................................................... 167 8. Kommunikationspolitik....................................................................169 8.1. 8.2. Inhalte Kommunikationspolitik....................................................................... 169 Kommunikation ............................................................................................. 169 8.2.1. 8.2.2. 8.3. Kommunikationsprozess.............................................................................................. 169 Blickaufzeichnung........................................................................................................ 171 Kommunikationsinstrumente......................................................................... 173 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. Corporate Communication ........................................................................................... 173 Corporate Design ........................................................................................................ 173 Corporate Identity ........................................................................................................ 173 Corporate Image.......................................................................................................... 174 4 8.3.5. 8.3.6. 8.3.7. 8.3.8. 8.3.9. 8.3.10. 8.3.11. 8.3.12. 8.3.13. 8.3.14. 8.4. Werbepolitik .................................................................................................. 183 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.4.5. 8.4.6. 8.4.7. 8.5. Design......................................................................................................................... 174 Direktwerbung ............................................................................................................. 174 Elektronische Medien .................................................................................................. 175 Events ......................................................................................................................... 176 Messen........................................................................................................................ 177 Persönlicher Verkauf ................................................................................................... 177 Public Promotion ......................................................................................................... 178 Public Relations........................................................................................................... 181 Verkaufsförderung ....................................................................................................... 182 Werbung...................................................................................................................... 182 Situationsanalyse ........................................................................................................ 183 Werbeziele .................................................................................................................. 183 Werbestrategien .......................................................................................................... 184 Werbebudget............................................................................................................... 189 Werbebriefing .............................................................................................................. 190 Werbeagenturen.......................................................................................................... 190 Werbekontrolle ............................................................................................................ 191 Ökologie........................................................................................................ 192 5 MARKETING I 1. Entwicklung des Marketing 1.1. Idee des Marketing Die umfassende Auseinandersetzung mit Marketing ist mehr als «das Denken vom Kunden her». Es geht um die Gestaltung unternehmungs-, markt- und umweltgerichteter Phänomene. In der Entwicklung des Marketing wechseln Einzelerscheinungen (business fads) mit Phasen akzentuierter Wandlungen ab. Der Begriff «Marketing» wurde in unserem Sprachraum in den fünfziger Jahren aus dem angloamerikanischen Raum übernommen. Zunächst war Marketing ein Modewort, dann ein Synonym für Absatz, Absatzwirtschaft oder Absatzfunktion. Es war auch der Übergang vom Verkäufer- zum Käufermarkt: Das Angebot wurde grösser als die Nachfrage, der Nachfrager wuchs in eine stärkere Position und der Absatz der Produkte entwickelte sich für die einzelne Unternehmung zur primären Fragestellung der Leistungserstellung. Diese Situation verlangte eine Neuorientierung des unternehmerischen Verhaltens, denn die Nachfrager mit ihren vielschichtigen Wünschen und Bedürfnissen entwickelten sich zu den bestimmenden Faktoren des Erfolges eines Produktes, einer Unternehmung, einer Branche. Diese unternehmerische Orientierung wird als Marketing umschrieben. © Marketing bedeutet «die Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmungsaktivitäten. Durch eine dauerhafte Befriedigung der Kundenbedürfnisse sollen die Unternehmungsziele verwirklicht werden» (Meffert 1998). Bei diesem Austausch (Transaktionen) von Gütern, Diensten und Rechten entstehen Transaktionskosten, die es aus ökonomischen Gründen zu minimieren gilt. Es entstanden «Marketing-Geschichten» (Hartley 1981), «Marketing-Mythen» (Fullerton 1988) und vielfältige Konzepte: vom Balanced-Marketing über das kundenorientierte Massen-Marketing zum Customer Relationship Marketing. 1.2. Erste Marketing-Ansätze Um 1900 erschienen die ersten angelsächsischen Beiträge zum Phänomen Marketing. Sie verstanden Marketing als einen Distributionsprozess: Verteilung der Güter in einem Marktraum. Später standen funktionen- (Cherington 1920) und warenanalytische (Copeland 1924) Fragen im Mittelpunkt der Betrachtungen: 6 UZH | Marketing I Der funktionale Ansatz versucht, ausgehend von den Handelsfunktionen, Grundfunktionen des Marketing zu unterscheiden. Diese werden in einer weiterentwickelten Systematisierung (McGarry 1950, Lewis/Erickson 1969) in die zwei Primärfunktionen «Nachfrage schaffen» (obtaining demand) und «Nachfrage erhalten» (servicing demand) gegliedert; beide werden von übergreifenden Aktivitäten (transpermeating activities) zusammengehalten. Nach dem warenanalytischen Ansatz (commodity approach) ist der Vertrieb einzelner «Waren» vom Produzenten zum Endverbraucher Gegenstand der Betrachtung, da jede Warenart jeweils andere Marketing-Aktivitäten erfordert. Die deutschsprachige Marketing-Diskussion wurde von Fragen der Handelsbetriebslehre angeregt und von einer eigentlichen Absatzlehre gefördert (Findeisen 1925). Prägend war damals die neue Denkweise des Absatzprimats (Lisowsky 1936): Dem Marktdenken sei der gebührende Platz einzuräumen. Die bedeutungsvolle American Marketing Association (AMA) definierte Marketing 1948 als «the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user». Einen wesentlichen Einfluss auf das Marketing-Denken seit den vierziger Jahren übte die Idee des Marketing-Mix aus (Borden 1942): Die verschiedenen MarketingInstrumente sind optimal zu kombinieren und einzusetzen. In der Regel bildet die Produktpolitik den Ausgangspunkt dieser Überlegungen. © Der Begriff «Marketing» erschien erst nach 1950 im kontinentaleuropäischen Wirtschaftsvokabular. 1.3. Marketing-Management In den fünfziger Jahren vollzog sich eine gewisse Abkehr vom funktionsorientierten Verständnis: Marketing wird als eine unternehmerische marktorientierte Denkhaltung (business philosophy) verstanden (marketing management concept, marketing concept). Bei dieser Ausrichtung hat sich eine Unternehmung an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren und diese Grundhaltung in einem Marketing-Management-Konzept (Houston 1986), verkürzt Marketing-Management (McCarthy 1964, Kotler 1967), zu konkretisieren. In diesem Verständnis war Marketing die marktgerichtete und damit marktgerechte Unternehmungspolitik (Weinhold 1970). Marketing bezog sich primär auf die Absatzmärkte einer Unternehmung. Die darauffolgenden Konzeptionen waren von einer Interpretations- und Gliederungsvielfalt geprägt, die das Verständnis wie die Umsetzung des Marketing in die Praxis nicht erleichterte. Trotzdem können wir nach wie vor von drei Sinngehalten sprechen: (1) Marketing-Praxis (Marketing als Sachvorgang und Tätigkeit), (2) Marketing-Konzept (Marketing als Denkhaltung und Unternehmungspolitik) und (3) Marketing-Theorie (Marketing als Disziplin und Lehre) (Krulis-Randa 1977). 7 UZH | Marketing I Die Austauschbeziehungen wie das Verhalten der Beteiligten (Käufer, Verkäufer, Organisation, Gesellschaft) sind der Kern jeder Marketing-Theorie (Bartels 1968, Bagozzi 1975, Hunt 1983, Houston/Gassenheimer 1987): Eine Theorie versucht etwas zu erklären und zu gestalten (Wenn-Dann-Aussagen). Die möglichen Ingredienzen einer generellen Marketing-Theorie: «Marketing is a study of market behavior rather than marketer behavior or buyer behavior». «Market behavior is measured by a fundamental unit of analysis called the market transaction». «We must focus on the dynamic nature of marketing». «Marketing as a study of market behavior must include constraints on that behavior». «The raison d'être of marketing is to create and distribute values» (Sheth/Gardner/Garrett 1988). Setzten ältere deutschsprachige Marketing-Begriffe Marketing mit «Sachvorgang», «Tätigkeit», oder «Absatz» gleich, so erhielten neuere die zusätzliche Dimension «geistige Einstellung der Unternehmungsleitung», «Denkhaltung», «Grundeinstellung», «Unternehmensphilosophie» oder «Handlungsmaxime». Dieses Marketing-Management «umfasst die Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle von Programmen, die darauf gerichtet sind, gewünschte Austauschbeziehungen mit bestimmten Zielgruppen zum Zweck des eigenen oder beiderseitigen Vorteils herbeizuführen» (Kotler 1977). Die wesentlichen Inhalte eines so verstanden Marketing-Management im Sinn eines Entscheidungsprozesses sind beispielsweise: 1. Analyse der Chancen und Risiken (Markt, Umwelt) sowie der Stärken und Schwächen (Marketing, Unternehmung) 2. Festlegung der Marketing-Ziele und -Strategien 3. Planung der Marketing-Instrumente 4. Umsetzung der Aktivitäten 5. Kontrolle des Erfolgs (Effektivität, Effizienz) © Marketing kann daher in einem klassischen Verständnis als marktorientierte Führung verstanden werden: einerseits als Leitbild des Management, andererseits als gleichberechtigte Unternehmungsfunktion (Meffert 2000). Die Marketing-Instrumente sind dabei die Gesamtheit der unternehmerischen Aktionsbzw. Handlungsalternativen, welche die Marktbeziehungen (Beschaffungs- wie Absatzmärkte) gestalten und der Realisierung des unternehmerischen Leistungsangebotes in den Märkten dienen. Diese Instrumente werden als Marketing-Mix je nach Autor unterschiedlich gegliedert: Die Marktorientierung prägt die übrigen unternehmerischen Bereiche: beispielsweise die Forschung und Entwicklung, die Produktion, das Rechnungswesen, das Controlling, die Entwicklung marktorientierter Organisationsstrukturen (Kunden-, Markt- und Produktmanagement) wie die Unternehmungskultur. Eine Marketingorientierung muss in jeder Organisation umgesetzt, implementiert werden (managing marketing implementation). Ausdruck der gesamten unternehmerischen Kraft, die eingesetzt wird, um eine Unternehmung marktorientiert (market driven, customer focused) zu gestalten, ist die Marketization (Kotler 1989). 8 UZH | Marketing I 1.4. Marketing-Vertiefung © In der gesamten Entwicklung von 1900-1970 wird Marketing als eine unternehmerische Aktivität (business activity) betrachtet. Erste Kritik am Marketing führte zur Forderung einer vermehrten Berücksichtigung menschlicher Werte im traditionellen MarketingKonzept, dem Human Concept of Marketing (Dawson 1969). Individuelle Sicherheit, Konsumentenbewegung (consumerism) und Umweltschutz sind Ausdruck vielschichtiger Veränderungen der Unternehmungsumwelt. Diese Entwicklungen unterstützten das Postulat der Übernahme vermehrter gesellschaftlicher Verantwortung im Rahmen unternehmerischen Handelns: Die traditionelle Mikro-Orientierung am Markt (Kunde) ist durch eine Makro-Orientierung (Gesamtgrössen) zu vertiefen. Das Makro-Marketing (Hunt 1976) ist Ausdruck dieser Vertiefung(deepening) des angestammten Marketing: Die Berücksichtigung ökologischer, sozialer, humaner und ethischer Aspekte anerkennt den Tatbestand der vernetzten Situation jeder Unternehmung. Ebenso nimmt jeder Mitarbeiter durch sein Handeln bzw. Nicht-Handeln mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf die Gesellschaft als Ganzheit (societal orientation) und ihre Entwicklung. 9 UZH | Marketing I Herausforderungen wie AIDS, Arbeitslosigkeit, BSE, globaler Handel, neue Medien oder Schattenwirtschaft unterwerfen Marketing noch verstärkt gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Zielen (externen Effekten). Marketing wird von dieser Zielbildung erfasst und von dort hinzunehmenden Fehlschlägen getroffen (Dichtl 1985): Eine zu enge Ausrichtung der Unternehmung an den einzelnen Konsumenten vernachlässigt möglicherweise die übrigen Aspekte von Markt, Branche und Umwelt. Die umfassende Berücksichtigung dieser Aspekte findet ihren Ausdruck im Societal-Marketing (El-Ansary 1974). Diese Markt- und Gesellschaftsorientierung entspricht dem Verständnis des Makro-Marketing (Moyer/Hunt 1978): Individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse sind gleichwertig und möglichst gleichzeitig zu befriedigen. Diese Ausrichtung muss nicht notwendigerweise zu einem Konflikt zwischen individuellen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Zielen führen. Ausprägungen des Societal-Marketing sind das kamerale Marketing(sparsamer Einsatz der Ressourcen) (Bantleon/Wendler/Wolff 1976), das ökologische Marketing bzw. ÖkoMarketing (green marketing) und das umweltorientierte Management (environmental management) (Zeithamel/Zeithamel 1984). Die Societal-Orientierung kann von öffentlichen Interessen (Allgemeinwohl, Gesamtoder Gemeininteresse, Gemeinwohl) nicht losgelöst werden. Träger solcher externen Interessen sind soziale Gruppen (stakeholders) (Achleitner 1985): 1. Bezugsgruppen Alle sozialen Gruppen, welche in irgendeiner Beziehung zu einer Organisation stehen, z.B. eine politische Partei. 2. Interessengruppen Bezugsgruppen, die ein unmittelbares Interesse am Verhalten einer Organisation haben, z.B. die Konsumentenorganisationen. 3. Anspruchsgruppen Interessengruppen, die konkrete Ansprüche gegenüber einer Organisation erheben, z.B. die Nachbarn einer emissionsreichen Produktionsstätte. 4. Strategische Anspruchsgruppen Anspruchsgruppen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Aktivitäten einer Organisation nehmen können, z.B. die Kunden. © In den vielschichtigen Handlungsräumen «Staat», «Gesellschaft» und «Markt» muss die aktive Berücksichtigung der verschiedenen Ansprüche Gegenstand des unternehmerischen Handelns sein. Diese Wahrnehmung der sozialen Verantwortung kann zu Wettbewerbsvorteilen und neuen Märkten (Öko-Innovationen u.ä.) führen: 10 UZH | Marketing I Werden die öffentlichen Interessen ungenügend oder gar nicht berücksichtig, erbringen möglicherweise andere Unternehmungen oder Organisationen (Nichtregierungsorganisationen u.a.) die Interessenwahrnehmung mittels Skandal-Marketing effektiver und effizienter oder die Massenmedien skandalisieren unternehmerische Sachverhalte (Holzmüller/Schuh 1988). © Diese gesellschaftsbewusste Erweiterung des Marketingdenkens beinhaltet zusammenfassend die vermehrte Auseinandersetzung mit nichtmarktlichen strategischen Fragen und die berechtigte Suche nach Marketing- und Management-Hilfen für ihre praktische Bewältigung (ökologische Produkte u.a.). 1.5. Marketing-Ausweitung Neben diesen Strömungen der Vertiefung, finden wir seit den 70er Jahren eine vermehrte, oft undifferenzierte Übertragung angestammter Marketing-Ideen auf gemeinwirtschaftliche und öffentliche Betriebe und Unternehmen wie öffentliche Organisationen (non-profit-organizations, not-for-profit-organizations). Diese Ausweitung (broadening) beinhaltet auch die Verbreitung sozialer Ideen von karitativen Organisationen und Aktivitäten sozialer Problemlösungen: Marketing für Nonprofit-Organisationen (Kotler/Andreasen 1987, Kotler/Scheff 1997), Polit-Marketing (Wangen 1983), Social-Marketing (Kotler/Zaltmann 1971, Kotler/Roberto 1989), SozioMarketing (Holscher 1977), Verwaltungsmarketing (Homann 1989). Diese Strömungen sind weder eine Uminterpretation des kommerziellen Marketing noch eines auf das Instrument «Kommunikation» reduzierten Marketing. Im Mittelpunkt steht die individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisbefriedigung, beispielsweise beim «Produkt Kranken11 UZH | Marketing I haus» die individuelle Heilung, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung und die Ausbildung des medizinischen Personals. Eine umfassende Ausweitung vom marktlichen zum sozialen Austausch (Fässler 1989) finden wir im Generic Concept of Marketing (Kotler 1972). Diese Sicht verwischt jedoch die Grenzen zwischen Marketing und anderen unternehmerischen Funktionen, insbesondere Führung und Personalwesen derart, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit in der konkreten Ausgestaltung dominiert. Die skizzierten Marketing-Strömungen (broadening, deepening) wurden von der renommierten American Marketing Association (AMA) einst - unglücklicherweise - im Begriff «Metamarketing» zusammengefasst. Im Frühling 1985, seit 1960 ihre erste Neudefinition, veröffentlichte die American Marketing Association ihre umfassende MarketingDefinition: «Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organisational objectives». Dieses Marketing-Verständnis bestärkt die Loslösung des Marketing von einer engen unternehmerischen Ausrichtung (business activity) und stellt die Gestaltung aller Austauschbeziehungen in den Vordergrund. Auch dieser Begriff soll die individuelle Kommunikation erleichtern, das Trennende abbauen, das Verbindende schaffen, das Marketing-Verständnis erleichtern. 1.6. Megamarketing © Aussermarktliche Institutionen (Regierungen, Nichtregierungsorganisationen u.a.) können einen nationalen oder internationalen Markteintritt begünstigen, verzögern oder verhindern. Diese Entwicklung erfordert nach Kotler (1986) eine Erweiterung der MarketingInstrumente: Zu den angestammten «four P´s» (product, price, place, promotion) treten im Konzept des Megamarketing ergänzend die politische Einflussnahme (power) und die Public Relations (publics). Das traditionelle Marketingziel, die Befriedigung der Konsumentenbedürfnisse bleibt primär. Jedoch sind nicht nur die Kunden und die übrigen Marktpartner die Adressaten, sondern auch die Politiker, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und andere Interessengruppen (stakeholders). Diese Gruppierungen sind mit den zwei zusätzlichen MarketingInstrumenten langfristig anzusprechen. Die Konsequenz: «Mancher mag Einwände gegen die hier vorgetragenen Ansichten haben. Denn Megamarketing dringt in die Kompetenzbereiche anderer Manager ein und setzt voraus, dass die Marketingverantwortlichen nicht vor dem Einsatz der Macht zurückscheuen. Sie gehen mit anderen Parteien im allgemeinen ausgesprochen gentlemanlike um. Megamarketing mag da einen Imageschock bedeuten. Doch diese Unschuld hat dazu geführt, dass Unternehmungen auf Märkten scheitern, wo harte Verhandlungen, Bestechungen und skrupellose Kompensationsangebote an der Tagesordnung sind» (Kotler 1986). Die skizzierte Begriffsvielfalt können wir, ausgehend vom angestammten BusinessMarketing, in einer zweidimensionalen Sicht zusammenfassen: 12 UZH | Marketing I © 1.7. Strategisches Marketing Die anfängliche Idee des Marketing-Management als marktgerechte und marktgerichtete Unternehmungspolitik wandelte sich zu einer langfristigen, umfassenden Markt- wie Wettbewerbsorientierung, dem strategischenMarketing (Marketing-Management). Die unterschiedliche Marketing-Sicht kann kriterienhaft verglichen werden (Cady/Buzzel 1986): 13 UZH | Marketing I © Marketing beeinflusste die Entwicklung des strategischen Management durch die Marketing-Konzeption, die Segmentierung, die Positionierung wie den Produktlebenszyklus (Biggadike 1981). Andererseits prägten Management-Vorstellungen die möglichen Inhalte eines strategischen Marketing, insbesondere über die Bewertung und Auswahl von Produkt-Markt-Kombinationen und deren organisatorische Verankerung in der Unternehmung (Köhler 1985). In dieser strategischen Sicht mehren sich die Gemeinsamkeiten von Marketing und Unternehmungsführung und -politik. Die enge Marktorientierung erfährt ihre Integration in der gesamtheitlichen Führung (integrierte Führung, marktorientierte Führung, strategisches Management). Das strategische Marketing ist ein notwendiger Ansatz, um die enge, meist kurzfristige Marktsicht (Kunde) mit den Dimensionen der Konkurrenz (Branche) und Umwelt zu erweitern: Der Unternehmungserfolg beruht nicht nur auf einer langfristigen Bedürfnisbefriedigung aktueller und potentieller Kunden und ihrer Umsetzung in praktisches operatives Handeln (Implementierung), sondern auch in der Schaffung langfristig verteidigbarer Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz und im verantwortungsvollen Handeln in der Umwelt. Die dabei resultierende persönliche, sachliche, räumliche und zeitliche Differenzierung sollte dauerhaft sein. Marketing wird daher umso wichtiger, je höher die 14 UZH | Marketing I Wettbewerbsintensitäten, je grösser die Verhandlungsmacht der Kunden und je stärker die gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen sind. 1.8. Beziehungsmarketing 1.8.1. Customer Relationship Marketing Während sich das traditionelle Marketing-Verständnis an den einzelnen Markttransaktionen (Kauf, Bezahlung u.a.) orientiert (transaction marketing), sind bei einem heutigen Verständnis die vielschichtigen Beziehungen wesentlich. Diese qualitativ neue Ausrichtung kann mit Beziehungsmarketing, Relationship Marketing oder Customer Relationship Marketing (CRM) umschrieben werden. Der Begriff wurde in den 80er Jahren in der angelsächsischen Literatur eingeführt: «Relationship Marketing is attracting, maintaining and - in multi-service organizations - enhancing customer relationships» (Berry 1983). Eine neuere Definition versteht Beziehungsmarketing wie folgt: «An integrated effort to identify, maintain, and build up a network with individual consumers and to continuously strengthen the network for the mutual benefit of both sides, through interactive, individualized and value-added contacts over a longer period of time» (Shani/Chalasani 1992). Das Beziehungsmarketing hat einerseits das Potential, verschiedenste MarketingAnsätze (Konsumgüter-, Industrie-, Societal- und Servicemarketing) zusammenzuführen, andererseits ist es sehr ähnlich, wenn nicht identisch mit einer Vielzahl von Konzepten, beispielsweise «Aftermarketing», «After Sale Marketing», «Database Marketing», «Loyalty Marketing» oder «One to one Marketing». Das Grundverständnis «Beziehungsmarketing» kann durch die folgenden Aspekten charakterisiert werden: • • • • • © Der Verkauf ist der Beginn, nicht das Ende einer Kundenbeziehung, d.h.nicht «to make a sale», sondern «to create a customer». Der Kunde erwartet individualisierte Leistungen. Diese Form der Leistungserbringung erfordert individualisierbare Prozesse und Produkte (Mass Customization) Das Marketing orientiert sich an den langfristigen Kundenbeziehungen. Die Beziehungen, nicht die Produkte, bestimmen die Marketing-Aktivitäten. Die Gestaltung der Beziehungen ist Ausdruck einer intangiblen (Kern-)Kompetenz. Die wesentliche Aufgabe des Relationship Marketing ist die Gestaltung von langfristigen (End-)Kundenbeziehungen zwecks allseitiger Wertsteigerung und der Schaffung strategischer Wettbewerbsvorteile. Die Positionierung des Beziehungsmarketing sei kurz verdeutlicht: • • Eine Leistung wird durch die Interaktionen zwischen Käufer und Verkäufer geprägt. Die zunehmend komplexeren Problemlösungen sind Ausdruck eines Leistungsbündels mit einer erhöhten Wertdichte und einer stärkeren Gewichtung der Serviceaspekte. Die zunehmende Individualisierung lässt sich sowohl auf die Individualisierung der Austauschobjekte (Informationen, Produkte u.a.) als auch auf die Einzigartigkeit der Austauschprozesse zurückführen. Individualisierte Leistungen erhöhen die Bin15 UZH | Marketing I • • dungsstärke zu Kunden wie Lieferanten, da die Leistungserstellung und -nutzung möglicherweise beidseitig spezifische Investitionen erfordert. Ein weiteres Element ist die Komplexität und Hochwertigkeit des Leistungsversprechens: Insbesondere im Dienstleistungsmarketing wird der Produktionsprozess durch die Interaktion mit dem Kunden meist gleichzeitig zum Marketingprozess: Der Kunde kann als «Co-Producer», «Co-Designer» oder «Prosumer» in die Prozesse der Leistungserstellung integriert werden. Der Kunde wird so zum aktivierbaren Produktionsfaktor. Durch die Ausweitung auf die vielfältigen externen Märkte (Kunden, Lieferanten u.a.) und die internen Märkte ist Beziehungsmarketing ein ganzheitliches Verständnis von Marketing. Oft wird von der Vorstellung ausgegangen, dass sich Beziehungsmarketing konzeptionell in die sich gegenseitig durchdringenden Dimensionen «externes Marketing» und «internes Marketing» gliedern lässt: © Externes Marketing Primärer Gegenstand des externen Marketing sind die langfristigen und langfristig einzigartigen Beziehungen zu Lieferanten und Kunden (relationship customization), welche Imitationen von Konkurrenten verhindern und einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil sichern sollen. Diese Beziehung ist stark mit Inhalten wie Commitment, Involvement, Loyalität, Vertrauen und Zufriedenheit verwoben. Sie kann zu einer stimmigen Kundenbindung führen und so die zukünftigen Unternehmungsergebnisse nachhaltig bestimmen. Die Konzepte der Marketing-Strategien versuchen die Frage zu beantworten, weshalb sich eine Unternehmung in einer Branche über längere Zeit erfolgreich entwickelt. Mit 16 UZH | Marketing I dem Marketing-Mix konkretisiert die Unternehmung ihre Beziehungen: In ihnen finden die Strategien ihre konkrete Umsetzung, ihre Implementierung. Die MarketingInstrumente müssen hinsichtlich ihres Einsatzes kombiniert und synchronisiert werden. Die Beziehungen einer Unternehmung zu ihren Kunden und Lieferanten sind Ausdruck von Prozessen mit verschiedenen Phasen und Inhalten, beispielsweise der «Bestellungsauslösung, -annahme und -abwicklung». Diese Sichtweise bedingt eine Identifizierung unternehmungsrelevanter Marketingprozesse. Dabei können interaktive Medien, beispielsweise CDROM, Internet oder POS-Terminals die Gestaltung der vielschichtigen Prozesse unterstützen. Diese mediale Nutzung kann als Online- oder OfflineAnwendung erfolgen: Der Kunde tritt mit dem Anbieter ohne Umweg in Kontakt oder greift auf interaktive Medien zurück, ohne dass eine direkte Kommunikation zum Anbieter aufgebaut wird. In jeder Ausprägung der Beziehungsgestaltung muss Marketing auf die individuellen Kundenbedürfnisse eingehen (segment-of-one marketing). Mit Hilfe dieser «micromajorities» (McKenna 1988) können, quasi von unten, grössere Segmente gebildet werden, ohne die individuelle Ausrichtung der Marketing Aktivitäten aufzugeben. Die Analyse und Beurteilung dieser Kundenpotentiale erfolgt nicht nur auf der Basis von individuellen Käufermerkmalen, beispielsweise mittels Database-Marketing bzw. Data Mining, des bisherigen Kundenverhaltens bzw. der Kundenlebenszyklen, sondern bezieht Merkmale vergangener, bestehender wie potentieller Beziehungen zwischen Kunde und Unternehmung mit ein. Internes Marketing © Das Marketing kann grundsätzlich nur dann effektiv, effizient und flexibel umgesetzt werden, wenn die Marketing-Verpflichtung von der gesamten Unternehmung getragen wird (Levitt 1983). Aus diesem Grunde ist dem internen Marketing verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Es basiert auf der Idee, die Realisierung der Marketing-Politik zu verbessern, indem sie in die Unternehmung gekehrt wird: «Internal marketing starts from a notion that the employees are a first, internal market for the organization. If goods, services, and external communication campaigns, cannot be marketed to this internal target group, marketing to ultimate, external customers cannot be expected to be successful either» (Grönroos 1990). Internes Marketing ist ein Konzept zur Gestaltung einer marketingorientierten Organisation: «In practice, internal marketing is concerned with communications, with developing responsiveness, responsibility and unity of purpose» (Payne 1993). Gegenstand eines internen Marketing sind strukturelle, prozessuale und kulturelle Aspekte: • • Einer Unternehmung muss im Aufbau und in den Abläufen eine innere Ordnung gegeben werden. Die Organisationsstruktur sollte die Bündelung partnerspezifischer Aufgaben ermöglichen und eine hohe Kundennähe in der Leistungsentwicklung und -erstellung sicherstellen. Die vielschichtigen Prozesse bedingen ein klares Prozessverständnis: «Marketing 17 UZH | Marketing I • processes, designed to get customers to initiate a relationship or transaction with an organization; sales processes, the activities associated with customer purchase and receipt of, and payment for, products or services; and service processes that provide for post-sales maintenance of customer relationships» (Davenport 1993). Traditionen, Wertvorstellungen und gültige Meinungen von Kunden, Mitarbeitern und Führungspersönlichkeiten summieren sich zu einer mehr oder weniger homogenen Marketingkultur. Die stringente Umsetzung des Beziehungsmarketing führt zu den folgenden unternehmerischen Chancen: • • • Die Marketingkosten pro Kunde sind bei langfristigen Beziehungen tiefer bzw. der Umsatz pro Kunde höher. Die Kundenbindungen sichern der Unternehmung einen Testmarkt und ermöglichen somit vereinfachte Produkteinführungen. Die Kosten der Beziehungsgestaltung, somit die Marketingkosten, sind in Relation zum Kundenwert zu setzen und an ihm auszurichten. 1.8.2. Netzwerke © Die Vielfalt von materiellen und immateriellen, von direkten und indirekten, von strategischen und operativen Transaktionen zwischen Herstellern, Kunden und Lieferanten, zwischen Kunden und Kunden, zwischen Personen in- und ausserhalb der Unternehmung, erweitern in einem umfassenden Verständnis die lineare Beziehungssicht zwischen zwei Partnern zu einem Beziehungsgeflecht, zu einem Netzwerk. Dabei sind zwei oder mehrere Organisationen in langfristige Beziehungen involviert (Thorelli 1986). Wir können zwischen internen, stabilen und dynamischen Netzwerken (Snow/Miles/Coleman 1992) und verschiedenen Beziehungsinhalten unterscheiden. So verdeutlichten beispielsweise die Autoren einer Studie über Einkaufsbeziehungen, dass beim Nutzen der Partnerschaft immaterielle Inhalte eine tragende Rolle spielen: gute Kommunikation und persönliches Vertrauen (Fram 1995). Am Anfang eines Netzwerks bestehen zunächst lineare Beziehungen zwischen Unternehmungen (A-B/A-C). Durch die stimmige Gestaltung der Beziehungen (B-C) entwickelt sich die Unternehmung A als Knoten im Netzwerk zum Netzwerkgestalter: Dabei sind die Beziehungen die Kernelemente eines solchen Netzwerkes (Håkansson/Johanson 1993). So stuft Webster (1992) das Netzwerk als «ultimate outcome of relationship marketing» ein. Das Netzwerk kann sich zu einem Wertschöpfungssystem (value creating system) (Normann/Ramírez 1993) entwickeln und der marktliche Wettbewerb zu einem Wettbewerb der Netzwerke. 18 UZH | Marketing I 1.8.3. Konzept Marketing Die Beschaffungs- und Absatzmärkte (unmittelbare Umwelt) sind Segmente einer umfassenden Umwelt (mittelbare Umwelt) mit ihren kulturellen, ökonomischen, ökologischen, politischen, rechtlichen, sozialen und technischen Phänomenen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Marketing immer dreiseitig zu verstehen ist: beschaffungs-, absatzmarkt- und umweltorientiert: In diesem umfassenden Gesamtverständnis beinhaltet Marketing die dauernde Auseinandersetzung in den folgenden Räumen: © 19 UZH | Marketing I Die unmittelbare wie mittelbare Gestaltung dieser Räume ist Gegenstand eines integrierten Marketing-Management (framework) und Ausdruck der dauernden Auseinandersetzung mit dem Markt, der Marktforschung, den Marketing-Instrumenten (MarketingMix), dem Marketing-Management, der Unternehmung und der Umwelt als umfassende Erscheinung. © 2. Markt 2.1. Marktmorphologie Das Zusammentreffen von Anbietern und Nachfragern einer bestimmten Leistung (Produkt) bezeichnen wir als Markt. Die Absatz- und Beschaffungsmärkte sind die unmittelbare Unternehmungsumwelt. Auf Märkten können Produkte (Fahrräder u.a.), Dienstleistungen (Beratung u.a.), Kapital (Kredite u.a.) und Informationen (Daten u.a.) gehandelt werden. Sie können räumlich, sachlich und zeitlich definiert werden. Die Märkte unterliegen ökologischen, ökonomischen, politischen und/oder technologischen Einflussfaktoren. Ein örtlich und zeitlich konzentriertes Zusammentreffen (Börse, Auktion, Messe) führt zu einem hoch organisierten Marktgeschehen. 20 UZH | Marketing I Auf einem Markt tritt eine Unternehmung unmittelbar handelnd auf und es entstehen zwischen den Marktteilnehmern Kommunikations-, Kooperations, Wettbewerbs- und Machtbeziehungen. Die Anzahl dieser Marktteilnehmer bestimmt die jeweilige Marktform: Ein offener Markt liegt vor, wenn alle Marktteilnehmer Zutritt zu den Märkten haben; ein geschlossener Markt, wenn durch rechtliche (Konzessionen, Patente), technische oder andere Gründe der Zugang erschwert ist (hohe Markteintrittsbarrieren). Geschlossene Märkte führen zu oligopolistischen und monopolistischen Situationen. © Das Zusammenspiel der Marktteilnehmer ist nicht statisch, es ändert sich im Zeitablauf (Marktdynamik): Neben der Art und der Anzahl der Marktteilnehmer (Entwicklung Marktstruktur), verändert sich ihr Verhalten (Verhaltensentwicklung) (Steffenhagen 1988). 2.2. Bedürfnisse Bereits Lisowsky (1936) stellte in seinem «Primat des Absatzes» die Fragen: Was für Bedürfnisse werden durch meine Waren befriedigt? Wer braucht sie? und warum? Sind sie eigentlich das Richtige für ihn? Wie sieht es aufgrund dieser Bedürfnisse sowohl in seiner Seele als auch in seinem Haushalt wohl aus? Das jeweilige Marktgeschehen ist Ausdruck individueller Bedürfnisse und Motive (Ziele) der einzelnen Marktpartner: 21 UZH | Marketing I Die individuellen Bedürfnisse der Marktteilnehmer drücken einen individuellen Mangelzustand (z.B. Durst) aus. Sie bewirken ein richtungsorientiertes Verhalten, um diesen Mangel zu beseitigen. In diesem Verständnis verwenden wir die Begriffe «Bedürfnis», «Interesse» und «Motiv» synonym. Bedürfnisse können strukturiert und unter Kunden-, Markt- wie Marketing-Aspekten differenziert werden. So sind beispielsweise «Qualität» (Langlebigkeit, Verarbeitung, Zuverlässigkeit), «Funktion» (Komfort, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit), «Gebrauch» (Arbeit, Einkauf, Freizeit, Urlaub), «Emotionen» (Ästhetik, Aktualität, Erlebnis), «Gesellschaft» (soziale Akzeptanz, Umwelt, Understatement) oder «Marken» (Kaufsicherheit, Prestige, Service) spezifische Bedürfnisse eines Automobilkäufers (Müller 1987). © Gehen wir von der Bedürfnistheorie von Maslow aus, aufgrund derer ein Mensch durch bestimmte Bedürfnisse motivierbar ist, so dienen befriedigte Bedürfnisse dem Individuum nicht mehr als Motivation und unbefriedigte erzeugen einen Spannungszustand, den es durch Bedürfnisbefriedigung abzubauen gilt. Ein Bedürfnis wird in einem Bedarf konkretisiert, der durch Marktleistungen (Leistungskategorien) aufgrund gewisser Kriterien (präferenzbildende Faktoren) wahrgenommen und schliesslich durch ein angebotenes Produkt (Nutzen) gedeckt wird (Dichtl 1987): 22 UZH | Marketing I © 23 UZH | Marketing I Im skizzierten Marktgeschehen haben Anbieter sowie Nachfrager Ressourcen und Fähigkeiten. Durch deren Einsatz entstehen je ein erwarteter Nutzen wie erwartete Kosten. Der resultierende erwartete Nettonutzen (Wert) ist Ausdruck der Bereitschaft, einen marktlichen Geld-, Güter- und/oder Informationsaustausch zu tätigen. 2.3. Marktdimensionen Zwischen einem Leistungsersteller (Unternehmung) und -verwender (Kunde) bestehen wechselseitige Beziehungen. Diese Interaktionen zwischen den verschiedenen Tauschpartnern charakterisieren eine Marktsituation. In dieser Gesamtheit spielen trennende und gemeinsame Faktoren zusammen, wächst der eine Partner mit dem anderen (win-win-situation). Marktdimensionen sind jene Faktoren, die ein Angebot von der Nachfrage trennen (Krulis-Randa 1977): © Sind Markttrennungen räumlicher (Ort der Herstellung/Ort des Verbrauchs), zeitlicher (Produktion heute/Verbrauch morgen) und mengenmässiger (Massenproduktion/Einzelgebrauch) Art naheliegend, so bedeutet die Trennung der Wahrnehmung, dass Anbieter wie Nachfrager nicht umfassend über die Leistungen der Gegenpartei informiert sind (fehlende Markttransparenz). Gleichzeitig findet bei jedem Tausch eines Produktes eine Übertragung der Eigentumsrechte statt und diese erfolgt nur dann, wenn sich Anbieter und Nachfrager über die Bewertung dieses Tausches (Preis, Engagement, Verzicht, Zeit) einigen können. Die Gestaltung dieser Distanzen ist Ausdruck der Harmonisierung von Angebot und Nachfrage. Aus Anbietersicht gibt es dabei die folgenden Möglichkeiten: 24 UZH | Marketing I • • • • • • vorhandene Nachfrage: Bedarf decken fehlende Nachfrage: Bedarf klären latente Nachfrage: Bedarf entwickeln stockende Nachfrage: Bedarf beleben schwankende Nachfrage: Bedarf synchronisieren übersteigerte Nachfrage: Bedarf reduzieren Die grundlegende Aufgabe des Marketing ist die stimmige Überwindung aller Distanzen und das Schaffen gemeinsamer Dimensionen: «Marketing creates the transaction or flows which resolve market separations and result in exchange and consumption» (Bartels 1968). Marketing muss daher einen Kundennutzen finden, ihn gestalten und kommunizieren. 2.4. Marktgrössen © Die Marktgrössen sind Mengen- und/oder Wertgrössen, welche den Markt quantitativ umschreiben: Die Relation von Marktvolumen und Marktanteil bezeichnet man als Marktdurchdringungsgrad. Entscheidend bei einer Marktbeurteilung ist der Vergleich von Marktpotential und Marktvolumen: Entspricht das Marktvolumen weitgehendst dem Marktpotential, so spricht 25 UZH | Marketing I man von gesättigten oder ausgeschöpften Märkten. Neben dieser rein quantitativen Sicht kann eine Marktsättigung mittels der folgenden Kriterien operationalisiert werden: Die Situation gesättigter Märkte ist in hochindustrialisierten Welten relativ häufig, aber bei einer globalen Betrachtung immer relativ. Ein gesättigter Markt bedeutet für die einzelne Unternehmung gleichzeitig eine Gefahr und eine Chance: stagnierende Gesamtbranche, Überkapazitäten, Verfall der Branchenrendite, erhöhte Preissensibilität des Kunden, oberflächliche Konsumtrends, selektiv starkes Engagement, Konzentration im Handel, Verdrängungswettbewerb, zunehmende Importanteile, Pseudoinnovationen (Belz 1986). © 2.5. Marktverhalten Das Marktverhalten ist Ausdruck der qualitativen Marktfragen. Der Kauf eines Produktes ist nicht nur eine Entscheidung, ein Produkt zu erwerben («eine Affäre zu haben»), sondern eine dauernde Bindung («eine Ehe») mit dem Leistungsersteller einzugehen, denn die Produkte sind zu komplex und ständige Verhandlungen nervenaufreibend und teuer (Levitt 1983). Dies erfordert aus Anbietersicht eine hohe Kundennähe (close to the customer): Erfolgreiche Unternehmungen schulmeistern ihre Kunden nicht, sie lernen von ihnen, sie lösen ihnen ihre Probleme (Peters/Waterman 1982). Ein Neu- oder Wiederkauf ist für den Kunden mit verschiedensten Risiken verbunden: 1. 2. 3. 4. Risiko Produkt (Qualität, Recycling usw.) Risiko Produktverwendung (Handling, Sicherheit usw.) Risiko Hersteller (einer oder mehrere Lieferanten) Risiko Kauf (Neukauf, unveränderter oder modifizierter Wiederkauf) 26 UZH | Marketing I Diese Risiken prägen die vielschichtigen marktlichen Interaktionen und ihre Gestaltung. Die resultierenden Interaktionsmuster sind Ausdruck der Marktbeziehungen: 1. 2. 3. 4. Beziehungen zwischen einzelnen Unternehmungen (Buying Center, Selling Center) Beziehungen zwischen Unternehmungen und Konsumenten Beziehungen zwischen einzelnen Konsumenten Verhalten einzelner Kunden (Konsumenten, Unternehmungen) 2.5.1. Marktverhalten Unternehmung Zur Erklärung des Kaufverhaltens von Unternehmungen ist das Konstrukt des Buying Center ein bedeutendes Konzept (Webster/Wind 1972): Welche Personen bzw. Personengruppen sind in welchen Rollen an einer Kaufentscheidung beteiligt? Die Autoren unterscheiden fünf verschiedene Rollen der am unternehmerischen Beschaffungsprozess beteiligten Personen: 1. Verwender (User) verwendet das Produkt, beispielsweise der Produktionsleiter. 2. Einkäufer (Buyer) hat die formale Vertragsbefugnis, beispielsweise die Sekretärin. 3. Beeinflusser (Influencer) beeinflusst den Prozess durch sein Wissen, beispielsweise der Berater. 4. Entscheider (Decider) entscheidet endgültig, meistens die Geschäftsleitung. 5. Personen mit Informationsfiltrierungsaktivitäten (Gatekeeper) kontrollieren und Steuern den Informationsfluss. © Zwischen diesen Beteiligten mit ihren relativen Machtpositionen bestehen formale und informale Kommunikationsbeziehungen. Die Kenntnis dieser vielfältigen Beziehungen ist die wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Marketing bei Investitionsgütern. Eine empirische Studie verdeutlicht, dass ein Buying Center aus etwa fünf bis sieben Personen besteht und generell bei der Beschaffung von Anlagegütern etwas grösser ist als bei der Beschaffung industrieller Verbrauchsgüter (Specht 1986). Das Konzept des Buying Center ermöglicht eine mehrstufige Marktsegmentierung (Gröne 1977, Shapiro/Bonoma 1984): 1. Organisationsbezogene Kriterien: Organisationsdemografische Kriterien (Betriebsstandorte), Institutionalisierung Einkauf (dezentral, zentral) 2. Merkmale des Entscheidungskollektivs (Buying Center): Grösse, Verhalten (aggressiv, passiv), Zusammensetzung 3. Merkmale der einzelnen Mitglieder des Buying Centers: Einstellungen, Informationsverhalten, Motive. 27 UZH | Marketing I Der Partner eines Buying Centers sind bei der anbietenden Unternehmung das Selling Center, das Selling Team oder ein Key Account Management. Diese organisatorischen Lösungen sollten auf das jeweilige Buying Center zugeschnitten sein und ein effektives Beziehungsfeld aufbauen. Mögliche Gestaltungsmittel sind der Kommunikationsstil (Ausführlichkeit, Fairness, Offenheit, Sachlichkeit u.ä.), der Konflikthandhabungsstil (Salamitaktik u.ä.) sowie der Kooperations- und Organisationsstil (Diller/Kuster 1988). Für die anbietende Unternehmung ist es sinnvoll, die Buying Centers ihrer Kunden sowie die Kundenbeziehungen (Entwicklung, Profitabilität u.a.) computergestützt zu gestalten (Data Warehouse). 2.5.2. Marktverhalten Konsumenten Obwohl kein Erklärungsmodell dem vielschichtigen Konsumenten gerecht wird, kann sein individuelles Verhalten vereinfacht und erklärt werden (Howard-Sheth-Modell). Dabei wird angenommen, dass der Input(Stimulus), der Output (Reaktion) und die externen Grössen mittels Befragung oder Beobachtung erfassbar sind: Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis siebzehn Jahren wurden beispielsweise OutputVariablen im Rahmen einer Marktforschung repräsentativ erfasst: Mit einem Betrag von 1000 DM würden 30.5 % der Befragten für einen Wunsch über 1000 DM sparen, eine Hifi-Anlage kaufen © (21.0 %) oder eine Urlaubsreise unternehmen (18.1 %) (Dieckmann/Prigge/Röttger 1990). 28 UZH | Marketing I Kaufentscheid Konsument Im engeren Sinn ist der Kaufentscheid der eigentliche Entschluss, im Weiteren der gesamte Kaufprozess. Aufgrund der individuellen Prozesse können wir Kaufentscheidungen wie folgt gliedern (Weinberg 1981): extensive Kaufentscheidung (Lernprozesse), limitierte Kaufentscheidung (Kauferfahrung), habitualisierte Kaufentscheidung (Gewohnheit) und impulsive Kaufentscheidung (Reizkauf). Die Reize aktivieren die inneren (psychischen) Vorgänge. Diese gliedern wir in aktivierende (gefühlsmässige) und kognitive (gedankliche) Prozesse; durch ihr undurchsichtiges Zusammenspiel entstehen komplexe Prozesse (Kroeber-Riel 1984): Aktivierende Prozesse Diese Prozesse haben dominante aktivierende Komponenten: Emotionen (inneres Erleben), Motivationen (zielorientiertes Handeln), Einstellungen (Gegenstandsbeurteilung, Involvement). Diese Elemente sind eng miteinander verbunden und können auch kognitive Dimensionen beinhalten. Die Aktivierung ist eine notwendige Voraussetzung für alle psychischen Prozesse, sie versetzt den Organismus in eine Leistungsbereitschaft und fähigkeit. Atmosphäre, Bilder, Design, Erlebnisse, Erotik, Marke und Verpackung sind beispielhafte Aktivierungspotentiale im Marketing. Eine Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn diese emotionalen und kognitiven Reize für das Individuum eine klare subjektive Bedeutung haben. © Kognitive Prozesse Diese Prozesse kontrollieren und steuern gedanklich das Verhalten. Es dominieren die kognitiven Dimensionen: Wahrnehmung, Entscheidung, Lernen, Gedächtnis. Die kognitive Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung vollzieht sich in verschiedenen Speichern. Man unterscheidet in einer elementaren Sicht die folgenden «Speicher» oder «Gedächtnisse»: 29 UZH | Marketing I Die Botschaftsinhalte (Reize) unterliegen individuellen Wahrnehmungsfiltern (Sozialisation, Empfindungen, Gefühle, Situation) und treffen so als Input auf den Ultrakurzzeitspeicher UZS. Dieser sensorische Speicher speichert Sinneseindrücke von 0.1 bis 1.0 Sekunden. Er hat eine grosse Kapazität, aber eine kleine Speicherdauer. Die Weiterverarbeitung eines Reizes findet nur dann statt, wenn in diesem sensorischen Speicher eine Speicherung erfolgt ist. Die visuelle Informationsaufnahme kann mittels Beobachtung des motorischen Verhaltens (Lese-, Suchverhalten) oder mit der Blickaufzeichnung ansatzmässig erfasst werden. © Der Kurzzeitspeicher KZS ist das Primärgedächtnis, das als Reservoir von Sinneseindrücken der Entschlüsselung der Reize dient: Es speichert (S) und verarbeitet (V) die Reize in eine gedankliche Information. Der Kurzzeitspeicher muss dabei auf die im Langzeitspeicher LZS, dem eigentlichen Gedächtnis, vorhandenen Informationen aus früheren Erfahrungen zurückgreifen. Der resultierende Output ist das unmittelbare und mittelbare menschliche Verhalten (Bewusstsein, Einstellung, Präferenz, Kauf des Produktes, Ablehnung). Diese Sicht orientiert sich an den Erkenntnissen der Hemisphärenforschung, wonach im gedanklichen Verarbeitungssystem die verbalen und nicht-verbalen Informationen in unabhängigen, aber miteinander verbundenen Systemen verarbeitet werden: Bei rechtshändigen Menschen ist die rechte Gehirnhälfte für emotionale, die linke für kognitive Vorgänge zuständig (Kroeber-Riel 1986). Umwelt Konsument Die Umwelt des Konsumenten (externe Variable) können wir in eine Makro-, Meso- und eine Mikro-Ebene gliedern (Kroeber-Riel 1984). Die Makroumwelt ist physischer und sozialer Natur. Die räumliche Orientierung beim Einkauf im Warenhaus (gedankliche Lagepläne der Regale als kognitive Kartografie), die Wirkungen von Design, Farben (Beleuchtung), Materialien, Musik und Gerüchen sind marketingspezifische Aspekte einer Makroumwelt. 30 UZH | Marketing I Die Mesoumwelt ist Ausdruck der Kulturen, Subkulturen und Lebensstile. Diese bewirken eine situative Einordnung des Einzelnen in den Markt: Konsumentensozialisation. Die Familie, Freunde und Massenmedien sind beispielhafte Sozialisationsagenten. Die unmittelbare Einflusssphäre bezeichnet man als Mikroumwelt: Familiensituation; Rollen (Frau, Mann, Kinder); Koalitionsbildungen in der Familie (oft Kinder/Mutter); Kommunikationsformen; Phasen im Lebenszyklus des Individuums bzw. der Familie (ledig, jüngeres Paar, «volles Nest», älteres Paar); soziale Einflüsse (Konformitätsdruck Dritter). Entsprechend der Suchintensität bei der Beschaffung der Produkte können wir zwischen Produkten des täglichen Bedarfs (convenience goods), des gehobenen Bedarfs (shopping goods), des Spezialbedarfs (speciality goods) und nichtgesuchten Produkte (unsought goods) unterscheiden (Kotler 1988). Der Such- und Beurteilungsaufwand nimmt von der ersten zur vierten Produktkategorie zu. Die jeweilige Produktbeurteilung ist ein aktueller, durch äussere Darbietung der Reize (Produktdesign, -farbe, -form, -image, -geruch, Gestik des Verkäufers, Ladenatmosphäre u.a.) ausgelöster Prozess; die Einstellung zu einem Produkt (Erwartungen, Gewohnheit, Markentreue, Risiko u.a.) ist das gelernte und gespeicherte Ergebnis von vorausgegangenen Wahrnehmungsvorgängen (Kroeber-Riel 1984). Die eigentliche Produktwahl erfolgt stark kognitiv (überlegen, bewusste Wahl, echte Entscheidung), gewohnheitsmässig oder schwach kognitiv (automatisch, impulsiv, spontan). Die Menge an Produkten (Marken), die dem Nachfrager in einem Kaufentscheid bewusst sind, bezeichnet man als «evoked set». © Der Ort des Kaufentscheides ist für das Marketing ebenso wesentlich. So zeigen verschiedene Untersuchungen, dass die Konsumenten 60-80 % ihrer Kaufentscheide erst am Verkaufspunkt fällen (Ritter 1989). Für den Konsumenten entscheidend sind die Informationsquellen, seien es eine Ausstellung, die Imitation von Mitmenschen (Innovatoren), das Schaufenster, ein Testbericht, die Werbung oder ein Verkaufsgespräch. Diese Quellen können aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit und Informationskosten für den Kunden (Büchelhofer 1989) geordnet werden: 31 UZH | Marketing I Erstellt ein Kunde seine Güter in einem hohen Masse selbst und/oder ist er mit einem externen Produktionsprozess durch die Integration in eine © Wertschöpfungskette verwoben, so sprechen wir von einem Prosumer oder vom CoDesigner. Ausprägungen solcher Kundenintegrationen finden wir im Bereich von «Do-itYourself»-Aktivitäten (Möbelmontage u.a.) oder beim E-Business (E-Banking u.a.). Lebensstile Die individuell typischen Einstellungs- und Verhaltensmuster des Konsumenten können im Phänomen «Lebensstil» (life style) zusammengefasst werden: Lebensstile stehen als Indikatoren des Alltagslebens wie seiner Wandlungen (Wertewandel). Beispielhafte Kriterien (items) zur Erfassung des Wertewandels sind soziale Bedürfnisse und Selbstverwirklichung (ästhetisch, intellektuell, Wertschätzung, Zugehörigkeit) sowie physiologische Bedürfnisse (Sicherheit, Versorgung) (Inglehart 1979). Lebensstile sind erfassbar (Wertprioritäten) und dienen dem Marketing, Zielgruppen (Marktsegmente) zu finden, die im Verhalten möglichst homogen sind. Lebensstile werden insbesondere durch Automarken, Getränke, Kleidung, Kosmetik, Urlaub, Wohnungsdesign individuell demonstriert. Ausprägungen solcher Lebensstile sind beispielsweise (Auer/Horrion/Kalweit 1989): Yuppies (young urban professional peoples) Bevorzugen immer das Neuste und Ausgefallenste, sind Pioniere im Käufermarkt (Com32 UZH | Marketing I puter, Restaurant, Sport, Technik), sind 23 bis 41 Jahre alt. Dinks (double income, no kids) Kinderlose Ehepaare, leiden an Zeitnot, machen öfters Urlaub, sind unterhaltungssüchtig (Essen, gesellschaftliche Anlässe, Medien). Ultras Unterscheidungsmerkmal zu anderen Gruppen: Lebenseinstellung (egoistisch, extrovertiert, handeln kurzfristig, Lebemenschen, Lust am Kauf, Nobelmarken, prestigeorientiert: das Beste, Feinste und Teuerste). Flyers (fun loving youth en route to success) Primär Studenten, sind 13 bis 25 Jahre alt, haben Einfluss auf den Kaufentscheid in der Familie, probieren gerne neue Produkte aus. Woopies (well off older people) Nachkarrieristen, sind 55 bis 64 Jahre alt, aktiv, vorzeitig aus dem Berufsleben ausgestiegen, kaufen exklusive Markenartikel, sind konsumfreudig. © Ein solcher Typ oder eine Gruppierung (Cluster), beispielsweise die «Bobos» (Brooks 2000) stellt ein mehr oder weniger homogenes Marktsegment dar: Ein Konsumtyp ist Ausdruck eines relativ homogenen Verhaltens (Cluster). Die individuelle Werte- und Verhaltensvielfalt (Lebensstilpluralismus) führt jedoch dazu, dass sich zwischen einzelnen Typen fliessende Übergänge bilden, d.h. ein und derselben Person können verschiedene Typen zugeordnet werden. Diese multiplen Identitäten (Mischtypen) führen zu fragmentierten Segmenten. Diese multioptionalen Kunden bilden zielgruppenübergreifende neue Zielgruppen, beispielsweise im Gastronomiebereich: Eine herkömmliche Marktsegmentierung führt beim Bedürfnis «Gesundheit» zum vegetarischen Restaurant, beim Bedürfnis «Prestige»zum Luxusrestaurant; der Mischtyp dieser Bedürfnisse ist das vegetarische Feinschmecker-Restaurant als neue Zielgruppe. Die kriterienhafte Klassifizierung empirischer Phänomene (Einstellungen, Verhalten) als Basis für ein zielgruppenorientiertes Marketing führt zu verschiedensten nationalen und internationalen Typologien. Neben «Euro-Styles» mit seinen sechzehn Typen (Europanel/CCA/IHA·GfM) finden wir verschiedene Längsschnittanalysen (Scope u.a.) solcher Typen. 33 UZH | Marketing I 2.6. Relevanter Markt Ein Markt ist nicht einfach gegeben, er ist eine strategische Wahl. Diese Wahl ist gleichzeitig eine Auseinandersetzung (Situationsanalyse) mit möglichen Marktrisiken: Das Risiko «Fokussierung auf zu wenige Kunden» ist Ausdruck der Kundengrössen (ABC-Analyse nach Umsatz bzw. Deckungsbeitrag). Die «Konzentration auf <starke> Produkte» zeigt sich in einem relativ stabilen Sortiment (geringe Innovationsrate), und eine unscharfe Positionierung bzw. Markenführung bewirken eine «diffuse Marktpräsenz» (unscharfes Image). © Marketing setzt daher eine umfassende Auseinandersetzung mit dem relevanten Markt, seinen Risiken und seinen Grenzen voraus: «What is our business and what should it be?» (Drucker 1954). Die Definition des relevanten Marktes ist die tragende Voraussetzung für die Markt- und Konkurrenzorientierung, die Marktsegmentierung und positionierung, für das Marketing an sich. Der relevante Markt entsteht durch ein Herausschälen der aktuellen und potentiellen Bedürfnisse, Verhaltensweisen und angebotenen Problemlösungen aus der Vielfalt unstrukturierter Schichten. Ältere Konzepte schlagen zur Marktabgrenzung physischtechnische Produktmerkmale als erste grobe Abgrenzung vor: Der relevante Markt umfasst alle Produkte, die sich nach Stoff, Verarbeitung, Form und technischer Gestaltung gleichen. Die Sicht der Anbieter vertritt beispielsweise das Konzept der funktionalen Ähnlichkeit: Der relevante Markt umfasst alle Güter, welche das gleiche Grundbedürfnis bzw. die gleiche Funktion erfüllen. Weitere Ansätze orientieren sich am Nachfrager, beispielsweise: Der relevante Markt umfasst alle Produkte, die vom Verwender als subjektiv austauschbar angesehen werden (Konzept der subjektiven Austauschbarkeit), 34 UZH | Marketing I oder er umfasst alle Produkte, welche vom gleichen Kundentyp nachgefragt werden (Konzept der Kundentypendifferenzierung) (Meffert 2000). Vereinfacht scheint ein hierarchisches Vorgehen – vom Allgemeinen (Welt) zum Speziellen (Segment) – sinnvoll: Was wird gekauft? Wer kauft? Warum wird gekauft? Wie wird gekauft? Wo wird gekauft? Wieviel wird gekauft? Dieses Vorgehen setzt oft die Überwindung der meist vorhandenen marktlichen Kurzsichtigkeit im Management (marketing myopia) (Levitt 1960) und die Offenheit für neuartige Problemlösungen voraus. 2.7. Marktsegmentierung Mit der Marktsegmentierung soll eine möglichst hohe Identität zwischen der unternehmerischen Leistung und einer bestimmten Anzahl von Käufern erreicht werden. Es stellt sich die Frage, wie Teilmärkte sinnvollerweise aus grösseren Einheiten herausgelöst werden können: Marktsegmentierung bedeutet die Aufteilung eines relevanten Marktes in sich möglichst homogene, im Vergleich zu anderen Segmenten aber sehr heterogene Käufergruppen. Dabei kann ein bedeutendes Marktsegment als strategisches Geschäftsfeld (SGF) oder Strategic Business Area (SBA) verstanden werden. © Die Marktsegmentierung wird wegen der zunehmenden Sättigungserscheinungen auf vielen Märkten, des wachsenden Verdrängungswettbewerbs und der stärkeren Differenzierungs- und Individualisierungswünsche der Nachfrager immer wichtiger (Becker 1988). Die Voraussetzungen für eine sinnvolle Marktsegmentierung sind: • • • • ein identifizierbarer und definierbarer Markt, eine identifizierbare Heterogenität der Kunden, eine Differenzierbarkeit der angebotenen Leistung, eine wirtschaftlich tragende Grösse des Marktvolumens. Eine gute Marktsegmentierung führt zu vertieften Marktkenntnissen, legt Marktnischen offen und ermöglicht eine differenzierte Marktbearbeitung: hohe Identität von Zielgruppe und Markbearbeitung (Marketing-Mix). Mögliche Probleme einer Segmentierung sind die Schwierigkeiten einer differenzierten Marktbearbeitung (unscharfe Segmente, ähnliche Distributionskanäle u.a.) und kleinerer Produktionsserien. Sie führen zu erhöhten Marketing- und Produktionskosten. Kriterien der Marktsegmentierung sind: Die feinste geografische Segmentierungsebene liegt in der Regel auf Gemeinde- oder Postleitzahlebene. Die mikrogeografische Marktsegmentierung - Ort, Quartier, Strasse, Strassenabschnitt erlaubt eine noch differenziertere Ansprache der Zielgruppen (GeoMarketing). 35 UZH | Marketing I Die feinste geografische Segmentierungsebene liegt in der Regel auf Gemeinde- oder Postleitzahlebene. Die mikrogeografische Marktsegmentierung - Ort, Quartier, Strasse, Strassenabschnitt - erlaubt eine noch differenziertere Ansprache der Zielgruppen (GeoMarketing). Da das Marktverhalten von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, ist die Segmentierung mit Hilfe eines Kriteriums in den meisten Fällen nicht ausreichend. So segmentiert beispielsweise ein deutscher Sportwagenhersteller die Zielgruppe eines Produktes nach Alter (35-50 Jahre), Beruf (Unternehmer, Selbständige, freiberufliche Tätigkeit), Jahreseinkommen (ab 80'000 € netto), Haushalt/Familienstand (einkommensstarke Mehrverdiensthaushalte, Singles) und Verhaltensweisen (ausgeprägtes Image- und Qualitätsbewusstsein) (Kuhnle 1989); eine politische Partei nach dem Wählerverhalten: Stammwähler, Sympathiewähler, Randwähler und Nichtwähler (Bruhn/Tilmes 1989). © Marktsegmentierung aufgrund der Einstellungen und Lebensstile sind psychografische Segmentierungen. Bedeutungsvoll ist dabei das Konstrukt des Involvement, das sich wie folgt charakterisieren lässt (Trommsdorff 1989): Verallgemeinert haben «low Involvement»-Produkte meistens wenig emotionale Produktdifferenzierungsmöglichkeiten, wenig kaufentscheidende Merkmale, wenig intensiv ausgeprägte Einstellungen, gering empfundenes Kaufrisiko, insbesondere soziales Risiko. Die Produkte stehen in ihrem Lebenszyklus eher in einer Reife- bzw. Sättigungsphase (Trommsdorff 1989). 36 UZH | Marketing I Bei «high Involvement»-Produkten verhält es sich umgekehrt: Ihre Einmaligkeit (Singularität) aus Käufersicht wird mittels ihrer Differenzierung erreicht. Insbesondere auf gesättigten Märkten, wo die subjektiv wahrgenommenen Qualitätsunterschiede der Produkte wie das produktbezogene Engagement des Konsumenten meist gering sind (low Involvement), schaffen emotionale Konzepte (Design, Experience, Event, Marke, Verpackung, Werbebotschaft u.a.) neue Einmaligkeiten (high involvement). © 2.8. Positionierung Die Positionierung beschreibt die Position der verschiedenen miteinander im Wettbewerb stehenden Produkte (Marken) in einem sog. Eigenschaftsraum (Becker 1988). Damit ist die Vorstellung verbunden, dass ein Nachfrager die angebotenen Produkte aufgrund seiner individuellen Wahrnehmung in einem solchen Raum (Eigenschafts-, Nutzen-, Wahrnehmungs-, Urteilsraum) einordnet: Die Positionierung findet in den «Köpfen der Nachfrager» statt. Ein Eigenschaftsraum weist als Dimensionen (Achsen) die für den Nachfrager relevanten Bedürfnisse, Erlebniswelten und/oder Images auf. Diese können mittels Merkmalen (Attribute) erfasst werden. Beispielhafte Kriterien für die Beurteilung eines alkoholischen Getränks: «Strand/Meer/Sonne/Palmen», «Mixgetränk», «Karibik/Südsee», «schmeckt gut», «Urlaub», «junge Menschen» oder «Kopfweh/Rausch/Kater». Liegen empirische Daten über diese Kriterien vor, so ermöglichen beispielsweise multivariate Verfahren der Statistik (Faktoranalyse u.a.) eine Datenreduktion und das Aufspannen der Merkmale im Raum. Aus Gründen der Vereinfachung werden die Räume 37 UZH | Marketing I meist in zweidimensionale Darstellungen reduziert: In diesen Ist-Positionierungen sind Positionierungslücken (weisse Flecken) für neue Produkte zu identifizieren (SollPositionierung). Die Lücken sind hinsichtlich ihrer Markt- bzw. Segmentpotentiale zu beurteilen. Zusammenfassend die Vorgehensweise: (1) Definition des relevanten Markts, (2) Marktsegmentierung, (3) Beurteilung der Attraktivität des Segments (Zielmarkt) und (4) Positionierung. © 2.9. Elektronische Märkte In den Markt- und Wettbewerbsrealitäten steigen die Anforderungen an das Marketing der einzelnen Unternehmung: • • Die Kunden suchen vermehrt Kauferlebnisse, authentisch kombiniert mit ihren Erfahrungen: Reine Leistungen genügen nicht mehr, weil sie nicht vorgeführt, sondern nur geliefert werden und weil sie nicht zum Ziel haben, unvergesslich zu sein. Erlebnisse, genannt Experiences(Pine/Gilmore 1999), sind das ökonomische Gut, nach dem heute Kunden streben (Experience Economy). Dieser Trend zwingt (Dienstleistungs)Industrien dazu, ihre Leistungen erlebnisorientierter zu gestalten: Das Essen wird zum Eatertainment, das Einkaufen zum Shoppertainment. Die Zeitökonomie fördert in Consumer- wie in Business-to-Business-Märkten das 38 UZH | Marketing I • • One-Stop-Shopping. Der Kunde möchte «einmal anhalten» und eine Vielzahl seiner Probleme lösen. Er kann so seine Koordinations-, Such-, Zeit- und andere Transaktionskosten reduzieren. Der Kunde erwartet vermehrt Leistungen, welche exakt seinen Wünschen entsprechen. Dies erfordert eine individualisierte Leistungserstellung (Mass Customization) und ermöglicht eine stärkere Kundenintegration in die unternehmerische Wertschöpfungskette. Der einzelne Kundenkontakt entwickelt sich zum kontinuierlichen Prozess, zum dauernden Anspruch: «The 24 hours never satisfied customer». Die elektronischen Märkte im Bereich Business-to-Business wie Business-toConsumer werden diesen Anforderungen in vielen Bereichen gerecht. Als elektronischer Marktplatz lösen sie das marktliche Zusammentreffen und die Koordination mit informationstechnischen Systemen. Die Merkmale dieser Märkte sind: © Da die Eintrittsbarrieren für den einzelnen Marktteilnehmer relativ tief sind, entstehen transparente Märkte: Der Vergleich von Produkten und Preisen nimmt zu. Da für alle Marktpartner relativ niedrige Kommunikations- und Koordinationskosten bestehen, sind sie besser informiert und anspruchsvoller. Sie können leichter ihre Lieferanten wechseln (steigende Wechselrate) und sich vernetzen (community). Durch das Bündeln von Kunden- oder Lieferantengruppen steigt die (virtuelle) Nachfragemacht. Aufgrund geringerer Such-, Informations-, Verhandlungs- und Entscheidungskosten sinken die Transaktionskosten. Die individualisierbaren Leistungen (Design, Einkaufszeiten, Informationen, Losgrössen u.a.) ermöglichen zusätzlich ein einfacheres Erschliessen neuer Kundengruppen. Mögliche Nutzenelemente für Anbieter und Nachfrager in den elektronischen Märkten sind: 39 UZH | Marketing I 2.9.1. Electronic Business Die Gestaltung der elektronischen Märkte ist Ausdruck des Electronic Business als die Online-Nutzung interaktiver, digitaler Informations- und Kommunikationsmedien. © Das Electronic Business kann als neues Geschäftsmodell oder als (Marketing)Werkzeug verstanden werden. E-Business ermöglicht auf der Basis elektronischer Ver40 UZH | Marketing I bindungen, die technische Leistungsfähigkeit vorausgesetzt, eine relativ kostengünstige Reduktion der Distanzen zu den Kunden und Lieferanten sowie individualisierte, gehaltvolle Beziehungen. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, müssen oft notwendige Veränderungen von den Unternehmungen bewusst eingeleitet werden: «Deconstruction is the dismantling and reformulation of traditional business structures» (Evans/Wurster 2000). 2.9.2. Electronic Commerce Das E-Business kann sich primär an den elektronischen Prozessen (Efficient Consumer Response ECR, Logistik u.a.), an der elektronischen Kommunikation (Club, Investor Relations, Marktforschung u.a.) oder am elektronischen Handel (E-Commerce) ausrichten. Dieser Electronic Commerce ist weiter strukturierbar, wobei sich die drei Inhalte oft vermischen: © Electronic Shopping Das Electronic Shopping ist Ausdruck des Handels (Bücher, Maschinen u.a.) und kann zu einer Neugestaltung der Wertschöpfungsketten führen. Da der angestammte Handel bei der Entwicklung des Electronic Shopping nicht primär partizipiert, verändern sich möglicherweise angestammte Bereiche und Funktionen; auf jeden Fall verringert sich 41 UZH | Marketing I die Handelsmacht. Aufgrund dieser Branchenerosionen verschwinden einerseits bisherige Marktteilnehmer, weil unternehmerische Wertschöpfungsketten verdichtet oder vereinfacht werden (Disintermediation der Absatzwege). Anderseits entstehen Potentiale von Branchen-Neuintegrationen, sei es aufgrund neuer, meist branchenfremder Anbieter, anderer Wettbewerbsverständnisse (Co-opetition), veränderter Beziehungsformen (Electronic Corporation, Netzwerke) oder elektronischer (Einkaufs-) Plattformen (Information Hubs). Mögliche Gründe, wieso Kunden das Online-Shopping nicht nutzen, sind: «sehe die Ware nicht», «Datenschutz», «Zahlung unsicher», «schwer zu finden» und «zu umständlich» (FGW Online 2000). Die immateriellen Leistungen sind, da oft digitalisierbar, meist direkt absetzbar. Bei materiellen Leistungen kann der Vertrieb an Logistikpartner oder an öffnungszeitenunabhängige Vertriebsformen wie Pick-up-Centern oder Consumer-Response-Centern übertragen werden. Electronic Relations © Die Electronic Relations gestalten Problemlösungen und Kundenbeziehungen (Auftragsinformationen, Beschwerdemanagement, Clubs, Foren, Notdienste, Reparaturzeichnungen u.a.) Electronic Marketing Gegenstand des Electronic Marketing sind vielfältige Marketingaktivitäten (Auktionen, Mass Customization, Marktforschung, Side Promotion, virtuelle Messen u.a.). In allen Bereichen finden wir ähnliche Marktphasen: Anbahnung, Aushandlung und/oder Abwicklung: Die Marktphasen sind Ausdruck der Gestaltung der Wertschöpfungskette: «Redefine the market around the customer». Die Anforderungen an die verschiedenen Phasen: 42 UZH | Marketing I 1. 2. 3. 4. 5. Effektives Suchen und Finden (Portal, Newsletter u.a.) Wirkungsvolles und unkompliziertes Bestellen (Kataloge, Konfiguratoren u.a.) Sichere Zahlung (Digitales Geld, Electronic Data Interchange u.a.) Schnelle Zustellung (Logistik, Updates u.a.) Betreuungsmanagement (Customer Care Center u.a.) © Bei der Gestaltung der Wertschöpfungskette ist die Durchgängigkeit aller Prozesse, von der ersten Anregung des Kunden über die Bezahlung (Debitzahlung, OfflineZahlung u.a.) bis zum After Sales Service, ebenso entscheidend wie den Kunden zum Kaufabschluss zu führen. Die zu hohen Liefer- und Versandkosten, das Nichtfinden der gewünschten Produkte, die fehlende Vertrauenswürdigkeit des Anbieters sowie der Sicherheit des Zahlungsverkehrs sind in den Business-to-Consumer-Märkten (B2C) mögliche Gründe für den Abbruch des einzelnen Online-Shopping. Neue Möglichkeiten der Leistungserstellung und -übertragung werden vom mobilen Electronic Business (Mobile Business) dank neuer Technologien (GPRS, UMTS) erwartet. In den Business-to-Consumer-Märkten (B2C) liegen die Potentiale bei den günstigeren Einstandspreisen und noch ausgeprägter bei tieferen Prozesskosten aufgrund durchgängiger Informationsflüsse und der Reduktion der Schnittstellen (Electronic Data Interchange, Electronic Procurement u.a.). Die Potentiale des Electronic Commerce finden sich zusammenfassend in den Kosteneinsparungen (Beschaffung, Kundendienst u.a.), den Zeitreduktionen (Durchlaufzeiten, Reaktionszeiten u.a.), der Steigerung des Absatzpotentials (kontinuierliche Marktpräsenz, weltweite Markterschliessung u.a.), der Verbesserung der Wettbewerbsposition (Differenzierung, Netzwerke u.a.) sowie der Kundenorientierung (CRM, Electronic Experience, Mass Customization u.a.). Im Kontext «elektronische Märkte» steigen die Ansprüche der Kunden. Entscheidende Triebkräfte sind dabei nicht die Technologien, sondern das individuelle Verhalten: Die 43 UZH | Marketing I Erwartungen hinsichtlich (Dienst-)Leistungen und Preise steigen ebenso wie die Bereitschaft, Teil einer Wertschöpfungskette zu werden (Integration des Kunden in die unternehmerische Wertschöpfungskette als Prosumer oder Co-Designer; dieser konfektioniert im Electronic Commerce seine Produkte (Fahrräder, Kleider, Musik u.a.). Diese Individualisierung von Leistungen gestaltet sich umso einfacher, je digitalisierbarer eine Leistung ist (Musik, Spiele u.ä.). Diese Wertschöpfung wird vom Kunden unmittelbar gesteuert: © Die Individualisierung und die Kundenintegration erlauben zusätzlich, verwoben mit einem Loyalitätsprogramm (E-Mails) und unterstützt von einem Customer Care Center, eine verstärkte Kundenbindung. Umgekehrt verfügt der Kunde aufgrund seiner Initialaktivität inhaltlich, technisch und zeitlich über eine Verfügungsmacht: Er ist per se primärer Kommunikator. Mit einem persönlichen Portal wird er Dritten gezielt seine Erlaubnis für weitere Kontakte erteilen oder entziehen (Permission Marketing). Seine Macht kann er durch die (virtuelle) Verknüpfung mit aktuellen und/oder potentiellen Kunden noch steigern. Er kann einen für die anbietende Unternehmung nur schwer kontrollierbaren Nachfrageverbund schaffen und etablieren. Dieser konkretisiert sich in kommerziellen und nichtkommerziellen virtuellen Communities. 44 UZH | Marketing I In diesen Räumen gelebter Konsumentensouveränität entwickelt sich Electronic Business zu einer Interaktionsarena elektronischer Dialoge mit beinahe unbeschränkten, relativ kostengünstigen Individualisierungs- und Emotionalisierungspotentialen. Die gesamte Branchenentwicklung wird oft mit den Begriffen «Internet-Ökonomie» oder «Webonomie» (Schwartz 1997) umschrieben: Während in der traditionellen Ökonomie der Wert eines Gutes mit dessen Knappheit steigt, steigt der Wert eines Gutes in der Internet-Ökonomie mit zunehmender Verbreitung. 2.10. Verbraucherschutz Am 15. März 1962 proklamierte der damalige amerikanische Präsident John F. Kennedy die vier Grundrechte des Verbrauchers: (1) The right to safety. (2) The right to be informed. (3) The right to choose. (4) The right to be heard. In den siebziger Jahren entwickelten sich verschiedene Strömungen der sozialen Bewegung «Konsumerismus». Im Mittelpunkt standen die Kritik am unternehmerischen Marktverhalten und die Forderungen eines verstärkten Schutzes von Konsument (food safety, product Saft) und Umwelt (qualitatives Wachstum). © Der Schutz des Verbrauchers schlug sich im Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über die Verbraucherpolitik (1972), in der Entschliessung der Beratenden Versammlung des Europarates über eine Verbraucherschutz-Charta (1973), in der Richtlinie des EU-Ministerrates über irreführende Werbung (1984) wie in den Richtlinien für den Verbraucherschutz durch die UNOGeneralversammlung (1985) nieder. Neuere Aktivitäten finden wir beispielsweise in Form des Adbusting, von «ads» gleich «Anzeigen» und «bust» gleich «zerschlagen», der kanadischen Organisation «Abusters Media Foundation» oder der Kampagne für «saubere» Kleider der Clean Clothes Campaign (CCC), welche gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen bei der Kleiderherstellung kämpft. Forderungen einer offenen und transparenten Entwicklung elektronischer Märkte zeigen sich zum Beispiel im «The Clutrain Manifesto» (Levine/Locke/Searls/Weinberger 2000), «Cluetrain» als ein Zug voller Ahnungen und Tips. Beispielhafte schweizerische rechtliche Regelungen von Konsumenteninteressen finden wir im Konsumentenschutzartikel der Bundesverfassung, im Kartellgesetz, im Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, im Konsumkreditgesetz, in der Lebensmittelgesetzgebung wie in der Heilmittelkontrolle. Waren es in der Schweiz zunächst die Konsumgesellschaften, später Frauenorganisationen und Gewerkschaften, welche sich für ihre Mitglieder einsetzten (Dörler 1982), so folgten die Gründungen von Interessenorganisationen zeitlich konzentriert: Fédération 45 UZH | Marketing I romande des consommatrices FRC (1959), Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz und des Kantons Tessin KF (1961), Stiftung für Konsumentenschutz SKS (1964). Social Marketing ermöglicht die interessenorientierte Gestaltung der Aktivitäten dieser Organisationen. Im Jahre 1964 wurde in der Bundesrepublik Deutschland die Stiftung Warentest gegründet. Im vergleichenden Warentest hat sich eine gesamtheitliche Produktbeurteilung an objektiven (Funktion, Preis,Lebensdauer), subjektiven (Ästhetik, Design, Prestige) und umfassenden Kriterien wie Gesundheits-, Sozial- und Umweltverträglichkeit zu orientieren (Garbe/Grothe-Senf 1986). Ein Warentest erhöht beim Konsumenten, der sich an Testergebnissen orientiert, die Markttransparenz (Kenntnis Produktalternativen) und hat nachhaltige Wirkungen auf die Umsatzentwicklungen von Industrie und Handel: Erhalten Hersteller beispielsweise positive Testergebnisse, so erhöhen sich die Umsätze der betreffenden Produkte in den untersuchten Branchen im Durchschnitt um 23 % für den Zeitraum eines halben Jahres; bei negativen Testergebnissen beträgt der durchschnittliche Umsatzrückgang 35 % (Fritz 1985). Warentests sind für die Hersteller wie für den Handel strategische Herausforderungen (societal marketing) und bedürfen der Einbettung in den gesamten Marketing-Mix, sei es durch Produktverbesserungen und innovationen aufgrund der Testergebnisse, Verwendung von positiven Testergebnissen im Verkaufsgespräch (Ausstrahlungseffekt) oder Einbezug der Testkriterien in die Qualitätskontrolle (total quality management). © Verbraucherabteilung (consumer affairs department) – ähnliche Ausgestaltungen finden wir im Konzept des Ombudsmanns – sind unternehmerische Lösungen eines verstärkten Dialogs mit dem Kunden: Ein unzufriedener Kunde kann im Sinn eines Markenwechsels oder eines Marktaustritts abwandern, negative Mund zu Mund-Kommunikation betreiben, sich gegenüber der Unternehmung bzw. Drittorganisationen beschweren oder ganz einfach inaktiv bleiben (Stauss 1989). Umgekehrt beinhaltet ein stimmiges Beschwerdemanagement (Abhilfe, Schadensregulierung) ein relativ hohes Potential der Kundenbindung. Externe Funktionen einer Verbraucherabteilung sind die Beseitigung individueller Kundenunzufriedenheiten, die aktive Information des Verbrauchers (externe Partizipation) und das Verhindern übergreifender Problemlösungen, beispielsweise staatlicher Eingriffe, durch unternehmungsindividuelle Lösungen. Wesentliche interne Funktionen sind die funktionsübergreifende Informationstätigkeit und die Impulsgebung für Innovationen (Hansen/Raabe/Stauss 1985). Ein solches Rückkoppelungssystem (customer feedback system) reduziert gleichzeitig die unternehmerische Reaktionszeit und verbessert die Chancen für kundengerechte Innovationen. 46 UZH | Marketing I 3. Marketing Management 3.1. Management Wenn mehrere Menschen in einem sozialen System arbeitsteilig Probleme lösen, tritt das Phänomen der Führung auf. Führung (Leitung, Management) ist die Steuerung eines multipersonalen Problemlösungsprozesses. Die Verfahrensformen und Regeln bestimmen das Zusammenwirken der Beteiligten: Jede Problemlösung sollte effektiv (to do the right things) und effizient (to do the things right) erfolgen. Wir können vier Dimensionen der Führung unterscheiden: 1. Die formale Seite der Führung umfasst die Struktur (Aufbau), die diesen Strukturen innewohnenden Prozesse (Abläufe) und die eingesetzten Instrumente (tools), beispielsweise Anreizsysteme, Budgets, Kennzahlensysteme, Organigramme, Planungskonzepte oder Stellenbeschreibungen. 2. Die sozialpsychologischen Aspekte beinhalten die Interaktionen, das Verhalten, die Normen, die Werte und das Wissen der an der Führung beteiligten und der von der Führung betroffenen Individuen: Kulturen. 3. Die konkrete Problembewältigung ist der Gegenstand der Führung: Politik. 4. Die Unternehmung setzt Ressourcen ein. Die tragende Aufgabe des Management ist es, diese zu bündeln und zu unternehmungsspezifischen, einzigartigen (Kern-) Kompetenzen zu entwickeln (Prahalad/Hamel 1990). © Diese vier Dimensionen sind nicht isolierbar, sie sind mit unterschiedlicher Dynamik vernetzt. Sie verändern sich als Trilogie von Struktur, Kultur und Politik im Fliessgleichgewicht der Unternehmung mit ihrer Umwelt in ihren Beziehungen und Bedeutungen in Raum (regional, national, international, global) und Zeit (gestern, heute, morgen): 47 UZH | Marketing I 3.1.1. Problemlösungsprozess © Der multipersonale Problemlösungsprozess kann idealtypisch in die Phasen der Willensbildung (Planung, Entscheidung) und -durchsetzung (Anordnung, Kontrolle) gegliedert werden. Diese Phasen sind eng verwoben, da jeder Problemlösungsprozess wiederum aus einer Vielzahl von Teilprozessen und Rückkoppelungen (feedbacks) besteht. Die zu lösenden Probleme sind der Inhalt jeder Führung. Ob eine Situation, ein einzelnes Ereignis als wirkliches Problem oder Scheinproblem erkannt und eingestuft wird, hängt von der Wahrnehmung und Betroffenheit der Beteiligten ab. Den Gegenstand eines Problemlösungsprozesses bezeichnen wir als Politik (policy). Jede Politik ist gleichzeitig gemeinsames Gestalten. Sie ist eine dynamische Auseinandersetzung um Wertvorstellungen, Machtanteile und Interessenabstimmungen (politics). Die Politik ist auch Ausdruck der unternehmerischen Risikobewältigung: Neben externen Risiken (Branchen, gesellschaftliche Entwicklungen u.a.) finden wir interne Risiken, beispielsweise: (1) strategische Risiken (Organisationsstruktur und -kultur, Ressourcen u.a.), (2) finanzielle Risiken (Kredite, Liquidität u.a.) und (3) operationelle Risiken (Diebstahl, Markenerosion u.a.). Eine systematische Politik beinhaltet zunächst eine klare Situationsanalyse (SWOTAnalyse) mit dem Ziel einer Beurteilung der Unternehmung hinsichtlich der aktuellen Situation und der zukünftigen Entwicklung. Diese Analyse sollte zu einer eindeutigen Formulierung der Ziele und Umsetzung der Strategien führen. Die Klärung des Einsatzes der notwendigen Ressourcen (Implementierung, Mitteleinsatz) und die Erfassung und Bewertung der Resultate sind die weiteren Inhalte einer Politik. Die Teilprobleme einer Politik sind als Entscheidungsprozess mit den Phasen der Willensbildung und durchsetzung konzeptionell harmonisierbar. 48 UZH | Marketing I © Eine erfolgreiche Problemlösung braucht Visionen, ergänzend und widersprüchlich zugleich. Ein solch erahnendes Verständnis zukünftiger Situationen und ein wegweisendes Selbstverständnis in diesen Situationen stimuliert, klärt, ordnet, legitimiert und fördert unternehmerisches Handeln (entrepreneurship, intrapreneurship). Visionen geben oft Überzeugungen der Unternehmungsgründer wieder: Gottlieb Duttweiler (Migros) oder Henry Ford (Ford Motor Company). 3.1.2. Management-Konzept Bewusstes unternehmerisches Handeln benötigt einen Handlungsrahmen. Ein Management-Konzept ist ein sinnvoll gestalteter Handlungsrahmen und beinhaltet zusammenfassend die Unternehmungs- und Umweltanalyse, die Strategieformulierung und umsetzung wie die Steuerung und Kontrolle (Wheelen/Hunger 1987): 1. Unternehmung, Umwelt - Strukturen, Kulturen, Politiken, Ressourcen - Märkte, Branchen, Umwelten 2. Formulierung Politik 49 UZH | Marketing I -Visionen -Leitbilder -Ziele -Strategien 3. Umsetzung Politik -Pläne -Budgets -Handlungen 4. Überprüfung Politik -Ergebnisse, Prozesse, Prämissen 3.2. Strukturen Richtet sich das Interesse auf den Tatbestand, dass ein dauerhaftes soziales System geschaffen werden soll, entsteht eine Organisation (Institution). Dieser Organisation muss im Aufbau und in den Abläufen eine innere Ordnung gegeben werden (Struktur). Jede so entstandene Struktur ist eine künstliche Ordnung und steht für ein relativ einheitliches formales System von Regelungen. © Eine Struktur kann nicht in die Kategorien «richtig» oder «falsch» eingeordnet werden, sie ist für eine bestimmte Situation mehr oder weniger sinnvoll. Die substantielle wie symbolische Gestaltung der Organisation ist die Aufgabe der Unternehmungsführung. Diese Organisationsgestaltung(organisieren) ist eine nach innen gerichtete Politik und hat ihre Grenzen im Phänomen der Selbstorganisation: Einer Organisation lässt sich eine Struktur nicht einfach aufzwingen, sie produziert sich häufig selbst aus dem Gesamten heraus. 3.2.1. Stellen Die wesentlichen Fragestellungen jeder Organisationsstruktur sind die Arbeitsteilung und Spezialisierung, die Zentralisation und Dezentralisation (Zusammenfassung bzw. Trennung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung), die sinnvollen Leitungsspannen (Anzahl der Direktunterstellten) und die Koordinationskosten in Form der Planungs-, Entscheidungs-, Anordnungs-, Kontroll- und Konfliktkosten. Mit der Stellenbildung werden die Aufgaben so auf Stellen verteilt, dass eine sinnvolle Struktur (Organisation) einer Einheit (Abteilung, Profit Center, Division, Unternehmung) entsteht. 50 UZH | Marketing I Die Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit. Mehrere Stellen können in einer Abteilung zusammengefasst werden. Eine Instanz ist eine Stelle mit Vorgesetztenfunktion. Die in ihrer Intensität möglichst kongruenten Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen einer einzelnen Stelle wie ihre hierarchische Einordnung (Vorgesetzter, Stellvertreter) werden im Führungsinstrument «Stellenbeschreibung» festgehalten. Das Zusammenwirken verschiedener Stellen bei der Lösung einer Aufgabe ist Inhalt des Instruments «Funktionendiagramm». Die Stellenbildung kann nach Verrichtungen, z.B. «Einkauf», «Logistik», «Marketing», oder nach Objekten, z.B. «Produkt», «Markt», «Projekt», «Kundengruppe», «strategische Geschäftseinheit» (SGE), «Region», erfolgen. Die Anwendung des ersten Kriteriums führt zu funktionalen oder verrichtungsorientierten, des zweiten zu divisionalen oder objektorientierten, der beiden Kriterien in einer Dimension zu hybridenStrukturen. 3.2.2. Strukturtypen Die wesentlichen Organisationsformen (Strukturtypen) im Sinn der Aufbauorganisation sind: 1. Einlinien-System Im funktionalen oder divisionalen Einlinien-System erhält eine Stelle nur von einer Instanz Anordnungen. Bei dieser Einheit der Auftragserteilung liegt eine klare Regelung des Unterstellungsverhältnisses, eine eindeutige Abgrenzung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung vor, jedoch sind die Instanzwege lang und umständlich. 2. Mehrlinien-System In diesem funktionalen oder divisionalen System erhält eine Stelle von mehreren Instanzen Anordnungen (Mehrfachunterstellung): kurze Kommunikationswege, Möglichkeit der Spezialisierung, jedoch schwierige Kompetenzabgrenzung (Konfliktpotentiale). 3. Stab-Linien-Organisation Diese Form ist ein funktionales oder divisionales Ein- oder Mehrlinien-System mit Stabsstellen als dauerhafte Hilfsorgane der Führung. Stabsstellen, beispielsweise «EDV» oder «Marktforschung», beraten und entlasten das Management primär im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung, beinhalten jedoch das Konfliktpotential «Stab-Linie» (Stab als «graue Eminenz»). 4. Projekt-Organisation Einmalige Vorhaben (Projekte) werden in die bestehende Organisationsstruktur mittels Stabsstelle oder Formen des Venture-Management integriert. 5. Matrix-Organisation Das zweidimensionale Mehrlinien-System mit den möglichen Hauptdimensionen «Funktion» und «Objekt» erfordert eine hohe Informationsverarbeitungs- und Konfliktkapazität der Mitarbeiter (Schnittstellenprobleme). 6. Profit-Center-Organisation Ein Profit-Center ist als abrechnungstechnische Einheit ein Verantwortungsbereich, an den die folgenden Anforderungen zu stellen sind: operationelle Unabhängigkeit (Freiheit in Markt- und Produktionsentscheidungen) und zurechenbare Gewinnkom- © 51 UZH | Marketing I ponenten (Deckungsbeitrag DB, Return on Investment ROI von Produkt, Sortiment, Markt). Eine strategische Geschäftseinheit (SGE) bzw. Division kann als ProfitCenter organisiert sein. Eine weitere Verwirklichung der Profit-Center-Idee finden wir in der Zerlegung gewachsener Grossunternehmungen in eine Vielzahl unternehmerisch selbständige Einheiten. Die skizzierten Strukturtypen lassen sich in ihren Grundzügen graphisch verdeutlichen (Organigramme): © 52 UZH | Marketing I 3.2.3. © Marktorientierte Strukturen Kundenbedürfnisse können nur dann effektiv, effizient und flexibel erfüllt werden, wenn das Marketing von der gesamten Unternehmung getragen wird (Levitt 1983). Aus diesem Grunde ist dem sog. internen Marketing verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen (Stauss/Schulze 1990). Es basiert auf der Idee, die Umsetzung des Marketing zu verbessern, indem die externe Marktsicht in die Unternehmung gekehrt wird: «Internal marketing starts from a notion that the employees are a first, internal market for the organization. If goods, services, and external communication campaigns, cannot be marketed to this internal target group, marketing to ultimate, external customers cannot be expected to be successful either»(Grönroos 1990). Internes Marketing ist daher ein Weg zur Gestaltung einer marketingorientierten Organisation als «fit» zwischen externen und internen Welten, wobei der Kunde eine Unternehmung grundsätzlich horizontal und nicht vertikal versteht. 53 UZH | Marketing I Drei marktorientierte Organisationsformen: 1. Dem Produktmanagement fallen die Aufgaben zu, die produktbezogenen Planungs-, Entscheidungs-, Anordnungs- und Kontrollfunktionen wahrzunehmen und in einer personalen Instanz zu integrieren. 2. Im Konzept des Key Account Management wird die Betreuung der für die Unternehmung strategisch wichtigen Kunden, Kundengruppen oder Absatzmittler organisatorisch zusammengefasst. Dabei sind alle Marketingaktivitäten zielgruppenspezifisch zu gestalten und zu koordinieren. 3. Das Category Management fasst die organisatorisch traditionellerweise getrennten Funktionen des Einkaufs und des Verkaufs für eine Warengruppe zusammen. Es kann als eine Form des Prozessmanagement verstanden werden, bei dem Warengruppen durchgängig als selbständige und gewinnverantwortliche Einheiten (Profit Center) geführt werden (Meffert 1998). Dabei wird eine konsequente Marktorientierung und eine Gesamtsystemeffizienz durch kooperatives Zusammenwirken von Herstellern und Händler angestrebt (Innovationen, Sortimente, Warenwirtschaftssysteme u.a.). © Die gewählte Organisationsstruktur sollte eine sinnvolle Spezialisierung, eine hohe Markt- und Umweltnähe der Problemlösungen, klare Marktverantwortungen und die Möglichkeiten unternehmerischer Flexibilität und Innovation in der gesamten Wertschöpfungskette beinhalten. Diese Forderungen erfahren ihre Realisierung in der einheitlichen Behandlung eines Kunden, in durchgängigen Prozessen, der kundenbezogenen Koordination der unternehmerischen Funktionen (Schnittstellen-Management), den kundenbezogenen Informations- und Controllingsystemen (Lieferzeit, Reklamationen, Reparaturhäufigkeit, Wartezeit für Ersatzteile u.ä.) sowie der marktorientierten Schulung aller Mitarbeiter (Werkmann 1989). Die Struktur steht im dauernden labilen Gleichgewicht zwischen Starrheit und Flexibilität, zwischen Wandel und Kontinuität, zwischen Über- und Unterorganisation. 54 UZH | Marketing I 3.2.4. Prozesse Das Verstehen der vielschichtigen (Kern-)Prozesse im Marketing, beispielsweise «Bestellungsannahme und -abwicklung», und der ihr innewohnenden Bewertungen (Prozesskostenrechnung) bedingt ein klares Prozessverständnis, möglicherweise ein Process Reengineering (Hammer/Champy 1993). Das Prozessverständnis komprimiert die Unternehmung in horizontaler Richtung: Mehrere Prozessschritte werden zusammengefasst, der Koordinationsaufwand reduziert. In einem umfassenden Sinn ist diese prozessuale Sicht auf alle unternehmerischen Beziehungen auszuweiten. Die Prozessorganisation erfordert eine Identifizierung vorrangiger Marketingprozesse. Wir unterscheiden drei Ausprägungen: (1) Prozesse, welche eine Transaktion mit der Unternehmung einleiten, (2) Kauf- und Verkaufsprozesse sowie (3) Serviceprozesse (Davenport 1993). Diese Kernprozesse ergänzen unterstützende Prozesse, beispielsweise Entwicklungs-, Marktforschungs- oder Planungsprozesse. Welcher Prozess als Kernprozess bzw. als kritisch anzusehen ist, hängt entscheidend von der Branche, der Unternehmung sowie der Definition der angestrebten Wettbewerbsvorteile ab (Krüger 1993). Die Prozesse bestimmen wiederum die Arbeitsinhalte, die Funktionen, die Informations- und Controllingsysteme sowie die Strukturen. 3.2.5. Instrumente © Der Einsatz des Marketing erfordert eine stimmige Planung. Eine grobe Bündelung der Aktivitäten konkretisiert sich in Aktionsplänen. Diese dienen als Kommunikationsmittel und als Checklisten zwecks Kontrolle (Meilensteine): Wichtig ist die Einteilung in Zwischenziele und -ergebnisse zwecks Korrekturen (Massnahmen) während der Plandauer. Basierend auf den Aktionsplänen können alle im betreffenden Planungszeitraum laufenden Aktivitäten zusammengefasst werden, je nach Planungssystem in Budgets und operativen oder strategischen Plänen. Analog zur Planung lassen sich zwei Arten von Controlling unterscheiden: Das operative Controlling untersucht Marketing-Massnahmen auf ihre Zielwirksamkeit (Effizienz), beispielsweise Besuchshäufigkeiten, Kundenzufriedenheit oder Werbedruck. Im Rahmen des strategischen Controlling wird versucht, mögliche Zielabweichungen und deren Ursachen zu antizipieren (Frühaufklärung), um mit entsprechenden Massnahmen angemessen zu reagieren (Effektivität) (Becker 1998). Eine umfassende Leistungsbeurteilung ist Ausdruck eines Performance Management. Diese Systeme dienen der Umsetzung strategischer Zielvorgaben in der Unternehmung und finden ihre Instrumentalisierung in Scorecards. Diese beschreiben UrsacheWirkungs-Zusammenhänge: Die Resultate (beispielsweise Umsatz) und die Treiber (beispielsweise Kundenzufriedenheit) werden in verschiedenen Perspektiven kategorisiert (Fickert/Kind 2000). 55 UZH | Marketing I Einer der bekanntesten Ansätze ist die Balanced Scorecard (Kaplan/Norton 1996). Sie ist ein Managementsystem, welches Strategien in konkrete Massnahmen übersetzt. Es verbindet gleichzeitig finanzielle und nichtfinanzielle Steuerungsgrössen: Ausgehend von den Visionen und Strategien sind vier gleichwertige Perspektiven wesentlich: (1) «How do we look to shareholdes?», (2) «How do customers see us?», (3) «What must we excel at?» und (4) «How can we continue to improve and create value?» (Kaplan/Norton 1996). Jede dieser Perspektiven wird wiederum in (strategische) Ziele (objectives), Messgrössen/Kennzahlen (measures), (Ziel-)Vorgaben (targets) und Massnahmen (initiatives) unterteilt. 3.3. Kultur Zu Beginn der 80er Jahre veröffentlichten Richard Pascale und Anthony Athos «The Art of Japanese Management». Ihre Auseinandersetzung mit der japanischen Unternehmungsführung führte zum 7S-Modell: © In dieser Struktur sehen die Autoren den japanischen Erfolg in der Fähigkeit des Management, mit den weichen «S» (software) sinnvoll umzugehen; demgegenüber behandelt das amerikanische Management die weichen «S» wie die harten (hardware). Für den unternehmerischen Erfolg gilt es, alle «S» aufeinander abzustimmen, Synergieeffekte zu nutzen. Solche «Erfolgsrezepte» sollten jedoch nicht ungeprüft auf die eigene Management-Situation übertragen werden (Schein 56 UZH | Marketing I 1987). 3.3.1. Unternehmungskultur Im obigen Konzept erscheint das Phänomen der Organisations- oder Unternehmungskultur (corporate culture). Diese ist «ein System von Wertvorstellungen, Verhaltensnormen und Denk- und Handlungsweisen, welches von einem Kollektiv von Menschen erlernt und akzeptiert worden ist und welches bewirkt, dass sich diese soziale Gruppe deutlich von anderen Gruppen unterscheidet» (Staerkle 1985). Die Unternehmungskultur schliesst die Vorstellung von sichtbaren und unsichtbaren, von vergangenen und zukünftigen Dimensionen in einer Unternehmung mit ein (Eisbergphänomen): Traditionen, Wertvorstellungen und «gültige» Meinungen von Kunden, Mitarbeitern und Führungspersönlichkeiten summieren sich zu einem mehr oder weniger homogenen Ganzen. Sie ist im Sinn einer subjektiv-interpretativen Kulturperspektive das Ergebnis interaktiver Erfahrungs- und Lernprozesse; im Verständnis einer funktional-objektiven Kulturperspektive gestaltbar. 3.3.2. Unternehmungskultur erfassen und gestalten © Die Unternehmungskultur ist eine Grundhaltung, die sich in Äusserungen und Handlungen verdeutlicht. Resultiert in einer Unternehmung ein Konsens bezüglich dieser Normen und Werte, so kann man von einer starken Unternehmungskultur sprechen; während bei einer schwachen Kultur der gemeinsame Grundkonsens fehlt. Sie wird über Symbole wie Sprache, Rituale oder Zeremonien weitergegeben: «Ein Wandel der Unternehmungskultur ist daher immer ein Wandel der Symbole und der entsprechenden Bedeutungsinhalte» (Heinen/Dill 1986). Die Kultur führt zu einer Identität (corporate identity) und kann visualisiert werden (corporate design). Die Gestaltung einer Unternehmungskultur setzt als Problemlösungsprozess (Inpolitik) die Kenntnis operationaler Erfassungs- und Gestaltungskriterien (Schuh 1989) voraus (Situationsanalyse). Die konzeptionelle Erfassung kann über die kulturellen Wirkungen erfolgen (Befragung, Beobachtung als interne Marktforschung), beispielsweise über das jeweilige Risiko der Aktivitäten und die Geschwindigkeit, mit welcher die Wirkungen des Handelns erkennbar werden (Deal/Kennedy 1982): 57 UZH | Marketing I Symbolische Handlungen (Architektur, Auszeichnungen, Logos, Statussymbole, Tabus, Traditionen, Rituale u.ä.), Wahrnehmung der Vorbildfunktion (fachliche und soziale Kompetenz, Offenheit, Visionen u.ä.), Anerkennung (situativer Führungsstil) und das gelebte Kommunikationssystem (formal, informal) sind beispielhafte Dimensionen der Pflege und Gestaltung einer Unternehmungskultur. © Die möglichen Kriterien einer Kulturerfassung bzw. -sicht sind: dynamisch, fair, familiär, flexibel, innovativ, kommunikativ, kooperativ, leistungsorientiert, loyal, mitarbeiterorientiert, offen, persönlich, sozial oder verschworen. Kulturelle Veränderungen können auch durch die spezifische Auswahl neuer Mitarbeiter eingeleitet oder unterstützt werden: Individuen bewirken mit ihrem Verhalten individuelle und kollektive Veränderungen. Sie sind Präger und Träger (Rühli 1989) solcher Kulturen wie der von ihnen intendierten Handlungen. Eine Kultur wird so zum Ergebnis interaktiver Erfahrungs- und Lernprozesse aller Beteiligten (Sozialisation): Durch dauernde Verbesserungen (continuous improvement) entwickelt sich die Unternehmung zu einer lernenden Organisation (Garvin 1993, Senge 1990, Webster 1994). 58 UZH | Marketing I 3.3.3. Marketing-Kultur © Jede Kultur stiftet und vermittelt Identitäten: Man lebt in ihr, aber man erlebt sie oft unreflektiert, sie ist interpretationsbedürftig. Marketing-Erfahrungen, Traditionen, Wertvorstellungen und «gültige» Meinungen von Kunden und Mitarbeitern summieren sich zu einer mehr oder weniger homogenen Marketing-Kultur. Die Gesamtheit der Werte und Normen, die das Marketing betreffen, verstehen wir als Marketing-Kultur, unpräzise als Marketing-Philosophie oder -Denkhaltung. Aggressivität, Arroganz, Fairness, Flexibilität, Ignoranz, Innovationsfähigkeit, Kundennähe, Marktsensibilität, Problemlösungskompetenz, Risikofreudigkeit, Servicegeschwindigkeit, Umweltbewusstsein, Zielgruppendenken und Visionen sind beispielhafte Inhalte einer Marketing-Kultur. Der Kunde erlebt die Marketing-Kultur im Alltag. Sie muss daher als kulturelles Selbstverständnis operationalisiert werden, beispielsweise (Shapiro 1988): 1. 2. 3. 4. 5. Wie einfach ist der geschäftliche Umgang mit uns? Halten wir unsere Versprechungen ein? Entsprechen wir unseren selbst gesetzten Standards? Sind wir gut ansprechbar? Hören wir zu? Fassen wir nach? Arbeiten wir wirklich zusammen? 59 UZH | Marketing I Die Kultur steuert je nach ihrer Dichte und Stärke die Entwicklung des Marketing: Als primäre Kultur einer Unternehmung entsteht ein gewisser Dominanzanspruch; als Subkultur ist die Marketingkultur Teil der Unternehmungskultur. Differenzen zwischen Subkulturen, beispielsweise «Technik» und «Marketing», erhöhen Kommunikations- und Koordinationskosten. In einem gesamtheitlichen Verständnis drängen sich daher kulturelle Veränderungen auf: die relative Einebnung von Subkulturen und die primäre Gestaltung jener Normen sowie Werte, welche die Bereitschaft für Kunden und beziehungen fördern (Ellis/Lee/Beatty 1994). Diese Bereitschaft ist beispielsweise durch die spezifische Auswahl der Mitarbeiter (Individualkompetenz, Wertsystem) oder strukturelle Lösungen (Projektorganisation, Teambildung, Simultaneous Engineering u.ä.) unterstützbar. Die Kultur wird so zum Ergebnis interaktiver Erfahrungsund Lernprozesse aller Beteiligten: Jedes Handeln muss die jeweilige Marketing-Kultur präaktiv, nicht reaktiv miteinbeziehen. 3.4. Politik Eine Politik ist der Gegenstand eines multipersonalen Problemlösungsprozesses. Sie beinhaltet beispielsweise eine Marke (Markenpolitik), ein Produkt (Produktpolitik), einen Teilbereich (Produktionspolitik), eine Unternehmungskultur (Kulturpolitik) oder die gesamte Unternehmung (Unternehmungspolitik). Sie kann je nach Situation mehr strategischer oder operativer Natur sein: • • © Dem strategischen Verständnis sind komplexe, längerfristige, grundlegende, vorausdenkende, umfassende mehr qualitative als quantitative, oft ungewisse Dimensionen innewohnend. Demgegenüber steht das operative Verständnis für konkrete, selektive, detaillierte, quantitative, kurzfristige Aspekte. Das Management ist daher die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Politiken. Es ist als Konzeption im Sinne eines «Fahrplanes» gestaltbar: Nur ein in sich schlüssiges Konzept integrierter Analyse-, Ziel-, Strategieund Massnahmeentscheidungen ermöglicht konsequentes Handeln. 60 UZH | Marketing I 3.4.1. Situationsanalyse © Die bewusste Gestaltung einer Politik ist die wesentliche Aufgabe der Willensbildung. Die Marketing-Planung beschäftigt sich mit der systematischen und rationalen Gestaltung einer Marketing-Politik. Diese Planung kann strategischer oder operativer, langfristiger oder kurzfristiger, zentraler oder dezentraler, laufender oder periodischer, qualitativer oder quantitativer Natur sein und sich verschiedenster Entscheidungshilfen (Analyseinstrumente) bedienen. Neben der Analyse der Wertschöpfungskette finden wir beispielsweise das Konzept des Benchmarking, die SWOT- und die Gap-Analyse. Mit Benchmarking erfolgt ein systematischer Vergleich zwischen Unternehmungen bzw. Unternehmungseinheiten anhand von standardisierten Vergleichsgrössen und Richtwerten (benchmarks). Insbesondere ein Vergleich mit branchenfremden Unternehmungen bzw. Unternehmungseinheiten, welche bezügliche eines bestimmten Aspektes als vorbildlich angesehen werden (best practices), kann zu Ansatzpunkten der Produkt- und Prozessverbesserung (Erhältlichkeit, Kosten, Qualität u.a.) führen. Mit Hilfe der SWOT-Analyse sind im Rahmen einer Situationsanalyse die unternehmungsinternen Stärken und Schwächen (Strengths/Weaknesses: SW) sowie die unternehmungsexternen Chancen und Gefahren (Opportunities/Threats: OT) zu beurteilen. Die Gap-Analyse ist ein Instrument zur strategischen Planung und Früherkennung von strategischen Lücken (Potential- oder Lückenanalyse). Dabei werden eine quantitativ geplante Zielgrösse (z.B. Cashflow) der erwarteten Entwicklung gegenübergestellt. Liegt dieser Zielerreichungsgrad unter der geplanten Zielgrösse, so spricht man von einer 61 UZH | Marketing I Ziellücke (Gap): Sie deutet im voraus Änderungen in den Ausgangsbedingungen der ursprünglich gewählten Strategien an, ist zu analysieren und erfüllt so die Funktion einer strategischen Anregung. © Die gewählte planerische Vorgehensweise ist Ausdruck des jeweiligen Planungssystems (Budgets, Pläne, Prozesse) und die Durchführung Aufgabe des Management und der involvierten Stellen (Planung, Unternehmungsentwicklung u.a.). 3.4.2. Strategie In unserer Vorgehensweise verstehen wir das Phänomen der Politik als umfassende Management-Aufgabe und betrachten die Strategie als die tragende Kategorie jeder Politik. In der Vielfalt der Strategieverständnisse (Mintzberg 1987, 1994) verwenden wir so einen eher engen Strategiebegriff: Die Strategie ist eine wesentliche Handlungsalternative. Dieses Handlungsmuster dient der Erreichung konkreter Ziele (Zielsysteme). 62 UZH | Marketing I Carl von Clausewitz (1780-1831), der einstige preussische Generalmajor, definierte: «Die Strategie bestimmt den Punkt, auf welchem, die Zeit, in welcher, und die Streitkräfte, mit welchen gefochten werden soll». Es ist nicht erstaunlich, dass sich die Strategie vielschichtig in Management- und Marketing-Konzepten widerspiegelt (Bracker 1980, Evered 1983). Eine Strategie ist so die Kunst und Fertigkeit der Heer- und Kriegsführung, im Gegensatz zur Taktik, der Kunst der Führung einer Truppe zum und im Gefecht, wie auch die Lehre darüber. Einzelne Autoren sehen den Markt als einen Kriegsschauplatz (Cohen 1986) und entwickeln differenzierte Kampfstrategien (frontal, flanking, encirclement, bypass, guerrilla attack) (Kotler/Fahey/Jatusripitak 1985). Eine Unternehmungsstrategie beinhaltet die langfristig-orientierten Entscheidungen darüber, in welchen Domänen (Märkte, Branchen) eine Unternehmung tätig sein soll, und welche Handlungsanweisungen und Ressourcen zu wählen sind, um eine vorteilhafte Wettbewerbsposition zu erreichen. Eine Strategie muss die Unternehmung klar positionieren, ihr Überleben und Wachsen sichern (dynamische Existenzsicherung). Sie kann je nach Hierarchie eine Funktion (functional strategy), ein Geschäftsfeld (business strategy, domain navigation) oder eine Unternehmung (corporate strategy, domain selection, enterprise strategy) zum Gegenstand haben. 3.4.3. Marketing-Strategie © Eine Marketing-Strategie ist die geplante Vorgehensweise zur Erreichung der MarketingZiele (Deckungsbeitrag, Image, Marktanteil, Recycling, Umsatz u.a.) und bewegt sich inhaltlich im Spannungsfeld und Fliessgleichgewicht «Kunde - Konkurrenz - Marketing Gesamtunternehmung». Die Marketing-Strategien müssen in die strategischen Vorstellungen der Gesamtunternehmung (Unternehmungspolitik, Visionen) bzw. Geschäftsfelder eingebettet sein und finden in den operativen (taktischen) Handlungen (Mitteleinsatz) ihre konkrete Umsetzung (Implementierung). Die in einer Situation (Kunde, Markt, Branche, Unternehmung, Umwelt) tragende Vorgehensweise bezeichnen wir als Kern- oder Grundstrategie. Beispielhafte Marketing-Strategien, wobei die Zeit einen allumfassenden strategischen Erfolgsfaktor darstellt (Stalk 1988, Simon 1989), in der Vielfalt von strategischen Möglichkeiten (Strategiemuster), sind: Diese Gliederung von Marketing-Strategien darf nicht dazu verleiten, die einzelnen Strategien (Teilstrategien) isoliert nebeneinander zu betrachten. Die Strategien sind so aufeinander abzustimmen (Strategie-Mix), dass ein konsistentes Gesamtverhalten, auch in der Umsetzung, resultiert: strategische und operative Synergien. 63 UZH | Marketing I © 3.4.4. Strategiefindung Die Formulierung einer Politik wie einer Strategie bewegt sich in den folgenden Fragestellungen: 64 UZH | Marketing I Solche planvoll entwickelten Strategien (planned strategies) müssen mit den realisierten (realized strategies) nicht übereinstimmen, da gewisse Strategien aufgrund individueller, kultureller bzw. struktureller Widerstände nicht realisiert werden können, andere ungeplant, zufällig entstehen (Mintzberg/Waters 1985). Häufige strategische MarketingFehler, neben der oft ungenügenden Effektivität und Effizienz, sind (Kühn 1985): 1. Fehlende strategische Analysen führen zu unreflektiertem Festhalten an Gewohnheiten und Bewährtem. 2. Fehlende Strategien bewirken unbewusste strategische Änderungen, die nicht als solche erkannt werden. 3. Fehlende strategische Auseinandersetzungen führen zu isolierten Betrachtungen von Einzelideen und einseitigen Beurteilungen. 3.4.5. Frühwarnsysteme Unternehmungen können trotz ihrer strategischen Ausrichtung von unternehmungsinternen und -externen Ereignissen (Turbulenzen) überrascht werden. Diese können sich im Falle bedrohlicher Ereignisse zu existenzgefährdenden Krisen entwickeln. Wichtig ist daher die rechtzeitige Abstimmung von Unternehmungsaktivitäten im Hinblick auf solche Veränderungen. © Systeme der Frühwarnung (Frühaufklärung, Früherkennung) erlauben strategische Reaktionen (strategic responses) durch rechtzeitiges Antizipieren plötzlich eintretender Veränderungen (discontinuities) (Ansoff 1984). Diese Konzepte gehen davon aus, (1) dass sich Überraschungen durch schwache Signale (weak signals) oder Schatten ankündigen und (2) dass solche Diskontinuitäten prinzipiell durch das Management antizipiert werden können: Das umweltverschmutzende Ereignis «Tankerunfall» entwickelt sich vom isolierten Einzelereignis (weak signal) zu einem Bündel gleichartiger Ereignisse, zu neuen Märkten, zu neuen Technologien, Dokumentationen, Statistiken, Kurzbegriffen wie «Ölpest» und schlussendlich zu historischen Analysen. Ein Ereignis wird mit der bewussten gedanklichen Vorwegnahme ohne Dringlichkeit, ohne Überraschung antizipiert: (1) Das Management hat ein unbestimmtes Gefühl einer Bedrohung (Chance). (2) Die Quelle der Bedrohung (Chance) ist bekannt. (3) Die Bedrohung (Chance) ist in ihrer Erscheinung konkret bekannt. (4) Die Reaktionsmöglichkeiten auf diese Bedrohung (Chance) sind bekannt. (5) Die Folgen der Bedrohung (Chance) sind überschaubar. 3.4.6. Produkt-Markt-Strategien In der Vielzahl von Management-Entwicklungen (Brauchlin/Wehrli 1994) sind die Produkt-Markt-Strategien sicher das bekannteste Strategiekonzept: Jede Unternehmung muss in wachsenden wie in schrumpfenden Phasen ihre Produkt-Markt-Kombinationen (Marktfelder) bestimmen: Welche Kunden benötigen welche Problemlösungen? Diese Festlegung des Leistungsprogramms kann in den folgenden Marktfeld-Strategien erfol65 UZH | Marketing I gen (Ansoff 1957): Die Marktdurchdringung (Ausschöpfung des Marktpotentials bestehender Produkte in bestehenden Märkten) beinhaltet als die «natürlichste» Strategie (Plattform) die relativ geringsten Risiken. Diese Marktpenetration kann über eine intensivere Produktverwendung bei bestehenden Kunden, die Gewinnung neuer Kunden (Abwerbung) oder die Gewinnung bisheriger Nichtkunden erreicht werden. Die Marktentwicklung ist eine naheliegende Strategie, da für bestehende Leistungen neue Märkte (lokal, regional, national, global) bzw. Teilmärkte (Marktsegmente) gesucht werden. © Die Produktentwicklung (Innovation) ist risikoreicher und Ausdruck der Produktpolitik (Marketing-Mix) sowie der Innovationsfähigkeit. Mit einer Diversifikation bricht die Unternehmung aus ihren angestammten Produkten und Märkten aus: Produkt-und Marktentwicklung. Sie verlässt eine gewachsene Vertrautheit mit Markt und Technologie. Eine hohe Verwandtschaft der neuen ProduktMarktleistungen mit dem angestammten Kerngeschäft führt zur horizontalen oder vertikalen Diversifikation, fehlende Verwandtschaften zur lateralen. Diese Strategien können der Risikostreuung dienen, beinhalten jedoch gleichzeitig relativ hohe unternehmerische Risiken: fehlende Produkt- und Markterfahrung wie kompetenz. Eine horizontale, vertikale oder laterale Diversifikation kann mittels eigener Forschung und Entwicklung, Übernahme von Lizenzen (Know-how-Kauf), Aufnahme von Produkten in das Sortiment (Produktkauf), Kooperationen («Partner-Kauf») oder Beteiligungen wie Zusammenschlüssen (Unternehmungskauf) (Becker 1988) realisiert werden. Die häufige Strategie der oft impulsiven Unternehmungskäufe (mergers and acquisitions) erlaubt eine relativ schnelle und nachhaltige Stärkung der angestammten Marktposition. Eine Längsschnittanalyse der Diversifikationsaktivitäten von 33 US-Konzernen verdeutlicht jedoch, dass im untersuchten Zeitraum (1950-1986) durchschnittlich mehr als die Hälfte der Akquisitionen wieder abgestossen wurden (Porter 1987). Die Hauptursachen für die unerfüllten Erwartungen der Akquisitionen sind: (1) Die Marktnische war nicht echt (fehlende Markteintrittsbarrieren) und (2) die Mutterunternehmung beurteilte die strategische Situation der akquirierten Unternehmung richtig, führte jedoch die übernommene Einheit falsch (negieren von Kulturen, übereilte Integration). Eine empirische 66 UZH | Marketing I Untersuchung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt demgegenüber einen Diversifikationserfolg, d.h. die neuen Bereiche verblieben bei rund 80 % im Unternehmungsverbund (Hoffmann 1989). 3.4.7. Portfolio-Strategien Die gebräuchlichen Portfolio-Konzepte orientieren sich an der Gegenüberstellung von Markt-und Unternehmungsfaktoren. Ausgangspunkt dieser Produkt-Markt-Konzepte ist die klassische Vier-Felder-Matrix der Boston Consulting Group (BCG). Diese verdichtet eine Informationsfülle (Hinterhuber 1980) auf eine zweidimensionale Darstellung, die einen Zusammenhang zwischen einer von der Unternehmung beeinflussbaren und einer nicht-beeinflussbaren Grösse wiedergibt: Das Marktwachstum (Marktattraktivität) wird der relativen Wettbewerbsposition (relativer Marktanteil, relative Marktposition), relativ in bezug zu den stärksten bzw. zwei oder drei stärksten Konkurrenten, gegenübergestellt: Das Konzept geht von identifizierbaren Märkten und ihrer Segmentierung aus: In einem stufenweisen Herantasten an die für die Unternehmung «richtigen» strategischen Geschäftsfelder (SGF) sollten möglichst wenige, überschneidungsfreie, isolierte Felder definiert werden (Antoni/Riekhof 1989). Ein solches Geschäftsfeld ist die Zusammenfassung von Produkt-Markt-Kombinationen, die gemeinsam eindeutig definierte Problemlösungen erfüllen, z.B. «Stromerzeugung», «Stromübertragung», «Stromverteilung», und für die relativ unabhängig eigenständige Strategien entwickelt und realisiert werden können; d.h. ein Geschäftsfeld sollte eigenständige Marktaufgaben wahrnehmen, strategisch unabhängig führbar sein, relative Wettbewerbsvorteile erzielen und in seiner Abgrenzung eine gewisse Stabilität erreichen (Kreilkamp 1987). Die strategische Geschäftseinheit (SGE) ist die strukturelle Verankerung eines Geschäftsfeldes in der Unternehmung. © Die Geschäftsfelder werden in den Portfolio-Feldern positioniert (Ist-Portfolio). Für jedes 67 UZH | Marketing I Feld wird eine Normstrategie empfohlen: 1. Stars Diese «Sterne» erarbeiten erste Erträge, erfordern jedoch zur Sicherung und dem Ausbau der Marktposition noch relativ hohe Investitionen um den Netto-Cashflow von morgen zu erarbeiten. 2. Cash Cows In diesen Geschäftsfeldern besitzt die Unternehmung trotz geringem Marktwachstum eine relativ gute Wettbewerbsposition; Marktanteilsgewinne sind keine mehr anzustreben. Diese «Melkkühe» generieren den heutigen NettoCashflow. Sie sollten bei fehlenden bzw. schwachen «Stars» nicht zu schnell «gemolken» werden, da die Unternehmung sonst gefährdet wird. 3. Question Marks Trotz hohem Marktwachstum haben diese Felder eine schwache Wettbewerbsposition. In diese «Fragezeichen» kann selektiv investiert werden. Sind neben diesem Aufbau neuer Geschäfte rasche Marktanteilsgewinne nicht möglich, ist ein Marktaustritt (Aufgabe Randgeschäfte) mittels Verkauf, Verselbständigung (venture management) oder Liquidation anzustreben (Abschöpfungsstrategie). 4. Dogs Diese Felder erzielen in der Regel ausgeglichene Ergebnisse. Die «armen Hunde» sind entweder aufzugeben (vorsichtige Desinvestition) oder weiter zu differenzieren (Marktnische). © Mit diesen Normstrategien sind die erwünschten Positionsveränderungen (Soll-Portfolio) anzustreben. Das Ziel dieses Portfolio-Management besteht darin, eine finanzielle Ausgewogenheit zu finden, so dass die finanziellen Mittel, die der Umsatz der «Cash Cows» generiert, zusammen mit den Liquidationserlösen aus der Aufgabe von «Dogs» ausreichen, um den Finanzbedarf der «Stars» sowie derjenigen «Question Marks» zu finanzieren, deren Position so verbessert werden soll, dass sie zu «Stars» werden (Albach 1978). Die Anwendung setzt voraus, dass die Unternehmung, die Unternehmungseinheit bzw. das Geschäftsfeld das zu erwartende Marktwachstum prognostizieren kann und die Hauptkonkurrenten eindeutig identifizierbar sind (Innovationsfähigkeit, Marktanteil, Produktalternativen, Technologien u.a.). Jedes Portfolio-Konzept geht von der Annahme aus, dass das Marktrisiko mit zunehmendem Marktwachstum und Marktanteil sinkt: Je höher die Wachstumsrate des eindeutig abgegrenzten Marktes und je höher der relative Marktanteil, desto höher der kumulierte Gesamtabsatz, desto grösser die Kostenvorteile (Erfahrungskurveneffekte) und desto geringer die unternehmerischen Gesamtrisiken. In die Überlegungen fliessen drei Konzepte ein: Lebenszyklus In den Phasen des Lebenszyklus durchläuft ein Produkt in seiner relativ begrenzten Lebensdauer zunehmende, stagnierende wie abnehmende Wachstumsraten des Marktes wie der Marktanteile. Diese Phasen können idealtypisch gegliedert werden, sie sind jedoch nicht eindeutig abgrenzbar. Es wäre daher zu vereinfachend, aufgrund geschätzter 68 UZH | Marketing I Positionen von Produkten im Produktlebenszyklus phasenspezifische Grundstrategien abzuleiten (Chrubasik/Zimmermann 1987). Um eine möglichst stabile kontinuierliche Geschäftsfeld- wie Unternehmungsentwicklung zu erreichen, ist eine ausgewogene Mischung von Produkten in allen Phasen erforderlich (Metamorphose des Sortiments). PIMS Das PIMS-Projekt (profit impact of market strategies) beruht auf einem Zusammenschluss von mehr als 450 Unternehmungen mit mehr als 3000 strategischen Geschäftseinheiten, die dem «Strategic Planning Institute» (Cambridge, Mass.) unternehmerische Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen (Buzzell/Gale 1987). Kern des Projekts ist eine umfassende Daten- und Methodenbank, mit deren Hilfe unternehmerische Erfolgsgrössen (strategische Erfolgsfaktoren) analysiert und prognostiziert werden. Wesentliche Aussagen der Untersuchungsergebnisse sind, dass der absolute wie der relative Marktanteil mit der definierten Rentabilität (ROI) bzw. mit dem definierten Cashflow stark positiv korrelieren und dass die relative Produktqualität eine positive Beziehung mit der definierten Rentabilität (ROI) aufweist. Diese Zusammenhänge werden teilweise in Frage gestellt, da Marktführer nicht zwingend die höchste Rentabilität erzielen, bzw. hoch differenzierte Marktsegmente hohe Rentabilitäten ermöglichen. Erfahrungskurve © Die Erfahrungskurve lehrt, dass mit jeder Verdoppelung der im Zeitablauf kumulierten Produktionsmenge die in der Wertschöpfung eines Produktes enthaltenen realen (nicht inflationierten) Stückkosten (Wertschöpfungsanteile) potentiell um 20-30 % sowohl in einer Branche als auch bei der einzelnen Unternehmung fallen (Kreilkamp 1987). Dabei wird unterstellt, dass alle Möglichkeiten der Kostensenkung in Produkt und Prozess genutzt werden und die Produkte wie die Stückkosten für längere Zeit gültig identifizierbar sind. Ursachen potentieller Erfahrungskurven sind Lerneffekte (kleinere Ausschussraten und Fertigungszeiten, bessere Kundenkontakte u.ä.), Marktmacht (Einkaufsmacht, Reaktionsgeschwindigkeit u.ä.), Skaleneffekte, d.h. Kostendegressionen bei ansteigender Kapazitätsauslastung oder ansteigender Kapazitätsgrösse, eingeleitete Rationalisierungsmassnahmen (Gemeinkostenwertanalyse GWA, einfacheres Vertriebssystem u.a.) oder der technische Fortschritt (höhere Leistung bei geringerem Ressourceneinsatz). Erfahrungskurven stützen die PIMS-These, dass Marktanteil und Rentabilität positiv korrelieren, d.h. mit zunehmendem Marktanteil nimmt die Rentabilität zu. Sie verdeutlichen, dass Unternehmungen mit hohen Marktanteilen höhere Kostensenkungspotentiale aufweisen und dass es bei geringem Marktwachstum und konstantem Marktanteil relativ lange dauert, bis die kumulierte Produktionsmenge sich verdoppelt und die Kosten reduzierbar sind (Becker 1988), d.h. die Kostenvorsprünge angestammter Marktführer 69 UZH | Marketing I können Markteintritte erschweren. Die Gefahren eines Portfolio-Konzepts liegen in einer zu engen oder zu weiten ProduktMarkt-Definition (relevanter Markt, Marktsegmente), in einem zu frühen Melken der Cash Cows (fehlende Sicherung der Kerngeschäfte), der einseitigen Beachtung von Geschäften der Matrix und der Vernachlässigung neuer Marktchancen (fehlende Innovationen) wie der Gleichsetzung von Marktanteils- und Wachstumszielen mit der Strategie der einzelnen Geschäftseinheit (Hamermesh 1986); das Konzept muss daher mit anderen Analyseinstrumenten kombiniert werden (Brauchlin/Wehrli 1994). 3.4.8. Wettbewerbsstrategien Eine Loslösung von der Produkt-Markt-Sicht finden wir im Konzept der Wettbewerbsstrategie (Porter 1980). Sie beinhaltet die Fragen nach der Profitabilität einer Branche und einer Unternehmung. Die Grundlage dieser Strategien ist die Branchenanalyse. Der Wettbewerb in einer Branche, die Branchenattraktivität, wird von fünf Wettbewerbskräften geprägt: © 70 UZH | Marketing I Die fünf Triebkräfte der Rivalität zwischen Wirtschaftssubjekten sind die folgenden (Porter 1980): 1. Bedrohung durch neue Konkurrenten Die Gefahr eines Markteintritts hängt von den herrschenden Eintrittsbarrieren (Effekte der Erfahrungskurve, Grad der Produktdifferenzierung, Kapitalbedarf, Kundenloyalität, Umstellungskosten, Zugang zu Vertriebskanälen) und dem Reaktionspotential der etablierten Wettbewerber (bisherige Vergeltungsmassnahmen, Branchenwachstum, liquide Mittel) ab. Je grösser diese Faktoren, desto unwahrscheinlicher sind Markteintritte. 2. Verhandlungsmacht der Kunden Die Macht der Abnehmer ist umso stärker, je konzentrierter die Abnehmer, je standardisierter die Problemlösungen, je niedriger die Umstellungskosten, je niedriger die Gewinne, je einfacher die Rückwärtsintegration, je unerheblicher die Qualität und je höher die Markttransparenz. 3. Bedrohung durch Ersatzprodukte Im weiteren Sinn konkurriert jede Branche mit Branchen, die Ersatzprodukte (Substitute) herstellen. So kann das individuelle Bedürfnis «Sicherheit» von Banken und Versicherungen befriedigt werden. Gefährlich sind Problemlösungen mit, gegenüber den Produkten der angestammten Branche, attraktiven Preis-Leistungs-Potentialen. Bei einem Substitutionsprodukt ist die Kreuzpreiselastizität positiv, d.h. wenn der Preis für ein Gut «A» erhöht wird, nimmt die Nachfrage nach dem Substitutionsgut «B» ceteris paribus zu. 4. Verhandlungsstärke der Lieferanten Diese Macht ist umso höher, je konzentrierter die Lieferanten, je geringer die Ersatzprodukte, je unwichtiger der Kunde, je wichtiger das Produkt für den Kunden, je ausgeprägter die Produktdifferenzierung und je wahrscheinlicher eine Vorwärtsintegration des Lieferanten. 5. Rivalität unter den etablierten Unternehmungen Diese Konkurrenz ist um so intensiver, je zahlreicher die Wettbewerber, je geringer das Branchenwachstum, je geringer die Kapazitätsauslastung, je höher die Fixkosten, je geringer die Produktdifferenzierung, je grösser die Kapazitätserweiterungssprünge, je unkonventioneller die Spielregeln der Wettbewerber, je höher ihr strategisches Engagement und je höher die Austrittsbarrieren aufgrund von emotionalen Bindungen, rechtlichen und sozialen Hindernissen oder relativ hohen Austrittskosten (Image, Logistik, Service, Sortiment u.a.). Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Mitbewerber sich durch gezielte Informationen gegenseitig beeinflussen können: Die Aktivitäten zielen auf die Beeinflussung der Wahrnehmung der Marktteilnehmer ab und können so indirekt die Strategien beeinflussen. Diese strategische Informationsherausgabe (Hess 1991) führt zu Informationsasymmetrien zwischen den Marktteilnehmern, die Überwindung der Asymmetrien zu Transaktionskosten. © Die Analyse dieser fünf Wettbewerbskräfte führt zu drei strategischenHandlungsmöglichkeiten, um in der Branche die Konkurrenten zu übertreffen (Positionierungseffekt): 71 UZH | Marketing I Kostenführerschaft Im Rahmen der Marktbehauptung versucht eine Strategie der umfassenden (generellen) Kostenführerschaft (Strategie der Effizienz) durch die Nutzungdes Kostenrückgangs bei entsprechend grossen (Produktions-)Mengen innerhalb der Branche einen Kostenvorsprung (Kosteneffizienz) und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen (Porter 1980). Die relativ günstige Kostensituation muss vom Management mit der Gestaltung des Leistungsangebotes (Marketing-Mix) in Wettbewerbsvorteile umgesetzt werden, sei es über tiefere Preise, höhere Handelsmargen oder verbesserte Qualität: «Es kostet sehr viel Geld, schlechte Produkte zu bauen» (Augustine 1988). © Diese Strategie erfährt ihre Konkretisierung im aggressiven Aufbau von effizienten Produktionsanlagen, in geringen Vermögenswerten in Relation zum Output, im Ausnutzen erfahrungsbedingter Kostensenkungs- und Erlöserhöhungspotentiale (Verfahrensinnovationen) in allen Funktionen, im Abbau von Kunden mit geringen Bestellmengen, in der Beschaffung (kostengünstiger Zugang zu den Produktionsfaktoren) und in der intensiven Kostenkontrolle und -steuerung. Sie führt eher zu funktionsorientierten, zentralen Strukturen mit eindeutigen Verantwortlichkeiten und monetären Anreizen für den Mitarbeiter und das Management. Voraussetzung für diese Ausrichtung sind ein weitgehend homogenes Produkt, ein relativ hoher Marktanteil in zeitlich stabilen Volumenmärkten (d.h. keine saisonalen Schwankungen) und der Zugang zu relativ preisgünstigen Rohstoffen und Lieferanten. Eine erfolgreiche Strategieimplementierung erfordert die exakte Identifizierung des Produktes, die Erfassung der wertschöpfungsbezogenen und inflationsbereinigten Kosten sowie die Operationalisierung der Erfahrung, für welche die kumulierte Produktmenge nicht die optimale, jedoch eine praktikable Massgrösse darstellt (Kreilkamp 1987). Die Strategie der Kostenführerschaft birgt die Risiken der hohen Spezialisierung, der geringen Flexibilisierung und Marktnähe in sich. 72 UZH | Marketing I Differenzierung Mit der Differenzierung sollen Wettbewerbsvorteile durch einzigartige Problemlösungen geschaffen werden. Design, Emotionalitäten, Geschwindigkeit, Image, Logistik, Marke, Ökologie, Qualität, Raumgestaltung, Service, Sicherheit, Sortiment, Standort, Technologie und Verpackung sind Elemente eines solchen Bündels der Differenzierung. Da eine Differenzierung auf die Bildung einmaliger Präferenzen abzielt, verschafft sie der anbietenden Unternehmung preispolitische Spielräume. Diese verdeutlichen sich in abnehmenden Preiselastizitäten. Es ist sinnvoll, bei der Differenzierung von einer Positionierung mittels objektiven und subjektiv wahrgenommenen Leistungseigenschaften zu sprechen. Bei diesen emotionalen Erlebniswerten (psychologischer Nutzen) ist nicht primär entscheidend, ob ein objektiver Wettbewerbsvorteil (realer Nutzen) existiert, sondern ob dieser vom Individuum (enduser) subjektiv stimmig wahrgenommen wird: © Die Singularität der Leistung muss aus der Sicht des Käufers erreicht werden: Da auf gesättigten, konsumnahen Märkten die subjektiv wahrgenommenen Qualitätsunterschiede der Produkte eines Sortiments wie das produktbezogene Engagement des Kunden relativ gering sind (low involvement product), stehen nicht-kognitive Aspekte im Vordergrund. Diese erlebnisorientierten Strategien (experience economy) sind in Segmenten mit ähnlichen Präferenzstrukturen durch verstärkte emotionale Elemente im Marketing-Mix (Design, Events, Ladengestaltung, Marke, Verpackung) zu erreichen. Die 73 UZH | Marketing I individuell wahrgenommenen Wettbewerbsvorteile müssen den von der Unternehmung beabsichtigten entsprechen. Dies erfordert eher marktnahe, flexible, dezentrale, qualitätsorientierte Strukturen mit engen funktionalen Koordinationen und qualitativen Anreizen für den Mitarbeiter. Beispielhafte Ausprägungen der Differenzierungsstrategie finden wir in der Markenpolitik (brand management). Diese ermöglicht Positionierungen im Vertriebskanal (Hersteller-, Handelsmarken), im Marktraum (nationale, internationale, globale Marken) und im Marktsegment (Einzel-, Mehr-, Dachmarken) (Meffert 1988). Konzentration Der dritte Strategietyp beschränkt sich auf ein Marktsegment. Diese segmentspezifische Konzentration kann zu einer Differenzierung, einer situativen, nicht generellen Kostenführerschaft oder einer Kombination dieser Strategieformen führen. Alle drei genannten Strategieformen sollten dazu führen, dass die Unternehmung nicht «zwischen den Stühlen sitzt»: Marktnischen (Differenzierung, Konzentration auf Schwerpunkte) wie Volumenmärkte (Kostenführerschaft) ermöglichen als konsequente Strategietypen relativ hohe Renditen (return on investment ROI). Unternehmungen mit fehlenden Differenzierungs- oder Kostendegressionspotentialen in unspezifischen Märkten sind bedroht. © Eine Unternehmung, die sich mit ihrer Wettbewerbssituation erfolgreich auseinandersetzt, muss daher über die Zeit attraktive Branchen wählen, ihre Position in der jeweiligen Branche ständig verbessern und die erarbeiteten Wettbewerbsvorteile mittels ihrer Fähigkeiten (Kernkompetenzen) nachhaltig verteidigen. Die Wettbewerbsstrategien werden jedoch wie die Produkt-Markt- und die PortfolioStrategien oft kritisiert, weil sie sich (1) einseitig auf Märkte und Branchen sowie (2) an (kurzfristigen) Preis-Leistungsverhältnissen orientieren. Ebenso vernachlässigen sie (3) die globale Wettbewerbsfähigkeit und (4) die unternehmungsinternen Voraussetzungen der Strategieentwicklung und -umsetzung, d.h. ihre Ressourcen, Strukturen, Prozesse und Kulturen. 3.4.9. Kernkompetenzen Die Orientierung an den Märkten, den Konkurrenten wie der Umwelt ist möglicherweise keine sichere Basis für die Strategieentwicklung: Wenn das Umfeld durch zunehmende Instabilität und steigende Änderungsgeschwindigkeiten gekennzeichnet ist, können unternehmungsspezifische Gegebenheiten eine weitaus stabilere Basis für die Strategieformulierung bilden. Die Kritik am Fokus der Strategieentwicklung auf unternehmungsexterne Felder und der 74 UZH | Marketing I Vorschlag des Perspektivenwechsels zu unternehmungsinternen Gegebenheiten ist das gemeinsame Merkmal jener Beiträge, welche die kompetenzorientierte Perspektive im strategischen Management und Marketing prägen. Dabei wurden ältere Konzepte, welche die Bedeutung einzigartiger, nur schwer imitierbarer Ressourcen für den Unternehmungserfolg betonten, aufgegriffen (Penrose 1959) und durch neue Gedanken zu umfassenderen, kompetenzorientierten Ansätzen weiterentwickelt (Prahalad/Hamel 1990). Das gemeinsam verfolgte Ziel aller kompetenzorientierten Beiträge ist zusammenfassend die Erklärung von Wettbewerbsvorteilen auf der Basis unternehmungsinterner Komponenten. Dieser Fokus kann die in der Strategieliteratur vorherrschende Konkurrenz- oder Produkt-Marktorientierung ergänzen, jedoch nicht ablösen. Für diese unternehmensinternen Komponenten hat sich keine eindeutige Bezeichnung herausgebildet, so dass die Begriffsvielfalt kaum abschliessend nachvollziehbar ist (Jüttner 1994). Sie reicht von «resources» über «invisible assets», «strategic assets», «competency», «intangible resources», «assets/skills», «firm resources», «capabilities», «distinctive competence», «core capabilities», «resources/capabilities/strategic assets» bis hin zu «core competences». Dennoch lässt sich eine Gemeinsamkeit bei der inhaltlichen Konkretisierung der verschiedenen Begriffe nachzeichnen. So erklären nahezu alle Autoren die Entstehung von Wettbewerbsvorteilen durch unternehmensinterne Elemente, die sich in unspezifische, isolierbare Komponenten (resources, skills, assets) und spezifische, integrierte, einmalige Komponenten (strategic assets, capabilities, competences», core competences) differenzieren lassen. Die spezifischen Komponenten besitzen eine höhere Ordnung und bauen direkt auf den unspezifischen Komponenten auf. Während diese noch eingeschränkt transferierbar und imitierbar sind, erfolgt der Aufbau spezifischer Komponenten erst durch organisatorische Lernprozesse und einzigartige Kombinationen unspezifischer Komponenten. Daraus resultiert die höhere Komplexität spezifischer Komponenten und die für Aussenstehende geringere Transparenz, welche zugleich den Transfer und die Imitation erschweren. Es entstehen Ressourcenbarrieren. © Zur Vereinfachung bezeichnen wir die unspezifischen Komponenten als Ressourcen und die spezifischen Komponenten als Kompetenzen. Ressourcen Die Ressourcen sind die Basiselemente des unternehmerischen Erfolges und zugleich die Basiseinheit der Analyse (Grant 1991). Sie umfassen sämtliche Inputs in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung, das heisst das finanzielle, technologische, menschliche und organisatorische Potential der Unternehmung. In einem produktionswirtschaftlichen Verständnis gehören die Ressourcen zur Kategorie der Produktionsfaktoren. Ressourcen, die für eine Unternehmung nicht ohne weiteres zugänglich sind, haben einen «strategischen Wert». Oft sind dies intangible Ressourcen (Marken, Patente, Wissen u.a.). 75 UZH | Marketing I Da Ressourcen lediglich die Basis des Gesamtprozesses bilden, sind sie isoliert betrachtet ohne Wert für die Unternehmung, notwendig ist vielmehr die Ansammlung eines spezifischen Ressourcensortiments, welches ein hohes Potential zur Entwicklung von Kompetenzen besitzt. Die Tatsache, dass dem Ressourcensortiment eine höhere Bedeutung zukommt als der einzelnen Ressource führt in der Umkehrfolgerung dazu, dass der Wert der Ressource sich ebenfalls erst anhand seines Beitrags zu dem dazugehörenden Sortiment ableiten lässt. Die Spezifität und der Wert einer Ressource hängt damit von der Einmaligkeit der jeweiligen Unternehmung ab. Eine Differenzierung der Ressourcen kann unter verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Unter dem Aspekt der Erhältlichkeit können handelbare (z.B. Maschinen) und selbst zu entwickelnde Ressourcen (z.B. Fähigkeiten des Personals) unterschieden werden. Ferner können die Verfügungsrechte über Ressourcen ausschliesslich im Besitz der Unternehmung sein oder geteilt werden, die zeitliche Dauer der Verfügungsrechte permanent oder zeitlich befristet sein, die Ressourcen können im Produktionsprozess verbraucht werden oder dauerhaft sein und schliesslich bildet die funktionale Einordnung der Ressourcen in die Unternehmung (marketing-, finanzspezifische oder andere Ressourcen) ein mögliches Differenzierungsmerkmal (Penrose 1959). Das wichtigste Selektionskriterium innerhalb des kompetenzorientierten Management bildet dagegen die Ausrichtung auf ausschliesslich kompetenzbildende Ressourcen. Kompetenzen © Die Kompetenzen als Komponenten höherer Ordnung resultieren aus der einmaligen (idiosynkratischen) Kombination verschiedener Ressourcen. Ihre Entstehung und Qualität ist somit von zwei Faktoren abhängig: 1. Von den unternehmensspezifischen Fähigkeiten, funktionsübergreifend Ressourcen zu integrieren. Diese Fähigkeiten werden in einem kollektiven Lernprozess entwickelt und verbessert, da menschliche Fähigkeiten als wesentlicher Integrator wirken. 2. Die Basis für die Qualität einer Kompetenz ist das Ressourcensortiment. Dieses bildet ein Kompetenzpotential, welches durch die Entwicklung einzelner Kompetenzen maximal ausgeschöpft werden sollte. Die Qualität einer Kompetenz erhöht sich in der Regel durch ihren Komplexitätsgrad, welcher auf die Anzahl der kombinierten Ressourcen zurückgeführt werden kann. Kompetenzen können auf der Basis einer einzelnen Ressource oder aber der Koordination zahlreicher Ressourcen entwickelt werden. In der kompetenzorientierten Perspektive bilden die einmaligen Kompetenzen einer Unternehmung den Ansatzpunkt zur Strategieentwicklung. Insofern weist im Gegenzug die Strategie auf die Kompetenzen: Kompetenzen bilden gleichzeitig die Basis und Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Die aus den Kompetenzen aufgebauten Wettbewerbsvorteile hängen daher wesentlich von der Fähigkeit der Ressourcen und Kompetenzen ab, als isolierende Mechanismen zu wirken (Mahoney/Pandian 1992). Für Kompetenzen und Ressourcen werden im wesentlichen drei Eigenschaften genannt, welche isolierende Funktionen fördern: 76 UZH | Marketing I 1. Die begrenzte Transferierbarkeit kann Ursachen in geographischer, räumlicher Immobilität, in Informationsasymmetrien und der Unternehmungsspezifität der Ressourcen und Kompetenzen haben, bei denen der Wert sich durch den Transfer verringert. Die begrenzte Transferierbarkeit limitiert die Möglichkeit der Konkurrenz, durch käuflichen Erwerb Ressourcen oder Kompetenzen zu imitieren und dadurch den Wettbewerbsvorteil auszuschalten. 2. Die begrenzte Imitierbarkeit bezieht sich auf Ressourcen oder Kompetenzen, die durch interne Investitionen ohne Markttransfer nachgebildet werden können. Die Imitierbarkeit wird dann eingeschränkt, wenn die Entwicklung von Kompetenzen oder Ressourcen stark mit der Unternehmungsentwicklung, den organisationsspezifischen Prozessen, der Komplexität der Ressourcen und der Unternehmungskultur verflochten ist. Dadurch wird es für Konkurrenten zunehmend schwieriger, die notwendigen Mechanismen zu kopieren. Diese Faktoren schaffen Isolationsmechanismen, die vor einer Imitation durch die Mitwerber schützen. 3. Mit der begrenzten Imitierbarkeit eng verwandt ist die begrenzte Transparenz als dritte Eigenschaft, welche speziell die isolierenden Funktionen von Kompetenzen fördert. Sie ist abhängig von der Komplexität der Kompetenz, d.h. der Anzahl der kombinierten Ressourcen und der Spezifität der kombinatorischen Fähigkeiten. Beides führt dazu, dass Konkurrenten Kompetenzen schwer kopieren können, da sie daran gehindert werden, die zugrunde liegende Ressourcenkombination überhaupt zu erkennen und die Kompetenzen verteidigungsfähig bleiben. © Im Sinn eines Exkurses und umfassenden Kompetenzverständnisses können wir die tangiblen und intangiblen Kernkompetenzen den internen strategischen Erfolgspositionen (SEP) gleichsetzen: Durch den Aufbau strategischer Erfolgspositionen wird eine Unternehmung langfristig gesichert (Pümpin 1986). Kompetenzorientiertes Management Die Ressourcen sind die Basis, ihre Bündelung fördert die Entwicklung von Kernkompetenzen und damit von Wettbewerbsvorteilen. In ihrer Einmaligkeit ist die Kernkompetenz durch den Konkurrenten schwer angreifbar und die eigenen Wettbewerbsvorteile steigen: Je höher ihre Bedeutung für den Kunden und je stärker ihre relative Stellung, desto eher muss die Kernkompetenz in der Unternehmung gepflegt und weiterentwickelt werden. Kernkompetenzen sind, bildlich gesehen, gleich den Wurzeln eines Baumes: Aus ihnen wachsen Stamm und Äste (Kernprodukte), aus diesen die Zweige, die Blätter, die Blüten und die Früchte (Endprodukte). Die Identifikation der Kernkompetenzen kann mittels Fragen (Checklisten) erfolgen: Was können wir besser als die Konkurrenz? Worauf ist unser Können übertragbar? 77 UZH | Marketing I © Die Kernkompetenzen sind im Zeitablauf unternehmensweit durch entsprechende Investitionen weiter zu unterstützen. Beispiele oft erwähnter materieller (tangibler) wie immaterieller (intangibler) Kernkompetenzen sind: Motorenbau (Honda), Logistik (Migros), Optik/Elektronik (Canon), Versandhandel (L.L. Bean), Zahlungsverkehr (American Express) oder Gestaltung durchgängiger Wertschöpfungsketten (IKEA). Intangible Kernkompetenzen sind von Konkurrenten schwerer angreifbar als tangible, da jene nicht in physischen Leistungen, sondern in Know-how, in Konzepten oder in Beziehungen, zum Beispiel «Logistik» oder «Kundenbeziehungen», verankert sind. Die wiederholte Schöpfung von Kernkompetenzen (Multiplikationen) kann zu einer noch einmaligeren Fähigkeit der Unternehmung, einer sog. Metakompetenz (grand competence), führen. Die kompetenzorientierte Strategieentwicklung und -durchsetzung ist eine «Inside-OutBetrachtung», das Produkt-, Markt-, Industriestruktur-Verständnis demgegenüber eine «Out-Inside-Betrachtung». 78 UZH | Marketing I © Das Verständnis der Kernkompetenzen impliziert die folgenden Konsequenzen für das strategische wie operative Marketing-Management: Die Auseinandersetzung mit den Kernkompetenzen bedeutet, dass bei einer lokalen wie globalen Wettbewerbsanalyse Kernkompetenzen, Kern- und Endprodukte der einzelnen Marktteilnehmer klar zu trennen sind: Eine nur endproduktorientierte Konkurrenzanalyse würde die Kraft der Kernkompetenzen negieren bzw. mit einer Kompetenzanalyse kann kein unmittelbarer Zusammenhang zu potentiellen Endprodukten hergestellt werden. In einer unternehmungsstrategischen Diskussion hilft das Erkennen eigener Kernkompetenzen, insbesondere folgende Fragen zu klären: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sind unsere Endprodukte gebündelt, d.h. entsprechen sie den Kernkompetenzen? Welche Kernkompetenzen sind wie zu nutzen? Wie können wir unsere Kernkompetenzen schützen? Liegen die kurzfristigen Wettbewerbsvorteile eher in den Endprodukten (Pommes Chips), in den Kernprodukten (Verarbeitung Kartoffeln) oder zeigen sich die langfristigen Vorteile in der Kernkompetenz (Logistik)? Wie weit ist das geplante Neuprodukt von den Kernkompetenzen entfernt? Wie weit ist die vorgesehene Diversifikation von den Kernkompetenzen entfernt? Erfolgt die geplante Kooperation auf der Ebene der Kernkompetenzen, der Kernoder der Endprodukte? Beziehen wir unsere Lieferanten und Kunden in die Entwicklung von Kernkompe79 UZH | Marketing I tenzen mit ein? (9) Werden bei In- und Outsourcing-Entscheidungen Kernkompetenzen angegriffen, aufgegeben oder gestärkt? (10) Gewinnen wir mit einem schlanken, kompetenzorientierten Sortiment an unternehmerischer Stärke? Die Entwicklung und Sicherung der Kernkompetenzen erfordert eine stimmige Bündelung aller Ressourcen über die Zeit. Das gemeinsame Ziel der kompetenzorientierten Perspektive und der an Produkt, Markt, Industriestruktur orientierten Konzepte ist zusammenfassend die Erzielung von langfristigen Gewinnen bzw. Steigerung des Unternehmungswertes, welche in allen Ansätzen durch die Existenz von Wettbewerbsvorteilen erklärt werden. Unterschiede bestehen dagegen im Ansatzpunkt der Strategieentwicklung. Während die Produkt, Markt und Industriestruktur orientierten Konzepte sich auf die optimale Struktur von Produkt-MarktKombinationen konzentrieren, geht die kompetenzorientierte Perspektive von «costly to copy attributes» (Conner 1991) der Unternehmung aus, d.h. sie orientiert sich an den individuellen Perspektiven der firmenspezifischen Ingredienzen von Wettbewerbsvorteilen. © Es ist die Aufgabe der Unternehmungsführung, Strategien zu formulieren, (1) die durch ihre Realisierung das kompetenzbildende Potential der Ressourcenbasis hoch halten, (2) durch einmalige Kombinationen Kompetenzen aufbauen, um auf dieser Basis Wettbewerbsvorteile zu erzielen, (3) die letztlich aus dem einzigartigen Charakter der Unternehmung resultieren. 3.4.10. Zeitstrategien Die Zeit hat die Dimensionen des Nacheinanders (Zeitabläufe) und der Dauer (Zeitbedarfe). Sie ist nur in ihrer Veränderung ables-und erlebbar. Aus unternehmerischer Sicht sind die Grössen «Zeitpunkt» (Bestandesgrösse) und «Zeitraum» (Stromgrösse) wesentlich. Es sind daher die folgenden Dimensionen denkbar: (1) Die Zeit als institutionelle, knappe, nicht ersetzbar Ressource: die zeitliche Effizienz von Prozessen und die Bewertung möglicher Zeitverzögerungen (Opportunitätskosten). So zeigen beispielsweise Erfahrungswerte, dass bei einer Produktlebensdauer von fünf Jahren, eine Verlängerung der Entwicklungszeit um sechs Monate zu rund 80 UZH | Marketing I 30% Ergebniseinbussen führt; die Erhöhung der Entwicklungskosten um 50% bewirkt jedoch nur Einbussen von 5%. (2) Die Zeit als Wettbewerbsfaktor beinhaltet die unternehmerische Anpassungsfähigkeit (Antizipationsfähigkeit) auf marktliche Veränderungen und die Aspekte des Zeitpunktes eines möglichen Markteintrittes: Ist der Pionier (first) oder der Verfolger (first follower) erfolgreicher? Die möglichen Pioniervorteile (Nachteile für den Folger) sind: (1) vorübergehende Monopolsituation (Einmaligkeit der Leistung, technologischer Standard u.a.), verbunden mit relativ hohen Preisen, (2) Kostenvorteile durch Erfahrungskurveneffekte, (3) Sicherung der Distributionskanäle, (4) Image- und Präferenzbildung bei Nachfragern und daher (5) Aufbau von Wechselbarrieren und kosten bei den Kunden. Die möglichen Pioniernachteile (Vorteile für den Folger) sind: (1) hoher Ressourceneinsatz für die Markterschliessung (Kommunikation u.a.) und (2) Produkt- und Nachfrageschwächen. Aufgrund der vielfältigen Gründe eines Markterfolges scheint nicht die Frage «Pionier» oder «Folger» primär, sondern die Marktakzeptanz einer Produkt- bzw. Prozessinnovation: der Zeitpunkt hinsichtlich des Marktes, nicht der Konkurrenz. Die Zeit zum Markt bzw. die Schnelligkeit am Markt (time to market) verstehen wir als die Zeit von der Produktidee bis zum erfolgreichen Produkt. Dabei nehmen die Fehlerkosten - die Kosten für die Verbesserung (rework) einer marktlich und technisch qualitativ ungenügenden Leistung - von der Produktidee über die Teilelieferung bis zur Markteinführung zu. Ebenso ist der Einfluss eines einzelnen Zyklus auf andere Zyklen aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten sehr unterschiedlich: In vielen Fällen ist der tatsächliche Einfluss des Zyklus «Entwicklung, Konstruktion» auf die übrigen Zyklen grösser als die zunächst gemeinte Wirkung (Schatteneffekte). © Die Zeitführerschaft kann als mögliche (Teil-)Strategie für die Kostenführerschaft relevant sein (Beschleunigung der Prozesse u.ä.) oder als spezifische Ausprägung einer Differenzierung (Erhältlichkeit der Leistung u.ä.) gesehen werden. 3.4.11. Co-opetition Verfügt die einzelne Unternehmung über keine eindeutigen Kompetenzen und/oder liegen Marktschwächen vor, so ist die eigenständige Leistungserstellung zu überprüfen. Diese Analyse kann zu einer Verdichtung oder Reduktion der eigenen Wertschöpfungskette führen, bedingt jedoch gleichzeitig die Übertragung ausgelagerter Leistungen auf Dritte. Für diese begrenzte oder vollständige Funktionsausgliederungmüssen stimmige Partner gefunden werden, welche 1. den Willen haben, die unternehmerischen Risiken (Kosten) in der gesamten Wertschöpfungskette gemeinsam zu reduzieren, 2. die qualitative Zufriedenheit der Endkunden verbessern möchten und 3. das gemeinsame Lernen als einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil verstehen. 81 UZH | Marketing I Die Partnersuche ist dabei eng mit den Fragen der Konkurrenz (Competition) und der Kooperation (Cooperation), somit der Co-opetition (Nalebuff/Brandenburger 1996), verwoben: Eine Unternehmung kann zu einer anderen in bestimmten Produkt-Marktfeldern Kooperationspotentiale nutzen, in anderen Feldern wird der Alltag jedoch durch intensive Konkurrenz geprägt. Ein solches strategisches Denken und Handeln verbindet die Vorteile der Konkurrenz mit denjenigen der Kooperation und erlaubt der einzelnen Unternehmung eine unterschiedliche Rolle in verschiedenen Partnerschaften. Wesentliche Erfolgsfaktoren in beschaffungsorientierten Partnerschaften sind: (1) Kein Partner sollte vom anderen stark abhängig sein (power balancing), (2) jeder Partner investiert in bestimmte Fähigkeiten (cospezialization), (3) marktorientierte Preispolitik (target pricing) und (4) persönliche Beziehungen (personal ties) (Landry 1998). Die Partnerschaften führen zu einem gegenseitigen Nutzen, insbesondere zu tieferen Kosten und langfristigen Potentialen (Investitionen u.a.) und basieren auf Vertrauen sowie innere Verpflichtung; diese Werte stabilisieren eine Beziehung vor allem in Phasen des opportunistischen Verhaltens. 3.4.12. Netzwerkstrategien © Die Beziehungen von Herstellern, Kunden und Lieferanten, von Personen in- und ausserhalb der Unternehmung, von materiellen und immateriellen Austauschprozessen sind der Zugang zu den Wertschöpfungsprozessen der Marktpartner. Diese vielfältigen Beziehungen bzw. Beziehungsformen können eine isolierte unternehmerische Wertschöpfungskette zu umfassenden Netzwerken erweitern: Solche Arrangements entstehen durch den Zusammenschluss rechtlich unabhängiger Unternehmungen, welche durch verstärkte Kooperation und Koordination eine zumindest temporäre wirtschaftliche Einheit bilden. Über Geschäftsbeziehungen mit eher projektspezifischem Charakter entsteht ein Netz von Partnern, die sich mit ihren spezifischen Kompetenzen langfristig durchdringen. Es entsteht ein Unternehmungsverbund mit gleichgerichteten Zielen, ein Wertschöpfungssystem (value creating system) (Normann/Ramírez 1993) mit immer neuen Ressourcen in Form von Erfahrungen, Sachmitteln, Vertrauen oder Wissen. Durch die «Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmungen oder im Zuge einer begrenzten Funktionsausgliederung» (in-, outsourcing) bilden sich strategische Netzwerke (Sydow 1992). Diese relativ stabilen Netzwerke sind als virtuelle Organisation (Davidow/Malone 1992) verstehbar. Da in Netzwerken unterschiedlich agiert werden kann, sind sie für verschiedene Marktkonstellationen geeignet, insbesondere (1) fragmentierte, (2) internationale und (3) schnell wachsende Märkte. In diesen Situationen ist bei isoliertem Wirken ein zeitgerechter Wettbewerbsvorteil für kleinere und mittlere Unternehmungen nur schwer erreichbar: Die Bildung von (Netzwerk-)Partnerschaften erlaubt (1) einen flexibleren Ressourceneinsatz, (2) eine individualisierte Leistungserstellung (Mass Customization) und 82 UZH | Marketing I (3) eine relativ agile Teilhabe an Marktentwicklungen: Die unternehmerische Reaktionsschnelligkeit kann bei gleichzeitiger Reduktion der eigenen unternehmerischen Risiken (Markteintritt, Technologien u.a.) gesteigert werden. Diese Ausrichtung führt zu geringeren Total Cost of Ownership (Herstell-, Instandhaltungs-, Kapitalbindungs- und Testkosten, Recycling, Zahlungsbedingungen u.a.) für alle Partner. In diesen Netzwerken werden die Grenzen der In- und Umwelt einer Unternehmung fliessend, der traditionelle Wettbewerb zwischen Unternehmungen entwickelt sich zum Wettbewerb zwischen Netzwerken: Die Rolle einer Unternehmung im Netzwerke hängt davon ab, (1) mit welcher Intensität (Dauer, Häufigkeit, Qualität der Beziehungen) sie in welchem Netzwerk eingebunden ist, sei es beispielsweise in ein Vertriebs- oder in ein Informationssystem, (2) wie der Lieferant bzw. Kunde internalisiert wird, (3) wie sich die gesamte Wertschöpfung entwickelt bzw. verteilt, (4) ob sie sich als Knoten (core firm, focal firm) eines Netzwerkes positioniert und (4) ob die Beziehungsgestaltung zu tragfähigen Wettbewerbsfähigkeiten entwickelt wird (Multiplikation von Beziehungskompetenz). Die einzelne Unternehmung steht in diesem Kontext vermehrt in der paradoxen Situation, dass sich in Netzwerken tragfähige Wettbewerbsfähigkeiten und nachhaltige Wertsteigerungen nur dank stimmigen (Kern-)Kompetenzen sowie hoher Kooperationsbereitschaft entwickelt. Die Entwicklung von Partnerschaften bedingt ein systematisches Vorgehen: © 1. Partnerprofil Ausgehend von der eigenen Situation (Kompetenzen, Offenheit, Märkte u.a.) sind die Anforderungen an die Partner und ihre unternehmerischen Funktionen zu definieren. 2. Partnersuche Aufgrund der formulierten Suchkriterien sind bestehende und neue Beziehungen zu identifizieren sowie ihre Gestaltung zu klären. 3. Beurteilung Die einzelnen Unternehmungen sind hinsichtlich ihrer Ressourcen und Potentiale zu beurteilen. Dabei gilt es, Möglichkeiten der Multiplikation (Kompetenzen, Kunden, Marken, Markterfahrung, Produktdesign, Prozesse, Vertrieb u.a.) zu nutzen. 4. Verhandlung Aufgrund der Vorauswahl und möglichen Erstkontakten gilt es, die gemeinsamen Absichten zielorientiert zu klären. 5. Integration Die erfolgreiche Gestaltung der Partnerschaft bedingt koordinierte Informationen und gelebte Transparenz (open books, shared profits): Die vielschichtigen Beziehungen und Prozesse müssen sich im Alltag bewähren. 83 UZH | Marketing I © 3.4.13. Endspielstrategien In sich abzeichnenden Stagnations- oder Schrumpfungsphasen, insbesondere bei fehlender Restnachfrage und ungünstiger Branchenstruktur (sprunghafte Veränderungen, fehlende Marktnischen, instabile Preise, erhebliche Überkapazitäten, hohe Stillegungskosten der Anlagen, enge vertikale Integration), wird durch eine Desinvestitionsstrategie ein bewusster Marktaustritt eingeleitet (Harrigan/Porter 1984). Diese Strategien sind sehr oft nur schwer realisierbar, da Austrittsbarrieren (Vertrauensverluste gegenüber Marktpartnern) und unternehmungsspezifische Besonderheiten (Sortiment, Folgekosten, Handelsmacht, subjektiv wahrgenommene Marktstellung und -risiken) einen Marktaustritt erschweren. Die schliesslich gewählten «Endspielstrategien» sind abhängig von den eigenen unternehmerischen Vorteilen und der jeweiligen Branchen- wie Nachfragesituation (Harrigan 1989): 84 UZH | Marketing I Die Strategien «sofort veräussern» und «Investitionen melken» gehen davon aus, dass das erwartete «Endspiel» keine vernünftige Rendite (ROI) erwarten lässt. 3.4.14. Europäische Strategien © Die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes findet ihre Konkretisierung in den Aktivitäten der Europäischen Gemeinschaft sowie in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen (euroconsumers, the european way of life). Die Marktstrukturen und -kulturen lassen jedoch eher eine zögerliche Angleichung der Kundengewohnheiten vermuten. Die schrittweise Einführung der europäischen Währung (Euro) bewirkt Währungsumstellungseffekte (Umrechnungsproblematik, Preisbeurteilung), Preistransparenzeffekte (Preisvergleiche, Preisdifferenzierung) und Binnenmarkteffekte (Wegfall Währungsgrenzen, Intensivierung Wettbewerb). Diese Entwicklungen fördern die Konzentration von Handel und Hersteller. Die Unternehmungen werden sich entscheiden müssen, ob sie sich als lokaler (Nischen)Anbieter oder als an europäischen Kundengruppen ausgerichteter Anbieter positionieren wollen. Mögliche Gründe für eine Internationalisierung: (1) Reife- oder Sättigungsphase der nationalen Märkte, (2) Verdrängungswettbewerb, (3) Schutz gegen unfreundliche Übernahmen, (4) Überalterung der Bevölkerung, (5) Druck zur Gewinnrealisierung. Umgekehrt käme ein Rückzug auf den Heimmarkt einer Renationalisierung gleich. Mögliche Konsequenzen für das Leistungsangebot: 1. Die zunehmende Normierung von Produkten, Verpackungen und Kennzeichnungen 85 UZH | Marketing I sowie der Ausbau europaweiter Dachmarkenprägen die Produktpolitik. 2. Im Rahmen der Preispolitik sollte im Sinn der Preiskorridor-These eher ein Kompromiss zwischen Einheitspreisbildung und unabhängigen Länderpreisen (Preisschwellen) angestrebt werden, als sich an europäischen Niedrigstpreisen zu orientieren. Letztere könnten, gefördert von noch nicht harmonisierten Steuersätzen, das Arbitrageverhalten der Kunden fördern. 3. Der zunehmende Wettbewerbsdruck erzwingt Effizienzsteigerungen in der Distributionspolitik und fördert das kooperative Verhalten (ECR, EDI), möglicherweise unter Ausschaltung bestehender (Gross-) Handelsstrukturen und unter Nutzung von Internet-Plattformen, insbesondere bei Industriegütern (B2B-Marktplätze). 4. In der Heterogenität der europäischen Medienstruktur und -nutzung gewinnen länderübergreifende Medien und Botschaften in der Kommunikationspolitik an Bedeutung. 3.4.15. Globale Strategien Die Globalisierung der Märkte bedeutet, dass einzelne Märkte (Kaufkraft, Strukturen, Verhalten) untereinander ähnlicher werden. Dieses harmonisierte Nachfrageverhalten (Levitt 1973, Ohmae 1987) führt zu einem weltweiten Angebot und Wettbewerb. Entwicklungen wie der Massentourismus, die Massenmedien (Print, Non-Print) und das Internet fördern den Abbau der psychischen Distanzen. Diese sind Ausdruck der Fremdheit bzw. Vertrautheit zwischen Regionen (Kaufkraft, Konsumentenverhalten, Kultur, Rechtsnormen, Sprache usw.). Im internationalen Marketing wird dabei unterstellt, dass bei sonst gleichen Bedingungen die Neigung, mit einem distanziert wahrgenommenen Land Geschäftsbeziehungen aufzunehmen, geringer ist, als wenn Marktnähe oder Gefühle der Gleichartigkeit vorherrschen (Müller/Köglmayr 1986). Zusammen mit ähnlicheren Produktanforderungen, beispielsweise über den Abbau von Normen oder technischen Vorschriften, verstärken die geringeren psychischen Distanzen transnationale Austauschprozesse und die Wettbewerbsintensitäten. © Globale Märkte Die Globalisierung ist eine Phase der Entwicklung einer Unternehmung: (1) national (Binnenmarkt),(2) national (Export- und Importgeschäft, Lizenzen, Franchising), (3) national (Vertretung Ausland), (4) national (Tochtergesellschaft Ausland, Joint Ventures), (5) international (Umsatz Markt Ausland grösser Umsatz Markt Inland), (6) multinational (Konzentration auf internationale Aktivitäten in ausgewählten Märkten), (7) global (weltweites Konzept, Weltmarkt). Die Harmonisierung der globalen Integration (globale Unternehmung) und der lokalen Differenzierung (multinationale Unternehmung) führen zum Typ der transnationalen Unternehmung (Bartlett 1986). Diese in mehreren Ländern operierenden Unternehmungen sind je nach Standort (Müller/Kornmeier 2000) mit den folgenden Management-Risikenunterschiedlich konfron86 UZH | Marketing I tiert: (1) makroökonomische Risiken (Löhne, Zinsen, Wechselkurse), (2) politische Risiken (Regierungsaktionen, kriegerische Handlungen), (3) Wettbewerb (globale Konkurrenz) und (4) Ressourcen (Management). Mögliche Hemmnisse der unternehmerischen Globalisierung (etablierte Verkaufskanäle, lokaler Kundendienst, mangelnde Weltnachfrage; Marktkulturen u.a.) müssen nicht als Datum hingenommen werden, sondern können durch strategische Innovationen globalisierungsfördernd beeinflusst werden (Welge 1990), sei es über die Human Ressourcen oder die Gestaltung der Management-Prozesse. Die strategischen Lösungsansätze und ihre Umsetzung sind für europäische wie globale Märkte konzeptionell ähnlich, aber inhaltlich verschieden. Das Ausmass der Globalität von Märkten wird von den Marktbedürfnissen und ressourcen (Erfahrung, Kaufkraft, Zeit) bestimmt (Sheth 1986): © Ähnliche Marktbedürfnisse und -ressourcen sind somit die Zielmärkte eines globalen Marketing. Die umspannenden Markttransparenzen - «man» trägt «Giorgio Armani» in Boston, London, Milano, München, Padua, Tokio und Zürich - prägen wiederum die lokalen Bedürfnisse. Es entstehen global-homogene Märkte (Marktsegmente) mit lokalen Potentialen. Die Grundproblematik dieser Situation, somit die strategische Herausforderung für die einzelne Unternehmung, besteht in der weltweiten Identifizierung und Definition dieser Märkte: Marktgrössen, Marktwachstum, staatliche Kontrollen, ökonomische und politische Stabilität. Für die Marktwahl sind die folgenden Kriterien wesentlich: (1) unternehmerische Ressourcen und Kompetenzen, (2) Sortimentsstruktur (Länder-PortfolioAnalyse), (3) Potentiale zu bestehenden Leistungen (Produkt-Markt-Fit), (4) Margensituation, (5) erwartete Konkurrenzreaktionen und (6) Entwicklungsphase Markt. 87 UZH | Marketing I Globale Märkte können wie folgt segmentiert werden (Porter 1986): © Schränken geschützte Märkte (blockierte Segmente) die Marketingaktivitäten ein oder verhindern sogar das Ausschöpfen des Marktpotentials, so fehlt der nationalen Ausrichtung die globale Auseinandersetzung. Die globale Orientierung ist je nach Markt und Branche unterschiedlich gestaltbar, grundsätzlich als Standardisierung oder Differenzierung des Marketing. Standardisierung versus Differenzierung Die Frage der Standardisierung bzw. Differenzierung im Marketing bewegt sich in der bestmöglichen Kombination und Integration von Märkten, Produkten und betrieblichen Funktionen. Leitlinie dieser Gestaltung ist die gesamtunternehmerische Ausrichtung auf das Stammhaus (einheitliche Unternehmungspolitik), das Gastland (differenzierte Unternehmungspolitik) oder die Welt (einheitliche Unternehmungspolitik). Wir unterscheiden formale und inhaltliche Fragestellungen einer Standardisierung bzw. Differenzierung: Formale Standardisierungenhaben primär eine Transparenz- und Koordinationsfunktion für das Marketing-Management, beispielsweise einheitliche Prozesse (Controlling, Marktforschung, Planung). Sie finden ihren bedingten Ausdruck in den jeweiligen Organisationsstrukturen wie -kulturen. Diese sind für eine Globalisierung 88 UZH | Marketing I kritische Erfolgsfaktoren (Ohmae 1989, Rall 1989). Die inhaltlichen Standardisierungen zeigt sich im gewählten MarketingMix. Die besten Ansatzpunkte einer Vereinheitlichung bestehen im Bereich der Marken- und Produktpolitik. Beinhaltet eine globale Markenführung Multiplikationspotential, so kann eine Produktgestaltung in den folgenden Varianten erfolgen: (1) «universal product»: Produkt weltweit identisch; (2) «modified product»: Produktkern identisch, jedoch länderspezifisch angepasst und (3) «country tailored product». So ist beispielsweise «Nescafé» eine globale Marke, der Kaffee wird jedoch in rund 150 Variationen den jeweiligen Markteigenheiten angepasst. Bei der Distributions-, Kommunikations- wie der Preispolitik kann von einer standardisierten «Plattform» mit differenzierter Gestaltung der verschiedenen Instrumente ausgegangen werden. Die geringste Standardisierung (höchste Differenzierung) ist bei der Public Relations und dem persönlichen Verkauf sinnvoll. Eine solche Ausrichtung ist als «sub-global» oder «modular marketing» (Kaynak 1987) interpretierbar. Das LeadCountry-Konzept ist ein Steuerungsansatz für ein modulares Vorgehen: Die von einem «Lead-Country» ausgearbeiteten Marketing-Konzepte sind die Grundlage für die Marktbearbeitungen in den übrigen Ländern. Eine Standardisierung im Marketing beinhaltet, neben ihren Grundrisiken (Hemmung innovativer Prozesse, Gefahr Mutter-Tochter-Konflikte, Gefahr weltweiter Maxi-Flops), die folgenden Kostensenkungs- undErlöserhöhungspotentiale (Segler 1986, Kreutzer 1989): © Diese Potentiale sind hinsichtlich Produkten (Lebenszyklus), Märkten (Potential) und Branchen (Grad Konsumnähe) zu differenzieren und verdeutlichen, dass Globalisierung, Kostenführerschaft und Standardisierung einerseits, Differenzierung und Lokalisierung andererseits miteinander eng verwoben sind. Dabei kann eine hohe Fertigungsflexibi89 UZH | Marketing I lität mit grosser Marktflexibilität (Mass Customization) das strategische MarketingDilemma reduzieren: In diesem Rahmen verstehen wir globale Strategien als Strategien, deren Fokus Weltmärkte (Weltmarktsegmente) sind. Diese Strategien beschränken sich nicht nur auf Absatzmärkte, sondern schliessen die Beschaffungsmärkte (global sourcing) (Arnold 1990) und weitere Funktionen wie die Produktentwicklung (Takeuchi 1988) mit ein. Länderübergreifende Strategien sind gegenüber traditionellen Strategien grundsätzlich durch eine höhere Komplexität der Informationen, Kulturen, Ressourcen und Wettbewerbe gekennzeichnet. Mögliche erweiterte Strategiemuster sind die globalen strategischen Partnerschaften (Perlmutter/Heenan 1986), die internationalen Finanzstrategien, die kulturüberschreitende Strategien (Chan Kim/Mauborgne 1987) oder die strategische Allianzen (James 1985). © 3.4.16. Marketing-Mix Die gewählte Marktpositionierung findet ihren Ausdruck im Marketing-Mix: Alle Marketing-Instrumente müssen hinsichtlich ihres Einsatzes sinnvoll kombiniert werden. Je nach Grundstrategien ist diese Aufgabe mehr strategischer oder operativer Natur (Aktionsinstrument). Das gewählte Vorgehen ist Ausdruck einer Kaskade von Politiken und ihren Teilproblemen («Wasserfall-Phänomen») (Bonoma 1985). Da zwischen den Instrumenten funktionale (Wirkung), zeitliche (Zeitpunkt des Einsatzes und des Wechsels, Zeitdauer) und hierarchische (strategisch, operativ) Beziehungen bestehen, wird meist die Produktpolitik als primäres Instrument für die optimale Gestaltung eines MarketingMixes gesehen (Basispolitik): 90 UZH | Marketing I Die sinnvolle Kombination ist Aufgabe der Planung: Ausgehend von einer Grobplanung mit der Produktpolitik als Eckwert ist in der Feinplanung die detaillierte Gestaltung des Marketing-Mixes vorzunehmen. Es ist sinnvoll, dabei eine modulare Vorgehensweise zu wählen. Je nach Intensität der Markt-, Branchen- und Umweltdynamik kann, eingebettet in die Grundstrategien, in einzelnen Feldern (Modulen) operativ reagiert werden: © CRM-Marketing-Mix Mit dem Marketing-Mix ist im Konzept von Customer Relationship Marketing (CRM) eine stimmige Kundenbeziehung aufzubauen und zu erhalten. Als Konsequenz verändern sich im Verständnis «Beziehungsmarketing» die Ausprägungen der einzelnen Marketing-Instrumente: 1. Die Produktpolitik wird durch die Leitvorstellung geprägt, dass der Wert einer Leistung durch die Interaktionen zwischen Käufer und Verkäufer geprägt wird (relations91 UZH | Marketing I hip specific offering) (Anderson/Narus 1991). Die vielschichtigen Dimensionen der Beziehung führen zum Verständnis des Produktes als Leistungsbündel, zu einer Erhöhung der Wertdichte (neue Ausprägungen von Zusatznutzen) und einer stärkeren Gewichtung der Serviceaspekte (Hanan 1992): (1) Die Verkäufer-KäuferBeziehungen, ihre Intensität und Verwobenheit definieren das Produkt (Qualität, Quantität). (2) Das Produkt entwickelt sich verstärkt zu einer Serviceleistung. (3) Da viele Serviceleistungen stark wissensbasiert sind, entwickeln sich die Unternehmungen vermehrt zu Erzieherinnen (educators) und der Kunde zum Lernenden (lifelong learners) (Davis/Botkin 1994). (4) Die Problemlösungskompetenz der Unternehmung zeigt sich in den Möglichkeiten, Kunden Gesamtsysteme anzubieten. Diese Herausforderung bedingt eine auftragsbezogene Bündelung der funktionalen bzw. geschäftsfeldbezogenen Ressourcen wie Kompetenzen. 2. Als wesentliches Kriterium der Preispolitik kann der langfristige Kundenwert (customer lifetime value) (Blattberg/Deighton 1991) herangezogen werden: (1) Die Beziehungen bestimmen den gesamten Preis. (2) Der Preis steht in enger Korrelation zur Qualität und der Zeit der Beziehungen (lifetime customer value). (3) Der Preis muss dem Wert einer Leistung für den Kunden (value pricing) und (4) der langfristigen Wettbewerbsposition entsprechen (Nagle 1993). (5) Monetäre Zusatzleistungen - beispielsweise die Zahlungsweise (pay before: Wertkarte, pay now: Debitkarte, pay later: Kreditkarte) - dienen ebenso der Beziehungsgestaltung wie nicht-monetäre Aspekte, beispielsweise Engagement oder persönliche Sicherheit beim Einkaufen. 3. Der tragende Leitgedanke einer Distributionspolitik ist die Individualisierung des «Weges zum Kunden» (customizing distribution) (Fincke/Goffard 1993): (1) Die Erhältlichkeit einer Leistung ist eine wesentliche Marketing-Aufgabe (point of sale). (2) Die Distributionspolitik sollte eine permanente Kundenanalyse ermöglichen («blueprint» customers). (3) Die Distributionsform muss eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen erlauben. (4) Zwischen dem Hersteller und dem Handel sind, auchunter dem Aspekt der Ökologie (Retrodistribution), langfristige Kooperationen im Sinn des vertikalen Marketing aufzubauen. 4. Die übergeordnete Zielsetzung der Kommunikationspolitik ist das «Lernen vom Kunden» (Shapiro 1991). Kommunikationsinhalte setzen entsprechend nicht primär an Produkt-, sondern an Beziehungsmerkmalen an. Die hohe Bedeutung neuer Kommunikations- und Informationstechnologien (Blattberg/Glazer 1994) erklärt sich somit aus der gewährleisteten Informationsverarbeitung und -aufbereitung (customer information file) und damit letztlich aus der Voraussetzung für kundenindividuelle Dialoge. Dieser Fokus bedingt ein integriertes Kommunikationsverständnis (Schultz/Tannenbaum/Lauterhorn 1993): (1) Der aktuelle wie potentielle Kunde muss für die anbietende Unternehmung identifizierbar sein (FIS - frontline information system, CIF - customer information file). (2) Die interaktive Kommunikation erfordert verstärkt individualisierte Botschaften und Medien (segment of one marketing). (3) Die langfristige Kundenbindung wird zum tragenden Kommunikationsziel. © E-Marketing-Mix Interaktive Medien, beispielsweise CR-ROM, interaktives Fernsehen, Internet oder POSTerminals unterstützen die Gestaltung von Kundenbeziehungen. Diese mediale Nutzung kann als Electronic Business verstanden werden. Die Ausgestaltung erfolgt «online» 92 UZH | Marketing I oder «offline», d.h. der Kunde tritt mit dem Anbieter ohne Umweg in Kontakt oder greift auf interaktive Medien zurück, ohne dass eine direkte Kommunikation zum Anbieter aufgebaut wird. Mögliche Konsequenzen für den Marketing-Mix: 1. Der Gegenstand der Produktpolitik ist das (modulare) Leistungsbündel. Für seine Gestaltung kann der Endkunde vermehrt in den Wertschöpfungsprozess integriert werden. Im Sinn eines Co-Design konfektioniert er Produkte (Fahrräder, Kleider, Musik u.a.) für sich auf dem Internet. Diese Individualisierung von Leistungen gestaltet sich umso einfacher, je digitalisierbarer eine Leistung ist (Musik, Spiele u.ä.). Diese Individualisierung und die Integration erlauben, verwoben mit einem Loyalitätsprogramm (E-Mails) und unterstützt von einem Customer Care Center, eine verstärkte Kundenbindung. 2. Die Preispolitik kann vermehrt (waren-)börsenähnlich bzw. auktionsmässig gestaltet werden. Reservationssysteme erlauben bereits heute solche Preiskonzepte, welche die Erstellung von Kundenprofilen aufgrund des individuellen Such- und Kaufverhaltens ermöglichen. Mit diesen personalisierten Daten wird eine verstärkte Kundenbindung im Sinn von Electronic Relations (Foren, Clubs u.a.) ermöglicht. 3. Im Rahmen der Distributionspolitik fördern insbesondere digitalisierbare Leistungen das Ausschalten von Wertschöpfungsstufen und die verstärkte Integration des Kunden in die primäre Wertschöpfung. Bei materiellen Leistungen kann der Vertrieb Logistikpartnern oder an Öffnungszeiten unabhängige Vertriebsformen wie «Pickup-Centern» oder «Consumer-Response-Centern» übertragen werden. 4. Im Electronic Business verändert sich der Kommunikationsprozess, somit die Kommunikationspolitik: In der elektronischen Kommunikation verfügt der Kunde aufgrund seiner Initialaktivität inhaltlich, technisch und zeitlich über eine Verfügungsmacht: Er ist per se primärer Kommunikator. Mit einem persönlichen Portal kann er seine Macht stärken, da er Dritten gezielt seine Erlaubnis für weitere Kontakte erteilen oder entziehen wird. Diese bewusste Selbststeuerung der kommunikativen Nachfrage ist durch eine (virtuelle) Verknüpfung mit aktuellen oder potentiellen Kunden noch steigerbar. Es entsteht ein für die anbietende Unternehmung nur schwer kontrollierbarer Nachfrageverbund (virtual community). 5. In diesen Räumen einer gelebten Konsumentensouveränität entwickelt sich Electronic Business zu einer Interaktionsarena elektronischer Dialoge mit beinahe unbeschränkten, relativ kostengünstigen Individualisierungs- und Emotionalisierungspotentialen. Der Einsatz von Electronic Business ermöglicht deshalb auch etablierten Unternehmungen die Effektivität und Effizienz ihres Marketing zu verbessern. © 3.4.17. Gesamtsicht Eine Unternehmung ist ein autonomes, offenes, soziales System. Sie erfüllt gegenüber den verschiedenen sozialen Gruppen (stakeholders) bestimmte Funktionen und steht mit ihrer Umwelt in einem vielfältigen Beziehungsmuster und Fliessgleichgewicht. Ändern sich äussere oder innere Bedingungen, so kann das System «Unternehmung» in eine relativ labile Lage geraten: Die verschiedenen internen und externen Interessengruppen (Aktionäre, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter u.a.) gefährden, wenn die unternehmerischen Leistungen (Gebaren, Problemlösungen, Moral, Recycling u.a.) den Gegenleistungen (Engagement, Erwartungen, Preise, Verzicht, Zeit u.a.) nicht entspre93 UZH | Marketing I chen, eine Unternehmung schleichend oder überraschend. Ein nachhaltiges Marketing erfordert eine konsequente Interessen-und Innovationsorientierung. Dabei ist nicht die traditionelle, reaktive, meist kurzfristige Kundenorientierung - «erfasse die Bedürfnisse und befriedige sie» - primär: «If a marketing program satisfies a million people, distracts 500'000, and frustrates 300'000, what is the net effect» (Star 1989)? Marketing muss die gesamte Wertschöpfungs- und Beziehungskette durchdringen und sich gesamtheitlich gestaltend, markt-, branchen- und umweltorientiert, strategisch flexibel, sinnvoll und stimmig ausrichten. Diesen Ansatz können wir mit Strategic Societal Marketing (strategisches gesellschaftsorientiertes Marketing) umschreiben. Dieses Konzept ist nicht ein weiteres «Marketing-Konfetti», sondern der Versuch, dem Sinnhaften einen Namen zu geben. Dieses Marketingverständnis ist in praktisches Handeln zu überführen (making strategic societal marketing work). Etwas Geschaffenes ist in etwas Bestehendes bzw. Bestehendes in zu Schaffendes einzubetten. Handlungen formen Strukturen, Kulturen wie Politiken und werden von ihnen situativ begrenzt. Aus bestehenden Gefügen (Leistungspotentialen) entstehen reaktiv oder prospektiv, eher statisch oder sprunghaft neue, sinnhaft harmonisierte Gefüge (Beitragspotentiale). © Diese Marketing-Realisierung kann über strukturelle (implementation by structure), kulturelle (implementation by culture) und politische (implementation by policy) Prozesse erfolgen. Diese mehr oder weniger evolutionären Harmonisierungen sind Ausdruck individueller Promotionen einer visionären Führungspersönlichkeit oder ManagementGruppe im unternehmerischen Handlungsraum: 94 UZH | Marketing I Diese vielschichtigen Führungsprozesse bedürfen eines Promotors (Pümpin 1989). Dieser erkennt vielschichtige Potentiale, erschliesst und sichert sie. Das Marktpotential, die Recyclingkompetenz, die Revitalisierungsfähigkeit, die gesellschaftlichen Trends, die unternehmerische Vermögenssituation («Kriegskasse») sind beispielhafte externe und interne Potentiale. Ein Promotor ist Träger und Präger von Strukturen, Kulturen und Politiken. Er verpflichtet die Mitarbeiter zum Handeln (managing values). Er macht aus «Mitläufern» «Führer» (pathfinders) (Leavitt 1986). Solche Multiplikationen schaffen langfristige unternehmerische Wettbewerbsvorteile. Ängste, angestammte Denkstrukturen, Gewohnheiten Karrierechancen oder Selbstgenügsamkeit führen oft bei Führungskräften und Mitarbeitern zu fehlenden Multiplikationen, zu fehlender Dynamik. Die Implementierung des Marketing ist eine endlose Metamorphose, die sich zeitweise auf einem von Individuen akzeptierten Anspruchsniveau stabilisiert. Einzelne sind aktive Träger dieser Veränderungen, andere Betroffene, Beobachter. Die individuelle Lernfähigkeit ist die Chance der persönlichen Metamorphose: Man tut, was man tut. © 95 UZH | Marketing I MARKETING II 4. Marktforschung 4.1. Markt- und Marketingforschung Die Marktforschung (Marketingforschung) ist die «systematische und objektive Gewinnung und Analyse von Informationen, die zur Erkennung und Lösung von Problemen im Bereich des Marketing dienen» (Green/Tull 1982). Sie stellt Informationen für notwendigerweise zukunftsorientierte Entscheidungen bereit (Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1988). Dabei gilt es, die Marktdimension «Wahrnehmung» durch die anbietende Unternehmung zu überwinden, d.h. dem Management die entscheidungsnotwendigen Marktund Umweltkenntnisse zu verschaffen. Die Marktforschung hat daher die folgenden Aufgaben: Erkennen von Risiken (Frühwarnung), Antizipieren von Chancen (Innovation), Selektieren und Aufbereiten von Informationen und systematische Problemlösung (Strukturierung) (Meffert 1986). Wir können die folgenden Begriffsinhalte unterscheiden: © Wir verwenden die Begriffe «Marktforschung», «Marketingforschung» und «Sozialforschung» synonym und sehen die Marktforschung als eine umfassende Auseinandersetzung mit den Marketingaktivitäten, dem Markt (Kunden, Lieferanten, Wettbewerber) und der Umwelt (Ökologie, Politik, Technologie u.a.). Das Management erreicht eine hohe Kundennähe, indem es die Kunden aktiv in die Marktforschung integriert: Die Domino's Pizza Inc, Ann Arbor, Mich., entschädigt beispielsweise ausgewählte Kunden (mystery shopper, silent shopper), die eine Pizza konsumieren und anschliessend der Unternehmung ihre Meinung mitteilen. 96 UZH | Marketing II Bei Investitionsgütern sind spezifische Kundenbefragungen, unaufgeforderte Kundenmeinungen (Beschwerden, Reklamationen), Konkurrenzbeobachtungen und Verkäufe über Vertretungen die bedeutendsten Informationsquellen (Shanklin/Ryans 1985). Die systematische Informationsgewinnung und -analyse ist wesentlich, • • • • • • wenn eine Tendenz zum Angebotsüberschuss besteht, die Kapazitäten ungenügend ausgelastet sind, der Markt völlig frei, anonym oder unruhig ist, die abgeleiteten (sekundäre) Bedürfnisse eine wesentliche Rollespielen, die Unternehmung keinen technischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz hat, die Marketingkosten bedeutend sind, die Konkurrenz intensiv ist und/oder die Markterfahrung fehlt (Angehrn 1973). Um problemlösungsgerechten Informationen zu erhalten, muss ein spezifisches Marketing-Problem, beispielsweise «sinkender Marktanteil», in ein Marktforschungsproblem, beispielsweise «Einkaufsverhalten» übersetzt werden. Die Resultate der Marktforschung müssen wiederum für die konkreten Marketing-Problemlösungen kommuniziert, umgesetzt, rückübersetzt werden. Der Marktforscher hat sich dabei vom Informationslieferanten zum Chancenschnüffler zu entwickeln (Wessner 1989). © Wir unterscheiden die folgenden Formen der Marktforschung: Die Gliederung dieser Formen nach dem Untersuchungsdesign - welche Informationen sind aus welchen Quellen und durch welche Verfahren zu beschaffen - führt zu folgenden Arten von Designs (Green/Tull 1982): 4.1.1. Explorative Studien Problemerkennung, Problemformulierung, Formulierung von Handlungsalternativen mittels Befragung von Experten, Sekundärforschung, Sonderformen (Analogien, Fallstu97 UZH | Marketing II dien, Pilotstudien), beispielsweise: «Welche Kundenbedürfnisse sind durch unsere Produkte noch nicht abgedeckt?» 4.1.2. Deskriptive Studien Beschreiben von Markt-, Unternehmungs- und Umweltphänomenen mittels Befragung, Beobachtung, Sekundärforschung, Sonderformen (Experiment, Simulation), beispielsweise: «Welche Kunden benutzen mehr als dreimal wöchentlich ein öffentliches Verkehrsmittel?» 4.1.3. Kausalanalytische Studien Erklärung von Ursachen, Wirkungen mittels Sonderformen (kontrolliertes Experiment, quasi-experimentelle Anordnung), beispielsweise: «Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Kundenzufriedenheit und dem Markenimage?» © 4.2. Phasen der Marktforschung Jede Marktforschung lässt sich als Problemlösungsprozess in die folgenden Phasen gliedern (Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1988): 1. DefinitionsphaseProblemdefinition und -strukturierung, Festlegen der Erhebungsziele. 2. Designphase Aufbau des Projektes, Bestimmung der Erhebungsmethode und einheiten, Probeerhebung (Pretest), Erhebungsplan (Zeit, Kosten). 3. Feldphase Organisation, Durchführung und Kontrolle der Datenerhebung. 4. Analysephase Vorprüfung und Auswertung der Erhebung, Interpretation der Ergebnisse. 5. Kommunikationsphase Abfassung des Berichts, Präsentation und Umsetzung (Implementierung) der Ergebnisse. Wesentliche unternehmerische Rahmenbedingungen jeder Marktforschung sind das Beschaffungsbudget, die Beschaffungszeit für die Informationen (Suchzeit), das Anspruchsniveau an die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Informationen (Anspruchsni98 UZH | Marketing II veau) sowie der geforderte Entsprechungsgrad der Marktforschungsinformation zum Marketing-Problem (Problementsprechung) (Hasenauer/Scheuch 1974). 4.3. Primärforschung Die Unterscheidung in primäre und sekundäre Marktforschung beruht auf der Gliederung nach den Methoden der Datengewinnung: Wenn das Datenmaterial, das ursprünglich für andere Zwecke gewonnen und aufbereitet worden ist, für die aktuelle Problemlösung nicht genügt, muss dazu eine eigens konzipierte Untersuchung, eine Primärforschung durchgeführt werden. Bei der Primärforschung spricht man bei kleinen Fallzahlen von qualitativer (psychologische Marktforschung, Motivforschung), bei hohen Fallzahlen von quantitativer Marktforschung. Gegenstand einer quantitativen Marktforschung sind alle Marktpartner (Vollerhebung) oder ein Teil davon. © Teilerhebungen (Stichprobe) können repräsentativ oder nicht repräsentativ (willkürlich) sein. Die repräsentative Auswahl einer Stichprobe (Sample) aus der sachlich, räumlich und zeitlich abgegrenzten Grundgesamtheit (Universum) kann zufällig oder nach einer bewussten Auswahl erfolgen. Wir können zwei Hauptgruppen von Auswahlverfahren unterscheiden (Berekoven/Eckert/Ellenrieder 1986): 4.3.1. Zufallsauswahl Das reine Zufallsverfahren wird durch das sog. Urnenmodell (Lotterieauswahl) versinnbildlicht: Jedes Element, das in die Stichprobe eingeht, wird unmittelbar aus der Grundgesamtheit gezogen. Liegt diese vollständig vor, so hat jedes Element die gleiche Chance (Wahrscheinlichkeit), in die Stichprobe zu gelangen. Dadurch ist die Repräsentanz der Stichprobe (theoretisch) gewährleistet und der Zufallsfehler (Stichprobenfehler) berechenbar. Die Anwendung des Verfahrens setzt identifizierbare Elemente (Karteikarte, Namenliste u.ä.) und eine hundertprozentige Ausschöpfung der Stichprobe voraus. Von den systematisch ausgewählten Untersuchungspersonen, beispielsweise jede zehnte auf einer Adressliste, sind jedoch nie alle erreichbar, andere verweigern die Auskunft (nonresponse-problem). Wenn die Berechnung des Zufallsfehlers aufrechterhalten werden soll, dürfen diese einmal ausgewählten, dann ausgefallenen Personen nicht nachträglich durch neu ausgewählte ersetzt werden. Die Gliederung einer insgesamt heterogenen Grundgesamtheit, beispielsweise des Universums «Einzelhandel», in mehrere homogene, einander ausschliessende Untergrup99 UZH | Marketing II pen (Schichten), beispielsweise Supermarkt, Discount, «Lädeli», ermöglicht eine geschichtete Zufallsauswahl (stratified sampling) und eine grössere Genauigkeit. Die Unterteilung der Grundgesamtheit, beispielsweise «Stadtquartier», in «natürliche» Klumpen (cluster) wie Strassenzüge, ist eine Klumpenauswahl (cluster sampling) und führt zu einer höheren Effizienz in der Marktforschung (Zeit- und Wegersparnis). Werden mehrere Auswahlverfahren hintereinandergeschaltet, liegt ein mehrstufiges Verfahren vor. Den Vorteilen der Zufallsauswahl, die Berechenbarkeit des Zufallsfehlers wie die Vermeidung grober Verzerrungen, stehen die relativ hohen Planungs- und Durchführungskosten insbesondere bei den oft notwendigen grossen Stichproben (Ausfallfehler) sowie die fehlende Substituierbarkeit der einmal ausgewählten Elemente als Nachteile gegenüber (Hamman/Erichson 1990). 4.3.2. Bewusste Auswahl Die Verfahren der Zufallsauswahl (Random-Verfahren) basieren auf Zufallsmechanismen. Bei den Verfahren der bewussten Auswahl wird das Sample nach problemrelevanten Kriterien konstruiert. © Eine gängige Methode ist das Quota-Verfahren. Dabei geht man von der Kenntnis der untersuchungsrelevanten Merkmale (Alter, Beruf, Geschlecht, Wohnort usw.) und deren Ausprägung sowie ihrer relativen Verteilung (Quote) in der Grundgesamtheit aus (Meffert 1986). Mittels der vorgegebenen Quoten versucht man, eine Strukturgleichheit der Stichprobe mit der Grundgesamtheit zu erreichen und setzt dabei die Kenntnis der relevanten Merkmale der Grundgesamtheit voraus. Ist beispielsweise für die Grundgesamtheit «Leser» bekannt, dass 90 % Frauen und 10 % Männer sind, so wird man bei einer Stichprobe von 100 Personen 90 Frauen und 10 Männer auswählen. Zur Erreichung einer solchen Teilauswahl wird dem Interviewer eine Quotenanweisung - Anzahl Interviews 20, Anzahl Frauen 18, Anzahl Männer 2 - vorgegeben und er wählt die Auskunftspersonen selbst aus. Für das Quota-Verfahren spricht, dass es relativ kostengünstig, schnell und flexibel ist; nachteilig sind nicht einfache Auswahl geeigneter Quotenmerkmale, die möglichen Verzerrungen durch die Ausfälle, die Verweigerungen und die Interviewer. Diese bevorzugen möglicherweise leicht erreichbare Personen und halten somit die Quotenvorgabe nicht ein. Mögliche Fehler einer Stichprobe sind einerseits die Zufallsfehler – sie streuen gleichmässig um einen richtigen Wert, so dass sie sich per Saldo ausgleichen – und andererseits die systematischen Fehler. Diese verteilen sich nicht gleichmässig um die wahren Werte, sondern konzentrieren sich in einer bestimmten Richtung, beispielsweise 100 UZH | Marketing II durch falsche Definitionen der Grundgesamtheit, falsche Quoten, suggestive Frageformen des Interviewers, unpräzise Antworten der Probanden und verfälschen damit die Marktforschungsresultate. 4.4. Sekundärforschung Da Sekundärforschung bereits vorhandene Daten (desk research) analysiert, ist sie kostengünstig und erlaubt ein relativ schnelles Vorgehen. Sie lässt sich nach der Herkunft der internen und externen Informationen, sei es via Personen (persönliche Netzwerke), gedruckte oder elektronische Medien, gliedern: © Die Speicherung der Daten in einer computergestützten, gewarteten Datenbank (Datawarehouse) erlaubt eine rasche Informationsbeschaffung und unterstützt die Datenanalyse (Data Mining). Die Möglichkeiten unternehmungsinterner Marketinginformationssysteme (MAIS) sind mit externen Online-Datenbanken (Internet u.a.) wesentliche erweiterbar 101 UZH | Marketing II 4.5. Erhebungstechniken Bei der primären Marktforschung ist zusätzlich zwischen den verschiedenen Erhebungstechniken als mögliche Marktforschungsmethoden zu unterscheiden: © 102 UZH | Marketing II 4.5.1. Befragung Mit einer Befragung (Umfrage) versucht der Fragesteller, Personen zu Aussagen über bestimmte, vorgegebene Sachverhalte zu veranlassen. In der Schweiz wie in Schweden erfolgen 47 % aller Befragungen telefonisch, in Deutschland und in Frankreich hat diese Befragungsform je einen Anteil von 20 % (Demby 1990). Mögliche Gliederungen der Befragung: 1. nach dem Standardisierungsgrad: standardisierte, teil- und nichtstandardisierte Befragung, 2. nach der Art der Fragestellung: direkte und indirekte Befragung, 3. nach der Befragungshäufigkeit: einmalige und mehrmalige Befragung (Panel), 4. nach dem Befragungsgegenstand: Einthemen- und Mehrthemenbefragung (Omnibusbefragung), 5. nach dem Befragtenkreis: Individuen oder Organisationen, 6. nach der Kommunikationsform: computergestützte, mündliche, schriftliche oder telefonische Befragung. Es ist daher verständlich, dass sich viele Bemühungen darauf richten, die Befragungsmethoden zu optimieren und auch zu automatisieren. Lösungen sind computergestützte Befragungssysteme, insbesondere bei Telefoninterviews (computer-aided telephone interview CATI), und Bildschirmbefragung (computer-aided personal interview CAPI), bei denen die Fragen im Dialog über ein Bildschirmgerät gestellt und die Antworten direkt eingegeben werden. © Neben diesen Offline-Entwicklungen sind die Online-Möglichkeiten im E-Commerce zu prüfen. Neben passiven Ergebniskontrollen (Ad Clicks, Hits, Page Views u.a.) sind aktive Ergebniskontrollen wesentlich: Online-Erhebungen (Einstellungen gegenüber Internetangebot u.ä.), Expertenbefragungen (Qualität Internetauftritt u.ä.) oder Experimente (Wirkung unterschiedlicher Bannerwerbung u.ä.). Die in einem Fragebogen formulierten Fragen sollten einfach, eindeutig und neutral sein. Sie sind offen oder geschlossen bzw. direkt oder indirekt. Dabei prägen vier Fragegruppen den Aufbau eines Fragebogens (Berekoven/Eckert/Ellenrieder 1986): 1. 2. 3. 4. Einleitungsfragen (Kontakt-, Eisbrecherfragen) Sachfragen Kontrollfragen, Plausibilitätsfragen Fragen zum Befragten (Person, Unternehmung) Die schriftlichen Befragungen kranken oft an mangelhaften Rückläufen, geringer Rücklaufgeschwindigkeit und schlechter Rücklaufqualität (Abwesenheit des Adressaten, antwortunfähige und/oder antwortunwillige Befragte). Eine Rücklaufsteigerung wird erzielt durch schriftliche oder telefonische Vorankündigung, Begleitschreiben, Gestaltung des Fragebogens (Farbe, Format, Länge), frankierten Rückumschlag, Erinnerungsschreiben und die eher wirkungsschwachen Gewinnanreize (Brieföffner, Verlosungen usw.) (Schmalen 1989). 103 UZH | Marketing II 4.5.2. Panel Die einmalige Befragung ermöglicht die Marktanalyse («Foto»), aber keine Marktbeobachtung: Veränderungen über die Zeit («Film») sind nur mittels mehrmaligen Befragungen beobachtbar. Werden solche Befragungen in regelmässigen Abständen zum gleichen Untersuchungsgegenstand (Endverbraucherabsatz, Einkaufsmengen, Werbeausgaben usw.) bei einer repräsentativen permanenten Stichprobe durchgeführt, liegt ein Panel vor. Mit dieser quasi-experimentellen Versuchsanordnung, es liegt keine Einflussnahme auf die Untersuchungsbedingungen vor, können Marktveränderungen festgestellt werden. Dabei können wir zwischen Verbraucherpanel (Individualpanel, Haushaltspanel), Spezialpanel (Berufsgruppen, Medien, Unternehmungen) und Handelspanel unterscheiden. Jedes Panel unterliegt den negativen Effekten der Ermüdung (nachlassendes Interesse führt zu unpräzisen Angaben, Eintragungen), der Sterblichkeit (Teilnehmer scheiden aus, die Repräsentanz verändert sich), des Bewusstseins (Checklisten-Effekt, Eintragungen führen zum bewussten Kaufverhalten, Overreporting) wie der Erstarrung (PanelMerkmale entwickeln sich nicht wie die Grundgesamtheit). 4.5.3. Test © Im Gegensatz zum Panel liegt beim Produkt- und Markttest ein kontrolliertes Experiment vor, da der Experimentator die Untersuchungsbedingungen steuert. Beim Produkttest wird einer ausgewählten Gruppe von Personen (Testsubjekt) ein Produkt (Testobjekt) zum probeweisen Gebrauch/Verbrauch vorgelegt oder überlassen. Mögliche Gruppen von Produkttests sind: (1) Warentest (objektive Qualität), Konzepttest (subjektive Beurteilung); (2) Blindtest (neutrales Testprodukt); (3) Partialtest (einzelne Produktmerkmale), Volltest (ganzes Produkt); (4) simultaner, alternierender oder sukzessiver Vergleichstest (mehrere Produkte); (5) Eindruckstest (Kurzzeittest), normaler Erfahrungstest, extensiver Erfahrungstest (Langzeittest); (6) Feldtest (Markttest), Labortest. Beim Markttest hat der regionale Markttest bis heute die grösste Bedeutung. Bei einem solchen Markttest werden im Rahmen eines weitgehend kontrollierten Feldexperimentes Produkte probeweise in einem regional begrenzten Teilmarkt angeboten, um so Marktchancen (Abverkäufe, Einkaufsintensität, Einkaufs- oder Sortimentsverbund, Erst-und Wiederkaufsraten, Käuferstruktur, Medienwirkung, Umschlagsgeschwindigkeit) realitätsnah zu überprüfen. In der deutschsprachigen Schweiz wurde hierzu der «Testmarkt Langenthal» geschaffen: Die Kaufkraft entspricht dem schweizerischen Durchschnitt, der Ort verfügt über jene Ladengeschäfte, in denen üblicherweise eingekauft wird, das Marktgebiet ist relativ abgeschlossen und ein Drittel aller Haushaltungen nehmen mittels Identifikationsnummer an den Tests teil (Witprächtiger 1989). Entwicklungen wie Strichcodes, beispielsweise die Europäische Artikelnumerierung EAN, «intelligente» Kreditkarten, Kabelfernsehen, Scanner (optische Lesegeräte), Vide104 UZH | Marketing II otex (Bildschirmtext BTX) und Internet ermöglichen die Erschliessung umfassenderer Marketing-Daten, ihre verfeinerte Analyse und den Aufbau von elektronischen Minimarkttests. Bei einem elektronischen Minimarkttest wird in einem regional begrenzten, hinsichtlich der Kaufkraftströme und Medienreichweiten möglichst abgeschlossenen Gebiet, ein repräsentatives Haushaltspanel und ein auf der Basis elektronischer Kassensysteme arbeitendes Handelspanel installiert. Dabei erfolgt die haushaltsindividuelle Erfassung der Einkäufe der Panelteilnehmer direkt in den Testgeschäften mittels maschinenlesbaren Identifikationskarten (Stoffels 1989). Diese Kombination von Handels- und Haushaltspanel am Verkaufspunkt (point of sales) findet beispielsweise im «Targetable-TV-System» seine Ergänzung: Im «GfKBehavior-System» des Testmarktes «Hassloch» (Ludwigshafen/Vorderpfalz) ermöglicht diese Technik die gezielte Ansprache des einzelnen verkabelten Haushaltes, da innerhalb der regulär ausgestrahlten Werbesendungen bei einer Gruppe von Haushaltungen (Testgruppe) gezielt einzelne Werbespots durch Testspots elektronisch überblendet werden (cut in), während die unverkabelte Gruppe (Kontrollgruppe) weiterhin den regulären Spot erhält. So können die Wirkungen der Werbebotschaften und -medien (nur TV, nur Print, TV und Print) umfassend untersucht werden. Bei dieser Datenvielfalt sind die Gefahren eines Missbrauchs («gläserner Kunde») nicht von der Hand zu weisen. 4.5.4. Beobachtung © Äusserlich wahrnehmbare Reaktionen werden mittels Beobachtung durch Personen und/oder Apparate, beispielsweise Blickaufzeichnung, gewonnen. Die einzelnen Tatbestände sind in der jeweiligen Situation einmalig (Produktwahl, Lesen einer Zeitschrift usw.); weiss die einzelne Person um das Beobachtetwerden, so ändert sie möglicherweise ihr Verhalten (Beobachtungseffekt). Einstellungen, Motive, Werte lassen sich dabei nur auf dem Wege des Rückschlusses oder mittels separater Befragung erfassen. 4.5.5. Durchführung der Erhebung Bei der Auswahl der Erhebungstechniken sind, neben den Gütekriterien der Objektivität, der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und der Validität (Gültigkeit), zusammenfassend die folgenden Fragen zu beantworten (Wyss 1989): 1. 2. 3. 4. 5. Was ist das Problem? Welche Informationen benötigen wir zu seiner Lösung? Welche Ansprüche stellen wir an die Information? Wieviel ist uns diese Information wert? Wieviel Zeit haben wir? 105 UZH | Marketing II 6. Wenn die Information einmal vorliegt, was machen wir damit? Jede Primärforschung kann Fehler aufweisen: Auswahlfehler (Versuchsfehler), Ausfallfehler (non-response) und Auskunftsfehler bei Interviewer wie Interviewten (Ungenauigkeit durch unpräzise Formulierungen, Mehrdeutigkeit durch Interpretationen) (Green/Tull 1982). Diese Auskunftsfehler lassen den Schluss zu, dass die Befragten manchmal lügen. 4.6. Auswertung Marktforschung Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse hat sich an den Erhebungszielen der Marktforschung zu orientieren. Die Aufbereitung und Auswertung der erfassten Datenmengen ist Gegenstand der beschreibenden (deskriptiven) Statistik mit ihren univariaten Verfahren (Analyse einer Variablen, beispielsweise «Alter»), bivariaten Verfahren (Analyse der Beziehungen von zwei Variablen, beispielsweise «Alter» und «Einkommen») und multivariaten Verfahren (Analyse der Beziehungen von drei und mehr Variablen, beispielsweise «Alter», «Beruf», «Einkommen» und «Geschlecht»). Mögliche Anwendungsbereiche multivariater Verfahren sind (SchuchardFicher/Backhaus/Humme/Lohrberg/Plinke/Schreiner 1982): © • Varianzanalyse Hat die Art der Verpackung einen Einfluss auf die Absatzmenge? Hat die Farbe einer Anzeige einen Einfluss auf die Zahl der Personen, die sich an die Werbung erinnern? • Regressionsanalyse Wie verändert sich die Absatzmenge, wenn die Werbeausgaben um 10 % gekürzt werden? Wie lässt sich der Preis für Aluminium in den nächsten sechs Monaten schätzen? • Clusteranalyse Lassen sich die Kunden eines Warenhauses entsprechend ihrer Bedürfnisse in Gruppen einteilen? Gibt es bei Zeitschriften verschiedene Lesertypen? • Diskriminanzanalyse In welcher Hinsicht unterscheiden sich Raucher von Nichtrauchern? Welche Merkmale von Aussendienstmitarbeitern tragen am besten zu ihrer Differenzierbarkeit in Erfolgreiche und Erfolglose bei? • Faktoranalyse Lässt sich die Vielzahl der Eigenschaften, die Käufer von Autos als wichtig empfinden, auf wenige komplexe Faktoren reduzieren? Wie lassen sich, darauf aufbauend, 106 UZH | Marketing II die verschiedenen Automarken anhand dieser Faktoren beschreiben? • Multidimensionale Skalierung Inwieweit entspricht das eigene Produkt den Idealvorstellungen der Konsumenten? Welches Image besitzt die Unternehmung? Diese Verfahren (Backhaus/Erichson/Plinke/Schuchard-Ficher/Weiber 1989, Kinnear/Taylor 1985) werden von Statistikprogrammen wie SAS™ oder SPSSx ™ umfassend unterstützt. Die Ergebnisse der Marktforschung sollten anschaulich, nachvollziehbar, überschaubar und vollständig dem Adressaten in der folgenden Gliederung vermittelt werden: (1) Problem, (2) Methode, (3) Ergebnisse, (4) Diskussion und (5) Zusammenfassung der Untersuchung (Bortz 1984). 5. Produktpolitik 5.1. Produkt © Das Produkt ist ein Bündel von materiellen und immateriellen Leistungen. Es sind konkretisierte Problemlösungen für einen Kunden: «A product is what the buyer thinks it is, not what the seller thinks it is» (Markin 1979). Produkte für Endkunden verstehen wir als Konsum- oder Gebrauchsgüter (Letztverwendung). Produkte, welche weitere Leistungen erstellen bzw. ermöglichen (Weiterverwendung) sind Investitionsprodukte(Industriegüter), sei es in der Form von Einzelaggregaten, Komponenten (original equipment manufacturer), Systemen oder Anlagen. Der Produktkern ist die eigentliche Problemlösung (Primärleistung): «Befördern», «Informieren», «Leuchten» oder «Unterhalten» u.a. Die ästhetischen, physikalischen, funktionalen, ökologischen und symbolischen Eigenschaften sind die Zusatzelemente; Kundendienst und Beratung die Zusatzleistungen. Der gesamte Produktnutzen besteht daher aus einem Grundnutzen und verschiedenen Zusatznutzen. So ergeben sich für jedes Produkt die folgenden Gestaltungs- und Differenzierungsmöglichkeiten (Dichtl 1987): Die skizzierte Produktsicht geht von einem Produktkern aus, den es zu erweitern gilt. Diese Möglichkeiten der Differenzierung beinhalten für die einzelne Unternehmung ein hohes Potential zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch eine kunden- und mitbewerberorientierte Unterscheidung der Leistung. Eine um107 UZH | Marketing II fassendere Differenzierung ermöglicht die Modularisierung der Leistung (Mass Customization) und die Entwicklung affiner immaterieller Leistungsbündel (value-addedservices). Diese können durch Emotionalisierungen (emotional selling proposition) verstärkt werden. © Demgegenüber kann eine hohe Standardisierung der Produkte (make-to-stock company) zu einem geringeren Potential, somit zu Wettbewerbsnachteilen führen (Bühner 1988): 108 UZH | Marketing II Bei vielen Produkten ist die objektive Grenze der (technischen) Steigerungsfähigkeit nicht erreicht. Der Kunde will jedoch diese Grenze nicht nutzen, da eine weitere Steigerung im Sinn von Zusatzleistungen für den Kunden ohne Wert ist. Das Konzept «Kundenwert» stellt daher diese klassische Differenzierungsidee insofern in Frage, als es nicht den Produktkern (core product), sondern den Kundenwert (customer value) in den Mittelpunkt stellt. Beiträge für diesen Kundenwert liefern beispielsweise das Produkt, die Logistik, die Ökologie, der Preis, die Servicegeschwindigkeit und die Werbung (Marketing-Mix). © Die Möglichkeiten von E-Commerce führen zu einer verstärkten Dematerialisierung von Produkten: Informationen und Wissen werden zu tragenden Bezugsgrössen für Kunden und Wettbewerber. Gleichzeitig verstärkt das Zusammenspiel von technischen Innovationen (technology push) und marktlichen Ansprüchen (market pull) die Innovationsgeschwindigkeit im E-Business. 5.2. Qualität Die Qualität ist der Grad der Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck (Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1988). Die Qualität eines Produktes kann von der Qualität seiner Erstellung (Prozessqualität) nicht losgelöst werden. 109 UZH | Marketing II 5.2.1. Qualität verstehen In Markt und Umwelt sind immer objektive Leistungselemente mit subjektiven Erwartungen verknüpft: Der objektiven oder technischen Qualität steht die subjektiv wahrgenommene oder kundenbezogene Qualität gegenüber. Die Positionierung eines Produktes hat in diesen Wahrnehmungsräumen zu erfolgen. Die Qualität ist daher immer eine relative Grösse und kann mit folgenden Dimensionen charakterisiert werden (Garvin 1987): • • • • • • • • • Gebrauchsnutzen (Produktgrundfunktionen) Ausstattung (Zusatzleistungen) Zuverlässigkeit (Ausfallwahrscheinlichkeit, Wartungszeiten) Normgerechtigkeit (Einhalten von Sollwerten, Zertifizierungen) Haltbarkeit (Garantieleistungen, ökonomische, ökologische und technische Lebensdauer) Kundendienst (Geschwindigkeit, Höflichkeit, Kompetenz) Ästhetik (Aussehen, Geschmack, Geruch, Lärm) Image (Einstellungen, Erfahrungen, Vorstellungen) Diese Grunddimensionen sind mit Aspekten wie Zeit (Erhältlichkeit), Moral (Bescheidenheit, Fairness) (Edosomwan 1988) und Ökologie (Recycling) ergänzbar. In einer gesamtheitlichen Sicht durchdringt die Qualität sämtliche Bereiche bzw. Funktionen (Wertschöpfungskette) einer Unternehmung, ihrer Lieferanten, Absatzmittler und Endkunden. Dies erfordert eine durchgängige Produkt- und Prozessqualität. © Bei Gebrauchsgütern zeigt sich die Rolle der Qualität als Entscheidungskriterium in verschiedenen Facetten, sei es in den bisherigen Erfahrungen, im Gebrauch oder bei Serviceleistungen: 110 UZH | Marketing II 5.2.2. Qualität umsetzen Die Umsetzung der Qualität ist Gegenstand von Konzepten und Programmen (Six Sigma u.a.) wie dem Total Quality Management (TQM) als tragendem Ausdruck unternehmerischer Kulturen (commitment, empowerment), Prozesse und Strategien. Es erfordert gleichzeitig die stimmige interne Koordination (Forschung und Entwicklung, Produktion u.a.) und die Integration von Lieferanten und Kunden (Co-opetition, ECR, Just In TimeKonzepte u.a.). © Die Qualität prägt die Kundenzufriedenheit, langfristig die Kundenbindung. Die Kundenzufriedenheit ist das Ergebnis eines Vergleichsprozesses des Kunden zwischen seinen Erwartungen (Anspruchsniveau, Leistungsversprechen u.a.) und der wahrgenommenen Leistung (Erfahrungen, Involvement u.a.). Die Zufriedenheit zeigt sich in der Kundenbindung, der Loyalität, der Mund zu Mund-Werbung und den relativ stabilen Kundenbeziehungen. Die Unzufriedenheit konkretisiert sich in Abwanderung zur Konkurrenz, in Beschwerden (Reklamationen), in der Diffusion der Unzufriedenheit gegenüber anderen Kunden und Wettbewerbern. Der unzufriedene Kunde kann jedoch auch keine Reaktion zeigen. Die Hauptursachen von Kundenbeschwerden aufgrund einer Studie im deutschen Facheinzelhandel sind Produktmängel. Die prozessualen Schwierigkeiten der Reklamation liegen in der Geschwindigkeit ihrer Behandlung durch den Hersteller (BBE 2001). 111 UZH | Marketing II 5.2.3. Qualität messen Die Kundenzufriedenheit kann mittels objektiver Verfahren (Abwanderungsrate, Retention Rate u.a.) und subjektiver Verfahren (Ereignissen, Merkmalen u.a.) gemessen werden (Controlling). © Ein Instrument ist das Benchmarking als systematischer Leistungsvergleich: Unternehmerische Leistungen und Prozesse sind anhand Vergleichsgrössen bzw. -objekten zu evaluieren. Neben internen Vergleichen (internal benchmarking) und Branchenvergleichen (competitive benchmarking) ist ein Vergleich mit branchenfremden Unternehmungen (best-in-class-benchmarking), auch beispielsweise im Rahmen eines Kundenbarometers, sehr lehrreich (Wissensmanagement). 112 UZH | Marketing II Durch die Institutionalisierung eines Beschwerdemanagement sind Informationen systematisch erfassbar. Sie zeigen Chancen der Leistungsverbesserung, sofern diese in der gesamten Wertschöpfungskette kommuniziert werden. Voraussetzungen sind technische Systeme (Data Warehouse, Rechnungswesen u.a.), einfache Strukturen (kurze Kommunikationswege, Zugriff auf Kundendaten) und eine entsprechende Kultur (internes Marketing). © 113 UZH | Marketing II 5.3. Produktlebenszyklus Jedes Produkt durchläuft in seinem «Leben» verschiedene Phasen, die man idealtypisch gliedern kann, jedoch nicht eindeutig abgrenzbar sind: © Die einzelnen Phasen, sie werden grundsätzlich vom Markt, der Branche und den Marketing-Aktivitäten für das Produkt geprägt, lassen sich wie folgt charakterisieren (Siegwart 1974): Die Phasenlängen können sehr verschieden sein: Neben hochmodischen Produkten einer Saison, beispielsweise Rollschuhe (roller skates), finden wir «alte» Produkte, welche immer noch «leben»: die grüne American-Express-Karte, die Kamera von Leica, die Bausteine von Lego, die Märklin-Eisenbahn, das «Meisterstück» von Montblanc, das Mundwasser von Odol, die Nivea-Creme, der Porsche 911, das TempoTaschentuch, der Uhu-Alleskleber, das Zippo-Feuerzeug oder der Flügel von Steinway. 114 UZH | Marketing II © Neben dem Produkt sind die Branche, ein Geschäftsfeld oder die Marke weitere Bezugsgrössen für das Konzept «Lebenszyklus». Es ist jedoch von beschreibender Natur und wird von den jeweiligen Marketing-Aktivitäten und dem Kontext (Markt, Technologie 115 UZH | Marketing II u.a.) nachhaltig beeinflusst. Es hat jedoch keine Allgemeingültigkeit, keine eindeutig abgrenzbare Phasen und drückt keine Gesetzmässigkeit aus. Die geplante Veralterung eines Produktes bezeichnet man als Obsoleszenz, sei es aufgrund qualitativer (Sollbruchstellen), technischer (fehlende Innovation) oder psychischer Elemente (Mode). Demgegenüber dient eine Produktveränderung (Produktvariation) mittels Design, Dienstleistung u.a. der Anpassung an Marktveränderungen (Endkunde, Handel). Umfassendere Veränderungen (Modifikationen) eines am Markt eingeführten Produktes sind Gegenstand eines Relaunch. Wird ein bestehendes Produkt aus unternehmungsinternen oder -externen Gründen (Deckungsbeitrag, Industrienorm, Image, Qualität, Markt, Sortiment) nicht mehr angeboten, so liegt eine Produkteliminierung (Demarketing) vor. Diese ist Teil einer Analyse der Altersstruktur eines Sortiments, beispielsweise mittels einer ABC-Analyse hinsichtlich Umsatz/Produktalter (Kennzahlen). Ein Produkt kann jedoch trotz unterdurchschnittlichem Erfolg dann weitergeführt werden, wenn es die Funktion eines Lockartikels hat, der Handel ein umfassendes Sortiment erwartet (Listung), die Unternehmung über freie Kapazitäten verfügt oder im Produkt Abfallstoffe verarbeitet werden (Hill/Rieser 1990). Eine Eliminierung hat jedoch insbesondere dann zu erfolgen, wenn moralische, ökologische oder rechtliche Gründe eine Produktweiterführung verunmöglichen. 5.4. Dienstleistung © Die enge Verzahnung von Dienstleistungen und Sachgütern verhindert eine eindeutige Abgrenzung und Systematisierung: Wir finden in Dienstleistungen stets Sachleistungen und in Sachgütern stets Dienstleistungselemente. Dieses Kontinuum von Produkt- und Serviceorientierung kann kriterienhaft verdeutlich werden: Die Erstellung von Dienstleistungen ist meist eine Kombination interner und externer, materieller und immaterieller Produktionsfaktoren. Dabei kann der Aktivitätsgrad des Anbieters oder des Nachfragers gesteigert werden: Internalisierung- bzw. Externalisierung der Leistungserstellung (Co-Design, Prosumer). 116 UZH | Marketing II Die Erstellung einer Leistung erfolgt eher kontinuierlich (continuos delivery of service), beispielsweise Autoclub oder Versicherung, oder diskret (discrete transactions), zum Beispiel Autoverleih oder öffentliche Verwaltung. Dabei ist der Prozess berührbar (tangible), beispielsweise die Müllabfuhr, oder unberührbar (intangible) wie die Ausbildung. Die Besonderheiten von Dienstleistungen sind insbesondere: 1. 2. 3. 4. die Unmittelbarkeit: Herstellung und Verbrauch fallen zeitlich meist zusammen. die Nichtgreifbarkeit: mehrheitlich kein physisches Produkt die Beziehung: oft persönliche Beziehungen (people-based service) die Kundenbeziehung: grundsätzlich direkte Beziehung, ausser beim Einsatz von technischen Mitteln (equipment-based service) 5. die Kundenbeteiligung: Der Nachfrager ist oft an der Erstellung der Dienstleistung beteiligt (Co-Design, Prosumer). 6. die schwierige Standardisierung: Der Kunde wünscht eine individualisierte Leistung welche aus Kostengründen oft nicht erbracht werden kann und Leistungsstandardisierungen bedingt. 7. die räumliche Bindung: Die Leistungserbringung erfolgt dort, wo sich der Kunde befindet. © Dienstleistungen sind daher meistens doppelt individuell, da sie sowohl für den Anbieter wie Nachfrager individuelle Leistungen (Problemlösungen) darstellen. Ebenso ist der Kunde oft in den Erstellungsprozess, somit in den Erfolg und die Qualität der Dienstleistung, integriert, sei es physisch (Skigymnastik), intellektuell (Schulung) oder emotional (Beratung). Dem Nachfrager obliegt damit eine Doppelfunktion als Prosumer (producer and consumer) (Normann 1987). Eine Problemlösung, beispielsweise «Sicherheit», kann von einer privaten Unternehmung (Bewachungsdienst), einer staatlichen Organisation (Polizei) oder einer Privatperson (Hauswart) wahrgenommen werden. Diese originären Dienstleistungen führen zu einer möglichen Kategorisierung der Dienstleistungsbranche (service industrie): Individual Services (Hotel, Makler, Reisebüro, Restaurant usw.), Office Service (Catering, Rechtsanwalt, Unternehmungsberater usw.) und Public Service (Feuerwehr, Forschungsinstitut, Militär usw.) (Yamamoto 1986). Neben den originären Dienstleistungen (Kerndienstleistungen) finden wir Dienstleistun117 UZH | Marketing II gen auch in der Form von Zusatzleistungen, sei es zu einem physischen Produkt oder einer Dienstleistung. Diese produktbegleitenden (funktionellen) Dienstleistungen dienen der Differenzierung der Kernleistung und zeigen sich beispielsweise in Ersatzteildienst, fertigungssynchroner Auslieferung (just in time), Finanzierungshilfen, Garantieleistungen, Lizenzen, Montageleistungen oder Rücknahmen (Recycling). Die resultierende Gesamtleistung ist ein komplexes Produkt (compack) mit materiellen und immateriellen Qualitäten. Einen bedeutenden Stellenwert haben Zusatzleistungen der Form «Wartung, Reparatur» bei Investitionsgütern mit oft sehr geringen Stückzahlen (Anlagegeschäft). Diese industrielle Dienstleistung zeichnet sich, von der Vorkaufphase zur Nachkaufphase beim Anlagen- und Systemgeschäft für kundenspezifische Leistungen durch folgende Ausprägungen aus: (1) technische und wirtschaftliche Beratung, (2) Projektmanagement, (3) Projektierung (Grob-)Konzept, (4) technische (Fach-)Planung eines funktionsfähigen Konzepts, (5) Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung zwecks Erreichung der Funktionsfähigkeit, (6) Garantieleistungen, Reparaturen, Service, Wartung zwecks Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, (7) Schulung, Training, um Personen mit der Funktionsfähigkeit vertraut zu machen, (8) Dokumentation. 5.4.1. Dienstleistungsqualität © Während bei Sachleistungen eine Produktbeurteilung relativ gut möglich ist (high in search qualities), sind bei Dienstleistungen Erfahrungen (high in experience qualities) und Vertrauen (high in credence qualities) tragend. Die Qualität einer Dienstleistung ist abhängig von den Potentialen des Anbieters und des Nachfragers (Potentialdimension), dem Prozess während der Leistungserstellung (Prozessdimension) und der Beurteilung der erfolgten Leistung (Ergebnisdimension). So zeigt sich beispielsweise die Servicequalität einer Bank in den Bearbeitungszeiten, in den Fehlerquoten, in der Kundenzufriedenheit, im Motivationsgrad der Mitarbeiter oder in der Verfügbarkeit des technischen Equipments. Ein umfassenderes Konzept zur Erfassung der Dienstleistungsqualität ist das GAPModell (Zeithaml/Parasuraman/Berry 1990). Die Autoren gehen von den zentralen Dimensionen der Dienstleistungsqualität aus der Kundenperspektive aus: (1) Annehmlichkeiten des materiellen Umfelds sowie Einrichtungen oder Erscheinungsbild des Personals (tangibles), (2) Verlässlichkeit der Mitarbeiter (reliability), (3) Aufgeschlossenheit und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter (responsiveness), (4) Leistungskompetenz der Mitarbeiter im Sinn von Freundlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Wissen u.a. (assurance) und (5) Einfühlungsvermögen in den Kunden (empathy). In diesem Kontext definieren die Autoren fünf Lücken (gap): 1. Diskrepanz zwischen Kundenerwartungen und deren Wahrnehmung durch das Management 2. Diskrepanz zwischen den vom Management wahrgenommenen Kundenerwartungen und deren Umsetzung in Dienstleistungsspezifikationen 118 UZH | Marketing II 3. Diskrepanz zwischen den Spezifikationen der Dienstleistungsqualität und der tatsächlich erstellten Leistung 4. Diskrepanz zwischen tatsächlich erstellter Dienstleistung und der an den Kunden gerichteten Kommunikation 5. Diskrepanz zwischen der vom Kunden erwarteten und der wahrgenommenen Dienstleistung Die Ziele eines Qualitätsmanagement können markt- und unternehmungsgerichtet sein: Die externen Ziele (Steigerung der Kundenzufriedenheit, Schaffung von Markteintrittsbarrieren u.a.) sind von den internen Zielen (Schaffung eines Qualitätsbewusstseins, Senkung der Kosten u.a.) jedoch nicht trennbar. Für eine Dienstleistungsorganisation ist daher die Erstellung von Dienstleistungen mit dem Personalmanagement(Personalbedarfsermittlung, -beschaffung, -einsatz, -erhaltung, entwicklung, freistellung) und organisatorischen Gestaltungen (Prozessorganisation, technische Hilfsmittel, Zertifizierung u.a.) aufs engste verwoben: Zufriedene Kunden (Kundenzufriedenheit) führen zu zufriedenen Mitarbeitern (Mitarbeiterzufriedenheit) und umgekehrt. Beide Zufriedenheiten steigern aufgrund von Kosteneinsparungen (geringere Fehlerkosten, tiefer Mitarbeiterfluktuation) und Mehrumsätzen (cross selling) den Gewinn. © 119 UZH | Marketing II 5.4.2. Rationalisierung Die Rationalisierungsmöglichkeiten von Dienstleistungen ergeben sich durch organisatorische Massnahmen (Arbeitszeitflexibilisierung, Selbstbedienung u.ä.), durch Veränderung der Leistungserstellung (Container, Geldautomaten, Sprachlabore u.ä.) sowie durch Einführung neuer Systemlösungen (Datenbanken, Reservierungssysteme u.ä.) (Schwenker 1989). Die Standardisierung von Dienstleistungen drückt das permanente Spannungsfeld «hohe Kundenindividualität» versus «kostengünstige Leistungserstellung» aus. Ihre Potentiale bestehen im Prozess (Standardisierung der Leistungserstellung), beispielsweise in einer vollständigen oder teilweisen Substitution des Faktors «Mensch» durch den Faktor «Maschine» (Billettautomat, Geldautomat, Reservierungssysteme, POS-Systeme u.ä.). Neben diesen automatisierten Dienstleistungen finden wir Potentiale in der Leistung an sich (Spezialisierung auf Kundengruppen, Standardisierung des Outputs). Umfassende Rationalisierungen zeigen sich, die Klärung der Kernkompetenzen vorausgesetzt, in der Übertragung von Teilleistungen auf Dritte (outsourcing). Für jedes Dienstleistungskonzept sind im Hinblick auf mögliche Wettbewerbsvorteile (Kosten, Kundennähe, Qualität) zusammenfassend die folgenden Fragen primär (Heskett 1986): • • • Welches sind die wichtigsten Leistungselemente? Wie werden diese Elemente vom Zielmarkt, vom Gesamtmarkt, von den Mitarbeitern, von Dritten aufgenommen? Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? © 5.5. Innovation Innovationen haben vielschichtige Ursachen und Folgen: Sie ziehen Imitationen nach sich und Imitationen führen zu neuen Innovationen; sie bringen Unterschiede zum Verschwinden (Auto, Jeans, Radio) und lassen die Individualität der Menschen stärker hervortreten (Automarken, Mode, Mundarten) (Albach 1989). «Innovation» ist seit den achtziger Jahren zum Modebegriff geworden; nach wie vor herrscht jedoch keine Einigkeit darüber, was «neu» bedeutet (Staudt 1985). Dynamische Märkte erfordern zur Unternehmungssicherung (Vermeidung von Wachstumskrisen) vielfältige Innovationen, seien es Produkt-, Verfahrens- oder Sozialinnovation. Jede Innovation beinhaltet die Merkmale • • «Neuigkeitsgrad», «Unsicherheit» (Marktrisiko, Produktionsrisiko, finanzwirtschaftliches Risiko), «Komplexität» und 120 UZH | Marketing II • «unternehmerischer Konfliktgehalt» (Wohinz 1983). 5.5.1. Produktinnovation Eine Innovation, «if the idea seems new to the individual, it is an innovation» (Rogers 1983), kann durch gezieltes (Innovations-) Management herbeigeführt und räumlich wie zeitlich verbreitet werden (Diffusion). Bei jeder Produktinnovation ist klar zwischen der Betriebs- und Marktneuheit und der Subjekt- und Intensitätsdimension einer Innovation zu unterscheiden (Meffert 1986/2000): • • • Was für die einzelne Unternehmung neu ist, muss nicht für den Markt neu sein! Für wen ist das Produkt neu (Subjekt)? Wie neu ist das Produkt (Intensität)? Wann beginnt und endet die Innovation (Zeit) und in welchem Gebiet findet sie statt (Raum)? Eine Produktinnovation kann auf eine Produktdifferenzierung (Berücksichtigung spezifischer Kundenwünsche) und/oder eine Produktdiversifikation (Erweiterung des Sortiments) ausgerichtet sein. In einer umfassenden Sicht ähnelt die Produktinnovation einer «Reise in die Wildnis» (Wheelwrigth/Sasser 1989): © 121 UZH | Marketing II In diesem Kontext ist eine Innovation die nachhaltige Absicherung eines Wettbewerbsvorteils durch einen Angriff «auf sich selbst» (Kannibalismuseffekt) und erfordert die Analyse der gesamten unternehmerischen Wertschöpfungskette (Porter 1985), von der Beschaffung, Forschung und Entwicklung, der Produktion, Marketing bis zum Endkunden. Die verschiedenen Innovationsformen sind miteinander verwoben, bewirken ein gegenseitiges Stimulieren und jede innovative Veränderung eines Gliedes der Wertschöpfungskette hat untrennbare Auswirkungen auf die übrigen Glieder. Das klassische Beispiel ist die Möbelbranche (Pernicky 1988): Ein traditionelles Möbelhaus legt sein Sortiment lokal fest, der Hersteller tätigt das Design, kauft die Materialien ein und stellt die Produkte her, der Standort ist die Innenstadt, die Werbung produktbezogen und der Kundenservice umfassend. Demgegenüber tätigt die IKEA die Sortimentsgestaltung international, führt das Design selbst durch, kauft die Materialien international ein und lässt nach IKEA-Standards international produzieren, die Werbung ist Ausdruck des «unmöglichen Möbelhauses» und der Service wird auf den Kunden verlagert. Innovationen stellen einen kontinuierlichen Prozess dar und können Branchenstrukturen sowie -grenzen verändern, da viele der Innovationen sehr oft nicht von den marktführenden Unternehmungen getätigt werden, sondern von Branchenneulingen oder Aussenseitern (Schnaars 1989). Beispiele: • • • • • • • © Die elektronischen Taschenrechner wurden nicht von den etablierten Herstellern von elektromechanischen Addiermaschinen eingeführt. Die Wegwerfwindel entwickelte der damalige Aussenseiter Procter & Gamble. Die ersten Radialreifen im amerikanischen Markt stammten nicht von den USMarktführern Goodyear, Firestone oder Goodrich, sondern vom französischen Hersteller Michelin. Die ersten kalorienarmen Softdrinks hat der Markt nicht Coke oder Pepsi zu verdanken, sondern der Royal Crown Cola. Die Joggingschuhe wurden nicht von den führenden Herstellern entwickelt und eingeführt. Die schweizerische Uhrenindustrie ignorierte die Digitaluhren. Das erste alkoholfreie Bier braute nicht eine Grossbrauerei. Die marktliche Ausbreitung einer Innovation ist Ausdruck des Diffusionsprozesses: Innovatoren treten frühzeitig als Käufer auf, sobald ein Produkt auf den Markt kommt. Sie sind sozusagen die Brückenköpfe und spielen mit ihrem Pionierverhalten bei der Ausbreitung einer Neuerung (Diffusion) eine wesentliche Rolle (Marketing-Zielgruppe). Innovatoren können aufgrund ihrer persönlichen Merkmale und ihres (Risiko-)Verhaltens mit Meinungsführern gleichgesetzt werden. Den Innovatoren (2.5 % aller Kunden) (Rogers 1983) folgen nach einer Weile die Imitatoren als zeitlich und sachlich folgende Käufer (Bandwagon-Effekt): frühe Adaptoren, Adaptoren, frühe Mehrheit, späte Mehrheit. Der Absatz steigt solange, bis der lokale bzw. globale Markt gesättigt ist. Dieser Diffusionsprozess kann durch die Nutzung von Diffusionsagenten (Einzelhandel u.a.) beschleunigt werden. 122 UZH | Marketing II Neue industrielle Produkte erreichen um so schneller eine gewisse Marktdurchdringung, d.h. sie weisen eine hohe Diffusionsgeschwindigkeit auf, je deutlicher ihr Wettbewerbsvorteil (Rentabilität, Verlässlichkeit usw.) ist, je weniger komplex sie sind, je einfacher sie übernommen werden können, je besser ihre Marktverfügbarkeit (Erhältlichkeit) ist und je verträglicher sie mit den Einstellungen, Wertsystemen (Kulturen) der Nachfrager sind (Böcker/Gierl 1987). Die Neuheiten können echte Innovationen (originäre Produkte), neuartige Produkte (quasi-neue Produkte) oder nachempfundene, nachgeahmte Produkte (Me tooProdukte) sein: Die Sofortbild-Kamera von Polaroid war eine echte Innovation, das Mountain-Bike ist ein neuartiges und das x-te Frühstücksgetränk ein nachgeahmtes Produkt. Für die Markteinführung ist daher die Einzigartigkeit (uniqueness) der Innovation wie der Vertriebsweg entscheidend. Der Zeitpunkt des Markteintrittes kann von der Produktentwicklung und ihrem Beschleunigungspotential (Verkürzung von Entwicklungszeiten, Beschleunigung der Diffusionsprozesse, Erhöhung der Anpassungsgeschwindigkeit der Organisation usw.) nicht losgelöst werden. © Eine Verlängerung der Entwicklungszeiten führt in der gesamten Produktlebensdauer zu Gewinneinbussen von rund 30 %; die Erhöhung der Entwicklungskosten um den geplanten Markteintritt zu sichern, zu Einbussen von rund 5 %, d.h. je kürzer der Produktlebenszyklus, desto einschneidender ist das marktliche Zuspätkommen. 123 UZH | Marketing II 5.5.2. Innovationserfolg Die Kriterien «Synergie» (Produkt, Produktion, Markt), «Produktkomplexität» (hoch, gering) und «Marktentwicklung» (schnelle, zögernd) (Perillieux 1989) prägen ebenso das Innovationstiming wie innovationsauslösende Stimulationen durch das oberste Management (Yamanouchi 1989). Eine erfolgreiche Markteinführung erfordert daher die klare Beantwortung der Fragen (Kotler 1988): «When? Where? To whom? How?» Dabei zeigen Beobachtungen der Strategien von Unternehmungen, dass der Zugang zu Märkten und Kunden, von denen die stärksten Impulse für Innovationen ausgehen, ebenso entscheidend ist wie die zeitliche Steuerung der Innovationsaktivitäten (Gerybadze 1988). Vergleichende Analysen von Wachstumsmärkten im Konsumgüterbereich (Digitaluhren, Diät-Softdrinks, Leichtbiere, Personalcomputer, Taschenrechner, Videogeräte) verdeutlichen, dass nicht nur Pionierunternehmungen (first, pioneers), sondern auch erste Verfolger (first follower, early entrants) erfolgreich sein können (Schnaars 1986). Verschiedene empirische Untersuchungen zeigen, dass 30-50 % (je nach Kriterium) der am Markt eingeführten Produkte sich zu Fehlschlägen (flops) entwickeln, nur 1-2 % aller Erfindungen jemals die Produktion erreichen, in den USA fünf von sechs Arbeitsstunden für industrielle Forschung und Entwicklung aufgewendet werden, die ökonomisch erfolglos sind, bis zu 45 % der betrieblichen Forschungskosten eingespart werden könnten, wenn man auf bereits publizierte Forschungsergebnisse zurückgreifen würde, und die Kosten der Überleitung von Ideen in marktfähige Produkte oft grösser sind als die eigentlichen Forschungs- und Entwicklungskosten (Hübner 1986). © Das Endziel jeder Innovation ist ein nachhaltiger Markterfolg, d.h. die Innovation wurde vom Markt akzeptiert und für die Unternehmung ertragswirksam. Produktbezogene Gründe für die fehlenden Markterfolge sind (Backhaus 1982): • • • • • • «Die bessere Mausefalle, die keiner wollte». «Das Me too-Produkt, das auf eine Konkurrenzbarriere trifft». «Produkte mit Wettbewerbsschwächen». «Produkte mit Umfeldschwächen». «Produkte mit technischen Schwächen». «Der Preiseinbruch». Bedeutende Widerstände des Kunden gegen Innovationen sind die bisherige Produktverwendung, der unbekannte Innovationswert, die physischen, ökonomischen, funktionalen und sozialen Produktrisiken sowie die Identifikation mit dem bisher verwendeten Produkt (Ram/Sheth 1989). 124 UZH | Marketing II 5.5.3. Innovationsmanagement Erfolgreiche Innovationen stehen in einem sozialen System immer im paradoxen Kontext von Stabilität, Konservatismus und schneller Veränderung, zwischen Ordnung und Chaos. So sind Atmosphäre und Vision, Marktorientierung, kleine, schlanke Organisationsstrukturen, diversifiziertes Vorgehen, konkurrierende Entwicklungslinien, Arbeiten im Garagenstil sowie interaktives Lernen wesentliche Erfolgsfaktoren unternehmerischer Innovationen (Quinn 1985). Diese unternehmerischen Auseinandersetzungen sind Ausdruck eines systematischen Innovationsmanagement mit seinen vielschichtigen Prozessen. Ein Innovationsprozess lässt sich in einem engen Verständnis in die Phasen «Ideengenerierung» (Ideenproduktion), «Ideenakzeptierung» (Ideenannahmeentscheidung) und «Ideenrealisierung» gliedern (Thom 1980). Im umfassenderen Sinn durchläuft eine Innovation die folgenden Phasen (Töpfer 1984): 1. Markt- und Umfeldbeobachtung: Erkennen schwacher Signale (Schatten) 2. Problemdefinition: Analyse kritischer Faktoren 3. Invention: Suche, Bewertung, Auswahl erfolgversprechender Lösungen 4. Produktentwicklung: Entwurf und Konstruktion 5. Herstellung der Marktreife: Produkterprobung und Markttest 6. Produktion: Herstellungsverfahren und Kapazitätsbereitstellung 7. Markteinführung: Abbau von Markteintrittsbarrieren © Diese lineare, relativ statische Prozesssicht ist hinsichtlich der marktlichen Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit (Adaptionsfähigkeit) nicht immer ideal. Verbesserungen versprechen Konzepte mit absolut endzielorientierten, sich stark überlappenden Aktivitätsphasen (Takeuchi/Nonaka 1986): Sämtliche Aktivitäten sind auf die Problemlösung für den Kunden (Endprodukt) auszurichten. Dieses Vorgehen setzt eindeutige Kernkompetenzen und eine stimmige Prozessorganisation (horizontale Organisation) voraus. Eine organisatorische Verankerung paralleler Tätigkeiten verschiedener Bereiche (Beschaffung, F+E, Marketing u.a.) ist das Simultaneous Engineering (SE). Es verbessert die Koordination, die Qualität und die Prozesszeiten (time to market). Im umfassenderen Sinn kann der Kunde als Co-Designer in den Innovationsprozess integriert werden. 125 UZH | Marketing II Neben den unternehmungsexternen Innovationshemmnissen sind die folgenden unternehmungsinternen Widerstände häufig: Eine mangelnde innerbetriebliche Kommunikation und die fehlende Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen (Marketing, Forschung und Entwicklung, Produktion) führen zu Informationsdefiziten. Die Kooperationsdefizitezeigen sich in der fehlenden Zusammenarbeit, der Ressourcenzuteilung, der Patent- und Lizenzvergabe sowie der unternehmerischen Kooperation. Mögliche Umsetzungsdefizite finden wir wegen ungenügender Qualifikation der Mitarbeiter (Fach-, Sozialkompetenz), kulturellen Widerständen und unerprobten operativen Instrumenten (Controlling, Markttest u.a.). © Die Entwicklung einer Unternehmung erfordert eine stetig innovative Unternehmungsorganisation. So begannen einst Soichirio Honda und Takeo Fujisawa, die Gründer der Honda Motor Co. Ltd., mit einer organisatorischen Einheit. Diese wurde inzwischen in drei Einheiten gegliedert: Die Honda Research and Development Co. betreibt die technologische Grundlagenforschung und entwickelt neue Konzepte. Diese Resultate werden ausgewertet und der Holdinggesellschaft Honda Motor Co. Ltd. verkauft. Die Honda Engineering Co. entwickelt Produktionssysteme und führt sie ein. Die Honda Motor Co. Ltd. produziert und vermarktet die Produkte weltweit (Iikubo 1990). Entfernen sich Innovationen deutlich vom bestehenden Markt und der aufgebauten unternehmerischen Kompetenz, so haben sie den Charakter eines Venture. Dabei muss die Unternehmung ihre oft innovationshemmende, pathologisch-bürokratische Struktur (Organisation) verändern. Solche Veränderungen sind im Innern der Unternehmung oder ausserhalb, insbesondere auch bei Klein- und Mittelbetrieben, möglich und führen zu folgenden Organisationsformen als Umsetzungsmechanismen von Innovationen (Arthur D. Little 1988). Solche Ventures (new venture unit) unterscheiden sich von den angestammten Unternehmungseinheiten (historical operating unit) insbesondere in den folgenden Dimensionen (Bart 1988): 126 UZH | Marketing II Sollte sich eine Innovation als Fehlschlag (flop) erweisen, so sind die folgenden Handlungen im Sinn eines aktiven Krisenmanagement wesentlich: (1) Kundenbefragung, (2) Problemsuche, (3) Anpassung der Leistungserstellung, (4) Überprüfung der unternehmerischen Situation, (5) echte Problemlösung und (6) Rückgewinnung der Kunden (Meyers 1989). Erfordern Produktfehler, welche die Gesundheit oder die Sicherheit von Personen bedrohen oder erhebliche Sachschäden verursachen könnten, Rückrufaktionen, so ist ein ähnliches Krisenmanagement notwendig. © Innovationen können durch technische Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster) wie durch Schutzrechte der Form (Urheberrechte, Geschmacksmuster) und Warenzeichen (trademarks) abgesichert werden. Die Gesamtheit unternehmerischer Innovationen bestimmt massgeblich die nationale Wettbewerbsposition . Eine erfolgreiche Nation besitzt ein bestimmtes innovatives Klima, das es ihr ermöglicht, einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen und zu erhalten. Die Merkmale dieses Klimas (the diamond of national advantage), in dem Unternehmungen geboren werden und den Wettbewerb lernen, sind (1) die Produktionsfaktoren (Ausbildung, Infrastruktur), (2) die lokale Nachfrage (Signale des Heimmarkts, Wettbewerb), (3) verwandte Industrien, die international wettbewerbsfähig sind und Innovationen verlässlich unterstützen können, (4) die Strategien, Strukturen und Rivalitäten der nationalen Unternehmungen (Porter 1990). 127 UZH | Marketing II 5.6. Technologie Bei Innovationen sind meist Technologien von primärer Bedeutung: Material-, Produktund Verfahrenstechnologien. Neue Materialien, Informationsübertragungen oder Biologietechnologien werden oft als bedeutende Zukunftstechnologien gesehen. Ein umfassender Vergleich von Technologieprognosen verdeutlicht, dass nicht mehr als 20 bis 25 % der prophezeiten Technologien eintreffen (Schnaars 1989). Die Technologien sind aktuelle wie potentielle Barrieren für einen Markteintritt und können für die einzelne Unternehmung wie für die Branche die Wettbewerbssituationen nachhaltig verändern (Porter 1985). Technologien dürfen nicht isoliert betrachtet werden, da sie vernetzt sind: Technologien der Zulieferer, Technologien der Abnehmer. Diese «Druck- und Sogphänomene» (technology-push, demand-pull) beschleunigen den Einsatz neuer Konzepte und Technologien in Produkten wie Prozessen. 5.6.1. Just in Time-Konzepte (JIT) In der Produktion dienen Just In Time-Konzepte (JIT) der Steuerung der Prozesse: Auf jeder Stufe und jederzeit wird genau die Menge rechtzeitig hergestellt, welche auf der nachfolgenden Stufe bzw. auf dem Absatzmarkt eingesetzt bzw. abgesetzt wird (Hässig 1988). © Die durchgängigen Problemlösungen (ECR, JIT u.a.) werden von Fertigungskonzepten (computer integrated manufacturing CIM) unterstützt. Diese ermöglichen in der Fertigung eine erhöhte qualitative, quantitative wie zeitliche Flexibilität des Gesamtprozesses, eine verstärkte Automatisierung und einen integrierten Informationsfluss; gleichzeitig im Marketing eine Angebotsdifferenzierung und -flexibilität, eine erhöhte Qualitätsund Termintreue sowie eine Angebots- und Lieferzeitverkürzung (Gün128 UZH | Marketing II ter/Kleinhaltenkamp 1987, Meredith 1987). Solche Konzepte bedingen eine enge Integration von wenigen, jedoch leistungsstarken, pünktlichen und den Qualitätsnormen in Produkt und Prozess verpflichteten Zulieferern (Burt 1989). Diese Sicht bricht mit dem traditionellen Beschaffungsverständnis, nach dem der Einkäufer (buying center) auf den Zulieferer reagiert und erfordert statt dessen einen Einkäufer, der den Lieferanten antizipierend und umfassend in den gesamten unternehmerischen Wertschöpfungsprozess (F+E, Konstruktion, Produktion, Marketing, Service) integriert. Ein solches Marktverständnis kann mit Reverse Marketing (Leenders/Blenkhorn 1989) umschrieben werden. Die Aussen- und Innenwirkungen der skizzierten Produktions- und Beschaffungsstrategien stärken die unternehmerische Wettbewerbsposition umfassend. Liegen bei Produkten hohe marktliche und technologische Risiken vor, so kann man von einem High Tech Marketing sprechen (Moriarty/Kosnik 1989). Wesentliche Merkmale hochtechnologischer Unternehmungen und ihrer Leistungen sind eine Vielzahl von Markteintrittsbarrieren, kostenorientierte Produktentwicklungen, problemlösungsorientierte Servicekonzepte, individuelle Distribution und vielfältige, hochqualifizierte Mitarbeiter (Bühner 1988). 5.6.2. © Technologie-Lebenszyklus Der Lebenszyklus einer Technologie ist indikatorenhaft erfassbar (Sommerlatte/Deschamps 1985): 129 UZH | Marketing II © Neben dem Lebenszyklus einer Technologie drückt die S-Kurve das Verhältnis zwischen dem Aufwand für die Verbesserung einer Technologieleistung und den Ergebnissen aus, die man durch diese Investitionen erzielt (Foster 1986): Da eine Technologie selten alle Anforderungen erfüllt, gibt es immer aktuell und potentiell konkurrierende Technologien, von denen jede ihre eigene S-Kurve hat. Technologiesprünge (d.h. eine Technologie wird von einer anderen abgelöst) sind Diskontinuitäten in der Entwicklung einer Technologie und können nicht nur den Untergang einzelner Produkte, sondern auch ganzer Branchen zur Folge haben (Foster 1986). 130 UZH | Marketing II 5.6.3. Lizenzen Für jede Technologie resultiert aus den Marktbedingungen ein Marktrisiko, das durch die Risiken der Leistungserstellung (operating leverage) und dem finanzwirtschaftlichen Risiko (financial leverage) verstärkt wird. Diese Risiken sind über Joint Ventures, Tochtergesellschaften, Unternehmungsakquisitionen, Zukäufe von Produktteilen oder aktive Lizenzstrategien reduzierbar. Lizenzen erweitern für den Lizenzgeber (licensor) die Chancen der Erhaltung des Kundenkreises, der schnellen und kostengünstigen Durchdringung neuer Märkte, der Erhöhung der Markenbekanntheit, der Einführung einer nationalen Marke sowie der Kontrolle der Tochtergesellschaften (Quelch 1985). Die Möglichkeit des Lizenztausches (cross-license) erlaubt dem Lizenznehmer die Ergänzung des eigenen Sortiments und bei internationalen Lizenzen die Reduktion von Kursschwankungen und/oder Transferschwierigkeiten (Aufrechnung Lizenzgebühren). © Die Lizenzvergabe (licensing) ist insbesonders für kleine Unternehmungen sowie bei geringer internationaler Markt- und Managementerfahrung, hoher Diversifikation (Produkt, Service), grosser Ähnlichkeit von Heim- und Auslandsmarkt (Lizenztausch), hohen Markteintrittsbarrieren (geschützte Märkte), staatlichen Forderungen nach lokaler Produktion (local content) oder hohen politischen und ökonomischen Risiken sinnvoll. 5.7. Design Im deutschen Sprachraum beinhaltet Design die Produktgestaltung, im englischen auch die Erarbeitung der Produktleistung (Nutzen) und die eigentliche Konstruktion (Produkt, Prozess). 131 UZH | Marketing II Die zunehmend identischen Leistungsmerkmale erfordern eine vermehrte subjektive Positionierung des Produktes. So ist es offensichtlich, dass die Produktgestaltung im Marketing eine zunehmende Rolle spielt, da sie objektiv gleichartige Produkte emotional differenziert. Das Design muss in die gesamte unternehmerische Kommunikation (corporate communication) sowie die Wertschöpfung integriert werden. Das Design besteht aus den folgenden Gestaltungselementen (Koppelmann 1987): Mit einer Differenzierung der Fassade des Produktes, von der Entwicklung der technologischen Möglichkeiten wie CAD (computer aided design) und CAM (computer aided manufacturing) unterstützt, wandelt sich auch die «Sprache des Produkts» (product semantics). Ein «menschenfreundliches» Design muss vor allem «Dinge sichtbar machen», d.h. die wichtigen Dinge müssen sichtbar sein (Türgriff) und sie müssen die richtige Botschaft übermitteln (stossen, ziehen) (Normann 1989). Denn jedes Produkt kommuniziert immer mit rein technisch-funktionalen Aspekten (ergonomische, fertigungstechnische und konstruktive Anforderungen) wie kommunikativen Funktionen (Ästhetik, Symbolik) (Bürdek 1989). © 5.8. Marke Eine Marke (brand) ist ein Wort- und/oder Bildzeichen, das dazu dient, Produkte einer Unternehmung zu individualisieren. Die Marke hat Identifikations-, Differenzierungsfunktionen und präferenzprägende Funktionen zu erfüllen. Sie erleichtert so die Kommunikation zwischen Unternehmung und Kunde, insbesondere weil starke Marken beim Kunden verankert sind und er sie mit Vorstellungsbildern (Eigenschaften, Erlebnissen, Verwendungszusammenhänge u.a.) verknüpft. Die Bedeutung der Marken steigt, weil die Märkte zunehmend segmentiert und internationaler werden, sich die Produktlebenszyklen verkürzen und die Produktinnovationen, bei hoher Floprate, zunehmen (Esch 2000). In gesättigten Märkten finden wir daher verstärkt den Trend vom Produkt- zum Marken- bzw. Kommunikationswettbewerb. 132 UZH | Marketing II 5.8.1. Markenbildung Eine Marke muss in den Augen des Kunden einen Wert (Markenwert) verkörpern. Sie löst beim Kunden, je nach Marke mit unterschiedlicher Intensität, psychische Reaktionen kognitiver (Wahrnehmung, Gedächtnis), affektiver (Emotionen, Einstellungen) und konativer (Kaufabsichten) Art aus (Hätty 1989). Markentreue Kunden zeichnen sich durch eine starke Markenpräferenz eine geringe Preissensibilität aus; eine Ausnahme bildet der Schnäppchenjäger (smart shopper), der bei relativ hoher Markenpräferenz eine hohe Preissensibilität entwickelt. Die Marke muss sich gleichzeitig deutlich von der Konkurrenz unterscheiden. Neben dieser Differenzierung muss sie attraktiv, aussprechbar, merkfähig und schutzfähig sein (Gotta 1988), sei es mittels optischen oder akustischen Markierungsmitteln, sei es als Firmen- oder Fantasiemarke: a good name (VISA), a brand's logo (Coca Cola), a color (Kodak's yellow film box), a symbol (Marlboro Man), a package (Coca Cola's old bottle), a shape (Porsche), a slogan (Pepsi Generation) and music (This Bud's for you) (Magrath 1990). Markennamen haben verschiedenste Wurzeln. So ist der Name «Caran d'Ache» eine in französische Schreibart umgewandelte Form des russischen Wortes «karandásch» für «Bleistift», «Persil» aus Bestandteilen der Bezeichnung der Wirkstoffe «Perborat» und «Silikat» gebildet und «Swatch» eine Fügung aus «Swiss Watch» (Lötscher 1987). Ein Name kann daher produktbeschreibend (Swatch), assoziativ-symbolträchtig (Caran d'Ache) oder artifiziell (Persil) sein. Die Markenkommunikation erfolgt akustisch (Melodie, Wort gesprochen) oder optisch (Bild, Wort geschrieben, Zeichen). © Die Marken bilden ein Vertrauenskapital: Der Kunde kauft eine «vorfabrizierte Sicherheit», denn ein Bedürfnis soll ohne Risiko und ähnlich wie in der Vergangenheit befriedigt werden (standardisiertes Kaufverhalten) (Morwind 1986). Er erlebt die Einmaligkeit des Produktes und entwickelt eine Markenloyalität. Diese schafft langfristige Kundenbeziehungen, schützt die eigenen Investitionen und unterstützt die Leistungsdifferenzierung. Das entstehende Vertrauenskapital der Marke hängt jedoch stark von den Branchen und Märkten ab. So enthalten beispielsweise die Marken «Persil» (Waschmittel), «Milka» (Süsswaren) oder «Nivea» (Körperpflege) in den Konsummärkten der Bundesrepublik Deutschland ein hohes Vertrauen (GfK). Insbesondere Jugendliche entwickeln ein starkes Markenbewusstsein. Jede Marke bewegt sich in einer gewissen Marktschicht (Marktzwiebel, Marktglocke). In dieser Hierarchie bedeutet die Strategie der Aufwertung einer Marke, beispielsweise von einer Konsummarke zu einer Luxusmarke, ein Trading up; ein Abwerten ein Trading down. Weltweite Luxusmarken (Premiummarken) sind beispielsweise «Chanel», «BMW», «Porsche» oder «Rolex». Über die Zeit durchlaufen viele Marke einen Markenzyklus, beispielsweise: Aufbau, Absicherung, Differenzierung, Imitation, Spaltung, Polarisierung und Revitalisierung der Marke. 133 UZH | Marketing II 5.8.2. Markenausprägungen Das Markenobjekt kann eine Produkt- oder Dienstleistungsmarke sein. Die ursprüngliche Marke bezeichnet man als Erstmarke. Wird diese gewissen Marktsegmenten nicht gerecht, so kann eine Zweitmarke geschaffen werden. Meist sind dies Billigmarken mit den ihren eigenen Vertriebswegen. Aufgrund der horizontalen Reichweite unterscheidet man zwischen regionalen, nationalen, internationalen und globalen Marken. Nach dem Markengeber (Markeninhaber) können wir zwischen Herstellermarken (Markenartikeln im Sinn von Eigenmarken) und Handelsmarken (Eigenmarken im Sinn von Handelsmarken) unterscheiden. Die Handels- und Herstellermarken sind meist Individualmarken (Hausmarken), oft auch Kollektivmarken (Gemeinschaftsmarken), beispielsweise einer Handelsorganisation. Eine Herstellermarke ist einerseits in Erst- und Zweitmarken (Primär- und Sekundärmarken), andererseits in Einzel- (Monomarke, Produktmarke), Produktgruppen- (Markenfamilie) und Globalmarke (Dachmarke) gliederbar. Bei vorverpackten Konsumgütern beträgt beispielsweise der Anteil der Herstellermarken im Lebensmittelhandel in der Bundesrepublik Deutschland rund 80 %, in Frankreich 90 %, in Grossbritannien 70 % und in der Schweiz 65 %. Je nach Studie sind etwa 20 % der Kunden bereit, für einen Markenartikel mehr Geld auszugeben. Der Handel kann sich sortimentspolitisch an den Herstellermarken oder an seinen Handelsmarken orientieren. Diese können wie die Herstellermarken gegliedert werden, zusätzlich finden wir Gattungsmarken. Diese markenlosen Produkte (weisse Ware, generics, no names, produits blancs), werden insbesondere bei Lebensmitteln und sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs (convenience good) geführt: einfache Verpackung und tiefe Preise in engem Distributionskanal, meist Discounter. Gattungsmarken bei pharmazeutischen Produkten (generics) verwenden einst patentrechtlich geschützte Wirkstoffe erfolgreicher Produkte und werden, aufgrund der geringeren Kosten in Forschung und Entwicklung, auf dem Markt preisgünstiger angeboten. Im Konzept «Markenhierarchie» ist die Gattungsmarke die unterste Ebene (Preiskäufer); bei den oberen Ebenen (Markenkäufer) finden wir aufsteigend die Handelsmarken (im eigentlichen Sinn Eigenmarken), die Herstellermarken (Markenartikel) und die Luxusmarken (Premiummarken). © Eine am Markt erfolgreich eingeführte Marke kann «multipliziert» werden, wenn eine Gruppe von Produkten unter dieser Marke abgesetzt wird. So erzielte beispielsweise im Markendach «Nivea» die Nivea-Creme in den Jahren 1975-85 ein Umsatzwachstum von +41 %, das übrige Sortiment (Badeseife, Creme-Bad, Sonnenmilch u.a.) ein Wachstum von +405 % (Prick 1988). Eine Marke ist bei ähnlicher Marktpositionierung mit einer anderen Marke auch verknüpfbar. Dieses Co-Branding, beispielsweise einer Kreditkarte mit der Mitgliederkarte eines Automobilclubs, erlaubt das Ausschöpfen «verwandtschaftlicher» Zielgruppen. Die Marke ist so als Markenrecht (licensing) von einem Markenrechtsinhaber handelbar. 134 UZH | Marketing II 5.8.3. Markenpolitik Die Markenpolitik ist Ausdruck der Markenführung (Markenmanagement) mit den folgenden Zielen der Schaffung von Markenbekanntheit, Markenpräferenzen und -image. Erfüllen die unternehmerischen Leistungen die Kundenerwartungen, so kann sich eine Markentreue entwickeln. Das Markenimage zeigt sich in den folgenden Merkmalen: (1) starke Marken sind vor allem mit emotionalen Inhalten verknüpft, (2) enge Assoziationen stärken die Markenbeurteilung, (3) starke Marken sind Ausdruck nonverbaler Markeninhalte, einzigartiger Assoziationen mit positiven Gefühlen, (4) Marken müssen mit bestimmten Eigenschaften und Merkmalen vom Kunden leicht verknüpft werden können, (5) die Markenassoziationen müssen die Kundenbedürfnisse treffen und für den Kunden wichtig sein (Esch 2000). Der Aufbau einer Marke und ihre Führung (brand design, branding) ist, ausgehend von vielfältigen Informationen (Marktforschung), Ausdruck eines langfristigen Entwicklungsprozesses und hat sich stark an der angestrebten Positionierung zu orientieren. Dabei stellen sich beispielhafte Fragen: 1. 2. 3. 4. 5. Soll für das Produkt eine Marke entwickelt werden? Wer ist der Markeninhaber? Welche Markenstrategie (Dachmarke, Einzelmarke u.a.) wird verfolgt? Unter wievielen Marken soll ein Produkt lanciert werden (Multibrandstrategie)? Soll eine heutige Marke neu positioniert werden? Eigene Position stärken oder Konkurrenzposition schwächen? 5.8.4. Markenwert © Alle Massnahmen der Markenpolitik schaffen einen Markenwert. Diesen gilt es im Rahmen der Markenbewertung geldlich zu erfassen. In der Vielfalt der Methoden und Verfahren ist die Bewertung aufgrund der Kundenpräferenzen (Kaufverhalten) ein erster Weg: Testkunden werden verschiedene Marken einer Produktkategorie mit relativ tiefen Preisen zur Auswahl «vorgelegt», um aufgrund anschliessend erhöhter Preise das neue Wahlverhalten zu erfahren. Die Differenz von den ersten zu den zweiten Durchschnittspreisen drückt einen Markengeldwert aus. Die Bewertung aufgrund der historischen Kosten ist Ausdruck der Gesamtinvestitionen in eine Marke über einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise die Entwicklungs- und Marketingkosten über acht Jahre. Eine andere Form der Bewertung ist die Ermittlung des Markengeldwerts mittels eines Preiszuschlags (premium pricing). Der Markengeldwert entspricht der Preisdifferenz zwischen zwei Produkten multipliziert mit der in einem Zeitraum verkauften Stückzahl. Ein Beispiel: Preis Produkt A € 50.00, Preis Produkt B € 45.00; abgesetzte Menge von A bzw. B 1 je Mio. Stück; Markengeldwert € 5 Mio. Umfassendere Konzepte sind beispielsweise Punktbewertungsmodelle(Markenbilanz 135 UZH | Marketing II von Nielsen, Modell Interbrand): Sie kombinieren quantitative Daten (Aufwand/Ertrag) mit subjektiven Werten (Kundenbefragung Marke) über die Markenstärke, um einen Markengeldwert zu bestimmen. Auch über den Kauf und Verkauf von Unternehmungen (mergers and acquisition) wird eine Marke handelbar. Ihr Wert liegt jedoch nicht in der Unternehmung, sondern in den «Köpfen der Kunden». Für eine Markenpolitik stellen sich zusammenfassend die folgenden Fragen: 1. Was gibt der Markt her (Markt- und Gewinnpotential, Lebenszyklus Markt)? 2. Welchen Anteil holt die Marke aus ihrem Markt heraus (Gewinnanteile, Marktanteile)? 3. Wie bewertet der Handel die Marke (Nachfragepotential, Rangplatz Regal)? 4. Was tut der Hersteller für die Marke (Preispolitik, Produktqualität, Share of Voice)? 5. Wie stark sind die Kunden mit der Marke verbunden (Erinnerung, Identifikation, Markentreue, Vertrauenskapital «Marke»)? 6. Wie gross ist der Geltungsbereich der Marke (Internationalität, Markenschutz)? 5.9. Verpackung © Verpackung ist ein Sammelbegriff für jegliche Art von Produktumhüllung (Meffert 2000). An eine Einweg- oder Mehrwegverpackung mit ihrer Informations-, Schutz-, Transport-, Verkaufs- und Verwendungsfunktion ergeben sich je nach Nutzer die folgenden Anforderungen (Dichtl 1987): Die Verpackung ist ein Instrument der Produktpolitik (Design u.a.) aber auch der Distributionspolitik (Handling u.a.). Bei mehrstufiger Distribution sind konzeptionelle und technische Aspekte (ECR, EDIFACT u.a.) verstärkt zu berücksichtigen. Ebenso gilt es, vielfältigen ökologischen Anforderungen (Abfallvermeidung, Mehrfachverwendung u.a.) kosten- und nutzengerecht zu erfüllen. 136 UZH | Marketing II © 5.10. Sortiment Neben die Einproduktentscheidung tritt die Programm- oder Sortimentsentscheidung. Zwischen den Produkten bestehen verschiedene Verbundeffekte: Bedarfsverbund (komplementäre Produkte), Nachfrageverbund (Bedarf an einem Ort abdecken) oder Kaufverbund (mehrere Produkte bei einer Gelegenheit kaufen). Die Daten hierzu sind am Verkaufspunkt (EAN, Scanning u.a.) erfassbar und mittels multivariater Verfahren als Verbundanalyse auswertbar (multidimensionale Skalierung). Die Gestaltungsprinzipien für ein Sortiment orientieren sich primär an (End-)Kunden (Bedürfnisse, Preislagen, Verhalten), am Handel (Category Management) und an der strategischen Ausrichtung (Differenzierung, Diversifikation). Ein Sortiment ist in seiner Breite und Tiefe charakterisierbar: 137 UZH | Marketing II Das Ziel jeder Sortimentsgestaltung ist die Minderung des unternehmerischen Risikos durch Risikostreuung (verschiedene Produkte). Dabei sind «Beibehaltung» und «Änderung» die grundlegenden Entscheidungsalternativen. Eine Sortimentsänderung kann die folgenden Massnahmen beinhalten (Busse von Colbe/Hammann/Lassmann 1990): • • • Bei der Einengung erfolgt eine Elimination der Sortimentsbreite (Spezialisierung) und/oder der Sortimentstiefe (Standardisierung). Dadurch können beispielsweise im Handel neue Regalflächen geschaffen oder der Ersatzteildienst vereinfacht werden. Die Auswechslung dient der Variation des Sortiments oder der Behebung von Produktschwächen (Fehler, Imageschäden u.a.). Mit der Ausweitung erfolgt eine Erweiterung der Sortimentsbreite (Diversifizierung) und/oder der Sortimentstiefe (Differenzierung) nach oben (trading up) oder unten (trading down). Eine Kombination beider Richtungen ist möglich. © Die Sortimentsgestaltung sollte sich am Potential der unternehmerischen (Kern-) Kompetenz orientieren und Verbundeffekte (komplementäre Beziehungen) von Produkten wie Käufen nutzen. Fehlt die Fähigkeit ganz oder teilweise, so kann ein Sortiment durch Zukäufe ergänzt werden (make or buy). Wesentliche quantitative Hinweise auf die Bedeutung der einzelnen Produkte und die Notwendigkeit der gezielten Produkteliminierung (Sortimentsbereinigung) liefert die ABC-Analyse. Die Umsatzanteile bzw. die Anteile der Deckungsbeiträge der von der Unternehmung angebotenen Produkte eines Sortiments werden in eine Rangreihe gebracht und kumuliert. Das Ergebnis kann in der Form einer Konzentrationskurve dargestellt werden: Die Analyse der Umsatz- bzw. Deckungsbeitragsstruktur ist mit einer Analyse der Altersstruktur zu ergänzen: Die Lebenszyklen der einzelnen Produkte des Sortiments sind untereinander zu vergleichen und Verbund- und Substitutionseffekte zu klären. 138 UZH | Marketing II 5.11. Experiences © Die Emotionalisierung der Welt ist vermehrt Teil des Marketing bzw. der Produktpolitik: Produkte müssen Träume, Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen liefern. Die unternehmerischen Leistungen genügen nicht immer, weil sie nicht vorgeführt, sondern nur geliefert werden und weil sie nicht zum Ziel haben, unvergesslich zu sein. Erlebnisse, genannt Experiences (Pine/Gilmore 1999), werden zum ökonomische Gut. Traditionelle Unternehmungen sind gezwungen, ihre Leistungen erlebnisorientierter zu gestalten: Darum ist das Essen ein Element des Eatertainment, darum ziehen Geschäfte Kunden durch Verkaufs-Events, genannt Shoppertainment an. Nur ein Angebot, das sich als Bühne für den Kunden versteht, kann sich in diesem Konzept künftig von der Konkurrenz differenzieren. Und der Kunde zeichnet sich durch eine viel höhere Zahlungsbereitschaft aus, beispielsweise wenn er vor imposanter Kulisse auf dem Markusplatz in Venedig einen Kaffee geniesst. Die Wertigkeit der Leistung wird von der Commodity zum inszenierten Erlebnis verschoben. Was für die einen «Experiences», also Erlebnisse und Erfahrungen, sind, nennen andere «Geschichten»: Die Informationsgesellschaft wird von der Traumgesellschaft, dem «Zeitalter der Geschichten und der Erzähler» (Jensen 1997) abgelöst. In den gesättigten Märkten werden Emotionen wichtiger als Sachwerte; der Nutzwert wird vom Gefühlswert übertroffen. Eine Person oder ein Produkt, das keine Geschichte erzählt, wird auf dem Markt nicht wahrgenommen. Dies bedeutet, dass sich Leistungen vermehrt zu einem ganzheitlichen, kontinuierlichen «Theater» entwickeln und damit zu einem unver139 UZH | Marketing II gesslichen Erlebnis. Die möglichen Erfahrungen sind sinnlicher, affektiver, kreativ kognitiver, physischer oder sozialer Natur; möglicherweise Ausdruck von Lebensstilen (Bobos u.a.). An diesem inszenierten Erlebnis muss der Kunde teilhaben wollen: Der «Konsum» von Träumen, Geschichten, Erlebnissen und Erfahrungen erfordert die Bereitschaft des Kunden zu einem Engagement, zu einem Commitment: Ähnlich wie vor einer Theateraufführung, muss er sich darauf einlassen wollen und durch den Bezug einer Leistung weiterentwickeln können. 5.12. Ökologie Eine bedeutende Ursache wachsender Abfallberge sind die Verpackungen, beispielsweise Becher, Dosen, Flaschen, Folien, Tuben. Eine repräsentative Umfrage in der Bundesrepublik Deutschland, Mehrfachnennungen waren möglich, zeigt die folgenden Einstellungen: Kaum überflüssige Verpackungen gibt es bei Eiern 76 %, Kaffee 76 %, Büchern 73 %, Fleisch 73 %, Kleidung 70 %; zuviel überflüssige Verpackungen haben Süssigkeiten 73 %, Kosmetik 70 %, Spielzeug 61 %, Fertiggerichte 58 %, Hamburger 51 % (natur-Umweltbarometer 1989). © Ökologie ist aber auch eine Auseinandersetzung mit den Produkten an sich. Erste ökologische Lösungen bei Produkten wie Prozessen sind die Reduktion bzw. das Weglassen einzelner Nutzenelemente, beispielsweise die Verbesserung/Verringerung des Verpackungsmaterials und die Vereinfachungen der Reinigungs- und Servicemöglichkeiten. So konnte eine schweizerische Detailhandelsunternehmung durch den Ersatz der PVCEssig- und -Speiseölflaschen durch solche aus dem umweltfreundlicheren Verpackungsmaterial PET (Polyethylenterephthalat) jährlich mehr als 600 Tonnen PVC (Polyvinylchlorid) einsparen. Sind im Beschaffungsmarkt die Rohstoffabhängigkeit und die Umweltgefährlichkeit der Stoffe auch aus Gründen der Produkthaftung zu klären (Stahlmann 1988), so benötigt es im Absatzmarkt eine markante Neuorientierung der Nutzen einer unternehmerischen Leistung (Burghold 1988): 1. persönlicher Nutzen: Schonung des natürlichen Ökosystems 2. soziologischer Nutzen: Zugehörigkeit zum Kreis der Umweltbewussten 3. magischer Nutzen: Sicherung des Überlebens Durch diese ökologische Auseinandersetzung verändert der Kunde potentiell sein Verhalten (Erfahrung, Lernen) und beeinflusst interaktiv Handel und Industrie. In jedem Lebenszyklus eines Produktes, auch bei Dienstleistungen, entstehen verschie140 UZH | Marketing II dene Reststoffe (Rückstände, Abfälle, Schadstoffe). Diese Abfälle im umfassenden Sinn können, obwohl die unternehmerischen Möglichkeiten zur Verhinderung sämtlicher negativer ökologischer Wirkungen letztlich immer begrenzt sind, durch den geeigneten Einsatz bzw. Nichteinsatz von Rohstoffen und Technologien (ökologische Wertanalyse) sowie der Verwendung recyclinggerechter Konstruktions- und Designelemente vermieden werden (Abfallvermeidung) oder sind zu bewältigen. Für die Abfallbewältigung (Trennung, Vorbehandlung, Umwandlung) stehen die folgenden Möglichkeiten offen (Hamman 1987): 1. 2. 3. 4. Weiterverarbeitung: Abfall als Einsatzstoff Wiedereinsatz: inter- und intraindustrielles Recycling Weitervermarktung: Branchenkooperationen, Abfallbörsen Beseitigung: Deponierung, Vernichtung. Diese Sicht verdeutlicht, dass der Lebenszyklus des Gesamtproduktes mit den Lebenszyklen der Produktelemente harmonisiert werden muss. Diese Zyklen wiederum sind von den Lebenszyklen der einzelnen Stoffe (Rückstandszyklen) nicht trennbar. Da umfassende Umweltverträglichkeitsprüfungen von Produkten wie Prozessen methodisch schwierig, zeitlich aufwendig und teuer sind, scheint ein pragmatisches Vorgehen sinnvoll: Produkte mit hohen Umweltauswirkungen sind vorrangig auf Verträglichkeit zu überprüfen (Griesshammer 1988). © Die unternehmerischen Ökologieerfahrungen, beispielsweise die Bodendekontamination oder die Abfallbeseitigung mittels Mikroorganismen, sind andererseits unternehmerische Leistungen, welche spezifische Erweiterungen angestammter Sortimente und/oder umfassendere lokale wie globale Diversifikationen (Akquisitionen, Kooperationen, Joint Ventures) auslösen können. Solche Branchen sind unter anderem die Hersteller von Mess- und Regeltechnik, der Apparate- und Maschinenbau oder die biotechnische Industrie. 141 UZH | Marketing II 6. Preispolitik 6.1. Preis Der Preis ist der in Geld ausgedrückte Tauschwert eines Produktes. Dieses geldliche Äquivalent für materielle (tangible) und immaterielle (intangible) Leistungen finden wir ausser bei den Marktpreisen auch bei Gebühren, Tarifen oder Spenden. Der Preis ist ein operativ flexibles und schnelles Instrument, da kurzfristig variierbar (Aktionen u.ä.). Die Preispolitik ist gleichzeitig ein wirkungsstarkes Instrument, da sie mit ihrer Gestaltung auf die Mengen- sowie die Wertkomponente des Umsatzes einwirkt (Hill 1971) und das Überleben der Unternehmung sichert (Cashflow). Mit dem Preis, den eine Unternehmung für ihr Produkt festlegt, gestaltet sie das Marketing von der Ertragsseite her (Anghern 1973). Mit ihm werden alle Produktions- und Marktleistungen für ein Produkt abgegolten; er bestimmt fast uneingeschränkt über Erfolg oder Misserfolg der unternehmerischen Tätigkeit (Tietz 1978). Die wesentlichen Elemente des Preises sind Grundpreis, Rabatte, Skonti, Kredite, Leasing. Einzuschliessen sind die Zahlungsbedingungen: Banken- und Kundenkreditkarten, bargeldloses Zahlen am Verkaufspunkt (electronic funds transfer -point of sale EFT-POS), Factoring, Leasing und Kredite. Diese Möglichkeiten sind für den Anbieter mit anderen Marketing-Aktivitäten (Electronic Data Interchange EDI, Marktforschung, Kundenbindungsprogramm, Regalstopper, Warenwirtschaftssystem) vernetzbar. © Sucht ein Kunde nach Preisinformationen (E-Commerce, Kataloge, Medien u.a.), so sprechen wir von einem Preisinteresse. Dieses Interesse führt zu einem Preiswissen (Preiskenntnis), beispielsweise über Einzelpreise, Preislagen, Preisverteilungen (Absatzkanäle, Marken, Saison u.a.) und Preisanker (Referenzpreise u.a.) (Diller 1988). Da der Preis eine eindimensionale Grösse ist, ermöglicht er einen relativ einfachen Vergleich alternativer Leistungsangebote. Die Einstellungen und Erwartungen gegenüber einem Preis sind Ausdruck eines Preisbewusstseins. Dieses Bewusstsein des Kunden (subjektives Bezugssystem) über den angemessenen Preis einer Leistung (objektives Nutzenbündel) zeigt sich in der Preisvorstellung. Ist der Kunde bereit, diesen Preis im Sinne eines Toleranzbereiches (Niedrigst- und Höchstpreis als Preisschwellen) zu bezahlen, so hat er eine Preisbereitschaft. Diese Bereitschaft ist insbesondere bei Produkten mit einem relativ hohen Engagement des Konsumenten (high involvement product) eng mit Qualitäts- und Imagevorstellungen verbunden. Im Prozess der Preisbeurteilung spielen insbesondere im Einzelhandel die Preisschwellen als Ausdruck einer psychologischen Preispolitik eine wesentliche Rolle: Sie gliedert sich in runde Preise (beispielsweise € 2.09), in Preise auf «psychologischem Niveau» (glatte Preise) (€ 1.99), in rein glatte Preise (€ 2.00) und in gebrochene Preise (€ 1.95). Andere Autoren bezeichnen Preise, welche mit der Ziffer 1 bis 9 enden als gebrochene Preise und Preise, welche auf volle € 0.10 lauten als runde Preise. 142 UZH | Marketing II Eine Währungsumstellung wie der Euro (€) erschwert zunächst die Preisbeurteilung (Referenzpreis, Umrechungsproblematik). Längerfristig erleichtert sie die Preisvergleiche (Preistransparenzeffekt) und erhöht die Wettbewerbsintensität. In einem umfassenderen Verständnis ist der Preis jedoch nicht nur der fakturierte Rechnungsbetrag, sondern Ausdruck aller mittelbaren und unmittelbaren Kosten, welche für den Käufer im Lebenszyklus der Leistung entstehen: Informations-, Beschaffungs-, Installations-, Betriebs-, Instandhaltungs- und Entsorgungskosten (life cycle costs, total cost of ownership). Diese Kosten sind beim Kauf oft unbekannt, da sie nicht bzw. noch nicht erfasst werden können oder nicht bewertbar sind (Ärger, Freude, Zeit u.a.). Überschreiten diese Kosten im Produktlebenszyklus die erwarteten Kosten, so kann dies zu nachträglichen Unzufriedenheiten führen, zur Reue nach dem Kauf (kognitive Dissonanzen). Für den Anbieter ist daher wesentlich, ob der Käufer den Anschaffungspreis oder die gesamten Lebenszykluskosten als Entscheidungskriterium wählt. © 6.2. Grundlagen Preispolitik Die Preispolitik beinhaltet grundsätzlich Handlungsalternativen: Festlegung der Preishöhe und der Preisanpassung. Diese preispolitischen Entscheidungen basieren auf dem Kundennutzen, der Unternehmungs-, der Konkurrenz- und der Umweltsituation. Sie verändern sich je nach Marktentwicklung, Produkt- oder Marktinnovationen, Absatzkanal sowie je Käufer- und Konkurrenzverhalten. 143 UZH | Marketing II Die Grundlagen der Preispolitik für ein Produkt und/oder Sortiment können unternehmungsintern oder -extern sein, wobei zwischen dem Marktpreis (Wertprinzip) und der unternehmerischen Kalkulation (Kostenprinzip) kein unmittelbarer Zusammenhang besteht: Das Marktphänomen drückt eine Angebots- und Nachfragesituation aus; die Kosten, die in der Leistungserbringung verzehrten Produktionsfaktoren, alle Faktoren prägen die Preisbildung. © Das Risiko der Preisbildung kann, je nach Marktmacht, eher beim Lieferanten (Festpreis u.ä.) oder beim Kunden (tatsächlicher Preis zum Lieferzeitpunkt u.ä.) liegen. 6.3. Preisbildung 6.3.1. Ziele Preisbildung Die Ziele der Preisbildung können mehr interner (Anpassung des mengenmässigen Umsatzes an die Kapazität, kalkulatorischer Ausgleich u.a.) oder externer Natur (Kundengewinnung, Marktanteil, Positionierung u.a.) sein. Bei der Preisbildung sind die folgenden Aspekte zu beachten: • Eine Preissenkung führt nicht zwingend zu Umsatzerhöhungen, weil konkurrierende Unternehmungen die Preissenkungen nachvollziehen können und ruinöse Preiswettbewerbe in der Branche drohen (Preisfalle): Eine Preisreduktion führt möglicherweise kurzfristig zu einem erhöhten Umsatz, langfristig zum Verlust einer ein144 UZH | Marketing II • deutigen Positionierung (fragmentiertes Image) und zu marktlichen Unflexibilitäten («Einbahnstrategie»). Sie ist relativ schwer rückgängig zu machen: Der Kunde hat sich an tiefere Preis gewöhnt und ändert sein Verhalten (Preiselastizität) nicht bzw. sucht nach Alternativen. Statt in monetärer Form können Preissenkungen in Form einer Produktvergrösserung, beispielsweise 10 % Mehrgewicht bei Frühstücksflocken, umgesetzt werden, und der absolute Preis bleibt gleich. Mögliche Preiskämpfe entstehen in Branchen mit einer schwachen Innovationsdynamik, relativ hohen Fixkosten und Überkapazitäten. In solchen Situationen gilt es, die Preispolitik nicht auf die Gewinnung von Marktanteilen, sondern von Deckungsbeiträgen auszurichten. © • • • Die kurzfristige Preisuntergrenze ist von der Marktsituation und der unternehmerischen Kostenstruktur abhängig. Sie kann sich an den variablen Stückkosten, den Grenzkosten oder den Grenzkosten plus Opportunitätskosten (Image, Kapazitätsengpässe u.a.) orientieren. Langfristig muss die Untergrenze mindestens die vollen Kosten decken. Die Preise können nicht mit gleicher Geschwindigkeit erhöht und gesenkt werden (Kostenstruktur, Kostenremanenz). Insbesondere relativ hohe Fixkosten reduzieren die strategische und operative Preisflexibilität. Die meisten Kosten sind jedoch gestaltbar, nur wenige sind eindeutig fix oder variabel. Der Kunde erwartet ehrliche Preise. Diese Preisehrlichkeit zeigt sich beispielsweise in der Angemessenheit oder der Einheitlichkeit der Preise. Sie stärkt das (Preis-) Vertrauen und die Kundenbeziehung (Beziehungsmarketing). 145 UZH | Marketing II • • • • • • Die einzelnen Branchen kennen unterschiedliche Preismodelle, beispielsweise der Handel (Handelsspanne, Produktrentabilität) oder der E-Commerce (Auktionen, Cost per). Beim Ausgleich von Produkten mit niedrigen und hohen Deckungsbeiträgen (Ausgleichskalkulation) ist das «normal» kalkulierte Produkt der Ausgleichsträger, der Ausgleichsnehmer beispielsweise ein Sonder- oder Lockvogelangebot. Neben den unternehmerischen Gegebenheiten (Deckungsbeiträge Produkte) hat dieses Vorgehen Grenzen im Kundenverhalten (smart shopper): Kauft der Kunde langfristig nur die günstigen Angebote (Ausgleichsnehmer), so fehlt der Umsatz der Ausgleichsgeber, und der preispolitische Ausgleich zeigt kontraproduktive Wirkungen (Image, Marke, Preisverfall u.a.). Eine Marktschwäche ist nicht a priori auf falsche Preispositionierungen zurückzuführen. Sie liegen oft auch im Verhalten des Anbieters (Verkäufer beginnt Preisdiskussion u.ä.). In solchen Situationen sind Preissenkungsaktionen wenig sinnvoll und vernichten unternehmerische Werte. Der Preis wird vom Kunden oft als statischer wie dynamischer Massstab der Beurteilung von Image und Qualität herbeigezogen, um so das vor dem Kauf empfundene Risiko zu senken. Umgekehrt kann der Preis vom Anbieter zur Positionierung (Image, Marke, Qualität) genutzt werden: Schaffung eines preispolitischen Spielraums (akquisitorisches Potential). Die Positionierung mittels dauerhaften Hoch- bzw. Niedrigpreisen ist Ausdruck einer (relativen) Preisstandardisierung, sei es durch den Marktführer oder den -folger. In internationalen Märkten bedingt dieses Vorgehen eine Ausrichtung der Preise auf die länderspezifische Wettbewerbssituation mittels preislichen Bandbreiten. Bei hoch innovativen bzw. modischen Produkten muss der Anbieter die Produktlebensdauer (Produktlebenszyklus) beachten: Können mit der gewählten Preispolitik die getätigten Investitionen (Entwicklung, Markteinführung u.a.) in der erwarteten Lebensdauer «verdient» werden? © 6.3.2. Vorgehen Preisbildung Das Vorgehen der Preisbildung hat sich am Markt (Kundennutzen), an der Konkurrenz (Kosten, Preise, Marketing, Reaktionsverhalten), an den eigenen Kosten (Deckungsbeiträge u.a.) und an den nichtpreislichen Marketingaktivitäten (Markenführung, Positionierung u.a.) zu orientieren. Dabei ist zwischen den Zielen einer Preisführerschaft (Preis-Mengen-Strategie) und einer Leistungsdifferenzierung (Präferenzstrategie) zu unterscheiden: • • Eine Preisführerschaft ist Ausdruck eines vereinfachten Marketing, beispielsweise einfacher Vertriebsweg und klare Positionierung über den Preis. Demgegenüber sucht die Leistungsdifferenzierung die Kundenbindung im Aufbau von Einmaligkeiten (high involvement, Image, Marke, Vertriebskanal u.a.). Bei der Preisbestimmung mittels Zuschlagskalkulation (cost plus-pricing) entspricht der Preis der Summe aus Kosten und Gewinn (P=K+G). Dieses Verfahren ist metho146 UZH | Marketing II disch einfach und anhand fester Kalkulationsschemata vollziehbar. Da es auf harten Kostendaten aufbaut, erlaubt es scheinbar eine bessere Bewältigung marktlicher Risiken. Das Target Pricing (target costing) geht demgegenüber von einem (globalen) tragfähigen Marktpreis (target price) aus. Es verknüpft die Marktund die Kostensituation. Nicht interne Gegeben- und Gepflogenheiten bilden die Preisbasis, sondern der Markt: Es gilt kunden- und konkurrenzorientiert einen am Markt erzielbaren Preis zu ermitteln, von dem ausgehend man durch Abzug eines geplanten Gewinns die vom Markt erlaubten Kosten (Zielkosten) erhält: Der Marktpreis minus der angestrebte Gewinn ergeben die Kosten (P-G=K). Diese maximal zulässigen Kosten (target costs) dürfen beim Angebot nicht überschritten werden. Die Stärken dieses Vorgehens liegen in der klaren Marktorientierung, die Schwierigkeiten im Erkennen und Festlegen des (globalen) Marktpreises. Im Sinne von Preisexperimenten können diese Marktpreise im Einzelhandel mittels Scanning und im E-Commerce mittels Auktionen erfahren werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht auch die Schätzung von Preisabsatzfunktionen. Da die festgelegten Preise einen hohen Einfluss auf die Gewinnsituation der anbietenden Unternehmung haben, sind Preisänderungen und -nachlässe mit Vorsicht zu tätigen: Eine einprozentige Anhebung/Senkung des Preises steigert/senkt den Betriebsgewinn um rund 10 %. © Die Wirkungen von Preisänderungen sind abhängig von den Preiselastizitäten. Diese sind das Verhältnis der relativen Änderung der Produktnachfrage zu der sie verursachenden relativen Änderung des Produktpreises. Eine hohe Preiselastizität liegt beispielsweise dann vor, wenn eine Preissenkung bzw. -erhöhung von 10 % eine Zunahme (Abnahme) der Absatzmenge von 20 % bewirkt; die Preiselastizität hat den Wert -2. Eine unelastische Situation liegt dann vor, wenn zum Beispiel eine Preissenkung bzw. erhöhung von 10 % eine Zunahme (Abnahme) der Absatzmenge um 5 % bewirkt; die Preiselastizität hat den Wert -0.5. Die Minuszeichen rühren daher, dass Mengen- und Preisänderungen entgegengesetzt verlaufen. Bei einem Wert von -1 liegt eine indifferente, beim Wert 0 eine vollkommen unelastische Situation vor. 147 UZH | Marketing II Empirisch gemessene relativ hohe Preiselastizitäten finden wir beispielsweise bei Kaffee oder Papiertüchern. Andere empirische Studien zeigen insbesondere, dass die Preiselastizität deutlich höher ist als die Werbeelastizität (Simon 1992). Bei jeder Preisfindung sind die Kenntnisse des Zusammenwirkens der verschiedenen Treiber (cost volume profit analysis) wesentlich. Da eine Preisbildung nie isoliert betrachtet werden darf, sind die Potentiale von nichtpreislichen Mehrwerten (value added) bzw. den vom Kunden wahrgenommenen Werten (perceived value) immer zu prüfen. © 6.4. Markteintritt Beim Markteintritt, sei es die Einführung eines Standardprodukts (built to plan) oder eines individualisierten Produkts (customizing, built to order) können hinsichtlich des Preises die folgenden Ziele verfolgt werden: 6.4.1. Marktabschöpfung Bei der Marktabschöpfung (skimming policy) erfolgt der Markteintritt mit relativ hohen Preisen: Abschöpfen eines beschränkten Marktes (Innovatoren). Der übrige Markt wird den günstigeren Nachahmern teilweise überlassen. Bei starker Konkurrenz kann der Preis sukzessive gesenkt werden, sofern dies beispielsweise der anfängliche Exklusivvertrieb (selektiver Vertrieb) zulässt (Push Strategie). 6.4.2. Marktdurchdringung Bei der Marktdurchdringung (penetration policy) erfolgt der Markteintritt mit relativ tiefen 148 UZH | Marketing II Preisen. Es gilt, auf ausreichend grossen Märkten schnell einen hohen Marktanteil zu erreichen (Volumenstrategie), um die Nachahmer abzuwehren. Später kann der Preis sukzessive erhöht werden, sofern der (End-)Kunde den anfänglich tiefen Preis nicht mit einer tiefen Qualität (Image) verbunden hat und Preiserhöhungen möglich sind (sinkende Kaufwahrscheinlichkeit bei steigenden Preisen). Diese Politiken sind spezielle Formen der Preisdifferenzierung: Die Bedeutung (operativ/strategisch), die Markt- und Wettbewerbssituation sowie die Vertriebswege (ECommerce u.a.) prägen die preispolitischen Entscheidungen beim Markteintritt. 6.5. Preisdifferenzierung Eine tragende preispolitische Möglichkeit in angestammten Märkten ist, oft in Verbindung mit einer Produktdifferenzierung, die Preisdifferenzierung zwecks einer differenzierten Marktbearbeitung: Käufergruppen können besser erschlossen werden, da möglicherweise die eine Gruppe den Ausgangspreis als zu hoch empfindet, somit nicht kauft, und bei der anderen Gruppe eine gegenüber dem Ausgangspreis höhere Preisbereitschaft besteht: Es müssen unterschiedliche Preisbereitschaften vorliegen und die Segmente identifizierbar und bearbeitbar sein (Marktsegmentierung). Aus ökonomischer Sicht dient daher die Preisdifferenzierung der Abschöpfung der Konsumentenrente. • • • • © Bei der horizontalen Preisdifferenzierung wird ein bestehender Gesamtmarkt in einzelne, abgrenzbare Marktsegmente mit Kunden ähnlicher Preisbereitschaft aufgeteilt. Die resultierenden unterschiedlichen Preise für die an sich gleiche Leistung können, je nach Markttransparenz, zu einer Diskriminierung einzelner Kunden führen. Daher ist diese Preisdifferenzierung mit weiteren Differenzierungen (Produkt, Marke, Technologie, Vertriebsweg u.a.) zu ergänzen. Eine zeitliche Preisdifferenzierung (Hoch-, Vor- und Nachsaison, Tag- und Nachttarif usw.) dient primär dem Kapazitätsausgleich. Eine räumliche Preisdifferenzierung ist zwischen regional verschiedenen Märkten (Inland, Ausland) möglich, beispielsweise bei ausgewählten Konsumgütern oder bei Leihwagen. Für eine langfristige Kundenbindung (Beziehungsmarketing) ist auch eine personelle Preisdifferenzierung (Alter, Erstkäufer, Geschlecht u.a.) sinnvoll. In internationalen Märkten fördert eine zu ausgeprägte Preisdifferenzierung den Arbitragehandel (diverting). Bei solchen Preisunterschieden entstehen graue Märkte mit lokalen und globalen Absatzmittlern (Intermediäre). Diese Märkte gleichen bei entsprechender Markttransparenz durch Reimporte die Preise längerfristig aus (Preisausgleichseffekt). 149 UZH | Marketing II Die Preisbündelung (pricebundling) stellt eine Sonderform der Preisdifferenzierung dar: Pakete aus Sach- und/oder Dienstleistungen werden im Bündel nicht zu Einzelpreisen, sondern zu einem Paketpreis angeboten. Die Bündelung ist vor allem für komplementäre Produkte sinnvoll und der Bündelpreis ist in der Regel niedriger als die Summe der Einzelpreise. So können beispielsweise Informationsinhalte (Börseninformationen, Sportberichte u.a.) im Internet als Gesamtpaket zu einem Bündel- oder Paketpreis (pure bundling) oder zusätzlich auch zu Einzelpreisen (Teilpreisen) angeboten werden (Wirtz 2000). Die Bündelung ermöglicht eine höhere Individualisierung der Leistung für den Kunden bei oft geringerer Markttransparenz für Kunde und Wettbewerber. Das Ertragsmanagement (yield management) erlaubt eine Feinsteuerung der Preisbildung (Preisdifferenzierung): Die Kapazitäten von Freizeitparks, Hotelketten, Mietwagenfirmen oder Schiffahrtslinien müssen ausgelastet werden (Beschäftigung, Kapitalbindung) und sind zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Nachfrager unterschiedlich viel wert (Enzweiler 1990). Die Idee dieses «Peak-load Pricing» sei für eine Fluggesellschaft skizziert: Ausgehend von externen Informationsquellen (Messedaten, Ferienzeiten u.ä.), internen Informationsquellen (Abkommen, Tarifstrukturen u.ä.), Buchungsdatenbank (Daten der Vergangenheit) und Reservierungs-/Check-in-Systemen (Daten der Gegenwart) kann eine Prognose über die zu erwartende Nachfragestruktur, den Buchungsverlauf und die Stornierungsrate erstellt werden. Diese Prognose wird mit den Erträgen und variablen Kosten je Kapazitätseinheit bewertet und optimiert. Dabei resultiert der Klassenmix (first class, business class, economy class), der Preismix und die Überbuchungsrate. Diese Preis-Mengensteuerung ermöglicht eine differenzierte Kapazitätssteuerung, hier der Sitzplätze, und eine optimale Angebotsgestaltung. © 6.6. Break-Even-Analyse Die Break-Even-Analyse (Gewinnschwellenanalyse) beantwortet beispielsweise die Frage: Bei welcher Absatzmenge werden die Kosten durch den Erlös des Produktes gedeckt? Das Verfahren setzt die Kenntnis der Kosten des einzelnen Produktes und ihre Aufspaltung in fixe und variable (proportionale) Kostenbestandteile voraus. Die Analyse geht von der folgenden Gleichung aus: 150 UZH | Marketing II © Die Differenz zwischen dem Preis und den variablen Kosten pro Stück (p - k ) bezeichv ). net man als Deckungsbeitrag pro Stück (DB Stück Der gesamte Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den erzielbaren Netto-Erlösen (Bruttoerlöse - Erlösminderungen) und den direkt zurechenbaren (variablen) Kosten (direct costs) eines Kostenträgers. Produkt, Sortiment, Abteilung oder Verkaufsstelle sind beispielhafte Kostenträger. Ein positiver Deckungsbeitrag liefert zuerst einen Beitrag an die fixen Kosten, dann an den Gewinn; ein negativer Deckungsbeitrag liefert keine Beiträge. Die Deckungsbeitragsrechnung ist vor allem dann sinnvoll, wenn es um eher kurzfristige Preisentscheidungen für einheitliche Produkte bei gegebener Kapazität und Kostenstruktur geht (Hill/Rieser 1990). Die Break-Even-Analyse kann in zwei Varianten dargestellt werden. Beide führen zum gleichen Resultat, die zweite Variante zeigt jedoch den gesamten Deckungsbeitrag (Erlös (E) - proportionale Kosten (Kv)) bei einer bestimmten Absatzmenge. Bei der mengenmässigen Nutzschwelle (x0) entspricht dieser Deckungsbeitrag den fixen Kosten (Kf): 151 UZH | Marketing II © Ein Beispiel soll die Break-Even-Analyse verdeutlichen: Der Produkt-Manager «Technische Kunststoffartikel» kennt für ein neues Produkt die folgenden Grössen: die einmalig anfallenden Kosten «Forschung und Entwicklung» € 70'000, die Anschaffungskosten der Spritzgussmaschine € 105'000, die Kosten der Markteinführung € 95'000. Die variablen Kosten betragen € 0.35 pro Stück, der geplante Verkaufspreis € 0.50 pro Stück. Die Lösung: Fixe Kosten (K ) € 270'000; f Deckungsbeitrag pro Stück (DB pro Stück) € 0.15; Breakeven-Absatzmenge (mengenmässige Nutzschwelle) 1.8 Mio. Stück; wertmässige Nutzschwelle (mengenmässige Nutzschwelle · Preis pro Stück) € 900'000. Bei einer geplanten jährlichen Absatzmenge von 0.3 Mio. Stück wird die Nutzschwelle in sechs Jahren erreicht. Eine vertiefte Marktanalyse zeigt, dass die Kunden nur einen Verkaufspreis von € 0.45 pro Stück akzeptieren. Die neue Lösung aufgrund der erwarteten Marktreaktion: Fixe Kosten (K ) € 270'000; f 152 UZH | Marketing II Deckungsbeitrag pro Stück (DB pro Stück) € 0.10; Breakeven-Absatzmenge (mengenmässige Nutzschwelle) 2.7 Mio. Stück; wertmässige Nutzschwelle (mengenmässige Nutzschwelle · Preis pro Stück) € 1'215'00. Bei einer geplanten jährlichen Absatzmenge von 0.3 Mio. Stück wird die Nutzschwelle erst in neun Jahren erreicht. Eine Preissenkung von 10 % bewirkte in diesem Beispiel eine Erhöhung der mengenmässigen Nutzschwelle um 50 %. Die Begründung liegt in den geringeren Deckungsbeiträgen an die relativ hohen fixen Kosten. 6.7. Konditionen Die Konditionen sind Ausdruck der Geschäftsbedingungen und führen zu direkten und indirekten Preisnachlässen, oft in kombinierter Form. Ihre Ausgestaltung prägt das Kunden- und Konkurrenzverhalten ebenso wie die unternehmerische Ertragsseite. 6.7.1. Rabatte © Rabatte sind Nachlässe von den festgelegten oder ursprünglich geforderten Preisen. Diese Vergütungen verändern den Preis und sind wie folgt strukturierbar (Meffert 2000): • • • • Die Leistungen des Handels werden vom Hersteller mittels Funktionsrabatten abgegolten, beispielsweise Pauschalfunktionsrabatt (Grosshandel, Einzelhandel), Marktbearbeitungsrabatt (Aktionen, Messe, Leistungszuschuss, Zweitplazierung u.a.), Finanzierungsfunktionsrabatt (Delkredere, Skonti u.a.). Die Mengenrabatte (Abschlussrabatt, Volumenrabatt u.a.) beruhen auf dem Bezug einer bestimmten Menge in einem gewissen Zeitraum. Der vereinbarte Bezug kann vertraglich geregelt sein oder auf Vertrauen (commitment) beruhen. Der Zeitpunkt der Bestellung bzw. der Lieferung (Abnahme) kann zum Zeitrabatt (Einführungsrabatt, Saisonrabatt u.a.) führen. Zeitrabatte in Form von Auslaufrabatten werden, ausser bei Lagerräumungen, oft mit Produktvariationen verbunden. Der Treuerabatt zielt auf langfristige Geschäftsbeziehungen ab, sei es für Händler (Rückvergütungen u.a.) oder Endkunden (Club, Rückvergütung, Rabattmarken u.a.). Beziehen sich die Treuerabatte auf die Ebene der Endkunden, so spricht man von Verbraucherrabatten. In verschiedenen Branchen geben Rabatte Machtasymmetrien im Absatzkanal wieder: Mit zunehmender Macht des Kunden (Einkaufsmacht) wächst tendenziell die Höhe der vom Lieferanten einzuräumenden Konditionen (Rabatte u.a.). 153 UZH | Marketing II 6.7.2. Factoring Das Factoring ist eine Form der Finanzierung, d.h. der Beschaffung finanzieller Mittel: Der Anbieter überträgt seine Forderungen gegenüber einem Kunden einer Factoringgesellschaft (factor). Da der Kunde an diese Gesellschaft bezahlt, entfallen für den Lieferanten Risiken (Forderungsausfall, Vorfinanzierung). Für diese Leistungen erhebt die Factoringgesellschaft eine Gebühr. 6.7.3. Kredite Eine wettbewerbsflexible Preispolitik sollte die Möglichkeiten von Krediten beinhalten. Diese dienen der Steigerung des Absatzvolumens, sei es durch Gewinnung neuer Kunden oder durch Mehrkäufe (Menge, Wert) bisheriger Kunden. Der Kreditfinanzierung wie dem Mietvertrag kommt das Leasing sehr nahe. Es ist keine Finanzierung im eigentlichen Sinne, da ein Leasinggeber (lessor) einem Leasingnehmer (leaser) ein Objekt für die Laufzeit des Leasingvertrags zur Nutzung überträgt. Grundsätzlich bezahlt der Kunde eine Leasinggebühr in Form einer Einmalzahlung und wiederkehrenden Teilbeträgen. Je nach Vertrag werden zusätzlich Ausgleichszahlungen fällig, beispielsweise für einen schlechten Produktzustand bei der Rückgabe. © Nach dem Leasingobjekt können wir zwischen dem Konsumgüter- und Investitionsgüterleasing (equipment-, plant-leasing), nach der Vertragsform zwischen dem Operatingund Financial-Leasing unterscheiden: • • Das Operating-Leasing ist kurzfristiger Natur, wird meist von einem Hersteller oder Händler direkt getätigt. Diese Leasinggeber übernehmen umfassende Ersatz-, Reparatur- und Serviceleistungen und tragen das Investitionsrisiko. Das Financial-Leasing ist in der Regel ein reines Finanzierungsleasing mit mittelbis langfristigem Charakter unter Einschaltung Dritter (Banken, Leasinggesellschaften). Das Investitionsrisiko trägt der Leasingnehmer. Mischformen dieser beiden Leasingformen sind möglich. 6.7.4. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Gegenstand der Geschäftsbedingungen und können die folgenden Aspekte beinhalten: Garantie, Kompensationsgeschäft, Konventionalstrafe, Serviceleistungen oder Umtauschrecht. 154 UZH | Marketing II 6.8. Ökologie Mess- und Bewertungsprobleme erschweren in der Preispolitik die Berücksichtigung ökologischer Produkt- und Prozesswirkungen in den einzelwirtschaftlichen Kosten. Jedoch können ökologiebedingte Kosten, beispielsweise umfassende umwelttechnische Prüfungen, zu Kosteneinsparungen für die Unternehmung führen, da Ressourcen effektiver und effizienter eingesetzt werden. Die Überwälzung ökologiebedingter Kosten, sei es über erhöhte Endpreise und/oder Pfandgebühren, hängt von der ökologischen Preisbereitschaft, dem Gap zum tatsächlichen Kaufverhalten (Burghold 1988) und dem ökonomischen Vorteil für den einzelnen Nachfrager ab. So führt beispielsweise der Ersatz eines Haushalts-Kühlschrankes «Modell 1978» durch ein «Modell 1988» zu einer jährlichen Energieeinsparung von 237 kWh (Nutzenergie) (Schläpfer 1989). Das enge Preisverständnis -Preis als geldliches äquivalent - ist in einem umfassenden Markt- und Umweltverständnis aufzubrechen: Die nicht- monetären Preisdimensionen sind Ausdruck der eingesetzten Zeit (Suche umweltfreundlicher Produkte), des persönlichen Engagements (Papiersammeln) oder des Verzichts (Bequemlichkeitsverlust durch den Umstieg vom privaten auf das öffentliche Verkehrsmittel). Diese Preisdimensionen stellen nicht-monetäre Markteintrittsbarrieren für die anbietende Unternehmung dar und erfordern ihre Berücksichtigung im gesamten Marketing-Mix. © 155 UZH | Marketing II 7. Distributionspolitik 7.1. Aufgaben Distributionspolitik Die Distributionspolitik stellt sicher, dass die richtige Leistung zur gewünschten Zeit in der richtigen Menge am gewünschten Ort ist. Zwecks Überwindung von Zeit und Raum legt sie den Güterfluss (Beschaffungs-und Absatzkanal, Retrodistribution) und die Güterhaltung(Beschaffungsniveau, Lieferniveau) sowie die Auswahl und Kooperation mit den Absatzmittlern fest. Im Kontext der Marketingziele und -strategien sind die folgenden Ziele Gegenstand einer Distributionspolitik: • • • Mit der Selektion der Absatzkanäle (Vertriebswege) werden die Positionierung (Flexibilität, Image, Marke u.a.), die Kontrollierbarkeit der Vertriebsleistungen (Qualität, Service u.a.) und die Vertriebskosten (Handelsspanne, Rabatte u.a.) festgelegt. Der Distributionsgrad drückt den Anteil der Absatzmittler aus, welche ein Produkt in ihrem Sortiment führen, bezogen auf einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum. Die gewichtete Distribution strebt eine qualitative Selektion der Absatzmittler (Exklusivität, Selektivität) an. Ein möglichst flächendeckender Vertrieb ist Ausdruck einer ungewichteten (intensiven, numerischen) Distribution: Das Produkt ist überall erhältlich, ähnlich einer Ubiquität. In verschiedenen Branchen sind die distributionspolitischen Ziele mit konzeptionellen und technischen Lösungen verbunden, beispielsweise Efficient Consumer Response (ECR) oder Electronic Data Interchange (EDI). © 7.2. Logistik Die Logistik oder das logistische System ist die sinnhafte Verknüpfung von Beschaffung (Procurement, Physical Supply) und Verteilung der Güter (Distribution, Physical Distribution) zu einem synergetischen Ganzen. In dieser gesamtheitlichen Sicht sind die Entscheidungen von Standort und Lagerhaltung eingeschlossen und der Warenfluss kann vom Informationsfluss nicht losgelöst werden (Heskett 1977). Die Marketing-Logistik ist konsequenterweise jene Funktion des Marketing, welche eine möglichst optimale Gestaltung, Steuerung und Kontrolle des physischen Warenflusses sowie des dazugehörenden Informationsstroms anstrebt (Krulis-Randa 1977). Im Mittelpunkt steht der Güterfluss und nicht die Lagerhaltung, denn «tote» Produkte sind teure Produkte. Zudem sind einzelne Produkte, beispielsweise Dienstleistungen, nur bedingt lagerfähig. 156 UZH | Marketing II In eine Gesamtsystembetrachtung (total system efficiency) ist, trotz der fehlenden Marktbeziehung, die innerbetriebliche Logistik zu integrieren: © Die Anforderungen der Industrie (hoher Distributionsgrad, Just in Time-Produktion, Senkung des Eigenfertigungsgrades (Reduktion der Fertigungstiefe), weltweite Beschaffung (global sourcing) u.a.) und des Handels (Abbau der Lagerbestände, hohe Lieferbereitschaft, Erhöhung des Bestellrhythmus (Just in Time-Belieferung), weltweiter Einkauf, elektronischer Datenaustausch u.a.) sowie die noch nicht ausgeschöpften Rationalisierungsreserven bei allen Beteiligten führen vermehrt zu kooperativen Logistikkonzepten wie zur Fremdvergabe von Logistikfunktionen an Dritte. Eine umfassende Gestaltung der Waren- und Informationsflüsse von der Urproduktion zum Endkunden (Vertikalisierung) kann jedoch nur durch umfassende Kooperationen vollzogen werden. Logistikkonzepte finden wir auch in der Dienstleistungsbranche in verschiedenster Ausgestaltung. Ein Beispiel sind die Computer-Reservierungssysteme (CRS) im Luftverkehr: Die von den USA seit 1978 betriebene Deregulierung im Luftverkehr (open sky) und die Liberalisierung des europäischen Luftverkehrs förderten den Aufbau globaler Reservierungssysteme (Flugreisen, Hotels u.a.). Hat ein Kunde mehrmals über ein solches Reservierungssystem gebucht, so lässt sich sein Kundenprofil erstellen (Airlines, Destinationen, Hotels, Mietwagen, Sitzplatz, Zahlungsart usw.). Diese Informationen erlauben der einzelnen Unternehmung eine Individualisierung (Mass Customization) der angebotenen Leistungen und eine Stärkung der Kundenbindung (Beziehungsmarketing). Und der Kunde kann seine Transaktionskosten (Such-, Informations- und Verhandlungskosten) reduzieren. 157 UZH | Marketing II 7.3. Handelsbetrieb 7.3.1. Vertriebsformen Die Wahl der Vertriebsform hat eine akquisitorische Bedeutung und wird von den folgenden Kriterien geprägt: (1) Kunde (Einkaufsgewohnheiten, Standort u.a.) (2) Produkt (Erklärungsbedürftigkeit, Lagerfähigkeit u.a.), (3) Absatzmittler (Frequenzen, Margen u.a.), (4) Konkurrenz (Vertriebswege, Wettbewerbsintensität u.a.), (5) Unternehmung (finanzielle Mittel, Sortiment u.a.) und (6) Rahmenbedingungen (Recht, Trends u.a.). Beim Direktvertrieb erfolgt der Vertrieb eines Produktes direkt an den Kunden: Es besteht ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem Hersteller und dem Endkunden. Für den indirekten Vertrieb benötigt es gewisse Absatzmittler (Eigen-, Fremdvertrieb), beispielsweise Handelsbetriebe, Kommissionäre oder Vertreter (Aussendienst). In einem umfassenderen Verständnis sind Formen des medialen Vertriebs (Automatenverkauf, Teleshopping u.a.) als Absatzmittler verstehbar und oft vom Verkauf nicht trennbar. Direkter wie indirekter Vertrieb können aus Herstellersicht als eigene Vertriebsorganisation aufgebaut oder Dritten übertragen werden. Der Einsatz dieser Mittler wird von den Marketingzielen und der jeweiligen Branche (Internationalität, Struktur, Vergangenheit u.a.) wesentlich geprägt. So werden beispielsweise die schweizerischen Verlagsprodukte über zwei Vertriebskanäle abgesetzt: direkt über (eigene) Automaten, Verträger (Abonnement); indirekt über Grosshändler (nationale Verteiler, Kioskagenturen) und Einzelhändler (Buchhandlungen, Kioske, Abonnement) (Wolf/Wehrli 1990). © 7.3.2. Handelsbetriebsformen Um die qualitativen, quantitativen, räumlichen und zeitlichen Spannungen zwischen der Produktion und dem Gebrauch/Verbrauch auszugleichen, nimmt der Handelsbetrieb grundsätzlich die folgenden Funktionen wahr: (1) Raumüberbrückung, (2) Zeitüberbrückung, (3) Mengenausgleich, (4) Sortimentsgestaltung, (5) Qualitätssicherung, (6) Beratungsleistungen, (7) Serviceleistungen, (8) Kreditgewährung, (9) Kommunikation, (10) Information und (11) Weckung von Bedürfnissen (Tietz 1993). Wir können die folgenden Handelsbetriebsformen unterscheiden (Tietz 1985): Eine interessante Entwicklung im stationären Einzelhandel hat das Tankstellengeschäft durchgemacht. Eine Tankstelle hat eine Verkaufsfläche bis zu 300 qm und führt ein breites, flaches Sortiment mit 250 bis 3000 Artikeln (convenience goods). Sie bietet erweiterteÖffnungszeiten, ist gut erreichbar und verzeichnet einen hohen Kundendurchlauf (BBE Data Kompakt 2001). Ihre Leistungen liegen in der Dienstleistung (Automaten, Lotto, Reinigung u.a.), in der Gastronomie (Getränke, Kaffeebar, Snacks u.a.) und im Handel (Batterien, Brot- und Backwaren, Kraftstoff, Zeitschriften u.a.). 158 UZH | Marketing II © 7.3.3. Vertikales Marketing Bei der Erfüllung der Handelsfunktionen haben die Hersteller und die Handelsbetriebe (Grosshandel/Einzelhandel) oft unterschiedliche Interessen: 159 UZH | Marketing II Die unterschiedlichen Ziele führen zu möglichen Kommunikations-, Macht-, Rollen- und Zielkonflikten, deren Ursachen in der Aufgabenverteilung, in Informationsasymmetrien, in der Machtausübung und in den Zielprioritäten liegen (Meffert 2000). Die gemeinsame Überwindung dieser Konfliktbereiche ist Gegenstand eines vertikalen Marketing von Hersteller und Handel. Die Ausgestaltung vertikaler Beziehungen (Verkauf Hersteller - Einkauf Handel) wird oft auch als Trade-Marketing oder POS-Marketing umschrieben (Zentes 1989). In diesen Beziehungen kann der Hersteller dem Händler Anreize bieten: Mit diesem «Push-Konzept» wird versucht, das Produkt und/oder die Marke in das Handelsregal mittels Anreizen (Exklusivität, Handelsspanne, Rabatte u.a.) hineinzudrücken (Meffert 2000). Im «Pull-Konzept» löst der Endkunde aufgrund von Marketingmassnahmen des Herstellers beim Handel einen Nachfragesog aus und veranlasst den Handel zur Produktführung (Regalaufnahme). Gelingt es dem Hersteller jedoch nicht, ein starkes Marketing (Marken u.a.) im Markt aufzubauen, so wird ihm die Marketing-Initiative vom Handel langfristig entzogen. © Wesentliche strategische Gestaltungselemente vertikaler Konzepte sind für den Hersteller die Marktselektion (Grad der Marktabdeckung, Struktur der Absatzwege) und das Marktverhalten (Anpassung, Autonomie, Partnerschaft, Umgehung). Der Marketing-Mix beinhaltet die Sortimentsgestaltung, die Logistik (EDI, Verpackung u.a.), die Plazierung am POS (point of sale), das Merchandising, die Verkaufsförderung und die Werbung. Die konkrete Ausgestaltung dieser Strategien findet ihre Grenzen in der Nachfragemacht des Einzelhandels. Dieser kann seine Nachfragemacht beispielsweise mittels Einkaufsgemeinschaften, freiwilligen Ketten oder Lieferantenkooperationen weiter stärken. Der Aufstieg der Handelsmarken, meist in Richtung des mittleren Preissegments (medium brand), ist zusätzlich ein Weg des Handels gegen den Gewinnverfall und für seine unternehmerischen Möglichkeiten. Da ein nicht unerheblicher Teil der Hersteller neben den eigenen Marken auch Handelsmarken produzieren, unterstützen sie den Handel (Know-how-Transfer u.a.) zusätzlich, so dass die Handelsmarken aufgrund ihrer Leistung (Innovation, Ökologie, Qualität u.a.) keine Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. 160 UZH | Marketing II Anderseits führen marktliche und technologische Entwicklungen zur Schwächung des Handels: Beim Grosshandel sind es zum Beispiel die Möglichkeiten des E-Commerce (B2B) und die Vor- und Rückwärtsintegrationen (Hersteller, Einzelhandel). Beim Einzelhandel bewirken die gesättigten Märkte (Konzentrationsdruck, Margendruck, Preisverfall, Standortkosten, unentgeltliche Zusatzleistungen u.a.) und der E-Commerce (Beratung, digitalisierbare Leistungen, Preistransparenz u.a.) Verunsicherungen. 7.4. Franchising Franchising ist eine vertraglich geregelte vertikale Kooperation zwischen zwei rechtlich selbständigen Unternehmungen: dem Franchisegeber und dem Franchisenehmer. Der (unbefristete) Vertrag regelt die entgeltliche Gewährung eines Nutzungsrechtes (Lizenz) an einer vom Franchisegeber entwickelten geschützten Konzeption (Hansen/Algermissen 1979): Marketingsystem für ein Produkt, Abfüllsystem von Getränken oder Verkäuferschulung. So können wir zwischen drei Kategorien von Franchising unterscheiden: • • • © Produkt-Franchise (Coca Cola, Pepsi Cola), Vertriebs-Franchise (Benetton, Yves Rocher) oder Dienstleistungs-Franchise (Burger-King, Holiday Inn, Manpower, McDonald's, Portas). Franchise-Systeme sind in andere Vertriebsformen integrierbar und verbessern für den Franchisegeber die Chancen des Markteintrittes und -wachstums. Sie reduzieren den Einsatz finanzieller Mittel und die laufenden Betriebskosten (Standardisierung der Leistung). Die unternehmerische Selbständigkeit im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen, die Risikoabsicherung, der relativ geringe Kapitalbedarf und die schnelle Übernahme (Zeit als Wettbewerbsfaktor) von Leistungspaketen (Image, Know-how, Kompetenz, Schulung u.a.) sind wesentliche Vorteile für den Franchisenehmer (Skaupy 1987). 7.5. Ladengestaltung Jedes Produkt muss über entsprechende Distributionskanäle verfügen. Ist der eingesetzte Absatzmittler ein Einzelhandelsgeschäft, so gewinnt das Instrument der Ladengestaltung (Ladenlayout) zwecks Differenzierung und Individualisierung zunehmend an Bedeutung. Diese primär non-verbalen und sozial-psychologischen Einflussfaktoren 161 UZH | Marketing II dienen der Schaffung vonKauflust (Kaufanregung) und der Beeinflussung des emotionalen Entscheidungsverhaltens (Impulskäufe, Verweildauer) (Diller/Beba 1988). Neben der Schaufenstergestaltung, der Sortiments- und Servicepolitik ist die Ladengestaltung verstärkter Ausdruck dieser Erlebnisorientierung, deren Möglichkeiten von der Betriebsform und dem Standort wesentlich geprägt werden. Entstanden vor etwa 200 Jahren in Orléans, später in Mailand die ersten Einkaufspassagen, so sind die unterschiedlich anziehenden Atmosphären heutiger Anlagen, oft durch die Integration alter, revitalisierter Bausubstanz erreicht, Ausdruck umfassender emotionaler Positionierungen von Ladengeschäften. Unter diesen Aspekten hat das Warenhaus, trotz der bis heute fortdauernden Problemphase im Lebenszyklus, mit seiner ausgedehnten Sortimentsbreite («Alles unter einem Dach»-Kompetenz) wesentliche strategische Möglichkeiten einer erlebnisorientierten Ausrichtung, insbesondere durch die qualitative Verbesserung des Leistungsprogrammes bei höheren Preisen (trading up). Die Ladengestaltung im Inneren wie im Betriebsumfeld soll sich an den Erlebniswelten der Kunden orientieren (Weinberg 1986): © Erlebnisorientierte Gestaltungsformen sind beispielsweise wochenmarktähnliche Arrangements von Gemüse- und Früchteständen (Trend zur Individualisierung), Schaubacken von Broten (Trend zur Natürlichkeit), Veranstaltungen (Trend zur Kommunikation) oder Festivals (Trend zum Erlebnis). Dadurch erreicht man eine Förderung der Kommunikation unter den Kunden, eine abwechslungsreiche Einkaufsatmosphäre und eine dem Lebensstil des Kunden angepasste Individualität des Konsums. Umfassendere Formen, beispielsweise die Zentren «West Edmonton Hall» (Kanada) oder «Bluewater» (London), entwickeln sich vom Einkaufszentrum zum Freizeitzentrum (mixed use): In solche Zentren sind erlebnisorientierte Freizeitmöglichkeiten (Restaurants, Schwimmbad, Tennis, etc.) integriert. Damit werden die aktuellen Wertetrends abgedeckt (Freizeit, Erlebnis, Genuss, Gesundheit und Umwelt) (Silberer 1987, Weinberg/Gröppel 1988). 162 UZH | Marketing II Die erlebnisorientierte Einkaufsstättengestaltung ist eine bewusste Gestaltung des Corporate Image und Ausdruck einer emotionalen Positionierung. Diese kann von den angebotenen Produkten (Design, Marke, Qualität, Sortiment u.a.) und ihren Verpackungen (Bequemlichkeit, Erlebnis, Information, Ökologie u.a.) nicht losgelöst werden. Tragende Voraussetzungen für diese Konzepte sind zudem die Qualität des Verkaufspersonals (Marketingkultur), das Reklamationsverhalten (Beschwerdemanagement) sowie die differenzierte Zielgruppenorientierung (Marktsegmentierung), insbesondere in hoch modischen Bereichen, seien sie zeitbegrenzt oder lebensbegleitend. Eine erfolgreiche und unverwechselbare Positionierung ist für den einzelnen Handelsbetrieb dann erreicht, wenn der Betriebstyp eine klare Botschaft vermittelt, aus der Sicht des Kunden eine eindeutige Marktfunktion erfüllt und der Kunde eine emotionale Beziehung zum Betriebstyp entwickelt (Betriebstypen-Affinität) (Drexel 1990). Der qualitätsorientierte Erlebnishandel stärkt so im Sinn eines vertikalen Marketing die präferenzbildenden Marketing-Aktivitäten des Herstellers (Produkt-, Marken-Image). 7.6. Regaloptimierung © Im Einzelhandelsbetrieb besteht eine Raum- und Regalplatzknappheit. Ihre Ursachen liegen 1. im Kundenverhalten (Bequemlichkeitsstreben, zunehmende Bedürfnisdifferenzierung u.a.), 2. im Herstellerverhalten (Streben nach hoher Distributionsdichte, zunehmende Produktvielfalt u.a.), 3. im Verhalten der Handelsbetriebe (Beschränkte Vermehrbarkeit von Regalplätzen, Konkurrenz Handels-/Herstellermarken u.a.) und 4. in den Rahmenbedingungen (Selbstbedienung, Flächenrestriktionen u.a.). In diesem Kontext dient die Regaloptimierung der Steigerung der Regalrentabilität, sei es durch die Verhinderung von Out of Stock-Situationen, die Verbesserung der Sortimentsgestaltung, eine abverkaufsgerechten Plazierung oder die Senkung der Kapitalbindung durch einen Bestandesabbau (Hertel 1999). Möglichkeiten einer Regalplatzsicherung durch den Hersteller finden wir beispielsweise bei den folgenden Konzepten: Depotsystem (Warenverkauf), Rack Jobber (Regalplatzmiete) oder Shop in Shop bzw. Store in Store (Abteilungs-/Ladenmietsystem). Die Regaloptimierung ist Teil einer umfassenden Raum- und Flächenoptimierung (Space Management) und hängt, je nach Zielsetzung, mit dem Category Management zusammen. 163 UZH | Marketing II 7.7. Warenwirtschaftssysteme Ein Warenwirtschaftssystem sollte die sich aus den Warenbewegungenergebenden wert- und mengenmässigen Informationen möglichst artikelgenau erfassen, die Bestände fortschreiben, aufbereiten und auswerten und damit ein Steuerungssystem aufbauen, mit dem Kosten und Umsatz wirkungsvoll beeinflusst werden (Tietz 1984). Zu den Elementen (Stationen) eines geschlossenen, gesamtheitlichen oder integrierten Warenwirtschaftssystems zählen Bestellwesen, Wareneingang, Warenauszeichnung (Etikettierung), Lagerhaltung und Warenausgang. Dabei werden alle Warenbestände artikelgenau geführt und kurzfristig fortgeschrieben (Hertel 1999). Der Nutzen liegt in der Beschleunigung des Informationsflusses und der Reduktion von Verwaltungskosten (Electronic Data Interchange) (Barth 1996), auch über mehrere Handelsstufen und prozesse (mehrstufige Warenwirtschaftssysteme). Beispielhafte Inhalte von Warenwirtschaftssystemen sind (1) zeitnahe Belieferung des einzelnen Handelsbetriebes im Rahmen der gesamten Wertschöpfungskette (just in time JIT, quick response QR), (2) Expertensysteme (Kombination Warenbewirtschaftung und Marktforschung) sowie die (3) Produktrentabilitäts- und Regalbewirtschaftungskonzepte (Direkte Produktrentabilität DPR). Erweiterungen ergeben sich in Kombination mit den elektronischen Medien: Ergänzungen mit Tele-Shopping und/oder E-Commerce. Alle integrierten Systeme sind in die vertikalen Marketing-Konzepte einzubetten. © Umfassendere Möglichkeiten zur Verbesserung des Informations- und Warenflusses zwischen Hersteller und Handel bieten rechnergestützte Warenwirtschaftssysteme (computer integrated merchandising CIM). Voraussetzungen dazu sind ausgezeichnete Produkte (Europäische Artikelnumerierung EAN, optical character recognition code OCR, Strichcode), Normen für den strukturierten Datenaustausch (Electronic Data Interchange for Administration EDIFACT u.a.) und installierte Scanner (optische Lesegeräte). Das Scanning ermöglicht eine artikelgenaue, ort- und zeitkongruente Datenerfassung zur Steuerung des Warenflusses (Bestellung, Lagerhaltung, Renner- und Pennerlisten u.a.) und für die Marktforschung (Abverkäufe Aktionen, Warenkorb u.a.). Kunden- und Artikeldaten sind umfassender kombinierbar (Data Mining, Data Warehouse), wenn der Kunde seine Identität am Verkaufspunkt offenlegt (Kundenkarte, Treuekarte). Die Datenintegration ist gleichsam ein Zusammenfügen von Handelspanel und Haushaltspanel. Diese Prozessinnovationen erlauben in einer umfassenden Ausgestaltung - je nach Transaktionsvolumen und Vernetzung - einen elektronischen Bestell-, Lieferund Marktdatenverbund. Die Systemvorteile liegen in der Reduktion der Lagerbestände und der Risiken der Unverkäuflichkeit, der Vermeidung von Lieferengpässen (Out of Stock-Situation) sowie den Harmonisierungsmöglichkeiten des Marketing-Mix (Aktionen, Preisauszeichnungen u.a.). Bei sehr hohen Transaktionsvolumen ermöglicht ein Rechnungs- und Zahlungsverbund (Electronic Bill Presentment and Payment EBPP, Electronic Funds Transfer -Point of Sale EFT-POS) zusätzlich die kostengünstige Abwicklung des gesamten Geldgeschäftes zwischen Handel, Kunden und Geldinstituten. 164 UZH | Marketing II 7.8. Efficient Consumer Response Eine umfassendere Ausgestaltung der Zusammenarbeit wie des vertikalen Marketing finden wir im Konzept «Efficient Consumer Response». Seine Wurzeln liegen im sogenannten Quick-Response-System der nordamerikanischen Textilindustrie. Dieses Konzept richtet sich nicht nach den konfliktären Eigeninteressen von Hersteller und Handel, die nur die eigene Wertschöpfungskette optimieren wollen («Mein Gewinn ist Dein Verlust»); im Vordergrund steht vielmehr ein kooperatives Verhalten, das die Verbesserung der gesamten Wertschöpfungskette verfolgt (der Endkunde soll die richtige Leistung am rechten Ort zum richtigen Preis zur rechten Zeit erhalten). In einer solchen Wertschöpfungspartnerschaft ist die Fähigkeit, sich in die Partnerschaft einzubinden, ein ebenso kritischer Erfolgsfaktor wie das Einbringen eindeutiger Leistungskompetenzen (Kernkompetenzen). Das Konzept «ECR» konkretisiert sich in verschiedene Grund- bzw. Basisstrategien: • • • • Die Efficient Product Introduction (EPI) beinhaltet die gemeinsame Optimierung der Produktentwicklung und -einführung zwecks einer schnellen und kostengünstigen Reaktion auf verändertes Kundenverhalten. Die Efficient Promotion (EP) ist Ausdruck einer effizienten Handelsund Kundenkommunikation (Verkaufsförderung, Werbung u.a.); sie beabsichtigt eine schnelle und effektive Reaktion auf Kundennachfragen. Das (Continuous) Efficient Replenishment (ERP) ist die logistikorientierte Strategie: Es gilt den Güter- und Informationsfluss entlang der gesamten Versorgungskette (supply chain) zu optimieren (beispielsweise durch eine Automatisierung der Bestellung mittels Electronic Data Interchange (EDI), ausgehend vom Warenabverkauf (scanning) und durch stimmiges Informationsmanagement (information sharing)). Das Efficient (Store) Assortment (EA) beinhaltet als Bestandes- und Regaloptimierung (Space Management) die kundengerechte Produktplazierung (Category Management), eine eindeutige Kundenkontaktstrecke sowie eine präzise Preisfindung, um die Regalproduktivität (Steigung Umschlagsgeschwindigkeit) zu verbessern. Das Erzielen dieser Sortimentsproduktivität bedingt im Sinn von Efficient Unit Loads (EUL) auch die Schaffung einheitlicher Ladungsträger und somit die bestmögliche Zusammenfassung einer Gruppe von Produkten in sekundären und tertiären Verpackungen (Versandkartons/Paletten) zum Zweck einer leistungsfähigen und schlanken Logistik, möglicherweise auch durch direktes Umladen der Waren ohne Einlagerung (cross docking). © Einzelne Autoren fassen das Efficient Store Assortment (EA), das Efficient Product Introduction (EPI) und die Efficient Promotion (EP) im Konzept Category Management zusammen; andere Autoren verstehen Category Management als Voraussetzung für das Konzept «Efficient Consumer Response». Category Management ist eine Organisationsform, bei der die prozessuale Verantwortung - von der Beschaffung bis zur Vermarktung - in einer Hand liegt bzw. nach Produkt- bzw. Warengruppe (categories) organisiert ist (Hertel 1999). Daher verstehen einzelne Autoren eine Produkt- bzw. Waren165 UZH | Marketing II gruppe, beispielsweise «Aufbau- und Vitaminpräparate» (Energy-Drinks, Fruchtsäfte, Früchte, Gemüse, Kraftnährmittel, Sportlergetränke u.ä.), als Strategische Geschäftseinheit (SGE). Durch die stimmige Ausrichtung auf themenspezifische Kundenbedürfnissen (one stop shopping) ist eine verbesserte Produkt- bzw. Warengruppenleistung erzielbar. Dies bedingt eine institutionelle Verankerung (Category Manager, Category Team) der von Hersteller und Handel gemeinsam gestalteten und optimierten Prozesse (automatische Nachbestellung, kontinuierliche Nachlieferung u.a.). Category Management unterstützt durch die Steigerung des Kundennutzens mögliche Ergebnisverbesserungen und die Umsetzung von Efficient Consumer Response in ein integriertes Gesamtkonzept. Die Implementierung von Efficient Consumer Response bewirkt eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität, der Renditen und Umsätze, eine Reduktion der Personalkosten und Warenbestände sowie eine Schwächung schwacher Herstellermarken. Mögliche Werkzeuge zur Realisierung von Efficient Consumer Response sind am Informations- und Warenfluss orientiert: (1) der elektronische Informationsaustausch (Electronic Date Interchange EDI), (2) die elektronische Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Electronic Funds Transfer EFT), (3) eine exakte Datencodierung und -führung (Scanning POS, Warenwirtschaftssystem), (4) eine entsprechende Prozesskostenrechnung (Activity Based Costing, Balanced Scorecard) zwecks Beurteilung der ECR-Leistungen. 7.9. Ökologie © Logistik kann sich ökologischen Fragestellungen nicht entziehen; dazu gehören Standortwahl (Entsorgungspotentiale, Flächenverbrauch, Flächenrecycling), RecyclingBeschaffungsmärkte, Reduktion lagerzeit-, lagerort- und transportbedingter Emissionen (Seidel/Menn 1988). In der Wahl der Transportmittel (Schiene, Strasse) und in der konkreten Ausgestaltung der gesamten Logistik finden sich unterschiedliche ökologische Lösungen. Bei konsumnahen Produkten gewinnt die Retrodistribution im logistischen System zusätzlich an Bedeutung: Die Abfallbewältigung und -reduktion erfordert dabei eine Rückführung von Produkten und Produktelementen, insbesondere Verpackungen: 166 UZH | Marketing II Bei der Rückführung können wir zwischen direkten und indirekten Retrodistributionssystemen (Burghold 1988) unterscheiden: Ist ein direktes System durch das unmittelbare Zusammentreffen von Erstanbieter und Letztnachfrager (Abholen, Sammelstellen) charakterisiert, so sind bei indirekten Systemen selbständige Unternehmungen zur Überwindung der marktlichen Distanzen in die Rückführung integriert. Traditionelle indirekte Systeme sind die Rückgabemöglichkeiten für Getränkeflaschen im Einzelhandel. Ein direktes System ist die Rückführung ausgedienter Personal Computer an Sammelstellen. Dort kann das Produkt überprüft und anderen Märkte zugeführt oder fachgerecht zerlegt werden. © Retrodistributionssysteme finden ihre Grenzen, neben fachlichen Unkenntnissen und persönlichen Bequemlichkeiten der Kunden (fehlende «Sammlerkultur»), in den Kosten des Systemaufbaus und der Systempflege (Erlös aus Recycling, Entsorgungsgebühr, Logistik). Konsequenterweise setzt die Ökologie ein in sich geschlossenes, interessenharmonisiertes vertikales Marketing voraus. 7.10. Stadtmarketing Stadtmarketing ist die gesamtheitliche Ausrichtung einer Stadt (Gemeinde) und ihrer langfristigen Beziehungen auf stadtinterne und -externe soziale Anspruchsgruppen (stakeholders). Während die aktuellen wie potentiellen Anspruchsgruppen (Bürger, Investoren u.a.) einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg einer Stadt nehmen, gestalten die oft sehr heterogenen Interessengruppen (Parteien, Verbände u.a.) den Erfolg mittelbar mit. Die Trägerschaft des Stadtmarketing (Nonprofit-Marketing) kann kooperativ ausges167 UZH | Marketing II taltet sein (public privat partnership). Unter Zentrum verstehen wir eine Anhäufung von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben verschiedener Branchen, Betriebsformen und grössen . Sind (historische) Stadtzentren als natürliche Einheit organisch gewachsen, daher auch Seismograph gesellschaftlicher Entwicklungen, so sind Ladenzeilen (Einkaufspassagen) und Einkaufszentren (Shopping-Zentren) geplante künstliche Einheiten, langfristig auch Ausdruck von Sub- und Desurbanisationsprozessen. Während ein gewachsenes Zentrum aufgrund der heterogenen Interessen nur schwer eine Fokussierung (Geschäftemix, Positionierung u.a.) erreichen kann, sind Einkaufszentren für den Einzelhandel plan- und gestaltbare Standorte. Verschiedene Standortfaktoren prägen die Wahl eines Standorts als eine konstitutive Entscheidung; beispielsweise im Einzelhandel die Attraktivität des Raums (persönliche Sicherheit, Stadtzentrum u.a.), die Kaufkraft der Kunden, die Konkurrenz (Dienstleistungen, Handel), die baulichen Möglichkeiten oder die Verkehrslage (Erreichbarkeit, Parkplätze u.a.). © 168 UZH | Marketing II 8. Kommunikationspolitik 8.1. Inhalte Kommunikationspolitik Die Kommunikationspolitik ist Ausdruck der Corporate Communicationund beinhaltet vielfältige kommunikative Gestaltungsfelder, beispielsweise Aussenwerbung, Design, Public Relations oder Werbung. Ihre gesamtheitliche Gestaltung ist Ausdruck einer integrierten Kommunikation und erlaubt die Schaffung eines akquisitorischen Potentials. Die hohe unternehmerische Bedeutung der Kommunikationspolitik resultiert aus den gesättigten Märkten mit oft austauschbaren Produkten, aus der Fragmentierung der Märkte (mass custominization) und der notwendigen emotionalen Positionierung. Ebenso steigen die Medienangebote (Fachzeitschriften, TV-Programme u.a.) und erschweren eine stimmige Selektion. 8.2. Kommunikation © Kommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen mindestens zwei Partnern: Wer ein Gespräch beginnt, muss etwas zu sagen haben (Schraner 1988). In der Kommunikationsvielfalt ist es daher wesentlich, dass die Kommunikation glaubwürdig, konstant und vertrauensbildend wirkt. 8.2.1. Kommunikationsprozess Im Kommunikationsprozess (Lasswell 1949) drücken sich die Grundfragen jeder Kommunikation aus: Who says what in which channel to whom with what effect? 169 UZH | Marketing II Dieser Kommunikationsprozess ist immer in eine bestimmte Situation (Botschaftsumfeld, Zeit, Zielen u.a.) eingebettet und kann als Regelkreis zwischen Sender und Empfänger dargestellt werden: © Eine Gemeinsamkeit der Vokabulare (Zeichenvorräte) von Sender (Unternehmung) und Empfänger (Kunde) ist die tragende Voraussetzung für die Botschaftsgestaltung. Trotz gleicher Vokabulare kann jedoch eine erhaltene Botschaft vom Empfänger im Sinn des Senders verstanden oder nicht verstanden werden. Ihre Wirkung (impact) löst heterogene Reaktionen beim Empfänger aus (feedback): Produktkenntnis, Produktpräferenz, Kauf, Wiederkauf oder Ablehnung des Produktes. Ein Kommunikationsprozess unterliegt gleichzeitig verschiedenen Störungen: Der Empfänger erhält über das gewählte Medium die Botschaft nicht (technische Blockade), er selektiert alle bei ihm eintreffenden Botschaften (selektive Wahrnehmung aufgrund individueller Wahrnehmungsschwellen) oder die Wirkung der Botschaft wird durch andere 170 UZH | Marketing II Botschaften verändert (Filtrierung, Verstärkung). Die Wahrnehmung der auditiven (Hören), olfaktorischen (Riechen) wie visuellen (Sehen) Botschaftsinhalte erfolgt beim Empfänger über die menschlichen Sinne (Sinnsystem). Daher beeinflusst jede aufgenommene Botschaft die Gefühle, Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Es werden dabei immer emotionale (gefühlsmässige) und kognitive (gedankliche) Vorgänge in Gang gesetzt (Kroeber-Riel/Meyer-Hentschel 1982). Die emotionalen Vorgänge (Emotionen, Motivationen, Einstellungen) sind die Triebkräfte individuellen Handelns. Es sind die Erregungen, welche den Organismus zum Aktivsein stimulieren. Demgegenüber sind kognitiveVorgänge gedankliche Prozesse (Wahrnehmungen, Entscheidungen, Lernen). 8.2.2. Blickaufzeichnung Alle Reize wirken in einer Welt der Informationsüberlastung. Diese beinhaltet zwei Aspekte (Kroeber-Riel 1987): © 1. Informationsüberschuss: Ein Informationsüberschuss entsteht dadurch, dass Informationen produziert und angeboten, aber nicht konsumiert werden. 2. Informationsstress: Der Informationsstress ist das subjektive Gefühl, durch das Informationsangebot als Individuum unter Druck zu stehen. Der Informationsüberschuss kann mit Hilfe gesamtgesellschaftlicher Daten (Makromodell) oder des individuellen Verhaltens (Mikromodell) berechnet werden. Informationseinheiten (information chunks) eines Mikromodells sind alle visuellen oder akustischen Elemente, die von einem Individuum aufgenommen und psychisch verarbeitet werden. Dabei bleibt das natürliche Informationsangebot (Landschaften, Pflanzen, Tiere u.a.) ausgeklammert. Als Messmethode der visuellen Information wird im Mikromodell meist die apparative Blickaufzeichnung verwendet (Bernard 1983). Die Blickregistrierung erfolgt mit der Hilfe einer Lesebrille. Diese ist über ein Glasfaserkabel mit einer Videokamera verbunden: Die Kamera «schaut» gemeinsam mit der Testperson durch die Brille und zeichnet das Blickfeld auf. Zusätzlich wird ein auf die Hornhaut gerichteter und von dieser reflektierter Lichtstrahl aufgezeichnet, der die Augenbewegung zeigt. Das Verfahren nutzt die Physiologie dieser Augenbewegungen: Der menschliche Blick tastet eine Vorlage (Bild) mit unregelmässigen Sprüngen weitgehend autonom ab. Dabei kann mit einem einzigen Blick bei einem Leseabstand von fünfzig Zentimetern nur ein Ausschnitt von einem Zentimeter scharf gesehen werden. Die übrigen Bereiche werden mit zunehmender Entfernung zusätzlich diffuser und unkenntlicher. Die Blickaufzeich171 UZH | Marketing II nung sagt jedoch über die Verhaltensbeeinflussung nichts aus. Ein Blickverlauf wird durch zwei unterschiedliche Phasen charakterisiert: 1. Die Fixation ermöglicht ein klares Abbild des fixierten Reizes. Der fixierte Ausschnitt (Informationseinheit) wird scharf wahrgenommen (200-400 msec) und kann im Gedächtnis weiterverarbeitet werden. 2. Die Saccaden laufen als Fortbewegung von einem Fixationspunkt zum anderen sehr schnell ab (30-90 msec). Diese Phasen dienen der allgemeinen Orientierung. In dieser unklaren Reizsituation findet keine Informationsaufnahme statt. Die erfassten Blickverläufe einer Werbebotschaft (Inserat, Katalog, Prospekt u.a.) erlauben eine Auswertung nach der Häufigkeit der Fixation (Wahrscheinlichkeit Informationsaufnahme), der Dauer der Fixation (Verarbeitung Information), der Reihenfolge der Fixationen (Muster der Wahrnehmung, Plazierung Schlüsselbotschaften) und eine Prüfung des «Vampireffektes»: Werden der Markennamen und der Slogan fixiert oder nur der Blickfang, beispielsweise «Opel. Technik, die begeistert»oder «Steffi Graf». Resultate zeigen, dass Bildelemente einer Botschaft (Inserat) in der Regel zuerst fixiert werden und der Blick wandert tendenziell von links oben nach rechts unten. Die Analyse einer Martini-Anzeige zeigte die folgenden Fixationen der einzelnen Anzeigenelemente: Frau 43 %, Segel 36 %, Flasche (Produkt)/Glas 9 %, Hand 4 %, Martini (Marke) 7 %, Fusszeile (Slogan) 1 % (Schweiger/Schrattenecker 1989). Die fehlende Konzentration auf das Produkt, die Marke und den Slogan zeigen einen ungünstigen Blickverlauf hinsichtlich einer stimmigen Positionierung von Marke und Produkt. © Die durchschnittliche Betrachtungszeit einer Anzeige in einer Illustrierten beträgt rund zwei Sekunden. In dieser Zeit werden nur 32 % des gesamten Informationsangebotes so betrachtet, dass eine exakte Informationsaufnahme erfolgt (Leven 1988). Ausgehend von diesen Erkenntnissen kann die individuelle Informationsnachfrage (durchschnittlich wahrgenommene Informationsmenge) gemessen und dem Informationsangebot (durchschnittlich wahrnehmbare Informationsmenge) gegenübergestellt werden. Diesem Mikromodell sind verschiedene Annahmen zum Informationsgehalt (glaubwürdig, lästig u.a.), Informationsmass (Gleichwertigkeit der Informationseinheiten «Buchstabe, Wort, Satz und Bild») oder Bildungsniveau (Lesegeschwindigkeit) innewohnend (Brandstätter 1987). Dienen die Leitmedien Fernsehen, Radio, Tageszeitungen und Zeitschriften als Informationsangebot - diese Medien bestreiten beispielsweise mehr als 95 % des gesamten Informationsangebotes in der Bundesrepublik Deutschland - so resultiert ein Informationsüberschuss von rund 98 %, d.h. nur 2 % der angebotenen Informationen werden «konsumiert» (Brünne/Esch/Ruge 1987). Die Situation des Informationsüberschusses verdeutlicht das Dilemma des Informationsanbieters: Jedes zusätzliche Informationsangebot, beispielsweise Werbung, senkt tendenziell die durchschnittliche Nutzung aller angebotenen Informationseinheiten und erhöht damit die Informationskosten. Eine solche Informationskonkurrenz verstärkt gleichzeitig die flüchtige und oberflächliche Informationsaufnahme beim Individuum. 172 UZH | Marketing II 8.3. Kommunikationsinstrumente Als klassische Medien («above the line») versteht man die Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), den persönlichen Verkauf, die Verkaufsförderung und die Werbung. Die übrigen Instrumente werden oft als nicht-klassische Medien («below the line») bezeichnet. 8.3.1. Corporate Communication Mit der Corporate Communication sollte die Identität einer Unternehmung nach innen und aussen vermittelt werden. Unter Ausschluss der Führungskommunikation (Führungsstil, Unternehmungskultur) ist eine so verstandene Corporate Communication als kommunikatives, strategisches Dach der Vielfalt von Design, Direktwerbung, Kundenzeitschrift, Messebeteiligung, persönlichem Verkauf, Public Promotions, Public Relations, Verkaufsförderung, Werbung (Beschaffungs- und Absatzmärkte) und umfassenderer Beeinflussung (Megamarketing) zu sehen. Dabei ist die Kommunikation mit weiteren internen und externen Anspruchsgruppen (Corporate Publishing) miteinzubeziehen. Corporate Communication ist daher als Kommunikations-Mix Bestandteil jedes strategischen Marketing und Management. 8.3.2. Corporate Design © Corporate Design ist die Gesamtheit der visuellen Erscheinungselemente einer Unternehmung, insbesondere die Gebäudearchitektur, das Industrial Design, die Messestände, und somit symbolischer und sinnvermittelnder Ausdruck unternehmerischer Kulturund Strategievorstellungen. Die Harmonisierung von Corporate- und Produktdesign dieses ist eher Teil der Produktpolitik - erlaubt eine umfassende kommunikative Wirkung. 8.3.3. Corporate Identity Mit diesem Schlagwort sind die vielfältigsten Vorstellungen verbunden: Sie reichen vom Marketing über die Unternehmungsphilosophie bis zur Unternehmungskultur. Es erscheint jedoch in einer gesamtheitlichen Orientierung der Unternehmung angebracht, Corporate Identity als resultierendes Kommunikationsziel (Harmonie Fremd- und Eigenbild) und programm (Aktionen) (Achterhold 1988) aller Unternehmungsaktivitäten zu sehen. Corporate Identity-Konzepte dienen daher der Identitätsvermittlung (Akzeptanz, Glaubwürdigkeit, Vertrauen) wie der Identitätsgestaltung (Identifikation, Integration, 173 UZH | Marketing II Kooperation, Koordination, Motivation, Wir-Bewusstsein) (Wiedmann/Jugel 1987). Eine umfassende Möglichkeit der Identitätsgestaltung ermöglicht die Gebäudearchitektur, beispielsweise die «Hongkong and Shanghai Bank» des britischen Architekten Norman Foster, um so Identitäten zu visualisieren und für Dritte «lesbar» zu machen. 8.3.4. Corporate Image Images werden als «objektiv und subjektiv verzerrte Vorstellungsbilderverstanden» (Meffert 1986). Ein Corporate Image ist daher das Bild, das Dritte von einer Unternehmung besitzt und auch übertragen werden kann (Imagetransfer). Es entwickelt sich aus einer Vielzahl von Inhalten, beispielsweise beim Einzelhandel: Bedienungsform, Einkaufsatmosphäre, Ladenöffnungszeiten, Preisniveau, Schaufenster, Sortiment und Warenpräsentation. Jede Unternehmung hat ein gegenwärtiges (Ist-Image) und ein anzustrebendes Image (Soll-Image, Wunschimage). In der Vielfalt der Images (Marken, Produkte, Konkurrenten) ist die Suche nach Image-Nischen für eine eindeutige Image-Positionierung von primärer Bedeutung. 8.3.5. Design © Das Design ist mit dem Angebots- und Unternehmungsimage wie der Produktpolitik untrennbar verbunden (Marke, Positionierung u.a.). Dabei können sich Unternehmungsund Produktimage weitgehend decken (Identität), aus der Sicht des Kunden gemeinsame Beziehungspunkte bestehen (positive Integration), ein widersprüchliches Bild resultieren (negative Integration) oder die Produkt- und Unternehmungspersönlichkeit fallen deutlich auseinander (Isolation). Das Design ermöglicht eine kommunikative Differenzierung und Kundenbindung über Ästhetik und Symbolik. Es kann zu zeitlosen Produkten wie «Braun-Küchenmaschinen» oder «Porsche 911» führen und sie emotional verankern (emotionale Positionierung). 8.3.6. Direktwerbung Die Direktwerbung, deren Ursprung im Versandhandel liegt, umfasst die Zustellung adressierter wie unadressierter Werbesendungen sowie die Verteilung von Werbematerial: Couponanzeigen, Kataloge, Kundenzeitschriften, Mail-order-packages (Versandkuvert, Prospekt, Werbebrief, Antwortkarte/Bestellschein, Antwortkuvert), Wurfsendungen (Huth/Pflaum 1986). 174 UZH | Marketing II Direktwerbung (direct mail) versteht sich als kostengünstige Alternative (schriftlicher Dialog) zum Vertretergespräch (persönlicher Dialog) und muss sich ihm konsequenterweise anlehnen (Vögele 1987). Erfolgreiche Direktwerbung bedeutet Kundengewinnung (kalte Adressen) und Kundenbindung. Die Bindung verzichtet auf eine weitere Optimierung der Kontaktchancen («Affären») und sucht dauerhafte Beziehungen («Ehen»). So muss beispielsweise ein Verlag den Kontakt zum Leser über verschiedene Stufen dialogisieren: Direktwerbung (mail) > telefonische Rückantwort (call), Coupon (mail) > Abonnementverkäufer (face), aktive Telephonwerbung (call) > Katalog (mail) > aktive Telephonwerbung (call) und den Leser «ewig binden» (Club, Kundendienst, Wettbewerbe u.a.). Der Erfolg dieser unmittelbaren, individuellen, aber unpersönlichen Form der Kommunikation ist umso höher, je präziser sich die Zielgruppenlokalisieren lassen (Cost per Contact, Cost per Order). Ihre gezielte Ansprache erfordert aktuelle, qualitativ und quantitativ präzise Adressen (Data Warehouse) und Selektion (Data Mining). Die Erweiterung dieser Direktwerbung um elektronische Kommunikationsformen (Electronic Mail, Internet u.a.) und um Kombinationen interner und externer kundenorientierter Datenbanken führt zu begrifflich unpräzisen Phänomen des Dialog Marketing, des Direct Marketing oder des Database Marketing sowie meist zur undifferenzierten Integration in ein Beziehungsmarketing (Customer Relationship Marketing). 8.3.7. Elektronische Medien © Erste Veränderungen in der Medienlandschaft zeigten sich mit der Deregulierung europäischer Fernsehmärkte: Verleger gründeten Fernsehkanäle (Free-TV, Abo-TV oder Pay per View-TV) als Alternativen zu den über Gebühren finanzierten Sendern. Die Vorteile dieser klassischen Medien (Print, TV) liegen in ihren grossen Reichweiten und den relativ geringen Kontaktkosten aufgrund ihrer Breitenwirkung. Verstärkt verschieben sich jedoch die Grenzen zwischen Massen- und Individualkommunikation (Dienste der Telekommunikation). Dabei sind die Inhalte (content) selbst von zentraler Bedeutung. Der Besitz von Inhalten sowie ihrer Aufbereitung und Integration wird daher von verschiedenen Autoren als stärkerer unternehmerischer Erfolgsfaktor gesehen als beispielsweise die technische Infrastruktur (Mobiltelefonie, breitbandige/schmalbandige Netze, Software u.a.). Diese inhaltlichen und technischen Entwicklungen verschieben traditionelle Branchengrenzen (Branchenanalyse) und führen zu neuen Branchen (Branchendynamik). Es wird daher auch von der Entstehung der TIMEBranchen gesprochen: Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien und Entertainment (Unterhaltung). Die verbundene Kombination unterschiedlicher Medienformen wie Bild, Grafik, Sprache, Tabelle, Text, Video oder virtuelle Realität unter Nutzung einer Vielfalt von «Zugriffsund Transporttechnologien» kann mit Multimedia umschrieben werden. Dabei bestimmt 175 UZH | Marketing II der Nutzer ihre Anwendung, beispielsweise durch ein gezieltes Suchen nach Inhalten unter Einsatz von Software (Suchmaschinen u.a.). Für die Kommunikationspolitik zeigen sich sehr unterschiedliche Möglichkeiten: Die Offline-Medien (CD-ROM, Videosäulen u.a.) sind beispielsweise für Kataloge, Lernsoftware, Nachschlagewerke oder Präsentationen anwendbar. Wir finden sie oft bei nichtdomiziler Nutzung (Perron, Kaufhaus u.ä.) im Sinn von Instore-Medien. Die Online-Medien (Interaktives Fernsehen, Internet u.a.) erlauben vielfältige zielgruppenorientierte, individualisierte (Direct-Response-) Kommunikationsangebote, seien es zum Beispiel die Prüfung der Benutzerfreundlichkeit von Websites (usability test) oder die Umweltinformationssysteme (Luftverschmutzung u.a.) öffentlicher Organisationen (Nonbusiness-Marketing). Bei der Werbung steht der Banner (Banner Ad) und seine Alternativen (Skyscrapers, Textlinks u.a.) als interaktive Werbefläche im Vordergrund. Mögliche Ziele statischer oder animierter Banner: Aufmerksamkeit, Erschliessung neuer Vertriebswege, Interaktivität («Klicken Sie hier»), Steigerung der Markenbekanntheit, «Traffic». Dabei finden wir verschiedene Preis- und Messmodelle (Cost per). Da Banner alleine nicht genügen, muss die Unternehmung auf ihren Websites klare Mehrwerte für den Kunden schaffen (Emotionalität, Exklusivcharakter, transparente (Bezahlungs-)Vorgänge u.a.) und die Online-Werbung in das Marketing einbetten (Branding u.ä.). © Die Online-Medien sind nicht auf kommunikationspolitische Fragen reduzierbar, da mit ihnen andere Marketingthemen verknüpft sind, beispielsweise die Distributionspolitik (ECommerce) oder der Produkttest (inhome product-tests). Bei diesem Test teilt der Kunde seine Produkterfahrungen dem Lieferanten online mit. 8.3.8. Events Ein Event ist ein erlebnisorientiertes Ereignis für zielgruppenspezifische Adressaten (Händler, Kunden u.a.), welche der Umsetzung von Marketingzielen dienen. Die Adressaten dürfen daher diese inszenierten Aktionen und Veranstaltungen von Marken, Produkten und Unternehmungen zumindest als nicht störend empfinden (Brückner/Przyklenk 1998). Die Eventmöglichkeiten reichen vom Pflanzenfest eines regionalen Gärtners bis zur Operngala eines europäischen Finanzinstituts. Für alle Formen gilt: Events müssen sowohl zu den Kunden (Zielgruppe) als zu der veranstaltenden Unternehmung (Image) passen. Da sie der Kundenakquisition und -bindung dienen, sollen sie unternehmungsweit konsistente Kundenerfahrungen ermöglichen, sich nicht in widersprüchlichen Aktionen kannibalisieren und in die Kommunikationspolitik eingebettet sein. Der Begriff «Event-Marketing» wird diesem integrierten Verständnis nicht gerecht und wird daher nicht weiterverfolgt. 176 UZH | Marketing II Jedes Event kann mit Sponsoring verknüpft werden: Ein Einzelhändler unterstützt einen im Ort gastierenden Zirkus und lädt seine Kunden zu «geschlossenen» Vorstellungen ein. Der Einzelhändler tritt als Sponsor, der Zirkus als Event-Veranstalter auf. In einem viel umfassenderen Sinn sind Events Ausprägungen der Erlebnisökonomie (experience). 8.3.9. Messen Messen (Ausstellungen) sind Marktveranstaltungen einzelner oder mehrerer Branchen und finden meist im regelmässigen Turnus am gleichen Ort statt. Der Messeauftritt der einzelnen Unternehmung kann von der Corporate Communication nicht losgelöst werden. Die Messe dient gleichzeitig als relativ kostengünstiges Forum der Konkurrenzbeobachtung (Marktforschung). 8.3.10. Persönlicher Verkauf Der persönliche Verkauf (personal selling) beruht auf dem unmittelbaren Kontakt zwischen Verkäufer und Käufer (Empathie). Diese einzelgezielte und persönliche Kommunikation finden wir im Konsum- wie Investitionsgüter-Marketing (Business to Consumerbzw. Business to Business-Geschäft), im Innen- wie Aussendienst, im Messeverkauf und im Party- bzw. Eventverkauf. Der persönliche Verkauf ist in seiner Zielsetzung eine aktive Beeinflussung des jeweiligen Marktpartners («Speerspitze des Marketing»), jedoch nicht eine umfassende Bedürfnisbefriedigung im Sinn des Marketing (Houston 1986). © Der Aufbau und die Sicherung dieser Ausprägung der Kommunikationspolitik erfordert finanzielle Anreizsysteme für die Mitarbeiter des Verkaufs: Neben den Grundlohn (Zeitlohn) tritt der Leistungslohn (Prämien, Provisionen, Vergütungen). Jede Verkaufssituation wird von den Fähigkeiten (Argumentation, Erfahrung, Kreativität, Rhetorik u.a.) und vom Wissen des Verkäufers (Branchen-, Markt-, Konkurrenz-, Produkt-, Kundenkenntnisse) wesentlich geprägt (Young/Mondy 1982). In diesem Kontext wurden die vielschichtigsten Ratschläge des erfolgreichen Verkaufs (Verkaufsstrategien) entwickelt (Johnson/ Wilson 1988); beispielsweise für das Telefongespräch: «kurze Sätze, nur wichtige Informationen, keine langen Pausen, kommen Sie sofort an den richtigen Partner, nennen Sie möglichst oft den Kundennamen, bringen Sie die Sache rasch auf den Punkt, sprechen Sie die Kundenprobleme an und schlagen Sie Problemlösungen vor, formulieren Sie die Vorschläge bestimmt und erleichtern Sie beispielsweise mit Alternativtechniken die Zustimmung des Kunden, fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen, bedanken Sie sich und verabschieden Sie sich freundlich» (Pfeiffer 1989). 177 UZH | Marketing II Wesentliche Fragestellungen des persönlichen Verkaufs bei unternehmungseigenen Aussendienstorganisationen sind die Einteilung der Verkaufsgebiete, die Zuordnung der Reisenden auf diese Gebiete, die Tourenplanung sowie die Steuerung der Besuchszeiten (Albers 1989). Rationalisierungsmöglichkeiten dieser Verkaufsform liegen in computergestützten Informations- und Kommunikationssystemen: Computer Aided Selling (CAS): Basierend auf einer umfassenden Kunden-Datenbank (Entwicklung, Struktur, Verhalten der Kunden) ermöglichen diese Systeme eine stets aktuelle Datenbasis (Database-Marketing), eine kundenindividuelle Kommunikation sowie die Kundenverknüpfung (crossselling). Sie heben gleichzeitig die klassische Trennung von Marktforschung und Marketingaktivitäten auf. Der persönliche Verkauf entwickelt sich über den Telefonverkauf (Call Center, Customer Care Center) zu einem semi-persönlichen Verkauf, dieser möglicherweise zu einem unpersönlichen (multi-)medialen Verkauf, sei es Offline-Verkauf (CD-ROM, Video u.a.) oder Online-Verkauf (E-Commerce, Teleshopping u.a.); beide mit den Potentialen einer erhöhten Kundenbindung bei tieferen Marketingkosten, insbesondere Gewinnungsund Abwicklungskosten, durch die Vereinfachung der (Verkaufs-)Prozesse. 8.3.11. Public Promotion © Public Promotion ist eine Mischung von Werbung, Verkaufsförderung und Public Relations. Heutige Formen sind das Sponsoring, das Product-Placement und das Licensing. Sponsoring Das Sponsoring (sponsorship) ist eine unternehmerische Aktivität, bei der sich Leistungen und Gegenleistungen langfristig entsprechen müssen: Der Sponsor unterstützt den Gesponserten mit materiellen oder immateriellen Leistungen, um so seine definierten persönlichen oder unternehmerischen Ziele zu erreichen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Gesponserte, die Voraussetzungen für den Erfolg des Sponsoring zu schaffen und zu sichern. Die Massenmedien sind die unfreiwilligen Partner im Sponsoring, beispielsweise bei Sportveranstaltungen. Sponsoring ist daher eine spezifische Form einer Interaktion auf Gegenseitigkeit und steht im Gegensatz zum Mäzenatentum: Als einst Gajus Clinius Maecenas (70 bis 8 v. Chr.) als Freund und Berater des römischen Kaisers Augustus die Dichter seiner Zeit wie Vergil und Horaz um sich versammelte, unterstützte er sie auch. So wird nach ihm ein altruistischer Gönner Mäzen genannt. Ein Mäzen fördert Personen oder Organisationen ohne Erwartung einer Gegenleistung. Das Mäzenatentum wird heute häufig von Stiftungen wahrgenommen. Ohne erwartete Gegenleistung ist auch das unternehmerische Spendenwesen (corporate giving). 178 UZH | Marketing II Formen des Sponsoring Sehr oft assoziieren Befragte «Sponsoring» spontan mit «Sport». In einer umfassenderen Sicht können wir folgende Grundformen des Sponsoring, die unterschiedliche Erlebniswelten (experience) repräsentieren, unterscheiden (Bruhn 1987): In einer weiteren Differenzierung ist entscheidend, ob Individuen, Gruppen oder Organisationen die Gesponserten sind: Spitzensportler, Sportmannschaft oder Sportverband beim Sportsponsoring; Schriftsteller, Theatergruppe oder Theater beim Kultursponsoring; Wissenschaftler, Forschungsgruppe oder Universität beim Sozio-Sponsoring. Ebenso entscheidend ist der Umfang des Sponsoring-Engagements (Drees 1989): © Beim Full-Sponsoring wird ein Ereignis von einem Sponsor vollständig getragen. Der Sponsor erhält als Gegenleistung das umfassende Recht der alleinigen kommunikativen Nutzung. Diese Ausgestaltung ermöglicht insbesondere einen klaren Imagetransfer sowie die Benennung des Ereignisses nach dem Sponsor (Titelsponsoring). Ein Ereignis wird beim Haupt-Sponsoring nicht von einem Sponsor allein getragen. Der Hauptsponsor dominiert gegenüber den Co-Sponsoren mittels Titelsponsoring und/oder exklusiven Möglichkeiten, beispielsweise der Beschriftung von Startnummern mit dem Logo. Ein Co-Sponsor (Förderer) engagiert sich mit relativ geringen Mitteln an einem Ereignis, erhält dafür auch wenig Möglichkeiten für Gegenleistungen, beispielsweise Anzeigen im Programmheft. Zwischen dem Sponsor und dem Gesponserten muss eine hohe Übereinstimmung angestrebt werden. Solche Affinitäten fördern beim Kommunikationsempfänger die sachlichen wie emotionalen Assoziationen. Tragende Anknüpfungsebenen zwischen dem Sponsor und dem Gesponserten können der Name des Sponsors (Uhu-Klebstoffe Nachteulen - Naturschutz), der Name des Gesponserten (Whiskas Katzenfutter - Musical «Cats»), der Lebensstil (Pepsi Cola - Tina Turner) oder die Zielgruppe (Rolex Uhren - Poloturniere) sein (Erdtmann 1989). Übergreifendes Ziel jedes Sponsoring ist die langfristige Stabilisierung oder Korrektur unternehmerischer Images. Sponsoring ist meist mit dem Product Placement, der Plazierung von Markenprodukten in Handlungen von Filmen, Radio- oder TV-Sendungen 179 UZH | Marketing II und der Lizenzierung (licensing) von Marken, Comic-Figuren oder Prominenten verbunden. Sport-Sponsoring Beim Sport-Sponsoring ist - gemäss einer empirischen Untersuchung - die primäre Zielsetzungen der Sponsoren der Imagetransfer sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades (Hermanns/Dress/Püttmann 1986). Die Auswahl dieser Formen (Sponsorship) basiert auf der Affinität zwischen dem Sponsor (Produkt/Unternehmung) und dem Gesponserten (Sportart/Sportler). Diese kann sich auf das Produkt, das Produktimage wie das Unternehmungs-Image beziehen oder von diesen Dimensionen völlig isoliert sein. Die beispielsweise jeder Sportart situativ inhärenten Imagedimensionen (Erlebnischarakter, Faszination, Exklusivität, Emotionalität, Urteilsvermögen oder Kommunikationswert) (Dreyer 1986) sind mit dem Unternehmungsimage (Corporate Image) und dessen Positionierung in Markt und Umwelt unmittelbar verbunden. Es ist daher entscheidend, wer die Gesponserten sind: © Diese Sicht trägt die Gefahr der Polarisierung zwischen den mediengerechten und anderen Sportarten in sich. Die Wirkungsintensität des Sponsoring kann sich so im Zeitablauf verändern («what's in, what's out»). Das Sportsponsoring eignet sich insbesondere für die Leistungsdemonstration von Produkt und Unternehmung wie die unmittelbare Beeinflussung der Kernzielgruppen durch Einladungen an gesponserte Veranstaltungen (hospitality) (Drees 1989). 180 UZH | Marketing II Kultur-Sponsoring Das Kultur-Sponsoring beinhaltet die Zusammenarbeit eines Sponsors mit einer künstlerischen Person oder Institution und beinhaltet neben Finanzierungshilfen (Ankäufe, Fundraising, Preisausschreibungen, Stipendien, Zuschüsse) auch Sach- und Dienstleistungen (Management, Materialien, Mitarbeiter, Räume) (Look 1988). Diese Sponsoringaktivitäten finden ihre Konkretisierung im «Neujahrskonzert» der Wiener Philharmoniker, in der Renovation der «Villa Turque» von Le Corbusier in La Chaux-de-Fonds oder im Bild-Zyklus «Cars» von Andy Warhol (Roth 1989). Dabei haben die einzelnen Kulturbereiche sehr unterschiedliche Imagedimensionen, somit Imageaffinitäten zum Sponsor, beispielsweise die Oper/Operette wie das Ballett: Atmosphäre, Ästhetik, Originalität, Prestige, Tradition, Verantwortung, Harmonie; ein Buch: Modernität, Ästhetik, Originalität, Harmonie (Bruhn 1989). Social-Sponsoring In seiner Entwicklung nähert sich das Sport-Sponsoring nach einer intensiven Wachstumsphase der Reifephase; das einst innovative Instrument erreichte die allgemeine Akzeptanz. Vorwiegend schweizerische Experten sehen im Rahmen einer Delphi-Studie die stärksten Entwicklungen des Sponsoring im Bereich «Kultur» (Kühn/Jucken 1988). Das Kultur-Sponsoring mit seinen extrem vielfältigen Bereichen (Bruhn/Dahlhoff 1989, Hermanns/Dress 1987) wird in Zukunft wachsen, während das Social-Sponsoring (Social Marketing) von vielen Unternehmungen noch als wenig attraktiv gesehen wird. Die Zielgruppen eines Kultur-Sponsoring sind sozial höher angesiedelt als im SportSponsoring und wirken verstärkt als sogenannte Multiplikatoren für lebensstilorientierte Diffusionen neuer Produkte und Dienstleistungen. © Obwohl das Potential eines Kultursponsoring entsprechend hoch ist, hält die teilweise emotionale Diskussion insbesondere im europäischen Raum zwei Thesen aufrecht: (1) Die Unternehmungen verdrängen mit ihrem Kultursponsoring die Öffentliche Hand. Dadurch sind diejenigen künstlerischen Aufgaben gefährdet, welche für die Unternehmungen nicht öffentlichkeitswirksam sind. (2) Die Unternehmungen nutzen die Abhängigkeit der Künstler aus und missbrauchen sie für ihre unternehmerischen Zwecke (cash and culture) (Loock 1988). 8.3.12. Public Relations Mittels Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) soll eine Unternehmung ihre Politik erklären und Vertrauen in der Öffentlichkeit (Bezugs-, Interessen- und Anspruchsgruppen) aufbauen und pflegen: «Mit Public Relations wird die Politik der Unternehmung erklärt und verteidigt» (Tietz 1978), beispielsweise mit Geschäftsberichten (Inhalt, Optik) gegenüber den Aktionären. Die unmittelbare Beziehung zu den erbrachten Leistungen 181 UZH | Marketing II (Produkte) fehlt. Wir können zwischen interner und externer Public Relation unterscheiden: Bei der Beurteilung der Public Relations ist die «öffentliche Meinung», d.h. das was die Mehrheit der Bevölkerung zu diesem Aspekt sagen würde, von Bedeutung. Steht eine Unternehmung zu dieser Normal-Meinung im Widerspruch, so hat sie folgende Handlungsalternativen: Widerstand, Vermeidung, Anpassung, Unterstützung (Innovation) oder Zusammenarbeit (Kooperation). 8.3.13. Verkaufsförderung © Unter Verkaufsförderung versteht man jene Kommunikationsform, die sich an die Absatzmittler (Grosshandel/Einzelhandel/Vertreter/Makler) wendet: Sales Promotion ist die Gesamtheit der Verkaufsförderungsmassnahmen gegenüber den Absatzmittlern («Reinverkauf»); Merchandising ist die Gesamtheit der Verkaufsförderungsmassnahmen am Verkaufsort (Point of sales POS/ Point of Purchasing POP) mit der Zielgruppe «Kunde» («Rausverkauf»). Beispielhafte Ausprägungen der Verkaufsförderung sind: Die kundenorientierte Verkaufsförderung zeigt sich in Gratisprodukten, CouponAktionen, 3 für 2, Huckepack-Promotion (Produkt mit Gratisprodukt), Personality Promotion, Self-Liquidation-Offer (bisherige Käufe berechtigen zum preisgünstigen Einkauf), Treuerabatte, Dialogvideosysteme, Wettbewerbe. Die handelsorientierte Verkaufsförderung hat folgende Möglichkeiten: Bonus, DisplaysMaterial, Händlerschulung, kooperative Werbung, Verkaufsunterlagen, Verkaufswettbewerbe. Bei der aussendienstorientierten Verkaufsförderung stehen Incentives und Wettbewerbe im Vordergrund. 8.3.14. Werbung Werbung ist «eine absichtliche und zwangsfreie Form der Beeinflussung, welche die Menschen zur Erfüllung der Werbeziele veranlassen soll» (Behrens 1963). Diese mittel182 UZH | Marketing II bare, unpersönliche Form der Kommunikation ist jedoch in ihrer gesamten Entwicklung (Kutter 1976) «weder Unterhaltung noch eine Form der Kunst, sondern vielmehr ein Medium der Information» (Ogilvy 1984): «Advertising is any paid form of nonpersonal presentation of ideas, goods or services by an identified sponsor» (McCarthy 1979). Jede kommunikative Darstellung der eigenen Vorzüge erfordert eine Auseinandersetzung mit den Kunden und den Leistungen der Konkurrenten. Eine vergleichende Werbung liegt dann vor, wenn zwei oder mehr ausdrücklich benannte oder erkennbar dargestellte Marken oder Produkte einander gegenübergestellt werden. Die Grundfrage dabei ist: Wird Gleiches mit Gleichem verglichen? 8.4. Werbepolitik Mit der Kommunikationspolitik gestaltet die Unternehmung ihre Kommunikation mit Markt, Branche und Umwelt. Am Beispiel der Werbepolitik seien die wesentlichen Schritte einer Kommunikationspolitik verdeutlicht. Diese Vorgehensweise ist auch für andere Instrumente anwendbar. Die einzelnen Schritte: 8.4.1. Situationsanalyse © Grundlage jeder erfolgreichen Problemlösung ist eine klare Analyse der vorliegenden Situation, insbesondere von • • • • Markt (Marktgrösse, Marktform, Marktentwicklung, Marktsegmente, Konkurrenz (Positionierung Produkt, Argumente Werbung u.a.) und Zielgruppen der Werbung (Werbedestinatare): Alter, Ausbildung, Einkaufsgewohnheiten, Einkommen, Geschlecht, Kaufkraft, Kaufverhalten, Lebensstile, Ort, soziale Gruppe, Wertvorstellungen u.ä.), von Produkt (Dienstleistungen, Grundfunktionen, Handling, Marke, Marketingkosten, Phase im Lebenszyklus, Preis, Rabatte, Recycling, Vertriebsweg u.a.) und Marketing (Marketingziele der Unternehmung bzw. der Geschäftseinheit (Stärken/ Schwächen), bisherige Gestaltung des Marketing-Mix, bisherige Kommunikationspolitik, Ressourcen, Werbedruck u.a.). 8.4.2. Werbeziele Werbeziele sind zukünftige Sachverhalte oder Zustände, die vom Management angestrebt werden, wie beispielsweise Positionierung, Anzahl der Werbeimpulse (Kontinuität/Pulsation, Werbedruck), Bekanntheit/Akzeptanz der Marken, Imagekorrektur, Markt183 UZH | Marketing II positionierung, zeitlicher (Timing) und zyklischer Einsatz (prozyklisch, antizyklisch). Mögliche ökonomische und psychografische Werbeziele sind: (1) Steigerung der «Kauffrequenz Einzelhandel», Steigerung des «Marktanteils»; (2) Auslösen von Emotionen durch «Produkt», Korrektur des «Markenimage». Alle Werbeziele müssen möglichst widerspruchsfrei, klar und verständlich sowie grundsätzlich realisierbar und kontrollierbar (Werbeerfolgskontrolle) sein. Die Kommunikationsverantwortlichen der grössten Unternehmungen im Werbemarkt «Schweiz» erachten die folgenden Aufgaben der Werbung als wichtig: • • • • • • «Verkauf, Umsatz erzielen» (63.9 %), «Marktanteile gewinnen und sichern» (59.7 %), «Markenführung» (42.5 %), «Unterstützung bei Produkteinführung» (37.1 %), «Unternehmungsimage verbessern» (34.6 %) und «Bekanntheitsgrad erhöhen» (32.1 %) (IHA/GfM 1998). 8.4.3. Werbestrategien © Die Werbestrategie ist die im Rahmen einer Politik grundsätzliche Vorgehensweise zur Erreichung der Werbeziele. Die Handlungsmöglichkeiten sind insbesondere die Festlegung der Werbebotschaften und Werbemedien. Werbebotschaft Bei den Werbebotschaften gibt es meisterliche Würfe, guten Durchschnitt, schwache und fehlerhafte Arbeiten (Schraner 1990). Die verschiedensten Erfolgsregeln wurden für die Gestaltung veröffentlicht; beispielsweise: «Werben wie die Profis» (Bürger 1986), «Werbung für Einsteiger» (Ewald 1999) oder «Werbung, die ankommt»: (1) Sei neu und nicht nur neuartig! (2) Sei einfach - aber nicht harmlos! (3) Sei zwingend - aber nicht mit dem Holzhammer! (4) Sei Verkäufer - und kein Unterhalter! denn (1) wenn wir nichts Neues sagen, wird uns niemand zuhören, (2) wenn wir es nicht einfach sagen, wird man uns nicht verstehen, (3) wenn wir es nicht zwingend sagen, werden wir keine Wirkung erreichen (4) wenn wir es nicht verkäuferisch sagen, werden wir keinen Verkaufserfolg haben (Schönert 1986). Neben diesen praxisorientierten «Formeln» und den «Werbegesetzen» wie DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results), steht das bereits 1898 veröffentlichte Stufenmodell des individuellen Ablaufs der Werbewirkung: AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). 184 UZH | Marketing II Eine Werbebotschaft sollte je nach Studie daher eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen: ehrlich, emotional, informativ, intelligent, interaktiv, ironisch, sachlich, unterhaltend oder witzig. Sie darf daher nicht langweilig, nervend oder schlecht sein. Für unsere weitere Vorgehensweise wählen wir den Ansatz der Werbewirkung, ein Strukturmodell für die Gestaltung einerWerbebotschaft (Kroeber-Riel 1984): © In diesem Ansatz muss eine erfolgreiche Botschaft den Empfänger aktivieren (emotionaler Teil löst emotionale Vorgänge aus) und informieren (rationaler Teil löst kognitive Vorgänge aus): 185 UZH | Marketing II Die Aktivierung über die Reize, beispielsweise «schreIBMaschine», ist die notwendige Voraussetzung für die Wahrnehmung einer Werbebotschaft und ihre Aufnahme im Ultrakurzzeitspeicher UZS. Eine starke Aktivierung fördert die effiziente Verarbeitung der Botschaft, der Werbeerfolg muss jedoch nicht unbedingt höher sein. Die Aktivierung kann zu einem multisensualen, emotionalen Erlebnis führen, beispielsweise bei einem TV-Spot: helle, klare Klangfarben, Dur-Tonlage; grün-gelb-blaue Farbtöne; Blumen, Frühlingslandschaft; Text: «Aprilfrisch». Die Minimalaktivierung bleibt aufgrund des aktuellen Interesses an einem Produkt (Objektinvolvement), der individuellen Werthaltung (Personeninvolvement) sowie der Kommunikationssituation (Situationsinvolvement) eine relative Grösse und die individuelle Reizempfindung (angenehm, unangenehm) meist offen (Konditionierung). © Im Mittelpunkt des Abbaus des gefühlsmässigen Widerstandes steht die Bereitstellung übereinstimmender (konsonanter) Informationen in der Botschaft mittels Akzeptanz, Glaubwürdigkeit, Kontinuität, Vertrautheit (Personen, Produkt, Marke, Verhalten u.ä.). Die zentrale Annahme dabei ist, dass die Realität von einem Individuum nicht objektiv wahrgenommen wird, sondern Ausdruck verschiedenster Dimensionen (Vorstellungen, Werte, Umwelt) ist. Nimmt das Individuum Widersprüche wahr (dissonante Informationen), so werden diese meist als unangenehm empfunden und fördern die Werbewirkung nicht; sie führen beim Individuum zu zusätzlichen «Kosten» (Wahrnehmung, Verarbeitung, Verhalten). Dissonante Informationen sind dann einsetzbar, wenn sie mittels Gegenargumenten erklärt werden, zum Beispiel das Bild einer Werbebotschaft: ein platzender Luftballon; der Text: «KODAK Diafilme sehen den Knall besser als der Mensch». Die dritte Phase ist mit der zweiten eng verwoben: Im Vordergrund der gedanklichen Beeinflussung steht das Imagery-Konzept (Modell der mentalen Repräsentation) (Pavio 1979). Dieses Modell impliziert, dass Vorstellungsbilder die Grundlage des menschlichen Speicherns von realen Informationen (Person, Produkt, Marke u.a.) sind. Solche visuellen Vorstellungen (innere Bilder) repräsentieren konkrete Gegenstände im Gedächtnis in einer visuellen, nicht-sprachlichen Form (Kroeber-Riel 1986) und sind daher mit emotionalen Erlebnissen eng verbunden («emotionale Werbung»). Grundsätzlich 186 UZH | Marketing II gilt: Reale Ereignisse werden besser erinnert als Bilder, Bilder besser als Wörter und ein konkretes Wort (Auto) besser als ein abstraktes (Gerechtigkeit). Bilder besitzen starke Potentiale. Sie können die analytisch-kritische Kontrolle beim Individuum unterlaufen. Bilder werden meist zuerst erfasst und haben damit höhere Aktivierungs- und Erinnerungswerte; sie werden, im Gegensatz zu Texten, mit geringerem gedanklichen Aufwand schneller und intensiver verarbeitet; sie werden schneller gelernt, meist als angenehmer empfunden und sind glaubwürdiger (Neibecker 1987). Aus diesen Gründen sind Bilder ein wirksames Kommunikationselement, um dem Informationsüberschuss entgegenzuwirken: Ein zusätzliches Informationsangebot, beispielsweise eine neue Werbekampagne, senkt potentiell die durchschnittliche Nutzung aller angebotenen Informationseinheiten und erhöht damit die Informationskosten. Diese Informationskonkurrenz verstärkt gleichzeitig beim Empfänger die flüchtige, oberflächliche Informationsaufnahme sowie die Austauschbarkeit der Botschaften und führt zur Forderung von schnelleren Botschaften über Text (Reizwörter) und Bild (eyecatcher) (Meyer-Hentschel 1988). Ebenso entscheidend ist, ob Irritationen vermieden werden und ob die Werbebotschaft und das redaktionelle Umfeld des Werbeträgers ähnliche Zielgruppen ansprechen (Affinität Werbemarkt/Lesermarkt). Das Schaffen von inneren Marken-, Produkt- und Unternehmungsbildern (Images) sowie das gezielte Auslösen dieser inneren Bilder - beispielsweise «Cowboy» - gehört daher zu den wirkungsvollsten Mitteln der Kommunikation und erfordert erlebnisorientierte Botschaften durch Bilder (Gestaltpsychologie), Musik oder Duftstoffe. Ausgehend vom Erlebniswert, dem subjektiv erlebten, vom Produkt vermittelten Beitrag zur Lebensqualität des Botschaftsempfängers, sind dabei die folgenden Fragen zu beantworten: Welche Erlebniswerte liegen «im Trend»? Welche Erlebniswerte sind für die spezifische Botschaft geeignet? Welche Erlebniswerte erlauben eine Abgrenzung zur Konkurrenz? © Werbemedien Die Medien transportieren eine Botschaft vom Sender zum Empfänger. Jedes Medium bewegt sich gleichzeitig im Markt der Leser, Zuhörer bzw. Zuschauer (Zielgruppen der Redaktionen) und im Werbemarkt (Zielgruppen der Werbetreibenden). Diese Märkte finanzieren wiederum das Medium. Die bedeutendsten schweizerischen Werbemedien, bei einem gesamten NettoWerbeumsatz von CHF 4466 Mio. (ohne Direktwerbung und Internet), sind: Zeitungen (CHF 2118 Mio.), Aussenwerbung (CHF 502 Mio.), Fachpresse (CHF 456 Mio.) Publikumszeitschriften (CHF 260 Mio.) und Werbefernsehen (CHF 439 Mio.) (Stiftung 2000). Bei einem Werbemedium ist zwischen Werbemittel und Werbeträger zu unterscheiden: 187 UZH | Marketing II Der Entscheid für einen Werbeträger (Copy Strategy) ist eine Wahl der Werbeträgergattung (Fernsehen, Tageszeitungen u.a.) als Ausdruck eines Intermediavergleichs und eine Wahl des einzelnen Werbeträgers mit seinen spezifischen Möglichkeiten (Beihefter, Prime Time TV u.a.). © Mit jedem Werbeträger ist ein physischer Kontakt mit dem Umworbenen zu schaffen. Eine wichtige Kontaktmasszahl ist die Reichweite. Als Beispiel ist die Reichweite (Leser pro Ausgabe LpA) für eine Zeitschrift die verbreitete Auflage (verkaufte Auflage plus Frei-Exemplare) plus die Mitleser. Die Reichweite kann sich auf eine einzige Belegung eines Mediums, mehrere Belegungen (kumulierte Reichweite) oder einen gesamten Mediaplan (mehrere Medien mit mehreren Belegungen) beziehen. Liegt die Reichweite bei einer einmaligen Schaltung beispielsweise bei 20 %, dann liegt die Bruttoreichweite bei zwei Schaltungen bei 40 %; und die Nettoreichweite bei Mehrfachbelegungen ist die Bruttoreichweite, korrigiert um diejenigen Empfänger, die mehrfach erreicht werden (Unger 1989). Die Reichweite entspricht jedoch nicht vollumfänglich dem Marktsegment (Zielgruppe). Neben der Reichweite spielt auch die Kontakthäufigkeit eine wesentliche Rolle: Die durchschnittliche Kontaktzahl drückt aus, wie oft die durchschnittliche Zielperson Kontakt mit dem Werbeträger hat, in dem die Werbebotschaft geschaltet wird; die durchschnittliche Kontaktzahl streut um die tatsächliche (Schweiger/Schrattenecker 1986). Die Möglichkeit des Kontaktes nennt man Streuung: Bringt die gewählte Kombination (Mediaplanung) eine Reichweite, die über die definierte Zielgruppe hinausgeht, so liegt eine Überdeckung (Streuverlust) vor; umgekehrt eine Unterdeckung (Streulücken). Ist der umworbene Nutzer in den ausgewählten Werbemedien zum Teil identisch, so führt dies zu Überschneidungen und reduziert die Effektivität des Mediums. Neben diesen quantitativen Grössen sind die demographische und psychographische Struktur der Me188 UZH | Marketing II diennutzer (Einstellungen, Gewohnheiten, Hobbys, Mediaverhalten u.a.) wesentlich. Eine Vielzahl dieser Grössen wird mittels Mediaanalysen (primäre Marktforschung) erhoben. So verknüpft beispielsweise die schweizerische Konsum-Media-Studie (KMS) die Konsumdaten einer Person mit der Mediennutzung derselben Person (SingleSource-Prinzip). Die traditionelle Grösse für die Wirtschaftlichkeit eines Mediums ist der Tausenderpreis, die Kosten des Werbeträgers zur Erreichung von je 1000 Zielpersonen (Hörer, Leser, Zuschauer). Zusammenfassende Kriterien für die Auswahl der Werbemedien sind (Huth/Pflaum 1986): © 8.4.4. Werbebudget Im Rahmen der Werbepolitik ist auch das Werbebudget der Planperiode festzulegen. Mögliche Orientierungsgrössen sind dabei Umsatz, Gewinn, Deckungsbeitrag, Branche, die Markenloyalität des Käufers, die Wettbewerbssituation, der Marktanteil, die lokale/globale Medienlandschaft, die erwartete Reaktion der Konkurrenz, die Verkaufseinheit, der angestrebte Werbedruck sowie die Stellung des Produktes im Produktlebenszyklus. Die Budgetfestlegung kann mittels theoretisch exakter Verfahren (konkurrenzbezogene 189 UZH | Marketing II Ansätze, marginalanalytische Verfahren u.a.), der Verhältnismethoden (percentage of sales methode u.a.) oder der in der Praxis oft angewandten Orientierung an den Marketing- und Werbezielen erfolgen. 8.4.5. Werbebriefing Die Werbepolitik (Werbekampagne) für das einzelne Werbeobjekt (Produkt, Sortiment) ist in einem Briefing schriftlich festzuhalten (Huth/Pflaum 1986): © 8.4.6. Werbeagenturen Eine Werbeagentur befasst sich als Dienstleistungsunternehmung mit der Planung, Gestaltung, Herstellung und Durchführung von Kommunikationsmassnahmen für Dritte (Billings). Wesentliche Aufgaben sind: Beratung/Kontakt, Gestaltung (verbal, visuell), Herstellung (Produktion) und Streuung (Medienplanung). Neben Agenturen mit weltweiten, umfassenden Serviceleistungen (Mega-Agenturen) finden wir lokale, funktionsspezifische Anbieter für Design, Direct-Mail, Marktforschung, Public Relations, Sales Promotion oder Werbung. 190 UZH | Marketing II Die Arbeitsweise einer Agentur vollzieht sich in den folgenden Schritten (Wirz 1989): Briefing durch den Auftraggeber, Beratung in Marktforschungsfragen, Erarbeitung eines Konzepts, Budgetierung, Mediaplanung, Präsentation beim Auftraggeber, Gestaltung, Realisation, Durchführung, Abrechnung und Erfolgskontrolle. 8.4.7. Werbekontrolle Die Werbekontrolle, eine spezifische Ausprägung der Marktforschung, kann in einen Pretest (Diagnose/Prognose) und einen Posttest gegliedert werden. Beide untersuchen den ökonomischen oder den ausserökonomischen Werbeerfolg. Die folgenden Methoden ger/Schrattenecker 1986): erlauben eine Kontrolle der Werbung (Schwei- © Die Untersuchung der Print-Mediennutzung ist mit dem in der Verlagsbranche häufig durchgeführten Copy-Test möglich: Ein Interviewer legt der Testperson ein Original vor, geht mit ihr Seite für Seite durch und fragt sie, ob sie sich erinnern kann, die jeweilige Anzeige bzw. die Marke gesehen oder gelesen zu haben. Ein schweizerischer CopyTest zeigt beispielsweise, dass schwarz-weiss Anzeigen von 35 %, vierfarbige Anzeigen von 52 % gesehen werden. Dieses Verfahren, mit dem versucht wird, aufgrund der Wiedererkennung einer Werbebotschaft (recognition) auf die Werbewirkung zu schliessen, hat jedoch starke Mängel: (1) Die Wiedererkennung einer Botschaft in einem Medium kann von den Wirkungen anderer Medien und Botschaften anderer Produkte (Marken) nicht isoliert werden. (2) Die Angaben der Befragten sind eher spontane Bewertungen von Anzeigen als verläss191 UZH | Marketing II liche Wiedererkennungen. (3) Bekannte bzw. intensiv beworbene Produkte (Marken) erzielen höhere Wiedererkennungswerte als andere Produkte (Marken). Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise der Vergleich der Werbewirkung mit preispolitischen Massnahmen im Einzelhandel: Verschiedene Studien zeigen hier kein einheitliches Bild; stärker als die Produktwerbung wirken möglicherweise die Aktivitäten am Verkaufspunkt (Regal, Verkaufsförderung). Ein weiterer Aspekt ist die Klärung der Ursache der Kundenbindung im Einzelhandel (share of customer): Erfolgt diese aufgrund der Einkaufsstätten (Image u.a.) und/oder angebotenen Produkte (Marken, Sortiment u.a.)? © Verschiedene Studien zeigen, dass die Kundenbindung im Einzelhandel (food/near food) zu je etwa 35 % durch die Einkaufsstätte und die Marken erfolgt. 8.5. Ökologie Wesentliche ökologische Ziele der Kommunikationspolitik sind die Schaffung eines umweltbewussten Corporate Image sowie die langfristige Änderung des Konsumentenverhaltens (Substitution ökologisch belastender Produkte) im Sinn eines Wandels von einer Produktleistungs- zu einer verstärkten Interessenkommunikation. 192 UZH | Marketing II Die Erreichung dieser Ziele bedingt eine Kommunikation ökologischer Produktnutzen und Zusatznutzen (Ökologie als spezifischer Beitrag zur Lebensqualität) in Werbung, Direct Mail und Verkauf sowie die Dialogisierung der Ökologie (corporate dialogue) über Public Promotions und Public Relations mit den spezifischen internen und externen Interessengruppen (Kunden, Mitarbeiter, Umweltschutzorganisationen usw.). Diese ökologische Sensibilisierung der Bezugsgruppen sollte aufgrund der kommunikativen Rahmenbedingungen (Informationsüberschuss) primär über emotionale Kommunikation (Ecotainment) erfolgen. © 193 UZH | Marketing II Literatur Aaker, D.A.: Strategic market management, 3rd edition, New York 1992 Aaker, D.A./Joachimstahler, E.: Brand leadership, New York 2000 Achleitner, P.: Sozio-politische Strategien multinationaler Unternehmungen, Bern 1985 Achterholt, G. : Corporate Identity, Wiesbaden 1988 Ahlert, D./Becker, J./Kenning, P./Schütte, R.: Internet & Co. im Handel, Berlin 2000 Albach, H.: Strategische Unternehmensplanung bei erhöhter Unsicherheit, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 48(1978)8 Albach, H.: Innovationen als Fetisch und Notwendigkeit, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft Ergänzungsheft (1989)1 Albers, S.: Entscheidungshilfen für den persönlichen Verkauf, Berlin 1989 Anderson, J./Narus, J.: Partnering as a focused market strategy, in: California Management Review 33(1991)3 Angehrn, O.: System des Marketing, Bern 1973 Ansari, A./Modarress, B.: Just-in-time purchasing, New York 1990 Ansoff, I.H.: Strategies for diversification, in: Harvard Business Review 35(1957)5 Ansoff, I.H.: Managing strategic surprise by response to weak signals, in: California Management Review 18(1975)2 Ansoff, I.H.: Implanting strategic management, Englewood Cliffs, N.J. 1984 Anton, J.: Customer relationship management, Upper Saddle River, N.J. 1996 Antoni, M./Riekhof, H.C.: Strategieentwicklung mittels Portfolioanalyse, in: Riekhof, H.C. (Hrsg.): Strategieentwicklung, Stuttgart 1989 Antonides, G./Raaij van, W.F.: Consumer behavior: a European Perspective, West Sussex 1998 Arnold, D./Isermann, H./Kuhn, A./Tempelmeier, H. (Hrsg.): Handbuch Logistik, Berlin 2002 Arnold, U.: "Global Sourcing" - Ein Konzept zur Neuorientierung des Supply Management von Unternehmen, in: Welge, M.K. (Hrsg.): Globales Management, Stuttgart 1990 Arthur D. Little International: Innovation als Führungsaufgabe, Frankfurt 1988 Arthur D. Little (Hrsg.): Management der Lernprozesse im Unternehmen, Wiesbaden 1995 Auer, M./Horrion, W./Kalweit, U.: Marketing für neue Zielgruppen, Landsberg/ Lech 1989 Augustine, N.R.: Augustines Erkenntnisse, Frankfurt 1988 Bach, V./Vogler, P./Österle, H. (Hrsg.): Business Knowledge Management, Berlin 1999 Backhaus, K.: Investitionsgüter-Marketing, München 1982 Backhaus, K.: Industriegütermarketing, 5. Auflage, München 1997 Backhaus, K./Büschken, J./Voeth, M.: Internationales Marketing, 3. Auflage, Stuttgart 2000 Backhaus, K./Büschken, J./Voeth, M.: Internationales Marketing, 5. Auflage, Stuttgart 2003 Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Schuchard-Ficher, C./Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden, 5. Auflage, Berlin 1989 Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W././Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden, 9. Auflage, Berlin 2000 Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W././Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden, 10. Auflage, Berlin 2003 194 Bagozzi, R.P.: Marketing as exchange, in: Journal of Marketing 39(1975)4 Baier, M.: Elements of direct marketing, New York 1985 Balderjahn, I.: Standort-Marketing, Suttgart 2000 Baldock, R.: Destination Z: The history of the future, Chichester 1999 Bantleon, W./Wendler, E./Wolff, J.: Absatzwirtschaft, Opladen 1976 Bart, C.K.: New venture units: Use them wisely to manage innovation, in: Sloan Management Review 29(1988)4 Bartels, R.: The general theory of marketing, in: Journal of Marketing 32(1968)1 Barth, K.: Betriebswirtschaftslehre des Handels, Wiesbaden 1988 Bartlett, C.A.: Building and managing the transnational: The new organizational challange, in: Porter, M.E. (ed.): Competition in global industries, Boston, Mass. 1986 Beatty, J.: Die Welt des Peter Drucker, Frankfurt 1998 Beck, H./Prinz, A.: Ökonomie des Internet, Frankfurt 1999 Becker, J.: Marketing-Konzeption, 2. Auflage, München 1988 Becker, J.: Marketing-Konzeption, 6. Auflage, München 1998 Becker, J.: Das Marketingkonzept, München 1999 Behrens, K. C.: Absatzwerbung, Wiesbaden 1963 Beike, P.: Werbewirkung, Zürich 1985 Belz, C.: Marketing in stagnierenden Märkten: Zerstörung oder Aufbau? in: Belz, C. (Hrsg.): Realisierung des Marketing, Savosa 1986 Bennis, W./Townsend, R.: Reinventing leadership, New York 1995 Berekoven, L./Eckert, W./Ellenrieder, P.: Marktforschung, 2. Auflage, Wiesbaden 1986 Berekoven, L./Eckert, W./Ellenrieder, P.: Marktforschung, 8. Auflage, Wiesbaden 1999 Berekoven, L./Eckert, W./Ellenrieder, P.: Marktforschung, 9. Auflage, Wiesbaden 2001 Berekoven, L./Eckert, W./Ellenrieder, P.: Marktforschung, 10. Auflage, Wiesbaden 2004 Bergmann, M. (Hrsg.): Servicewüste Supermarkt, Düsseldorf 1999 Bernard, U.: Das Verfahren der Blickaufzeichnung, in: Forschungsgruppe Konsum und Verhalten (Hrsg.): Innovative Marktforschung, Würzburg 1983 Berry, L.L.: Discovering the soul of service, New York 1999 Berry, L.L./Parasuaman, A.: Marketing services, New York 1991 Besanko, D./Dranove, D./Shanley, M.: Economics of strategy, 2nd edition, New York 2000 Biggadike, E.R.: The contributions of marketing to strategic management, in: American Management Review 6(1981)4 Bingham Jr., F.G.: Business marketing management, Lincolnwood, Ill. 1998 Bishop, B.: Strategic marketing for the digital age, Lincolnwood, Ill. 1998 Blattberg, R.C./Deighton, J.: Interactive marketing: Exploiting the age of addressability, in: Sloan Management Review 33(1991)1 Blattberg, R.C./Glazer, R./Little, J.D.C. (eds.): The marketing information revolution, Boston 1994 Blickhäuser, J./Gries, T.: Individualisierung des Konsums und Polarisierung von Märkten als Herausforderung für das Konsumgüter-Marketing, in: Marketing ZFP 11(1989)1 195 Böcker, F./Gierl, H.: Determinanten der Diffusion neuer industrieller Produkte, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 57(1987)7 Bollmann, S./Heibach, C. (Hrsg.): Kursbuch Internet, Mannheim 1996 Bolz, N.: Das kontrollierte Chaos, Düsseldorf 1994 Bonoma, T.V.: The marketing edge, New York 1985 Booz Allen & Hamilton (Hrsg.): Integriertes Technologie- und Innovationsmanagement, Berlin 1991 Borden, N.H.: The economic effects of advertising, Homewood, Ill. 1942 Borner, S./Porter, M.E./Weder, R./Enright, M.: Internationale Wettbewerbsvorteile: Ein strategisches Konzept für die Schweiz, Frankfurt 1991 Bortz, J.: Lehrbuch der empirischen Forschung, Berlin 1984 Bortz, J./Döring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschafter, 3. Auflage, Berlin 2003 Bothe, K.R.: World class quality, New York 1988 Boulton, R.E.S./Libert, B.D./Samek, S.M.: Cracking the value code, New York 2000 Boutellier, R./Wagner, S.M./Wehrli, H.P. (Hrsg.): Handbuch Beschaffung, München 2003 Boyett, J.H./Boyett, J.T.: Management-Guide, München 1999 Bracker, J.: The historical development of the strategic management concept, in: American Management Review 5(1980)2 Bräunig, D./Greiling, D. (Hrsg.): Stand und Perspektiven der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre, Berlin 1999 Brandstätter, H.: Lieber Philosophieren statt Rechnen, in: Die Betriebswirtschaft 4(1987) Brauchlin, E./Wehrli, H.P.: Strategisches Management, 2. Auflage, München 1994 Braun v., C.F.: Die Beschleunigungsfalle in der Praxis, in: Zeitschrift für Planung 2(1991)3 Braun, W.: Europäisches Management, Wiesbaden 1991 Bressand, A.: Dienstleistungen in der neuen "Weltwirtschaft", in: Pestel, E. (Hrsg.): Perspektiven einer Dienstleistungswirtschaft, Göttingen 1986 Breuer, W./Gürtler, M.(Hrsg.): Internationales Management, Wiesbaden 2003 Brockhoff, K.: Schnittstellen-Management, Stuttgart 1989 Bronder, C.: Kooperationsmanagement, Frankfurt 1993 Brooks, D.: Bobos in Paradise, New York 2000 Brown, S.L./Eisenhardt, K.M.: Competing on the edge, Boston 1998 Bruhn, M.: Sponsoring, Wiesbaden 1987 Bruhn, M.: Kulturförderung und Kultursponsoring - neue Instrumente der Unternehmenskommunikation, in: Bruhn, M./Dahlhoff, D.H. (Hrsg.): Kulturförderung, Kultursponsoring, Wiesbaden 1989 Bruhn, M.: Relationship Marketing, München 2001 Bruhn, M. (Hrsg.): Internes Marketing, Wiesbaden 1995 Bruhn, M./Georgi, D.: Kosten und Nutzen des Qualitätsmanagements, München 1999 Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbindungsmanagement, Wiesbaden 1998 Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Marketing Lexikon, Wiesbaden 2001 Bruhn, M./Stauss, B. (Hrsg.): Dienstleistungsqualität, 3. Auflage, Wiesbaden 1999 196 Bruhn, M./Tilmes, J.: Social Marketing, Stuttgart 1989 Brückner, M./Przyklenk, A.: Event-Marketing, Wien 1998 Brünne, M./Esch, F.R./Ruge, H.D.: Berechnung der Informationsüberlastung in der Bundesrepublik Deutschland, Saarbrücken 1987 Büchelhofer, A.: Produktdesign aus der Sicht der Käuferverhaltensforschung, in: Der Markt 28(1989)3 Bühner, R.: Betriebswirtschaftliche Organisationslehre, 3. Auflage, München 1987 Bühner, R.: Gefährliche Versuchung High-Tech, in: Harvardmanager 10(1988)3 Bühner, R.: Technologieorientierung als Wettbewerbsstrategie, in: Zeitschrift für betriebswirschaftliche Forschung 40(1988)5 Bundschuh, T.: Produktrentabilitäts- und Regalbeschichtungssysteme, in: Der Markt 27(1988)3 Bürdek, B.E.: Desing, in: Marketing Journal 22(1989)6 Bürgel, H.D. (Hrsg.): Wissensmanagement, Heidelberg 1998 Burghold, J.A.: Oekologisch orientiertes Marketing, Augsburg 1988 Burt, D.N.: Managing suppliers up to speed, in: Harvard Business Review 67(1989)4 Busse von Colbe, W./Hammann, P./Lassmann, G.: Betriebswirtschaftstheorie, Band 2. Absatztheorie, Berlin 1990 Butler, C./Keary, J.: Managers & Mantras: One company's struggle for simplicity, Singapore 2000 Buzzell, R.D./Gale, B.T.: The PIMS-Principles, New York 1987 Cady, J.F./Buzzell, R.D.: Strategic marketing, Boston 1986 Cairncross, F.: The death of distance, Boston 1997 Camp, R.C.: Learning from the best leads to superior performance, in: Journal of Business Strategy 13(1992)3 Cannie, J.K.: Keeping customers for life, New York 1991 Champy, J.: Reengineering management, New York 1995 Chan Kim, W./Mauborgne, R.A.: Cross-cultural strategies, in: The Journal of Business Strategy 7(1987)4 Cherington, P.T.: The elements of marketing, New York 1920 Chesbrough, H.W./Teece, D.J.: When is virtual virtuous? Organizing for innovation, in: Harvard Business Review 74(1996)1 Christensen, C.M.: The innovator's dilemma, Boston 1997 Christensen, R./Andrews, K.R./Bower, J.L./Hamermesh, R.G./Porter, M.E.: Business Policy, Homewood, Ill. 1982 Chrubasik, B./Zimmermann, H.J.: Evaluierung der Modelle zur Bestimmung strategischer Schlüsselfaktoren, in: Die Betriebswirtschaft 47(1987)4 Clancy, K.J./Shulman, R.S.: Marketing myths that are killing business, New York 1994 Clark, S.: The co-marketing solution, Lincolnwood, Ill. 2000 Cleland, A.S./Bruno, A.V.: Building customer and shareholder value, in: Strategy & Leadership 25(1997)3 Cohen, W.A.: War in the marketplace, in: Business Horizons 29(1986)2 Collis, D.J./Montgomery, C.A.: Corporate strategy: resources and the scope of the firm, Chicago 1997 Conner, K.: A historical comparison of competence-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm?, in: Journal of Management 17(1991)1 197 Copeland, M.T.: Principles of merchandising, Chicago 1924 Copeland, T./Koller, T./Murrin, J.: Unternehmenswert, 2. Auflage, Frankfurt 1998 Cornelsen, C.: Lila Kühe leben länger, Frankfurt 2001 Corsten, H.: Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungsunternehmungen, München 1988 Corsten, H.: Dienstleistungsmanagement, 3. Auflage, München 1997 Coyle, D.: The weightless world, Cambridge, Mass. 1998 Cronin, M.J. (ed.): The internet strategy handbook, Boston 1996 Crosby, P.B: Quality is free, New York 1980 Curry, J./Curry, A.: The customer marketing method, New York 2000 Czepiel, J.A.: Competitive marketing strategy, Englewood Cliffs, N.J. 1992 Daft, R.L.: Management, 6th edition, Mason 2003 Dallmer, H. (Hrsg.): Handbuch Direct Marketing, 6. Auflage, Wiesbaden 1991 D'Aveni, R.A.: Hypercompetition, New York 1994 Davenport, T.H.: Process Innovation, Boston 1993 Davidow, W.H./Malone, M.S.: The virtual corporation, New York 1992 Davidow, W.H./Uttal, B.: Total customer service, New York 1989 Davis, B./Wessel, D.: Prosperity: the coming twenty-year boom and what it means to you, New York 1998 Davis, S./Botkin, J.: The coming of knowledge-based business, in: Harvard Business Review 72(1994)5 Dawson, L.M.: The human concept: new philosophy for business, in: Business Horizons 12(1969)6 Day, G.S.: Market driven strategy, New York 1990 Deal, T.E./Kennedy, A.A.: Corporate Cultures, Reading, Mass. 1982 Demby, E.H.: ESOMAR urges changes in reporting demographics, issues worldwide report, in: Marketing News 24(1990)1 Deming, W.E.: Quality, productivity and competitive position, Cambridge, Mass. 1982 Denton, K.D.: Horizontal management, New York 1991 DeRose, L.J.: The value network, New York 1994 Dichtl, E.: Marketing vor neuen Herausforderungen - Ein Problemaufriss, in: Raffée, H./Wiedmann, K.P. (Hrsg.): Strategisches Marketing, Stuttgart 1985 Dichtl, E.: Der Weg zum Käufer, München 1987 Dieckmann, R./Prigge, M./Röttger, J.: Kleine Leute, grosse Klasse, in: Stern (1990)3 Diller, H.: Das Preiswissen von Konsumenten – Neue Ansatzpunkte und empirische Ergebnisse, in: Marketing ZFP 10(1988)1 Diller, H.: Key-Account-Management als vertikales Marketingkonzept, in: Marketing ZFP 11(1989)4 Diller, H.: Preis-Management im Zeichen des Beziehungsmarketing, in: Die Betriebswirtschaft 57(1997)6 Diller, H. (Hrsg.): Vahlens Grosses Marketinglexikon, 2. Auflage, München 2001 Diller, H./Beba, W.: Erlebnisorientierte Ladengestaltung im Bekleidungshandel, Hamburg 1988 Diller, H./Kusterer, M.: Beziehungsmanagement, in: Marketing ZFP 10(1988)3 Dörler, A.: Konsumentenpolitik in der Schweiz, Diessenhofen 1982 Dolan, R.J./Simon, H.: Power pricing, New York 1996 198 Dolmetsch, R.: eProcurement, München 2000 Domizlaff, H.: Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, Hamburg 1992 Doole, I./Lowe, R.: International marketing strategy, 3rd. edition, London 2001 Downes, L./Mui, C.: Unleashing the killer app: digital strategies for market dominance, Bosten 1998 Doyle, P.: Marketing management and strategy, New York 1994 Drees, N.: Sportsponsoring, Wiesbaden 1989 Drexel, G.: Strategische Entscheidungen im Einzelhandel, in: Krulis-Randa, J.S./Ergenzinger, R. (Hrsg.): Entwicklung zum strategischen Denken im Handel, Bern 1990 Dreyer, A.: Werbung im und mit Sport, Göttingen 1986 Dru, J.M.: Disruption, New York 1996 Drucker, P.F.: Managing for the future, Oxford 1992 EAN-Austria (Hrsg.): ECR-Handbuch Österreich, Wien 1997 Eckstein, P.P.: Angewandte Statistik mit SPSS - Praktische Einführung für Wirtschaftswissenschafter, 3. Auflage, Wiesbaden 2000 Edosomwan, J.A.: Productivity and quality improvement, Berlin 1988 Egger, U.: Konsumententrends, Düsseldorf 1997 Ehrbar, A.: EVA, New York 1998 Eisenhardt, K.M./Brown, S.L.: Patching: Restitching business portfolios in dynamics markets, in: Harvard Business Review 77(1999)3 Ellis, K./Lee, J./Beatty, S.: Relationships in consumer marketing: Directions for future research, in: Park, W./Smith, D. (eds.): Marketing theory and applications, AMA Educators' Proceedings, Volume 5, Chicago 1994 Enzweiler, T.: Wo die Preise laufen lernen, in: manager magazin 20(1990)3 Erdtmann, S.L.: Sponsoring und emotionale Erlebniswerte, Wiesbaden 1989 Esch, F.R.(Hrsg.): Moderne Markenführung, 2. Auflage, Wiesbaden 2000 Eschenbach,R./Kunesch, H.: Strategische Konzepte, Stuttgart 1994 Ettore, B.: Give me a "B" for Benchmarking, in: Management Review 81(1992)5 Evans, P./Wurster, T.S.: Blown to bits, Boston 2000 Evered, R.: So what is strategy, in: Long Range Planning 16(1983)3 Ewald, C.: Werbung für Einsteiger, 3. Auflage, Freiburg 1999 Expertenbefragung des Japanischen Amtes für Wissenschaft und Technologie, in: gdi-Impuls 6(1988)3 Fässler, E.: Gesellschaftsorientiertes Marketing, Bern 1989 Feigenbaum, A.V.: Total quality control, New York 1983 Feldmann, M.L./Spratt, M.F.: Speedmanagement für Fusionen, Wiesbaden 2000 Fincke, U./Goffard, E.: Customizing distribution, in: The McKinsey Quarterly 30(1993)1 Findeisen, F.: Absatztheorie, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2(1925)1 Fischbach, S.: Lexikon der Wirtschaftsformeln und Kennzahlen, Landsberg/Lech 1999 Fitzsimmons, J.A./Fitzsimmons, M.J.: Service management for competitive advantage, New York 1994 Fletcher, K.: Marketing management and information technology, 2nd edition, Hemel Hempstead 1995 Foster, R.N.: Innovation, Wiesbaden 1986 199 Fram, E.H.: Purchasing partnership: Teh buyer's view, in: Marketing Management 4(1995)1 Frese, E.: Grundlagen der Organisation, 6. Auflage, Wiesbaden 1995 Friedag, H.R./Schmidt, W.: Balanced Scorecard, Freiburg 1999 Fritz, W.: Konsequenzen des vergleichenden Warentests für das strategische Marketing, in: Raffée, H./Wiedemann, K.P. (Hrsg.): Strategisches Marketing, Stuttgart 1985 Fritz, W.: Internet-Marketing und Electronic Commerce, Wiesbaden 2000 Fullerton, R.A.: How modern is modern marketing? Marketing's evolution and the myth of "production era", in: Journal of Marketing 52(1988)1 Furlong, C.B.: Marketing for keeps, New York 1993 Furrer, P.: Ueberleben mit Innovationen, Kilchberg 1990 Garbe, D./Grothe-Senf, A. (Hrsg.): Bürgerbeteiligung in der Verbraucherinformationspolitik, Frankfurt 1986 Garvin, D.A.: Competing on the eight dimensions of quality, in: Harvard Business Review 65(1987)6 Garvin, D.A.: Building a learning organization, in: Harvard Business Review 71(1993)4, Geml, R./Geisbüsch, H.R./Lauer, H.: Das kleine Marketing-Lexikon, 2. Auflage, Düsseldorf 1999 Gerybadze, A.: Innovationswettbewerb: Der Hase und der Igel in den Märkten von morgen, in: Arthur D. Little International (Hrsg.): Management des geordneten Wandels, Wiesbaden 1988 Geus de, A.: The living company, London 1997 Ghoshal, S.: Global strategy: an organizing framework, in: Strategic Management Journal 8(1987)6 Gilson, C./Pratt, M./Roberts, K./Weymes, E.: Peak Performance, London 2000 Goldman, S.L./Nagel, R.N./Preiss, K./Warnecke, H.J.: Agil im Wettbewerb, Heidelberg 1996 Gotta, M. (Hrsg.): Brand News, Hamburg 1988 Gouillart, J.F./Kelley, J.N.: Business transformation, New York 1995 Grant, R.M.: The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, in: California Management Review 33(1991)3 Grant, R.M.: Contemporary strategy analysis, 3rd. edition, Malden Mass. 1998 Gratton, L.: Living strategy, London 2000 Green, P.E.: Analysing multivariate date, Hinsdale 1978 Green, P.E./Tull, D.S.: Methoden und Techniken der Marktforschung, 4. Auflage, Stuttgart 1982 Griesshammer, R.: Kriterien zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Produkten in: Brandt, A./Hansen, U./Schoenheit, I./Klaus, W. (Hrsg.): Oekologisches Marketing, Frankfurt 1988 Gröne, A.: Marktsegmentierung bei Investitionsgütern, Wiesbaden 1977 Grönroos, C.: Service management and marketing, Lexington, Mass. 1990 Groocock, J.M.: The chain of quality, New York 1986 Groth, W./Kammel, A.: 13 Stolpersteine vor dem schlanken Unternehmen, in: Harvard Business Manager 15(1993)1 Gündling, C.: Wer den Kunden nicht ehrt ..., Stuttgart 1999 Grünig, R./Kühn,R.: Methodik der strategischen Planung, Bern 2000 Günter, B./Kleinaltenkamp, M.: Marketing-Management für neue Fertigungstechnologien, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 39(1987)5 Gutenberg, E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 2. Band, Der Absatz, 11. Auflage, Berlin 1968 200 Hagel III, J./Armstrong, A.G.: Net gain, Boston 1997 Hagel III, J./Singer, M.: Net worth, Boston 1999 Halal, W.E./Geranmayeh, A./Pourdehnad, J.: Internal markets, New York 1993 Hall, W.K.: Survival strategies in a hostile environment, in: Hamermesh, R.G. (ed.): Strategic management, New York 1983 Hamel, G.: Strategy as revolution, in: Harvard Business Review 74(1996)4 Hamel, G./Prahalad, C.K.: Strategic intent, in: Harvard Business Review 67(1989)3 Hamel, G./Prahalad, C.K.: Corporate imagination and expeditionary marketing, in: Harvard Business Review 69(1991)4 Hamel, G./Prahalad, C.K.: Competing for the future, Boston 1994 Hamermesh, R.G.: Making planning strategic, in: Harvard Business Review 64(1986)4 Hamermesh, R.G./Silk, S.B.: How to compete in stagnate industries, in: Hamermesh, R.G. (ed.): Strategic management, New York 1983 Hammann, P.: Betriebswirtschaftliche Aspekte des Abfallproblems, Arbeitspapier zum Marketing Nr. 18, Bochum 1987 Hammann, P./Erichson, B.: Marktforschung, 2. Auflage, Suttgart 1990 Hammer, M./Champy, J.: Reengineering the corporation, New York 1993 Hanan, M.: Profits without products, New York 1992 Hand, M./Plowman, B. (eds.): Quality management handbook, Oxford 1992 Hanning, U. (Hrsg.): Data Warehouse und Managementinformationssysteme, Stuttgart 1996 Hansen, U.: Marketing und soziale Verantwortung, in: Die Betriebswirtschaft 48(1988)6 Hansen, U./Algermissen, J.: Handelsbetriebslehre 1 und 2, Göttingen 1979 Hansen, U./Raabe, T./Stauss, B.: Verbraucherabteilungen als strategische Antwort auf Verbraucher- und umweltpolitische Herausforderungen, in: Raffée, H./Wiedemann, K.P. (Hrsg.): Strategisches Marketing, Stuttgart 1985 Hanson, W.: Principles of internet marketing, Cincinnati 2000 Harmon, R.L.: Reinventing the business, New York 1996 Harrigan, K.R: Unternehmensstrategien für reife und rückläufige Märkte, Frankfurt 1989 Harrison, B.: Lean and mean, New York 1994 Hartcher, P.: The ministry, Boston 1998 Hartley, R.F.: Marketing mistakes, 2nd. edition, New York 1981 Hartley, R.F.: Marketing mistakes and successes, 7th edition, New York 1998 Hasenauer, R./Scheuch, F.: Entscheidungen im Marketing, Opladen 1974 Hässig, K.: Wettbewerbsfähigkeit und neue Technologien in der Produktion, in: Die Unternehmung 42(1988)5 Hässig, K.: Prozessmanagement, Zürich 2000 Hätty, H.: Das Transferproblem von Marken, in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 35(1989)2 Hauser, J.R./Clausing, D.: The house of quality, in: Harvard Business Review 66(1988)3 Heinemann, G.: Betriebstypenprofilierung und Erlebnishandel, Wiesbaden 1989 Heinen, E./Dill, P.: Unternehmenskultur, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 56(1986)3 201 Hermanns, A.: CAS-Systeme für Database-Marketing, in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 34(1988)3 Hermanns, A./Drees, N.: Kultursponsoring - Neue Möglichkeiten für die Kommunikationspolitik, in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 33(1987)1 Hermanns, A./Drees, N./Püttmann, M.: Siegen mit Siegern? in: Absatzwirtschaft Sonderausgabe 10, 1986 Hermanns, A./Sauter, M.: Management-Handbuch Electronic Commerce, München 1999 Herrmann, A./Homburg, C. (Hrsg.): Marktforschung, Wiesbaden 1999 Herrmann, A.: Produktmanagement, München 1998 Hertel, J.: Warenwirtschaftssysteme, 3. Auflage, Heidelberg 1999 Heskett, J.L.: Logistics - essential to strategy, in: Harvard Business Review 55(1977)6 Heskett, J.L.: Managing in the service economy, Boston 1986Heskett, J.L./Sasser Jr., W.E./Hart, C.W.L.: Service breakthroughs, New York 1990 Heskett, J.L./Sasser Jr., W.E./Schlessinger, L.A.: The service profit chain, New York 1997 Hesse, J./Kaupp, P. (Hrsg.): Kundenkommunikation und Kundenbindung: Neue Ansätze zum Dialog im Marketing, Berlin 1997 Heydt von der, A. (Hrsg.): Handbuch Efficient Consumer Response, München 1999 Hilke, W.: Grundprobleme und Entwicklungstendenzen des Dienstleistungs-Marketing, in: Hilke, W. (Hrsg.): Dienstleistungs-Marketing, Wiesbaden 1989 Hill, W.: Marketing I, Bern 1971 Hill, W.: Marketing II, Bern 1971 Hill, W./Rieser, I.: Marketing-Management, Bern 1990 Hinterhuber, H.H.: Strategische Unternehmungsführung, 2. Auflage, Berlin 1980 Hinton, T./Schaeffer, W.: Customer-focused quality, Englewood Cliffs, NJ 1994 Hoffmann, F.: So wird Diversifikation zum Erfolg, in: Harvardmanager 11(1989)4 Holscher, C.: Sozio-Marketing, Essen 1977 Holzmüller, H.H./Schuh, A.: Skandal-Marketing, in: Frank, H./Plaschka, G./Rössl, D. (Hrsg.): Umweltdynamik, Wien 1988 Homann, K.: Verwaltungsmarketing, in: Chmielewicz, K./Eichhorn, P. (Hrsg.): Handwörterbuch der Oeffentlichen Betriebswirtschaft, Stuttgart 1989 Homburg, C./Werner, H.: Kundenorientierung mit System, Frankfurt 1998 Hope, J./Hope, T.: Competing in the third wave, Boston 1997 Hopfenbeck, W.: Umweltorientiertes Management und Marketing, München 1990 Horváth, P./Herter, R.N.: Benchmarking, in: Controlling 4(1992)1 Horváth & Partner (Hrsg.): Balanced Scorecard umsetzen, Stuttgart 2000 Horx, M.: Das Wörterbuch der 90er Jahre, Hamburg 1991 Horx, M.: 2000X, Bonn 2000 Houston, F.S.: The marketing concept: What it is and what it is not, in: Journal of Marketing 50(1986)2 Houston, F.S./Gassenheimer, J.B.: Marketing and exchange, in: Journal of Marketing 51(1987)4 Houston, F.S./Gassenheimer, J.B./Maskulka, J.M.: Marketing exchange transactions and relationships, Westport, CT 1992 Hunt, S.D.: The nature and scope of marketing, in: Journal of Marketing 40(1976)3 202 Hunt, S.D.: General theories and the fundamental explananda of marketing, in: Journal of Marketing 47(1983)4 Hussey, D./Jnester, P.: Competitor intelligence, Chichester 1999 Huth, R./Pflaum, D.: Einführung in die Werbelehre, 2. Auflage, Stuttgart 1986 IFAM: Die 199 besten Checklisten für Ihr Marketing, München 1998 Iikubo, H.: Innovation in Japan am Beispiel Honda, in: bulletin (1990)1-2 Imai, K.: Kaizen, New York 1986 IMD International Lausanne/London Business School/The Wharton School of the University of Pennsylvania (Hrsg.): Das MBA-Buch Mastering Management, Stuttgart 1998 Inglehart, R.: Wertewandel und politisches Verhalten, in: Matthes, J. (Hrsg.): Sozialer Wandel in Westeuropa, Frankfurt 1979 Irrgang, W.: Der Kampf um die Marketing-Führerschaft, in: Absatzwirtschaft 32(1989)9 Jackson, R./Wang, P.: Strategic database marketing, Lincolnwood, Ill. 1994 James, B.G.: Alliance: the new strategic focus, in: Long Range Planning 18(1985)3 Janisch, M.: Das Anspruchsgruppenmanagement, Bern 1993 Jansen, S.A.: Mergers & Acquisition, 3. Auflage, Wiesbaden 2000 Jennings, K./Westfall, F.: Benchmarking for strategic action, in: Journal of Business Strategy 13(1992)3 Johnson, S./Wilson, L.: Das Minuten Verkaufstalent, Reinbek bei Hamburg 1988 Johnson, W.C./Chvala, R.J.: Total quality in marketing, Delray Beach 1996 Jugel, S./Zerr, K.: Dienstleistungen als strategisches Element eines Technologie-Marketing, in: Marketing ZFP 11(1989)3 Juran, J.M.: Juran on planning for quality, New York 1988 Juran, J.M.: Made in U.S.A.: A renaissance in quality, in: Harvard Business Review 71(1993)4 Jüttner, U.: Kompetenzorientiertes Marketing, Zürich 1994 Kanter, R. M.: When giants learn to dance, New York 1989 Kaplan, R.S./Norton, D.P.: The balanced scorecard, Boston 1996 Kappeller, W.: Das Marketing-Lexikon für die Praxis, Landsberg/Lech 2000 Katzenbach, J.R.: Teams at the top, Boston 1998 Katzenbach, J.R./Smith, D.K.: The wisdom of teams, Boston 1993 Kay, J.: Foundations of corporate success, Oxford 1995 Kaynak, E.: Global marketing: theory and practice, in: Journal of Global Marketing 1(1987)1/2 Keeler, L.: Cyber marketing, New York 1995 Kieser, A.: Innovation und Organisationskultur, in: gdi impuls 2(1984)4 Kilimann, J./Schlenk von, H./Tienes, E.C. (Hrsg.): Efficient Consumer Response, Stuttgart 1998 Kinnear, T.C./Taylor, J.R.: Marketing research: an applied approach, 2nd. edition, Singapore 1985 Klaus, P./Krieger, W. (Hrsg.): Lexikon Logistik, 2. Auflage, Wiesbaden 2000 Klee, A.: Strategisches Beziehungsmanagement, Aachen 2000 Kleinaltenkamp, M. (Hrsg.): Dienstleistungsmarketing, Wiesbaden 1995 Kleinaltenkamp, M./Fliess, S./Jacob, F. (Hrsg.): Customer Integration, Wiesbaden 1996 203 Köhler, R.: Strategisches Marketing: Auf die Entwicklung eines umfassenden Informations-, Planungsund Organisationssystem kommt es an, in: Marketing ZFP 7(1985)3 Koppelmann, U.: Design: Nur Selbstzweck darf es nicht werden, in: Marketing Journal 20(1987)1 Koppelmann, U.: Produktmarketing, 5. Auflage, Berlin 1997 Kotabe, M.: Global sourcing strategy, New York 1992 Kotkin, J.: Tribes, New York 1993 Kotler, P.: Marketing management, Englewood Cliffs, N.J. 1967 Kotler, P.: A generic concept of marketing, in: Journal of Marketing 36(1972)2 Kotler, P.: Marketing Management, Stuttgart 1977 Kotler, P.: Megamarketing, in: Harvard Business Review 64(1986)2 Kotler, P.: Megamarketing, in: Harvardmanager 8(1986)3 Kotler, P.: Uncertain 90s, in: Marketing News 21(1987)16 Kotler, P.: Marketing management, 6th edition, Englewood Cliffs, N.J. 1988 Kotler, P.: Marketization - The art of creating market driven business, in: Werbeforschung & Praxis 34(1989)6 Kotler, P.: «Bestelle nie nackt eine Pizza», in: trend 20(1989)11 Kotler, P.: Marketing Management, 9th edition, Upper Saddle River, N.J. 1997 Kotler, P.: Kotler on Marketing, New York 1999 Kotler, P.: Marketng Management, 10th edition, Upper Saddle River, N.J. 2000 Kotler, P./Andreasen, A.R.: Strategic marketing for nonprofit organizations, 3rd edition, Englewood Cliffs, N.J. 1987 Kotler, P./Andreasen, A.R.: Strategic marketing for nonprofit organizations, 5th edition, Englewood Cliffs, N.J. 1996 Kotler, P./Fahey, L./Jatusripitak, S.: The new competiton, Englewood Cliffs, N.J. 1985 Kotler, P./Roberto, E.L.: Social marketing, New York 1989 Kotler, P./Scheff, J.: Standing room only, Boston 1997 Kotler, P./Zaltmann, T.: Social marketing: an approach to planned social change, in: Journal of Marketing 35(1971)3 Kreuzer, R.: Global Marketing - Konzeption eines länderübergreifenden Marketing, Wiesbaden 1989 Kroeber-Riel, W.: Konsumentenverhalten, 3. Auflage, München 1984 Kroeber-Riel, W.: Die inneren Bilder der Konsumenten, in: Marketing 8(1986)2 Kroeber-Riel, W.: Informationsüberlastung durch Massenmedien und Werbung in Deutschland, in: Die Betriebswirtschaft 47(1987) Kroeber-Riel, W.: Strategie und Technik der Werbung, 3. Auflage, Stuttgart 1991 Kroeber-Riel, W./Meyer-Hentschel, G.: Werbung, Würzburg 1982 Krüger, W.: Die Transformation von Unternehmungen und ihre Konsequenzen für die Organisation der Information und Kommunikation, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 45(1993)6 Krulis-Randa, J.S. Marketing-Logistik, Bern 1977 Krulis-Randa, J.S.: Marketing - Theorie und Praxis, in: Die Unternehmung 31(1977)1 204 Krulis-Randa, J.S.: Die Entstehung der Marketing-Idee - Ein Beitrag zur Dogmengeschichte der Betriebswirtschaftslehre, in: Krulis-Randa, J.S./Schneebeli, R./Siegenthaler, H. (Hrsg.): Geschichte der Gegenwart, Zürich 1981 Krulis-Randa, J.S.: Reflexionen zur Unternehmungskultur, in: Die Unternehmung 38(1984)4 Krulis-Randa, J.S.: Das Tao des Marktes - ein Weg der Marketing-Realisierung, in: Belz, C. (Hrsg.): Realsierung des Marketing, Savosa 1986 Krulis-Randa, J.S.: Die Funktion des Handels, die Handelsfunktionen und die Handelsstrategie, in: KrulisRanda, J.S./Ergenzinger, R. (Hrsg.): Entwicklung zum strategischen Denken im Handel, Bern 1990 Kühn, R.: Strategische Marketingkonzepte: Notwendigkeit oder Luxus, in: Die Unternehmung 39(1985)4 Kühn, R./Grünig, R.: Grundlagen der strategischen Planung, 2. Auflage, Bern 2000 Kühn, R./Jucken, H.: Die Werbung im Markt von morgen, Zürich 1988 Kühne, R.: Nachfragemacht zwischen Einzelhandel und Konsumgüterindustrie, Bern 1984 Kunde, J.: Corporate Religion, Wiesbaden 2000Kurtz, D.L./Clow, K.E.: Services marketing, New York 1998 Kutter, M.: Abschied von der Werbung, Niederteufen 1976 Lamming, R.: Beyond Partnership, New York 1993 Landry, J.T.: Supply chain management, in: Harvard Business Review 76(1998)6 Lasswell, H.D.: The structure and function of communication in society, in: Schramm, W. (ed.): Mass communication, Urbana Ill., 1949 Lauer, H./Geml, R.: Das kleine Verkaufs-Lexikon, Düsseldorf 2000 Leavitt, H.J.: Corporate Pathfinders, Homewood, Ill. 1986 Leder, M.: Innovationsmanagement, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft Ergänzungsheft (1989)1 Leenders, M.R./Blenkhorn, D.L.: Reverse Marketing, Frankfurt 1989 Lehmann, D.R./Jocz, K.E. (eds.): Reflections on the futures of marketing, Cambridge, Mass. 1997 Lele, M.M.: Creating strategic leverage, New York 1992 Leonard-Barton, D.: Wellsprings of knowledge, Boston 1995 Leven, W.: Anzeigen-Werbung, in: Marketing-Journal 21(1988)3 Levine, R./Locke, C./Searls, D./Weinberger, D.: Das Cluetrain Mainifest, München 2000 Levitt, T.: Marketing Myopia, in: Harvard Business Review 38(1960)4 Levitt, T.: The globalization of markets, in: Harvard Business Review 61(1983)3 Levitt, T.: After the sale is over ..., in: Harvard Business Review 61(1983)5 Levitt, T.: Marketing Imagination, Landsberg/Lech 1984 Lewis, R.J./Erickson, L.G.: Marketing functions and marketing systems: a synthesis, in: Journal of Marketing 33(1969)3 Limerick, D./Cunnington, B.: Managing the new organization, San Francisco 1993 Link, J. (Hrsg.): Wettbewerbsvorteile durch Online Marketing, Berlin 1998 Lischka, A.: Dialogkommunikation im Relationship Marketing, Wiesbaden 2000 Lisowsky, A.: Primat des Absatzes? in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 13(1936)1 Loock, F.: Kunstsponsoring, Wiesbaden 1988 Lötscher, A. : Von Ajax bis Xerox, Zürich 1987 205 Lovelock, C.: Product plus, New York 1994 Magrath, A.J.: Strengthen brands with 8 essential elements, in: Marketing News 24(1990)1 Magrath, A.J.: How to achieve zero-defect marketing, New York 1993 Mahoney, R./Pandian, J.: The competence-based view within the conversation of strategic management, in: Strategic Management Journal 13(1992)5 Malhotra, N.K.: Marketing research, Englewood Cliffs, N.J. 1993 Mankiw, N.G.: Prinicples of economics, Forth Worth, TX. 1998 Marconi, J.: Future marketing, Lincolnwood, Ill. 2000 Marconi, J.: The brand marketing book, Licolnwood, Ill. 2000 Markin, R.J.: Marketing, New York 1979 Marn, M.V./Rosiello, R.T.: Balanceakt auf der Preistreppe, in: Harvard Business Manager 15(1993)2 Martin, I./Sperling, U.A.: Erfolgreiches Marketing, Freiburg 1998 Mathe, H./Shapiro, R.D.: Integrative service strategy in the manufacturing company, London 1993 Matheson, D./Matheson, J.: The smart organization, Boston 1998 McCall Jr., M.W.: High flyers, Boston 1998 McCarthy, E.J.: Basic marketing, Homewood, Ill. 1964 McCarthy, E.J.: Essentials of marketing, Homewood, Ill. 1979 McGarry, E.D.: Some functions of marketing reconsidered, in: Cox, R./Alderson, W. (ed.): Theory in marketing, Chicago 1950 McGrath, M.E./Hoole, R.W.: Manufacturing's new economies of scale, in: Harvard Business Review 70(1992)3 McHugh, P./Merli, G./Wheeler III, W.A.: Beyond business process reengineering, Chichester 1995 McKenna, R.: Relationship marketing, Reading, Mass. 1991 McKenna, R.: Real-time marketing, in: Harvard Business Review 73(1995)4 McKenna, R.: Real time, Boston 1997 McLaren, C.H./McLaren, B.J.: E-Commerce, Cincinnati, Ohio 2000 McTaggart, J.M./Kontes, P.W./Mankins, M.C.: The value imperative, New York 1994 Means, G./Schneider, D.: Meta-Capitalism, New York 2000 Meffert, H.: Marketing, 5. Auflage, Wiesbaden 1980 Meffert, H.: Marketing, 7. Auflage, Wiesbaden 1986 Meffert, H.: Marktforschung, Wiesbaden 1986 Meffert, H.: Marketing im Spannungsfeld von weltweitem Wettbewerb und nationalen Bedürfnissen, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 56(1986)8 Meffert, H.: Erfolgsfaktoren im Einzelhandelsmarketing, in: Bruhn, M. (Hrsg.): Marketing-Erfolgsfaktoren im Handel, Frankfurt 1987 Meffert, H.: Markenstrategien als Waffen im Wettbewerb, in: Henzler, H.A. (Hrsg.): Handbuch Strategische Führung, Wiesbaden 1988 Meffert, H.: Marketingforschung und Käuferverhalten, 2. Auflage, Wiesbaden 1992 Meffert, H.: Marketing, 8. Auflage, Wiesbaden 1998 206 Meffert, H.: Marketing, 9. Auflage, Wiesbaden 2000Meffert, H. (Hrsg.): Lexikon der aktuellen MarketingBegriffe, 2. Auflage, Frankfurt 1999 Meffert, H. (Hrsg.): Marktorientierte Unternehmungsführung im Wandel, Wiesbaden 1999 Meffert, H./Bruhn, M.: Dienstleistungsmarketing, 3. Auflage, Wiesbaden 2000 Meffert, H./Katz, R.: Unternehmensverhalten in strategischen und schrumpfenden Märkten, Arbeitspapier Nr. 12, Münster 1983 Meffert, H./Kirchgeorg, M.: Marktorientiertes Umweltmanagement, 2. Auflage, Stuttgart 1993 Meffert, H./Kirchgeorg, M./Ostmeier, H.: Strategisches Marketing und Umweltschutz, Münster 1989 Meier, W.A./Schanne, M. (Hrsg.): Gesellschaftliche Risiken in den Medien, Zürich 1996 Meran, R./Wehrli, H.P.: Praxisbeispiel Belimo: Co-opetitives Netzwerk zur erfolgreichen Internationalisierung, in: Manager Bilanz (1999)III Meredith, J.R.: The strategic advantages of the factory of the future, in: California Management Review 29(1987)3 Meyer, A.: Mikrogeographische Marktsegmentierung, in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 35(1989)4 Meyer, A. (Hrsg.): Handbuch Dienstleistungs-Marketing, 2 Bände, Stuttgart 1998 Meyer, A./Davidson, H.J.: Offensives Marketing, Planegg 2000 Meyer, A./Mattmüller, R.: Qualität von Dienstleistungen, in: Marketing ZFP 9(1987)3 Meyer, J.A.: Computer Integrated Marketing, München 1992 Meyer, M.H./Lehnerd, A.P.: The power of product platforms, New York 1997 Meyer, P.: War-speed growth, New York 2000 Meyer-Hentschel, G.: Erfolgreiche Anzeigen, Wiesbaden 1988 Meyer-Hentschel, G.: Alles was Sie schon immer über Werbung wissen wollten, Wiesbaden 1996 Meyers, G.C.: Bevor die Fetzen fliegen, Frankfurt 1989 Micklethwait, J./Wooldridge, A.: The witch doctors, London 1996 Mikunda, C.: Marketing spüren, Frankfurt 2002 Mintzberg, H.: The strategy concept I: Five Ps for strategy, in: California Management Review 30(1987)1 Mintzberg, H.: The strategy concept II: Another look at why organizations need strategies, in: California Management Review 30(1987)1 Mintzberg, H.: The rise and fall of strategic planning, New York 1994 Mintzberg, H./Waters, J.A.: Of strategies, deliberate and emergent, in: Strategic Management Journal 6(1985)3 Moore, J.F.: The death of competition, Chichester 1996 Moriarty, R.T./Kosnik, T.J.: High-tech marketing: concepts, continuity, and change, in: Sloan Management Review 30(1989)4 Morwind, K.: Markenartikel, Markennamen und ihre Zukunft, in: Werbeforschung & Praxis 31(1986)1 Moyer, R./Hunt, M.D.: Macro marketing, 2nd edition, Santa Barbara 1978 Muchna, C.: Strategisches Dienstleistungsmarketing für Distributionskonzepte, in: Strategische Planung 4(1989)3/4 Mühlbacher, H./Dahringer, L./Leihs, H.: International marketing, London 1999 Müller, S./Kornmeier, M.: Internationale Wettbewerbsfähigkeit, München 2000 207 Müller, W.: Am Nutzen orientiert, in: Absatzwirtschaft 30(1987)12 Müller-Stewens, G./Lechner, C.: Strategisches Management, Stuttgart 2001 Muther, A.: Electronic Customer Care, Berlin 1999 Nadler, D.A.: Champions of change, San Francisco 1998 Nagle, T.T.: Managing price competition, in: Marketing Management 2(1993)1 Nalebuff, B.J./Brandenburger, A.M.: Co-opetition, New York 1996 Neely, A.: Measuring business performance, London 1998 Nefiodow, L.A.: Der sechste Kondratieff, Sankt Augustin 1996 Neibecker, B.: Werben mit Bildern, in: Marketing Journal 20(1987)4 Neuerburg, U.: Werbung im Privatfernsehen, Heidelberg 1988 Nevens, M.T./Summe, G.L./Uttal, B.: Commercializing technology: What the best companies do, in: Harvard Business Review 68(1990)3 Nevett, T./Schleede Jr., J.M.: Marketing in the AIDS era, in: Business Horizons 32(1989)6 Newell, F.: Loyalty.com, New York 2000 Nickels, W.G./Wood, M.B.: Marketing Relationships, Quality, Value, New York 1997 Niepmann, C.: Wirkungsmodelle der Werbung, Hamburg 1999 Nieschlag, R./Dichtl, E./Hörschgen, H.: Marketing, 15. Auflage, Berlin 1988 Nonaka, I./Takeuchi, H.: The Knowledge-creating company, New York 1995 Norman, D.R.: Dinge des Alltags, Frankfurt 1989 Normann, R.: Dienstleistungsunternehmen, Hamburg 1987 Normann, R./Ramírez, R.: Designing interactive strategy, in: Harvard Business Review 71(1993)4 O’Dell/Grayson Jr., C.J.: If only we know what we know, New York 1998 Ogilvy, D.: Über Werbung, Düsseldorf 1984 Ohmae, K.: The triad world view, in: The Journal of Business Strategy 7(1987)4 Ohmae, K.: Managing in a borderless world, in: Harvard Business Review 67(1989)3 Ohmae, K.: Planting for a global harvest, in: Harvard Business Review 67(1989)4 Oliver, R.W.: The shape of things to come, New York 1999 Olve, N.G./Roy, J./Wetter, M.: Performance drivers, Chichester 1999 O'Reilly, III, C.A./Pfeffer, J.: Hidden value, Boston2000 Osterloh, M./Frost, J. Prozessmanagement als Kernkompetenz, 2. Auflage, Wiesbaden 1998 Ottman, J.A.: Green marketing, Lincolnwood, Ill. 1993 Ouchi, W.: Theory Z, Reading, Mass. 1981 Pascale, R./Athos, A.: The art of japanese management, Harmondsworth 1981 Pasternack, B.A./Viscio, A.J.: The centerless corporation, New York 1998 Pavio, A.: Imagery and verbal process, Hillsdale 1979 Payne, A.: The essence of services marketing, New York 1993 Payne, A. (ed.): Advances in relationship marketing, London 1995 Payne, A./Rapp, R.: Handbuch Relationship Marketing, München 1999 208 Penrose, E.: The theory of the growth of the firm, Oxford 1959 Pepels, W.: Lexikon des Marketing, München 1996 Peppers, D.: Building value through customer strategies, Zürich 2004 Peppers, D./Rogers, M.: Enterprise one to one, New York 1997 Perillieux, R.: Einstieg bei technischen Innovationen: früh oder spät? in: Zeitschrift Führung + Organisation 58(1989)1 Perlmutter, H.V./Heenan, D.A.: Cooperate to compete globally, in: Harvard Business Review 64(1986)2 Pernicky, R.: Innovative Wertschöpfungsstrategien, in: Arthur D. Little International (Hrsg.): Management des geordneten Wandels, Wiesbaden 1988 Peters, T.: Jenseits der Hierarchien, Düsseldorf 1993 Peters, T.J./Watermann, R.H.: In search of excellence, New York 1982 Pfeiffer, H.: Der Verkaufs-Fall, Wien 1989 Picot, A./Dietl, H./Franck, E.: Organisation, 3. Auflage, Stuttgart 2002 Picot, A./Reichwald, R./Wigand, R.T.: Die grenzenlose Unternehmung, 3. Auflage, Wiesbaden 1998 Pine II, J.B.: Mass customization, Boston 1993 Pine II J.B./Gilmore, J.H.: The experience economy, Boston 1999 Porter, M.E.: Competitive strategy, New York 1980 Porter, M.E.: Competitive advantage, New York 1985 Porter, M.E.: The strategic role of international marketing, in: The Journal of Consumer Marketing 3(1986)2Porter, M.E.: From competitive advantage to corporate strategy, in: Harvard Business Review 65(1987)3 Porter, M.E.: The competitive advantage of nations, in: Harvard Business Review 68(1990)2 Porter, M.E.: The competitive advantage of nations, London 1990 Porter, M.E.: Towards a dynamic theory of strategy, in: Strategic Management Journal 12(1991)Special Issue Winter Porter, M.E. (ed.): Competition in global industries, Boston 1986 Prahalad, C.K./Hamel, G.: The core competence of the corporation, in: Harvard Business Review 68(1990)3 Prahalad, C.K./Ramaswamy, V.: The future of competition, Boston 2004 Prick, H.J.: Warum Line Extension für Nivea? in: Spiegel-Verlag (Hrsg.): Brand news, Hamburg 1988 Pringle, H./Thompson, M.: Brand spirit, Chichester 1999 Prognos: Weltmärkte bis 1995, Stuttgart 1984 Pümpin, C. Management strategischer Erfolgspotentiale, 2. Auflage, Bern 1983 Pümpin, C.: Das Dynamik-Prinzip, Düsseldorf 1989 Pümpin, C.: Strategie der Wertsprünge, in: Manager Bilanz (1999)III Quelch, J.A.: How to build a product licensing program, in: Harvard Business Review 63(1985)3 Quelch, J.A.: How to market to consumers, New York 1989 Quinn, J.B.: Managing innovation: controlled chaos, in: Harvard Business Review 63(1985)3 Raffée, H.: Marktorientierung der BWL zwischen Anspruch und Wirklichkeit, in: Die Unternehmung 38(1984)1 209 Raithel, H.: Alles für die Marke, in: manager magazin 19(1989)10 Raithel, H.: Das Geheimnis des einsamen Reiters, in: manager magazin 19(1989)10 Rall, W.: Strategien für den weltweiten Wettbewerb, in: Henzler, H.A. (Hrsg.): Handbuch Strategische Führung, Wiesbaden 1988 Rall, W.: Organisation für den Weltmarkt, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 59(1989)10 Ram, S./Sheth, J.N.: Consumer resistance to innovations: the marketing problem and its solutions, in: The Journal of Consumer Marketing 6(1989)2 Rao, V.R./Steckel, J.H.: Analysis for strategic marketing, Reading, Mass. 1998 Rapp, R.: Customer Relationship Management, Frankfurt 2000 Rappaport, A.: Creating shareholder value, New York 1986 Rayport, J.F./Sviokla, J.J.: Exploiting the virtual value chain, in: Harvard Business Review 73(1995)6 Reichheld, F.F.: Learning from customer defections, in: Harvard Business Review 74(1996)2 Reichheld, F.F.: The loyalty effect, Boston 1996 Reinartz, W.J./Kumar, V.: On the profitability of long-life customers in noncontracual setting: An empirical investigation and implications for marketing, in: Journal of Marketing 64(2000)4 Remmerbach, K.U.: Markteintrittsentscheidungen, Wiesbaden 1988 Riddersta°le, J./Nordström, K.A.: Funky Business, M ünchen 2000 Riekhof, H.C. (Hrsg.): Strategieentwicklung, Stuttgart 1989 Ries, A./Trout, J.: Die 22 umstösslichen Gebote im Marketing, Düsseldorf 1993 Ritter, L.: Trends im Einzelhandel, in: Werbung Publicité (1989)12 Robert, M.: Strategy pure & simple, New York 1993 Roberts, H.W./Sergesketter, B.F.: Quality is personal, New York 1993 Robinson, W.T./Fornell, C.: Sources of market pioneer advantages in consumer goods industries, in: Journal of Marketing Research 22(1985)3 Rogers, E.M.: Diffusion of innovations, 3rd edition, New York 1983 Ross, J./Krogh v., G.: Managing strategy processes in emergent industries, London 1996 Rössl, D.: Der relevante Markt - Ein heuristischer Lösungsansatz, in: Der Markt 28(1989)4 Roth, P.: Kultur-Sponsoring, Landsberg/Lech 1989 Rühli, E.: Ein Ansatz zu einem integrierten, kooperativen Führungskonzept, in: Kirsch, W. (Hrsg.): Unternehmungsführung und Organisation, Wiesbaden 1973 Rühli, E.: Konzeptionelle Ueberlegungen zur marktorientierten Unternehmungsführung, in: Rühli, E./Wehrli, H.P. (Hrsg.): Strategisches Marketing und Management, Bern 1986 Rühli, E.: Strategische Unternehmungsführung heute, in: Rühli, E. (Hrsg.): Strategisches Management in schweizerischen Industrie-Unternehmungen, Bern 1989 Rühli, E.: Visionen, in: Die Unternehmung 44(1990)2 Rühli, E./Wehrli, H.P.: Marktorientierte strategische Führung, in: das wirtschaftsstudium wisu 16(1987)10 Schedler, K./Proeller, I.: New Public Management, Bern 2000 Schein, E.H.: Does japanese management style have a message for american managers? in: Schein, E.H. (ed.): The art of managing human resources, New York 1987 Schein, E.H.: How can organizations learn faster? The challenge of entering the green room, in: Sloan Management Review 34(1993)2 210 Schein, E.H.(ed.): The art of managing human resources, New York 1987 Scheuch, F.: Marketing, München 1986 Schläpfer, K.: Oekologie in der Haushaltapparatebranche, in: Ideales Heim (1989)5 Schliessmann, Ch. Ph.: Strategisches Marketing, Wiesbaden 1995 Schmalen, H.: Die Entwicklung der Warenhäuser, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 17(1988)11 Schmalen, H.: Fragebogenrücklauf und Gewinnanreiz, in: Marketing ZFP 11(1989)3 Schmeh, K. David gegen Goliath, Frankfurt 2004 Schmitt, B.H. Experiential marketing, New York 1999 Schnaars, S.P.: When entering growth markets, are pioneers better than poachers? in: Business Horizons 29(1986)2 Schnaars, S.P.: Musterbeispiele für Markt-Fehlprognosen und wie man sie vermeiden kann, Landsberg/Lech 1989 Schnaars, S.P.: Managing imitation strategies, New York 1994 Schnaars, S.P.: Marketing strategy, 2nd ed., New York 1998 Schneider, B./Bowen, D.E.: Winning the service game, Boston 1995 Schneider, D.J.G./Müller, R.U.: Datenbankgestützte Marktselektion, Stuttgart 1989 Scholz, C.: Strategische Organisation, Landsberg/Lech 1997 Schonberger, R.J.: Building a chain of customer, New York 1990 Schor, J.B.: The overspent american: upscaling, downshifting and the new consumer, New York 1998 Schraner, M.: Konzeptionelles Kursbuch, Glattbrugg 1988 Schraner, M.: Wer ist für Sie ein guter Werber, Herr Schraner? in: Werbung Publicité (1990)3 Schreyögg, G.: Unternehmungsstrategie, Berlin 1984 Schub von Bossiazky, G.: Psychologische Marktforschung, München 1992 Schuh, S. Organisationskultur, Wiesbaden 1989 Schuh, S.: Organisationskultur, Integration eines Konzepts in die empirische Forschung, Wiesbaden 1989 Schultz, D.E./Tannenbaum, S.I./Lauterborn, R.F.: Integrated marketing communications, Lincolnwood, Ill. 1993 Schulze, G.: Die Erlebnisgesellschaft, Frankfurt 1992 Schulze, G.: Kulissen des Glücks, 2, Auflage, Frankfurt 2000 Schumpeter, J.: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 9. Auflage, Berlin 1997 Schwartz, E.I.: Webonomie, Hamburg 1997 Schweiger, G./Schrattenecker, G.: Werbung, Stuttgart 1986 Schweiger, G./Schrattenecker, G.: Werbung, 2. Auflage, Stuttgart 1989 Schwenker, B.: Dienstleistungsunternehmen im Wettbewerb, Wiesbaden 1989 Seghezzi, H.D.: Integriertes Qualitätsmanagement, München 1996 Segler, K.: Basisstrategien im internationalen Marketing, Frankfurt 1986 Seidel, E./Menn, H.: Oekologisch orientierte Betriebswirtschaft, Stuttgart 1988 Senge, P.M.: The leader's new work: Building learning organizations, in: Sloan Management Review 32(1990)1 211 Seth, J.N./Gardner, D.M./Garrett, D.E.: Marketing theory: evolution and evaluation, New York 1988 Seyffert, R.: Werbelehre, Stuttgart 1966 Shanklin, W.L./Ryans, J.K. Jr.: Marketing high technology, Lexington, Mass. 1984 Shapiro, B.P./Bonoma, T.V.: How to segment industrial markets, in: Harvard Business Review 62(1984)3 Shapiro, C./Varian, H.R.: Information rules, Boston 1999 Shapiro, E.C.: Die Strategiefalle, Frankfurt 1999 Shaw, R.: Improving marketing effectiveness, London 1998 Sheth, J.: Global markets or global competition? in: The Journal of Consumer Marketing 3(1986)2 Siegwart, H.: Produktentwicklung in der industriellen Unternehmung, Bern 1974 Silberer, G.: Wertorientiertes Management im Handel, in : Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 33(1987)4 Silberer, G. (Hrsg.): Marketing mit Multimedia, Stuttgart 1995 Simon, H.: Die Zeit als strategischer Erfolgsfaktor, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 59(1989)1 Simon, H.: Preismanagement, 2. Auflage, Wiesbaden 1992 Simon, H. (Hrsg.): Das grosse Hanbuch der Strategiekonzepte, Frankfurt 2000 Simon, H./Homburg, C. (Hrsg.): Kundenzufriedenheit, Wiesbaden 1995 Simon, H./Tacke, G./Woscidlo, B.: Mit einfallsreicher Preispolitik die Kunden binden, in: Harvard Business Manager 20(1998)2 Skaupy, W.: Franchising, München 1987 Slack, N./Chambers, S./Harland, C./Harrison, A./Johnston, R.: Operations management, London 1998 Slywotzky, A.J.: Strategisches Business Design, Frankfurt 1997 Slywotzky, A.J./Morrison, D.J.: The profit zone, New York 1997 Snow, C.C./Miles, R.E./Coleman Jr., H.J.: Managing 21st century network organizations, in: Organizational Dynamics 20(1992)3 Specht, G.: Beschaffungsverhalten in der Bundesrepublik Deutschland und in Ungarn, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 38(1986)4 Spulber, D.F.: The market makers, New York 1998 Staerkle, R.: Wechselwirkungen zwischen Organisationskultur und Organisationsstruktur, in: Probst, G.J./Siegwart, H. (Hrsg.): Integriertes Management, Bern 1985 Staffelbach, B./Wehrli, H.P. (Hrsg.): Markt- und menschenorientierte Führung, Bern 1996 Stahlmann, V.: Umweltorientierte Materialwirtschaft, Wiesbaden 1988 Stahr, G.: Internationale strategische Unternehmungsführung, Stuttgart 1989 Stalk Jr., G.: Time - The next source of competitive advantage, in: Harvard Business Review 66(1988)4 Stalk Jr., G./Hout, T.M.: Competing against time, New York 1990 Star, S.H.: Marketing and its discontents, in: Harvard Business Review 67(1989)6 Staudt, E.: Innovation, in: Die Betriebswirtschaft 45(1985)4 Stauss, B.: Beschwerdepolitik als Instrument des Dienstleistungsmarketing, in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 35(1989)1 Stauss, B./Schulze, H.: Internes Marketing, in: Marketing ZFP 12(1990)3 Steffenhagen, H.: Marketing, Stuttgart 1988 212 Steger, U.: Umweltmanagement, Wiesbaden 1988 Stern, C.W./Stalk Jr., G. (eds.): Perspectives on strategy, New York 1998 Sterne, J.: Customer service on the internet, 2nd. edition, New York 2000 Stevenson, H.H.: Do lunch or be lunch, Boston 1998 Stiftung Werbestatistik Schweiz: Werbeaufwand Schweiz, Zürich 2000 Stoffels, J.: Der elektronische Minimarkttest, Wiesbaden 1989 Sudharshan, D.: Marketing strategy, Englewood Cliffs, N.J. 1995 Sydow, J.: Strategische Netzwerke, Wiesbaden 1992 Tafertshofer, A.: Corporate Identity, in: Die Unternehmung 36(1982)1 Takeuchi, H.: Gaining competitive advantage through global product development, in: Hitotsubashi Journal of Commerce and Management 23(1988)1 Takeuchi, H./Nonaka, I.: The new product development game, in: Harvard Business Review 64(1986)1 Taguchi, G./Clausing, D.: Robust quality, in: Harvard Business Review 68(1990)1 Tebbe, K.: Die Organisation von Produktinnovationsprozessen, Stuttgart 1990 Thietart, R.A./Vivas, R.: Success strategies for declining activities, Working Paper, Brussels 1982 Thom, N.: Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagement, 2. Auflage, Königstein 1980 Thomas, H./Gardner, D.: Strategic Marketing and Management, Chichester 1985 Thomas, P.R.: Competitiveness through total cycle time, New York 1990 Thomas, U.: Die Substitutionskonkurrenz als Herausforderung für das Marketing, Berlin 1989 Tietz, B.: Marketing, Tübingen 1978 Tietz, B.: Die elektronischen Technologien und Medien in Marketing und Vertrieb, Rüschlikon 1984 Tietz, B.: Der Handelsbetrieb, München 1985 Tietz, B.: Euro-Marketing, Stuttgart 1989 Tietz, B.: Der Handelsbetrieb, 2. Auflage, München 1993 Töpfer, A.: Innovationsmanagement, in: Wieselhuber, N./Töpfer, A. (Hrsg.): Strategisches Marketing, München 1984 Töpfer, A.: Die Restrukturierung des Daimler-Konzerns 1995-1997, Neuwied 1998 Töpfer, A. (Hrsg.): Kundenzufriedenheit messen und steigern, Frankfurt 1998 Treacy, M./Wiersema, F.: The discipline of market leaders, Reading, Mass. 1995 Trommsdorff, V.: Konsumentenverhalten, Stuttgart 1989 Trout, J.: The power of simplicity, New York 1999 Tscheulin, D.K./Helmig, B. (Hrsg.): Branchenspezifisches Marketing, Wiesbaden 2001 Tung, R.L.: Strategic Management in the United States and Japan, Cambridge, Mass. 1986 Ulrich, D./Zenger, J./Smallwood, N.: Results-based leadership, Boston 1999 Unger, F.: Werbemanagement, Heidelberg 1989 Vandermerwe, S.: How increasing value to customers improves business results, in: Sloan Management Review 42(2000)1 Vasata, V.: Radical Brand, München 2000 Vavra, T.G.: Aftermarketing, Chicago 1995 213 Vesey, T.: Time-to-market: Put speed in product development, in: Industrial Marketing Management 21(1992)2 Vögele, S.: Dialog-Verkauf im Direkt-Marketing, in: Werbeforschung und Praxis 32(1987)4 Wall, S.J./Wall, S.R.: The new strategists, New York 1995 Walter, A.: Der Beziehungspromotor, Wiesbaden 1998 Wamser, C./Fink, D.H. (Hrsg.): Marketing-Management mit Multimedia, Wiesbaden 1997 Wangen, E.: Polit-Marketing, Opladen 1983 Wasserstein, B.: Big deal, New York 1998 Watzlawick, P./Beavin, J.H./Jackson, D.D.: Menschliche Kommunikation, 10. Auflage, Bern 2000 Wayland, R.E./Cole, P.M.: Customer connections, Boston 1997 Weber, J./Schäffer, U.: Balanced Scorecard & Controlling, 2. Auflage, Wiesbaden 2000 Webster, F. E. Jr.: The rediscovery of the marketing concept, in: Business Horizons 31(1988)3 Webster, F. E. Jr.: The changing role of marketing in the corporation, in: Journal of Marketing 56(1992)2 Webster Jr., F.E.: Defining the new marketing concept, in: Marketing Management 2(1994)4 Webster Jr., F. E. /Wind, Y.: Organizational behavior, Englewood Cliffs, N.J. 1972 Weeser-Krell, L.: Marketing, 2. Auflage, München 1988 Wehrli, H.P.: Marketing - Zürcher Ansatz, Bern 1981 Wehrli, H.P.: Strategisches Marketing, in: Rühli, E./Wehrli, H.P. (Hrsg.): Strategisches Marketing und Management, 2. Auflage, Bern 1987 Wehrli, H.P.: Marketing - Zürcher Ansatz, 2. Auflage, Bern 1989 Wehrli, H.P.: Die «Time to Market» - Philosophie, in: Fickert, R./Hässig, K. (Hrsg.): Megatrends für die Materialwirtschaft, Aarau 1992 Wehrli, H.P.: Relationship Marketing, in: Verkauf & Marketing 21(1993)12 Wehrli, H.P.: Beziehungsmarketing - Ein Konzept, in: Der Markt 33(1994)4 Wehrli, H.P.: Marketing - oder die Gestaltung von Netzwerken, in: Schwander, P. (Hrsg.): Prozessmanagement, Zürich 1995 Wehrli, H.P.: Entwicklungen im Marketing, in: Spoun, S./Müller-Möhl, E./Jann, R. (Hrsg.): Universität und Praxis - Tendenzen und Perspektiven wissenschaftlicher Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft - Der Universität St. Gallen zum 100-Jahr-Jubiläum, Zürich 1998 Wehrli, H.P.: Marketing, 4. Auflage, Wetzikon 1998 Wehrli, H.P.: Beziehungsmarketing in unterschiedlichen Kontexten, in: Schmengler, H.J./Fleischer, F.: Marketing Praxis Jahrbuch 1999, Düsseldorf 1999 Wehrli, H.P.: Marketing im Zeitalter des Electronic Commerce, in: Manager Bilanz (1999)I Wehrli, H.P.: Marketing.com, in: Weber, R.H./Hilty, R.M./Auf der Maur, R. (Hrsg.): Geschäftsplattform Internet, Zürich 2000 Wehrli, H.P./Jüttner, U.: Competitive advantage by competence-based marketing management, in: Park, C.W./Smith, D. (eds.): Marketing theory and applications, Volume 5, 1994 AMA Winter Educators' Conference Proceedings, Chicago 1994 Wehrli, H.P./Jüttner, U.: Relationship marketing in value generating system, in: Sheth, J.N./Paravatiyar, A. (eds.): Relationship marketing: Theory, methods and applications, Atlanta 1994 Wehrli, H.P./Jüttner, U.: Relationship marketing from a value system perspective, in: Payne, A. (ed.): Advances in Relationship Marketing, London 1995 214 Wehrli, H.P./Krick, M.: Strategische Netzwerke: Grundzüge und Vorteile, in: Manager Bilanz (1997)III Wehrli, H.P./Müller, H.: Kundenorientierung trägt erste Früchte, in: Schweizer Bank (1997)7 Wehrli, H.P./Wirtz, B.: Relationship Marketing: Auf welchem Niveau bewegt sich Europa? in: Absatzwirtschaft Sondernummer Oktober 1996 Wehrli, H.P./Wirtz, B.: Virtualisierungspotentiale im Handel, in: Markenartikel 58(1996)6 Weilbacher, W.M.: Advertising, New York 1979 Weilbacher, W.M.: Brand marketing, Lincolnwood, Ill. 1993 Weinberg, P.: Das Entscheidungsverhalten der Konsumenten, Paderborn 1981 Weinberg, P.: Vom Preis- zum Erlebniswettbewerb, in: Absatzwirtschaft 29(1986)3 Weinberg, P.: Erlebnismarketing, München 1992 Weinberg, P./Gröppel, A.: Formen und Wirkungen erlebnisorientierter Kommunikation, in: Marketing ZFP 10(1988)3 Weinhold-Stünzi, H.: Marketing, Zürich 1970 Weinhold-Stünzi, H.: Marketing, 12. Auflage, St. Gallen 1988 Welge, M.K.: Globales Management, in: Welge, M.K. (Hrsg.): Globales Management, Stuttgart 1990 Werkmann, G.: Strategie und Organisationsgestaltung, Frankfurt 1989 Wessner, K.: Strategische Marktforschung mittels kohortenanalytischen Designs, Wiesbaden 1989 Westley, F./Mintzberg, H.: Visionary leadership and strategic management, in: Strategic Management Journal 19(1989)Special Issue Westwick, C.A.: How to use management ratios, 2nd edition, Hants 1987 Wheelen, T.L./Hunger, J.D.: Strategic management, 2nd. edition, Reading, Mass. 1987 Wheelwright, S.C./Clark, K.B.: Revolutionizing product development, New York 1992 Wheelwright, S.C./Sasser, E.: The new product development map, in: Harvard Business Review 67(1989)3 Whiteley, R.C.: The customer-driven company, Reading, Mass. 1991 Wiedmann, K.P./Jugel, S.: Corporate-Identity-Strategie, in: Die Unternehmung 41(1987)3 Wiegran, G./Koth, H.: Firma.nach.Mass, München 2000 Wildemann, H.: Qualitätsentwicklung in F&E, Produktion und Logistik, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 62(1992)1 Wildemann, H.: Zulieferer: Im Netzwerk erfolgreich, in: Harvard Business Manager 20(1998)4 Williamson, O.E.: Markets and hierarchies, New York 1975 Winkelmann, P.: Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung, 2. Auflage, München 2003 Wirtz, B.W.: Medien- und Internetmanagement, Wiesbaden 2000 Wirz, A.: Marginalien zur Werbung, Zürich 1989 Witprächtiger, U.: Testmarkt Langenthal, in: IHA news (1989)3 Wohinz, J.: Wertanalyse - Innovationsmanagement, Würzburg 1983 Wolf, M.: Zeitschriften in Europa, Zürich 1988 Wolf, M./Wehrli, H.P.: Verlagsmarketing, Wetzikon 1990 Womack, J.P./Jones, D.T.: Lean thinking, New York 1996 Womack, J.P./Jones, D.T./Ross, D.: Die zweite Revolution in der Autoindustrie, Frankfurt 1992 215 World Commission on Environment and Development: Our common future, Oxford 1987 Wyss, W.: Ueberlegungen zur Methodenwahl in der Marktforschung, Adligenswil 1989 Yamamoto, S.: Japan's new industrial era - II. Information and service industries, in: Long Range Planning 19(1986)2 Yamanouchi, T.: Breakthrough: The development of the Canon personal copier, in: Long Range Planning 22(1989)5 Young, J.R./Mondy, W.R.: Personal selling, Chicago 1982 Zeithaml, C.P./Zeithamel, V.A.: Environmental management: revising the marketing perspective, in: Journal of Marketing 48(1984)2 Zeithaml, V.A./Parasuraman, A./Berry, L.L.: Delivering service quality, New York 1990 Zentes, J.: Warenwirtschaftssysteme, in: Marketing ZFP 10(1988)3 Zentes, J.: Trade-Marketing, in: Marketing ZFP 11(1989)4 Zerdick, A./Picot, A./Schrape, K./Artopé, A./Goldhammer, K./Lange, U.T./Vierkant, E./López-Escobar, E./Silverstone, R.: Die Internet-Ökonomie (European Communication Council Report), Berlin 1999 216