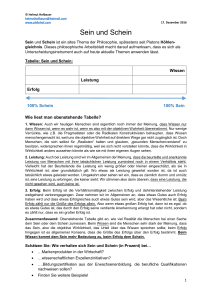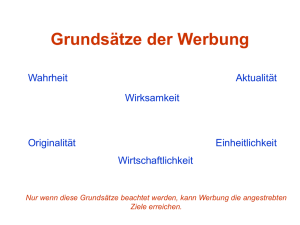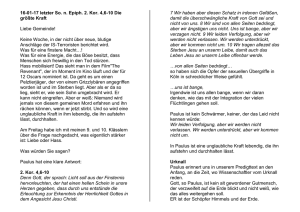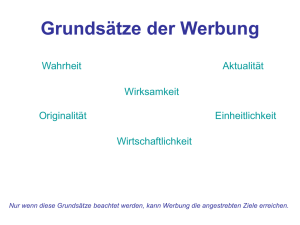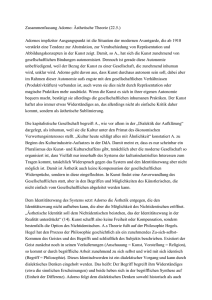Vom Schein. Ein Plädoyer Unlängst konnte man auf der Titelseite
Werbung

Vom Schein. Ein Plädoyer Unlängst konnte man auf der Titelseite einer renommierten Wochenzeitung die Analyse unserer ganz auf Schein ausgerichteten Gesellschaft lesen; die Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit Dissertationen werden hier der Selbstdarstellung von Politikern zugeordnet, die nur auf einen Markt reagieren: sie sollen sich photogen in Szene setzen können, Familiensinn zeigen und zugleich von hohen akademischen Graden sein. Der Politiker als Poser, Politik als Event. Wir suchen offenbar den schönen Schein, so der Tenor des Artikels. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen … Friedrich Hölderlin, Hyperion Entsprechend ist die politische Mitteilung der Ort des Bemäntelns von Wahrheit. Die Gefährlichkeit gewisser technischer Errungenschaften wird verharmlost, die Verflechtung von Politik und Wirtschaft heruntergespielt, durch Vorspiegelung leerer Hoffnungen wird das Gefühl der Sicherheit verbreitet. Das geht bis ins Begriffliche: Nichtigkeiten werden durch wolkige Worte bedeutend. Als Beispiel hierfür sei der Missbrauch des Wortes „Kultur“ herausgegriffen. Wer etwa im Bereich der Schule von einer „Neuen Aufgabenkultur“ spricht (ja manche versteigen sich zum Begriff einer „Aufgabenphilosophie“), verkennt, dass Kultur etwas mit Niveau und Bildung zu tun hat: wie könnte man sonst der anspruchsvollen Komplexität der Erscheinungsformen von Kultur gerecht werden? Hier aber soll die „Neuerung“ durch die Verwendung eines hochtrabenden Begriffes in einem besseren Licht erscheinen. Dasselbe gilt, wenn „Informationsaustausch“ mit „Gesprächskultur“ verwechselt wird: Banales wird aufgebauscht; wenn aber eine Regierung von einer „Kultur militärischer Zurückhaltung“ spricht, gleichzeitig aber Panzer in eine Krisenregion verkauft, dann erweist sich diese Wortwahl als eine Kultur der Lüge. Ist dieser Befund so neu? Hat man nicht zu allen Zeiten den schönen Schein gesucht – und bekommen? Ein Blick auf die griechische Kultur würde den Befund bestätigen. Was aber die Griechen auszeichnet, ist ihre Auseinandersetzung mit dem Scheinhaften, und dem nachzugehen mag auch für uns „Schein-Geplagte“ wichtig sein. Schein setzt etwas voraus, das scheint, eine Lichtquelle, die einen Gegenstand bescheint, beleuchtet, so dass dieser in Erscheinung treten, gesehen werden kann. Dann liegt Glanz auf diesem Gegenstand. Tagwesen! Was ist Sein? Was Nichtsein? Eines Schattens Traum ist der Mensch. Aber wenn gottgeschenkter Glanz kommt, Liegt helles Licht auf den Männern und freundliche Lebenszeit. Pindar, 8. Pythie (Ü. Uvo Hölscher) Bei den Griechen war es die Gottheit, die den Glanz verleiht, d.h. Erfolg in allen Lebensbereichen, auch im Sport, wie hier im Pindar-Zitat. Es ist aber auch das Entstehen von Dichtung der Gottheit zu verdanken. Aufgrund der Inspiration spricht der „erleuchtete“ Dichter im eönjousiasmoßw, aus der Begeisterung, heraus, und sagt dadurch natürlich die Wahrheit. Gegen die religiöse Auffassung vom Dichter als Priesterseher und damit Künder der Wahrheit hat sich sehr früh die Philosophie gewendet: Polla? yeußdont’ oiÖ aöoidoiß — „Vieles erfinden die Dichter“ heißt es schon bei dem durchaus pragmatisch denkenden Politiker-Dichter Solon über 100 Jahre nach der Entstehung der Odyssee. Diese Einschätzung liegt aber in dem eigentümlichen Wahrheitsbegriff des epischen Erzählstils begründet. Als der schiffbrüchige Odysseus, noch unerkannt, am Hof der Phaiaken gastlich aufgenommen wird, gibt es auch Unterhaltung: es wird Demodokos in den Königssaal geführt, ein blinder Sänger, der die Ruhmestaten der Helden vorzutragen versteht. Und der erzählt nun Begebenheiten der jüngsten Vergangenheit, nämlich aus der Zeit des vor zehn Jahren beendeten trojanischen Krieges. Am Schluss wird er von Odysseus ausdrücklich für seine Sangeskunst gerühmt: er habe so detailliert zu erzählen verstanden, als ob er selbst dabei gewesen wäre: also müsse er von der Muse oder von Apollon unterwiesen worden sein. Die Pointe ist: weil es so „gut“ erzählt wurde, ist es wahr. Nachdem die Anonymität des unbekannten Gastes aufgehoben ist und er nun seinerseits die königliche Gesellschaft mit der Erzählung seiner Irrfahrten unterhält, da wird er von König Alkinoos gerühmt: er habe so genau und detailliert erzählt, dass man unbedingt davon ausgehen müsse, dass alles der Wahrheit entspreche. Beide: Demodokos und Odysseus werden also wegen derselben Fähigkeit gerühmt: detailliert und exakt erzählen zu können. Auch hier gilt also: weil Odysseus so gut erzählt hat, ist es wahr. Nun gibt es aber Geschichten, die derselbe Odysseus andernorts erfindet. Es sind Geschichten, durch die der Held seine Anonymität wahren oder sich sonst irgendwie Vorteile verschaffen will. Ihre Unwahrheit ist für uns Rezipienten eindeutig, mögen auch „richtige“ Details vorkommen, wie etwa die Beschreibung des Mantels, den Odysseus trug, als er auf Kreta weilte. Wer wüsste über diesen Mantel besser Bescheid als der Erzähler selber - der aber behauptet, er habe Odysseus bewirtet! Diese Geschichten unterscheiden sich allerdings hinsichtlich ihrer Detailliertheit in nichts von den tatsächlich erlebten. Das rühmt auch Eumaios an den Erzählungen seines Gastes. Wenn nun erfundene und wahre Geschichten für den Hörer ununterscheidbar gleich wahr sind, weil sie gleich „gut“ erzählt worden sind, dann gibt dieses Kriterium höchstens einen Anschein an Wahrheit ab; die Genauigkeit des Erzählens soll im Hörer suggerieren, es sei alles so gewesen, wie es erzählt wird. Es scheint aber nur so. Und mit dem epischen Erzählstil verhält es sich ebenso. Wenn also der epische Dichter dieses ausführliche Erzählen zu seinem Darstellungsprinzip erhebt, dann will er bei seinem Publikum den Schein von Wahrheit produzieren. Wir können davon ausgehen, dass dieses Erzählprinzip in den Sängerschulen gelehrt wurde - wie ja auch das Prinzip, dass dieses „gute“ Erzählen Unterhaltung und Erkenntnis zugleich vermitteln soll, so ausdrücklich bereits in der Odyssee formuliert. Hervorgebracht wird dieser Schein durch Sprache. Schein ist hier etwas absichtlich Vorgetäuschtes, u.U. sogar negativ besetzt, bis hin zur Lüge; dieser Schein wird durch Zeichen hervorgerufen, vornehmlich durch sprachliche; im Bereich der Rhetorik wird das bewusst zur Täuschung des Zuhörers eingesetzte Wort missbraucht, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Das bewusst Vorgetäuschte wird aber im Bereich der Dichtung alles Fiktionale; der Dichter beleuchtet seinen Gegenstand gemäß seinen Vorstellungen, und so entsteht seine Wahrheit. Der Gegensatz Schein – Sein, ja der Versuch, alles Scheinhafte zugunsten einer Wahrheit des Seins zu demaskieren, durchzieht die gesamte griechische Geistesgeschichte, vor allem natürlich die Philosophie, die in den Jahrhunderten nach den homerischen Epen zur Blüte kam. Mit dem Bestreben, ein in der Natur wirksames Prinzip (oder deren mehrere) zu entdecken, haben die frühgriechischen Philosophen diese Antithese weitergetrieben. Alle Realität ist demnach Erscheinungsform oder Umgestaltung des zugrunde liegenden Prinzips. Etwa 200 Jahre nach der Entstehung der Odyssee-Dichtung war es Heraklit von Ephesos, „der Vater der Dialektik“, der die Realität auf Gegensätze (z.B. Leben – Tod) zurückzuführen versuchte, die Erscheinung einer verborgenen inneren Einheit sind. Sie verstehen nicht, wie das Verschiedene mit sich selber zusammenstimmt: gegengespannte Fügung wie beim Bogen und der Leier. Heraklit fr. 51 (Ü. Uvo Hölscher) Diese Einheit ist sprachlich nicht mehr fassbar: Zwar können wir von „Einheit“ sprechen, wir können dieses Wort sagen, aber die Identität von Gegensätzen zu denken ist uns verwehrt, wir können sie höchstens intuitiv erfassen. Daher dürfen wir nicht beim äußeren Schein stehen bleiben, sondern in die Natur einzudringen versuchen. „Die Natur liebt es sich zu verstecken“. Sie versteckt sich hinter Rätseln, und diese finden wir z.T. auch in der Sprache wieder. Heraklit versucht, die Rätselhaftigkeit der Natur in seiner Sprache, d.h. in seinem eigenwilligen aphoristischen Stil abzubilden – auch hierin ein Vorbild Nietzsches. Der Schein der gegensätzlich strukturierten Vielheit bei Heraklit steht allerdings nicht in Opposition zur Einheit, sondern ist nur deren Erscheinungsform: Identität und Nichtidentität sind identisch. Wie Heraklit ein hohes Niveau an Sprachreflexion zeigt, so auch zwei Generationen später Parmenides, Anf. 5. Jh., „der Vater der abendländischen Logik und Metaphysik“, der in einem großartig angelegten Beweis darlegt, dass es nur Sein gibt, kein Nichtsein. Schein kommt demnach nur durch Verknüpfung von Sein mit Nichtsein zustande. Und Nichtsein (als Nichtsein kann es nicht sein) kommt nur durch die Verwendung von Sprache zustande, denn diese verwendet Gegensätze. Und Gegensätze beinhalten eben jenes „nicht das andere“, das ein Nichtsein mit sich bringt. Das 5. Jahrhundert ist auch das Jahrhundert der griechischen Tragödie. In sehr vielen Stücken lässt sich der tragische Konflikt auf den Gegensatz Sein/Wahrheit – Schein/Irrtum zurückführen, und erst die Auflösung des Konflikts bringt die Wahrheit und ihre Erkenntnis hervor. Ausgangssituation ist in der Regel ein Zustand der Verkehrtheit, des Irrtums oder Einseitigkeit, gewissermaßen die „Schieflage“, und durch den tragischen Ausgang wird das „Gerade“ wieder hergestellt. So kommt z.B. Oidipus im Verlauf des gleichnamigen Dramas zur Erkenntnis seiner Vergangenheit; Kreon, aber auch Antigone, vertreten ihre Position in so aggressiv übersteigerter Form, dass nur ihrer beider Untergang über den Weg der Erkenntnis aus der „Heillosigkeit“ herausführen kann. Die Antithese zeigt sich damit geradezu als Struktur bildendes Element im Aufbau einer Tragödie. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts tritt eine neue Strömung in Griechenland auf: die Sophistik. Sophisten sind eigentlich nur Rhetoriklehrer, und als solche haben sie es sich zum Thema gemacht, mit welchen Mitteln am besten ein Publikum überzeugt werden kann. Wahrheit spielt dabei überhaupt keine Rolle. Durch sprachliche Artistik, psychologische Tricks und geschickte Manipulation des Zuhörers soll in diesem das eigenständige Denken ausgeschaltet werden, so dass er den Worten des Redners zustimmt (einen Staubsauger kauft oder einem „totalen Krieg“ zujubelt). Wahrheitskriterium ist damit die erwünschte positive Reaktion des Publikums, das aber höchstens ein Schein-Wissen vermittelt bekommen hat, nicht aber ein Wissen der Sache selbst, also des Gegenstandes der Rede; diese Art von Täuschungs-Wissen muss abgegrenzt werden von „richtigem“, und das erst ist der Ort der Aufklärung über die Machenschaften von Rednern und ihren Täuschungsabsichten. Übrigens rückt diese „Bewegung“ in eigentümliche Nähe zum Epos. Hier wie dort wird mit Hilfe sprachlicher Kunstgriffe im Zuhörer Schein produziert, Kunstgriffe, die wie ein Handwerk gelehrt werden; in beiden Fällen soll etwas bezweckt werden; da scheiden sich aber die Wege: die Dichter wollen Einsichten vermitteln und unterhalten, die sophistisch ausgebildeten Redner aber suchen auf dem Feld der Politik und des Gerichtswesens materiellen Erfolg. Mit ihrer Vermittlung von Pseudo-Wissen haben die Sophisten, wohl ohne es zu ahnen, den Schein rehabilitiert; daher gehören sie nicht zu den Philosophen. Kein Wunder also, dass sich gegen eine solche „Wissenschaft vom Schein“ die Philosophie wenden musste. Da war es vor allem Sokrates, der in seinen Gesprächen immer wieder auf „die Sache selbst“ führte, indem er seine Gesprächspartner unnachgiebig fragte, was er denn mit diesem oder jenem Begriff meine, den er gerade verwende. „Was ist …?“: diese Frage sollte schließlich zu Definitionen führen, in denen das Wesen des Gegenstandes klar wird. Ein Abbild dieser Gespräche haben wir in den frühen Dialogen Platons. Von der Struktur her bilden sie die Form der griechischen Tragödie ab: sie führen von einem Irrtum, einem Schein-Wissen zur Einsicht in diesen Irrtum, allerdings ohne dabei eine Lösung anzubieten. Eine systematische Einordnung und – vorläufig – endgültige Abwertung des Scheins hat Platon in seinem großen Werk „Politeia“ unternommen, am deutlichsten im berühmten Höhlengleichnis. Darin wird die condition humaine folgendermaßen beschrieben: wir befinden uns alle in einer Höhle, gefesselt, mit dem Kopf auf die Höhlenrückwand gerichtet. An dieser Wand sehen wir Schatten, projiziert von Gegenständen, die vor einem Feuer hinter uns hin und her getragen werden. Diese Schatten halten wir für die Realität. Daher befinden wir uns im Zustand des Irrtums, da wir Schein und Wahrheit verwechseln. In Wahrheit und in Wirklichkeit gibt es nurmehr noch Schauspieler auf der Welt, die Arbeit spielen, keine Arbeiter. Thomas Bernhard, Auslöschung Aber die hin und her getragenen Gegenstände sind auch noch nicht die eigentliche Realität, denn sie sind Abbilder vom eigentlichen, wahren Sein, das sich außerhalb der Höhle befindet. Wenn es uns gelänge, diese wahre Welt zu erleben - es ist die Welt des Geistes -, dann verstehen wir, dass wir vorher im Irrtum gelebt haben, ja sogar im doppelten Irrtum, als wir noch an die Schatten, den Abbildern der Abbilder, geglaubt hatten. Bei diesen handelt es sich offenbar um alles Künstliche: alle Produkte der bildenden Kunst, der Literatur, darunter fallen übrigens auch Film und Fernsehen, und Platons Darstellung der Situation in der Höhle, die geistige Dumpfheit und Verblödung der „Insassen“, ist eigentlich demaskierend, wenn man sich so manches Angebot auf unseren Bildschirmen ansieht. Aber müssen dann unter Platons Abwertung aller Kunstprodukte nicht auch seine eigenen Werke fallen? Das ist in der Tat so: Platon hat auch immer wieder betont, dass er seine eigentliche Philosophie niemals der Schrift anvertrauen würde, dass seine philosophischen Werke nur Spiel seien, wir dürfen hinzufügen: Schein, aber mit dem Ziel, den Leser für die Philosophie zu gewinnen. Damit steht Platon in der Tradition der Sophisten und Dichter: er benutzt den Schein, indem er alle möglichen literarischen Formen der damaligen Zeit philosophisch macht, mit der Absicht, die Leser zu seiner Philosophie zu bewegen. Was aber, wenn Platons Auffassung von der condition humaine als grundsätzlich dem Schein unterworfen einem grandiosen Irrtum aufsitzt, dass es nämlich hinter den von ihm so genannten Abbildern gar keine Urbilder gibt? Die Wahrheit, die wir kennen, ist logisch die Lüge, die, indem wir nicht um sie herumkommen, die Wahrheit ist. Thomas Bernhard, Der Keller Wenn demnach tatsächlich alles für wahr Gehaltene eine nur jeweilige Wahrheit ist, immer nur Produkt einer individuellen Perspektive, wenn alles gemeinsame Fürwahr-halten nichts anderes als gemeinsamer Irrtum? Wenn es also nur Welt, aber keine Hinterwelt gibt, wie es Nietzsche nannte? Das wäre in der Tat eine Rehabilitation des Scheins, ganz im Sinne der Sophistik. Schein ist für mich das Wirkende und Lebende selber, das soweit in seiner Selbstverspottung geht, mich fühlen zu lassen, dass hier Schein und Irrlicht und Geistertanz und nichts Mehr ist – dass unter allen diesen Träumenden auch ich, der „Erkennende“, meinen Tanz tanze … Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft 54 In dieser Situation im „schönen Schein“ Trost zu suchen, sei es in der Kunst, in der Literatur oder Philosophie, auch bei „den Griechen“, ist konsequent und legitim. Ja, selbst der Entwurf einer Hinterwelt wäre doch auch wieder „schöner Schein“, und die Beschäftigung damit kann größtes ästhetisches Vergnügen bereiten. Aber es ist eben nicht alles Ästhetik: Gerade durch die Beschäftigung mit „den Griechen“ mag es gelingen, Oberflächliches von Substantiellem zu trennen, z.B. zu erkennen, dass die Präsentation einer Schule nach außen durch oberflächliche Events nur Effekthascherei, nur äußerliche, künstliche Beleuchtung ist, dass sie aber durch ihre Substanz, die Erziehung junger Menschen, die sich in der unspektakulären Verborgenheit des Klassenzimmers ereignet, von innen her glänzt. Das wäre eine Rehabilitation des Scheins in seinen uranfänglichen Sinn. Das wäre „gottgeschenkter Glanz“: und „helles Licht liegt“ dann auf einer solchen Schule. Klaus Furthmüller