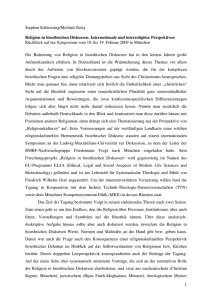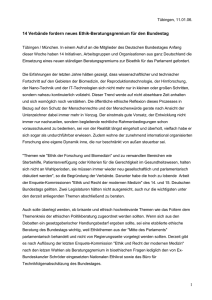Religion in bioethischen Diskursen: Internationale und interreligiöse
Werbung

Religion in bioethischen Diskursen: Internationale und interreligiöse Perspektiven Rückblick auf ein Symposium vom 18. bis 19. Februar 2009 in München Von Stephan Schleissing und Michael Zichy Die Bedeutung von Religion in bioethischen Diskursen hat in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erfahren. In Deutschland ist die Wahrnehmung dieses Themas vor allem durch das Auftreten von Kirchenvertretern geprägt worden, die für die komplexen bioethischen Fragen eine religiöse Deutungshoheit aus Sicht des Christentums beanspruchen. Blickt man genauer hin, dann relativiert sich freilich die Einheitlichkeit einer »christlichen« Sicht auf die Bioethik zugunsten einer innerchristlichen Pluralität ganz unterschiedlicher Argumentationen und Bewertungen, die zwar konfessionsspezifischen Differenzierungen folgen, sich aber längst nicht mehr darauf reduzieren lassen. Nimmt man zusätzlich die Debatten außerhalb Deutschlands in den Blick und kontrastiert man diese darüber hinaus mit Positionen anderer Religionen, dann drängt sich eine Thematisierung aus der Perspektive von »Religionskulturen« auf. Erste Vermessungen auf der weitläufigen Landkarte einer solchen religionskulturellen Hermeneutik bioethischer Diskurse standen auf einem internationalen Symposium an der Ludwig-Maximilians-Universität zur Diskussion, zu dem der Leiter der BMBFNachwuchsgruppe Friedemann Voigt nach München eingeladen hatte. Sein Forschungsprojekt »Religion in bioethischen Diskursen« wird gegenwärtig im Namen des EU-Programms ELSA (Ethical, Legal and Social Ascpects of Modern Life Sciences and Biotechnology) gefördert und ist am Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik von Friedrich Wilhelm Graf angesiedelt. Um der inneruniversitären Vernetzung willen fand die Tagung in Kooperation mit dem Institut TechnikTheologie-Naturwissenschaften (TTN) sowie dem Münchner Kompetenzzentrum Ethik (MKE) in dessen Räumen statt. Das Ziel der Tagung bestimmte Voigt in seinen einleitenden Thesen nach zwei Seiten: Zum einen geht es um den Einfluss, den die Religion über Personen, Institutionen, aber auch Ideen, Vorstellungen und Symbolen auf die Bioethik nimmt. Über diese analytisch-deskriptive Aufgabe hinaus sollte aber auch diskutiert werden, inwiefern die Religion in bioethischen Diskursen Werte, Normen und Maßstäbe an die Hand gibt bzw. geben kann. Damit war auch die Frage nach den Konsequenzen einer religionskulturellen Perspektivik bioethischer Debatten im Hinblick auf das Selbstverständnis von Religionen bzw. Kirchen berührt. Dieser doppelten Leitperspektivik korrespondierten auch die Beiträge der Tagung: Auf der einen Seite eher systematisch orientierte Vorträge, die sich an der normativen Rolle der Religion in bioethischen Diskursen abarbeiteten, und zwar aus medizinischem (Christian Kupatt, München), juristischem (Bijan Fateh-Moghadam, Münster), theologischem (Reiner Anselm, Göttingen) und christlichethischem (Svend Andersen, Aarhus) Blickwinkel. Auf der anderen Seite Beiträge, die die konkrete Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Religion und Bioethik in einzelnen Ländern (Shai Laiv – Israel, Teodora Karamelska – Bulgarien, Michael Zichy – Österreich, Ulla Schmidt – Norwegen, Stefanie Schardien – Deutschland) zum Thema hatten. Durch alle Vorträge und anschließenden Diskussionen zogen sich dabei drei wesentliche, miteinander zusammenhängende Problematiken: Das notorische Problem der Definition von Religion, das Problem der Sichtbarkeit und Fassbarkeit von Religion, und das Problem der religionsinternen Pluralität. An diesen Problematiken wurde zugleich deutlich, dass es wenig Sinn macht, den ethischen Status von Religion ohne seine kulturelle Verortung vorzunehmen. Insofern dient die Klärung des Verhältnisses zwischen Religion und Bioethik nicht nur der Selbstaufklärung der Bioethik, sondern zentral auch der Selbstverständigung der Religion in ihrem Verhältnis zu denjenigen kulturellen Deutungen, in denen sie praktisch wirksam ist. 1. Medizin, Recht und Religion in bioethischen Diskursen Den ersten Anlass zur Reflexion des religiösen Selbstverständnisses gab der Münchner Mediziner und Theo- 215 loge Christian Kupatt, der die Tagung mit einem Vortrag über die Rolle von Religion in bioethischen Diskursen aus der Sicht der Medizin und der medizinischen Ethik eröffnete. Er verortete die Thematisierung von Religion vor allem im Hinblick auf die Integration von Krankheit bzw. Heilung in das bestehende Sinnsystem einer Gesellschaft. Die auch heute noch enge Beziehung zwischen Religion und Medizin manifestiert sich dort, wo durch medizinische Innovation herkömmliche religiöse Sinnsysteme in Frage gestellt und neu geordnet werden (müssen), und dort, wo aus religiösen Sinnsystemen öffentlichkeitswirksame Forderungen an die Medizin abgeleitet werden. Bei den Kirchen konstatierte Kupatt allerdings eine partielle Blindheit für diejenigen Folgen des medizinischen Fortschritts, die nur als »diskrete Veränderungen« wahrgenommen werden, obwohl sie zahlreiche und zum Teil weitreichende Folgen für die Lebensführung des Einzelnen mit sich bringen. Exemplarisch hierfür stehen neuartige Behandlungen von Herzproblemen bei Kindern, die eine enorme Lebenszeitverlängerung mit sich bringen sowie die Fortschritte in der Kinderonkologie, die innerhalb der kirchlichen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Weil diese medizinischen Innovationen auf eine Normalisierung des Patienten zielen, und dies mit den kirchlich normativen Vorgaben, wie etwa Gerechtigkeitsvorstellungen (ausgleichende Gerechtigkeit) kompatibel ist, erscheinen sie nicht als eigenes Thema kirchlicher Medizinethik. Dort hingegen, wo die Kongruenz zwischen medizinischem Fortschritt und religiösen Normen nicht zustande kommt, wie dies z.B. bei der PID, bei humanen embryonalen Stammzellen oder am Lebensende der Fall ist, kommt es zum Konflikt. Hier prallen, so Kupatt, unterschiedliche Formen der Kontingenzbewältigung aufeinander: die medizinische, die auf Kontrolle und Überwindung, d.h. Veränderung der Kontingenz-Konstellation durch menschliche Kulturtätigkeit abzielt, und die religiöse, die auf Akzeptanz und Annahme der Kontingenz im Lichte eines höheren, guten Sinnzusammenhangs zustrebt. Religion bzw. Kirche tritt in diesen Fällen als Agentur der – aus der medizinischen Perspektive inakzeptablen – »Bestandswahrung« auf, und kann – wie im Fall von Aids – selbst zum Teil des Problems werden. In der sich anschließenden Diskussion stand vor allem Kupatts Verwendung des Kontingenzbegriffs anstelle von »Krankheit« im Mittelpunkt, die ihm eine funktionale Vergleichbarkeit von Religion und Medizin ermöglichte. Dabei blieb kontrovers, inwieweit Medizin und Religion auf unterschiedliche Quellen der Normativität rekurrieren, oder aber die in der Moderne zu beobachtende Konkurrenz zwischen medizinischem und religiösem Heilsversprechen als Folge einer im Christentum immer schon vorhandenen 216 Spannung zwischen Liebesideal und religiös gebotener Kontingenzhinnahme – Stichwort: Unverfügbarkeit des Lebens – zu verstehen ist. In dieser Perspektive müssten dann die auf Differenz fokussierten kirchlichen Wahrnehmungen des medizinischen Fortschritts als Folge einer institutionellen Ausdifferenzierung und Professionalisierung von Medizinbetrieb und »Heilsanstalt« interpretiert werden, deren Wurzeln gleichwohl nur auf dem Boden einer vom Christentum geprägten Welt verstanden werden können. Beanspruchen Kirchen und Religionen für sich allerdings einen exklusiven Normativitätsanspruch, dann stellt sich sofort die Frage, ob und wie diese Ansprüche in ein primär nicht religiös bzw. säkular verfasstes Feld eingebracht werden können. Diese Frage der Übersetzbarkeit religiöser Einsichten, wie sie in der Auseinandersetzung zwischen Jürgen Habermas und John Rawls exemplarisch geführt wird, war eine der dominanten Fragestellungen in den Diskussionen des Symposiums. Sie beschäftigte auch den Münsteraner Juristen Bijan Fateh-Moghadam, der in seinem Vortrag »Bioethische Diskurse zwischen Recht, Ethik und Religion. Juristische Perspektiven« die Rolle und den Einfluss von Religion in staatlichen Bioethikgremien thematisierte. Er konstatierte das Scheitern der Säkularisierungsthese, was sich nicht zuletzt daran ablesen lässt, dass Religion gerade auch in der Biopolitik eben nicht auf die Privatsphäre eingegrenzt ist, sondern im Gegenteil öffentlich auftritt. Aus der Sicht der weltanschaulichen Neutralität des Staates sei der Rekurs auf religiöse Normen allerdings in den Fällen problematisch, wo es um Aspekte der Rechtsanwendung sowie der politischen Willensbildung und institutionellen Politikberatung geht. Lediglich auf der Ebene der zivilgesellschaftlichen Selbstkontrolle z.B. in Klinischen Ethikkomitees, wo die Neutralitätspflicht des Staates per definitionem nicht mehr gelte, habe Religion nach Fateh-Moghadam ihre normative Berechtigung, wobei er ihre Übersetzbarkeit in einen öffentlichen Vernunftgebrauch lediglich als moralische Pflicht verstanden wissen wollte. Damit argumentierte er zugleich kritisch gegen die Besetzung z.B. der Zentralen Ethik-Kommission für Stammzellforschung oder des Deutschen Ethikrates mit Theologen, weil er hier das weltanschauliche Neutralitätsgebot des Staates nicht mehr gewährleistet sieht. Gleichwohl räumte FatehMoghadam für den ethischen Diskurs die Notwendigkeit ein, dass an diesem nicht nur Juristen, sondern auch »Laien« beteiligt sind. Doch was qualifiziert einen Bürger zum Laien? Kann von ihm mehr als eine bloß individuelle Betroffenheit erwartet werden? In der Diskussion wurde deutlich, dass die Ausbildung eines angestrebten common sense in normativen Fragen der Bioethik einen anspruchsvollen und reflektierten Begriff von »Laienkompetenz« voraussetzt. Aufgabe der Theologie und der Theologen könnte es dann gerade sein, mithilfe der christlich angeleiteten Unterscheidung von Religion und Recht die Geltung von common senseArgumenten in Bioethikdebatten zu unterstützen. Aus theologischer Sicht kritisch gegenüber der von den Kirchen betriebenen Ethisierung des biopolitischen Diskurses argumentierte der evangelische Theologe Reiner Anselm aus Göttingen, wenn er forderte, dass die Theologie verstärkt daran arbeiten müsse, ihre Anthropologie wieder aus einer dezidiert theologischsystematischen Perspektive zu entfalten. Auf dem Felde der Bioethik identifizierte er auch im protestantischen Raum die Anfälligkeit für eine Reduktion des Verständnisses von Menschsein auf die biologischen und körperlichen Aspekte, wie dies für die Naturwissenschaften per definitionem konstitutiv sei. Zwar kann damit dem Interesse an möglichst »klaren Grenzziehungen« in bioethischen Debatten Genüge getan werden, ohne dass man auf diesem Wege jedoch schon die Frage geklärt hat, ob der naturwissenschaftlichen Sicht des Menschen überhaupt die normative Beweislast aufgebürdet werden könne, die ihr in ethischen Konfliktlagen zugebilligt wird. Anselm votierte demgegenüber für eine Neubesinnung auf das Sinnerschließungspotenzial des christlichen Menschenbildes, wie es in der theologischen Formel von der leib-seelischen Einheit des Menschen vorgestellt ist. Er wies nach, dass dieser dezidiert christliche Topos nicht nur für die theologische Tradition, sondern zumindest ebenso für die Rechtskultur der Bundesrepublik als zentraler Bezugspunkt fungiert, in den letzten Jahren aber ausgerechnet in den Stellungnahmen der Kirchen zunehmend der Fixierung auf biologischen Kriterien von Anfang und Ende des Lebens gewichen ist. Demgegenüber plädierte Anselm für die Wiedereinführung des LeibSeele-Duals am Ort der individuellen Selbstauslegung des menschlichen Individuums. In dieser Perspektive kann aber weder in einem normativen noch in einem biologischen Sinne von einer ungebrochenen Ganzheit und Unverfügbarkeit des Menschen gesprochen werden. Vielmehr erlebe der Einzelne sein eigenes Leben als spannungsvolles und entwicklungsfähiges AufeinanderBezogensein sowohl von Seele und Bewusstsein auf der einen als auch von Körperlichkeit und Leib auf der anderen Seite: »Etwas pointiert gesagt: Wir kommen als Körper zur Welt, bilden im Prozess des Heranwachsens unser Bewusstsein, unsere Identität und unsere Personalität aus, die schließlich auch unsere physische Existenz überdauert.« Nach Anselm besteht der genuin theologische Beitrag in der Bioethik darin, deutlich zu machen, dass und wie diese zu Grunde liegenden Unterscheidungen für eine genaue Beschreibung menschlicher Lebenswirklichkeit – und auch menschlicher Selbsterfah- rung – mit Hilfe des christlichen Topos von der leiblichseelischen Einheit des Menschen dienlich gemacht werden können. 2. Internationale und interreligiöse Perspektiven in der Bioethik Argumentierten die bisher vorgestellten systematisch ausgerichteten Vorträge vor allem auf dem Hintergrund des deutschen Bioethikdiskurses, so machten die folgenden fünf Länderberichte deutlich, wie sehr das Verhältnis von Religion und Biopolitik in internationaler und interreligiöser Perspektive variiert. Geradezu ein Labor für die Untersuchung der Beziehung zwischen Religion und Bioethik sei Israel, so der in Tel Aviv lehrende Jurist Shai Lavi. Das Engagement von Personen, die sich im jüdischen Sinne als religiös bezeichnen, sei zwar vergleichsweise hoch, jedoch finde die Bioethikdebatte in der israelischen Gesellschaft selten in konflikthafter Zuspitzung statt. Der Grund für die gänzlich andere Debattenkultur liegt nach Lavi darin, dass die ethische Rolle des Judentums vom Primat des Verständnisses des jüdischen Gesetzes her ausgeht, dessen Eigenart Lavi in dreifacher Hinsicht als normatives System, als Funktion des Zusammenhalts des Volkes und als Kosmologie vorstellte. Da im jüdischen Verständnis jedoch ein vormodernes Menschenbild zum Tragen kommt, das im Unterschied zum christlichen keine Vermittlung am naturwissenschaftlichen state of the art intendiert, kann man zwar von einem dezidiert religiösen Technikverständnis in Israel sprechen, dessen methodisch-historische Reflexion innerhalb des jüdischen Gesetzesverständnisses aber kein Thema ist. So erklärt es sich, dass in Israel zwar eine ausgesprochen permissive Auffassung bei der Stammzellforschung herrscht, in der Frage der Todesdefinition allerdings nach wie vor das Herztodkriterium – und nicht der Hirntod – als vom jüdischen Gesetz her geboten angesehen wird. Die Rolle von Religion in der Bioethik stellt sich aber nicht nur zwischen den monotheistischen Weltreligionen gänzlich verschieden dar. Auch innerhalb des europäischen Christentums finden sich große Unterschiede in der Art und Weise, wie von kirchlicher Seite zum Thema Biopolitik Stellung genommen wird. Die Religionswissenschaftlerin Teodora Karamelska aus Sofia machte deutlich, dass man in Bulgarien zumindest öffentlich keinen Einfluss der orthodoxen Kirche in Fragen der Regulierung der Biomedizin erkennen könne. Dies hängt zum einen mit der traditionell staatstragenden, national 217 orientierten Rolle der Kirche zusammen; zum anderen hob sie als politisch entscheidende Ebene religiöser Einflussnahme das politisch relevante Engagement der Mönche hervor, deren weltabgewandte Askese allerdings jeden öffentlichen Diskurs verbietet. »Religion«, so Karamelskas Fazit, ist aufgrund der primär rituellen, staatsstabilisierenden Funktion der Kirche in ethischen Debatten kein öffentliches Streitthema, gleichwohl aber auf den Kanälen informeller politischer Kommunikation des Klerus Gegenstand zumeist pauschaler Ablehnung, die sich in der Öffentlichkeit aber weniger ethisch denn mithilfe religiöser Symbolik vernehmen lässt. Auf wenig öffentliche Resonanz stößt das Thema Bioethik auch in Österreich. Der im Münchner Institut TTN forschende Philosoph Michael Zichy erklärte dies vor allem mit den schlechten Erfahrungen, die man in Österreich mit der weltanschaulichen Aufladung öffentlicher Debatten zur Abtreibung und zur grünen Gentechnik gemacht habe. Zwar könne man grundsätzlich von einer ausgesprochen wissenschafts- und technologieskeptischen Grundhaltung der Bevölkerung sprechen, doch verunmögliche sowohl das Fehlen geeigneter publizistischer Medien als auch eine konservative Mentalität in Bezug auf rechtliche Veränderungen eine Debattenkultur, die mit Deutschland oder der Schweiz vergleichbar wäre. Der Einfluss der Religion auf den rudimentären bioethischen Diskurs sei gleichwohl erheblich, wenn auch nicht immer effektiv: Auf kultureller Ebene existiere er in einem tief verankerten Katholizismus, auf institutioneller (kirchliche Ethikeinrichtungen) wie auf personeller (etwa durch Religionsvertreter in der Bioethikkommission beim Bundeskanzler) Ebene zeichne er sich durch kirchliche Dominanz aus und auf der schwer fassbaren Ebene des politischen Lobbyismus funktioniere er durch gute Beziehungen zur Österreichischen Volkspartei. Auf den ersten Blick der deutschen Situation durchaus ähnlich ist die Situation in Norwegen, dessen lange staatskirchliche Tradition freilich dafür gesorgt hat, dass nach wie vor vier Fünftel der als religiös gemeldeten Bevölkerung sich zum lutherischen Protestantismus bekennen. Die in Oslo lehrende Theologin Ulla Schmidt machte zwar deutlich, dass in der norwegischen Öffentlichkeit – ähnlich wie in Deutschland – eine lebhafte und kontroverse Debatte über bioethische Themen wie Embryonenforschung, IVF, PID und Sterbehilfe im Gange ist, dabei aber »Religion« nicht als die unterscheidende Größe wahrnehmbar sei. Schmidt konstatierte ein hohes Maß an Übereinstimmung von kirchlichen und politischen Positionen, deren religiöse Artikulation aber weniger von Kirchenvertretern, sondern vor allem von den Parteien und zivilgesellschaftlichen Akteuren vorgetragen werden. Zugleich hob sie hervor, dass 218 christliche Positionen nur teilweise als ausdrücklich religiös inspirierte Positionen artikuliert werden; zumeist werden sie als den common sense bestimmende Werte – auch ohne explizites religiöses Bekenntnis – geteilt, was zur Folge hat, dass ihre Inanspruchnahme nur selten den Charakter einer weltanschaulichen Auseinandersetzung annimmt. Auch wenn man in der hierzulande geführten Debatte zum Verhältnis von Bioethik und Religion bisweilen den Eindruck erhält, dass die Fronten zwischen religiösen und säkularen Positionen in Deutschland relativ klar verlaufen, machte die in Hildesheim lehrende evangelische Theologin Stefanie Schardien in ihrem Vortrag doch zugleich deutlich, dass die jeweiligen Positionen in Abhängigkeit von den jeweiligen gesellschaftlichen Subsystemen, in denen sie zum Thema werden, bisweilen deutlich variieren. Schardien intendierte eine systemtheoretisch angeleitete Analyse der medizin- und bioethischen Debatten in Deutschland, wobei sie den starken Einfluss der Kirchen im politischen System hervorhob. 3. Europäische Religionskultur und Bioethik – ein Fazit Angesichts der Heterogenität der bioethischen Debattenlage in internationaler und interreligiöser Perspektive drängte sich als Ertrag des Symposiums die These geradezu auf, dass die Rolle von Religion in bioethischen Diskursen weniger über die Selbstpositionierung religiöser Akteure, als vielmehr über die kulturell bedingte Eigenart politischer Öffentlichkeit zu beschreiben ist. In dieser Perspektive erscheinen vor allem längerfristige historische Konfigurationsprozesse und kulturell gewachsene Institutionenarrangements als maßgeblich für die Frage, wie sich das religiöse Agenda-Setting in biopolitischen Fragen öffentlich vollzieht. Prozesse der Konfessionalisierung in Europa, aber auch die mentalitätsgeschichtlich differierenden Erfahrungen mit der Geschichte der jeweils eigenen Nation – in Deutschland z.B. die Erfahrungen mit Euthanasie und Judenvernichtung – erscheinen als prägender als die aktuellen Handlungsintentionen religiöser Akteure und ihr Anspruch auf Gesellschaftsgestaltung. Inwieweit man gleichwohl von einer typisch »christlichen« Bioethik in Europa sprechen kann, war Thema des abschließenden Vortrags von Svend Andersen, der in Aarhus systematische Theologie lehrt. Gegenüber der Rhetorik eines gemeinsamen europäischen Erbes insistierte er darauf, dass das Gemeinsame in Europa keine Voraussetzung, sondern allererst Auftrag sei. Andersen entwickelte das Bild einer europäischen Kultur, die ihre Identität aufgrund charakteristischer »Spaltungen« erfährt. Neben die ältere Spaltung des Christentums in die römisch-katholische Kirche, die protestantischen und die orthodoxen Kirchen trat nachaufklärerisch der weltanschauliche Gegensatz zwischen einem sich zunehmend naturwissenschaftlich entwerfenden Humanismus und einem solchen, der – bei aller Kirchenkritik – an der bleibenden Verortung im Christentum festhielt. Für diese zwei typischen Stränge verwendete Andersen die Opposition von »Kantischer Synthese« und »atheistischem Utilitarismus«. Letzterer ist heute die eigentliche Herausforderung der Wiedergewinnung einer ökumenischen Position in Fragen der Biopolitik. In dieser Situation plädierte Andersen dafür, dass die Kirchen das säkulare Verständnis von Menschenwürde nicht zugunsten einer religiösen Letztfun- dierung relativieren, sondern gerade wegen seiner Säkularität anerkennen. Weil religiöse Positionen in der Bioethik nie mehr sein können als subjektiv bedingte Interpretationen von Konfliktbeschreibungen, die wissenschaftlich immer umstritten bleiben, benötige eine europäische Rechtskultur ein von allen Europäern gemeinsam geteiltes Verständnis von Menschenwürde, dass sich weltanschaulichen Instrumentalisierungsversuchen jeglicher Couleur enthält. Korrespondierender Autor: Dr. Stephan Schleissing Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften (TTN) Marsstr. 19/V D-80335 München [email protected] 219