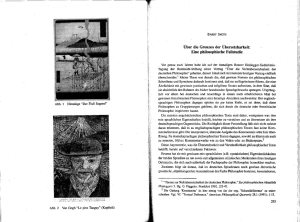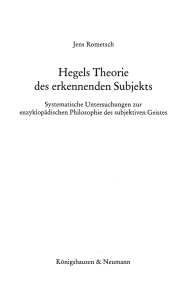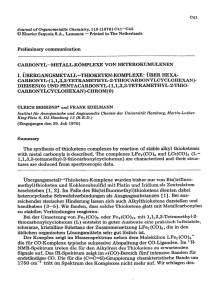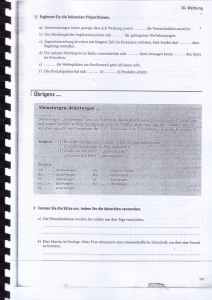Grundprobleme der Philosophie des Geistes und die
Werbung

82
Helmut Schwegler
Pauen, M. (1996) Mythen des Materialismus. Die Eliminarionstheorie
und <las Problem der psychophysischen Idenritat. Dtsch. Z.
Philos. 44: 77-99.
Primas, H. (1985) Kann Chemie auf Physik reduziert werden? Chemie in unserer Zeit 19: 109-119 und 160-166.
Roth, G. (1999) Die biologischen Grundlagen von Geist und BewuStsein. In diesem Band.
Roth, G., Schwegler, H. (1995) Das Geist-Gehirn-Problem aus der
Sichr der Hirnforschung und eines nicht-reduktionisrischen
Physikalismus. Ethik und Sozialwissenschaften 6: 69-156.
Scheibe, E. (1997) Die Redukrion physikalischer Theorien. Teil I:
Grundlagen und elementare Theorie. Berlín Heidelberg New
York: Springer.
Scheibe, E. (1999) Die Reduktion physikalischer Theorien. Teil II:
Inkommensurabilitat und Grenzfallreduktion. Berlin Heidelberg New York: Springer.
Scheffler, I. (1965) Comments. In: Cohen, R.S., and Wartofsky,
M.W. (Hg.) Boston Studies in the Philosophy of Science,
Vol.2, 77-80. New York.
Schwegler, H. (1998) The plurality of systems, and the unity of the
world. In: Altmann, G., and Koch, W.A. (Hg.) Systems - New
Paradigms. for the Human Sciences, Berlin New York: de
Gruyter.
Stock!er, M. (1999) Redukrion/Redukrionismus. In: Sandkiihler, H. J.
(Hg.) Enzyklopadie Philosophie, Hamburg: Felix Meiner.
Srockler, M. (1992) Pladoyer fur einen pragmarisch eingeschrankten
Reduktionismus. ln: Deppert, W., Kliemt, H., Lohff, B., und
Schafer, J. (Hg.) Wissenschaftstheorie in der Medizin,
157- 183. Berlin New York: de Gruyter.
Michael Pauen
Grundprobleme der Philosophie des
Geistes und die Neurowissenschaften
1. Einleitung
Die Philosophie hat bislang nicht sehr viel Gliick gehabt, wenn
sie sich mit den Fragen eingelassen hat, die auch die empirischen Wissenschaften beschaftigten: Die Naturphilosophie ist
zu groBen T eilen durch die Physik ersetzt worden, die rationale Psychologie durch die empirische Psychologie, und so
konnte man vermuten, daB auch die Philosophie des Geistes
friiher oder spater durch die Neuro- und Kognitionswissenschaften verdrangt werden wird. Hier wie in den anderen genannten Fallen mag die Philosophie den empirischen Wissenschaften den Weg ebnen, sie mag sogar mit ihren Fragen, ihren methodischen Úberlegungen und ihren begrifflichen Priizisierungen eine Weile selbst diese Entwicklung fordern, doch
es scheint, als waren die eigentlichen Antworten und die wirklich wichtigen LOsungsansatze nicht von den Philosophen,
sondern von den Wissenschaftlern zu erwarten. Zuweilen entsteht sogar der Eindruck, als wiirde die Philosophie die Entwicklung mit miiBigen Spekulationen und bloBen Scheinproblemen hemmen: Úberlegungen dariiber, wie es ist, eine Fledermaus zu sein (Nagel 1974), Gedankenexperimente iiber invertierte Farbspektren (Palmer 1999, Hardin 1987, 1990,
1997) oder Behauptungen iiber die Existenz eines unergriindlichen ,Ratsels des BewuBtseins' (Levine 1983, Chalmers
1996a, 1996b) scheinen den Fortschritt bei der Erklarung von
Gehirn und BewuBtsein eher zu behindern, als daB sie einen
produktiven Beitrag leisten wiirden.
leh mochte im folgenden zeigen, daB eine solche Einschatzung der Rolle der Philosophie des Geistes nicht gerecht wird.
84
Michael Pauen
Dabei mochte ich mích auf drei Beispiele konzentrieren. Das
erste Beispiel betrifft die Interpretation empirischer Erkenntnisse. Selbst perfekte Korrelationen von mentalen und neuronalen Prozessen jeweils eines Typs scheinen namlich ganz gegensatzliche Jnterpretationen ZU erJauben. leh mochte zeigen,
daB die Philosophie helfen kann, die dadurch entstehenden
Unklarheiten zu beseitigen: Eine der drei wichtigsten Varianten kann namlich durch theoretische ůberlegungen zuruckgewiesen werden, zwischen den beiden anderen, so wird sich
herausstellen, kann auf der Basis weiterer empirischer Erkenntnisse entschieden werden.
Das zweite Problem ergibt sich direkt aus dem interdisziplinaren Charakter des Versuches, Geist und BewuBtsein zu
erforschen. Ausgangspunkt ist die Úberlegung, daB auch eine
vollstandige neurobiologische Theorie uber die elektrochemischen Aktivitiiten von Nervenzellen offenbar noch nicht erklaren kann, warum diese Aktivitat in bestimmten Fallen mit BewuBtsein verbunden ist. Dies hatte zur Folge, daB die Neuround Kognitionswissenschaften ausgerechnet in einer zentralen
Frage eine unuberwindliche „Erklarungslucke" akzeptieren
muBten. leh mochte im folgenden zeigen, daB philosophische
Úberlegungen sowohl bei der Problemanalyse wie auch bei der
Entwicklung von LOsungsstrategien eine wichtige Rolle spielen konnen.
SchlieBlich stellt sich drittens die Frage nach den Konsequenzen der Erkenntnisse der Neuro- und Kognitionswissenschaften fiir das menschliche Selbstverstandnis. Hier wird zu
untersuchen sein, inwieweit eine Erkenntnis der neuronalen
Mechanismen unser Selbstverstandnis als verantwortlich handelnder Subjekte in Frage stellen kann. Wird also die Realitiit
des BewuBtseins gefahrdet, wenn wir die neuronalen Prozesse
kennen, die dem BewuBtsein zugrunde liegen? Kann man
noch von einem einheitlichen leh sprechen, wenn wir die
Vielzahl der Mechanismen verstehen, aus denen unser SelbstbewuBtsein hervorgeht? Kann man schlieBlich eine Person fiir
ihre Handlungen verantwortlich machen, wenn diese Handlungen auf neuronale Prozesse zuriickgehen, die durch Naturgesetze determiniert werden?
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
85
Selbstverstandlich kann es hier genausowenig wie bei den
anderen Beispielen darum gehen, mit fertigen LOsungsvorschlagen aufzuwarten. leh mochte jedoch mo~liche Antworten
erortern, wobei die Rolle philosophischer Uberlegungen im
Mittelpunkt stehen wird. Unnotig diirfte auch die Bemerkung
sein, daB es hier nur um Beispiele fiir die Probleme gehen
kann, mit denen sich die Philosophie des Geistes in der Gegenwart befaBt. Dennoch handelt es sich um exemplarische
Fragestellungen, die einen ersten ůberblick uber die Bedeutung philosophischer ·ůberlegungen fiir die Erforschung des
BewuBtseins geben konnen.
2. Grundfragen
Ein relativ groBer Teil der neurobiologischen Forschung konzentriert sich auf die Entdeckung moglichst stabiler und spezifischer Korrelationen zwischen neuronaler Aktivitiit und BewuBtseinsprozessen. Die jungsten Fortschritte bei den sogenannten bildgebenden Verfahren haben hier wesentlich genauere Einblicke ermoglicht. Weitere Fortschritte sind von einer Verbesserung der Verfahren selbst, aber auch von einer
Kombination unterschiedlicher Ansatze zu erwarten, durch die
die Starken dieser Methoden, etwa die vergleichsweise gute
raumliche Auflosung von fMRI und PET und die gute zeitliche
Auflosung von MEG und EEG, miteinander kombiniert werden konnen (Barinaga 1997, Posner & Raichle 1996). Erfolgversprechend ist auch die Messung der Aktivitiit einzelner
Neuronen sowie die Nutzung von besonderen Umstanden, die
eine sehr genaue Unterscheidung zwischen bewuBter und unbewuBter Wahrnehmung erlauben, wie dies etwa bei dem sogenannten Hysterese-Phanomen der Fall ist (Kleinschmidt
2000)
Soweit es um den konkreten Zusammenhang von Gehirn
und BewuBtsein geht, stoBen all diese Methoden jedoch an eine prinzipielle Grenze: Auch die genauesten Korrelationen
zwischen einem gewissen BewuBtseinszustand, beispielsweise
einem eindeutig beschriebenen Typ von Schmerzerfahrungen,
und der Aktivitat bestimmter Neuronenpopulationen, sagen
86
Michael Pauen
wir im vorderen Teil des Gyrus cinguli und im somatosensorischen Kortex, 1 wiirde immer noch unterschiedliche Interpretationen offenlassen - selbst dann, wenn die neuronale Aktivitat einschlielSlich der relevanten Neurotransmitter und Neuromodulatoren bis hinab zur Molekiilebene genauestens beschrieben worden ware: Zum einen lage der Gedanke nahe,
daíS wir es hier tatsachlich nur mit einem einzigen Vorgang zu
tun hatten, daíS mentale und neuronale Aktivitat also miteinander identisch waren. Zweitens ware es aber auch moglich,
daíS die Korrelation eine GesetzmafSigkeit indiziert, die zwei
unterschiedliche Aktivitaten miteinander verbindet, so wie etwa der Stromflu/5 durch eine Spule in einer gesetzmal5igen Beziehung zu dem dadurch entstehenden magnetischen Feld
steht. Die neuronale Aktivitat ware die Basis der mentalen
Prozesse, die ihrerseits wiederum Einflu/5 auf das weitere Geschehen auf der neuronalen Ebene nehmen konnten. Es bestiinde also eine lnteraktion zwischen mentalen und neuronalen Prozessen; Schmerzen wiirden durch ein bestimmtes Muster neuronaler Aktivitat entstehen, gleichzeitig kéinnte das
mentale Phanomen Schmerz seinerseits die Ursache einer bestimmten Handlung sein, mit der der schmerzempfindende
Organismus auf seine Situation reagiert. SchlielSlich ware es
drittens denkbar, da/5 die mentale Aktivitat nur als eine zusatzliche, ihrerseits jedoch wirkungslose Eigenschaft neuronaler
Prozesse aufgefal5t wird: Relevant fiir die Steuerung des Verhaltens waren also allein die neuronalen Prozesse; diese besa15en zusatzlich noch einen ,Erlebnisaspekť, der aber keinerlei
Einflu/5 auf das neuronale Geschehen hatte.
Offenbar ist diese Situation unbefriedigend: Natiirlich
mochten wir wissen, ob wir mit unserer neurobiologischen
Beschreibung gleichzeitig auch die mentalen Prozesse erfal5t
haben oder ob diese Prozesse ein zusatzliches Phanomen darstellen, das méiglicherweise einen ganz eigenstandigen Einflu/5
auf die neuronalen Prozesse ausiibt. Aul5erdem wollen wir
nicht nur etwas iiber die ,neuronale Basis' mentaler Phanomene wissen, sondern wir wollen diese Phiinomene selbst erforschen.
1
cf. Rainville et al. 1997, Cross 1994.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
87
Es fragt sich daher, ob die Philosophie etwas dazu beitragen kann, eine Entscheidung zwischen den genannten Interpretationsalternativen zu erleichtern. Immerhin sind alle drei
Positionen intensiv in der Philosophie des Geistes diskutiert
worden. Die zuerst genannte, monistische Interpretation entspricht der klassischen Identitiitstheorie, die zweite Interpretation ist die des interaktionistischen Dualismus, und die zuletzt
genannte Option wird im allgemeinen unter dem Tite! Eigenschaftsdua/ismus verhandelt.
Beginnen wir mit dem Eigenschaftsdualismus. Wie erwahnt,
interpretiert diese Position die eingangs genannte psychophysische Korrelation als das Produkt einer gesetzmal5igen Verbindung zwischen einer neuronalen und einer mentalen Eigenschaft, die jedoch ihrerseits kausal nicht wirksam sein soli. Attraktiv erscheint der Eigenschaftsdualismus nicht zuletzt deshalb, weil er die Eigenstandigkeit mentaler Prozesse wahrt,
ohne gleichzeitig Behauptungen iiber die Existenz von geistigen Substanzen zu machen. Anders als der interaktionistische
Dualismus umgeht er aul5erdem das Problem, wie denn mentale Prozesse EinfluB auf physische Vorgange nehmen konnen.2
Bei naherer Betrachtung werden hier allerdings gravierende
Probleme erkennbar. Die Ablehnung psychophysischer lnteraktionen hat namlich zur Folge, daB mentale Prozesse aus der
Sicht des Eigenschaftsdualisten nicht zu den Ursachen fiir physische Prozesse und damit auch nicht zu den Ursachen eines
bestimmten Verhaltens gehoren konnen. Konkret bedeutet
dies nicht nur, daB meine Schmerzen nicht unter den Ursachen dafiir sind, da/5 ich ein bestimmtes Schmerzverhalten zeige, genausowenig waren sie dafiir verantwortlich, daíS ich iiber
meine Schmerzen spreche, ja, da/5 ich mich an sie erinnere: In
al! diesen Fallen sind physische Prozesse wie die Bewegung
von Muskeln, die Aktivitat von Neuronen in den Sprachzen2
Ein Beispiel fiir eine eigenschaftsdualistische Position bietet Chalrners
1996a; Diskussionen dieser Position u.a. bei Bieri 1992b und Pauen
2000a. Dort auch eine ausruhrlichere Darstellung der hier vertretenen
Argurnentation.
88
Michael Pauen
tren oder aber die Anlage von Gedachtnisspuren involviert,
doch keiner dieser Prozesse kann von den kausal unwirksamen
mentalen Eigenschaften abhangig sein.
Wiirde <las genannte neuronale Aktivitatsmuster aus welchen Griinden auch immer einmal auftreten, ohne von
Schmerzerfahrungen begleitet zu sein, dann diirfte sich dies im
Verhalten der Versuchspersonen in keiner Weise niederschlagen, schlieJSlich wird dieses lediglich von physischen, insbesondere neuronalen Prozessen bestimmt. Problematischer
noch diirfte die Tatsache sein, daB auch wir selbst es im Riickblick nicht bemerken wiirden, sollte die neuronale Aktivitat
einmal in der Abwesenheit von Schmerzen auftreten: Da die
mentalen Phanomene kausal unwirksam sind, hangen die Gedachtnisspuren jenes Ereignisses allein von der neuronalen Aktivitat ab. Da diese sich nicht verandert hat, wird sich die Gedachtnisspur nicht von der gewohnlicher Schmerzereignisse
unterscheiden; wir wiirden also meinen, daB wir die Schmerzen tatsachlich gespiirt hatten. Der Eigenschaftsdualist kann
somit niemals sicher sein, daB er die mentalen Zusrande, an
die er sich zu erinnern meint, tatsachlich erfahren hat. Offenbar fiihrt seine Theorie also zu abwegigen Konsequenzen.
Aus diesen Ůberlegungen ergeben sich zwei Folgerungen:
Zum einen kann der Eigenschaftsdualismus nicht als annehmbare Interpretation der eingangs skizzierten empirischen Beobachtungen betrachtet werden. Es ware also nicht sinnvoll,
stabile Korrelationen von Schn;ierzerfahrungen und neuronaler
Aktivitat im Gyrus cinguli und im somatosensorischen Kortex
so zu interpretieren, als hatten wir es hier mit einer neuronalen Aktivitat zu tun, die zusatzlich. noch einen mentalen ,Erlebnisaspekť hatte. Grundsatzlich wird man zweitens zu dem
Ergebnis kommen, daB eine sinnvolle Interpretation empirischer Ergebnisse in den Neuro- und Kognitionswissenschaften
von der Annahme ausgehen muB, daB auch mentale Prozesse
kausal wirksam sind: Nur so laBt sich gewahrleisten, daB sie
iiberhaupt in empirischen Untersuchungen erfaBt werden
konnen. Diese Forderung wird nicht durch den Eigenschaftsdualismus, wohl aber durch die beiden anderen Ansatze erfiillt, also durch die Identitatstheorie und den interaktionistischen Dualismus.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
89
Der interaktionistische Dualismus trifft wie der Eigenschaftsdualismus eine Unterscheidung zwischen neuronalen und
mentalen Phanomenen; anders als der Eigenschaftsdualismus
geht er jedoch von einer Wechselwirkung zwischen beiden
Ebenen aus. lm Gegensatz zu einer weitverbreiteten Auffassung muB ein Dualist allerdings nicht die Existenz geheimnisvoller geistiger Substanzen postulieren, vertraglich mít seiner
Position ist auch die Behauptung, Bewuf5tseinsprozesse seien
eine besondere Art physischer Phanomene, solange diese Art
physischer Prozesse von den gleichzeitig stattfindenden neuronalen Prozessen unterschieden wird.
Mit ihrem Postulat einer psychophysischen lnteraktion
entgeht diese Position auch den Problemen des Eigenschaftsdualismus; sie kann also der nur schwer iiberwindbaren Vorstellung gerecht werden, daf5 unsere bewuBten Entscheidungen unter den Ursachen. fiir unsere Handlungen und unsere
Empfindungen unter den Ursachen fiir unsere Aul5erungen
iiber diese Empfindungen sind. Offensichtlich ware es allerdings nur dann gerechtfertigt, von einer Interaktion zwischen
mentalen und neuronalen Phanomenen zu sprechen, wenn wir
konkrete empirische Belege fiir eine solche Wechselwirkung
hatten. Solche Belege waren insbesondere dort zu erwarten,
wo wir mentale Phanomene fiir ein bestimmtes Verhalten verantwortlich machen, beispielsweise dann, wenn wir aufgrund
einer bewuf5t vollzogenen Willensentscheidung unsere Hand
heben.3
Der Dualist miil5te in diesem Falle erwarten, daB sich die
zugrundeliegenden neuronalen Prozesse nicht allein auf neurobiologischer Basis erklaren lassen. Dies wiirde selbstverstandlich auch fiir die physikalistischen Varianten des Dualismus gelten: Gerade dann, wenn man mentale Ereignisse als
physische Phanomene versteht, wird man erwarten, daB sie
Einfluf5 auf die neuronalen Prozesse nehmen. Selbstverstandlich kann auch der Dualismus stabile psychophysische Korrelationen akzeptieren; 4 doch irgendwo in der Kette zwischen
3
4
Einen Vorschlag fiir ein anderes Experiment macht Libet 1994.
cf. hierzu Carrier & MittelstraB 1989.
'/
90
Michael Pauen
Reiz und Reaktion miiBte etwas passieren, das nicht mehr auf
der Basis neurobiologischer Erkenntnisse zu erklaren ware,
sondern den Riickgriff auf die Willensentscheidung erforderte.
Es miiBte also innerhalb dieser Kette einen Schritt geben, der
auch bei vollig identischen neuronalen Bedingungen anders
ausgefallen ware, sofern es eine andere Willensentscheidung
gegeben hatte. Diese Forderung muB der Dualist iibrigens unabhangig von seinen Ansichten zum Problem der Willensfreiheit aufstellen: Die bewuBte Willensentscheidung muB kausal
wirksam sein; dabei kann sie jedoch ihrerseits durch vorangehende mentale oder neuronale Ereignisse determiniert sein.
Wenn sich eine solche psychophysische Interaktion nachweisen JieBe, dann wiirde dies den interaktionistischen Dualismus
stiitzen. Erwiese sich ein solcher Nachweis als unmoglích,
dann wiirde dies gegen diese Option sprechen.
Gegenwartig ist eine endgiiltige Antwort selbstverstandlich
noch nicht moglich; immerhin haben sich in den bislang vorliegenden Arbeiten noch keine Hinweise auf eine solche lnteraktion gefunden. Wichtiger noch diirfte sein, daB vorliegende
Studien zum Ablauf bewuBter Entscheidungen gegen die Annahrne sprechen, daB die relevanten neuronalen Prozesse von
mentalen Willensakten abhangig sind. So hat insbesondere
Benjamin Liber (1985) Belege fiir die Annahme gebracht, daB
zumindest bei sehr einfachen Bewegungen das BewuBtsein, eine Entscheidung getroffen zu haben, erst einsetzt, nachdem
die Bewegung auf der neuronalen Ebene bereits durch den
Aufbau eines sogenannten "Bereitschaftspotentials" im motorischen Kortex eingeleitet worden ist. Sollten sich Libets Resultate, die kiirzlich prinzipiell bestatigt worden sind (Haggard
& Eimer 1999), auch weiterhin als haltbar erweisen, dann
miiBten wir zu dem SchluB kommen, daB Handlungen nicht
durch die auf sie bezogenen bewuBten Willensakte gesteuert
)( werden. Ausgerechnet in einem paradigmatischen Fall lieBe
sich also die vom Dualismus postulierte psychophysische Interaktion nicht nachweisen. Karne man auch in anderen paradigmatischen Fallen zu ahnlichen Ergebnissen, so wiirde dies
entschieden gegen den interaktionistischen Dualismus sprechen.
l
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
91
Doch was ist mit der dritten Alternative, also der Annahme,
daB stabile Korrelationen als lndizien fiir die Identiti:it mentaler und neuronaler Prozesse gewertet werden konnen? Zunachst ist unklar, was es bedeutet, wenn man behauptet, daB
zwei Prozesse miteinander identisch sein sollen, geschweige
denn zwei Prozesse, die sich so massiv voneinander unterscheiden, wie es BewuBtsein und die Aktivitat von einfachen
Nervenzellen nun einmal tun. 5 Kann man also auch die Identitatsbehauptung als eipe wenig sinnvolle Alternative zuriickweisen, so wie dies oben mít dem Eigenschaftsdualismus geschah?
Um diese Frage zu beantworten, verdeutlicht man sich am
besten, wíe wír Identitatsbehauptungen im Alltag gebrauchen. .\
Um solche Behauptungen geht es, wenn wířiřleiner Person,
die wir gerade getroffen haben, einen Schulkameraden erkennen, den wir seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben. Wir
sagen dann, daB die Person identisch mít unserem Schulkameraden ist. Áhnliche Probleme treten auf, wenn wir nach dem
Verhaltnis von Samuel Clemens zu Mark Twain6 fragen oder
wenn wir eine Melodie horen und dann in dem vor uns spielenden Orchester nach dem zugehorigen Instrument suchen.
Finden wir das Instrument, dann konnen wir sagen, es sei
identisch ist mit demjenigen, das die Melodie spielt. Identitatsbehauptungen spielen also offenbar in solchen Fallen eine
besondere Rolle, wo wir zwei unterschiedliche Beschreibungen oder Zugange haben und dann erkennen, daB sich beide
nur auf ein Objekt oder ein Ereignis beziehen. Der Fall des
Musikinstrumentes zeigt iiberdies, daB die konkreten Wahrnehmungen oder Erfahrungen abhangig von den Zugangen
recht unterschiedlich sein konnen, auch wenn sich beide auf
einen Gegenstand oder ein Ereignis beziehen.
5
"Beilaufig gesprochen: Von zwei Dingen zu sagen, sie seien identisch,
ist ein Unsinn, und von einem zu sagen, es sei iden'tisch mit sich selbst,
sagt gar nichts." Wittgenstein 1984, 62 (fractatus logicophilosophicus 5.5303).
6 "Mark Twain" war der Kiinstlernarne von Samuel Langhorne Oemens.
92
Michael Pauen
Es fallt nicht schwer, diese Ůberlegungen auf das Verhaltnis
von Gehirn unci BewuíStsein zu iibertragen. lmmerhin haben
wir es auch hier mit zwei unterschiedlichen Zugangen zu tun.
BewuíStsein erfahren wir nur aus der Perspektive der ersten
Person: Direkt zuganglich sind mir nur meine eigene Schmerzen, meine eigenen Gedanken unci meine eigenen Wiinsche.
lm Gegensatz dazu ist das Gehirn ein aus der Perspektive der
dritten Person zuganglicher Gegenstand wissenschaftlicher
Auseinandersetzung wie eine Niere, ein Computer oder eine
Braunsche Rohre. Wenn wir also die ldentitat von mentalen
unci neuronalen Prozessen behaupten, dann meinen wir, daíS
sich bestimmte neurobiologische Erkenntnisse auf den gleichen Vorgang bzw. die gleichen Eigenschaften beziehen wie
gewisse BewuíStseinserfahrungen, die uns aus der Perspektive
der ersten Person zuganglich sind.
Damit ist nur die Bedeutung von ldentitatsbehauptungen
geklart, unklar bleibt aber, unter welchen Bedingungen es berechtigt ist, solche Behauptungen aufzustellen. Wenn Mark
Twain identisch mit Samuel Clemens ist, dann muíS er sich
immer dort unci nur dort aufgehalten haben, wo Samuel Clemens war: lnsofern scheint es in der Tat gerechtfertigt, stabile
unci spezifische Korrelationen als lndiz fiir eine Identitatsbeziehung zu interpretieren. Alleine sind sie jedoch unzureichend; so konnte es sich bei Samuel Clemens etwa um einen
Privatsekretar handeln, der sich stets am gleichen Ort aufgehalten hat wie Mark Twain. Notwendig ist also auíSerdem
der AusschluíS von Alternativinterpretationen. lm Falle des
Verhaltnisses von Geist unci BewuíStsein ware der interaktionistische Dualismus eine solche Alternative; Einwande gegen
diese Position wiirden also indirekt die Identitatsbehauptung
stiitzen. Da die ldentitatstheorie im Gegensatz zur interaktionistischen Variante des Dualismus keinen EinfluíS autonomer7
mentaler Prozesse auf neuronale Aktivitat annimmt, kann die
Entscheidung zwischen diesen beiden Positionen auf empirische Erkenntnisse zuriickgreifen; sollte es keine Belege fur ei7
Gemeint sind damit mentale Prozesse, die - anders als es die Identitatstheorie annimmt - nicht gleichzeitig auch auf der physiologischen
Ebene beschrieben werden konnen.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
93
ne psychophysische lnteraktion geben, dann sprache <las fur
die Identitatsbehauptung.
ln jedem Falle hatte diese Theorie eine ganze Reihe von
Vorteilen. Wenn geistige Prozesse neuronale Ereignisse sind,
dann sind sie selbstverstandlich kraft dieser ldentitat auch in
der Lage, andere physische Ereignisse zu beeinflussen. 8 Anders
als bei der dualistischen lnteraktionstheorie sind hier also keine komplizierten Annahmen uber die Wechselwirkung zwischen neuronalen unci mentalen Prozessen notwendig. Auch
der Erklarungsaufwand scheint geringer zu sein: Wir miiíSten
keine neuen mentalen Entitaten einfuhren, und es ware unnotig, jenseits der neuronalen Ebene noch eine ganz andere Art
von Prozessen, namlich autonome mentale Prozesse einzufuhren, die dann noch zusatzlich erklart werden miiíSten. Dieser
Vorteil bliebe auch gegeniiber ,physikalistischen' Varianten
des Dualismus bestehen, schlieíSlich wird auch hier eine ganz
neue Art physischer Phanomene postuliert. Wenn umgekehrt
mentale Prozesse neuronale Prozesse sind, dann sind Erklarungen bestimmter neuronaler Prozesse gleichzeitig auch Erklarungen der zugeh6rigen mentalen Vorgange: SchlieíSlich
haben wir es hier jeweils nur mit einem einzigen ProzeíS zu
tun, den wir nur aus zwei verschiedenen Perspektiven beschreiben konnen.
Es scheint damit, als waren wir bei der Klarung des urspriinglichen Problems zumindest einen Schritt vorangekommen: Von den drei lnterpretationsalternativen, die anfangs zur
Verfugung standen, konnte eine, der Eigenschaftsdualismus,
aufgrund theoretischer Ůberlegungen zurilckgewiesen werden.
AuíSerdem zeigte sich, daíS zwischen den beiden anderen auf
der Basis empirischer Befunde unterschieden werden kann:
Sollte es nicht moglich sein, die von den Dualisten behauptete
8
Der Untersdůed zum interaktionistischen Dualismus sollte klar sein:
Fiir die Identitatstheorie ist jedes mentale gleichzeitig ein neuronales
Ereignis, die Wirkung eines mentalen Prozesses laBt sich daher immer !
auch in den korrepsondierenden physiologischen Kategorien beschrei- /
ben. Genau dies gilt fiir den interaktionistischen Dualismus nicht: Da l
mentale Ereignisse von neuronalen Prozessen unterschieden werden,
schlieBt das Wirksamwerden eines mentalen Prozesses eine gleichzeitige neuronale Beschreibung aus.
K
Michael Pauen
94
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
lnteraktion von mentalen und neuronalen Phanomenen nachzuweisen, dann wiirde dies entschieden fiir die Identitatstheorie sprechen.
radikal von allen anderen korperlichen Organen, z.B.
den Nieren, also von jenen Organen, die noch nicht
einmal eine Spur von BewulStsein haben? Wie kann aus
der Anhaufung von Millionen jeweils fiir sich genommen unbewulSter Neuronen so etwas wie phanomenales
BewulStsein entstehen?9
3. Erklarung mentaler Zustande
Vorausgesetzt wird hier allerdings, dalS nicht noch ganz neue
Varianten ins Spiel gebracht werden und dalS keine wichtigen
theoretischen Einwande gegeniiber einer der beiden verbliebenen lnterpretationsvarianten erhoben werden konnen. Dies
ist nun zumindest bei der Identitatstheorie leider der Fall. Es
gibt hier in der Tat eine ganze Reihe von gravierenden Vorbehalten; am wichtigsten scheint mir dabei das sogenannte Erklarungsliickenproblem zu sein. Zwar betrifft das Problem
nicht ausschlielSlich die Identitatstheorie, allerdings wirft es
fiir diesen Ansatz besonders gravierende Schwierigkeiten auf.
Aufgetaucht ist dieses Problem i.ibrigens nicht erst in den letzten Jahren, es wird vielmehr mit einem sehr instruktiven Geki !u.i.~ dankenexperiment bereits zu Begiim des achtzehnten J ahr""-- hunderts in Leibniz' MONADOLOGIE (Leibniz 1979, urspr.
1714) er6rtert, es steht im Mittelpunkt von Emil DuboisReymonds beri.ihmtem IGNORABIMUS Aufsatz (DuboisReymond 1974, urspr. 1872), und in der Gegenwart wird es
von Philosophen (Levine, Chalmers, Bieri, Beckermann, Kim)
ebenso wie von Neurobiologen (Flohr 1993), Neuropsychologen (Rolls 1999, LeDoux 1996) und Psychologen (Windmann
& Durstewitz 2000) er6rtert. Ausgangspunkt ist dabei die In~ ! ~n, dalS auch ein vollstandiges Wissen iiber die neuronal"ěn
Prozesse im Gehirn nicht erklaren wiirde, warum BewulStsein
entsteht, insbesondere scheint dabei offenzubleiben, warum
Zustande des sogenannten ,phanomenalen BewulStseins' wie
Schmerzen, Farbempfindungen oder Furchtzustande so erfahren werden, wie dies nun einmal der Fall ist. In diesem Sinne
heilSt es bei Colin McGinn:
95
Auf den ersten Blick erscheint die Frage tatsachlich unlosbar:
Es ist einfach nicht zu erkennen, inwiefern Erkenntnisse uber
neuronale Prozesse uns weiterhelfen sollen, wenn wir etwas
iiber die Entstehung des BewulStseins und seiner spezifischen
Qualitaten erfahren wollen. Wichtig ist dabei zunachst, dalS
wir es hier nicht mehr mit einem empirischen Problem zu tun
haben, d~ etwa durch eine Erweiterung unseres neurobiologischen W1ssens zu losen ware. Das Problem scheint vielmehr 1-..:-...
auch dann bestehen zu bleiben, wenn wir beliebig viel i.iber die "-'- .
t· '"'p>ď'~\
neuronalen Prozesse in unserem Gehirn wiilSten.10
T atsachlich konnen philosophische Ůberlegungen zu einer
L6sung dieser Frage beitragen. Wenn ein Problem so ratselhaft erscheint, dann liegt der Verdacht nahe, die Frage sei
f.!!ls.ch-gestellt._pder sie basiere auf sprachlichen o"de;iň'haltli:.
chen Verwirru~enaua~6c1ireich i~ folg~nd~n
zeigen, ist auclrhier der Fall.
Dabei mulS man allerdings die beiden oben beschriebenen
Ansatze unterscheiden: Sollte sich der Dualismus als richtig
herausstellen, dann geht BewulStsein in einem gewissen Sinne
aus neuronaler Aktivitat hervor. Wir konnten dann z.B. fragen, warum jene neuronalen Prozesse im somatosensorischen
Kortex und im Gyrus cinguli uberhaupt BewulStsein hervorbringen, und genauer, warum sie Schmerzen und nicht beispielsweise Futcht oder Freude entstehen lassen. Auf der anderen Seite sollten wir jedoch nicht verwundert sein, dalS hier
ein Ratsel .entsteht: Wenn BewulStsein ein Phanomen jenseits
9 McGinn 1989, 99.
Wie k6nnen die Farben des phanomenalen BewulStseins
aus glitschiger, grauer Materie entstehen? Was unterscheidet das Organ, das wir als ,Gehirn' bezeichnen, so
lO
Man kann also auch nicht behaupten, es handle sich hier um ein
Scheinproblem, das sich von selbst auflosen wiirde, wenn unser neurobiologisches Wissen erst ·einmal weit genug reichen wiirde. (Parricia
Churchland, 1996).
96
Michael Pauen
der bislang bekannten physischen Prozesse ist, dann konnen
wir auch nicht erwarten, daB es sich aus dem bereits vorliegenden physiologischen oder physikalischen Wissen erklaren
lafk Wenn es sich hier um eine Erscheinung eines ganz neuen
Typs handelt, dann diirfte ihre Erklarung eben auch die Grenzen der Neurobiologie und der Physik sprengen, so wie wir
diese Wissenschaften heute kennen. Insofern existiert hier tatsachlich ein Problem, doch es ist leicht zu sehen, warum dieses
Problem hier auftreten mu/S. Der Dualist muB diese Schwierigkeiten erwarten, sie stellen daher keinen Einwand gegen
seine Theorie dar.
Ganz anders sieht es aus unter den Pramissen der Identitiitstheorie: Wenn zwischen mentalen und neuronalen Prozessen eine Identitiitsbeziehung besteht, dann diirfte es dieses
Ratsel eigentlich gar nicht geben. Wie bereits erwahnt, miiBte
unter diesen Bedingungen eine physiologische Erklarung der
Entstehung eines bestimmten neuronalen Prozesses gleichzeitig auch eine Erklarung fiir die Entstehung des damit identischen mentalen Prozesses liefern, schlieB!ich ware der neuronale ProzefS ja gleichzeitig auch ein mentaler ProzeB. W enn
wir wissen, dafS Mark Twain identisch mit Samuel Clemens
ist, dann muB uns die Krankenakte von Samuel Clemens auch
Aufschliisse iiber Mark Twain geben. Eventuelle Zweifel waren gleichzeitig Zweifel an der Identitat von Mark Twain und
Samuel Clemens. Genau diese Zweifel treten nun in der Tat
im Falle des Verhaltnisses von mentalen und neuronalen
Prozessen auf.
Doch worin bestiinde <las Ratsel unter den Pramissen der
Identitatstheorie nun genau? Festzuhalten ist zunachst, daB
wir in eine Konfusion geraten, wenn wir einerseits annehmen,
mentale Prozesse seien identisch mit bestimmten neuronalen
Aktivitaten, und dann gleichzeitig nach einer Erklarung dafiir
verlangen, wie der mentale Zustand aus der neuronalen Aktivitat „hervorgeht": Die Frage setzt ja bereits eine Unterscheidung zwischen dem „produzierenden" neuronalen und dem
„produzierten" mentalen ProzeB voraus, doch diese Unterscheidung kann es nicht geben, wenn die Identitatstheorie zutrifft. Es ist daher kein Wunder, daB wir uns hier mit einer
Erklarung schwertun: Die Frage ist einfach falsch gestellt.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
97
Der Identitiitstheoretiker kann allenfalls fragen, wie psychologische und neurobiologische Theorien sinnvoll aufeinander bezogen werden konnen. Diese Frage scheint jedoch prinzipiell losbar zu sein. Zwar kann man keine reibungslosen
ůbergange zwischen Theorien erwarten, die auf unterschiedlichen Niveaus der wissenschaftlichen Beschreibung und Erklarung arbeiten. 11 Dennoch haben wir im allgemeinen keine
prinzipiellen Probleme mit solchen ůbergiingen. Dies ist auch
dann der Fall, wenn wir nach naturwissenschaftlichen Erklarungen fiir Phiinomene suchen, die uns aus dem Alltag bekannt sind, also wenn wir beispielsweise wissen wollen, warum Wasser bei 0°C friert und bei l00°C kocht. Zwar beziehen
sich unsere naturwissenschafdichen Theorien nur auf eine
Substanz namens „H2 0", doch es fallt uns sehr leicht, <las physikalische oder chemische Wissen iiber H 20 fiir unsere Alltagserfahrungen mit Wasser nutzbar zu machen.
Genau dies scheint im Verhaltnis von mentalen und neuronalen Prozessen schwierig zu sein: Erkenntnisse iiber die Entstehung eines bestimmten Aktivitatsmusters im Gyrus cinguli
und im somatosensorischen Kortex scheinen auch dann keine
plausiblen Erklarungen fiir die konkrete Qualitat von
Schmerzerfahrung zu liefern, wenn wir ansonsten gute Grunde fiir die Annahme hatten, daB jene neuronale Aktivitat identisch mit der Schmerzerfahrung ist.
Die philosophische Diskussion liber dieses Problem hat nun
gezeigt, daB der entscheidende Grund fiir diesen Unterschied
zwischen der Erklarung bestimmter Eigenschaften von Wasser
und der Erklarung mentaler Phanomene offenbar darin besteht, daB sich BewufStseinsprozesse und insbesondere Zustande des phanomenalen BewuBtseins im Gegensatz zu Alltags- [
phanomenen nicht durch ihre relationalen Eigenschaften beschreiben lass~n. 12 Solche relationalen Beschreibungen versuchen eine Eigenschaft nicht durch Hinweise auf ihr ,Wesen' zu
erfassen; im Mittelpunkt stehen vielmehr die Beziehungen zu
anderen Objekten oder Eigenschaften. Die Durchsichtigkeit
von Wasser laBt sich also beschreiben als eine spezifische Be11 McCauley1981, 1986.
12 Levine 1995.
98
Michael Pauen
ziehung zwischen dieser Substanz und bestimmten elektromagnetischen Wellen, seine Dichte als Beziehung zwischen einer
bestimmten Menge dieser Substanz und der gleichen Menge
anderer Substanzen etc. Entscheidend ist nun, da15 sich unser
Alltagsbegriff von Wasser offenbar durch solche relationalen
Beschreibungen wie ,fliissig', ,geruchlos', ,durchsichtig', ,Dichte von lg/cm3 bei 4°C', ,Siedepunkt von l00°C auf Meeresh6he' etc. explizieren laíSt: Es ware sinnlos zu bezweifeln, daíS es
sich bei einer Substanz, die diesen Beschreibungen entspricht,
um Wasser handelt. Treffen diese Kriterien also auf H 2 0 zu,
dann gibt es kaum mehr einen begriindeten Einwand gegen
die Identifikation von Wasser und H 2 0. Gleichzeitig erscheint
es plausibel, eine Erklarung fiir Kristallisierung von H 2 0 bei
0°C auch als Erklarung fiir <las Frieren von Wasser zu akzeptieren.13
Genau dies scheint nicht fiir BewuíStsein und insbesondere
nicht fiir <las phanomenale BewuíStsein zu gelten. Natiirlich
gibt es bestimmte Relationen, die charakteristisch fiir Rotempfindungen sind. Solche Empfindungen werden normalerweise
von Objekten wie reifen T omaten hervorgerufen und fiihren
ihrerseits u.a. zu verbalen AuíSerungen wie „dieses Objekt ist
rot". Doch wahrend unser Alltagsbegriff „Wasser" vollstandig
durch solche Beschreibungen erfaíSt werden kann, scheint dies
bei phanomenalen Erfahrungen nicht moglich zu sein. Der
Grund dafiir ist recht einfach. Ega! wie genau die Beschreibung der Ursachen und Wirkungen einer Rotempfindung auch
sein mag, es scheint immer moglich, daíS jemand, auf den diese
Beschreibung zutrifft, in Wirklichkeit eine ganz andere oder
eben auch gar keine Empfindung hat. Eine Person, so lautet
<las sogenannte „lnverted-Spectrum-Argument", konnte seit
ihrer Geburt immer dort Griln sehen, wo wir Rot sehen und
umgekehrt, doch sie hat gelernt, <las Wort „rot" genauso zu
verwenden wie wir es tun, obwohl sie in den entsprechenden
Situationen eine Griinerfahrung hat; die Unterschiede konnen
also niemals auffallen. Diese Úberlegung wiirde dafiir sprechen, daíS phanomenale Erfahrungen einen Kern haben, der
sich relationalen Beschreibungen entzieht. Damit wiirde uns
13 Levine 1983, Kim 1998.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
99
<las Verbindungsglied zwischen phanomenalen und neuronalen Prozessen fehlen. Infolgedessen waren wir auch nicht in
der Lage, die entsprechenden neuronalen Erkenntnisse fiir die
phanomenalen Erfahrungen nutzbar zu machen.
Es gibt einige wichtige Einwande gegen derartige Gedankenexperimente. Sie erwecken den Eindruck, prinzipielle
Moglichkeiten, unabhangig von empirischen Bedingungen
aufzuzeigen. T atsachlich geht in sie jedoch immer schon unser
Alltagswissen ein. Dieses Wissen aber kann sich verandern und
damit <las Gedankenexperiment in Frage stellen. Es kommt
hinzu, daíS eine zentrale Voraussetzung des InvertedSpectrum-Argumentes bezweifelt werden kann: Da <las Farb- ) I
spektrum nicht symmetrisch ist, 14 miiíSten sich lnversionen[
vermutlich doch im Diskriminationsverhalten niederschlagen.
Entscheidend ist jedoch, da15 es keineswegs sicher ist, ob man
BewuíStseinserfahrungen nicht doch relational beschreiben
kann. leh kann hier nur einige Indizien nennen, die dafiir
sprechen, daíS solche relationalen Beschreibungen in der T at
moglich sind. AnschlieíSend werde ich skizzieren, was passieren wiirde, wenn tatsachlich iiberzeugende relationale Beschreibungen moglich waren.
Festzuhalten ist zum einen, daíS es mittlerweile eine ganze
Reihe von Hypothesen und empirischen Belegen gibt, die darin iibereinkommen, daíS BewuíStsein konkrete Funktionen hat:
Es dient unter anderem dazu, uns bei wichtigen, neuen Problemen Zugang zu Informationen und Lósungsmoglichkeiten
zu geben, die noch nicht in unseren eingeiibten Handlungsmustern enthalten sind. 15
Bei Emotionen sind solche funktionalen Zusammenhange
ein direkter Bestandteil unseres Alltagsvokabulars. 16 Begriffe
14
So kommt es nur zwischen Rot und Orange bei einer Abdunklung zu
einem Wechsel des Farbtones uber die Helligkeitsveranderung, wir sehen diese Farben dann namlich als Braun, auBerdem scheinen Blau
und Griin einen groBeren Bereich des Farbspektrums einzunehmen als
~ot (Hardin 1997, Einwande bei Palmer 1999 und Nida-Riimelin
1998).
15 Baars 1997, Roth 1994.
16 cf. Pauen 1999d.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
wie Furcht, Freude, Trauer oder Ekel implizieren Annahmen
iiber Handlungstendenzen, die ein konstitutives Element der
emotionalen Erfahrung selbst ausmachen. Ekel beinhaltet eine
T endenz zur Zuriickweisung, im Extremfall zum Ausspeien
des ekelhaften Objektes; genauso scheint Furcht eine Neigung
zur Entfernung, Freude oder Verlangen eine Tendenz zur Annaherung einzuschliel5en. Wir wiirden daran zweifeln, ob jemand wirklich weil5, was mit Eke/ gemeint ist, wollte er behaupten, sein massiver Ekel sei es gewesen, der ihn zur Annaherung an ein Objekt veranlalSt hatte. Genausowenig wiirden
wir erwarten, dal5 ein Baby, das aufgrund einer „Emotionsinversion" von vornherein Schmerz statt Freude empfindet, so
reagieren wiirde wie ein normales Kincl: Anzunehmen ware
vielmehr, dalS es bei dem ersten heftigen Schmerz aufschreien
wiirde, auch wenn dieser Schmerz de facto durch ein Streicheln ausgelost worden sein mag.
Diese Annahmen sind bislang zumindest teilweise durch die
Emotionspsychologie bestatigt worden17 und es ist anzunehmen, dal5 es auch in Zukunft zu einer weiteren Prazisierung
und Korrektur dieser Annahmen kommen wird. In diesem
Falle miil5ten sich Bewul5tseinszustande auf die Dauer ganz
ahnlich durch relationale Beschreibungen erfassen lassen, wie
dies oben am Beispiel von Wasser demonstriert wurde. Wir
( miil5ten dann nur noch in neurobiologischen Beschreibungen
') \ die entsprechenden ,Gegenstiicke' finden, so wie H 2 0 das naturwissenschaftliche Gegenstiick zu W asser ist. W enn wir
dann erklaren konnten, wie das Gehirn diese Funktionen zu
realisieren vermag, dann hatten wir gleichzeitig auch die Bewul5tseinsprozesse erklart, schlielSlich haben wir diese ja zuvor
· durch genau diese Funktionen erfal5t. Solche relationalen Beschreibungen wiirden somit die gesuchte Briicke zwischen
psychologischen Theorien und der Perspektive der Neurobiologie bilden, sie wiirden es uns ermoglichen, neurobiologische
Erkenntnisse zur Beantwortung psychologischer Fragen heranzuziehen.18
17 cf. LeDoux 1996, Frijda 1993, Frijda et al. 1989, Plutchik 1993, Rolls
l8
1999; eine kritische Diskussion bei Meyer et al. 1993/1997.
Lewis 1966, 1972, Kim 1998.
101
Eine Ůberwindung der Erklarungsliicke ist offenbar prinzipiell moglich und es scheint, als wiirde der Philosophie dabei
eine wichtige Rolle zufallen: Zum einen kann sie helfen, Verwirrungen in der Fragestellung zu vermeiden, zum zweiten
kann sie auch aus einer Problemanalyse L6sungsstrategien
entwickeln. Als entscheidend hatte sich dabei zum einen die
Einsicht erwiesen, dalS es - unter den Pramissen der Identitatstheorie - nicht um das Verhaltnis zweier Prozesse, sondern um
die Beziehung zweier. Theorien ging, konkret um die Frage,
wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse fiir das Verstandnis
mentaler Prozesse genutzt werden konnen. Wichtig ist zweitens der Nachweis, dal5 relationale Beschreibungen eine Verbindung zwischen beiden Theorien herstellen konnen. Zwar
konnte die Frage, ob mentale Prozesse wirklich in solchen Beschreibungen erfalSbar sind, nicht abschliel5end beantwortet
werden, immerhin gibt es jedoch keine prinzipiellen Einwande
gegen einen solchen Versuch, vielmehr sprechen Erkenntnisse
der Emotionspsychologie ebenso wie funktionale Implikationen unserer Alltagsbegriffe von Emotionen fur die Erfolgsaussichten eines solchen Unternehmens.
4. Konsequenzen
Nehmen wir 'also an, es hatte sich herausgestellt, dal5 mentale
Phanomene physische Prozesse sind. Aul5erdem ware die „Erklarungsliicke" iiberwunden; fiir die Entstehung dieser Prozesse stiinden also Erklarungen zur Verfiigung, wie wir sie bei
physischen Prozessen im allgemeinen gewohnt sind.
Unter diesen Voraussetzungen waren unsere geistigen Prozesse „in Wirklichkeit" nur natiirliche Phanomene; menschliche Personen waren also in ihrer Bewul5tseinserfahrung und in
ihrer Subjektivitat Naturgesetzen unterworfen, die sich nicht
prinzipiell19 von denjenigen unterscheiden, die fiir Steine, ein19 Hier muE zwischen Identitatstheorie und physikalistischem Dualismus
unterschieden werden: Der ldentitatstheorie zufolge waren hier die
gleichen Gesetze wirksam, dem Dualismus zufolge, der ja physische
Phanomene eines neuen Typs postuliert, ki:innte man allenfalls von
,gleichartigen' Gesetzen sprechen.
102
Michael Pauen
fache Bakterien oder Computer gelten. Es sieht also so aus, als
wiirden Menschen sich nicht prinzipiell von solchen einfacheren Objekten oder Lebewesen unterscheiden. Mit welchem
V { Recht konnten wir dann aber noch daran festhalten, daB Men! schen, anders als diese einfachen Lebewesen oder Artefakte,
bewuBtseinsfahige und verantwortliche Subjekte sind?
Auch hier handelt es sich um eine Frage, die nicht nur Philosophen beschaftigt hat; dennoch handelt es sich um ein genuin philosophisches Problem. Es geht allerdings nicht - wie
in den beiden vorangegangenen Teilen - um Fragestellungen
und Voraussetzungen, die empirischen Erkenntnissen zugrunde liegen, vielmehr geht es .um die Konsequenzen, die zu erwarten waren, sollten sich die gemeinsamen Bemiihungen der
empirischen Wissenschaften und der Philosophie schlieBlich
als erfolgreich erweisen. Tatsachlich ist auch dieser Problemkomplex in der Philosophie immer wieder mit Nachdruck diskutiert worden. Dabei handelt es sich im einzelnen um drei
miteinander zusammenhangende Fragen. Sie betreffen die
, . , ·rt. Realitat von BewuBtsein, den Status von Subjektivitat und
tN•<'<"' .i. schlieBlich das Problem der Willensfreiheit. Fragen der
iJ1t~~f>.•'-~ Subjektivitat haben die neuere Philosophie seit dem
1
Florentiner Neuplatonismus immer wieder beschaftigt, das
Problem der Willensfreiheit spielt schon bei Augustinus, in
Ansatzen sogar bei Aristoteles eine Rolle. Demgegeniiber ist
die Frage nach der Realitat des BewuBtseins erst in der letzten
Zeit in den Mittelpunkt getreten. Immerhin lagt sich hier
jedoch die konkreteste Antwort geben. Hinsichtlich der
beiden anderen Fragen fehlen bislang nicht nur die
empirischen Erkenntnisse, auch in der Philosophie sind die
moglichen Antworten noch heftig umstritten. Dennoch diirfte
sich ein Úberblick liber diese Diskussion als fruchtbar
erweisen, weil er dazu beitragen kann, fehlerhafte
Fragestellungen und Vereinfachungen zu vermeiden.
Zunachst also zu der Frage, ob eine naturwissenschaftliche
Erklarung mentaler Prozesse die Realitat des BewuBtseins in
Frage stellt. Die zugrundeliegenden Úberlegungen sind recht
einfach und haben auf den ersten Blick auch eine gewisse
Plausibilitat: Wenn wir eine solche naturwissenschaftliche Er-
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
103
klarung hatten, dann wiiBten wir endlich, was BewuBtsein „in
Wirklichkeit" ist.
Vertreten worden ist diese Argumentation mit groBem
Nachdruck durch den sogenannten Eliminativen Materialismus, den zumindest zeitweilig Autoren wie Willard V. O.
Quine (1966b), Paul Feyerabend (1963b), Richard Rorty
(1965, 1970a, 1970b), sowie insbesondere Paul Churchland
(1979) auf ihre Fahnen geschrieben haben. Churchland zufolge ist unsere Úberzeugung, daB es so etwas wie bewuBte Phanomene gibt, das Postulat einer vorwissenschaftlichen Theorie, der sogenannten ,Alltagspsychologie'. Ahnlich wie andere
Alltagstheorien wurde sie entwickelt, um Prognosen und Erklarungen fiir Geschehnisse zur Hand zu haben, denen wir im
Alltag begegnen, in diesem Falle eben fiir das Verhalten anderer Personen. Um dieses Verhalten zu erklaren, habe es sich als
zweckmaBig erwiesen, unseren Mitmenschen Wiinsche und
Bediirfnisse zuzuschreiben. Erst spater hatten wir dann die
Úberzeugung ausgebildet, selbst solche BewuBtseinserfahrungen zu machen. Eine ausgearbeitete neurobiologische Theorie
werde allerdings aussagekraftigere Erklarungen und genauere
Prognosen ermoglichen. Damit werde nicht nur die Alltagspsychologie iiberfliissig, vielmehr wiirden sich auch die von
ihr postulierten BewuBtseinszustande als verzichtbar erweisen.
Unsere Nachfahren diirften daher nur noch von neuronalen
Zustanden sprechen, ja sie wiirden auch nur solche Zustande
erfahren - auf unsere Glaubenszustande und Wiinsche miiBten
sie genauso mitleidig herabsehen, wie wir heute auf die Essenzen der Alchimie, das Phlogiston oder den Warmestoff.
Die philosophische Diskussion der letzten Jahre hat einige
schwerwiegende Einwande gegen den Eliminativen Materialismus hervorgebracht. Erwahnen mochte ich hier nur, daB
auch der Eliminative Materialist irgendeine Art von Zugang
zu seinen neuronalen Prozessen gewinnen muB - doch dazu
ben6tigt er schon wieder jene BewuBtseinszustande, deren
Existenz er jedoch nicht akzeptiert.
Es kommt hinzu, daB er an seine Theorie glauben muB.
Leider bestreitet seine Theorie jedoch die Realitat von Glaubenszustanden. Genausowenig erscheint es nachvollziehbar,
daB eine Gesellschaft, die Wiinsche und Bediirfnisse nicht
?f tt4 /
---
i
tt
104
Michael Pauen
selbst aus der Perspektive der ersten Person kannte, den Verweis auf solche ihr vóllig fremden Zustande als Erklarung fur
ein bestimmtes Verhalten akzeptiert haben sollte. 20
Aus diesen und anderen Einwanden ergibt sich nun allerdings nicht, daB der Eliminative Materialismus als ein weiterer
Beleg fur die Nutzlosigkeit philosophischer Spekulation abgetan werden kann. Entscheidend ist vielmehr, daB diese Theorien - letztlich gegen den Willen ihrer Autoren - deutlich gemacht haben, zu welch ~~~g~~~E-ID~­
schrankung auf rein~~l~-~!.1-~c;b;iťtlifhc::..~a.g~__fiip.tJ. Da~sicnmCllt nur, da/5 es wenig sinnvoll ist, die Realitat
des BewuBtseins abzustreiten, vielmehr wird hier auch deutlich, warum dies der Fall ist. Entscheidend ist, daB wir auch
fur den Zugang zu neuronalen Prozessen bereits die Existenz
von BewuBtseinszustanden voraussetzen miissen.
f/
Genauso wichtig ist allerdings die grundsatzliche Einsicht,
f ~ ' • daB eine neurobiologische Erklarung mentaler Zustande noch
nicht zeigt, daB es sich hier „in Wirklichkeit" um physische
und „eigentlich nicht" um mentale -Prozesse handelt. Die wissenschaftstheoretische Diskussion iiber das Verhaltnis von unterschiedlichen Theorien, die sich auf einen Gegenstandsbereich beziehen, hat vielmehr gezeigt, daB es keinen Grund
gibt, eine psychologische Theorie zu verwerfen, nur weil wir
denselben Sachverhalt auch physiologisch erklaren kónnen. 21
Die Realitat des BewuBtseins laBt sich also nur schwer bestreiten. Mit dieser Einsicht ist allerdings noch nicht viel gewonnen, solange es uns darauf ankommt, den besonderen Status
menschlicher Personen gegeniiber solchen Lebewesen oder Systemen zu begriinden, die wir nicht als Personen akzeptieren
wiirden, obwohl sie, wie etWa hóhere Tiere, durchaus iiber
BewuBtsein verfugen mógen. Ein entscheidendes Kennzeichen
einer Person scheint vielmehr zu sein, daB sie iiber so etwas
wie Subjektivitat verfugt, d.h. daB sie sich selbst als einer Person mit einer bestimmten Lebensgeschichte und mit bestimmten charakteristischen- Merkmalen bewuBt ist, und daB sie die
20 cf.
21
Pauen 1996a.
McCauley 1986, 1981.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
105
von ihr initiierten Handlungen als eigene Handlungen erkennt
unci damit auch die Verantwortung fur diese Handlungen
iibernehmen kann. 22
Die Diskussion ZU dieser Frage wird - wie bereits erwahnt
- bis heute sehr kontrovers gefuhrt, unci ein Ende dieser Kontroverse ist derzeit nicht in Sicht. Autoren wie Manfred Frank
(1991) und Dieter Henrich (1970) verweisen darauf, daB wir
immer schon iiber ein unmittelbares, „prareflexives" BewuBtsein von uns selbst verfugen miissen, bevor wir uns irgendeine
Eigenschaft zuschreiben kónnen: Ein Selbst zu sein, sei keine
Eigenschaft und auch keine Konstellation von Eigenschaften,
von der ich irgendwann einmal erfahren kann, daB sie auf
mich zutrifft. Ganz im Gegenteil miisse ich mich schon auf
mich selbst beziehen konnen, bevor ich irgendeine Eigenschaft
sinnvoll als meine Eigenschaft begreifen kann. 23
Dieses Argument erscheint plausibel, man mag dennoch
zweifeln, ob das prareflexive Selbst wirklich all das umfaBt,
was wir meinen, wenn wir von Subjektivitat sprechen, schlieBlich stellt es nur eine Voraussetzung fur die Selbstzuschreibung
von konkreten Eigenschaften dar. Offensichtlich verstehen wir
unter einem ,leh' aber mehr, namlich so etwas wie einen vergleichsweise stabilen Kern der Eigenschaften und Ereignisse,
die wir uns zuschreiben. Genau dies kann das von Frank postulierte prareflexive Selbst jedoch nicht gewahrleisten,
schlieBlich geht es jeder Zuschreibung von Eigenschaften voraus. Seinerseits enthalt es jedoch keinerlei Festlegung auf irgendeine konkrete Eigenschaft und vermag daher auch grundlegende Veranderungen der personalen Eigenschaften nicht
auszuschlieBen. 24
22
cf. Fischer 1994, Peter F. Strawson 1972
So stellt Frank fest, "daB wir SelbstbewuBtsein anders zu beschreiben
haben denn als ein BewuBtsein von etwas, wobei ,etwas' hier for einen
einzelnen Gegenstand namens Selbst (oder leh oder auch Person)
stiinde. SelbstbewuBtsein ist nicht gegenstandlich, seine Vertrautheit
ist iiber kein zweites Glied vernůttelt, sein urspriinglicher Vollzug geschieht irreflexiv, kriterienfrei und beruht auch nicht auf teilbaren
Wahrnehmungsbefunden." Frank 1992, 5.
2 4 cf. Galen Strawson 1997.
23
106
Michael Pauen
Tatsachlich setzen die Skeptiker an genau diesen Punkten
an. Zum einen gibt es sowohl auf der theoretischen wie auf
der empirischen Ebene eine ganze Reihe von Indizien, die gegen die Annahme sprechen, es gebe einen realen Kern von
Subjektivitat, der zum Gegenstand innerer Beobachtung werden konnte. Egal, ob man sich auf die neuronale oder auf die
kognitive Ebene bezieht, so scheint Subjektivitat das Produkt
eines dezentralen, konstruktiven Prozesses zu sein, der die unterschiedlichen und zum Teil sogar widerspriichlichen Motive,
Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erkenntnisse25 zu einem
,Selbstmodell' 26 integriert. AuBerdem sprechen einige vor allem von Dennett und Kinsbourne (1992) vorgelegte empirische Ergebnisse fiir die Annahme, daB wir zumindest innerhalb eines - allerdings recht engen - zeitlichen Rahmens unsere Selbstzuschreibungen andern, ohne uns dessen bewuBt ZU
sem.
Die Konsequenzen aus diesen Beobachtungen sind Gegenstand einer immer noch andauernden philosophischen Debatte. Wahrend das Selbst fiir Dennett eine bloBe Fiktion ist, 27
stellt es fiir Frank den Mittelpunkt von Erkenntnis und Erfahrung dar. 28 Ohne hier direkt Stellung zu nehmen, mochte ich
doch zumindest auf eine Option hinweisen, die es erlaubt, sowohl an der Realitat des Ichs festzuhalten wie auch den relevanten empirischen Erkenntnissen gerecht zu werden. Statt
das leh als eine feste GroBe oder gar als eine Art von Objekt
zu betrachten, kann man es namlich - in Anlehnung an ~29
25 cf.
Gazzaniga & LeDoux 1978, Nisbett & Wilson 1977, Minsky
1990.
26 cf. Metzinger 1993.
27 "The self .„ turns out to be a valuable abstraction, a theorisťs fiction
rather than an interna! observer or boss. If the self is ,jusť the Center
of Narrative Gravity „. then, in principie, a suitably ,programrneď
robot, with a silicon-based computer brain, would be conscious,
would have a self." Dennett 1991, 431.
28 "lst Subjektivitat nicht in der Tat der helle Punkt, von dem aus sich
Licht verbreitet iiber alle unsre Bezugnahmen auf Gegenstiinde und
Verhaltnisse der Welt?" Frank 1992, 7.
29 "Denn das empirische BewuEtsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identi-
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
107
- auch als das Produkt einer integrativen Leistung sehen. In
diesem Falle kann man sowohl den konstruktiven Charakter
von Subjektivitat wie die Abwesenheit eines „wirklichen Zentrums" akzeptieren, ohne daB sich daraus ein Argument gegen
die Realitat des Ichs ergeben wiirde. Statt dessen laBt sich
vermuten, daB aus der integrativen Leistung ein „Selbstkonzept" hervorgeht, das neben konkreten Charaktertnerkmalen
beispielsweise auch das Wissen um die eigene Lebensgeschichte enthalten kann. Aus ihm lassen sich Aussagen iiber die eigene Person ableiten, gleichzeitig erlaubt es die Zuschreibung
weiterer Eigenschaften und Episoden. Gewisse Korrekturen an
schon vorgenommenen Zuschreibungen, aber auch Spannungen unter den Eigenschaften, die man sich selbst zuschreibt,
wiirden dabei noch keine Zweifel an der Realitat des Selbst
begriinden.30
Keineswegs werden damit samtliche Zweifel an der Existenz von Subjektivitat beseitigt. Dennoch laBt sich der Eindruck nicht ganz vermeiden, daB d~Suhj~.kt von ei,!!!.gen Au- I
toren e_nYas voreilig zu Grab,e g.e!!.!1-g.e~ge. Der Nachweis,
daB es kein ,inneres Objekt' namens ,leh' gibt, reicht fiir eine
Widerlegung der Subjektivitat genausowenig wie gewisse Unstimmigkeiten in der Selbstzuschreibung von Episoden und
Eigenschaften.
Ganz ahnliche Probleme treten auf, wenn man nach den empirischen Indizien fiir das dritte zentrale Moment unserer Konzeption von Personalitat, die Willensfreiheit, fragt. Wir gehen
im allgemeinen davon aus, daB man einer Person Handlungen
zuschreiben und sie gegebenenfalls fiir eine Handlung auch
tat des Subjects. Diese Beziehung geschieht also dadurch noch nicht,
daE ich jede Vorstellung mit BewuEtsein begleite, sondern daE ich cine zu der andern hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewuBt
bin. Also nur dadurch, daE ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in cinem BewuEtsein verbinden kann, ist es moglich, daE ich
mir die Identitat des BewuEtseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d.i. die analytische Einheit der Apperception ist nur unter der
Voraussetzung irgend einer synthetischen moglich." Kant 1956, 142b
(KrV, B 133).
30 cf.
Pauen 2000b.
~ ll:t! ; ! I
•1. -
f -
1
eti..
-
bl"'<h'lrnc"-' ;
108
~w..&~ ?~ !t fa.;. "-'" IGJ...r./*4/Q.;J.l·,y... v~..t.
.:...
toc·-11.t
#
.J -~
ov•<
( cN~()L·, ,.,,.._, /
T't.
~
• '
•
~dJJJ
~ ~
~""! .,,,..~„ 1'."ÍJ,tc.~ ·~y< , / lt.?'i< /<:t..<:'J"'-~{ •
;:K;"
k.t/~«A-}
'
Michael Pauen
verantwortlich machen kann. Dies scheint allerdings vorauszusetzen, daB sich die Person auch gegen diese Handlung hatte
entscheiden konnen.
Auch dieses Problem ist in der philosophischen Diskussion
nach wie vor heftig umstritten, dennoch gibt es einige wichtige Argumente, die in Betracht gezogen werden sollten, wenn
es um empirische Indizien fiir oder gegen die Freiheit des Willens geht. Besondere Bedeutung hat dabei die Frage, ~­
terministische Natur . esetze die 6.glic~ Willensfrei;; eit ausschlieBen: Wenn BewuBtsein, so wie zu Beginnaíešes
Abschnittes angenommen, ein physischer ProzeB ist, der der
Geltung von Naturgesetzen unterliegt, dann scheint es keine
freien Entscheidungen geben zu konnen. Menschlichen Wesen
wiirde also ein zentraler Aspekt von Personalitat fehlen, namlich die Fahigkeit zu freiem und verantwortlichem Handeln.
Bei naherer Betrachtung zeigt sich, daB auch diese SchluBfolgerung voreilig ist. Notwendig ist zunachst eine Verstandigung dariiber, was iiberhaupt gemeint ist, wenn man von
,Freiheiť spricht. Unterscheiden lassen sich zwei wichtige Varianten: Zum einen die sogenannte Haudlun,~sfreiheit. Frei in
diesem Sinne ist eine Person dann, wenn sie so handeln kann,
wie es ihren Willensentscheidungen entspricht. Eingeschrankt
wird die Handlungsfreiheit in der Regel durch auBere Zwange; typische Beispiele waren die Situation eines Strafgefangenen oder aber die eines physisch Abhangigen, der gegen seinen
Willen weiter zu seiner Droge greifen muK
Einen wesentlichen Schritt weiter geht der Begriff der Willensfreiheit. Hier wird auch gefragt, ob die der Handlung
zugrundeliegende Entscheidung frei ist, ob die Entscheidung
also auch anders hatte ausfallen konnen. Hier geht es ničlit
nur um auBere Zwange, sondern ebenso um psychische Einfliisse: Auch wenn ich nicht unter externen Zwangen stehe,
kann meine Entscheidung durch meine psychischen Eigenschaften, meine Erziehung und meine Anlagen so bestimmt
werden, daB eine andere Option de facto nicht mehr offen
steht: leh hatte midi also nicht anders entscheiden konnen.
Willensfreiheit setzt daher voraus, daB ich in einem letzten
Sinne der Urheber meiner Handlungen bin. Auch wenn alle
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
109
auBeren Umstande vollig identisch waren, miiBte ich imstande
sein, mich anders zu entscheiden.
Genau dies scheint jedoch durch den Determinismus ausgeschlossen zu werden: Wenn Entscheidungsprozesse wie andere
mentale Prozesse auch physische Prozesse sind, dann unterliegen sie den Naturgesetzen. Sofern es sich hier um deterministische Gesetze handelt, bestehen im konkreten Fall offenbar
keine Entscheidungsalternativen. 31 Auf der anderen Seite fragt frt> ~
sich aber auch, ob eine Zuriickweisung des Determinismus i,.-f •.iť.J
oder der Nachweis, daB mentale Prozesse keine physischen
Prozesse sind, unseren Spielraum fiir freie Entscheidungen
vergroBern konnten.
In den letzten Jahren hat es jedoch gerade in diesem Punkt
wesentliche Einwande gegeben: Zum einen liegt hier offenbar
ein MiBverstandnis uber die Rolle von Naturgesetzen vor:
Diese IJ§stimmen nich.t etwa das Verhalten von Planeten, fallenden Kugeln oder Neuronen oder zwingen ihnen gar ein
Verhalten auf, das diese am Ende gar nicht ,wollten', vielmehr
beschreibe.tJ.. sie nur, was diese Objekte ,von sich aus' tun. 32
Auf der anderen Seite wiirde auch der bloBe Wegfall deterministischer Reaktionszusammenhange - beispielsweise im Gehirn - uns keinesfalls berechtigen, von einer ,freien Handlung'
zu sprechen; es scheint vielmehr, daB wir es dann nur mit einem zufiilligen Geschehen zu tun haben. Insofern diirften sich
die vielfach geauBerten Hoffnungen auf makroskopische Konsequenzen der Quantenphysik33 als triigerisch erweisen. Von
einer freien Handlung verlangen wir schlieBlich nicht nur, daB
sie nicht determiniert ist, notwendig ist auch, daB wir selbst es
waren, die die Entscheidung getroffen haben. Genau diese
Form von Selbstbestimmung kann durch den bloBen Wegfall
des Determinismus offenbar nicht gewahrleistet werden.
Dies scheint auf den ersten Blick in ein Dilemma zu fiihren:
Wenn der Determinismus gilt, sind wir offenbar nicht frei,
weil unsere Handlungen durch Naturgesetze bestimmt werden; gilt der Determinismus nicht, dann bleibt uns nur der
31 cf.
32 cf.
Van Inwagen 1982
Schlick 1978.
33 Kane 1989.
110
Michael Pauen
Z!!f.all. T atsachlich kann es eine Handlung, die in einem letzten Sinne selbstbestimmt ist, gar nicht geben: Um iiberhaupt
irgendeine freie Entscheidung treffen zu konnen, miissen wir
bereits iiber bestimmte Minimalvoraussetzungen verfiigen,
1-. \ doch wir konnen nicht der Urheber dieser Voraussetzungen,
f also letztlich unser eigener Urheber sein. 34
Nagel (1986, 1990) und Galen Strawson (1989) haben
daraus gefolgert, die Existenz freier Handlungen sei prinzipiell
ausgeschlossen, und zwar ganz unabhangig davon, wie die
physische Realitat nun beschaffen ist. Es waren damit also
keine empirischen Erkenntnisse, sondern theoretische Einsichten, die gegen die Realitat von Freiheit sprechen. Bei naherer
Betrachtung zeigt sich jedoch, daíS man hieraus auch ein wichtiges Argument far die Freiheit ableiten kann: Wenn von
vornherein klar ist, daíS Freiheit in dem oben skizzierten Sinne
noch nicht einmal theoretisch moglich ist, dann handelt es sich
vielleicht gar nicht um eine sinnvolle Erklarung dessen, was
J,-.C
. wir meinen, wenn wir von „freien Handlungen" sprechen. Es
5.f'~
scheint vielmehr, als sei diese Konzeption von Freiheit in sich
\ selbst unstimmig; sie kann daher keinen sinnvollen MaíSstab
I fiir unser Urteil iiber die Existenz freier Handlungen bilden.
Doch gibt es hierzu eine Alternative? Freiheit, so wurde
oben gesagt, ist Selbstbestimmung. Dann allerdings scheint es
kaum sinnvoll, die Úberzeugungen, Wiinsche und sonstigen
Eigenschaften der Person, die sich hier selbst bestimmt, als
Einschrankungen ihrer Freiheit zu begreifen. Wenn es also zu
meinen ureigensten Úberzeugungen gehort, daíS Diebstahl
verwerflich ist, do daB man sagen konnte, diese Úberzeugung
bilde einen Teil dessen, was konstitutiv fiir mein „Selbst" ist,
dann wiirde man eine Handlung, die dieser Ůberzeugung
folgt, nicht als unfrei bezeichnen konnen. Insofern scheint sich
eine Moglichkeit abzuzeichnen, solche Entschliisse als „frei"
zu bezeichnen, die aus den personalen Merkmalen des Han• delnden hervorgehen. 35
Damit ist die Entscheidung iiber die Existenz freier Handlungen wieder an die empirischen Wissenschaften zuriickver-
(1
34 cf. Galen Strawson 1989, Nagel 1986, 1990.
35 cf. hierzu ausfiihrlicher: Pauen 2001b
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
111
wiesen: Sollte es bewuBte Entschliisse geben, die sich auf personale Merkmale wie Úberzeugungen oder Charaktereigenschaften zuriickfiihren lassen, dann waren die aus diesen Entschliissen hervorgehenden Handlungen tatsachlich frei.
Die bereits erwahnten Ergebnisse von Benjamin Libet werfen hier jedoch ein schwerwiegendes Problem auf: Aus seinen
Experimenten scheint sich namlich zu ergeben, daíS unser
Handeln eben nicht von unseren bewuBten Entschliissen, sondern von vorbewuBt ablaufenden neuronalen Prozessen, namlich dem Aufbau des Bereitschaftspotenrials abhangt. Erst infolge dieser Aktivitat entstiinde dann <las - illusorische - BewuBtsein, eine Entscheidung getroffen ZU haben. Damit ware
eine zentrale Bedingung des skizzierten Begriffes von Freiheit
verletzt: Die eigentlich Entscheidung scheint nicht auf personalen Merkmalen zu basieren, sondern auf vorbewuBten, neuronalen Prozessen. Das BewuBtsein, eine Entscheidung zu treffen, wiirde erst dann entstehen, wenn die Handlung schon
eingeleitet, die Entscheidung somit getroffen ist. Von Selbstbestimmung konnte aiso keine Rede sein, vielmehr waren wir in
· unseren Entscheidungen abhangig von neuronalen Prozessen. 36
Libets Ergebnisse sind allerdings aus unterschiedlichen
Griinden umstritten: 37 Zum einen ist nicht klar, ob es wirklich, so wie von ihm angenornmen, einen genau besrimmbaren
Moment der Entscheidung gibt, oder ob Entscheidungen nicht
eher prozessualen Charakter haben. In diesem Falle konnte
der Aufbau des Bereitschaftspotentials von bewuBten Vorentscheidungen abhangen, die bereits vor dem Einsetzen der von
ihm vorgenommenen Messungen gefallen waren. Es kommt
hinzu, daB Libet (1985) selbst die Existenz eines bewuBten
„Vetos" belegen zu konnen glaubt, <las die Handlung noch bis
wenige Millisekunden vor der eigentlichen Ausfiihrung zu
verhii:de~n vermag. Wiird: man die Freiheit an die lJ.nterla.B- ~
barke1t emer Handlung bmden, dann ware also auch unter
36 cf. Roth 1998,
37 Siehe dazu die
Birnbacher 1995.
Diskussion im AnschluE an Libet (1985) sowie Gomes
1999, Walter 1998, 299-308 und Hartmann 1998, 242-244.
112
X
Michael Pauen
den von Libet beschriebenen Bedingungen ein zentrales Kriterium freier Handlungen erfiillt.
Offensichtlich ist auch bereits fiir die Interpretation der
Ergebnisse Libets eine Verstiindigung dariiber notwendig, was
denn ilberhaupt unter einer Entscheidung zu verstehen ist.
Handelt es sich um einen momentanen Akt, der zeitlich auf
Millisekunden genau zu verorten ist, oder haben wir es mit einem ProzeB zu tun, der sich uber einen mehr oder weniger
genau bestimmbaren Zeitraum erstreckt und sich moglicherweise in mehrere Phasen unterteilen laBt? Mehr noch diirfte
die Notwendigkeit einer solchen Verstiindigung fiir die Frage
nach der Willensfreiheit im allgemeinen gelten: Offenbar ist
die Suche nach empirischen Belegen fiir die Existenz freier
Handlungen solange problematisch, wie wir nicht wissen, was
denn iiberhaupt die entscheidenden Kriterien eines freien Willensaktes waren. Von besonderer Bedeutung diirfte dabei die
Frage sein, wie wir mit den Problemen umgehen, die sich aus
der traditionellen Vorstellung einer vollstiindig freien bzw.
selbstbestimmten Handlung ergeben.
Unnotig sein dilrfte dabei der Hinweis, daB solche philosophischen Diskussionen sich immer eng an den vorliegenden
empirischen Ergebnissen orientieren miissen: Eine iiberzeugende und fiir die Interpretation der Experimente Libets rele} vante Antwort auf die Frage nach dem Ablauf eines Entschei\ dungsprozesses wird man trivialerweise nur von Theoretikern
erwarten konnen, die diese Experimente kennen.
5. Fazit
Es scheint also, als wilrde die Philosophie des Geistes nicht
nur milBige Spekulationen anstellen, die friiher oder spater
durch solide wissenschaftliche Erkenntnisse ersetzt werden.
Philosophische Úberlegungen konnen offenbar bei der Interpretation empirischer Ergebnisse helfen, indem sie die Konsequenzen und Voraussetzungen der einzelnen Varianten deutlich machen, sie konnen aber auch dazu beitragen, Fehler in
Fragestellungen aufzuspiiren oder Erklarungsstrategien zu
entwickeln, schlieBlich kann die Philosophie auch versuchen,
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
113
die kiinftigen Entwicklungen und ihre mutmaBlichen Konsequenzen zu skizzieren. Dabei geht es nicht um philosophische
Science-Fiction, sondern um ein Abschatzen der Konsequenzen der wahrscheinlichsten Entwicklungen - in dem oben vorgestellten Fall also um die Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen die zu erwartenden Erkenntnisse in den Neuround Kognitionswissenschaften zu fundamentalen Veriinderungen des menschlichen Selbstverstiindnisses fiihren konnen.
Natiirlich wird es .in vielen Fallen moglich und oft sogar
sehr sinnvoll sein, empirische Untersuchungen so zu gestalten,
daB die philosophisch relevanten Fragen nicht beriihrt werden. Schwierig diirfte dies allerdings werden, sobald die fundamentalen Proble'me des Zusammenhangs von Geist und Gehirn betroffen sind. Es ist heute sicherlich noch nicht klar, ob
wir auf diese Fragen einmal eine zufriedenstellende Antwort
finden werden. Sollte dies aber moglich sein - und einiges
spricht dafiir - dann dilrfte die Philosophie des Geistes daran
nicht ganz unbeteiligt sein.
114
Michael Pauen
6. Literatur
Baars, B. J., (1996) Understanding Subjectivity: Global Workspace
Theery and the Resurrection of the Observing Seif. Journal of
Consciouness Srudies 3: 211-216.
(1997) In the Theatre of Consciousness. Global Workspace
Theery. A Rigorous Scientific Theery of Consciousness.
Journal of Consciousness Studies 3: 292-309.
Barinaga, M. (1997) New lmaging Methods Provide a Better View
lnto the Brain. Science 276: 1974-1976.
Bieri, P. (1982) Nominalismus und innere Erfahrung. Zeitschrift fiir
philosophische Forschung 36: 3-24.
(1989) Schmerz: Eine Fallsrudie zum Leib-Seele-Problem. ln:
Poppe! (Hg.) Gehirn und Bewugtsein.
(1992a) Was machr Bewugtsein zu einem Ratsel? Spektrum der
Wissenschaft, Oktober 1992: 48-56.
(1992b) Trying Out Epiphenomenalism. Erkennmis 36: 283309.
Bieri, P. (Hg.) (1987) Analytische Philosophie der Erkenntnis.
Weinheim.
(1993) Analytische Philosophie des Geistes. Bodenheim.
Birnbacher, D. (1990) Das ontologische Leib-Seele-Problem und seine
epiphanomenalistische Li:isung. ln: Biihler, K.-E. (Hg.),
Aspekte des Leib-Seele-Problems. Philosophie, Medizin,
Kiinstliche lntelligenz. Wiirzburg.
(1995) Die philosophische Brisanz der Neurowissenschaften
wird unterschatzt. ln: Ethik und Sozialwissenschaften 6: 8385.
Block, N. (Hg.) (1980) Readings in Philosophy of Psychology. 2 Bde.
London.
Bubner, R. (Hg.) (1970) Hermeneutik und Dialektik. Aufsatze (H.-G.
Gadamer zum 70. Geburtstag.). Tiibingen.
Carrier, M. & Mittelstr~, J. (1989) Geist, Gehirn, Verhalten. Das
Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie.
Berlín New York.
Chalmers, D. J. (1995) Facing up to the Problem of Consciousness.
Journal of Consciousness Srudies 2: 200-219.
(1996a) The Conscious Mind. In Search of a Fundamental
Theery. New York Oxford.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
115
(1996b) Das Ratsel des bewugten Erlebens. ln: Spektrum der
Wissenschaft, Februar 1996: 40-47.
Churchland, P. M. (1979) Scientific Realism and the Plasticity of
Mind. London New York Melbourne.
(1981) Eliminative Materialism and the Propositional
Attirudes. ln: Goldman, Readings in Philosophy.
(1985) Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of
Brain States. Journal of Philosophy 82: 8-i8.
(1988) Perceptual Plasticity and Theoretical Neutrality: A
Reply to Jerry Fodor. ln: Goldman, Readings in Philosophy.
(1992) Matter and Consciousness. A Contemporary
lntroduction to the Philosophy of Mind. Cambridge MA
London.
(1995) The Engine of Reason, the Seat of the Soul. A
Philosophical Journey into the Brain. Cambridge MA London.
Churchland, P. S. (1996) The Hornswoggle Problem. ln: Journal of
Consciousness Srudies 3: 402-408.
Clark, A. (1993): Sensory Qualities. Oxford.
Cross, S. A. (1994) Pathophysiology of Pain. Mayo Clinic Proceedings 69: 375-383.
Davidson, D. (1970) Mentale Ereignisse. In: Bieri, Analytische
Philosophie des Geistes.
(1993) Thinking Causes. ln: Heil & Mele, Mental Causation.
Davies, M. & Humphreys, G. W. (Hg.) (1993) Consciousness.
Psychological and Philosophical Essays. Oxford Cambridge
MA.
Dennett, D. C. (1982) Mechanism and Responsibility. In: Watson,
Free Will.
(1991) Consciousness Explained. Boston New York Toronto.
Dennett, D. C. & Kinsbourne, M. (1992) Time and the observer: The
Where and When of Consciousness in the Brain. The
Behavioral and Brain Sciences 15: 183-247.
Dubois-Reymond, E. (1974) Vortrage uber Philosophie und
Gesellschaft. Hamburg.
Esken, F. & Heckmann, H. D. (1998) Bewugtsein und
Reprasentation. Paderborn.
Feigl, H. (1967) The ,Mental' and the ,Physical'. The Essay and the
Postscript. Minneapolis.
116
Michael Pauen
Feyerabend, P. K. (1963a) Materialism and the Mind-Body Problem.
ln: Christensen & Turner, Folk Psychology.
(1963b) Mentale Ereignisse und das Gehirn. In: Bieri,
Analytische Philosophie des Geistes.
Fischer, J. M. (1994) The Metaphysics of Free Will. An Essay on
Control. Oxford Cambridge.
Flohr, H. (1993) Die physiologischen Bedingungen des BewuEtseins.
ln: Lenk & Poser, Neue Realitaten.
(1994) Denken und BewuEtsein. ln: Fedrowitz, Matejovski,
Kaiser, Neuroworlds.
Frank, M. (1991) SelbstbewuEtsein und Selbsterkenntnis. Essays zur
analytischen Philosophie der Subjektivitat. Stuttgart.
(1994a) Vorwort. ln: ders., Analytische Theorien.
(1994b) SelbstbewuBtsein und Rationalitat. In: Kolmer &
Korten Grenzbestimmungen.
Frank, M. (Hg.) (1991) SelbstbewuEtseinstheorien von Fichte bis
Sartre. Frankfurt.
(1994) Analytische Theorien des SelbstbewuBtseins. Frankfurt.
Frankfurt, H. G. (1969) Alternate Possibilities and Mora! Responsibility, in: Journal of Philosophy 66.
(1971) Freedom of the Will and the Concept of a Person, in:
Journal of Philosophy 68, dt. in Bieri, Analytische Philosophie
des Geistes.
(1988a) Identification and Wholeheartedness, in: ders., The
lmportance of What We Care About.
(1988b) The Importance of What We Care About. Philosophical Essays. Cambridge.
(1999) Necessity, Volition, and Love. Cambridge.
Frijda, N. H. (1993) Moods, Emotion Episodes, and Emotions. In:
Lewis & Haviland, Handbook of Emotions.
Frijda, N. H., Kuipers, P., ter Schure, E. (1989) Relations Among
Emotion, Appraisal, and Emotional Action Readiness. Journal
of Personality and Social Psychology 57: 212-228.
Gazzaniga, M. S. & LeDoux, J. E. (1978) The Integrated Mind. New
York London.
Goldman, A. I. (Hg.) (1993) Readings in Philosophy and Cognitive
Science. Cambridge MA London.
Gomes, G. (1999) Volition and the readiness potential. Journal of
Consciousness Studies 6: 59-66.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
117
Haggard, P. & Eimer, M. (1999) On the Relation Berween Brain
Potentials and the Awareness of Voluntary Movements.
Experimental Brain Research 126: 128- 133.
Hardin, C. L. (1987) Qualia and Materialism. Closing the
Explanatory Gap. Philosophy and Phenomenological Research
47: 281-298.
(1990) Color and Illusion. ln: Lycan, Mind and Cognition.
(1997) Reinverting the Spectrum. ln: Byrne & Hilbert,
Readings on Color, Bd. I.
Hartmann, D. (1998) Philosophische Grundlagen der Psychologie.
Darmstadt.
Heil, J. & Mele, A. (Hg.) (1993) Menta! Causation. Oxford.
Henrich, D. (1970) SelbstbewuEtsein. Kritische Einleitung in cine
Theorie. In: Bubner, Hermenutik und Dialektik Bd. I.
Jackson, F. (1982) Epiphenomenal Qualia. Philosophical Quarterly
32: 127-136.
Kane, R. (1989) Two Kinds of Incompatibilism. Philosophy and Phenomenological Research 1: 219-254.
Kant, I. (1956) Kritik der reinen Vernunft. Hamburg.
Kim, J. (1966) On the Psycho-physical Identity Theory. American
Philosophical Quarrerly 3: 227-235.
(1989) The Myrh of Nonreductive Materialism. ln: Warner &
Szubka, The Mind-Body-Problem.
(1990a) The Nonreductivisťs Troubles With Menta!
Causation. In: ders., Supervenience.
(1990b) Postscripts on Menta! Causation. ln: ders.,
Supervenience.
(1993c) Noncausal Connections. ln: ders., Supervenience.
(1996) Philosophy of Mind. Boulder.
(1998) Mind in a Physical World. An Essay on the Mind-Body
Problem and Menta! Causation. Cambridge.
(im Druck): Reduction, Reductive Explanation, and the
Explanatory Gap: A Current Perspective on Physical
Explanation of Mentality.
Kleinschmidt, A. (2000), Wahrnehmungskoirrelierte Hirnaktivitat.
ln: Newen & Vogeley, Selbst und Gehirn.
Kripke, S. A., (1993) Name und Norwendigkeit. Frankfurt.
(1994) Identitat und Norwendigkeit. In: Frank, Analytische
Theorien.
118
Michael Pauen
Lanz, P. (1996) Das phanomenale BewuBtsein. Eine Veneidigung.
Frankfurt.
LeDoux, ]. E. (1996) The Emotional Brain. The Mysterious
Underpinnings of Emotional Life. New York.
Leibniz, G. W. (1979) Monadologie. Ůbers. und eingel. v. Hermann
Glockner. Stuttgan.
Lenk, H. & Poser, H. (Hg.) (1995) Neue Relitaten Herausforderung der Philosophie. XVI. Deutscher KongreB fur
Philosophie. Vonrage und Kolloquien. Berlin.
Levine, J. (1983) Materialism and Qualia: The Explanatory Gap.
Pacific Philosophical Quanerly 64: 354-361.
(1991) Cool Red. Philosophical Psychology 4: 27-39.
(1993) On Leaving Out What Iťs Like. In: Davies &
Humphreys, Consciousness.
(1995) Qualia: intrinsisch, relational - oder was? In:
Metzinger, BewuBtsein.
Lewis, D. (1966) An Argument for the Identity Theory. Journal of
Philosophy 63: 17-25.
(1972) Psychophysical and Theoretical Identifications. In:
Block, Readings in Philosophy of Psychology Bd. I.
Lewis, M. & Haviland, J. M. (Hg.) (1993) Handbook of Emotions.
New York London.
Libet, B. (1985) Unconscious Cerebral Initiative and the Role of
Conscious Will in Voluntary Action. The Behavioral and Brain
Sciences 8: 529-539.
(1994) A Testable Field Theory of Mind-Brain Interaction.
Journal of Consciousness Studies 1: 119-126.
(1996) Solutions to the Hard Problem of Consciousness.
Journal of Consciousness Studies 3: 33-35.
Lycan, W. G. (Hg.) (1990) Mind and Cognition. A Reader. Oxford
Cambridge MA.
McCauley, R. N. (1981) Hypothetical Identities and Ontological
Economizing: Comments on Causey's Program for the Unity of
Science. Philosophy of Science 48: 218-227.
(1986) lntenheoretic Relations and the Future of Psychology.
In: Christensen & Turner, Folk Psychology.
McGinn, C. (1989) Can We Solve the Mind-Body Problem? In:
Warner & Szubka, The Mind-Body Problem.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
119
Metzinger, T. (1993) Subjekt und Selbstmodell. Die Perspektivitat
phanomenalen BewuBtseins vor dem Hintergrund einer
naturalistischen Theorie mentaler Reprasentation. Paderborn.
Metzinger, T. (Hg.) (1996) BewuBtsein. Beitrage aus der
Gegenwansphilosophie. Zweite Auflage. Paderborn.
Meyer, W. U„ Schiitzwohl, A. Reisenzein, R. (1993/1997)
Einfiihrung in die Emotionspsychologie 2 Bde. Bern Gottingen.
Minsky, M. (1990) Mentopolis. Stuttgan.
Nagel, T. (1974) What ls It Like to Be a Bat? Philosophical Review
83: 435-450, dt. Ín Frank, Analytische Theorien.
(1986) The View from Nowhere. New York Oxford.
(1990) Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einfiihrung in
die Philosophie. Stuttgan.
Newen, A. & Vogeley, K (Hg.) (2000) Selbst und Gehirn: Menschliches SelbstbewuBtsein und seine neurobiologischen Grundlagen. Paderborn.
Nida-Riimelin, M. (1998) Venauschte Sinnesquatitaten und die Frage
der Erklarbarkeit von BewuBtsein. ln: Esken & Heckmann,
BewuBtsein und Reprasentation
Nisbett, R. E. & Wilson, T. D. (1977) Telling More Than We Can
Know: Verba! Repons on Menta! Processes. Psychological
Review 84: 231- 59.
Oeser, E. & Seitelberger, F. (1988) Gehirn, BewuBtsein und
Erkennmis. Darmstadt.
Palmer, S. E. (1999) Color, Consciousness, and the Isomorphism
Constraint. The Behavioral and Brain Sciences 22.
Pauen,
M.
(1996a)
Mythen
des
Materialismus.
Die
Eliminationstheorie und das Problem der psychophysischen
Identitat. Deutsche Zeitschrift fur Philosophie 44: 77-100.
(1996b) Wahrnehmung und Mentale Reprasentation.
Philosophische Rundschau 43 : 243-264.
(1998a) Is There an Empirical Answer to the Explanatory Gap
Argument? Consciousness and Cognition 7: 202-205.
(1998b) Die Sprache der Bilder. Bestimmung und Funktion
piktorialer Formen mentaler Reprasentation. In: Sachs&
Rehkamper,
Bild-Bildwahrnehmung,
Hombach
Bildverarbeitung. Wiesbaden.
120
Michael Pauen
(1999a)
Materialismus
und
Metaphysik.
Konnen
naturwissenschaftliche
Erkennmisse
BewuEtsein
und
Subjektivitat in Frage stellen? Neue Rundschau 110: 29-47.
(1999b) Phenomenal Experience and Science: Separated by a
,Brick Wall'? The Behavioral and Brain Sciences 22.
(1999c) Reality and Representation. Qualia, Computers, and
the ,Explanatory Gap.' In: Riegler & Peschl, Understanding
Representation.
(1999d) Das Ratsel des BewuBtseins. Eine Erkliirung~strategie.
Paderborn.
(2000a) Painless Pain. Property Dualism and the Causal Role
of Phenomenal Consciousness. American Philosophical Quarterly 37: 51-64.
(2000b) SelbstbewuEtsein: Ein metaphysisches Relikt? Philosophische und empirische Befunde zur Konstitution von Subjektivitat. In: Newen & Vogeley, Selbst und Gehirn.
(200la) Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Eine
Einfuhrung. Frankfurt.
(2001b) Freiheit und Verantwortung. Wille, Determinismus
und der Begriff der Person. Allgemeine Zeitschrift fur
Philosophie.
Pauen, M. & Stephan, A. (Hg.) (2001) Phanomenales BewuEtsein.
Paderborn.
Popper, K. R. & Eccles, J. C. (1989) Das leh und sein Gehirn.
Miinchen.
Place, U. T., (1956) Is Consciousness a Brain Process? ln: Chappell,
The Philosophy of Mind.
Plutchik, R (1993) Emotions and their Vicissitudes: Emotions and
Psychopathology. ln: Lewis & Haviland, Handbook of
Emotions.
Posner, M. L. & Raichle, M. E. (1996) Bilder des Geistes. Hirnforscher auf den Spuren des Denkens. Heidelberg Berlin Oxford.
Pothast, U. (1987) Die Unzulanglichkeit der Freiheitsbeweise. Zu
einigen Lehrstiicken aus der neueren Geschichte von
Philosophie und Recht. Frankfurt.
Porhast, U. (Hg.) · (1978) Seminar: Freies Handeln und
Determinismus. Frankfurt.
Quine, W. V. O. (1966a) The Ways of Paradox and Other Essays.
New York.
Grundprobleme der Philosophie des Geistes
121
(1966b) On Menta! Entities. ln: ders., The Ways of Paradox.
(1985) States of Mind. Journal of Philosophy 82: 5- 8.
Rainville, P., Duncan, G. H., Price, D. D., Carrier, B., Bushnell, M.
C. (1997) Pain Affect Encoded in Human Anterior Cingulate
But Not Somatosensory Cortex. ln: Science 277: 968-971.
Rolls, E. T. (1999) The Brain and Emotion. Oxford New York.
Rorty, R. (1965) Leib-Seele Identitat, Privatheit und Kategorien. ln:
Bieri, Analytische Philosophie des Geistes.
(1970a) Unkorrigierbarkeit als Merkmal des Mentalen. ln:
Frank, Analytische Theorien.
(1970b) ln Defense of Eliminative Materialism. Review of
Metaphysics 24: 112-121.
(1976) Realism and Reference. The Monist 59: 321-340.
(1987) Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie.
Frankfurt.
Roth, G. (1991a) Die Konstitution von Bedeutung im Gehirn. ln:
Schmidt, Gedachmis.
(1994) Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive
Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen.
Frankfurt.
(1998) Ist Willensfreiheit eine lllusion. Biologie unserer Zeit
28: 6-15.
Roth, G. & Schwegler, H. (1995) Das Geist-Gehirn-Problem aus der
Sicht der Hirnforschung und eines nicht-reduktionistischen
Physikalismus. Ethik und Sozialwissenschaft 6: 69-77.
Roth, G. & Prinz, W. (Hg.) (1996) Kopf-Arbeit. Gehirnfunktionen
und kognitive Leistungen. Heidelberg Berlin Oxford.
Schlick, M. (1978) Freier Wille, in: Pothast, Seminar.
Schmidt, S. J. (1991) Gedachtnis. Probleme und Perspektiven der
interdisziplinaren Gedachmisforschung. Frankfurt.
Spaemann, R (1996) Personen. Versuche iiber den Unterschied
zwischen ,etwas' und ,jemanď. Stuttgart.
Strawson, P. F. (1972) Einzelding und logisches Subjekt. Ein Beitrag
zur deskriptiven Metaphysik. Stuttgart.
(1982) Freedom and Resentment. In: Watson, Free Will; dt. in
Pothast, Serninar.
Strawson, G. (1986) Freedom and Belief. Oxford.
(1989) Consciousness, Free Will, and the Unimportance of Determinism. Inquiry 32: 3-27.
122
Michael Pauen
(1997) The Self. Journal of Consciousness Srudies 4: 405-428.
(1998) Free Will. Artikel in: Routledge Encyclopedia of Philosophy.
Van Gulick, R. (1995) Who's in Charge Here? And Who's Doing Ail
the Work? ln: Heil & Mele, Menta! Causation.
Van lnwagen, P. (1982) The Incompatibility of Free Will and Determinism, in: Watson, Free Will.
Walter, H. (1996) Die Freiheit des Deterministen. Chaos und
Neurophilosophie. Zeitschrift fiir philosophische Forschung
50: 364-385.
(1998)
Neurophilosophie
der
Willensfreiheit.
Von
libertarischen Illusionen zum Konzept natiirlicher Autonomie.
Paderborn.
Watson, G. (Hg.) (1982) Free Will. Oxford New York.
Windmann, S. & Durstewitz, D. (2000) Phanomenales Erleben: Ein
fundamentales Problem fiir die Psychologie und die
Neurowissenschaften. Psychologische Rundschau 51: 75-82.
Wittgenstein, L. (1984) Tractarus logico-philosophicus. Tagebiicher
1914-1916. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt
(=Werkausgabe Bd. I).
Achim Stephan
Emergenz in kognitionsfahigen Systemen
1. Einleitung
Die englischen Ausdrticke ,to emerge' oder ,emergence' haben
eine alltagssprachliche sowie unterschiedlich starke technische
Bedeutungen: So wird mitunter von der ,emergence of x' gesprochen und damit lediglich das ,Erscheinen' oder ,Auftauchen' von x gemeint. ln einem solchen Sinne sind Buchtitel
wie z.B. The emergence of symbols (Bates 1979) zu verstehen.
Natiirlich lieJ~e sich auf diese Weise auch von der ,emergence
of cognitive systems' reden. Um diesen alltagssprachlichen
Gebrauch des Begriffs der Emergenz soli es im folgenden aber
nicht gehen.
Vielmehr will ich mích dem technischen Begriff der Emergenz zuwenden. Dieser bezeichnet eine Eigenschaft ,zweiter
Stufe', indem er Eigenschaften erster Stufe als ,emergenť auszeichnet und damit von anderen, den ,nicht-emergenten' Eigenschaften, unterscheidet. In der Fachwelt gibt es jedoch
ganz unterschiedliche Auffassungen dartiber, nach welchen
Kriterien emergente von nicht-emergenten Phanomenen zu
unterscheiden sind. Einige Kriterien sind sehr streng, so d~
nur wenige, vielleicht gar keine Eigenschaften unter den entsprechenden Begriff fallen, andere fordern einen eher inflationaren Gebrauch des Emergenzbegriffs mit dem Ergebnis, d~
sehr viele, wenn nicht alle Systemeigenschaften ,emergenť genannt werden muBten. Die Folge ist, d~ zur Zeit eine betrachtliche Verwirrung dartiber herrscht, was genau gemeint
ist, wenn in so verschiedenen Bereichen wie Theorien der
Selbstorganisation, der Philosophie des Geistes, der Theorie
dynamischer Systeme, der Kreativitatsforschung oder dem
Konnektionismus von emergenten Eigenschaften die Rede ist.