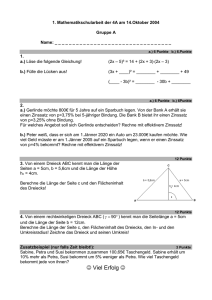Die implizite Ethik der modernen Ökonomie - Karl
Werbung

DIE IMPLIZITE ETHIK DER MODERNEN ÖKONOMIE Erläutert am Beispiel der Zinstheorie Impulsreferat im Rahmen des Forschungsgesprächs „Die kritisch-normative Orientierungsfunktion der Ethik im Härtetest globaler Ökonomie“, Forschungsgespräch am 12./13. Februar 2003 Universität St.Gallen Karl-Heinz Brodbeck Vorab möchte ich den Begriff „implizite Ethik“ erläutern. Unter Ethik versteht man im philosophischen Sprachgebrauch die theoretische Reflexion und Begründung moralischer Regeln. Moralische Regeln lenken oder begrenzen Handlungen. Die spezifisch moralische Qualität solcher Regeln liegt in der Freiheit, sich jeweils auch anders, als in einer Regel vorgeschrieben bzw. verboten, entscheiden zu können. Dass in vielen Handlungen moralische Regeln implizit gegeben sind, d.h. nicht von den Handelnden bewusst reflektiert werden, ist hinreichend bekannt. Sie verbergen sich in den Gewohnheiten, die − vielfach unbewusst geworden − Handlungen lenken, ohne bewusst reflektiert oder überhaupt bekannt zu sein. Aristoteles hat auf die enge Verwandtschaft zwischen Gewohnheiten und moralischen Regeln hingewiesen. Wenn man gewohntes Handeln von außen beobachtet, scheint die Differenz zum bloßen Verhalten von Naturgegenständen verschwunden zu sein. Tatsächlich lassen sich aufgrund gewohnter Handlungsmuster auch Prognosen formulieren. Die ökonomische Theorie setzt in ihren Modellen „Handeln“ und „Verhalten“ gleich und formuliert Aussagen über menschliches Verhaltens. Die theoretische Form zugehöriger Modelle hat in den Wirtschaftswissenschaften zunehmend einen mechanischen Charakter angenommen: Man unterstellt eine prinzipielle Trennung von Beobachter und Verhalten, das seinerseits als rein empirisches 1 Faktum behauptet wird. Bis zu diesem Punkt könnte man von einem erkenntnistheoretischen Fehler sprechen. Denn Menschen verhalten sich nicht, sie handeln, sie verändern immer wieder in vielen Situationen auch die Regeln ihres Handelns. Das wird bei kreativen Prozessen ebenso deutlich wie in Fällen wirklicher Ungewissheit. Doch die ökonomische Theorie geht weiter. Sie formuliert auf der Basis ihrer Verhaltensmodelle Handlungsempfehlungen für die Wirtschaftspolitik oder die betriebliche Praxis. Nun ist bekannt, dass Handlungsempfehlungen immer auf ethischen Normen beruhen und insofern Werturteile darstellen. Dieser Punkt ist weitgehend unstrittig. Doch in diesen Handlungsempfehlungen wird menschliches Verhalten so modelliert, als wäre es − wie ein mechanischer Körper − durch äußere Kausalfaktoren determiniert, also durch „Anreize gesteuert“. In dieser Modellvoraussetzung wird aber ein ethisches Urteil ausgesprochen. Selbst wenn gewohntes Handeln der Vergangenheit richtig erkannt wird, ist damit kein Verhalten beschrieben. Das wird an den Fehlprognosen erkennbar, die zeigen, dass sich behauptete Regelmäßigkeiten als Irrtum erwiesen haben. Entscheidungen sind immer situativ und kreativ und darin nicht sicher vorhersagbar. Die ökonomische Theorie ist eine Kommunikationsform. Sie nimmt teil am sozialen Kommunikationsprozess: An den Hochschulen, in der Ausbildung und Prägung von Urteilsformen für Berufe, in der Medienpräsenz oder in unmittelbaren Empfehlungen von Wirtschaftswissenschaftlern in Instituten oder politischen Gremien. Wer aber durch seine theoretische Modellierung in der Kommunikation vom je anderen unterstellt, er werde sklavisch durch Anreize gesteuert und auf der Basis dieser Annahme Handlungen empfiehlt, der urteilt moralisch. Also ist die Form der physikalistischen Ökonomie, sobald sie in die Kommunikation eintritt und dort als „Erklärung“ fungiert, in Wahrheit implizit eine Ethik. Diesen Zusammenhang möchte ich beispielhaft an der Zinstheorie vorführen. Die Zinstheorie (unter einem anderen Aspekt auch als „Kapitaltheorie“ bezeichnet) nimmt in der ökonomischen Theorie eine Sonderstellung ein. Wenn man z.B. die Preistheorie betrachtet, so finden sich zwar viele Varianten eines Grundmodells, kaum aber in ihren Grundlagen wirklich konkurrierende Theorien (sieht man einmal von der Arbeitswertlehre des 19. Jahrhundert ab, die faktisch keine Rolle mehr spielt). Ganz anders in der Zinstheorie. Hier gibt es eine große Zahl von in ihren zentralen Aussagen völlig unterschiedlichen Theorien nebeneinander. Selbst in den Lehrbüchern finden sich widersprechende Theorien: Die österreichischen Kapitaltheorie, wie sie Irving Fisher vereinfacht dargestellt hat, neben der Liquiditätspräferenztheorie von Keynes. Die unterschiedlichen Auffassungen in der Zinstheorie sind der eigentliche Grund für andere Gegensätze (wie in der Lohn- oder der Geldtheorie). In den wachstumstheoretischen Kapiteln fin- 2 det sich dagegen vielfach eine naive Produktivitätstheorie des Zinses (Kapitalrente gleich Grenzprodukt des Kapitals, wobei „Kapital“ oftmals sogar zirkulär als Wertaggregat aus − zinsabhängigen − Preisen interpretiert wird), während man in den wirtschaftspolitischen Teilen fast immer argumentiert, Geld und Zins seien durch Institutionen in Größe und Umfang determiniert. Ich möchte das illustrieren: Kaum jemand hegt heute noch daran Zweifel, dass das Zinsniveau durch die Politik der Zentralbanken wesentlich beeinflusst wird; vielfach herrscht sogar die Vorstellung, die Zentralbanken könnten die Zinssätze direkt steuern. Der Zinssatz, genauer der jeweilige Leitzinssatz ist ein „politischer Preis“. Die „Unabhängigkeit“ der Zentralbanken besteht auch und gerade darin, die Leitzinssätze, damit das allgemeine Zinsniveau durch diskretionäre Entscheidungen maßgeblich beeinflussen zu können. Und der Streit um diese Politik macht deutlich, dass der Zinssatz politisch und von der Wirtschaft als gelenkter Preis interpretiert wird. Hinter der Festlegung der Leitzinssätze steht eine Entscheidung, die durch bestimmte Gründe motiviert ist – Gründe, die ihrerseits wiederum auf ethische Grundüberzeugungen, also wirtschaftspolitische Ziele zurückgeführt werden können. Ziele verkörpern ethische Werte, weshalb der Zinssatz auch als Instrument interpretiert wird, diese Werte (z.B. die Stabilität einer Währung) durchzusetzen oder zu bewahren. Wenn man jedoch betrachtet, wie führende Entscheidungsträger der Zentralbankpolitik den Zinssatz theoretisch erklären, so stellt man erstaunt fest, dass sie darin ihr eigenes Tun leugnen und behaupten, dass Zinssätze ausschließlich durch Marktprozesse determiniert seien. Otmar Issing, Chefökonom der EZB und Verfasser viel verwendeter Lehrbücher zur Geldtheorie und -politik, sagt: „Der Zins als relativer Preis, als Verbindungsglied zwischen Gegenwart und Zukunft stammt aus der Welt der realen Wirtschaft. Seine Höhe wird durch das Verhältnis von Sparen und Investieren bestimmt.“ (O. Issing, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.11.1993) Diese Feststellung ist empirisch unhaltbar, denn erstens werden Kredite nicht nur in Höhe der Ersparnisse vergeben, und zweitens gehören volkswirtschaftlich die thesaurierten Gewinne zur Ersparnis, erscheinen aber nicht als Sparangebot und können deshalb den Zinssatz (ex ante) nicht determinieren. Die Zinstheorie, die bei Issing hier anklingt (die österreichische Kapitaltheorie), behauptet entgegen der praktizierten Festsetzung der Leitzinssätze, dass der Zins durch „reale“ Faktoren determiniert sei, die sich letztlich politisch nicht beeinflussen lassen. Ich möchte kurz einige zinstheoretische Argumente rekapitulieren. Issing bezieht sich hier auf die „österreichische Kapitaltheorie“, die behauptet, dass der Zinssatz zwei Ursachen habe: Die Gegenwartspräferenz (Minderschätzung künftiger Güter) und die höhere Produktivität kapitalintensiverer Produktionsmetho- 3 den. Diese Theorie wurde vielfach überzeugend kritisiert. Rawls sagt, dass individuell eine Zeitpräferenz dem Rationalitätspostulat widerspricht, während sie sozial ungerecht ist, weil sie künftige Generationen und deren Bedürfnisse geringer bewertet. Auch der „objektive Teil“ dieser Theorie (Mehrergiebigkeit „längerer“, also kapitalintensiverer Produktionsumwege) ist als generelle Aussage nicht zu halten: Investitionen führen keineswegs immer zu höherer Kapitalintensität. Schumpeter hat plausibel gemacht, dass in einer stationären Wirtschaft der Zinssatz durch Wettbewerbsprozesse − entgegen der Auffassung „österreichischen“ Kapitaltheorie − verschwinden würde; nur ein permanenter Innovationsprozess erzeugt jenen Gewinn, aus dem Zinsen bezahlt werden können. Keynes hat gezeigt, dass die österreichische Theorie eines „natürlichen Zinssatzes“ Vollbeschäftigung aller Produktionsfaktoren voraussetzt − ein Ergebnis, das in der kapitaltheoretischen Diskussion der 60er Jahre vielfach bestätigt wurde: Nur in einer Steady-State-Wachstumswelt mit gleicher Expansionsrate aller Sektoren ist ein positiver Realzins widerspruchsfrei definierbar. Bei ungleichem Wachstum der Sektoren gibt es nicht eine „interne Verzinsung“, sondern ebenso viele, wie es produzierte Güter gibt (ein Argument, mit dem Piero Sraffa in den 30er Jahren Hayeks österreichische Theorie widerlegte). Die Annahme eines positiven Zinssatzes ist nicht nur ungerecht, sie unterstellt in den Modellen optimalen Wachstums auch einen unendlich lebenden Konsumenten mit positiver Zeitpräferenzrate. Samuelson hat in einem bekannten Aufsatz gezeigt, dass bei nebeneinander lebenden Generationen, die auch Kreditverträge abschließen, der Zinssatz gleich der Wachstumsrate der Bevölkerung ist (in einem statischen Modell, das in der österreichischen Theorie vorausgesetzt wird, wäre der Zinssatz also null). Und schließlich hat Keynes eine Theorie entwickelt, die den Zinssatz als rein monetäres Phänomen beschreibt. Wer also eine zinspolitische Handlungsempfehlung gibt, der spricht allein durch die Wahl des Modells ein ethisches Urteil aus, auch wenn dieses Urteil nicht explizit gemacht wird. Die Zinstheorie ist der blinde Fleck der Ökonomik. Das ist schon daran erkennbar, dass die Zinstheorie aus einer Ethik − dem Zinsverbot − entsprungen ist. Aristoteles sagte, dass die Zinsforderung einen Missbrauch einer sozialen Funktion (der Tauschfunktion des Geldes) darstellt. Ein Blick auf die Spekulationsprozesse der Gegenwart lässt diesen Gedanken keineswegs als unplausibel erscheinen. Es gibt keinen „objektiven“, „natürlichen“ Grund für einen Zinssatz bestimmter Höhe. Wohl aber muss in einer Wirtschaft mit positivem Zinssatz das zugehörige Einkommen durch immer wieder neue Umwälzungen der Produktion erwirtschaftet werden. Wer also den Zinssatz als quasi-natürliches Phänomen verteidigt, der spricht das Urteil aus, dass die Wirtschaft erstens wachsen soll 4 (denn ohne Wachstum ist kein Zinssatz möglich), zweitens aber plädiert er für die permanente Umwälzung der Produktionsmethoden, um aus den draus erwachsenden Erträgen Zinszahlungen leisten zu können. Wer einen Zinssatz von 3% als „natürlich“ in einem Modell, einer Handlungsempfehlung einsetzt, der spricht das implizite Urteil aus, dass sich der Kapitalstock oder das Sozialprodukt in etwa 23 Jahren verdoppeln muss, soll dieser Wert möglich sein (sieht man von nur temporär wirksamen Umverteilungen aus anderen Einkommensformen ab, die durchaus zum Repertoire der neoliberalen Handlungsempfehlungen gehören). Das ist ein rein ethischer Satz im Gewande einer Theorie. An der Zinstheorie kann man wie in einem Hohlspiegel die schrittweise Transformation ethischer Sätze in eine Theorie beobachten, die unter dem Mantel der Mathematisierung ihre Herkunft verbergen. Die Leitkategorie in der Literatur zur Begründung der Vorzüge einer marktwirtschaftlichen Organisationsform der Produktion war in schrittweiser Abstraktion der Begriff des „Interesses“. Dieser Begriff wurde verwendet, die „irrationalen Leidenschaften“ der Herrscher einer Rationalisierung zu unterziehen (Le princes commandent aux peuples, et l´interêt commande aux princes). Später wurde die Kategorie des „Interesses“ zur Leitmetapher individuellen Handelns („Selbstinteresse“), das in der schottischen Moralphilosophie als Schlüsselbegriff einer neuen Systemtheorie verwendet wurde: Der mechanische Gegensatz des Selbstinteresses sollte das Allgemeininteresse herstellen − „Interesse“ bleibt hier als Kategorie allerdings ungedacht. In reiner Form erscheint das Selbstinteresse im Zins. Der Zins ist kein physisches Ding, sondern eine Forderung an Handlungen in einem Vertrag, also eine moralische Kategorie. Und die Praxis der Geldpolitik lässt daran keinen Zweifel, weil sie Zinssätze nach Zielen (Werten) festlegt. Allerdings führt die Zinsforderung einen Zwang für jede kreditfinanzierte Produktion herbei, einen Überschuss (Gewinn) zu erwirtschaften, um diese Forderung begleichen zu können. Da der Wettbewerb tendenziell alle Überschüsse über bloße Kosten hinaus eliminiert − was sich in verschiedenen oben erwähnten Modellen gleichfalls als Resultat ergibt −, erlegt der Zins der Wirtschaft insgesamt den Zwang auf, durch kreative Destruktion (Schumpeter) von Produktion und Verbrauch einerseits, die globale Unterwerfung aller Lebensbereiche unter den Verwertungszwang andererseits, immer neue Überschüsse zu erwirtschaften. Dieser Prozess, im Rhythmus der Konjunkturen durchgesetzt, wird angetrieben durch das Motiv der Verzinsung eingesetzten Kapitals. Und dieses Motiv ist keine rationale Handlungssteuerung, sondern nur die globale Herrschaft einer irrationalen Leidenschaft: der Geldgier. Beschreibt man also den Zinssatz als „natürliches“ Phänomen der Wirtschaft, so formuliert man implizit in der theoretischen Form einer Wissenschaft eine Ethik, die eine irrationale Leidenschaft zur Herrscherin des Handelns macht. Eine kriti- 5 sche Wirtschaftsethik kann deshalb von der „reinen Theorie“ nicht getrennt werden: Die ökonomische Theorie muss explizite Ethik werden, weil die Kategorien des Marktes implizit ethische Kategorien sind, wenn man sie in die theoretische Form einer physikalistischen Wissenschaft bringt, die zugleich am sozialen Kommunikationsprozess teilnimmt und Diskurspartner auf anreizgesteuerte „Roboterimitationen“ (R. E. Lucas) reduziert. © K.-H. Brodbeck, 30. Dezember 2002 6