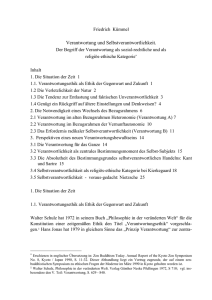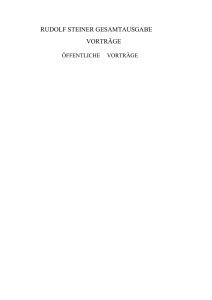Wissenschaft und die Ethik des Anderen
Werbung

Roland Fischer Wissenschaft und die Ethik des Anderen "Ethik des Anderen" bedeutet, sich auf das / den / die Andere(n) einlassen, es / ihn / sie wahrnehmen, ihm / ihr Aufmerksamkeit schenken, ihm / ihr zuhören usw. Man kann vielleicht auch sagen: es / ihn / sie erforschen. "Das Andere" kann ein anderer Mensch, eine andere Gesellschaft aber auch ein Teil der Natur, ein Kunstwerk, ein technischer Gegenstand usw. sein. Insbesondere ist der Gegenstand von Wissenschaft immer "ein Anderes". Ethik des Anderen bedeutet aber auch, das Andere als solches, als Anderes zur Kenntnis zu nehmen, es nicht vereinnahmen, nicht unterdrücken, kurz: Respekt vor dem Anderen haben. Eine Form der Vereinnahmung kann schon das als Ergebnis von Erforschen gewünschte Verstehen sein. Ein Kollege sagt öfters, daß für ihn der Satz "Ich verstehe dich" eine gefährliche Drohung ist. Auf der anderen Seite kann auch der Satz "Ich verstehe dich nicht" als eine solche aufgefaßt werden. Er kann Ablehnung, Zurückweisung, Desinteresse bedeuten. Wissenschaft ist auf Erforschung und Verstehen ausgerichtet. Sie strebt sogar eine Gesamttheorie des jeweiligen Gegenstandsbereichs an. Z. B. die Schulmedizin: Ihr genügt nicht, daß eine Heilmethode funktioniert, das Funktionieren muß auch erklärbar sein, indem ein Zusammenhang zur gängigen Theorie hergestellt wird. – Die Wissenschaft will weiße Flecken auf der Landkarte des Wissens beseitigen, kurz das Andere soll als solches beseitigt werden. Damit stehen wir vor einem Problem, einem Dilemma, nämlich dem zwischen Desinteresse und Vereinnahmung. Selbstbeobachtung und Empathie Wie ist eine Ethik des Anderen überhaupt möglich? Das genannte Dilemma gibt es ja nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für den einzelnen Menschen, der einem Anderen (Menschen, Gegenstand usw.) gegenübersteht. Wie löst er dieses Problem? -2- Es ist eine sensible Gratwanderung. Diese ist nur auf der Basis von Intuition und Empathie auf der einen (emotio) und kritischer Selbstbeobachtung (ratio) auf der anderen Seite möglich. Selbstbeobachtend muß sich der Mensch die Frage stellen: Was will ich eigentlich, was sind meine Motive? Was bewirke ich? Wie ist die Reaktion des anderen? Was will er? Wie verändert er sich? Respektiere ich ihn wirklich? Selbstbeobachtung ist die Grundvoraussetzung für Gewissen, d. h. für eine innere mitwissende Instanz (conscientia). Die Möglichkeit des Menschen zur Selbstdifferenz, d. h. die Aufspaltung in ein handelndes und ein beobachtendes Subjekt (je situativ) ist die Voraussetzung dafür. Die zweite Voraussetzung ist emotionaler Art, Intuition und Empathie. Sie geht davon aus, daß es möglich ist, mit dem Anderen in eine nicht rational explizierte Verbindung zu treten, d. h. etwas zu spüren. Zu spüren was der / die / das Andere braucht, um sich als solche/r/s entfalten zu können. Braucht er / sie / es mehr Zuwendung mit der Gefahr der Vereinnahmung oder mehr Abgrenzung mit der Gefahr der Isoliertheit. Die Voraussetzung dafür, daß dies möglich ist, ist ein Zusammenhang zwischen dem Ich und dem Anderen, ein Zusammenhang, der Wahrnehmung ermöglicht jenseits explizierter, rational kontrollierter Verfahren und Methoden. Wissenschaft als Organisation Wissenschaft ist ein soziales Unternehmen, ist eine Organisation. Zwar handeln einzelne Menschen, der Betrieb "Wissenschaft" – ob disziplinäre Community, eine Universität, eine Forschergruppe – ist aber mehr als eine bloße Menge von Menschen. Er ist ein strukturiertes Ganzes mit Regeln, Zielen, Verfahren, kurz: eine Organisation. Und Organisationen sind im Vergleich zu Individuen plump in ihrem Außenverhältnis, in ihrem Verhältnis zum Anderen. Sie können nicht so schnell und so sensibel reagieren, wie das einzelne Menschen tun können. Zwar sind an der Schnittstelle von Wissenschaft zum jeweiligen Anderen, zur beforschten Volksgruppe, zur beforschten Natur, zum beforschten Patienten immer Menschen tätig, und die können – der Ethik des Anderen folgend – sensibel, empathisch sein und ihr Gewissen erforschen. Aber: Sie handeln ja nicht als -3- Einzelmenschen. Sie sind den Zielen und Regeln der Organisation Wissenschaft verpflichtet. Sie müssen dieser Rechenschaft ablegen. Wenn sie den Zielen nicht entsprechen, werden sie über kurz oder lang ausgetauscht, da sich Ziele und Normen der Organisation nicht so schnell ändern. Das gilt übrigens in besonderem Maße, wenn die Organisationen demokratisch verfaßt sind, man könnte vielleicht sogar sagen: je demokratischer im Binnenverhältnis, desto plumper ist die Organisation in ihrem Außenverhältnis. Ein Forschungsprogramm, ein Institut wird eingerichtet, ein Rahmenprogramm definiert, dann rollt eine Maschinerie. Selbst wenn einzelne Menschen die Probleme schon ganz wo anders sehen, sie haben nicht die spontane Macht, etwas zu ändern, ja sie können / dürfen sie auch nicht haben, wenn organisiertes Tun einen Sinn ergeben soll. Stehen wir damit vor einem unauflöslichen Dilemma? Wenn Wissenschaft ethisch sein soll, müssen wir uns über so etwas wie Organisationsethik den Kopf zerbrechen. Es handeln nämlich nicht nur Einzelmenschen, es handeln auch soziale Systeme, zumindest halte ich das für eine sinnvolle Metapher. Bewußtsein eines sozialen Systems Was kann Organisationsethik bedeuten? Als Voraussetzung für eine solche sehe ich zunächst wie beim Individuum die Kompetenz zur Selbstbeobachtung an. Im Bezug auf Organisationen meine ich organisierte Selbstbeobachtung. Sie geht über die Beobachtung des sozialen Systems durch die einzelnen Mitglieder (und daraus oft folgendes informelles Raisonieren) hinaus und bedeutet eine explizite Aufgabenstellung für eine Untergruppe des sozialen Systems. Diese Herausnahme einiger Menschen aus dem Alltagsgeschäft der Organisation, man könnte auch sagen aus dem Prozessieren der Organisation, wie es auch in gruppendynamischen Settings oder bei der Entwicklung von Organisationen professionell verwendet wird, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es schwierig, gleichzeitig zu tun, zu handeln und sich in diesem Tun zu beobachten. Zweitens enthält diese Beobachtung immer -4- auch ein kritische Komponente, denn festzustellen, daß irgendetwas so und so ist, bedeutet die implizite Annahme daß es auch anders sein könnte, zumindest eine Vorstellung muß man davon haben. Und Kritik ist aus der Distanz leichter möglich. Und drittens geht es nicht nur um die Beobachtung, sondern um eine kollektive Auseinandersetzung mit den Beobachtungsergebnissen. Wenn ein soziales System in seinem Gewissen nicht auf eine stellvertretende Untergruppe, im Extremfall auf eine Person reduziert werden soll, muß eine solche Auseinandersetzung geführt werden. Dies erfordert eine Konzentration der Aufmerksamkeit, zu der sich das System entschließen muß, und das durch die phasenweise Hervorhebung bestimmter Mitglieder des Systems als Beobachter gefördert wird. Beobachter sollten keine Macht haben im Sinne von Entscheidungen, im Sinne von Ziehen von Konsequenzen aus ihren Beobachtungen, sie sollten bloß das Recht haben, daß ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Selbstbeobachtung eine sozialen Systems ist immer auch eine Konstruktion desselben. Es gibt das soziale System ja nicht so unmittelbar wie den einzelnen Menschen, der als Selbstbeobachtungsgegenstand seine körperliche Manifestation zur Verfügung hat. Bei sozialen Systemen ist immer die Frage "Wer gehört dazu? Was ist das Besondere? Wie verstehen wir uns?" zu beantworten. Das heißt, die Selbstbeobachtung ist immer auch ein Vorschlag, wie das Ganze zu sehen ist. Die Auseinandersetzung des sozialen Systems mit einem solchen Vorschlag, d. h. mit einem Beobachtungsergebnis hat dann den Charakter der Dekonstruktion. Nicht alle finden sich aufgehoben in dem Vorschlag, sich in ihrem individuellen Sein berücksichtigt, oder wollen einfach nicht aufgehoben sein, weil sie damit als Individuen oder Teilgruppen verschwinden. D. h., im Prozeß der Auseinandersetzung wird der Vorschlag kritisiert, er wird zerlegt und löst sich im Endeffekt auf. Der Boden ist frei für eine neue Beobachtung und für einen neuen Vorschlag. Ich nenne den Prozeß der beobachtenden Konstruktion und diskursiven Dekonstruktion einer sozialen Ganzheit das Bewußtsein eines sozialen Systems. Dabei ist für die Konstruktion eine Teilmenge (eben jene der Beobachter) zuständig, für die Dekonstruktion sind alle gefragt. Ohne innere Differenzierung ist kein Bewußtsein eines sozialen Systems, damit kein Gewissen eines sozialen Systems und damit auch keine Ethik möglich. Bewußtsein eines sozialen Systems ist ein -5- Prozeß, allerdings keiner, der im Gleichschritt der Mitglieder erfolgt, er ist von Konflikten begleitet. Bewußtsein "tut weh" – übrigens auch beim Individuum. Die Rolle des Anderen Die Sache mit dem Bewußtsein ist aber noch etwas komplizierter. Selbstbeobachtung eines sozialen Systems heißt immer auch, Beobachtung und Definition der Grenzen: Was sind wir im Unterschied zu den anderen? Wie bei jeder Grenzziehung müssen die Grenzen für beide Seiten zumindestens klar und verstehbar sein. Das spricht für die Beteiligung der "Anderen" an der Definition der Grenzen, insbesondere an der Diskussion was Wissenschaft ist bzw. sein soll. Man braucht diese Diskussion eigentlich vor allem für dieses Außenverhältnis. Die Wissenschafter selbst brauchen in der Regel keine Definition ihres Tuns, sie tun einfach. Erst im Außenverhältnis ist die Definition relevant. Dies gilt natürlich auch für die Einteilung der Disziplinen innerhalb der Wissenschaften. Für die obige Bewußtseinsdefinition heißt dies: zumindestens am Dekonstruktionsprozeß ist auch die Umgebung angemessen zu beteiligen. Bewußtsein eines sozialen Systems ist kein reines Binnenphänomen. Was heißt das nun für Wissenschaft? – Die jeweiligen Nicht-Fachleute müssen ein Mitspracherecht haben. Ich bin dafür, so etwas wie Laienräte einzurichten, genauer: gemischte Gremien, in denen Systeminsassen (im konkreten Fall Wissenschafter, z. B. Universitätsangehörige) und Vertreter des Umfelds zusammenwirken. Die Laienvertreter sollten nach einem Zufallsprinzip (wie Schöffen oder Geschworene) rekrutiert werden, damit nicht die Einflüsse anderer Organisationen, z. B. von Parteien, ein Übergewicht bekommen. Innerhalb der bestehenden Strukturen, etwa der Selbstverwaltung von Universitäten, sollten zumindestens die interdisziplinär zusammengesetzten Kollegialorgane als wechselseitige Laienräte inhaltlich ernst genommen werden, aber auch die Studenten als Vertreter des Anderen eine Rolle spielen. Das ganze bedeutet natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis von Wissenschaft, das mit der gängigen Überbewertung der jeweiligen fachlichen Kompetenz nicht vereinbar ist. -6- Emotionalität eines sozialen Systems? Wie sieht es mit dem zweiten Ingredienz für ethisches Handeln beim Individuum, nämlich mit Intuition und Empathie, bei Organisationen aus? Sie haben etwas mit Emotionen zu tun und ist das auf Organisationen übertragbar? Man spricht zumindest metaphorisch von kollektiver Emotionalität, aber was ist das und, wenn es das gibt, wollen wir das wirklich als kollektives Handlungsmotiv? Organisationen sollten zumindestens die Emotionalität ihrer Mitglieder insbesondere jener, die an der Schnittstelle zum Anderen stehen ernst nehmen. Es sollten Verfahren existieren, die es ermöglichen, diese Emotionalität überhaupt wahrzunehmen. Das bedeutet neue Formen der Kommunikation innerhalb einer Organisation, im konkreten Fall innerhalb von Wissenschaft. Man kann dies als Teil der Selbstbeobachtungsaufgabe ansehen. Ich meine aber, daß man darüber hinausgehen muß. Intuition und Empathie sind nicht bloß naturwüchsig vorhanden, sodaß man sich ihrer bedienen kann. Sie können erzeugt und gepflegt werden. In Organisationen sollte es Rituale geben, die der Erzeugung und Pflege von kollektiver Sensibilität, von kollektivem Verantwortungsgefühl und von kollektivem Interesse am Anderen dienen. Wie das im einzelnen geschehen soll, darüber sollte man nachdenken, insbesondere bestehende Rituale daraufhin ansehen, ob sie Derartiges leisten können. Erwähnt sei auch die Notwendigkeit einer auf das soziale System selbst gerichteten positiven Emotionalität. Wenn man von einem sozialen System, von einer Organisation mehr haben möchte als ein bloß maschinelles Ablaufen nach bestimmten Regeln, dann muß man ihm auch eine emotionale Identität zugestehen. Beim Individuum wird manchmal die Selbstliebe als eine ohnehin vorhandene vorausgesetzt und ethische Argumente können sich dann darauf konzentrieren, die Liebe zum Anderen zu fordern. Man kann selbst beim Individuum die Frage stellen, ob diese Voraussetzung wirklich hinreichend in jedem Einzelfall erfüllt ist, bei sozialen Systemen ist es jedenfalls so, daß ohne Investition in deren Selbstliebe sie als bloß seelenlose Mechanismen funktionieren und damit zu einer Ethik des Anderen nicht wirklich fähig sind. -7- Verzicht auf Wissen Betrachten wir noch einmal den Gegensatz zwischen Forschungsdrang auf der einen Seite und den notwendigen Respekt vorm Anderen auf der anderen. Das dominierende Wissenschaftsethos sagt: Das Andere soll sein Anderssein verlieren, es soll eingebaut werden in den Wissenskorpus. Wenn dieses Wissenschaftsethos in Frage gestellt werden soll, so bedeutet dies radikal: Bewußter Verzicht auf Wissen. Und das ist eine einschneidende Angelegenheit. Das dominierende Wissenschaftsethos setzt auf eine ungebremste Expansion von Wissen. In manchen Bereichen gesellschaftlicher Aktivität wird zwar schon über Begrenzungen von Expansionen nachgedacht, z. B. in der Wirtschaft. Bezüglich der Wissenschaft ist dies aber noch ein Tabuthema. Man würde die Freiheit der Wissenschaft gefährdet sehen, Zensur und Unterdrückung ablehnen, usw. Es gibt allerdings auch zaghafte Versuche, Forschung ethisch zu steuern, insbesonders dort, wo unerwünschte Anwendungen die Folge sein könnten. Aber daß das Wissen selbst unmittelbar schon ein Problem sein kann, davon ist eigentlich nicht die Rede. Auf der anderen Seite, im Bereich des individuellen Verhaltens einem anderen Menschen gegenüber, kann ein bewußter Verzicht auf Wissen als durchaus angemessen angesehen werden. Für einen Psychotherapeuten bespielsweise kann es Situationen geben, in denen er entscheidet, auf Wissen über einen Patienten zu verzichten, um diesem nicht zu nahe zu treten und dessen autonome Identität nicht zu gefährden. Auch Organisationen, z. B. der Staat, entscheiden sich gelegentlich für Nichtwissen, etwa wen Gesetze zum Schutz von Daten beschlossen werden. Sind derartige Entschlüsse auch grundsätzlicher für die Wissenschaft denkbar? Ich persönlich bin der Überzeugung daß die Biologie als Wissenschaft vom Leben sich mit der Problematik des bewußten Nicht-Wissens auseinandersetzen muß. Ich kann der von Maturana und Varela vorgeschlagenen Definition von Leben einiges abgewinnen: Lebewesen sind sogenannte "autopoietische" Systeme, das sind solche, die ihre Organisationsstruktur und ihre Grenzen ständig reproduzieren, d. h. sich selbst herstellen. Die Alternative sind sogenannte "allopoietische" Systeme, d. s. -8- solche, die von einem jeweils anderen hergestellt werden. Der entscheidende Punkt, und der wird von Varela am deutlichsten formuliert, ist aber der, daß die Frage ob etwas ein auto- oder ein allopoietisches System ist, nicht vom System selbst beantwortet wird, sondern durch eine Entscheidung des Beobachters; d. h. der Beobachter entscheidet, was für ihn Leben ist. Worin besteht nun die Entscheidung für Leben? Sie besteht darin, zu sagen, daß man einem Anderen gegenübersteht, dem man Eigenständigkeit zuerkennt und zwar eine Eigenständigkeit, die von außen, insbesondere von einem selbst, nicht beeinflußbar ist, jedenfalls nicht total; insbesondere – und das füge ich hinzu – die nicht total durchschaubar ist. Es handelt sich somit gewissermaßen um eine paradoxe Entscheidung: Ich entscheide mich dafür, daß etwas für mich nicht total erkennbar und daher auch in gewissem Sinn nicht entscheidbar ist. Ich sehe diese Art der Haltung gegenüber einem Anderen als einen sich selbst aufhebenden Konstruktivismus an, der für Leben konstitutiv ist. Es ist zwar so, daß eine biologische Wissenschaft immer mehr Wissen über Leben gewinnen kann. Gleichzeitig müßte sie aber sagen, da gibt es noch etwas, das ich als Wissenschafter nicht erkennen kann bzw. will. Würde ich alles erkennen, dann wäre es kein Leben. Erkenntnis und Selbstauflösung Warum soll man eigentlich auf Erkenntnis verzichten? Deswegen, weil Erkenntnis eine reziproke Angelegenheit ist. Weil Erkenntnis des Anderen immer auch Selbsterkenntnis bedeuten kann und die totale Selbsterkenntnis Auflösung der eigenen Ganzheit bedeutet. Ich gehe davon aus, daß eine notwendige Geheimnishaftigkeit des Lebens des Anderen auch für das eigene Leben gilt und damit eine Grenze der Selbstbeobachtung darstellt, d. h. daß die totale Selbsterkenntnis die Auflösung des Selbst nach sich zieht. Es gibt das notwendig undurchschaubare Selbst auf der psychischen Ebene – negativ konnotiert die "Lebenslüge" – es gibt notwendige Tabus für soziale Systeme usw. Natürlich kann deren partielle Aufdeckung oder In-Frage-Stellung auch eine Chance bedeuten, Möglichkeit für Umstrukturierung, jedenfalls ist es auch eine Gefahr für die Integrität. -9- Indem ich das Andere respektiere und nicht alles wissen möchte, respektiere ich somit auch mich selbst. Wenn ich die Grenzen zum Anderen auflöse, löse ich mich selbst auf. Von dieser Überlegung ausgehend biete ich einen Gedanken an, der vielleicht absurd erscheinen mag (vielleicht erscheint auch schon das bisher gesagte absurd). In diesem Jahrhundert hat die Wissenschaft Unmöglichkeitsaussagen bezüglich ihrer Erkenntnischancen formuliert. Ich denke an die Heisenbergsche Unschärferelation, die besagt, daß Ort und Geschwindigkeit eines Teiles nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit meßbar sind. Und ich denke an den Gödelschen Satz, der die Existenz von Aussagen in formalen Systemen behauptet, die mit den Mitteln des Systems weder beweis- noch widerlegbar sind. Es sind beides Aussagen über die NichtMöglichkeit von Wissen. Meine gewagte Interpretation: Diese Sätze drücken ein Nicht-Wissen-Wollen der Menschheit aus, motiviert aus dem Wunsch nach Abgrenzung vom Anderen, einerseits Abgrenzung von der (unbelebten) Natur, dem Gegenstand der Physik, andererseits Abgrenzung von formalen Systemen. Liebe als Selbstauflösungsangebot Vielleicht habe ich das Thema "Ethik des Anderen" verfehlt. Man kann ja dem im letzten Abschnitt Gesagten entgegenhalten: Liebe ist gerade das Angebot der Selbstauflösung. Es gibt Situationen, wo gerade aus der Auflösung der Grenzen die Kraft für Leben geschöpft wird, in denen die totale Selbstaufgabe für den anderen gefragt ist; oder auch solche Situationen, in denen zugunsten des Überlebens des anderen Übergriffe notwendig sind, auch Vereinnahmungen; oder daß es jenseits des vereinnahmenden Wissens ein anderes gibt, das nicht auf Beherrschung ausgerichtet ist und von dem man nie genug haben kann. Das ist aber doch nicht mehr Wissenschaft? Oder doch? - 10 - Literatur Fischer, R. / Costazza, M. / Pellert, A. (Hrsg.) (1993): Argumentation und Entscheidung: Zur Idee und Organisation von Wissenschaft. Wien/ München: Profil 1993 Fischer, R. (1994): Drei Paradigmen systemischen Denkens. In: Wissenschaftliche Blätter/Angewandte Ökologie der Wissenschaftlichen Landesakademie für Niederösterreich, Heft 1/1994, S. 38-40. Fischer, R. (1992): Ganzheitlichkeit = Nichtwissen. In: UNISONO, Zeitschrift des Außeninstituts der Universität Klagenfurt, Jänner 1992 Fischer, R. (1999): Kollegiales Management. In: R. Grossmann (Hrsg.) "Besser Billiger Mehr. Zur Reform der Expertenorganisationen Krankenhaus, Schule, Universität", IFF-texte Band 2. Springer-Verlag, Wien 1997, S. 58-67 Varela, Francisco I. (1979): Principles of Biological Autonomy. New York: Elsevier Schmidt, Siegfried I. (Hrsg.) (1987): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Frankfurt: Suhrkamp