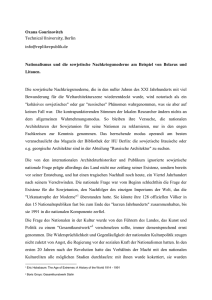„Der Kreml und Osteuropa 1989/91: Das Ende einer Epoche”
Werbung

„Der Kreml und Osteuropa 1989/91: Das Ende einer Epoche” Am 18. und 19. September 2012 fand an der deutschsprachigen Andrássy-Universität Budapest eine internationale Konferenz statt. Veranstaltet wurde die Tagung vom LudwigBoltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung mit Sitz in Graz und Wien (Leitung: Stefan Karner), dem Cold War History Research Center des Instituts für Internationale Studien der Budapester Corvinus-Universität (Leitung: Csaba Békés), dem Österreichischen Kulturforum Budapest (Direktorin Susanne Bachfischer) und der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität Moskau (Rektor Efim Pivovar). Mitgefördert wurde die Veranstaltung von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Österreichischen Botschaft Budapest (Dr. Michael Zimmermann). Die Konferenz wurde im Rahmen einer Veranstaltungsreihe durchgeführt. Die Referenten arbeiten gemeinsam in einem internationalen Forschungsprojekts auf der Basis sowjetischer und anderer osteuropäischer Quellen die Geschichte der letzten Jahre der Sowjetunion und des Ostblocks auf. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden Ende 2014 u.a. in der Harvard Cold War Studies Book Series publiziert. Die Budapester Vorträge stellten eine Zusammenfassung des bisherigen Forschungsstands der einzelnen Wissenschaftler dar und hatten zum Zweck, die neu gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen. Mark Kramer (Harvard University, Cambridge, Ma.) führte mit dem Vortrag Gorbatschow und der Umbruch in Osteuropa in die Konferenzthematik ein. Kramer zeichnete den Weg nach, den der sowjetische Parteisekretär und spätere Präsident von seiner Wahl im Jahr 1985 bis 1989 zurücklegte. Er vertrat dabei den Standpunkt, die Politik Gorbatschows habe sich erst im Laufe des Jahres 1987 endgültig gewandelt. Die Gründe dafür waren vielfältig. Einerseits benötigte Gorbatschow relativ lange Zeit, um seine Position an der Parteispitze zu konsolidieren. Andererseits trat Gorbatschow nicht etwa mit einem Programm an, die Hegemonialstellung der Sowjetunion über Osteuropa in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil, auf dem Warschauer Pakt-Gipfel 1985 trat Gorbatschow für eine Stärkung des Warschauer Paktes ein. Kramer sieht das Jahr 1988 als den Wendepunkt in Gorbatschows Politik. Während sich Gorbatschow 1987 trotz vielfacher gegenteiliger Hoffnungen in der Tschechoslowakei öffentlich noch zur Intervention 1968 bekannte, markierten seine Äußerungen anlässlich eines Jugoslawien-Besuchs im Frühjahr einen Wendepunkt in der sowjetischen Außenpolitik. In der Folge zeichnete Kramer das Aufweichen der BrežnevDoktrin nach, was den Staaten der Region in der Folge einen zunehmend größeren Handlungsspielraum brachte. Die Ereignisse des Jahres 1989 waren nach Ansicht Kramers daher kein Zufall. Was Gorbatschow unter den sowjetischen Führern einzigartig machte, sei, dass er bis zum Schluss an seiner Entscheidung zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer sozialistischer Länder festgehalten habe, selbst zu dem Zeitpunkt, als dies das Ende der sowjetischen Hegemonie über Osteuropa bedeutete. Michail Prozumenščikov (Russisches Staatsarchiv für Zeitgeschichte, Moskau) legte in seinem Vortrag Das Ende der KPdSU den Niedergang der sowjetischen Staatspartei dar. Der Beitrag suchte die Antwort auf die Frage, welche Gründe zur Einstellung der Tätigkeit der 1 KPdSU im Jahr 1991 durch Boris Jelzin führten. Nach Ansicht Prozumenščikovs waren die Hauptgründe folgende: Die Führungspersönlichkeiten der KPdSU waren – als Produkte des kommunistischen Regimes – nicht darauf vorbereitet, in einem zunehmend offeneren und kompetitiveren Umfeld um die Macht zu kämpfen. So waren sie auch dazu nicht in der Lage, bei der sich verschärfenden Wirtschaftskrise der Sowjetunion als Führungspersönlichkeiten aufzutreten. Die sowjetische Führung konnte im Wesentlichen keine entsprechenden Antworten auf die wirtschaftlichen Herausforderungen geben. Deutlich zeigt dies, dass 1990/91 die kommunalen Führungskräfte und die Intelligenz bereits das Nahen der Krise wahrnahmen, nicht aber das Zentralkomitee, da es seinen Bezug zur Realität verloren hatte. Prozumenščikov demonstrierte die Krise der Macht mit dem Erodieren der Parteiorganisation. Während 1990 die Zahl derjenigen, die aus der Partei austraten, noch um 2600 Personen lag, überstieg sie 1991 bereits zwei Millionen. Die offiziellen Begründungen sprechen klare Worte: der Verlust der Privilegien, Enttäuschung durch die Führung bzw. die sozialistischen Prinzipien (mehr als die Hälfte der Befragten gab dies als Grund an) und schließlich Angst vor Behelligungen bzw. Sorge um die Sicherheit von Familienmitgliedern. Prozumenščikov machte darauf aufmerksam, dass die Krise durch die neuen gesellschaftlichen Bewegungen, die wie Pilze aus dem Boden schossen, zusätzlich Zündstoff erhielt. Diese demokratischen Kräfte wollten das System nicht mehr von innen heraus verändern: unter ihren Forderungen befanden sich Punkte, die bislang als Tabu gegolten hatten, wie etwa die Auflösung der KPdSU bzw. der Rücktritt Gorbatschows. Prozumenščikov argumentierte abschließend, dass es aufgrund der oben genannten Gründe auf jeden Fall früher oder später zum totalen Zerfall der KPdSU und dem Rücktritt Gorbatschows gekommen wäre. Dazu bedurfte es seiner Meinung nach nicht des Putschversuchs im August 1991. Stefan Karner (Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz – Wien) wies in seinem Vortrag mit dem Titel Das Ende der Planwirtschaft eingangs auf die immensen Disparitäten der Wirtschaft der UdSSR hin, die bereits Anfang der 1980er Jahre mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Karner deutete in diesem Zusammenhang auf das frühe wirtschaftliche Reformdrängen Gorbatschows hin. Bereits ein Jahr vor seiner Wahl zum Generalsekretär forderte Gorbatschow 1984 die Verstärkung der Disziplin, der Verantwortung der Beschäftigten und der Verbesserung der Produktionsstrukturen. Zudem forderte er ein, stärker Bedürfnisse der Menschen im Blick zu haben und eine qualitative Steigerung der Produktion zu erreichen. Im September 1986 beschloss das Politbüro zahlreiche Reformmaßnahmen. Unter anderem sollte der Landwirtschaft eine stärkere Rolle zukommen, Unternehmensleiter sollten verstärkt animiert werden, Eigenverantwortung zu übernehmen. Die Reformen blieben nicht ergebnislos (beispielsweise wuchs die Selbstständigkeit der Unternehmen), jedoch hatten sie sowohl für die Gesellschaft als auch den Staat enttäuschende Folgen. Die sowjetischen wirtschaftlichen Indizes zwischen 1989 und 1991 waren allesamt rückläufig: die industrielle Produktion sank stark ab, das BIP fiel zurück. Zwischen 1985 und 1991 erlebte die Sowjetunion einen derart allgemeinen Verfall, der schließlich zum wirtschaftlichen Bankrott führte. Karner strich heraus, dass seiner Meinung nach die Gründe des wirtschaftlichen Zerfalls in erster Linie systemimmanent seien. Gorbatschows teils halbherzige oder oft wegen Widerstände orthodoxer Kreise nicht in vollem Umfang durchführbare Reformunternehmen beschleunigten den Zusammenbruch der Wirtschaft. Karner betonte, auch eine andersgeartete Politik hätte den Ausgang nicht anders gestalten können, den völligen Kollaps höchstens verlangsamen können. 2 In den folgenden zwei Panels wurden die Transformationsjahre in den ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten beleuchtet. Csaba Békés (Ungarische Akademie der Wissenschaften/ Corvinus-Universität, Budapest) untersuchte in seinem Vortrag Der politische Transformationsprozess in Ungarn 1988–1991 den weltpolitischen Kontext des mittelosteuropäischen politischen Wandels. Im Fokus des Beitrags stand unter anderem die Skizzierung der Bruchlinien innerhalb des Warschauer Pakts. Nach der Machtübernahme Gorbatschows entstand im sowjetischen Block eine Art sowjetisch-ungarisch-polnische virtuelle Koalition, die die Reformpolitik über bilaterale Kanäle miteinander abstimmte und sich bemühte, diese gegenüber den anderen Ländern wie der DDR, die sich den Reformen widersetzten, auf den multilateralen Foren des sowjetischen Blocks zu repräsentieren. Nach Békés spielte die ungarische Führung im Hinblick auf Gorbatschows Reformen gleichzeitig die Rolle des besten Schülers und des besten Lehrmeisters. Die Erfolge der ungarischen Landwirtschaft erwiesen sich zumindest als wichtige Referenzen. Bedeutsame Veränderungen im sowjetischen Verhältnis zu Osteuropa traten allerdings erst im Sommer 1988 ein. Das neue Sozialismus-Modell ließ den Experimenten in der Region, in erster Linie in Polen und Ungarn, großen Raum, ebenso die Absage der sowjetischen Führung, keine Gewalt mehr anzuwenden, wenn das kommunistische System in einem der „Bruderländer“ in Gefahr geraten würde. Diese radikale Veränderung im Diskurs konnte allerdings nicht offen ausgesprochen werden. So hielt man die Brežnev-Doktrin in der Schwebe, letztlich bis zum Herbst 1989. Während in zahlreichen Deklarationen öffentlich das Recht auf einen eigenständigen Weg erklärt wurde, machte die sowjetische Führung auf bilateraler Ebene die lokalen Führungskräfte darauf aufmerksam, dass als nicht zu überschreitende Grenze die Aufrechterhaltung des Sozialismus gelte. Békés maß in weltpolitischer Hinsicht der Warschauer Sitzung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Pakts im Sommer 1988 besondere Bedeutung bei. Hier gestand der sowjetische Außenminister Eduard Ševardnadze ein, dass sich die Sowjetunion und der gesamte Block in einer Krise befänden und der „Westen“ in allen nur erdenklichen Bereichen im Wettstreit besiegt hätte. Von diesem Zeitpunkt an erlangte die Abrüstung – selbst mit einseitigen Zugeständnissen – oberste Priorität. Dies war nach Békés Ansicht eine Grundvoraussetzung für die folgende sowjetische Akzeptanz des Veränderungsprozesses in Osteuropa und damit für die Aufgabe der Brežnev-Doktrin. Békés betonte zudem, dass die Akzeptanz des inneren politischen Wandels von Seiten Gorbatschows nicht auch die Aufgabe der sowjetischen Interessensphäre bedeutete. Dies galt auch reziprok für die Westmächte, die bis Ende 1990 stark dem bipolaren Denken verhaftet waren und die „Unabhängigkeitsbestrebungen“ in Osteuropa zunächst keinesfalls befürworteten. Nicht einmal das Streben nach Neutralität unterstützten sie. Man betrachtete die Existenz des Warschauer Paktes und der NATO als das europäische Sicherheitssystem, das den Grundpfeiler der Stabilität darstellte. Daher drängte man sogar die neuen, nach freien Wahlen an die Macht gekommenen, demokratisch legitimierten Regierungen im Frühjahr 1990 dazu, an ihrer Mitgliedschaft im Warschauer Pakt festzuhalten. Békés brachte zum Ausdruck, dass in den Jahren 1989/90 sowohl die UdSSR als auch die Westmächte gleichermaßen an einer Art „Finnlandisierung“ der mittelost- und osteuropäischen Staaten interessiert waren. Neben dem sicherheitspolitischen Denken ging es vielen westlichen 3 Politikern auch darum, mit dieser Art Unterstützung für Gorbatschow dessen Machtposition im Kreml nicht zu gefährden. Doch vor allem die ungarische und tschechoslowakische Führung – später auch die polnische – arbeiteten verstärkt auf die Auflösung des Warschauer Paktes hin. Die durch die zunehmend chaotischeren inneren Verhältnisse bedrängte sowjetische Führung gab dem Drängen schließlich nach. Ende Juni, Anfang Juli 1991 kam es damit zu der beinahe zeitgleichen Auflösung des RGW und des Warschauer Pakts, was der Befreiung der Staaten Osteuropas von der sowjetischen Hegemonie gleichkam. Bogdan Musial (Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität, Warschau) widmete sich in seinem Vortrag dem Weg zum „Runden Tisch“ in Polen. Er betonte, dass die Veränderungen in Polen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre nur in der Relation zur Lage in der Sowjetunion untersucht werden könnten. Nachdem Wojciech Jaruzelski 1981 das Kriegsrecht ausgerufen hatte, um die „Solidarność“-Bewegung zu zerschlagen, verhängten die USA ein Wirtschaftsembargo, das den wirtschaftlichen Niedergang Polens beschleunigte. Von dem Embargo wurde auch die Sowjetunion betroffen. Nach wenigen Jahren wurde dem Jaruzelski-Regime klar, dass ohne tiefgreifende wirtschaftliche und politische Reformen die Krise in Polen nicht überwunden werden könne. Jaruzelski und seine Vertrauten scheuten sich jedoch, diese ohne Genehmigung aus Moskau einzuführen. Erst die Perestrojka hatte die außenpolitischen Rahmenbedingungen für die nötigen Reformen geschaffen. Die ersten halbherzigen Reformen (ab 1986) scheiterten jedoch, sie steigerten lediglich den Unmut der Bevölkerung. Die erste große Streikwelle vom April 1988 konnte noch „befriedigt“ werden, ohne jedoch die Lage im Land zu stabilisieren. Wenige Monate später, im August 1988, erfasste Polen erneut eine Streikwelle. Vor diesem Hintergrund schlug das kommunistische Regime der immer stärker werdenden Opposition Verhandlungen vor, die zum „Runden Tisch“ führten. Ende 1988 wurden grundlegende wirtschaftliche Reformen eingeführt, die das Ende der sozialistischen Wirtschaftsordnung einleiteten. Musial betonte abschließend, dass der „Runde Tisch“ nicht ohne die Perestrojka in der Sowjetunion und zugleich den breiten und sich radikalisierenden Widerstand in Polen gegen das KP-Regime zustande kommen hätte können. Dies leitete die politische Transformation im Jahre 1989 ein. Hermann Wentker (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, Abt. Berlin) zeigte in seinem Vortrag Zwischen Isolation und Wiedervereinigung: Die Außenpolitik der DDR 1989/90 zunächst, dass sich die DDR bereits vor der friedlichen Revolution im Ostblock isoliert hatte. Er erläuterte dies anhand des am 19. Januar 1989 abgeschlossenen KSZENachfolgetreffens in Wien, anhand des Systemwechsels in Polen infolge der Wahlen vom Juni 1989 und anhand des schwindenden Rückhalts in der Sowjetunion, die mit dem Besuch Gorbatschows in Bonn im Juni verdeutlichte, dass ihr die Beziehungen zur Bundesrepublik wichtiger waren als die zur DDR. Deutlich bemerkbar machte sich der mangelnde Rückhalt der DDR im Ostblock im Zuge der Flüchtlingskrise ab August 1989: Weder Ungarn noch die Tschechoslowakei zeigten sich solidarisch mit der DDR, sondern gestatteten den DDRFlüchtlingen in ihren Ländern die Übersiedlung in die Bundesrepublik. Nach dem Wechsel von Honecker zu Krenz und dem Mauerfall am 9. November 1989 klammerte sich die DDR-Führung zunächst noch an die Hoffnung, in einem reformierten sozialistischen System die Eigenständigkeit der DDR zu erhalten. Als jedoch immer 4 deutlicher wurde, dass alles auf eine Wiedervereinigung hinauslaufen würde, verengte sich der Handlungsspielraum der Ost-Berliner Führung dramatisch, so dass diese die Idee einer eigenständigen DDR aufgeben musste. Bei der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 siegten die Kräfte, die eine möglichst rasche Wiedervereinigung anstrebten. Gleichzeitig fand ein Wechsel im politischen Spitzenpersonal statt. Die neue Spitze des DDR-Außenministeriums um Markus Meckel erkannte allerdings weder, dass sie über so gut wie keinen Handlungsspielraum mehr verfügte, noch dass sie auf eine möglichst enge Abstimmung mit der Bundesregierung angewiesen war. Sie versuchte vielmehr, sowohl im bilateralen Verhältnis zu Polen als auch in multilateralen Sicherheitsfragen einen anderen Kurs zu steuern als die Bundesregierung. Mit diesen Versuchen, den Vereinigungsprozess für eine Neugestaltung der europäischen Ordnung zu nutzen, musste sie angesichts ihrer schwachen Verhandlungsposition jedoch kläglich scheitern. Iskra Baeva (Kliment-Ohrid-Universität, Sofia) konzentrierte sich in ihrem Vortrag Bulgarien – der schwere Lösungsprozess von der Sowjetunion auf zwei Fragen: das Problem der türkischen Minderheit, bzw. der aus der Schwächung und späteren unerwarteten Auflösung der Sowjetmacht resultierenden Herausforderungen. Im ersten Teil ihres Beitrags erläuterte Baeva die in wirtschaftlicher Hinsicht schwerwiegenden Folgen des Massenexodus der türkischen Minderheit, die das KP-Regime unter Todor Živkov 1989 verfügt hatte. Die Ernte geriet in Gefahr und auch in der industriellen Produktion taten sich schwerwiegende Probleme auf. Inmitten dieser problematischen Situation trafen im Juni 1989 Živkov und Gorbatschow ein letztes Mal einander. Der bulgarische KP-Chef sprach sich dabei offen gegen die sowjetischen Reformen aus, nicht aber ohne Gorbatschow zu versichern, dass sein Land der einzige loyale Verbündete der Sowjetunion sei. Der Einfluss der damaligen, den Reformen verschriebenen sowjetischen Führung erwies sich für Sofia jedoch als ein zweischneidiges Schwert. Die Adaption der sowjetischen Reformen in Bulgarien hätte nämlich zwangsläufig die Macht der kommunistischen Partei gemindert. Doch die Notwendigkeit von Reformen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, hatte auch Živkov längst erkannt. Nachdem sich die KP sogar zu einer Öffnung und zu politischem Pluralismus entschlossen hatte, kam es zu einem – mit sowjetischer Unterstützung durchgeführten – Putsch in der Partei. Bei den späteren freien Wahlen erlangte trotz allem die kommunistische Nachfolgepartei die absolute Mehrheit. Sie erkannte zu diesem Zeitpunkt, dass der Preis für die Absage an das Machtmonopol der Partei eine künftige westliche Orientierung war. In diesem Geist wurde 1991 schließlich auch eine Verlängerung des Freundschafts- und Beistandsvertrages zwischen der UdSSR und Bulgarien aus dem Jahr 1948 nicht weiter verfolgt. Der Zusammenfall der Sowjetunion führte allerdings zugleich drastisch vor Augen, in welchem Maße Bulgarien sowohl im Energiesektor als auch hinsichtlich der Exportmärkte auf Moskau angewiesen war. In diesem Bewusstsein sei, so Baeva, war für die postkommunistische bulgarische Führung eine Orientierung des Landes am Westen unerlässlich und die einzige Option gewesen. Mark Kramer (Harvard University, Cambridge) befasste sich in seinem zweiten Vortrag mit dem Titel Das blutige Ende Ceauşescus mit der Zwiespältigkeit des Regimes des rumänischen Diktators. Während Ceauşescu als Reformer in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre als Unterstützer des „Prager Frühlings“ aufgetreten sei, habe er Ende der 1980er Jahre jeglichen Reformbemühungen im Sozialismus den Rücken gekehrt. Kramer begründete dies 5 unter anderem damit, dass das Regime nicht in der Lage war, den zunehmenden wirtschaftlichen Problemen in entsprechender Weise gerecht zu werden und daher versuchte, die politische Stabilität mit einer immer stärkeren Unterdrückung zu bewahren. Die autonome Außenpolitik begünstigte hier nicht eine Öffnung zum Westen, sondern ganz im Gegenteil: Rumänien verfolgte eine Außenpolitik, die den Reformen im Ostblock trotzte und sie von Grund auf ablehnte. Gerade diese autonome Außenpolitik habe den Ländern des sowjetischen Blocks nicht ermöglicht, Druck zur Aufweichung des Regimes auszuüben. Dieses Phänomen spitzte sich schließlich am Vorabend der polnischen Wahlen im Juni 1989 zu, als Ceauşescu im Sinne der Brežnev-Doktrin auf eine Intervention – die er 1968 vehement abgelehnt hatte – in Polen drängte. Im Unterschied zu 1968, als er keine Gefahr für den Ostblock sah, sondern die Reformen des Sozialismus begrüßte, verstand er im Sommer 1989 die – aus seiner Sicht – weitreichenden Folgen, die zu einem Verlust des Machtmonopols nicht nur der polnischen, sondern sämtlicher osteuropäischer kommunistischer Parteien, führen würde. Von den Demonstrationen 1989 in Siebenbürgen war der rumänische Führer überrascht. Nach Ansicht Kramers begünstigte die plötzliche Absetzung Ceauşescus den Volksaufstand aber nicht. Zur Untermauerung der These, innere Kreise hätten sich gegen den Diktator verschworen, führte Kramer an, dass es bei der Unterdrückung des Aufstands erst nach der Flucht Ceauşescus zum Blutbad gekommen sei, sodass letzten Endes nicht er für den Tod der Opfer verantwortlich gemacht werden könne. Kramer verdeutlichte abschließend, dass die Absetzung Ceauşescus noch nicht das Ende des Regimes bedeutet habe. Auch wenn Anfang der 1990er Jahre zweifelsohne eine Öffnung in Richtung Demokratie erfolgt sei, wären die Mitglieder des alten Regimes noch lange in ihren Machtpositionen geblieben. Die Vorträge des folgenden Panels widmeten sich der spätsowjetischen Geschichtspolitik und dem langen Weg zur Anerkennung der Existenz des Geheimen Zusatzprotokolls des HitlerStalin-Paktes von 1939 und der Ermordung der polnischen Elite in Katyn auf Befehl der Stalinschen Führung. Boris Chavkin (Russische Staatliche Geisteswissenschaftliche Universität, Moskau) zeichnete in seinem Vortrag den langen Weg nach, der beschritten wurde, bis er 1992 als erster das sowjetische Protokoll des Geheimen Zusatzprotokolls des Hitler-Stalin-Paktes in Russland veröffentlichen konnte. Ein halbes Jahrhundert lang hatte die sowjetische Führung dessen Existenz verleugnet. Nach Valerij Boldin, dem Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU, hätte man auch noch in der Spätphase der UdSSR „die ganze Welt“ deshalb diese Unwahrheit glauben machen wollen, weil Gorbatschow negative Folgen einer Veröffentlichung gefürchtet habe. Doch weder ließ sich mit dieser Lüge die Sowjetunion aufrechterhalten, noch das Amt Gorbatschows als Staatspräsident retten, so Chavkin. Das Protokoll wurde erst kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion an die Öffentlichkeit gebracht, jedoch basierte dieses zunächst einmal nicht auf den Originaltexten aus sowjetischen Archiven, sondern auf deutschen Kopien. Zur Enthüllung des Originaldokuments kam es erst im postsowjetischen Russland. Ausschlaggebend dafür waren dann aber weniger wissenschaftliche als vielmehr politische Interessen; die Veröffentlichung bekräftigte nämlich Gorbatschows Niederlage gegenüber Boris Jelzin. Das sowjetische Originaldokument wurde schließlich am 27. Oktober 1992 im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. 6 Natal´ja Lebedeva (Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau), eine der Mitentdeckerinnen sowjetischer Originaldokumente über das Massaker in Katyn im Jahre 1990, wies darauf hin, dass eine Umwertung der Katyn-Frage bereits 1988 in der KP zur Sprache gekommen sei, doch hätte die Mehrheit – unter Außerachtlassung der gegenteiligen Meinung Aleksandr Jakovlevs – dagegen gestimmt. 1990 kam das Thema Katyn – betrieben von Historikern wie Lebedeva selbst – schließlich in die sowjetische Presse und rückte damit ins öffentliche Bewusstsein. Als sich der polnische Präsident Jaruzelski am 30. April in Moskau aufhielt, konnte die Politik diese Angelegenheit nicht mehr unter den Teppich kehren. Es folgte eine Untersuchung durch die sowjetische Staatsanwaltschaft. Ein Teil der Dokumente wurde von Gorbatschow an Jelzin übergeben, 1992 schließlich dem polnischen Präsidenten Lech Wałęsa. Irina Kazarina (Russisches Staatsarchiv für Zeitgeschichte, Moskau) gab in ihrem Vortrag über Die Öffnung der sowjetischen Archive einen Überblick über die ersten Deklassifizierungen der bis dahin streng unter Verschluss gehaltenen Archivbestände. Die erste wichtige Station auf diesem Weg war die Herausgabe der neuen Monatszeitschrift „Vesti CK KPSS“ (Nachrichten des Zentralkomitees der KPdSU), in der neben aktuellen Fragen zur Innen- und Außenpolitik auch die Rubrik Aus dem Parteiarchiv erschien. Glasnost´ brachte mit sich, dass sich zusehends die Führungen aus den „Bruderländern“ an Moskau wandten, mit der Bitte um Archivunterlagen. Dies betraf anfangs in erster Linie Anfragen nach in der Sowjetunion in der Stalin-Zeit zu Tode gekommenen oder als vermisst geltenden Kommunisten, aber etwa auch den Ungarn-Aufstand von 1956 oder die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 1968, Themen, die die künftig neu zu gestaltenden bilateralen Beziehungen belasteten. Begründet wurde dies oftmals, so Kazarina, damit, dass dies „die anwachsenden gesellschaftlichen Spannungen mindern“ würde. Den wesentlichen Impuls zu einer wirklichen Öffnung der Archive gab aber erst das Verbot der KPdSU im August 1991, als Jelzin Beweismaterialien „zum verbrecherischen Wesen“ der Kommunistischen Partei zusammentragen ließ. Erst die Gesetzgebung in den Folgejahren regelte den Zugang zu den Archiven. Die letzten beiden Panels widmeten sich dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und daraus resultierenden Folgen. Gerhard Wettig (Institut für Zeitgeschichte, München) betonte in seinem Vortrag mit dem Titel Gorbatschow und der Warschauer Pakt eingangs, dass der Kremlchef das Bündnis der UdSSR mit den anderen sozialistischen Staaten nicht aufzugeben gedachte. Die Auflösung des Warschauer Pakts, so Wettig, war eine Spätfolge der fundamentalen Krise, der sich Gorbatschow schon bei seinem Amtsantritt gegenübersah. Sowohl die sowjetische Sicherheits-, Außen- und Innenpolitik als auch der Zusammenhalt der Verbündeten waren an einem Punkt angelangt, an dem man nicht so weitermachen konnte wie bisher. Gorbatschows Versuche, die Probleme durch Reformen zu lösen, blieben vergeblich. Die Situation verschlechterte sich immer mehr. Wie Wettig ausführte, war es schon Mitte 1989 sehr unwahrscheinlich geworden, dass die Krise noch überwunden werden konnte In der zweiten Hälfte des Jahres schritt die Entwicklung so rasch fort, dass die kommunistischen Regime im Vorfeld der UdSSR nacheinander zusammenbrachen. Damit wurde dem Warschauer Pakt die Grundlage entzogen. Die Mitgliedsländer, die sich nunmehr ohne Zwang entscheiden konnten, enttäuschten die Hoffnung Gorbatschows, dass sie weiter zum Pakt gehören wollten, 7 wenn dieser sich in ein politisches Bündnis ohne Bekenntnis zum Sozialismus verwandele. Wie sich die Krise des sowjetischen Lagers seit 1985 entfaltete und wie Gorbatschow sie in den folgenden entscheidenden Jahren zu überwinden suchte, ist bisher nicht näher untersucht worden. Wettig beabsichtigt, in seinem Beitrag zu dem Projektband die damit verbundenen Entwicklungen aufgrund einschlägiger sowjetischer Quellen ausführlich darzustellen. Ol´ga Pavlenko (Russische Staatliche Geisteswissenschaftliche Universität, Moskau) suchte in ihrem Vortrag Der letzte Warschauer-Pakt-Gipfel vor dem Fall der Berliner Mauer die Antwort auf die Frage, warum dieses Treffen in der Geschichte der Organisation einen Wendepunkt bedeutete. Zunächst legte sie die Fakten der Sitzung dar und betonte, dass bei diesem Treffen erstmals den Realitäten ins Auge gesehen worden sei. Gorbatschow erklärte den Genossen, der Kalte Krieg sei zu Ende und ein neuer historischer Abschnitt habe begonnen, der nicht länger durch die Konfrontation der beiden Blöcke gekennzeichnet sein würde. Der Abschluss der Konfrontation würde jedoch, wie Gorbatschow damals noch hoffte, nicht allein das Ende des Warschauer Paktes, sondern auch das der NATO bedeuten. Thomas Wegener Friis (Süddänische Universität) gliederte seinen Vortrag Westarbeit der DDR-Staatssicherheit und die Geheimdienstforschung, der auf gemeinsamen Forschungen mit Helmut Müller-Enbergs (BStU) basiert, in drei Teile. Er behandelte die Auswirkungen der Ereignisse von 1989 auf die Agenten des Nachrichtendienstes, ging der Frage nach, ob die Veränderungen von 1989 vom Nachrichtendienst vorauszusehen waren und skizzierte die Reaktionen des Nachrichtendienstes auf die politischen Umwälzungen. Friis betonte, dass die Beziehungen zwischen dem ostdeutschen und dem sowjetischen Nachrichtendienst auf vollkommen anderen Grundlagen basierten als die Kontakte der Nachrichtendienste des westlichen Blocks zueinander. Dies habe sich darin geäußert, dass die Agenten der DDR ihre außerordentlich vielen Informationen in ihrer Ursprungsfassung und unverzüglich an den KGB weitergaben. Er unterstrich, dass eine solche Praxis bei den westlichen Nachrichtendienste nicht üblich war und diese die USA keinem Automatismus folgend über ihre Erkenntnisse informierten. Die Ereignisse von 1989 beurteilte Friis aus der Geheimdienstsicht auch als ein Scheitern des Staatssicherheitsdienstes. Dieser konnte seine Aufgaben, die territoriale Integrität der DDR und die Verteidigung des politischen Systems zu garantieren, nicht mehr versehen. Zwar wären die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestanden, allerdings hatte man sich viel stärker auf eine äußere Bedrohung durch den Westen konzentriert und war so nicht auf einen inneren Zusammenfall vorbereitet. Nach den Ereignissen des Jahres 1989 und danach wurden zwei Zielsetzungen formuliert: 1. die Gewährleistung des Überlebens der Organisation, 2. die Vernichtung der Archive. Ersteres blieb aus. Der Nachrichtendienst wurde zwar in einzelne Einheiten unterteilt, die sich mit dem Ausland, dem Inland und militärischen Fragen beschäftigten. Doch nur der militärische Nachrichtendienst konnte noch für kurze Zeit weiter bestehen. Die zweite Zielsetzung wurde zum Bedauern der Historiker relativ effektiv verwirklicht. Anfang der 1990er Jahre kam die CIA in Besitz der sogenannten Rosenholz-Karteikarten und konnte damit das gesamte Netzwerk der HVA (Hauptverwaltung Aufklärung) enttarnen. Später machte die CIA auch anderen westlichen Regierungen einen Großteil der Informationen zugänglich. Auf diese Weise, so Friis, konnten Personen, die für den einstigen Staatssicherheitsdienst der DDR tätig gewesen waren, in Schach gehalten werden konnten. 8 Magdolna Baráth (Historisches Archiv der ehemaligen Geheimdienste, Budapest) sprach über den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn und Mittelosteuropa. Nach der Rede Gorbatschows vor der UNO im Dezember 1988 war der ungarischen Regierung deutlich geworden, dass die Abrüstung von nun an im sowjetischen Block Priorität haben würde. In der Folge übernahmen die Ungarn die Initiative und argumentierten auf dem Weg über bilaterale Kanäle, dass der Abzug der sowjetischen Truppen auch für die UdSSR mit positiven wirtschaftlichen Wirkungen einhergehen könne. Baráth wies darauf hin, dass die Sowjetunion die Stationierung atomarer Waffen in Ungarn strengstens geheim hielt. Nur KP-Chef J. Kádár bzw. 1988 sein Nachfolger K. Grósz und wenige Vertraute waren informiert (darunter nicht einmal der Verteidigungsminister, der später sogar eingestand, dass selbst beim Abzug des atomar bestückten Waffenarsenals niemand etwas mitbekam.) Für den Abzug der Truppen forderte die UdSSR eine Entschädigung für die infrastrukturellen Investitionen auf den militärisch genutzten Gebieten. Demgegenüber wandten die Ungarn, aber auch die anderen betroffenen Länder, in denen die sowjetischen Truppen bislang stationiert gewesen waren, ein, dass diese Investitionen ohne ihre Genehmigung und Einwilligung geschehen seien. Zudem waren die für den zivilen Nutzen gebauten Anlagen unbrauchbar geworden. Man drehte sogar den Spieß um und stellte nun erhebliche Schadensansprüche an die Sowjetunion. Diese Konfrontation führte im Fall Ungarns sogar so weit, dass ein sowjetischer Offizier hohen Ranges mit dem Stopp des Truppenabzugs drohte, falls Ungarn nicht zahlen würde. Schließlich gelang es aber, diese Probleme auf oberster Ebene zu schlichten. Harald Knoll (Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz – Wien) erinnerte in seinem mit Fotografien illustrierten Vortrag Österreich und der JugoslawienKrieg an den slowenischen Zehn-Tage-Krieg, der nach der Proklamation der Unabhängigkeit Sloweniens am 25. Juni 1991 ausgebrochen war, und an den Ausbruch des Krieges in Kroatien 1991. Die beim Vortrag gezeigten Bilder belegten, dass es zu Verletzungen des österreichischen Luftraums kam und sich das Kriegsgeschehen teilweise auch auf österreichisches Staatsgebiet verlagerte. So bombardierte die jugoslawische Luftwaffe Grenzübergänge zu Österreich. Ein steirischer General hatte eigenmächtig eine Truppenübung im Grenzbereich verordnet. Die in der Öffentlichkeit als erste Mobilmachung des Österreichischen Bundesheeres in der Zweiten Republik gedeutet wurde, war tatsächlich keine. In der Folge hatte die österreichische Bundesregierung dann aber noch massiver Truppenverbände an die Grenze verschoben. Erste Dokumente geben einen Einblick, dass sich die österreichische Politik anfangs uneins war. Einige fürchteten bei einer Abspaltung Sloweniens sogar als Folge eine Abtrennung des gemischtsprachigen Südkärntner Gebietes. Politiker wie Alois Mock unterstützten in der Folge aber die Unabhängigkeitsbestrebungen Kroatiens und Sloweniens. Knoll betonte abschließend, dass die Herausbildung der jugoslawischen Nachfolgestaaten künftig verstärkt als Folge des Zerfalls des Ostblocks untersucht werden sollte. Vladislav Zubok (Temple University, Philadelphia) hielt – in Anlehnung an seine preisgekrönte Monographie – den Schlussvortrag mit dem Titel A Failed Empire: The End of an Era. Den letzten Tagen des Sowjetreichs näherte er sich von der gesellschaftlichen Wahrnehmung aus. Nach Ansicht Zuboks wurde der Verlust der osteuropäischen „Pufferzone“ für die sowjetische Gesellschaft nicht als Tragödie wahrgenommen. 9 Gorbatschow blieb ja auch an der Macht, selbst nachdem er auf diese Region „verzichtet“ hatte. Der Grund dafür, so Zubok, sei klar, die sowjetische Gesellschaft hatte sich zu jener Zeit mit anderen, ernster zu nehmenden Problemen auseinanderzusetzen. Die Frage Osteuropas war für sie somit ein drittrangiges Problem. Für die sowjetische Politik hingegen lag die Priorität darauf, den Abspaltungstendenzen eigener Regionen des Reiches entgegenzutreten. Hinzu kam eine Krise in der Lebensmittelversorgung. Die Lebensmittelpreise schnellten in die Höhe, was die Legitimation der Führung grundlegend erschütterte. Hinzu kam auch die zunehmend bedeutendere Rolle der Medien und des Fernsehens, womit eine neue Öffentlichkeit geschaffen wurde, die die Führung mittels der alten Institutionen nicht mehr im Zaum halten konnte. Die Konferenz gab interessante Einblicke in ein internationales Forschungsprojekt, in dem vielfältige diplomatiegeschichtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte verknüpft werden. Die Tatsache, dass sich unter den Referenten sowohl Wissenschaftler aus den Ländern des einstigen Ostblocks als auch „westliche“ Historiker befanden, bereichert die Forschung in hohem Maße. Auch wenn man das Ende dieser Epoche noch kaum endgültig als Ganzes einschätzen kann und Differenzierungen nötig sind, kann man festhalten, dass die meisten Akteure der damaligen sozialistischen Staatenwelt aus vielen Gründen nicht in der Lage waren, die Herausforderungen, die sich Ende der 1980er Jahre auftaten, zu handhaben. Die Reformen Gorbatschows dürften eher – ungewollt – für eine Verkürzung des Todeskampfes des Ostblocks gesorgt haben. Zu erkennen ist jedoch auch, dass wohl niemand auf den „frühen Tod“ des sowjetischen Imperiums vorbereitet war – weder Politiker im Westen noch im Osten. Dóra Ilona Veress- Student Corvinus University of Budapest Dániel Vékony - PhD Student Corvinus University of Budapest 10