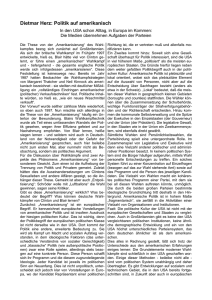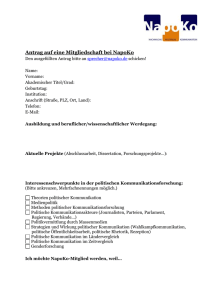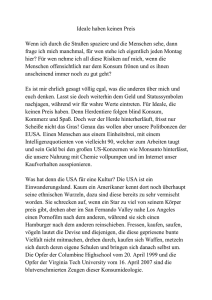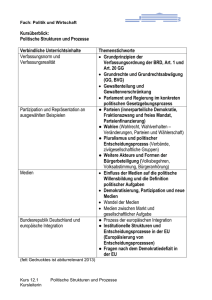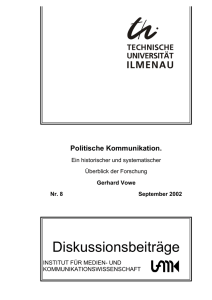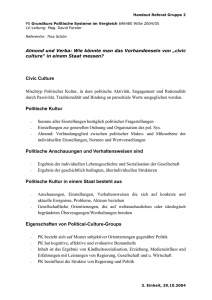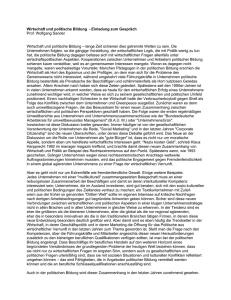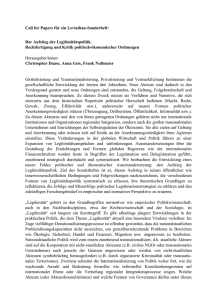Leseprobe - Die Kanzler und die Medien
Werbung

Die behauptete Amerikanisierung Eine erste Annäherung an unser Thema bietet ein kurzer Flug über den Atlantik, der uns zur Generalthese des Wandels politischer PR führt: Der Amerikanisierung. Auch hier gilt es, Mythen zu entzaubern. Vorweggeschickt: Ja, es gibt so etwas wie eine Amerikanisierung der politischen Kommunikation in der Bundesrepublik. Diese »Amerikanisierung«, die allerdings viel eher als ein Abschauen der modernsten Kniffe daherkommt, ist allerdings viel älter, als die meisten Autoren und Kommentatoren uns glauben machen wollen. Die Amerikanisierungsdebatte1 war in Deutschland zu keiner Zeit ideologiefrei und ist es bis heute nicht. Besonders die Achtundsechziger prägten sie leidenschaftlich und überfrachteten den Begriff der Amerikanisierung mit Schlagworten wie dem vermeintlichen »Kulturimperialismus« der USA. Wer redlich argumentieren will, kann seit 1968 praktisch nicht mehr von Amerikanisierung sprechen, ohne sich dem Verdacht politischer Einseitigkeit auszusetzen. Die hohen, emotionalen Wellen, die die ohne Zweifel umstrittene Politik George W. Bushs seit dem 11. September und das Nein Gerhard Schröders zum Irakkrieg auslösten, zeigen, wie tief verwurzelt anti-amerikanische Ressentiments in Teilen der bundesrepublikanischen Gesellschaft sind. Der »gütige Hegemon«2, der in unseren Tagen in Selbstzweifel über seine Rolle in der neuen monopolaren, aber nicht minder bedrohten Weltordnung verfällt, ist für die Deutschen ein in allen Facetten schimmerndes fascinosum et tremendum. Faszination und Furcht liegen beim Blick über den Atlantik stets dicht beieinander. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Politik. Allerdings hat hier ein historischer Bedeutungswandel stattgefunden: Während früher eher die Fremdbestimmung der Politik durch Werbeagenturen und Meinungsforschungsinstitute als typisch amerikanisch oder amerikanisiert kritisiert wurde, steht heute 22 D IE K ANZLER UND DIE M EDIEN vor allem die Medienfixierung von Politik unter Amerikanisierungsverdacht. Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass heute anders als in den fünfziger und sechziger Jahren die politische Meinungsbildung fast ausschließlich über Medienvermittlung bestimmt wird. Medienbezogene, politische Öffentlichkeitsarbeit hat die klassische, politische Werbung mittlerweile verdrängt und ist zum zentralen Feld der Politikvermittlung geworden. Vor allem die deutsche Kommunikationsforschung beschäftigt sich seit den neunziger Jahren intensiv mit der These der Amerikanisierung. Diese Beschäftigung unterliegt einer wellenartigen Konjunktur. In Wahljahren ist das Thema besonders schick, im Anschluss tritt es wieder deutlich in den Hintergrund. Die Wahlkampffixierung der meisten Autoren wird bereits anhand der Definitionsversuche sichtbar. Winfried Schulz beschreibt Amerikanisierung knapp als »einen Vorgang, dessen auffälligstes Merkmal die Übernahme von Wahlkampfmethoden aus den USA ist«.3 Barbara Pfetsch erklärt Amerikanisierung in ähnlicher, aber ausführlicherer Weise: »Die Personalisierung der Kampagne, die Hervorhebung des Kandidatenwettstreits, Elemente des Angriffswahlkampfes, Ereignis- und Themenmanagement, Professionalisierung und der Einsatz von Marketingmethoden – der Export von US-amerikanischen Wahlkampftechniken und die Globalisierung der US-Politikberatungsindustrie bewirken, dass die professionelle Wahlkampfkommunikation in den meisten westlichen Ländern ähnliche Charakteristika aufweist.«4 Das Kopieren von professionellem PR-Know-how aus den USA ist ein zentraler Aspekt der Amerikanisierungsdiskussion. Eine so verstandene »Amerikanisierung« hat in Deutschland ohne Zweifel stattgefunden und findet nach wie vor statt. Winfried Schulz meint hierzu: »Eine Orientierung an den Konzepten und Praktiken der Wahlkampfführung in den USA ist inzwischen selbstverständlich für europäische Kampagnenmanager.«5 Zumindest für die Bundesrepublik ist eine derartige Orientierung jedoch nicht erst inzwischen, sondern bereits seit sechzig Jahren selbstverständlich. Wir werden noch ausführlich davon hören, dass bereits die Berater des ersten Kanzlers, Konrad Adenauer, in die USA reisten, dort das Gespräch mit ihren amerikanischen Kollegen suchten und viele Herangehensweisen mit nach Deutschland brachten. Gleiches gilt auch und in noch stärkerem Maße für die PR- D IE BEHAUPTETE A MERIKANISIERUNG 23 Berater Willy Brandts, die seit den sechziger Jahren eine enge Orientierung an US-amerikanischen Wahlkampfpraktiken erprobten. Die Mediendemokratie: Ein Modell für Deutschland? Die Verfechter der Amerikanisierung ordnen ihrer These aber noch viel weiter reichende Bereiche unter, die über die eng gefasste Bedeutung des reinen Methoden- und Strategietransfers hinaus gehen: Im Kern geht es um die Angleichung des gesamten politischen Systems in Deutschland an das amerikanische Modell der »Mediendemokratie«. – Sie argumentieren, in den Vereinigten Staaten habe das politische System sich weitestgehend den Gesetzmäßigkeiten der Medien unterworfen, weil es ohne sie nicht ausreichend Legitimität erhalte. Zeitverzögert geschehe dies nun auch in Europa. Eine solche Unterwerfung des politischen Systems unter das »Diktat« der Medien führe zwangsläufig auch zu einer sukzessiven Angleichung politischer Strukturen, Werte und Normen nach amerikanischem Muster. Die amerikanische Mediendemokratie und ihre spezifische politische Kultur erscheinen in dieser Argumentation als generalisierbare Blaupause des Wandels von Politiksystemen in westlichen Demokratien schlechthin. Die »Mediokraten« fürchten, durch die Unterwerfung des politischen Prozesses unter das »Joch« der universellen Funktionslogik der Medien verliere das politische System zunehmend seine Eigenlogik. So werde langfristig auch jede Form von strukturellem Unterschied zwischen den politischen Systemen westlicher Demokratien außer Kraft gesetzt. Diese sehr weitreichende Argumentation bedarf einer deutlichen Relativierung. Es ist zwar nicht zu leugnen, dass besonders das Fernsehen länderspezifische, kulturelle und institutionelle Besonderheiten, Werte und Traditionen universal überformt. Die kulturelle Wirkung optischer Medien vergleicht der bedeutende amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman mit dem Eindringen einer neuen Art in ein gewachsenes Ökosystem: Neue Techniken können ihm zufolge nicht ohne soziale Veränderungen in ein bestehendes System integriert werden. Sie wirken auf die Gesellschaft, die sie benutzt, weder additiv noch subtraktiv, sondern ökologisch. Das heißt: Kommt ein neues Medium 24 D IE K ANZLER UND DIE M EDIEN hinzu, ist es nicht einfach eine Ergänzung des bestehenden Gefüges. Wie in der Natur bewirkt das Auftauchen einer neuen Art immer auch ein neues, völlig anders ausbalanciertes System.6 Das Urheberrecht auf diese ökologische Wirkung vor allem des Fernsehens liegt aber nicht bei einem bestimmten Land. Das Fernsehen ist kein amerikanisches, sondern ein universelles Medium. Die Vereinigten Staaten sind nicht Vorbild, sondern lediglich Vorreiter einer globalen Transformation politischer Handlungsmuster durch den Diskurs elektronischer Medien. Sie waren das erste Land, in dem die Voraussetzungen für eine Mediatisierung von Politik flächendeckend existierten: eine demokratische Gesellschaftsordnung mit einem freien Markt konkurrierender Meinungen und eine Öffentlichkeit, die sich durch ein kommerzialisiertes Massenmediensystem mit dem Leitmedium Fernsehen strukturiert. Die immer größere Ähnlichkeit der politischen Kommunikation in westlichen Demokratien ist also letztlich vor allem auf die diskursive Wirkung moderner Medien als dem Hauptkampfplatz des Politischen in solchen Gesellschaften zurückzuführen. Dass die USA hier eine Vorreiterrolle spielen, ist historischer Natur und kaum Ursprung eines wie auch immer gearteten »Kulturimperialismus«. Die Anfänge der modernen, fernsehorientierten Politkampagnen liegen in den USA bereits im Eisenhower-Nixon-Wahlkampf 1952 und damit zwanzig Jahre vor den ersten großen Fernsehwahlkämpfen in Deutschland. Grundlegende Meilensteine waren damals die Fernsehwerbekampagne »Eisenhower answers America«, für die eigens der große Werbepionier Rosser Reeves engagiert wurde und der perfekt kalkulierte Studioauftritt, mit dem sich der damalige Eisenhower-Vize und spätere Präsident Richard Nixon suggestiv gegen Korruptionsvorwürfe wehrte. Nixon trat gemeinsam mit seinem kleinen Hund Checker auf und erklärte, dies sei das einzige Geschenk, das er jemals angenommen habe. Wenn man ihm seinen Hund wegnehmen wolle, so werde er sich dem Willen des Wählers fügen. Dieser Auftritt verlagerte den Wahlkampf zunehmend in den redaktionellen Teil des Fernsehens. Die Generierung von kostenloser Medienaufmerksamkeit wurde in den USA bereits ab den sechziger Jahren als so zentral angesehen, dass reine Werbeagenturen, die ausschließlich Kompetenzen im Bereich der »Paid Media« besitzen, bei politischen Kampagnen in den Hintergrund traten. Aufgrund dieser historischen Vorreiterrolle ist es nur logisch, dass der D IE BEHAUPTETE A MERIKANISIERUNG 25 Blick europäischer PR-Profis sich gerade nach Amerika wandte, um von diesen langjährigen Erfahrungen zu profitieren. Dies bedeutet aber nicht, dass sich durch die Übernahme von Methoden und Strategien der Politikvermittlung aus den USA auch das politische System als solches nach amerikanischem Muster verändert. Auch hier ist die Debatte noch immer von Vorurteilen und Missverständnissen beherrscht. Wer sich eingehender mit den Politiksystemen in Deutschland und den USA beschäftigt, muss zu dem Schluss kommen, dass das US-amerikanische Modell der Mediendemokratie wesentlich einzigartiger, als dies früher angenommen wurde. Dies ist für unsere weitere Diskussion nicht unerheblich. Denn entscheidend für Stil und Ausprägung politischer Öffentlichkeitsarbeit ist nämlich vor allem und in erster Linie die länderspezifische Bedeutung der Medien im Prozess der Politikvermittlung. Hier bestehen zwischen Deutschland und den USA gravierende Unterschiede: In den Vereinigten Staaten sind Medien die zentrale strategische Ressource zur Machtlegitimation und -sicherung und damit zur Herstellung jedweder politischer Handlungsfähigkeit. Dies war in der Vergangenheit und ist in Deutschland auch heute keineswegs der Fall. Während in den USA ein präsidiales Regierungssystem mit schwachen Parteien und einem stark fragmentierten, öffentlichen Willenbildungsprozess mit vielen Lobbygruppen besteht, verfügt die Bundesrepublik über ein repräsentatives Regierungssystem mit einer ausgesprochen dominanten Rolle der Parteien in allen Gesellschaftsbereichen und wenigen, aber starken Lobbygruppen. In den USA kann sich der Präsident nicht auf eine starke Partei berufen, sondern ist gezwungen, immer neue, an Einzelfragen orientierte nationale Koalitionen zu schmieden. Für diese überparteilichen Koalitionen wirbt er durch seine Medienperformance, in der Hauptsache durch seine Fernsehpräsenz, direkt bei den amerikanischen Wählern. Medienvermittelter Legitimität kommt in den USA zudem eine wesentlich größere Kontrollfunktion zu: Weder der Präsident noch die Secretaries of State können durch Misstrauensvoten abgelöst werden. Es besteht lediglich die mit hohen Hürden versehene Möglichkeit des Impeachment. Wie schwer es ist, einen einmal gewählten Präsidenten aus dem Sattel zu heben, zeigt der Umstand, dass es in der 230-jährigen Geschichte der USA erst einen Rücktritt eines Präsidenten, nämlich eben jenes Richard Nixon gab, der einer der Pioniere des modernen Fernsehwahlkampfs 26 D IE K ANZLER UND DIE M EDIEN war. In der Bundesrepublik gab es dem gegenüber bereits drei Kanzlerrücktritte in nur sechzig Jahren. Medien fällt in den USA nicht nur die zentrale Rolle bei der Herstellung, sondern auch bei der Kontrolle von Politik zu. Deshalb trifft hier der Begriff der »Mediendemokratie« voll und ganz zu. Das politische System ist in seinen wesentlichen Mechanismen und Funktionen auf Medien zugeschnitten. In Deutschland sind demgegenüber die Parteien – wenngleich von vielen totgesagt – noch immer die zentralen strategischen Organisationseinheiten, aus denen sowohl inhaltliche Programmatik als auch politisches Personal und Unterstützung geschöpft werden. Deutsche Politiker werden deshalb, anders als ihre amerikanischen Kollegen, immer zuerst Rückhalt und Legitimität in der eigenen Partei und erst in zweiter Linie über Medien beim Wähler suchen. Dies entspricht dem repräsentativen Charakter unseres Systems. Die Bedeutung der Parteien in den USA ist demgegenüber stark auf technische Funktionen einer Wahlkampflokomotive reduziert. Weder werden die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten in Form eines Durchlaufs durch die Parteihierarchien rekrutiert – in Deutschland ist diese »Ochsentour« bis heute üblich –, noch haben die Parteien in den USA größeren Einfluss auf die politische Programmatik. Während in Deutschland niemand Kanzler werden kann, der vorher nicht eine häufig jahrzehntelange Karriereleiter in seiner Partei erklommen hat, nimmt in den USA das Fernsehen den Parteien praktisch die Kandidatenrekrutierung ab. Nicht ein Gremium aus Spitzenfunktionären der Partei, sondern die unmittelbare Basis bestimmt in den Primaries, welcher Kandidat ins Rennen geschickt wird. Das Publikum wählt dort seine Helden selbst. Die Elitenrekrutierung hat in den USA deshalb einen stark plebiszitären Charakter. Jenseits des Atlantiks werden auf allen staatlichen Ebenen regelmäßig politische Outsider, die in erster Linie durch ihre Prominenz und Popularität bestechen, zu politischen Spitzenkandidaten. So konnte der austro-amerikanische Hollywood-Held Arnold Schwarzenegger Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien werden, der Wrestling-Star Jesse Ventura wurde zum Gouverneur von Minnesota gewählt. Das Präsidentenamt konnten der populäre Weltkriegsgeneral Dwight D. Eisenhower und der Schauspieler Ronald Reagan – einer der Großmeister charismatischer Politkommunikation – erringen. NATO-General Wesley Clark konnte Präsidentschaftskandidat werden. Sogar Kandidaturen gegen den er-