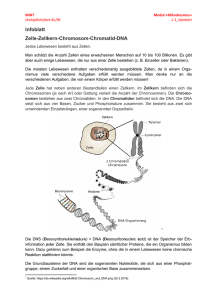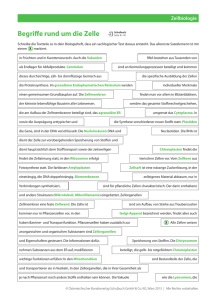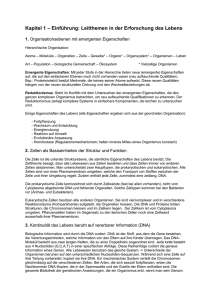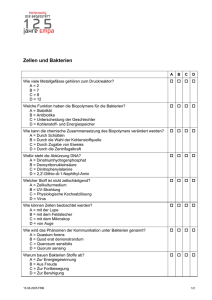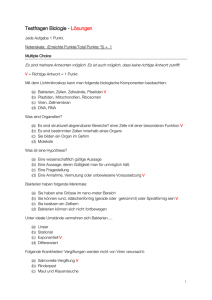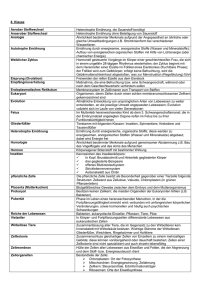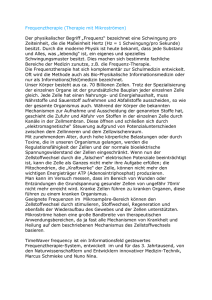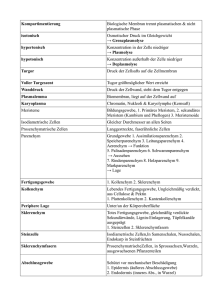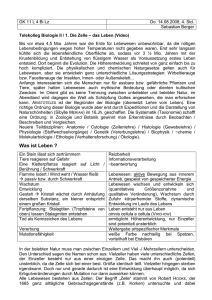3_Organisation des Lebendigen
Werbung

Johannes Herlet, 2012-2016 Thema der Arbeit: kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Hypothesen der modernen Wissenschaften auf die Fragen: was ist Leben, wie funktioniert Leben, wie ist das Leben auf der Erde entstanden und wie hat es sich seither entwickelt? Arbeit in 2 Teilen: I) Organisation des Lebendigen; II) Evolution des Lebens 1. Was ist Leben? Eine Lehre vom Leben wurde bereits 600 v. Chr. von Thales von Milet entwickelt, der damals unter anderem glaubte, dass das Leben aus dem Wasser komme. Erst im 19. Jahrhundert begann jedoch eine systematische Erforschung der Lebensstrukturen und Lebensprozesse. Die wissenschaftliche Erforschung des Lebens wird heute von mehreren interdisziplinären, sich teilweise überlappenden Wissenschaften voran getrieben, die oft auch unter dem Begriff „Biowissenschaften“ zusammen gefasst werden. Als Einzelwissenschaften sind hier an erster Stelle Biologie, Biochemie und Biophysik zu nennen sowie diverse Teilgebiete der Biologie wie Physiologie Molekularbiologie, Evolutionsbiologie und Genetik. Was unterscheidet lebende von unbelebter Materie? Kann Leben aus den Gesetzen der Physik und Chemie hergeleitet werden, also aus den erkennbaren und messbaren Eigenschaften der Materie, oder gibt es zusätzlich ein Leben schaffendes und erhaltendes Prinzip jenseits kausaler Naturerklärung? Auf die zweite Frage, komme ich am Schluss dieser Arbeit zurück. Zunächst möchte ich die Erkenntnisse kompakt darstellen, die wir in den letzten Jahrzehnten mittels der modernen Naturwissenschaften über das Leben gewonnen haben. Was unterscheidet lebende von unbelebter Materie? Als wesentliche Lebensmerkmale werden meist genannt: ein eigener Stoffwechsel und die Fähigkeit sich zu vermehren. Da aber z.B. auch Feuer einen eigenen Stoffwechsel unterhält und sich „vermehrt“, ist eine Präzisierung der Begriffe sinnvoll. „Eigener Stoffwechsel“ bedeutet, dass ein lebender Organismus mit seiner Umwelt durch eine teil-durchlässige Außenhaut oder Membran in einem ständigen Stoffwechselaustausch steht, also lebensnotwendige Stoffe aufnimmt und Abfallstoffe ausscheidet. Die aufgenommenen Stoffe dienen der Energiegewinnung (Energiestoffwechsel) und zur Synthese neuer Substanzen, die der Organismus zur Steuerung der lebenserhaltenden Prozesse benötigt (Baustoffwechsel). Die Fähigkeit zur Vermehrung bzw. Fortpflanzung bedeutet, dass der Organismus - ggf. zusammen mit einem Sexualpartner der gleichen Art – weitere vermehrungsfähige Organismen der gleichen Art erzeugen kann. „Eigener Stoffwechsel“ und „Vermehrung“ implizieren weitere Lebensmerkmale, z.B. • Reizbarkeit: lebende Organismen reagieren auf bestimmte von außen einwirkende Reize (Umweltänderungen physikalischer oder chemischer Natur) schon allein deswegen, weil ihr Stoffwechsel zwischen günstigen und giftigen Stoffen unterscheiden muss. • Aktive Beweglichkeit: diese beruht auf der aktiven Kontraktilität bestimmter Biomoleküle und ermöglicht die optimale räumliche Ausrichtung des Organismus auf die Umwelt. • Wachstum: dies ist eine Voraussetzung für Vermehrung (durch Zellteilung). Auch die Fähigkeit zur Darwinschen Evolution, also die Weiterentwicklung der Arten durch Mutation und Selektion, wird oft als wesentliches Lebensmerkmal genannt. Viren gehören nach obiger Definition nicht zu den lebenden Organismen, da sie keinen eigenen Stoffwechsel besitzen. Sie sind zur Vermehrung auf lebende Zellen angewiesen und bilden eine Grenzform des Lebens (siehe Kapitel 3) 2. Die Zelle als Grundform allen Lebens Jeder lebende Organismus ist aus Zellen aufgebaut. Die einfachste und früheste Form des Lebens sind einzellige Organismen. In Vielzellern haben sich unterschiedliche Zelltypen oder Zellkomplexe (Gewebe, Organe) mit spezifischen Aufgaben gebildet, die einzelne Zelle ist dabei in der Regel nicht mehr lebensfähig. Auch Vielzeller entwickeln sich aus einer Zelle. Im Lauf des individuellen Wachstums differenzieren sich die Zellen jedoch zu verschiedenen Organen, die jeweils bestimmte Funktionen im Gesamtsystem des Individuums übernehmen. Der menschliche Körper beispielsweise besteht aus etwa 50 bis 100 Billionen Zellen von über 200 verschiedenen Zell- und Gewebetypen. Jede Zelle enthält in ihrem Erbgut alle „Programme“, die das Wachstum und die vielfältigen Lebensprozesse des Organismus steuern. Jede Zelle ist ein hervorragend durchorganisierter Chemiebetrieb mit tausenden unterschiedlichen, genau und zweckmäßig auf einander abgestimmten Reaktionen. Im Laufe der Evolution haben sich zwei verschiedene Gruppen von Lebewesen gebildet, die sich durch die Struktur ihrer Zellen stark unterscheiden: zum einen die meist einzelligen Prokaryoten (Bakterien und Archaeen), die aus einfach gebauten Zellen ohne Zellkern bestehen, und zum anderen die Eukaryoten (Tiere, Pflanzen, Pilze und Protisten), die aus komplizierter strukturierten Zellen mit einem Zellkern und weiteren speziellen Zellorganen (Organellen) bestehen. Die Protisten sind eine Gruppe ein- bis wenig-zelliger Eukaryoten, sie beinhalten Vorstufen der Pflanzen, Tiere und Pilze, aber auch Lebensformen, die keinem dieser Reiche zugeordnet werden, wie z.B. die Amöben und Wimperntierchen. Zu den einzelligen Lebewesen gehören alle Archaeen, die meisten Bakterien, einige Pilze und viele Protisten. Der Durchmesser von Prokaryoten-Zellen (Protocyten) variiert i.d.R. zwischen 1 und 5 µm (tausendstel mm), der von Eukaryoten (Eucyten) i.d.R. Zwischen 10-50 µm. Die Eizelle des Menschen wird 0,1-0,2 mm, die eines Straußes sogar über 7 cm groß. Aufbau und Grundfunktionen von Zellen: Jede Zelle besitzt eine von der Außenwelt abgrenzende Zellmembran. Durch diese Membran wird kontrolliert, was in die Zelle aufgenommen und was hinaus transportiert wird. Alle Zellen besitzen Desoxyribonukleinsäure (DNS, engl. DNA), in der die Erbinformationen gespeichert sind, Ribonukleinsäure (RNS, engl. RNA), die zum Aufbau von Proteinen notwendig ist, und Proteine, welche als Biokatalysatoren (Enzyme) sehr viele chemische Reaktionen in der Zelle erst ermöglichen und viele weitere wichtige Lebensfunktionen haben. Das durch die Zellmembran umschlossene Medium (ohne den Zellkern der Eukaryoten) wird Zytoplasma genannt. Es besteht zu etwa 80% aus Wasser, dem aus Proteinstrukturen aufgebauten „Zytoskelett“ und weiteren Zellorganen (Organellen). Ein Organell („kleines Organ“) ist ein strukturell abgrenzbarer Bereich einer Zelle mit einer besonderen Funktion. Die meisten Organellen haben eine eigene Membran-Hülle und kommen nur bei Eukaryoten vor. Im Folgenden werden die wichtigsten Zellkomponenten kurz beschrieben: Der Zellkern bildet die Steuerzentrale aller eukaryotischen Zellen. Er wird durch die Kernhülle-Membran vom Zytoplasma abgegrenzt. Zu den Aufgaben des Zellkerns gehört es, das Erbgut (Genom) zu schützen. Er ist auch für dessen Replikation im Zuge der Zellteilung (Gen-Replikation) verantwortlich, außerdem synthetisiert er die Ribonukleinsäuren RNA, die den Aufbau der im Stoffwechsel benötigten Proteine steuern (Protein-Biosynthese). Der Zellkern enthält das Erbgut in Form von Chromosomen. Diese bestehen aus DNA, dem eigentlichen Träger des Erbguts und einer Verpackung aus Proteinen. Gene sind Abschnitte auf der DNA, welche die Information zur Steuerung spezifischer Stoffwechselfunktion enthalten, z.B. die Synthese eines bestimmten, für den Stoffwechsel benötigten Enzyms. Die Ribosomen sind die Proteinfabriken der Zellen. Sie sind aus RNA und Protein bestehende Komplexe ohne Membran, die im Zytoplasma der Zellen aller Lebewesen vorkommen. Die Protein-Biosynthese ist sehr wichtig für alle Zellen, weshalb die Ribosomen in großer Zahl in den Zellen vorliegen, zum Teil hunderte bis tausende pro Zelle. Die Mitochondrien sind die "Energiekraftwerke" der eukaryotischen Zellen. In ihnen findet der Abbau organischer Nährstoffe (primär Glukose) mittels Sauerstoff statt, wobei Energie freigesetzt und als chemische Energie in geeigneter Form zwischengespeichert wird, so dass sie für energiebedürftige Zellreaktionen jederzeit abrufbar ist. Diese „Zellatmung“ (auch aerobe Atmung genannt) findet sich auch bei vielen Prokaryoten, aber nur die Eukaryoten besitzen dafür spezialisierte Organellen. Besonders viele Mitochondrien befinden sich in Zellen mit hohem Energieverbrauch; das sind unter anderem Muskelzellen, Nervenzellen und Sinneszellen. In Herzmuskelzellen erreicht der Volumenanteil von Mitochondrien 36% /(W). Plastiden (bzw. Chloroplasten bei Grünalgen und höheren Pflanzen) nutzen das Licht zum Aufbau energiereicher organischer Stoffe (Kohlehydrate) aus Wasser und Kohlendioxid mit Hilfe von licht-absorbierenden Farbstoffen, meist dem für das Blattgrün verantwortlichen Chlorophyll. Dabei wird auch molekularer Sauerstoff freigesetzt. Diese oxygene Photosynthese ist die Grundlage der Nahrungskette des Lebens. Plastiden existieren nur in eukaryotischen Pflanzen und Algen. Es gibt jedoch auch einige Bakterienarten (z.B. Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt), die Photosynthese betreiben. Bei der Photosynthese wird aus Kohlendioxyd, Wasser und Lichtenergie Traubenzucker (Glukose) und Sauerstoff nach der Formel <6 CO2 + 6 H2O + Licht => C6H12O6 + 6 O2> erzeugt. Bei der Zellatmung wird die den Zellen in Form von Glukose zugelieferte Energie nach der Umkehrformel < C6H12O6 + 6 O2 => 6 CO2 + 6 H2O + Energie> abgebaut. Die Zellatmung ist also im Resultat die Umkehrung der Photosynthese. Beide hier durch ihre Summenformel dargestellten Prozesse sind jedoch in Wirklichkeit vielstufige chemische Reaktionsketten. Die das Sonnenlicht nutzende Photosynthese ist der primäre Nährstoff- und Sauerstoff-Lieferant für das Leben auf der Erde; Pflanzen und Grünalgen bilden den Anfang der Nahrungskette und sind Voraussetzung für tierisches Leben. Der bei der Photosynthese entstehende Sauerstoff wird von allen „aeroben“ Lebewesen, also allen Pflanzen, Tieren, Pilzen und vielen Prokaryoten, für die Zellatmung genutzt. Umgekehrt stellt diese den Pflanzen das für die Photosynthese benötigte Kohlendioxyd zur Verfügung. So ist der Energiestoffwechsel aller Lebewesen in einem globalen Kreisprozess miteinander verknüpft. Die Plastiden und Mitochondrien der Eukaryoten sind vermutlich in einer frühen Phase der Evolution dadurch entstanden, dass prokaryotische Organismen (Bakterien oder Archaeen), welche bereits die Photosynthese bzw. Zellatmung beherrschten, in voreukaryotische Urzellen aufgenommen wurden und dort über einen symbiotischen Zwischenzustand den Status von Organellen erlangt haben (Endosymbionten-Theorie). Beide Organelle besitzen eine eigene DNA und Außenhülle (Membran). Lysosomen sind die Verdauungsorganellen der tierischen Zelle. Ihre Hauptfunktion besteht darin, mittels der in ihnen enthaltenen Enzyme aufgenommene Fremdstoffe abzubauen. Vakuolen kommen nur in Zellen von Pflanzen und Pilzen vor. Sie sind für die Einlagerung von Nährstoffen aber auch pflanzlichen Giftstoffen und für den Wasserhaushalt der Zelle zuständig. Zellteilung, Vermehrung, Fortpflanzung, Wachstum, Zelldifferenzierung: Die Zellteilung ist die Basis für Vermehrung, Fortpflanzung und Wachstum von Lebewesen. Alle Lebewesen sind einmal aus einer Einzelzelle hervorgegangen („alles Leben kommt aus dem Leben“). Nur am Beginn der Evolution muss durch „Urzeugung“ (Abiogenese) ein erstes zelluläres Lebewesen aus nicht zellulären Vorformen des Lebens entstanden sein. Bei der Zellteilung werden die Bestandteile der Mutterzelle auf die Tochterzellen aufgeteilt und zwischen diese eine trennende Membran eingezogen. Für die Zellteilung muss insbesondere das Erbgut (die DNA) repliziert werden. Bei Organismen mit Zellkernen, den Eukaryoten, ist die Zellteilung in der Regel mit einer direkt zuvor stattfindenden Kernteilung (Mitose) zeitlich und regulatorisch gekoppelt. Zellen wachsen (Volumenzunahme, Vermehrung ihrer Organellen) bevor sie sich wieder teilen. Die Abfolge von Zellwachstum-Zellteilung nennt man Zellzyklus. Vermehrung bzw. Fortpflanzung ist ein essentielles Lebensmerkmal. Die sogenannte ungeschlechtliche Vermehrung durch Zellteilung ist bei allen Prokaryoten, aber auch einigen Eukaryoten zu finden. Die Mehrzahl der Tier- und Pflanzenarten pflanzt sich geschlechtlich (sexuell) fort. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung werden die Gene von verschiedengeschlechtlichen Lebewesen der gleichen Art, den Eltern, oder eines einzelnen Lebewesens, bezeichnet als Elter, kombiniert an die Nachkommen weitergegeben. Lebewesen, die sich geschlechtlich fortpflanzen, haben diploide Zellen, d.h. alle Chromosomen der Zelle – und damit auch alle Gene – liegen in doppelter Ausprägung vor. Zur Fortpflanzung bilden sie Keimzellen (Geschlechtszellen) durch eine sogenannte Reduktionsteilung (Meiose), bei der nur ein Chromosomensatz an die Keimzelle übertragen wird. Bei Verschmelzung männlicher und weiblicher Keimzellen im Akt der Befruchtung entsteht aus diesen beiden haploiden Chromosomensätzen wieder die diploide Ausgangszelle (Zygote) eines neuen Individuums. Die zwei-geschlechtliche Fortpflanzung bietet den Vorteil, dass die genetische Variation der Nachkommen durch die Rekombination der Erbanlagen der beiden Eltern erheblich größer ist, was die Anpassungsfähigkeit der Art an sich ändernde Umweltbedingungen erhöht. Aber auch bei ein-geschlechtlicher Fortpflanzung eines Elters durch Selbstbefruchtung, kommt es zu einer Rekombination von zwei haploiden Chromosomensätzen (des gleichen Individuums). Da bei sexueller Fortpflanzung jedes Individuum zwei Gene desselben Typs (rekombiniert) in sich trägt, muss eine nachteilige Mutation eines Gens nicht zum Tragen kommen, wenn dessen Funktion durch das andere Gen ersetzt wird. Ungeschlechtliche Vermehrung und Selbstbefruchtung haben den Vorteil, dass sie auch bei sehr geringen Populationsdichten funktionieren. Manche Pflanzen und weibliche Tiere (z.B. Blattläuse) können sich sowohl sexuell als auch ein-geschlechtlich fortpflanzen, das heißt ohne von einem männlichen Artgenossen befruchtet zu werden. Durch bestimmte Hormone wird der unbefruchteten Eizelle eine Befruchtungssituation „vorgespielt“, worauf diese sich zu teilen beginnt und zu einem Organismus heranreift. Zelldifferenzierung – Mehrzeller: Alle höheren eukaryotischen Mehrzeller wie Tiere, Pflanzen und Pilze bestehen in der Regel aus unterschiedlichen, spezialisierten Zellgeweben. Die Organe bzw. Gewebe dieser Mehrzeller bestehen jeweils aus ganz spezifischen Zellen, welche deren Funktion optimal gewährleisten. Diese spezifischen Zellen bilden sich während der Ausbildung des Organismus aus der befruchteten Zygote durch Zelldifferenzierung heraus. Die Zelldifferenzierung wird auch durch das Erbgut gesteuert, wie diese Steuerung im Detail funktioniert, ist bis heute noch ungeklärt. Die ausdifferenzierten Zellen sind für sich nicht lebensfähig, bei vielen Geweben/ Organen findet nach Ausbildung des Organs eine weitere Zellteilung nur noch zur Erneuerung beschädigter Gewebeteile oder sogar gar nicht mehr statt. Als Stammzellen werden allgemein Körperzellen bezeichnet, die sich in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren können. Die Zellen in Mehrzellern müssen miteinander kommunizieren. Dazu dienen Botenstoffe und entsprechende Rezeptoren an der Zelloberfläche. Zellzyklen: Bakterien können sich in geeigneter Umgebung alle 20 Minuten teilen, bei Eukaryoten dauert der Zellzyklus in der Differenzierungsphase i.d.R. 10-20 Stunden, meist sehr viel länger, wenn die Organe einmal ausgebildet sind. Damit unser Körper über Jahre seine Lebensfunktionen aufrecht erhalten kann, werden in jeder Sekunde ca. 50 Millionen Zellen (1/Millionstel seiner Zellen) ersetzt. Die Lebensdauer menschlicher Zellen hängt von ihrer Aktivität ab. 90% unserer Körperzellen werden jährlich mindestens einmal gewechselt, die Schleimhautzellen des Dünndarms sogar alle 30 - 35 Stunden, der Umbau der Knochen und Muskelzellen dauert etwa 10 bzw. 15 Jahre. Doch einige wenige Teile des Körpers bleiben lebenslang dieselben: Teile des Gehirns, des Nervensystems und der Augen, das Herz und die Schweißdrüsen ändern sich nie. Stammzellen: Alle Organe und Gewebe des Körpers haben ihren Ursprung in embryonalen Stammzellen. Späterer Gewebeersatz – bei Verletzungen oder Regeneration des betreffenden Gewebes – erfolgt über sogenannte „adulte Stammzellen“, die man in diversen Geweben, etwa im Knochenmark und in der Haut findet. Diese sind jedoch nicht „pluripotent“, d.h. ihr Differenzierungspotential ist beschränkt. Forschern aus Japan ist es kürzlich gelungen, normale Körperzellen durch Einschleusung bestimmter Gene mittels Viren in „induzierte pluripotente Stammzellen (iPS)“ umzuwandeln und aus diesen im Labor bestimmte Gewebezellen heranzuzüchten. Jüngste Forschungen weisen jedoch darauf hin, dass diese Technik doch nicht vollständig alle Spuren der ursprünglichen Zellfunktion entfernt, so dass auch iPS-Zellen nur eingeschränkt differenzierungsfähig sind. Altern und Tod von Organismen: Zum Leben gehört der Tod, gekennzeichnet durch den (endgültigen) Abbruch des Energiestoffwechsels. Alle mehrzelligen Organismen altern im Laufe ihres Lebens und müssen sterben. Man kann sogar sagen, dass der zu einer organischen Leiche führende unausweichliche Alterungstod erst mit Erfindung der Mehrzelligkeit in die Welt kam. Heute lebende sich durch Teilung vermehrenden Einzeller (z.B. Bakterien oder Pantoffeltierchen) sind noch nie gestorben, sie sind potentiell unsterblich. Sie können aber natürlich auch durch äußere Einwirkung sterben. Generell unterscheidet man beim Absterben von Zellen oder Zellpopulationen nach Art der Ursache zwischen Nekrose (krankhafte Ursache oder äußere Einwirkung, z.B. durch Gifte oder Radioaktivität) und Apoptose (programmierter Zelltod, als vorgesehener Teil des Stoffwechsels, z.B. bei starker Schädigung der Erbinformation). Mit der Erforschung des „biologischen Alterns“ beschäftigt sich die Gerontologie. Das biologische Altern entsteht durch allmähliche Funktionsverluste der Zellen, ist so gesehen die Unfähigkeit des Organismus die Selbstregulation aufrecht zu erhalten. Die Ursachen dieses Prozesses sind noch nicht restlos aufgeklärt. Ist Altern ebenso das Heranwachsen ein genetisch determinierter Prozess („programmiertes Altern“) oder wird es ausschließlich oder vorwiegend durch bestimmte Umwelteinflüsse verursacht, die schädigend auf die Zellen einwirken? Vermutlich wirken mehrere Effekte auf verschiedenen Ebenen zusammen. Dabei ist die Abgrenzung primärer biologischer Alternsprozesse von durch das Altern ausgelösten Krankheitsprozessen schwierig. Oft genannte Alterns-Ursachen sind: • Genetische Ursachen: Bestimmte Teilstrukturen der Chromosomen der eukaryotischen Zellen,Telomere genannt, schützen die Chromosomen vor Beschädigung. Diese Telomere verkürzen sich jedoch bei jeder Zellteilung und zusätzlich durch die Wirkung freier Radikale und können daher ihre schützend Wirkung nur zeitlich begrenzt aufrecht erhalten. (Das Enzym Telomerase, enthalten z.B. in Krebszellen, verhindert die Verkürzung der Telomere und wird in bestimmten Fällen auch medizinisch genutzt). • Zellverschleiß: Äußere Belastungen (z.B. UV-Licht, Ozon, Umweltgifte) und innere „Fehlreaktionen“ schädigen im Laufe der Zeit nicht nur die Erbsubstanz, sondern auch andere Moleküle wie Proteine und Fette. Die Reparatursysteme der Zellen verlieren an Wirkung, die Zellerneuerungsfähigkeit der Gewebe nimmt ab, gewisse Zellen werden auch gar nicht ersetzt (beim Mensch z.B. Teile des Gehirns und Nervensystems, ferner die Herzmuskel-Zellen). Die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Organe nimmt kontinuierlich ab. Studien deuten darauf hin, dass eine Reihe altersbedingte Stoffwechselstörungen auch durch Mutationen der mitochondrialen DNA hervorgerufen werden. Diese sammeln sich im Laufe des Lebens an, bis die betroffenen Zellen ein genetisches Selbstmordprogramm (Apoptose) auslösen. So verläuft z.B. die Sauerstoffverwertung bei der aeroben Energiegewinnung in den Mitochondrien der Zellen in einigen Fällen fehlerhaft. Es bleibt ungebundener und damit sehr reaktionsfreudiger Sauerstoff übrig. Bestimmte Stoffe (u.a. Vitamin A, C, E) fangen diese freien Sauerstoff-Radikale zum Teil ein. Trotzdem kommt es zu dadurch pro Tag und Zelle zu einer Vielzahl von DNA-Schädigungen. Diese können zwar zum größten Teil wieder repariert werden, im Lauf der Zeit sammeln sich jedoch Mutationen an. Sterblichkeit und Evolution: Was bedeutet Sterblichkeit? Den Alterungstod des Individuums hat die Natur mit Erfindung der Mehrzelligkeit eingeführt. Unser sterblicher Körper ist aus Sicht der Evolution nur die Schutz gewährende Hülle für die der Fortpflanzung dienenden Keimzellen. Aber auch unser individuelles Erbgut überlebt uns nicht. Mit der Erfindung der sexuellen Fortpflanzung hat die Natur die Entstehung immer neuer Erbanlagen durch Rekombination zum Prinzip erhoben. Auch das Erbgut der potentiell unsterblichen, sich durch Teilung vermehrenden Bakterien ändert sich dauernd durch Mutationen und Gen-Austausch zwischen den Individuen. Die Stammesentwicklung der heutigen Bakterien hat sich weit von den Ursprüngen entfernt. Allen Organismen ist ein individuelle Lebensdrang (manifestiert im Selbsterhaltungs- und Sexualtrieb) genetisch einprogrammiert. Dieser Trieb ist dabei aber offensichtlich nicht auf die Erhaltung der Art optimiert, sondern auf die Erhaltung und Ausbreitung der eigenen genetischen Information (man spricht auch vom „egoistisches Gen“). Dabei kann individuelle Opferbereitschaft, z.B. bei sozialen Insekten, durchaus dem Erhaltungsinteresse der eigenen Gene dienen. Nur beim Menschen kann das Bewusstsein den Trieb kontrollieren. Was bedeutet unsere Sterblichkeit? Es sind vor allem unsere Erinnerungen und – daraus genährt - unser Ich-Bewusstsein und unsere Erwartungen und Gefühle, die mit unserm Tod unwiederbringlich verloren gehen. Dieses Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit ist wohl nur dem Menschen gegeben. Aus Sicht der Evolution ist der individuelle Tod aber nicht nur nebensächlich, sondern sogar notwendig, dass das Leben selbst weiter gegeben und sich damit weiter entwickeln kann. Hoimar von Ditfurth: „Die Spannung zwischen Todeszwang und Lebensdrang ist das Erfolgsrezept der Evolution.“ 3. Die Formen des Lebens Alle Lebensformen auf der Erde haben sich aus einem gemeinsamen Ursprung im Laufe der Jahrmilliarden durch Mutation und Selektion zu immer neuen Formen weiter entwickelt. Jedes Lebewesen ist Resultat einer Entwicklung. Nach Ernst Haeckel lässt sich diese auf zwei zeitlich unterschiedlichen Ebenen betrachten: die Individualentwicklung eines einzelnen Organismus von seiner Zeugung über seine verschiedenen Lebensstadien bis hin zum Tod (Ontogenese) und die Stammesentwicklung (Phylogenese) der Art durch die Evolution. Eine „Art“ umfasst diejenigen Lebewesen, die von anderen aufgrund vererblicher Merkmale abgegrenzt werden können. Bei sich sexuell fortpflanzenden Arten sind das diejenigen, die untereinander fruchtbare Nachkommen zeugen können, die also eine kontinuierliche Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. Auch die weitere systematische Einteilung der Lebewesen beruht auf dem entwicklungsgeschichtlich (phylogenetisch) begründeten Grad der Merkmalsübereinstimmung. Viren: Viren werden im Allgemeinen nicht den lebenden Organismen zugeordnet, sondern gelten als Grenzform des Lebens. Sie bestehen nicht aus Zellen, sondern lagern sich in Zellen ein. Sie enthalten zwar das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung, besitzen selbst aber keinen Stoffwechsel, sondern sind auf den Stoffwechsel der Wirtszelle angewiesen. Ein Virus ist also im Wesentlichen ein genetisches Programm (in Form einer Nukleinsäure, DNA oder RNA), das als Virus-Partikel (Virion) in eine Wirtszelle eindringt und den Stoffwechsel der Wirtszelle so verändert, dass diese das Virus-Programm vervielfältigt und neue Virionen zur Verbreitung des Virus produziert und freisetzt. Virionen haben typische Durchmesser von etwa 10-400 Millionstel mm, sind also 10-100-mal kleiner als Bakterien. Die meisten Forscher nehmen heute an, dass es sich bei Viren nicht um Vorläufer des zellulären Lebens handelt, sondern eher um Erbgut von Lebewesen, das sich im Laufe der Zeit aus diesen lösten. Viren wären danach eine degenerierte Form ehemaligen Lebens. Viren befallen Zellen von Eukaryoten (Pflanzen, Pilze, Tiere) und Prokaryoten (Bakterien und Archaeen). Viren, die Prokaryoten als Wirte nutzen, werden Bakteriophagen genannt. Jede Virenart bevorzugt eine mehr oder weniger enge Bandbreite bestimmter Organe und Lebewesen. Die befallenen Wirtszellen erleiden Viren-spezifische Schädigungen, die oft zur Zellauflösung führen. Viruserkrankungen ergeben sich in der Regel durch eine unvorteilhafte Reaktion des Immunsystems auf die befallenen Zellen, welche zu einer Entzündung befallener Organe führt (z.B. Gehirnentzündung bei Tollwut). Der Tod des Wirtes schadet auch dem Virus, besonders gefährlich sind daher oft Virenarten, die nicht an den Mensch als Wirt angepasst sind. Bei den „echten Lebensformen“ unterscheidet man zunächst die Domäne der Prokaryoten (Lebewesen mit einfachen Zellen ohne Zellkern, meist einzellig) von der Domäne der Eukaryoten, die komplexere Zellen mit einem Zellkern besitzen. Prokaryoten (Bakterien und Archaeen) Die Prokaryoten teilt man neuerdings in 2 Grundformen ein, die Bakterien (gr. „Stäbchen“) und die Archaeen (früher Archae-Bakterien). Letztere sind wie die meisten Bakterien Einzeller, stehen jedoch den Eukaryoten auf Grund molekular-biologischer Eigenschaften phylogenetisch näher als die Bakterien. Prokaryoten ernähren sich meist von organischen oder anorganischen Stoffen (z.B. Schwefelverbindungen), einige Bakterienarten gewinnen ihre Lebensenergie jedoch durch Photosynthese aus Licht, zum Beispiel die früher auch Blaualgen genannten Cyanobakterien. Die typische Größe von Prokaryoten beträgt 1-5 µm (tausendstel mm), die so genannte „Schwefelperle von Namibia“ ist mit einem Durchmesser bis zu einem dreiviertel Millimeter das größte bekannte Bakterium. Viele Archaeen- und Bakterien-Arten sind an extreme Milieubedingungen angepasst (z.B. sehr kalte oder kochend heiße Temperaturen, hohe Strahlungsbelastung, sehr hoher Druck, stark saures oder stark basisches Milieu, hoch-konzentrierte Salzlösungen). Während Bakterien neben ihrer nützlichen symbiotischen Rolle z.B. im Verdauungstrakt der Menschen auch Krankheiten auslösen können, sind bei Archaeen keine Krankheitserreger bekannt. Archaeen-Kulturen werden z.B. bei Boden- und Gewässersanierung eingesetzt oder zur Methangewinnung in Biogasanlagen. Obwohl jedes Jahr einige 100 Bakterienarten neu entdeckt werden, geht man davon aus, dass heute höchstens 1-5% aller auf der Erde vorkommenden Bakterienarten näher bekannt und beschrieben worden sind. Bakterien und der Mensch: Schätzungen zufolge leben an und im menschlichen Körper bis zu 100 Billionen Bakterien, bis 2x so viele wie der Mensch Körperzellen besitzt. Allein im Mund eines Menschen leben insgesamt etwa 10 Milliarden Bakterien. Auf der menschlichen Haut befinden sich bei durchschnittlicher Hygiene etwa 1 Billion Bakterien von mehr als 200 Bakterien-Arten. 99% aller im und am menschlichen Körper lebenden Bakterien leben im Verdauungstrakt, vor allem im Dickdarm und bilden die sog. Darmflora. Darmbakterien helfen dabei, die Nahrung aufzuspalten und so dem Körper die einzelnen Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Sie fördern den Aufbau und den Erhalt der Darmschleimhaut und sind darüber hinaus an der Abwehr von Viren, Pilzen oder krankmachenden Bakterien beteiligt. Biotechnik: Viele Bakterien besitzen die Fähigkeit für den Menschen wichtige Stoffe zu produzieren oder problematische Abfälle zu beseitigen. Dies wird in der Biotechnik durch die gezielte Nutzung des Stoffwechsels geeigneter Bakterien vielfältig genutzt. Auf diese Weise lassen sich diverse nützliche Chemikalien und Medikamente herstellen (z.B. Antibiotika, Insulin, Bioethanol, Essigsäure,...). Auch Botox, das als das gefährlichste natürliche Gift der Welt gilt (etwa eine Million Mal giftiger als Arsen) wird von einer Bakterienart produziert. Es wirkt an der Übergangsstelle zwischen Nerven- und Muskelzellen und führt zur Lähmung der betroffenen Muskeln. Das Einspritzen einer winzigen Dosis von Botox in faltenreiche Gesichtspartien ist jedoch heute der häufigste Schönheitseingriff weltweit. Es reduziert die Muskelaktivität, die zu Falten führt, das Gewebe entspannt sich (für 3 bis 8 Monate). Bakterien als Krankheitserreger: Einige Bakterien verursachen eitrige Wundentzündungen (Infektionen), Sepsis (Blutvergiftung) oder die Entzündung von Organen (z.B. Blasen- oder Lungenentzündung). Sind die Bakterien einmal in den Körper eingedrungen und haben eine Infektion ausgelöst, stellen heute die Antibiotika ein wirksames Mittel gegen Bakterien dar. Viele Bakterien sind jedoch bereits multiresistent. Allein in der EU sterben jedes Jahr viele tausend Menschen an MRSA, also an Infektionen mit Bakterien, gegen die kein Medikament mehr hilft. Eukaryoten (Pflanzen, Tiere, Pilze und Protisten) Bei den Eukaryoten unterscheidet man traditionell die Reiche der Tiere, Pflanzen und Pilze sowie die Sammelgruppe der Protisten. Letztere sind ein- bis wenig-zellige Eukaryoten; sie umfassen die Vorstufen der Pflanzen (Grünalgen), Tiere (Urtiere bzw. Protozoen) und Pilze oder bilden eigenständige Evolutionslinien (z.B. viele Amöbenarten, diverse Algenarten, Augentierchen, Wimperntierchen). Die Pilze bilden ein eigenes Reich zwischen Pflanzen- und Tierreich. Sie betreiben keine Photosynthese sondern ernähren sich wie Tiere ausschließlich von organischen Substanzen, haben aber auch zellbiologische Gemeinsamkeiten mit Pflanzen. Nach dem Grad der biologischen Verwandtschaft (Merkmalsübereinstimmung) unterscheidet man diese Reiche weiter nach Stämmen und Klassen, Ordnung, Familie, Gattung und Art. Innerhalb der Art kann man noch nach Rassen unterscheiden (z.B. bei Haushunden). Im Tierreich unterscheiden wir heute knapp 30 Stämme. Wichtige Stämme sind z.B. • die Hohltiere, mit den Klassen der Polypen, Quallen, Korallen; • die Weichtiere mit den Klassen der Urmollusken, Schnecken, Muschel, Tintenfische; • die Gliedertiere mit dem Unterstamm der Gliederfüßer, dem arten- und formenreichsten Stamm der Tierwelt; darin u.a. die Klassen der Krebstiere, Spinnentiere, Tausendfüßer und Insekten; kennzeichnend sind ein äußeres Chininpanzer und eine Segmentierung des Körpers, die diesem eine gewisse Beweglichkeit ermöglicht. • die Chordatiere mit dem Unterstamm der Wirbeltiere und darin den Klassen der Fische, Lurche (Amphibien), Kriechtiere (Reptilien), Vögel und Säugetiere. Vögel und Säugetiere sind die Warmblüter unter den Wirbeltieren, d.h. sie halten eine weitgehend konstante Körpertemperatur aufrecht. Bei den Säugetieren unterscheidet man die Unterklassen der Kloakentiere (eierlegend; z.B. Schnabeltier), Beuteltiere (z.B. Känguru, Opossum) und echten Säugetiere (Plazentatiere), bei letzteren eine Vielzahl von Ordnungen, wie die der Wale, Nagetiere, Huftiere, Rüsseltiere, Raubtiere und Primaten (Affen und Halbaffen). Der Mensch (Art „homo sapiens“) gehört zur Gattung Homo, zur Familie der Hominiden (Menschenähnliche), zur Ordnung der Primaten. In der Tierwelt kennt man heute über eine Million Arten, darunter 750.000 Insektenarten und etwa 60.000 Arten von Wirbeltieren, darunter ca. 20.000 Fischarten, ca. 9.000 Vogelarten und ca. 6.000 Arten von Säugetieren. Das Pflanzenreich beinhaltet etwa 500.000 heute bekannte Pflanzenarten. Pflanzliche Zellen besitzen im Gegensatz zu tierischen Zellen Plastiden (Chloroplasten) zur Photosynthese, Vakuolen und eine Cellulose-haltige, Schutz- und Form-gebende Zellwand. Die Pflanzen haben sich vor etwa 400 bis 450 Millionen Jahren aus den Grünalgen, die zu den Protisten zählen, entwickelt. Unterschieden werden die Unterreiche der Moose und Gefäßpflanzen. Moose sind grüne Landpflanzen, die in der Regel kein Stütz- und Leitgewebe ausbilden. Gefäßpflanzen dagegen sind aufgebaut aus den drei Organen Wurzel, Sprossachse und Blatt und besitzen spezialisierte Wasser-leitende Zellen. Sie gliedern sich in die BärlappPflanzen, die Farne und die sich aus diesen entwickelten Samenpflanzen. Die Samenpflanzen bilden Samen (pflanzliche Embryos) zur Ausbreitung. Sie werden in die Klassen der nacktsamigen Pflanzen (Samen offen auf den oft zu Zapfen zusammengefassten Fruchtblättern) und der bedecktsamigen Pflanzen (Samen in geschlossenem Fruchtknoten) gegliedert. Zu den nacktsamigen Pflanzen gehören die Nadelhölzer, Palmfarne und GinkgoPflanzen. Bei den bedecktsamigen Pflanzen unterscheidet man nach Anzahl der Keimblätter die Einkeimblättrigen (dazu gehören z.B. die Liliengewächse, Getreidearten, Bambus, Gräser) und die zweikeimblättrigen Pflanzen, die den Hauptteil der Landpflanzen umfassen. Die Fortpflanzung der Samenpflanzen erfolgt wie bei Moosen und Farnen im Wechsel zweier Generationen: einmal ungeschlechtlich durch Bildung und Verbreitung von Sporen, aus denen sich männliche und weibliche Keimzellen-Träger (Gametophyten) entwickeln. Durch (sexuelle) Verschmelzung dieser Keimzellen entsteht in der nächsten Generation wieder ein sogenannter Sporophyt. Bei Samenpflanzen ist der Sporophyt die eigentliche Pflanze, die Gametophyten bestehen aus den männlichen Pollenkörnern (Blütenstaub) und den in den Fruchtblättern gebildeten weiblichen Samenanlagen. Durch Bestäubung entsteht aus der Samenanlage ein Same (pflanzlicher Embryo), der nach seiner Verbreitung in neue Erde fällt und aus dem die neue Pflanze (Sporophyt) keimt. Das Reich der Pilze (lat. Fungi) umfasst ca. 100.000 heute bekannte Arten, zu denen sowohl Einzeller wie die Backhefe, als auch Vielzeller wie die Schimmelpilze und die Speisepilze gehören. In der biologischen Systematik bilden die Pilze neben Tieren und Pflanzen ein eigenständiges Reich, sind dabei aber näher mit den Tieren verwandt und haben mit diesen einen gemeinsamen Vorfahr, der als geißeltragender Einzeller vor 1,2-1,5 Milliarden Jahren gelebt haben dürfte. Pilze ernähren sich wie Tiere von organischen Nährstoffen, die sie von anderen lebenden Organismen oder toter organischer Substanz beziehen und durch Abgabe von Enzymen zerlegen und dann aufnehmen, d.h. Sie verdauen außerhalb des Pilzkörpers. Unterschieden werden dabei Destruenten, die sich durch den Abbau toter organischer Materie ernähren, Symbionten, die sich durch Symbiose mit Pflanzen ernähren (z.B. Wurzelpilze) und Parasiten, die sich von lebender organischer Materie ernähren. Die Abgrenzung vom Tierreich erfolgt nicht primär durch die Unbeweglichkeit der Pilze, da auch manche Tiere wie Schwämme oder Steinkorallen den größten Teil ihres Lebens ortsfest verbringen. Pilze besitzen jedoch wie Pflanzen Zellvakuole als Organelle und der Versteifung dienende, die Zellmembran umgebende Zellwände, allerdings überwiegend aus Chitin und nicht wie Pflanzen aus Cellulose-Fasern. Pilze vermehren und verbreiten sich geschlechtlich oder ungeschlechtlich, oft durch Bildung von Sporen in ihrem Fruchtkörper. Pilze sind sehr nützlich für die Ökologie, zum einen sind sie neben den Bakterien die wichtigsten Destruenten im Nahrungskreislauf, zusammen mit diesen erzeugen sie aus organischem Abfall Humus. Zum anderen fördern sie als Wurzelpilze das Wachstum der meisten Pflanzen, indem sie für diese zusätzliches Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden lösen und dafür einen Anteil der von den Pflanzen durch Photosynthese erzeugten Nährstoffe erhalten. Parasitische Pilze können jedoch bei Tieren und Pflanzen Krankheiten hervorrufen. Vermutlich existieren Pilze schon seit 900 bis 1200 Millionen Jahren. Die ersten weitgehend unumstrittenen fossilen Pilzfunde sind ca. 450-500 Millionen Jahre alt. Der größte bekannte Pilz der Welt ist ein Hallimasch. Er befindet sich in Oregon und wird mit einer Ausdehnung von über 900 Hektar als das größte bekannte Lebewesen der Erde betrachtet. Sein Gewicht wird von Fachleuten auf 600 Tonnen geschätzt, sein Alter auf über 2000 Jahre. Zur Biomasse werden sowohl Lebewesen als auch tote organische Substanz wie Totholz, Laub, Stroh und anderes gezählt. Fossile Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas) sind in Millionen Jahre andauernden chemischen und geologischen Prozessen zwar aus Biomasse entstanden, werden dieser jedoch nicht zugeordnet. Den größten Teil der Biomasse machen lebende bzw. abgestorbene Pflanzen aus. Einige Schätzungen vermuten, dass ein erheblicher Anteil der irdischen Biomasse auch in Form unterirdisch lebender Mikroorganismen vorliegt. Stoffkreislauf: Biomasse wird zunächst von Primärproduzenten (Pflanzen, Algen und gewisse Bakterien) vor allem in Form von Kohlehydraten wie Cellulose durch Photosynthese gebildet. Konsumenten ernähren sich von diesen Pflanzen oder von anderen Konsumenten und setzen so die pflanzliche in tierische Biomasse um. Tote Biomasse wird wiederum von Destruenten (Bakterien-, Pilz-, Insekten-Arten) in anorganische Stoffe (z.B. Kohlendioxyd CO2) zersetzt. Sie vollenden den Stoffkreislauf und stellen die anorganischen Stoffe wieder für die Primärproduzenten zum Aufbau lebender Biomasse zur Verfügung. Etwa 8-10% der Biomasse der Erde wird jährlich neu erzeugt und verbraucht (Quelle: Wikipedia). 4. Chemie des Lebens Jede Lebensäußerung ist mit chemischen Umsetzungen verbunden, Stoffwechsel, Bewegung, Verarbeitung äußerer Reize, Wachstum, Krankheit, Altern. Diese sind Forschungsgegenstand der Biochemie. Die Stoffwechselprozesse laufen dabei in langen Reaktionsketten so ab, dass bei jeder Einzelreaktion nur geringe energetische Umsetzungen erfolgen, und die entstehende Wärme von den Zellen auch abgeführt werden kann. Jede Zelle ist ein hervorragend durchorganisierter Chemiebetrieb mit tausenden sehr genau und zweckmäßig auf einander abgestimmten Reaktionen. Sehr viele dieser chemischen Reaktionen werden durch spezifische Enzyme gesteuert, die als Biokatalysatoren die Reaktion erst ermöglichen. Alle Lebewesen bestehen vorwiegend aus Wasser, organischen Kohlenstoffverbindungen (Biomolekülen) und häufig aus mineralischen oder mineralisch verstärkten Schalen und Skeletten. Alle bekannten Lebensvorgänge finden in Anwesenheit von Wasser statt. Wasser dient als Lösungsmittel für Biomoleküle, es ist in einem Temperaturbereich flüssig, in dem diese stabil und hinreichend reaktiv sind. Es ist ein ideales Medium für chemische Reaktionen, da es eine homogene Durchmischung ermöglicht, durch Abgabe von Protonen beschleunigend (katalytisch) auf chemische Reaktionen einwirken kann und überschüssige Reaktionswärme durch seine hohe Wärmekapazität aufnehmen kann. Ohne die Anwesenheit von Wasser würden viele Bio-Reaktionen langsamer und mit höherer Aktivierungsbarriere ablaufen. Die sogenannte Anomalie des Wassers verhindert, dass Gewässer vom Grund aus vereisen und sorgt für einen Bereich gleichmäßiger Temperatur unterhalb von Eisflächen. Biomoleküle sind organischer Substanzen, die in Lebewesen gebildet werden, um biologische Funktionen zu erfüllen. Wichtigstes Element (vielleicht sogar notwendig für die Entstehung von Leben) ist dabei Kohlenstoff (C). Das liegt an der Eigenschaft des Kohlenstoffs eine praktisch unbegrenzte Zahl hochmolekularer Verbindungen einzugehen. Biomoleküle sind oft Makromoleküle mit tausenden bis hunderttausenden von Atomen. Neben Kohlenstoff, Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) als Hauptelementen des Grundgerüsts der Biomoleküle kommen die Elemente Stickstoff (N), Phosphor (P), Schwefel (S), Eisen (Fe), Magnesium (Mg), Kalium (K), Natrium (Na) und Calcium (Ca) und einige weitere Elemente in Lebewesen vor. Die weitaus häufiger als Kohlenstoff in der Erdkruste vorkommenden Elemente Silizium und Aluminium werden wegen eingeschränkter Verbindungsmöglichkeiten nicht als Bausteine des Lebens genutzt, ebenso wenig Elemente schwerer als Jod. Biomoleküle sind oft wasserlösliche organische Säuren oder Basen oder aus solchen zusammen gesetzt. Säuren (S) sind Verbindungen, die in der Lage sind, Protonen (H+) an einen Reaktionspartner abzugeben (in wässriger Lösung bilden sich H3O+ + <S>- , niedriger pH-Wert), Basen (B) dagegen nehmen Wasserstoff auf (in Wasser bilden sich H<B>+ + OH− , hoher pH-Wert). Basen reagieren mit Säuren unter Bildung von Wasser und Salzen. Bei Biomolekülen werden nach chemischer Struktur und Eigenschaften einige wesentliche Stoffklassen unterschieden: Proteine, Kohlehydrate, Nukleotide und daraus aufgebaute Nukleinsäuren, Lipide (darin Fette) und Porphyrine (1) Proteine (Eiweiße) sind von überragender Bedeutung für alle lebenden Organismen. Sie liefern dem tierischen Organismus zwar auch Energie (Abbau zu Harnstoff), ihre wichtigsten Aufgaben erfüllen sie aber als Biokatalysatoren (Enzyme), als Botenstoffe (Hormone), als Gerüst- und Struktur-Proteine für Knochen, Gewebe und Muskeln (Muskelkontraktion), als Antikörper, als Transportproteine (z.B. Hämoglobin für Sauerstofftransport im Blut) sowie als Rezeptorproteine für die Signalübertragung zwischen und innerhalb von Zellen, für den Stofftransport durch Zellmembrane und für den Zusammenhalt von Geweben (Zelladhäsion). Proteine sind aus miteinander verketteten Aminosäuren aufgebaut. Als proteinogene Aminosäuren werden alle Aminosäuren bezeichnet, die die Bausteine der Proteine von Lebewesen sind. Bisher sind 23 solcher Aminosäuren bekannt. Beim Menschen kommen 21 dieser Aminosäuren vor, davon sind 8 in dem Sinn essentiell, dass sie lebensnotwendig sind, aber im menschlichen Organismus nicht synthetisiert werden können, also mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Aminosäuren (A) haben die Strukturformel NH2- <A-Rest> -COOH mit der Aminogruppe NH2 und der Carbonsäuregruppe COOH und einem Aminosäure-Rest mit mindestens einem C-Atom (z.B. CH2 für Glycin). Alle proteinogene Aminosäuren sind α-Aminosäuren, d.h. die NH2 - und die COOH-Gruppe hängen am gleichen C-Atom von A-Rest. Sie verbinden sich unter Abspaltung von H2O nach folgendem Muster zu langen Ketten: NH2 -<A1-Rest>-CO (OH H) NH-<A2-Rest>-COOH. Bei Kettenlängen bis zu mehreren 1000 (meist jedoch 100 bis 300) und 23 in Proteinen vorkommenden Aminosäuren ist die Zahl der möglichen Proteine unvorstellbar groß. Bisher sind ca. 200.000 Proteine bekannt. Unter den Proteinen spielen die eine besonders wichtige Rolle, die als Enzyme wirken. Von Bakterien bis zum Säugetier wird die Chemie des Lebens von Enzymen gesteuert. Vorsichtige Schätzungen gehen dahin, dass eine einzelne Zelle eintausend bis mehrere tausend spezifische Enzyme enthält. Enzyme wirken katalytisch, d.h. sie überwinden die Reaktionsträgheit der Substrate (Ausgangsstoffe) so, dass die Reaktion sehr viel schneller und bei normaler Temperatur abläuft. Das Enzym bindet sich vorübergehend an das Substrat, es verändert dadurch dessen chemische Struktur so weit, dass die gewünschte chemische Reaktion erfolgen kann. Am Ende der Reaktion steht das Enzym in ursprünglicher Form für erneute Wirksamkeit zur Verfügung. Einerseits ist die Reaktionsträgheit der meisten chemischen Substanzen eine fundamentale Voraussetzung für Leben, da sonst keine hinreichend stabilen Lebensstrukturen entstehen könnten, andrerseits müssen viele lebenserhaltenden Funktionen millionenfach schneller ablaufen, also sie das normalerweise tun. Eine chemische Verbindung zwischen 2 Molekülen kommt durch einen Zusammenschluss ihrer Elektronenhülle zustande. Die Wirkung eines Enzym-Moleküls besteht nun darin, dass es durch die Beschaffenheit eines Teils seiner Elektronenhülle, des sogenannten aktiven Zentrums, die Elektronenhülle der SubstratMoleküle so verändert, dass sich für diese eine optimale Reaktionsbereitschaft ergibt. Diese elektrische Beeinflussung spielt sich im Bereich einer millionstel Sekunde ab, die durch Enzym katalysierte Reaktion innerhalb einer hunderttausendstel Sekunde. Die biologische Funktion des Enzyms ist durch seine Aminosäuren-Sequenz (Primärstruktur), aber auch durch seine sogenannte Sekundärstruktur (räumliche Anordnung, vorwiegend spiralig) und Tertiärstruktur (Knäuelbildung) bestimmt. Diese wirken zusammen, um das aktive Zentrum des Enzyms in geeigneter Weise an die Ausgangssubstrate heranzubringen. Die Bildung von Proteinen (Proteinbiosynthese) wird in einem Folgekapitel beschrieben. (2) Kohlehydrate dienen in erster Linie als Energiespender, sie werden dabei abgebaut zu Traubenzucker (Glukose). Nicht unmittelbar verwertete Kohlehydrate können in Fette (Depotfett) umgewandelt werden, der umgekehrte Vorgang kann im tierischen Organismus nicht erfolgen. Cellulose und Chitin (sogenannte Polysaccharide) haben wichtige Gerüst- und Stützfunktionen: Cellulose in pflanzlichen Zellen, Chitin in der Zellwand von Pilzen und dem Exoskelett von Gliederfüßern. Kohlehydrate (Zucker, Stärke, Cellulose, Glykogen) sind bis auf wenige Ausnahmen durch die Formel CnH2nOn beschreibbar („Hydrat“, da Wasserstoffund Sauerstoff-Anteile der Zusammensetzung des Wassers H2O entsprechen). Kohlehydrate entstehen durch Photosynthese und nachgelagerte Prozesse. Ihre Bedeutung im Energiestoffwechsel der Lebewesen wird in einem Folgekapitel beschrieben. (3) Nukleinsäuren sind aus Nukleotiden, aufgebaute Makromoleküle. Ihr bekanntesten Vertreter sind die Desoxyribonukleinsäure (DNS/englisch: DNA), der Speicher der Erbinformation, und die Ribonukleinsäure (RNS bzw. RNA), welche eine zentrale Rolle bei der Synthese von Proteinen spielt, aber z.B. auch als Biokatalysator für bestimmte Stoffwechselreaktionen dient. Nukleotide dienen als Grundbaustein von Nukleinsäuren (DNA und RNA). Außerdem haben viele Arten von Nukleotiden lebensnotwendige regulatorische Funktionen in Zellen, z.B. als ATP im Energiekreislauf. Sie haben die Form: „Phosphat (P)- Zucker(Z)-Base (B)“. Der Phosphor-Bestandteil ist charakteristisch für Nukleinsäuren, er kommt bei Proteinen nie vor. Die Verkettung der Nukleotide zu Nukleinsäuren erfolgt über die Phosphat- und ZuckerBestandteile (P-Z-P-Z…), wobei am Z jeweils auch die entsprechende Nukleotid-Base hängt. In der DNA und RNA aller Lebewesen kommen nun genau 4 verschiedene Nukleotid-Basen vor. Bei der DNA sind dies Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T), bei der RNA ist nur Thymin durch die Base Uracil (U) ausgetauscht. In der Aufeinanderfolge (Sequenz) dieser Basen in der DNA ist die Erbinformation gespeichert. Die Bedeutung und Funktion von DNA und RNA für die Vererbung (Gen-Replikation) und die Proteinbiosynthese sowie des Nukleotids ATP für den Energiestoffwechsel wird in Folgekapiteln beschrieben. (4) Lipide werden in Organismen hauptsächlich als Energiespeicher, für die Bildung von Zellmembranen, und zum Aufbau von Hormonen oder hormonähnlich wirkenden Substanzen benötigt. Sie sind ganz oder größtenteils wasserunlöslich und enthalten mehrere Stoffklassen, u.a. Fettsäuren, Fette (Triglyceride), Membran-bildende Lipide und Steroide. . Fette als Energiespeicher finden sich im tierischen Organismus in Fettgeweben (Fettzellen), aber z.B. auch die Samen der Ölpflanzen enthalten Fette als Energielieferant für die Keimung. Fettgewebe dienen aber auch zur Wärmeisolierung und als Druckpolster, viele wichtige Organe werden durch einen Fettmantel geschützt. Fette bestehen aus oder enthalten Fettsäuren. Fettsäuren werden für diverse Stoffwechselprozesse benötigt. Einige Fettsäuren sind für den Menschen sogar essentiell. Membran-bildende Lipide sind wesentlicher Bestandteil aller Zellmembrane (außer bei Archaeen). Steroide kommen in Tieren, Pflanzen und Pilzen vor. Sie dienen u.a. der Synthese von Sexualhormonen. Das wichtigste Steroid in tierischen Organismen ist Cholesterin. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Zellmembranen und eine wichtige Substanz beim Aufbau von Sexualhormonen und Gallensäure. Cholesterin wird zwar auch mit der Nahrung aufgenommen, überwiegend aber im Organismus, vor allem in der Leber, synthetisiert. Pflanzen und Pilze enthalten kein Cholesterin. (5) Porphyrine sind organische Farbstoffe mit einer bestimmten chemischen Grundstruktur. Als Chlorophylle dienen sie im Rahmen der Photosynthese der Lichtabsorption und der Weiterleitung der absorbierten Energie. Als Bestandteil sogenannter farbiger Proteine dienen sie dem Transport des Blutsauerstoffs (Häm-Gruppe des Proteins Hämoglobin) oder spielen eine enzymatische Rolle, z.B. als Häm-Gruppe des für die Zellatmung in den Mitochondrien wichtigen Proteins Cytochrom c. Dieses besteht aus ungefähr100 Aminosäuren. Es kommt bei fast allen Lebewesen in sehr ähnlicher Form vor, wobei die Sequenz-Unterschiede ein wichtiges Mittel zur taxonomischen (evolutionsgeschichtlichen) Einteilung der Arten sind. (6) Vitamine sind Biomoleküle unterschiedlicher chemischer Struktur, die für den Menschen essentiell sind, also i.d.R. mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. 5. DNA-Replikation und Protein-Biosynthese Der Mechanismus der Vererbung: Die Vererbungslehre (Genetik) geht auf den Augustinermönch Gregor Mendel zurück, der in den Jahren 1856 bis 1865 im Garten seines Klosters systematische Kreuzungsexperimente mit Erbsen durchführte. Mendel erkannte, dass die materiellen Träger bestimmter vererbbarer Merkmale in den Zellen in als Merkmalspaar, also in doppelter Ausprägung vorliegen, und dass bei der geschlechtlichen Fortpflanzung jeweils nur eine Merkmalsausprägung in die männlichen und weiblichen Geschlechtszellen übernommen und auf die Nachkommen weiter vererbt wird. Er untersuchte, welche Kombinationen von Merkmalsausprägungen dabei von Generation zu Generation auftreten können, und wie sich diese im äußeren Erscheinungsbild der Nachkommen niederschlagen (Mendelsche Regeln). Treffen beim Nachkommen eine dominante und eine rezessive Merkmalsausprägungen (z.B. braune und blaue Augen) zusammen, so zeigt sich in dessen Äußeren nur die dominante Ausprägung, die Erbinformation für die rezessive Merkmalsausprägung (hier "blaue Augen") bleibt jedoch erhalten und kann an die nächste Generation weitergegeben werden. Bei der selteneren intermediärer Vererbung wird eine Mischform der beiden Erbanlagen gebildet. Zum Beispiel ergibt sich bei der japanischen Wunderblume die Blütenfarbe rosa, wenn das Exemplar die Merkmalsausprägungen rot und weiß besitzt. Die Chromosomen-Theorie der Vererbung entstand Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts (1903, Walter Sutton). Danach ist die die Erbinformation im Zellkern aller Eukaryoten (Tiere, Pflanzen, Pilze) in Form von Chromosomen enthalten. In diesen sind die Gene, als die materiellen Träger der einzelnen Erbanlagen, wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht. Die Chromosomen liegen in der Regel immer paarweise vor, daher auch die für die Erbmerkmale zuständigen Gene oder Gen-Kombinationen. Der Mensch z.B. hat 23 Chromosomenpaare. Jedes dieser Paare enthält ca. 1000 Gene in jeweils doppelter, aber spezifischer Ausprägung. Bei normaler Zellteilung (Mitose) wird dieser Chromosomensatz zunächst verdoppelt, jede Tochterzelle erhält dann wieder den kompletten Chromosomensatz. Bei der Reduktionsteilung zu Geschlechtszellen (Meiose) werden die Chromosomenpaare jedoch aufgespalten und jeweils nur ein halber (haploider) Chromosomensatz in diese übertragen. Durch Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bei der Befruchtung wird also nach Zufall je eines der beiden Chromosomen der Eltern mit seinen spezifischen Merkmalsausprägungen an die Zygote des Nachkommen weiter gegeben. Dieser Vererbungsvorgang läuft bei Pflanzen und Tieren in grundsätzlich gleicher Weise ab. Bei Vererbung individueller Merkmale werden viele Anlagen nur gemeinsam mit anderen vererbt, weil die entsprechenden Gene auf dem gleichen Chromosom liegen, andere (z.B. die Hautfarbe der Menschen) werden durch mehrere Gene auf unterschiedlichen Chromosomen festgelegt. Die Geschlechtsbestimmung erfolgt (bei allen Säugetieren und vielen Insekten) durch ein bestimmtes Chromosomenpaar, das beim weiblichen Tier in so bezeichneter XXbeim männlichen Tier in XY-Ausprägung vorliegt. Je nachdem ob bei der Befruchtung der Xoder der Y- Anteil des Chromosomenpaars des männlichen Tiers weiter vererbt wird, entsteht ein weiblicher oder männlicher Nachkomme. Fast alle Gene der Eukaryoten liegen auf den Chromosomen des Zellkerns. Einige wenige liegen auf DNA-Strukturen in den Mitochondrien, bei Pflanzen auch in den Chloroplasten. Die DNA in den Mitochondrien wird nur von der Mutter auf die Nachkommen übertragen; sie eignet sich daher besonders gut zur Erforschung evolutionsgeschichtlicher Zusammenhänge. Prokaryoten bilden keine Chromosomen, sondern frei in der Zelle schwimmende DNAStrukturen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die molekular-biologischen Grundlagen der Vererbung weitgehend geklärt. Danach bestehen die Chromosomen aus DNA (Desoxyribonukleinsäure), die mit Proteinen verpackt ist. Der eigentliche Träger der Erbinformation im Chromosom ist die DNA, wobei jedes Chromosom ein fadenförmiges DNA-Molekül enthält, und die Gene durch aufeinanderfolgende Abschnitte auf diesem DNA-Faden gebildet werden. Die genaue Struktur der DNA wurde 1953 erkannt (Watson und Crick). Demnach besteht der DNA-Faden eines Chromosoms in Wirklichkeit aus zwei Einzelstrang-Molekülen, die jeweils die identische genetische Information enthalten und sich spiralig umeinander winden. Man spricht daher auch von der DNA-Doppelhelix oder dem DNA-Doppelstrang. Jeder der beiden Stränge besteht aus einer Kette von Nukleotiden (das sind Bausteine der Form „Phosphat– Zucker– Base“), wobei jedes Nukleotid genau eine der vier Basen Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) enthält. Die Erbinformation ist in der DNA durch die Abfolge der Basen im Strang gespeichert. Der zweite Strang der Doppel-Helix ist ein komplementäres Spiegelbild des ersten Stranges, das dadurch entsteht, dass man jede Base eines Stranges im anderen Strang durch die zugehörige komplementäre Base ersetzt. Dabei sind Guanin und Cytosin zueinander komplementär, ebenso die Basen Adenin und Thymin; d.h. überall, wo im einen Strang die Base Guanin vorkommt, steht im anderen Strang die Base Cytosin und umgekehrt, das Gleiche gilt für das Basenpaar Adenin und Thymin. Die beiden Einzelstränge sind spiralig so umeinander gewunden, dass sich jeweils zwei komplementäre Basenpaare gegenüberliegen und durch eine sogenannte schwache Wasserstoffbrücke miteinander verbunden sind. Die beiden Stränge sind also komplementäre Spiegelbilder voneinander, sie enthalten beide die gleiche Erbinformation. Gene sind Abschnitte der DNA, welche die Information zur Herstellung einer spezifischen, biologisch aktiven RNA (Ribonukleinsäure) enthalten. Diese wiederum steuert dann die Synthese von Proteinen oder die Regulation einer bestimmten Protein-Konzentration in der Zelle. Das menschliche Erbgut (Genom) umfasst ca. 23.000 RNA-codierende Gene. Diese machen aber weniger als 10% des menschlichen Genoms aus. Aber auch für nicht-codierende DNA-Abschnitte wurden bereits Funktionen identifiziert (u.a regulatorische Zellfunktionen, aber auch „stillgelegte“ evolutionär konservierte Funktionen). Menschen haben zwei Kopien des Genoms, eine von der Mutter und eine vom Vater, die in jedem Zellkern in Form von 23 Chromosomenpaaren vorliegen. Die Gesamtlänge der DNA in jeder menschlichen Zelle beträgt etwa 2 Meter, diese etwa 3,2 Milliarden Basenpaare sind beim Menschen auf 2x23 = 46 Chromosomen verteilt, so dass ein Chromosom im Schnitt etwa einen DNA-Faden von knapp 4-5 cm Länge mit etwas über 1000 Genen enthält. (Bei ca. 100 Billionen Zellen pro Mensch ergibt sich eine DNA-Gesamtlänge von 150 Milliarden km.) DNA-Replikation: Bevor sich eine Zelle teilt, muss die DNA aller Chromosomen verdoppelt werden. Dieser DNA-Replikation genannte Vorgang ist erforderlich, damit später beide Tochterkerne das ganze Erbgut, also Kopien aller Chromosomen, erhalten können. Wie oben geschildert enthält jedes Chromosom eine DNA- Doppelhelix in Form zweier spiralig umeinander gewundenen Nukleotid-Stränge, wobei die beiden Stränge in dem Sinn exakt spiegelbildlich aufgebaut sind, dass jeder Nukleotid-Base eines Stranges im anderen Strang die komplementäre Nukleotid-Base gegenüberliegt. Die Verdopplung der DNA bei der Zellteilung erfolgt nun im Prinzip so, dass der Doppelstrang in zwei Einzelstränge aufgelöst wird, und für die entstehenden Einzelstränge der zugehörige komplementär gespiegelte Strang sukzessive wieder neu aufbaut wird. Dieser Prozess wird durch spezielle Enzyme (Polymerasen) gesteuert. Nach der DNA-Verdopplung hat jedes Chromosom zwei identische DNA-Doppelstränge. Diese beiden Doppelstränge werden räumlich voneinander getrennt und mit Proteinen zu zwei identischen Schwester-Chromosomen verpackt. Bei der anschließenden Zellteilung erhält dann jede der beiden Tochterzellen den gleichen Chromosomensatz. Protein-Biosynthese: Die Protein-Biosynthese der Lebewesen wird durch aktive Gene der DNA gesteuert. Viele dieser Gene enthalten die Information zur Synthese eines bestimmten Proteins. Der Aufbau eines Proteins erfolgt dann in zwei Teilprozessen: Zunächst wird eine Kopie des Gens in Form eines RNA-Moleküls erstellt (genannt mRNA= messanger-RNA/ Boten-RNA). Dieser Transkription genannte Vorgang erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Gen-Replikation und wird wie diese durch spezielle Enzyme gesteuert. Dabei wird die DNA-Doppelhelix entlang des Gen-Abschnitts vorübergehend aufgetrennt, anschließend wird dort eine RNA mit einer Codierung (Basenfolge) erstellt, die exakt der des Gens entspricht. Wie das kopierte Gen der DNA besteht die Boten-RNA dann aus einer Nukleotid-Kette aus 4 „Buchstaben“, den Nukleotid-Basen Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Uracil (U), d.h. die Base Uracyl ersetzt die Base Thymin der DNA. Im anschließenden Vorgang der Translation wird das Protein entsprechend der in die mRNA kopierten Bauvorschrift des Gens synthetisiert. Dies erfolgt an den Ribosomen der Zelle, bei Eukaryoten also außerhalb des Zellkerns. Wie am Fließband arbeiten die Ribosomen die Information einer Boten-RNA nach einer für alle Lebewesen gleichen Bauvorschrift ab, in dem sie für jeweils 3 sukzessive „Buchstaben“ der mRNA das dieser Buchstabensequenz entsprechende Aminosäure-Molekül an die entstehende Aminosäurenkette anhängen bis die Boten-RNA abgearbeitet und das Protein-Molekül fertig ist. Jede 3’er Sequenz der 4 RNABasen mit den Kürzeln A, C, G, U bezeichnet also genau eine Aminosäure. Diese Codierung nennt man den genetischen Code. Er ist bei allen Lebewesen gleich. Da es 43=64 solcher Tripletts zur Bezeichnung von 20 derart genetisch-codierten Proteinbildenden Aminosäuren (sogenannten „kanonischen Aminosäuren“) gibt, haben einige dieser Aminosäuren Mehrfach-Codierungen. 2 weitere in Proteinen des Menschen vorkommende Aminosäuren werden nicht durch Transkription abgeleitet, sondern im Rahmen der Translation nach einem anderen Zellmechanismus eingebaut. Alternatives Spleißen (engl. splicing) : dieser Mechanismus im Rahmen der Transkription bei Eukaryoten erlaubt die Herstellung unterschiedlicher Proteine auf Basis einer DNASequenz (eines Gens). Dabei wird zunächst eine prä-mRNA anhand der DNA-Sequenz gebildet. Diese kann durch nachträgliches Schneiden und Zusammensetzten unter Steuerung spezieller Proteine in mehrere unterschiedliche mRNA umgeformt werden und damit im Rahmen der Translation zur Synthese unterschiedlicher Proteine führen. Auf diese Weise ist z. B. eine menschliche Zelle in der Lage, mit ihren rund 23.000 proteincodierenden Genen viele hunderttausend verschiedene Proteine herzustellen. Spleißen wird als wichtiger Faktor bei der Evolution neuer „nützlicher“ Proteine angesehen, ist aber auch für einige Erbkrankheiten verantwortlich. 6. Der Energie-Stoffwechsel Zellen müssen ständig Arbeit leisten: mechanische Arbeit (z.B. Kontraktion von Muskelzellen, Schlagen von Geißeln), Transportarbeit (z.B. zur Herstellung von Konzentrationsgefällen), chemische Arbeit (zum Antreiben energiebedürftiger StoffwechselReaktionen, wie z.B. die Synthese von DNA oder Proteinen), osmotische Arbeit (z.B. Sekretion der Drüsen), elektrische Zellarbeit (Nervenzellen) oder thermischer Zellarbeit (Körpertemperaturregelung). Mit Energie-Stoffwechsel bezeichnet man alle Stoffwechselvorgänge, welche die Energie für die Zellarbeit liefern. Energie muss von außen aufgenommen werden, in Form von Nährstoffen gespeichert oder transportiert werden und für die Arbeit in den Zellen in geeigneter Form aufbereitet werden. Bei allen energetischen Stoffwechselprozessen entsteht auch Wärmeenergie, die nach außen abgeführt werden muss. Diese laufen daher in langen Reaktionsketten so ab, dass bei jeder Einzelreaktion nur geringe energetische Umsetzungen erfolgen, und die entstehende Wärme von den Zellen auch abgeführt werden kann. Physikalisch gesehen sind Lebewesen offene thermodynamische Systeme, die ständig Energie zuführen müssen, um ihre hochgradige innere Ordnung aufrecht zu erhalten und damit ihre Entropie niedrig zu halten. Gleichzeitig muss die bei energetischen Prozessen entstehende ungeordnete Wärmeenergie abgeführt, in Summe also Entropie exportiert werden. Durch Wachstum der Zelle nimmt das Verhältnis Oberfläche/Volumen ab, der Wärmeexport wird bis zur nächsten Zellteilung erschwert. Kleine warmblütige Tiere müssen daher aber relativ (d.h. pro cm³) mehr Energie aufwenden als Große, um den Wärmeverlust durch die Oberfläche auszugleichen und die Körpertemperatur aufrecht zu halten. Energiegewinnung: Bezüglich der Quelle ihrer Lebensenergie kann man zwei Klassen von Lebewesen unterscheiden. Tiere, Pilze und die meisten Bakterien und Archaeen gewinnen ihre Energie ausschließlich aus organischen Nährstoffen (Kohlehydrate, Fette, Proteine), die sie mit der Nahrung aufnehmen; d.h. sie ernähren sich von organischen Körperbestandteilen anderer lebender oder gestorbener Organismen. Solche Lebewesen nennt man heterotroph. Lebewesen, welche die benötigten organischen Stoffe mittels Sonnenlicht oder durch chemische Umsetzung anorganischer Stoffe selbst aufbauen können, nennt man autotroph. Pflanzen, Algen und einige Bakterienarten gewinnen die für ihren Stoffwechsel benötigte Energie aus dem Licht der Sonne durch Photosynthese. Dabei wird Licht bestimmter Wellenlängen durch einen geeigneten Stoff, meist Chlorophyll, absorbiert. Dessen Farbe erscheint „Blattgrün“, da der rotwellige Lichtanteil absorbiert und daher grün reflektiert wird. Die Licht-absorbierenden Moleküle gelangen in einen angeregten, energiereichen Zustand. Diese elektromagnetische Energie wird in einer vielstufigen Reaktionskette in chemische Energie umgewandelt und zum Aufbau energiespeichernder Kohlehydrate aus Wasser und Kohlendioxyd verwendet. Primär entsteht dabei Glukose (Traubenzucker) nach folgender Summenformel: 6 CO2 + 6 H2O + Licht => C6H12O6 + 6 O2. Die Photosynthese ist nicht nur der bedeutendste biochemische Prozess der Erde, sondern auch einer der ältesten. Sie ist der Primärproduzent organischer Stoffe, die heterotrophen Lebewesen als Energie- und Baustoffquelle dienen, sie bildet den Anfang der Nahrungskette des Lebens. Die von allen Pflanzen und Algen genutzte, sogenannte oxygene Photosynthese, bei der freier Sauerstoff entsteht, liefert darüber hinaus den atmosphärischen Sauerstoff, den alle aeroben Organismen zum Leben benötigen. Gewisse Bakterien nutzen auch eine ursprünglichere, anoxygene Form der Photosynthese, bei der nicht Wasser sondern z.B. Schwefelwasserstoff genutzt wird und daher auch kein freier Sauerstoff entsteht (CO2 + 2H2S + Licht -> CH2O + H2O + 2S). Einige Bakterien (z.B. Schwefel- oder Nitratbakterien) können benötigte organische Stoffe aber auch ohne Licht durch Oxidation anorganischer Stoffe (z.B. Schwefelwasserstoff H2S oder Ammoniak NH3) aufbauen. Vermutlich war diese Chemosynthese die ursprünglichste Form der Energiegewinnung bei der Evolution des Lebens auf der Erde. Man findet sie nur bei aeroben Bakterien, vorwiegend in extremen Habitaten, z.B. heißen Quellen, in der Tiefsee, in aktiven Vulkanen. Schwefelbakterien z.B. gewinnen ihre Energie durch Oxydation von Schwefelwasserstoff: 2H2S + O2 → S2 + H2O + Energie. Nährstoffverwertung: Tiere, Pilze und die meisten Bakterien und Archaeen gewinnen ihre Energie ausschließlich aus organischen Nährstoffen (Kohlehydrate, Fette, Proteine), die sie mit der Nahrung aufnehmen. Von der Nahrungsaufnahme bis zur Energiegewinnung in den Zellen laufen eine Vielzahl Enzym-gesteuerter chemischer Prozesse ab. Im tierischen Organismus müssen die Nährstoffe im Verdauungsvorgang zunächst so aufbereitet werden, dass sie im Blut gelöst an die Orte des Energiebedarfs transportiert werden können. Kohlehydrate werden dabei zu Glukose abgebaut, Proteine in Aminosäuren und Peptide gespalten, Fette in Fettsäuren und Glyzerin zerlegt. Kohlenhydrate sind der hauptsächliche Energielieferant für die Zellen. Sie sind im Gegensatz zu den Fetten relativ schnell verwertbar, da sie auch anaerob (d.h. ohne Sauerstoff) Energie liefern. Die akute Energieversorgung tierischer Zellen wird im Wesentlichen über die im Blut gelöste Glukose gewährleistet. Ihre Konzentration im Blut, der Blutzuckerspiegel, wird in engen Grenzen reguliert. Jede Körperzelle kann Glukose durch die Zellmembran aufnehmen bzw. wieder abgeben. Nicht unmittelbar zur Zellarbeit benötigte Glukose kann in bestimmten Gewebezellen - bei Tieren vor allem Leber und Muskel-Zellen - in Form von Glukose-Ketten zwischengespeichert werden, als Glykogen bei Tieren und Pilzen, als Stärke bei Pflanzen. Ist die Versorgung der Gewebe mit Kohlenhydraten dauerhaft größer als ihr Verbrauch, wird der Überschuss in tierischen Organismen in Fett (Depotfett) umgewandelt und gespeichert. Glykolyse und Zellatmung: Der Abbau der Glukose in den Zellen erfolgt entweder unter Mitwirkung von Sauerstoff (aerob) oder ohne Sauerstoff durch Gärung (anaerob). Der anaerobe Abbau, Glykolyse genannt, wird von fast allen Lebewesen beherrscht, was auf eine sehr frühe Entstehung hinweist. Er ist meist eine Vorstufe des aeroben Abbaus. Bei der Glykolyse wird je ein Molekül Glukose in mehreren enzymatisch katalysierten Reaktionen u.a. in zwei sogenannte Pyruvat-Moleküle gespalten. Dabei wird chemische Energie in Form von 2 ATP-Molekülen für weitere Zellarbeit gewonnen. Die Pyruvat-Moleküle werden nun entweder ohne weitere Energiegewinnung durch Milchsäure-Gärung zu Lactat („SummenFormel“: C6H12O6 -> 2C3 H6 O3 +2 ATP) oder durch alkoholische Gärung (z.B. bei Hefen) zu Ethanol abgebaut oder sie werden dem weiteren aeroben Abbau zugeführt. Beim aeroben Abbau von Glukose wird chemische Energie in Form von 34 ATP-Molekülen erzeugt (Summenformel: <C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + 34 ATP>) und Kohlendioxyd ausgeschieden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Zellatmung oder aerobe Dissimilation. Er ist 17x effektiver als die Glykolyse, wird von allen Eukaryoten beherrscht und findet bei diesen in den Mitochondrien der Zellen statt. Die Zellatmung ist im Resultat also die Umkehrung der Photosynthese. Beides sind vielstufige chemische Reaktionsketten, die unter Mitwirkung zahlreicher Enzyme ablaufen. Alle Eukaryoten und viele Prokaryoten sind aerobe Organismen, sie benötigen Sauerstoff für die Zellatmung. Dieser wird fast komplett durch die Photosynthese der Pflanzen, Algen und Cyanobakterien erzeugt. Umgekehrt wird bei der Zellatmung das Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben, das für die Photosynthese benötigt wird. So sind beide StoffwechselProzesse in einem globalen Kreisprozess miteinander verknüpft. Der zentrale biochemische Prozess der Zellatmung ist der sogenannte Citratzyklus. In den Citratzyklus münden aber auch die Abbauprodukte anderer Nährstoffe, wie z.B. Fettsäuren und Proteine. Sogenannte „Acetyl-CoA Moleküle“ bilden dabei das zentrale Abbauprodukt der verschiedenen Nährstoffklassen. Diese Moleküle werden durch den Citratzyklus unter (anschließender) Zufuhr von Sauerstoff vollständig zu CO2 und H2O abgebaut. Das Prinzip der Energiegewinnung ist wie bei einer Knallgasreaktion, in der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagieren. Durch den Citratzyklus wird der Wasserstoff aber in chemisch gebundener Form sogenannter Reduktionsäquivalente bereitgestellt und anschließend kontrolliert zu Wasser oxidiert. ATP-Zyklus: Beim Abbau der Glukose in den Zellen (aber auch beim Abbau anderer Nährstoffe wie Fettsäuren und Proteine) wird das Nukleotid ATP (Adenosintriphosphat) gebildet. ATP dient zur Zwischenspeicherung und zum Austausch von Energie für alle Stoffwechselvorgänge, es setzt die Energie in kleinen, biologisch brauchbaren Mengen frei, wann und wo immer sie bei der Verrichtung von Zellarbeit benötigt wird, und nimmt in dieser Funktion eine Monopolstellung in der gesamten Welt der lebenden Materie ein. ATP ist sozusagen die universelle Energiewährung aller lebenden Organismen. Die ATP-Moleküle werden gemäß der Formel „ADP + P (Phosphor) + Energie -> ATP“ erzeugt. Auch bei der Photosynthese und Chemosynthese wird die gewonnene chemische Energie zunächst durch Phosphorylierung von ADP zu ATP gespeichert. Wird nun die chemische Energie der ATP-Moleküle für Zellarbeit benötigt, spaltet sich das ATP wieder gemäß „ATP -> ADP + P + Energie“ auf und gibt Energie frei. Die Komponenten ADP und Phosphor stehen für eine erneute ATP-Synthese wieder zur Verfügung. In Realität liegen obigen summarischen Formeln komplexere, katalytisch unterstützte Reaktionen zu Grunde. Da ATP in den Zellen jedoch nur in geringer Konzentration vorliegt, muss es durch den Abbau energiereicher Nährstoffe ständig nachgebildet werden. Für einen täglichen Bedarf von 3000 Kilokalorien müssen etwa 75 Kilogramm ATP gebildet werden. Da im menschlichen Körper aber nur ca. 50 Gramm ATP ständig vorhanden sind, muss jedes ATP-Molekül täglich 1500-mal gespalten und neu gebildet werden; d.h. ein Zyklus ATP -> ADP+P -> ATP dauert im Mittel eine Minute. Pro Sekunde und Zelle werden im Schnitt etwa 1 bis 2 Millionen ATPMoleküle verbraucht aber auch wieder neu generiert. Das verfügbare ATP in der Muskulatur reicht ohne Nachschub nur für circa 2 – 3 Sekunden Belastung. ATP muss daher ständig nach produziert werden. Für die blitzschnelle Resynthese von ATP wird Kreatin-Phosphat aus dem Proteinstoffwechsel genutzt. Der vorhandene Vorrat ist aber sehr gering und reicht für circa 5 – 7 Sekunden. Der nächste Schritt ist die ATPResynthese durch anaeroben Glucose-Abbau (Glykolyse). Dieser Vorgang geht zwar sehr rasch vor sich, ist aber ebenfalls nicht sehr ergiebig. Soll dauerhaft Hochleistung erbracht werden, muss genug Sauerstoff zu den Zellen transportiert werden, dass der aerobe Abbau von Glucose und Fetten aufrecht erhalten werden kann, der zwar vergleichsweise sehr viel mehr ATP liefert, aber auch wesentlich mehr Zeit beansprucht. Die Energieausbeute pro g bei Fettverbrennung ist dabei etwa 2 mal so hoch wie bei Kohlehydraten, dauert aber länger und erfordert mehr Sauerstoff. Die ATP-Konzentration in der Zelle ist eine Regelgröße, sinkt sie unter einen Schwellwert ab, werden Energie-liefernde Reaktionen aktiviert, übersteigt sie einen anderen Schwellwert, so bewirkt dies eine Energiespeicherung, z.B. durch Bildung von Kreatin-Phosphat als schnell verfügbaren Speicher im Muskel oder durch Aufbau von Glykogen in Muskeln und vor allem in der Leber. Diese Protein- und Kohlenhydrat-Speicher sind allerdings limitiert; weiterer Energieüberschuss führt zur Speicherung von Fett (Depotfett). 7. Das Leben als System von Regelkreisen Seit Begründung der Kybernetik durch Norbert Wiener Mitte das 20. Jahrhunderts wurde zunehmend erkannt und erforscht, dass jeder lebende Organismus auch ein äußerst kompliziertes, aufeinander abgestimmtes und vernetztes System von Regelkreisen darstellt. Ein Regelkreis mit negativer Rückkopplung ist ein System, das durch eine regelnde Einrichtung nach gewissen Sollgrößen ausgerichtet wird; erfährt das zu regelnde System eine Störung durch die Umwelt und dadurch eine Abweichung von den Sollgrößen, so wird diese Abweichung an die regelnde Einrichtung gemeldet (Rückkopplung), die dann dieser Abweichung durch die Beeinflussung einer Stellgröße gegensteuert. Dies setzt natürlich einen Steuerungs- und Rückkopplungskanal für die Nachrichtenübertragung zwischen geregeltem System und regelnder Einrichtung voraus. So wird z.B. die ausreichende Sauerstoffversorgung der Körperzellen dadurch geregelt, dass die Abweichung von Sollwerten durch Fühler in den Arteriewänden registriert werden, diese über Nervenbahn zu einer bestimmten Gehirnpartie geleitet werden, welche dann wieder über die Nervenbahn die Stellgröße „Atemfrequenz“ entsprechend verändert. Auch Blutdruck, Blutzuckerspiegel, ATP-Konzentration in den Zellen, Wärmehaushalt und Körpertemperatur sind Beispiele für geregelte Systeme. Die Körperhaltung der Wirbeltiere muss laufend durch Regelvorgänge stabil gehalten werden. Auch Willenshandlungen wie das Greifen nach einem Gegenstand sind Regelkreis-gesteuert. Die vielfältigen Regelkreise in Organismen sind oft miteinander gekoppelt. Der Sollwert eines Regelkreises kann durch einen weiteren Regelkreis vorgegeben werden. So verändert sich der Sollwert für die Körpertemperatur, wenn der Körper mit Fieber auf eine Erkrankung reagiert. Die Nachrichtenübermittlung im lebenden Organismus geschieht dabei entweder in Form elektrischer Impulse über die Nervenbahnen oder durch die Ausschüttung von Hormonen. Nervenbahnen werden genutzt für die Übertragung von Sinnesreizen (der Seh-, Hör- und Gefühlsnerven) an das Gehirn, aber auch für die Steuerung vieler Willensprozesse, wie z.B. beim Spannen von Muskeln. Hormone werden zur Erfüllung von Funktionen eingesetzt, bei denen Informationen an mehrere Stellen im Organismus übertragen werden muss, vielfach bei Steuerungsvorgängen, die zu vorherbestimmten Zeiten ausgelöst werden. Durch Hormone werden z.B. Zellteilung, Wachstum der Organismen, Fortpflanzungs- und Kampfinstinkte, Geburt der Säugetiere und Wandertrieb der Zugvögel gesteuert. Die Übertragung dieser Wirkstoffe erfolgt durch das Blut (Übertragungszeit ca. 1 Sek., Wirkung Minuten bis Tage). Das Versagen eines Steuerungs- oder Rückkopplungskanals z.B. durch Entzündungsherde, mangelnde Hormonproduktion oder toxische Substanzen ist die Ursache vieler chronischer Erkrankungen. Unser Organismus (und auch jede Zelle) ist ein offenes System, d.h. dass es mit seiner Umwelt in einem ständigen Stoffwechselaustausch steht. Die Zufuhr benötigter Stoffe von außen (Nahrung, Sauerstoff) führt in den Organen und Zellen zu einer Vielzahl gekoppelter Stoffwechselreaktionen, die in der Summe die Lebensfähigkeit sichern. Die meisten dieser internen Stoffwechselreaktionen werden durch Enzyme reguliert, die immer in benötigter Konzentration bereitgestellt werden müssen, damit das angelieferte Zwischenprodukt auch ausreichend schnell umgesetzt wird. Dabei stellt sich von Stoffzufuhr über alle interngekoppelten Stoffwechselreaktion bis zur Abfuhr von Abfallsubstanzen und Wärmeenergie ein sogenanntes Fließgleichgewicht ein. Das offene System muss in der Lage sein, über die gesamte Reaktionskette auf Störungen der Stoffzufuhr oder Umweltbedingungen zu reagieren. Dies geschieht durch viele Regelungsvorgänge: z.B. Regelung der Enzymaktivität, Regelung der Enzymsynthese, Regelung der Membrandurchlässigkeit, Regelung der Transportvorgänge. Die langsamste Teilreaktion bestimmt dabei den "Gesamtdurchfluss" durch das System. Die Ursache vieler Stoffwechselkrankheiten liegt daran, dass dieses Fließgleichgewicht an einer Stelle z.B durch einen erworbenen oder genetisch bedingten Enzymdefekt gestört wird. Auf zellularer Ebene werden diese Stoffwechsel-Regelkreise durch die Gene der DNA gesteuert. Als Botenstoffe für Steuerungs- und RückkopplungsKanal dienen Biomoleküle wie mRNA. 8. Organisation des Lebendigen: Zusammenfassung Alle Lebewesen bestehen aus Zellen (Einzeller, Vielzeller). Jede Zelle ist ein hervorragend durchorganisierter Chemiebetrieb, in der in jeder Sekunde tausende unterschiedlicher und sehr genau und zweckmäßig auf einander abgestimmten Reaktionen ablaufen. Sehr viele dieser chemischen Reaktionen werden durch spezifische Enzyme gesteuert, die als Biokatalysatoren die Reaktion erst ermöglichen. Enzyme sind Proteine, ihre Moleküle bestehen aus einer Sequenz von 23 in lebenden Organismen vorkommenden Aminosäuren. Die AminosäureSequenz eines Enzyms bestimmt entscheidend seine biologische Funktion. Der Aufbau und die zeit- und mengen-gerechte Bereitstellung der benötigten Enzyme in den Zellen werden durch die Erbinformation des Organismus gesteuert. Diese liegt in jedem Organismus als DNA vor. Das DNA-Molekül realisiert eine Kette aus 4 verschiedenen Basen und unterteilt sich in Abschnitte, die jeweils eine ganz bestimmte Erbinformation tragen und Gene genannt werden. Ein Teil der Gene enthalten jeweils einen Bauplan für ein bestimmtes Enzym, der durch die spezielle Sequenz der 4 Basen auf dem Gen codiert ist. Dieser genetische Code, der der Basen-Sequenz eines Gens die Bauvorschrift für ein entsprechendes Protein zuordnet, ist für alle Lebewesen gleich. Die Proteinsynthese in den Zellen ist ein komplexer biochemischer Vorgang und verbraucht Energie. Die Vermehrung von Zellen durch Zellteilung ist ein Grundprinzip des Lebens. Fortpflanzung und Wachstum der Organismen beruhen auf der Zellteilung. Jede Zelle enthält die komplette Erbinformation. Vor jeder Zellteilung muss daher der komplette DNA-Strang in der Zelle nachgebaut (repliziert) werden. Auch diese „Gen-Replikation“ wird gesteuert durch Enzyme und verbraucht Energie. Der Kern aller Lebensprozesse besteht also aus einem komplexen Regelkreis-gesteuerten Zusammenspiel zwischen der in den Genen der DNA enthaltenen Erbinformation, welche den Aufbau und die mengen- und zeitgerechte Bereitstellung von Enzymen steuert, und diesen Enzymen selbst, welche viele andere Lebensprozesse steuern, insbesondere auch die für die Zellteilung erforderliche Gen-Replikation und die Prozesse, die der Energiegewinnung für die Zellarbeit dienen. 9. Anhang: Moderne Anwendungen der GEN-Technik Stammzellenforschung: Alle Organe und Gewebe des Körpers haben ihren Ursprung in embryonalen Stammzellen. Späterer Gewebeersatz – bei Verletzungen oder Regeneration des betreffenden Gewebes – erfolgt über sogenannte „adulte Stammzellen“, die man in diversen Geweben, etwa im Knochenmark und in der Haut findet. Diese sind jedoch nicht „pluripotent“, d.h. ihr Differenzierungspotential ist beschränkt und damit gewisse Gewebe auch nicht ersetzbar. Die Stammzellenforschung verfolgt die Idee der Heilung von Krankheiten und Verletzungen durch gezieltes Nachzüchten von Geweben. Adulte Stammzellentherapien werden schon seit vielen Jahren z.B. zur Behandlung von Leukämie oder zur Regeneration von Knochen eingesetzt. Da dem Organismus relativ leicht zu entnehmende adulte Stammzellen aber nur eingeschränkt differenzierungsfähig sind, ist es ein erklärtes Ziel der Forschung zu pluripotenten Stammzellen zu gelangen, die wie embryonale Stammzellen uneingeschränkt differenzierungsfähig sind. Die Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen ist moralisch umstritten, da zu ihrer Gewinnung die Zerstörung von frühen menschlichen Embryonen erforderlich ist. Nach dem Embryonenschutzgesetz ist es in Deutschland z.B. verboten, menschliche Embryonen für Forschungszwecke herzustellen, zu klonen oder zu zerstören. Die Forschung an importierten embryonalen Stammzellen ist jedoch unter Auflagen möglich. Für die Heilung von Krankheiten durch Gewebeersatz würden sich aber aus Embryos gewonnene Stammzellen schon allein deshalb nicht eignen, weil diese Zellen ja nicht von dem Erkrankten stammen können und daher vermutlich auch Abstoßungsreaktionen für das nachgezüchtete Gewebe hervorrufen. Bei Heranzüchtung von Ersatzgewebe aus embryonalen Stammzellen besteht außerdem eine Neigung zur Tumorbildung nach einer Transplantation, wenn das Ersatzgewebe noch undifferenzierte Stammzellen enthält. Forschern aus Japan und England ist es 2006/2007gelungen, normale Körperzellen durch Einschleusung bestimmter Gene mittels Viren in induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) umzuwandeln und aus diesen im Labor bestimmte Gewebezellen heranzuzüchten (Nobelpreis 2013). Jüngste Forschungen weisen jedoch darauf hin, dass diese Technik doch nicht vollständig alle Spuren der ursprünglichen Zellfunktion entfernt, so dass auch iPSZellen nur eingeschränkt differenzierungsfähig sind. Gen-Editing: Gen-Editing bezeichnet eine molekularbiologische Methode zu einer gezielten Veränderung der DNA in Zellen von Organismen. Dabei werden bestimmte Enzyme eingesetzt, welche die DNA an einer vorgegebenen Zielsequenz schneiden, also einen Doppelastrangbruch erzeugen. Die nun einsetzenden Reparaturmechanismen der Zelle können gezielt beeinflusst werden um eine DNA-Sequenz herauszuschneiden, einzufügen oder punktuell zu verändern. Es gibt mehrere Methoden mit gleichem Funktionsprinzip. Als besonders leistungsfähig und vielseitig nutzbar gilt das sogenannte CRISPR/Cas-System, welches 2012 von Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna entdeckt wurden und auf einem adaptiven antiviralen Abwehrmechanismus von Bakterien und Archaeen beruht. Dieses funktioniert im Prinzip so: Das Bakterium schneidet bei erstmaligem Virenbefall einen Teil seiner durch den Virus (Bakteriophage) veränderten DNA heraus und fügt diesen in einen sogenannten CRISPRBereich seiner DNA ein (das sind sich wiederholende, identische DNA-Abschnitte zur Phagenabwehr). Durch Transkription des veränderten DNA-Bereichs und unter Mitwirkung von sogenannten Cas-Proteinen (das sind bestimmte von am CRISPR-Bereich angelagerten Cas-Genen erzeugte Proteine) wird ein RNA-Teilstring erzeugt, der genau auf die FremdDNA Sequenz passt. Dieser führt nun ein weiteres Cas-Protein (eine Endonuklease, meist Cas9) an die entsprechende DNA-Stelle heran und schneidet diese heraus. Auf diese Weise wird die Bakteriophage unschädlich gemacht und das Bakterium dagegen immun. Das System erkennt also mithilfe einer Nukleinsäure (RNA), wo es im Erbgut schneiden soll. "Der Gentechniker muss lediglich eine RNA konstruieren, die genau auf den Bereich der DNA passt, der verändert werden soll. Die RNA führt das Protein „Cas 9" zur DNA, und das schneidet genau an dieser Stelle. Die Reparatur-Maschinerie der Zelle baut schließlich eine Mutation ein, ein DNA-Stück, das der Zelle vorgegeben wird." Mögliche Anwendungen: Untersuchung der Funktion von Genen und die gezielte Veränderung des Genoms von Mikroorganismen, von Pflanzen (durch Veränderung der Keimzellen-DNA) oder auch von höheren Tieren oder Menschen durch Einbringung der DNA-Veränderung in deren embryonale Keimbahn. Möglich werden sowohl die Eliminierung von Erbkrankheiten im Rahmen von Gentherapie, als auch die Erschaffung von Designer-Organismen im Rahmen der Gen-Technik, bis hin zur Erschaffung einer neuen Menschenlinie. (Daher wird in Wissenschaftskreisen derzeit eine freiwillige Selbstbeschränkung diskutiert).