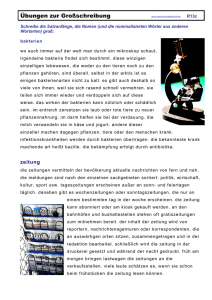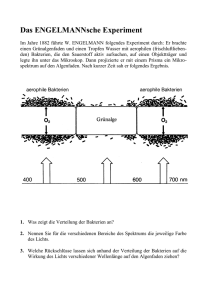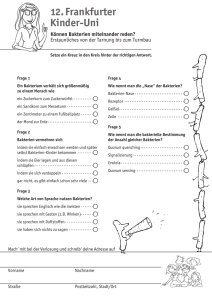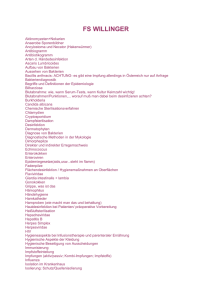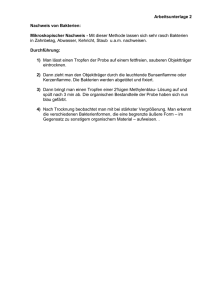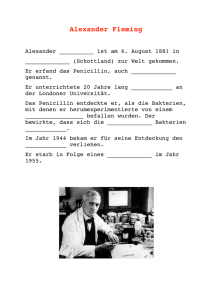Konventioneller Nachweis der Bakterien im
Werbung

Institut für Medizinische Mikrobiologie Konventioneller Nachweis der Bakterien in Patientenmaterial • Gram-Präparat von Direktpräparat • Normalflora berücksichtigen, z.B. bei Sputum • Beispiele von Hinweis auf Erreger im Gram-Präparat • Prinzip der Gram-Färbung • Schwiergkeiten bei Gram-Färbung • Beispiele anhand von Dias im Kurs • Allenfalls auch Nativpräparate (KOH) für Pilze • Methylenblaufärbung (auch in Giemsa-Färbung enthalten) • Direktnachweis von Antigenen • Beispiel von Pneumokokken-Antigen im Urin und Liquor • Beispiel von Legionella-pneumophila Serotyp 1 im Urin • Direktnachweis mit Agglutination nicht mehr üblich • Direktnachweis von Toxinen auf Zellkultur nur für Forschung 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 1 Institut für Medizinische Mikrobiologie Normalflora des Menschen • Der Mensch ist mit 10 mal mehr Bakterien besiedelt als er Körperzellen besitzt. Diese Bakterien sind für den Menschen in der Regel nützlich. • Nicht alle Bakterien, die man im Mikroskop sieht, sind Erreger • Beispiel Sputum mit viel Epithelzellen – nicht zur Kultur geeignet Gram-Färbung in 100-facher Vergrösserung zeigt Zellen der Mundschleimhaut 1000-fache Vergrösserung des Ausschnitts zeigt Tausende von Bakterien in einem Klumpen Epithelzellen 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 2 Institut für Medizinische Mikrobiologie Pneumokokken und Haemophilus influenzae im Respiratorischen Material 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 3 Institut für Medizinische Mikrobiologie Bakterien-Direktnachweis mit Färbung Zellen werden gleichzeitig erfasst Diese Zusatzinformation gibt keine PCR etc. Meningokokken 24.06.2015 Staphylokokken Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 4 Institut für Medizinische Mikrobiologie Gram-Färbung und Bakterienzellwand Gram-positive Zellwand Gram-Färbung Kristallviolett/ Alkohol Lugol Fuchsin Murein Kristallviolett/ Alkohol Lugol Fuchsin Murein Gram-negative Zellwand 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 5 Institut für Medizinische Mikrobiologie Prinzip der Gram-Färbung (1) • Geschichte • 1884 Gram war ein Pathologe in Berlin. Er versuchte, Kerne mit Gentianaviolett blau und Cytoplasma mit Lugol braun zu färben. Gleichzeitig wollte er Bakterien im Gewebe besser darstellen. In Histologieschnitten konnte er die Farbstoffe mit Alkohol wegspülen, um das gleiche Präparat wiederholt anzufärben. Dabei sah er Bakterien, die auch nach Alkohol blau blieben. Gram erkannte, dass sich Bakterien auch entfärben liessen, z. B. Salmonellen, aber auch Pneumokokken. Gram-Färbung. Gewisse Bakterien lassen sich nach • 1886 Roux Gentianaviolett/Lugol mit Alkohol entfärben und mit Carbolfuchsin rot gegenfärben Gram-negative Bakterien. • Andere lassen sich nicht mehr entfärben und bleiben blau Gram-positive Bakterien. 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 6 Institut für Medizinische Mikrobiologie Prinzip der Gram-Färbung (2) • Gram-Farbstoffe sind Anilinverbindungen (Benzolring-NH2) verbunden mit Chromophor • Farbstoffe sind geladen • Beispiel: Eosin ist negativ geladen, bindet an positiv geladene Strukturen Cytoplasma, Erythrozyten werden rot gefärbt. • Hematoxilin ist positiv geladen, bindet an negativ geladene Strukturen Zellkerne (Nucleinsäuren) werden blau gefärbt. • Methylenblau ist auch ein Anilinfarbstoff, aber auch ein Redox-Indikator • Farbstoffe für Gram-Färbung am IMM Zürich − Kristallviolett: 4% in Alkohol 1:10 in H2O/(ca.2%) Phenol 0.4% - 1 Min. auf hitzefixiertes, abgekühltes Präparat geben - fakultativ kurz abspülen mit Wasser − Lugol: 100g KJ, 50g J in 1 Liter H2O 1:10 ca. 1% - mind. 2 Min. überschichten, darf aber auch länger sein: einige Min. − Aceton/Alkohol 1:2 bis zur völligen Entfärbung, ca. 1-2 Min. - kurz mit Wasser spülen − Certistain Merck: 1% in Alkohol 1:10 in Wasser 0.1% Endkonz. - 30’’ bis 1 Min. Achtung vorher und nachher kurz mit Wasser spülen 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 7 Institut für Medizinische Mikrobiologie Schwierigkeiten und Hinweise für Gram-Färbung • Wichtige Hinweise für Gram-Färbung − Farblösungen müssen möglichst frei sein von Niederschlägen Filtration − Farbniederschläge können als Gram-positive Kokken GNS nicht fehlinterpretiert werden geteilt − Struktur von Bakterien ist in der Regel scharf abgegrenzt − Unter Therapie nicht typische Morphologie, GNS nicht geteilt − Im Zweifel mit Methylenblau-Färbung kontrollieren − In der Methylenblaufärbung sind alle Bakterien blau − Gram-negative Wasserbakterien können falsch positive Resultate verursachen Vorsicht bei einigen Geräten − Bakterien können falsches Gramverhalten zeigen − Pneumokokken falsch Gram-negativ − Acinetobacter sp. falsch Gram-positiv − Bakterien zeigen ihre Morphologie am besten im Flüssigmedium Flüssig-Präparat zur Unterscheidung von Stäbchen / Kokken 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 8 Institut für Medizinische Mikrobiologie Direktnachweis von Antigenen • Streptococcus pneumoniae - Binax Now-Schnelltest − Antigennachweis (Polysaccharid) aus Urin und Liquor mit einem immunchromatographischen Schnelltest − Schnelldiagnose einer Pneumokokkenpneumonie oder Pneumokokkenmeningitis − Falls unsicher, ob entfärbte Pneumokokken oder Meningokokken im Liquor Schnelltest hilft zur Unterscheidung − Analoger Test für Legionella pneumophila Serotyp 1 aus Urin − Seit der Einführung dieser Schnellteste nahmen die Meldungen in der Schweiz zehnfach zu − Serologie ist nicht mehr aktuell, nur in epidemiologischen Studien. Heute ergänzt durch PCR aus Respirationstrakt − Legionellen – PCR aus dem Wasser war die erste kommerzielle PCR 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 9 Institut für Medizinische Mikrobiologie Sensitivität und Spezifität des PneumokokkenBinax für Pneumokkken aus dem Urin (1) Sensitivität Spezifität 86% 94% 90% 78% 90% 71% 97% 99% Antigennachweis aus Urin Firmenangabe (retrospektiv) (Blutkultur für Pneumokokken positiv) Firmenangabe (prospektiv) (pos. Blutkultur; outpatients) Firmenangabe (prospektiv) (pos. Blutkultur; Spital) Antigennachweis aus Liquor Firmenangabe (prospektiv) Literaturdaten 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 10 Institut für Medizinische Mikrobiologie Sensitivität und Spezifität des PneumokokkenBinax für Pneumokkken aus dem Urin (2) Angaben aus Literatur Sensitivität Spezifität Gutiérrez et al. (2003) CID, 36: 286-92 (prospektiv, CAP, pos. Blutkultur, Pleura oder Sputum) 70% 90% Smith et al. (2003) JCM, 41: 2810-2813 (prospektiv, pos. BK), Antigen nach 3 Tagen unter Therapie noch positiv Correspondenz im CID: PPV 54%, NPV 95% 82% 97% Roson et al. (2004) CID, 38: 222-26 (CAP, nicht schwer immunsuppr. Patienten) 65,9% 100% wenn hohes Risiko für Pneumonie 94% wenn Sputum positiv für Pneumokokken 97% wenn Blutkultur positiv für Pneumokokken 92% Antigennachweis aus Urin 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 11 Institut für Medizinische Mikrobiologie Nachweis von Clostridium difficile Toxin Antibiotika unterdrücken im Darm normale Bakterien vermehren sich; zum Beispiel Clostridium difficile Andere Bakterien Clostridium difficile bildet Cytotoxin B, welches Darm schädigt Normale Fibroblasten-Kultur Cytotoxischer Effekt auf Kultur Heute kaum mehr eingesetzt, eher EIA für Toxin A und B oder neu zuerst Nachweis von GDH mittels EIA und anschliessend PCR 24.06.2015 Konvenitoneller Direktnachweis der Bakterien in Patientenmaterial R. Zbinden Seite 12