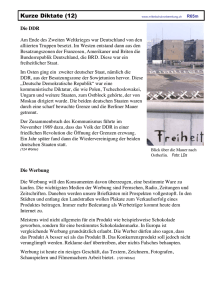1 RECHT UND ETHIK EINFÜHRUNG RECHTSMETHODIK UND
Werbung

RECHT UND ETHIK UNIVERSITÄT FRIBOURG RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT SS 2014 EINFÜHRUNG RECHTSMETHODIK UND FALLBEISPIEL PD DR. IUR. GABOR P. BLECHTA, RECHTSANWALT Inhaltsübersicht I. II. III. A. B. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 Recht und Gesetzesnorm Rechtsethische Prinzipien Fallbeispiel: Mauerschützenprozesse Sachverhalt Musterlösung Anwendbares Recht Grundsatz nach Art. 315 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 EGStGB Ausnahmeregelung nach Art. 315 Abs. 4 EGStGB Ergebnis Die Frage der Strafbarkeit nach dem zur Tatzeit geltenden positiven Recht der DDR Tabestandsmässigkeit Ergebnis Rechtswidrigkeit § 27 DDR-Grenzgesetz Höherrangiges positives Recht der DDR Völkerrecht Ergebnis Radbruchsche Formel Begründung der Strafbarkeit anhand überpositiven Rechts: Die Anwendung der Radbruchschen Formel 2.4.1 Rückwirkungsverbot 2.4.2 Gebot der lex scripta 2.5 Verschulden 1 I. Recht und Gesetzesnorm Im Rahmen dieser kurzen Einführung sollen u.a. die Grenzen der positiven Gesetze im Kontext der Rechtsprechung, zumindest in den Grundzügen, aufgezeigt werden. Dass die Rechtswissenschaft vornehmlich eine praktische Aufgabe zu erfüllen hat, dürfte unbestritten sein. Diese Aufgabe erfüllt sie durch die Verarbeitung des ihr in den Gesetzen und Gerichtsentscheidungen gegebenen Materials und ist bestrebt, differenzierte Kriterien für die Lösung von Rechtsfragen und die Entscheidung von Rechtsfällen zu gewinnen. Dies vollbringt sie im Rahmen des jeweils geltenden Rechts und dessen Grundwertungen. Ein gewöhnlicher Irrtum des juristischen Laien ist nun die Meinung, das Recht bestehe aus Gesetzesbestimmungen und alle Rechtsfragen könnten aus dem Gesetz beantwortet und alle Entscheidungen aus ihm abgelesen werden. Der Jurist sei folglich jemand, der möglichst viele Gesetzesbestimmungen kenne und je mehr er von ihnen kenne, umso besser sei er. Allerdings wissen wir, dass in den USA und auch in England beispielsweise gar kein kodifiziertes Privatrecht in unserem Sinne gibt. Kodifizierte Gesetzesnormen (sog. „Statutes“) spielen dort eine untergeordnete Rolle. Die Richter entscheiden aufgrund der Entscheidungen ihrer Vorgänger. Solche Vorentscheidungen, sog. Präjudizen – „Precedents“, sind keine Gesetze in dem uns bekannten Sinne; es gibt auch keine Gesetzesbestimmung, welche sie als verbindlich erklärt und dennoch gelten sie. Was heisst dann aber „gelten“ im juristischen Sinne? Und wie ist es möglich, dass angloamerikanische Richter, ganz ohne kodifiziertes Privatrecht, 80 bis 90% der Fälle im Ergebnis nicht anders entscheiden, als beispielsweise ihre Schweizer Kollegen? Für einen amerikanischen Juristen ist ein „Case“ nicht bloss Repräsentant eines Rechtssatzes, den man auch ganz losgelöst vom Fall betrachten kann. Vielmehr ist ein Case eine Geschichte, die ein Problem, widerstreitende Argumente und eine mögliche Lösung veranschaulicht. Er ist nicht Lückenfüllung oder Ersatz für eine gesetzliche Norm, sondern ein Lehrstück. Welche Regel er auch begründet, er bleibt stets seinem Gesamtzusammenhang verbunden. Jede Fallrechtliche Argumentation ist damit stets ein Vergleich zwischen konkreten Situationen. Ein privatrechtliches Gesetz ist in den USA normalerweise keine umfassende, in sich konsistente und vollständige Regelung eines Rechtsgebietes. Vielmehr ist es als gesetzliche Lösung von Einzelproblemen konzipiert, da Statutes traditionell der Lückenfüllung und Korrektur des „Case Law“ dienen. Das typische Statute stellt somit nach wie vor keine flächendeckende Regelung, sondern eine Antwort auf konkrete Einzelfragen, bzw. eine Sammlung solcher Antworten dar. Systematische Auslegung oder Lückenfüllung aus der Gesamtstruktur findet man kaum. Im Ergebnis existieren Cases und Statutes als Vielzahl von Einzelregelungen in einem beträchtlichen Durch– und Miteinander. Gesetze gehen dem Fallrecht vor, soweit sie anwendbar sind. Doch stehen sie in Funktion und Rang nicht über, sondern allenfalls neben dem Fallrecht. Bei der Rechtsanwendung gilt es daher Statutes und Cases im Hinblick auf ihre Einschlägigkeit zu identifizieren und zwar ohne Hilfestellung einer übergreifenden Systematik. Dass dabei die Hoffnung auf eine systematische Konsistenz der verschiedenen Rechtsquellen oft enttäuscht wird, brauch nicht weiter ausgeführt zu werden. 2 Aber auch der Schweizer Jurist, welcher der Meinung ist, dass ihn die Engländer oder Amerikaner nichts angehen, wird nicht selten verwundert feststellen, wie oft er vom Gesetzestext im Stich gelassen wird. Er wird in seiner Praxis selten einem Fall begegnen, der aus dem Gesetzestext allein zu lösen ist. Er wird erleben, wie der Gesetzestext im Rahmen der Rechtsprechung oft nebensächlich wird. Wonach entscheidet dann aber der Richter, wenn der Gesetzestext nicht unmittelbar weiterhilft? In solchen Fällen, in denen der Sinn der Vorschrift nicht unmittelbar aus dem Text gegeben ist, wird allenfalls nach dem Zweck der Vorschrift, nach der analogen Anwendung anderer Vorschriften, welche den Grundgedanken der vorliegenden Vorschrift reflektieren, entschieden, oder allenfalls wird eine echte Gesetzeslücke festgestellt und Lückenfüllung betrieben. In Fällen, in welchen die Auslegung des Gesetzes im erwähnten Sinne nicht zu einer befriedigenden Lösung führt, helfen letztlich nur die der Vorschrift inhärenten Grundgedanken oder im Falle des gänzlichen Fehlens einer Regelung die richterliche Rechtsfortbildung modo legislatoris weiter. Wie steht es angesichts dieser Einsichten mit dem Richterrecht praeter legem, mithin im Hinblick auf richterliche Entscheidungen, in deren Kontext der Richter i.S. von Art. 1 Abs. 2 ZGB modo legislatoris entscheidet und in der deutschen Lehre wie auch vom schweizerischen Bundesgericht (BGE 114 II 239 [246]) - insbesondere im Gegensatz zu sog. gebundenem Richterrecht - als „gesetzesüberschreitendes Richterrecht“, bzw. als „gesetzesübersteigende richterliche Rechtsfortbildung“ bezeichnet werden. Falls der Richter im Rahmen der Rechtsfindung auf Wertungen rekurriert, die sich aus dem geltenden Recht ergeben, bzw. in diesem nachweisbar sind, liegt gesetzesimmanentes Richterrecht vor, wobei in der Praxis die Lückenfüllung durch Analogieschluss im Vordergrund steht. Im Weiteren umfasst dies methodisch auch die sog. Teleologische Reduktion, wie auch Lückenfüllung durch Gewohnheitsrekurs. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidung zwischen gesetzesimmanentem und gesetzesüberschreitendem Richterrecht fliessend ist und letztlich bloss im Kontext einer Schwergewichtssetzung feststellbar ist. So kann etwa der Rekurs auf allgemeine Rechtsgrundsätze, wie beispielsweise auf das Legalitätsprinzip, das Verhältnismässigkeits- und Vertrauensprinzip oder auch auf geschriebene und ungeschriebene Grundrechte durchaus je nach Sichtweise beiden Kategorien der richterlichen Rechtsfindung zugerechnet werden. Im Gegensatz zum rechtspositivistischen Lückenlosigkeitsdogma ist heute die Möglichkeit der richterlichen Rechtsfindung praeter oder contra verba legis, von einigen Ausnahmen, wie spezifische Analogieverbote, allgemein anerkannt, da das Gesetz infolge der realen Gesellschaftsentwicklung stets lückenhaft bleibt. Die Frage, ob eine Verrechtlichung aller Lebensbereiche sinnvoll sei, oder nicht gerade die Unfreiheit fördere, soll hier indessen nicht näher erörtert werden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass u.a. auch das schweizerische Recht mit der Bestimmung des Art. 1 Abs. 2 ZGB bewusst die Lückenhaftigkeit des kodifizierten Rechts eingesteht und dem Richter deshalb die Möglichkeit der Regelbildung zuspricht. 3 Ohne auf die verschiedenen Arten von Gesetzeslücken und der Methode der Lückenfüllung weiter einzugehen, sei vorliegend im weiteren ein Blick auf Richterrecht praeter legem, mithin auf gesetzesüberschreitendes, Richterrecht im Kontext von Art. 1 Abs. 2 ZGB zu werfen. Angesichts der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen einerseits und der damit in den meisten Fällen nicht schritthaltenden Gesetzgebungsverfahren andererseits, hat das sog. „law-making“ eine besondere Bedeutung als Teil der Rechtsordnung von modernen Gesellschaften erhalten. Als Beispiele für gesetzesüberschreitendes Richterrecht seien etwa die aus dem Vertrauensprinzip abgeleitete „Ungewöhnlichkeitsregel“ der Bundesgerichts zur Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. etwa BGE 109 II 452; 119 II 443), oder auch die zahlreichen vom Bundesgericht entwickelten „ungeschriebenen Freiheitsrechte“ (Grundrechte) im Rahmen des Verfassungsrechts. Im Hinblick auf den Rechtsquellencharakter von Richterrecht praeter legem ist unbestritten, dass in faktischer Hinsicht das Richterrecht neben dem Gesetzesrecht die wichtigste generellabstrakt wirkende Rechtsquelle der Rechtordnung darstellt, wobei es fraglich bleibt, ob es auch normativen Rechtsquellencharakter aufweist. Mit dem Verweis auf den Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 ZGB ist dieses Rechtsquellenproblem nicht gelöst, da der historische Gesetzgeber den Richter durch Präjudizien zwar leiten, aber ihm keine Gehorsamspflicht anhand Gewohnheitsrechts auferlegen wollte. Zwar unterliegt auch das Richterrecht dem Gebot der Gleichbehandlung und dem Vertrauensschutz, aber Praxisänderungen sind möglich, soweit klar bessere Argumente für die neue Praxis vorliegen. Im Hinblick auf die Normadressaten – im Gegensatz zu Gerichten unterer Instanzen, die von gesicherter Bundesgerichtspraxis durchaus abweichen dürfen – entfaltet Richterrecht rechtliche Relevanz. In diesem Sinne setzen sich beispielsweise Anwälte und Notare, die ihre Klienten angesichts gefestigten Richterrechts unvorsichtig beraten, auftragsrechtlicher Haftung aus. In diesem Kontext spricht sich die Lehre (s. etwa KRAMER ERNST, Juristische Methodenlehre, Bern 1998, 175 ff.) dafür aus, höchstrichterlich entwickeltes, gefestigtes Richterrecht auch normativ als (gesetzesergänzende) Rechtsquelle neben Gesetzes- und Gewohnheitsrecht, als Rechtsquelle sui generis anzunehmen. Auch Richterrecht ist allerdings in die Gesamtrechtsordnung eingebunden und hat sich an den formalen Prinzipien rechtsstaatlicher Rechtsetzung und an inhaltlich diskursfähigen, objektivierbaren Gesichtspunkten zu orientieren, welche im Sinne von Inhaltskontrolle eine Begründbarkeit und insbesondere Überprüfbarkeit des in Frage stehenden Rechtsaktes erlauben. Bezüglich formaler Rechtsstaatsprinzipien im Kontext einer generalisierbaren Fallentscheidung ist der Richter gehalten, eine allgemeine ratio decidendi, eine Fallnorm zu konzipieren, die für die Beurteilung anderer gleich oder ähnlich gelagerter Fälle geeignet sein könnte. Hierbei hat der Richter ferner die Orientierungsgesichtspunkte einer offenen Begründung seiner Entscheidung darzustellen, welche aus dem Rechtssystem, nicht selten indessen auch aus rechtsexternen Begründungszusammenhängen, wie etwa wirtschaftspolitischen im Bereich des Kartellrechts oder auch psychologischen im Bereiche des Ehe- und Kindesrechts, gewonnen werden. 4 Eine solche ausserrechtliche Rechtfertigung von Richterrecht kann sich dabei sowohl auf die Frage nach dem Bedürfnis einer bestimmten richterlichen Lösung beziehen, als auch auf die faktischen Auswirkungen des dem Entscheid zugrunde liegenden Richterrechts bei aktuell und potentiell Betroffenen, wie auch der Gesellschaft insgesamt. Man spricht in diesem Zusammenhang vom „Postulat der Folgenanalyse“, die letztlich dazu führt, dass der Richter rechtspolitisch tätig wird. In diesem Kontext sei schliesslich noch auf das Institut der „Allgemeinen Rechtsgrundsätze“ verwiesen, welche in manchen Rechtsordnungen, wie etwa nach § 7 des österreichischen ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) oder auch nach Art. 7 Abs. 2 UN-Kaufrecht lege verbis in Fällen der Lückenfüllung, die nicht durch Analogieschlüsse erfolgen können, zu beachten sind. Diese Allgemeinen Rechtsgrundsätze oder auch Rechtsprinzipien spielen nach h. L. auch im schweizerischen Recht eine bedeutende Rolle für die richterliche Rechtsentwicklung, wie auch für die Rechtsordnung insgesamt, wenn auch im Hinblick auf ihre materiale Konkretisierung kein Konsens herrscht. Nach der h. Lehre (s. etwa KRAMER, aaO., 187 ff.) geht es dabei um Grundprinzipien des Rechts oder gewisser seiner Teilbereiche, die mitunter positiviert, manchmal quasi-konkludent aus der Rechtsordnung selbst erschlossen werden können und das innere System des Rechts konkretisieren ohne allerdings unmittelbar subsumtionsfähig zu sein. In erster Linie geht es um grundlegende Verfassungsprinzipien, wie etwa das Legalitätsprinzip, das Verhältnismässigkeitsprinzip, den Vertrauensschutz und insbesondere auch um geschriebene und ungeschriebene Grundrechte. Es geht mithin um wertorientiertes Denken, mithin um einen Rekurs auf Wertungen bei der Rechtsanwendung, die sich, wie aufgezeigt, auch im gesetzesüberschreitenden Rahmen abspielen kann. II. Rechtsethische Prinzipien Insbesondere ist im Kontext von gesetzesüberschreitender Rechtsfortbildung neben den Kategorien der Rechtsfortbildung im Hinblick auf die Bedürfnisse des Rechtsverkehrs und auf das Argument der sog. „Natur der Sache“, die vorliegend nicht im Näheren behandelt werden, auf die Rechtsfortbildung mit Rücksicht auf rechtsethische Prinzipien hinzuweisen, da diese ein Anwendungsproblem eigener Art darstellen. Rechtsethische Prinzipien werden gewöhnlich als leitende Massstäbe rechtlicher Normierung bezeichnet, die anhand ihrer immanenten Überzeugungskraft rechtliche Entscheidungen zu legitimieren imstande sind. Sie unterscheiden sich von den auf Zweckmässigkeitsgründen beruhenden rechtstechnischen Prinzipien durch ihren materialen, mithin inhaltlichen, Gerechtigkeitsgehalt. Als Prinzipien, wie diese auch immer definiert sein mögen, stehen sie auf einer Abstraktionsstufe, die keine unmittelbare Subsumtion erlaubt, d.h. sie stellen keine unmittelbar auf Einzelfälle anwendbare Regeln dar, sondern werden im Rahmen eines Transformationsprozess teils durch den Gesetzgeber, teils durch die Rechtsprechung durch Konkretisierung und Ausbildung spezifischer Grundsätze mittels Bildung von Fallgruppen zu Regeln umgesetzt um eine konkrete Entscheidung ermöglichen. Sie werden alsdann teils auf 5 Verfassungsstufe, teils auf Gesetzesstufe, wie bspw. der Grundsatz von Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 ZGB, positiviert oder mittels Rekurs auf die ratio legis, mithin auf den rechtfertigenden Grund einer positiven Regelung, erschlossen. Den Anstoss zu einer gesetzesübersteigenden Rechtsfortbildung mit Rücksicht auf ein rechtsethisches Prinzip bildet meist ein konkreter Anwendungsfall, der mit den Mitteln der traditionellen Gesetzesauslegung und einer immanenten Rechtsfortbildung nicht in einer dem Rechtsempfinden genügenden Weise gelöst werden kann. In diesem Kontext ist beispielhaft auf die Rechtsprechung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts zum auf das aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete Vertrauensprinzip im Verhältnis des Bürgers zur Gesetzgebung hinzuweisen. Dieses Prinzip verbietet im Allgemeinen eine Rückwirkung von Gesetzen auf bereits abgeschlossene Tatbestände, wenn und soweit der Bürger auf die Fortdauer der bisher für ihn bestehenden Rechtsposition vertrauen durfte. Das Vertrauensprinzip ist nun ein immanentes Prinzip von demokratisch erlassenen Rechtsordnungen, welches in dem ihm jeweils zu ziehenden Grenzen auf allen Rechtsgebieten Beachtung beanspruchen kann. Allerdings verdient nicht jedes Vertrauen Schutz, sondern bloss ein solches, das durch die Umstände gerechtfertigt erscheint. Darüber hinaus kann das Vertrauensprinzip mit anderen Rechtsprinzipien kollidieren, denen entweder generell oder im einzelnen Fall der Vorrang zukommen kann. In diesem Sinne hat das deutsche Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 13, 271 f. festgehalten, dass der Vertrauensschutz da nicht in Frage kommen könne, wo das Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt ist. Daher sei das Vertrauen nicht schutzwürdig, „wenn der Bürger nach der rechtlichen Situation in dem Zeitpunkt, auf den der Eintritt der Rechtsfolge vom Gesetz zurückbezogen wird, mit dieser Regelung rechnen musste“, wenn das bisher geltende Recht „unklar und verworren“, oder wenn das bisher scheinbar geltende Gesetz, auf das der Bürger glaubte sich verlassen zu können, ungültig war. Der Gesetzgeber habe daher eine nichtige Bestimmung rückwirkend durch eine rechtlich einwandfreie Norm ersetzen können. Schliesslich könnten „zwingende Normen des gemeinen Wohls, die dem Gebot der Rechtssicherheit übergeordnet sind, eine Rückwirkungsanordnung rechtfertigen“. Bei allen diesen Falltypen handelte es sich um „Ausprägungen des Grundgedankens, dass allein zwingende Gründe des gemeinen Wohls oder ein nicht – oder nicht immer – vorhandenes schutzbedürftiges Vertrauen des Einzelnen eine Durchbrechung des rechtsstaatlichen Rückwirkungsverbots zugunsten der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers rechtfertigen oder gar erfordern können“ (BVerGE 72, 200 ff., 258). Die Grenze des Vertrauensprinzips ergibt sich insoweit schon aus ihm selbst. Die Grenze der gesetzesübersteigenden Rechtsfortbildung durch die Gerichte liegt in diesem Kontext folglich dort, wo eine Antwort im Rahmen der geltenden Rechtsordnung insgesamt mit spezifisch rechtlichen Erwägungen allein nicht gefunden werden kann, insbesondere daher dort, wo es vorwiegend um Fragen der Zweckmässigkeit geht oder eine detaillierte Regelung erforderlich wäre, die im Rahmen des Demokratieprinzips nur der Gesetzgeber treffen kann. 6 III. Fallbeispiel: Mauerschützenprozesse Die deutsche Justiz hatte in der Folge des Zusammenbruchs des Naziregimes nach 1945 die Strafbarkeit von Handlungen, die vormals durch gesetzliches Unrecht gedeckt waren bejaht und damit das in jedem Rechtssystem zumindest latent vorhandene, besondere Spannungsverhältnis von Recht und Moral insbesondere am Extremfall des nationalsozialistischen Unrechts klar zutage treten lassen, um damit nicht zuletzt eine rechtsstaatwidrige Vergangenheit bewältigen zu können. Nach dem Zusammenbruch der DDR sahen sich die deutschen Gerichte insbesondere im Kontext der sog. „Mauerschützenprozesse“ erneut vor das Problem gestellt, im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens ex-post die Strafbarkeit von Taten zu beurteilen, die offenbar durch positive Gesetze eines totalitären Staatssystems erlaubt waren. Es wird im Folgenden vom Sachverhalt ausgegangen, wie er dem Urteil des Bundesgerichtshofes in seiner eingangs erwähnten Entscheidung vom 3. November 1992 (BGH, NJW 1993, 141 (144ff.)) zugrunde lag. A. Sachverhalt Der 20-jährige S versuchte am 1. Dezember 1984 gegen 3.15 Uhr die Grenzanlagen in Berlin mit einer 4m langen Leiter zu überwinden. Der damals 20-jährige Unteroffizier W und der damals 23-jährige Soldat H hielten auf einem 130m entfernten Turm Wache. Sie erblickten S erstmals, als er die 3.25m hohe hintere Mauer erklommen hatte. S hatte jetzt noch den 29m breiten Grenzstreifen mit einem 2.5m hohen Drahtzaun, der bei Berührung Signale auslöste, und die 3.5m hohe eigentliche Grenzmauer zu überwinden. Der Unteroffizier W schickte den Soldaten H auf den Grenzstreifen und rief dem Flüchtling S, der beim Übersteigen des Drahtzaunes inzwischen optischen und akustischen Alarm ausgelöst hatte, zu, dass er stehenbleiben solle. Doch auch als W von seinem Turm aus kurze Feuerstösse über den Flüchtling hinwegschoss, lief dieser weiter. Als S seine Leiter an die Grenzmauer lehnte und sich anschickte, sie zu besteigen, war den beiden Grenzsoldaten klar, dass sie die Flucht des S, wenn überhaupt, nur noch durch gezieltes Feuer verhindern konnten. H gab aus etwa 110m Entfernung in mehreren Feuerstössen insgesamt 25, W aus etwa 150m Entfernung von seinem Postenturm aus, ebenfalls mit Dauerfeuer, 27 Schüsse auf S ab. Beide zielten auf die Beine. Sie wussten aber, dass, insbesondere wegen des Dauerfeuers, die Möglichkeit eines tödlichen Treffers bestand. Auch um diesen Preis wollten sie die Flucht verhindern. S wurde etwa fünf Sekunden nach Eröffnung des Feuers in das linke Knie und den Rücken getroffen. Die Schützen hatten keinen Einfluss auf die Bergung des S; dieser wurde erst nach mehr als 2 Stunden in ein Krankenhaus eingeliefert und starb dort um 06.20 Uhr. Bei unverzüglicher Hilfe hätte er gerettet werden können. 7 B. Musterlösung 1. Anwendbares Recht Die Tat ist, wie aus dem Sachverhalt ersichtlich, in der untergegangenen DDR vor dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland von DDR-Bürgern gegenüber DDR-Bürgern begangen worden. Gemäss Art. 8 des Einigungsvertrages zwischen den beiden deutschen Staaten trat mit Wirksamwerden des Beitritts der DDR zur BRD, mithin am 3. Oktober 1990, in der ehemaligen DDR das Bundesrecht in Kraft, soweit nicht durch den Vertrag, insbesondere dessen Anlage I, etwas anderes bestimmt war. In der Anlage zum Vertrag wird Art. 315 EGStGB (Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch) neu gefasst: Danach ist auf Taten, die vor dem Beitritt in der DDR begangen wurden, § 2 StGB anzuwenden (Art. 315 Abs. 1 EGStGB), wenn das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland für sie nicht schon vor dem Beitritt gegolten hat (Art. 315 Abs. 4 EGStGB). Damit ist das anzuwendende Recht nach den in § 2 StGB formulierten Regeln des intertemporalen Strafrechts zu beurteilen. Seit dem Beitritt der neuen Bundesländer gilt auch dort, von einigen Ausnahmen abgesehen, das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland. Wollte man das bundesdeutsche Recht generell auf DDR-Alt-Taten anwenden, so verstiesse das gegen das in Art. 103 Abs. 2 GG (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) statuierte Rückwirkungsverbot, die danach insbesondere Taten erfasst, die zur Tatzeit nach dem bundesrepublikanischen Strafrecht, nicht aber nach demjenigen der DDR strafbar waren. 1.1 Grundsatz nach Art. 315 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 EGStGB Als Grundsatz ordnet Art. 315 Abs. 1 EGStGB in Verbindung mit § 2 Abs. 1 StGB daher an, dass sich die Strafbarkeit von DDR-Alt-Taten nach dem zur Tatzeit geltenden Strafrecht der DDR richtet, wobei die Rechtsfolgen der Tat nach Art. 315 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 EGStGB denen des bundesrepublikanischen Strafrechts angeglichen werden. War die Tat nach dem zur Tatzeit geltenden Strafrecht der DDR straflos, so kommt eine Bestrafung danach selbst dann nicht in Frage, wenn die Strafbarkeit nach bundesdeutschem Strafrecht gegeben war und ist. Auch im umgekehrten Fall scheidet eine Bestrafung aus, nämlich wenn eine Alt-Tat zwar nach dem zur Tatzeit geltenden Recht der DDR strafbar war, nicht aber nach dem heute geltenden Recht der Bundesrepublik strafbar ist. 8 Dieses Resultat ergibt sich aus dem Milderungsgebot des § 2 Abs. 3 StGB, denn mit dem Übergang vom Strafrecht der DDR zu dem der Bundesrepublik wurde das Gesetz geändert: das nunmehr anzuwendende mildere Gesetz ist dasjenige, nach dem ein Verhalten straflos ist. Zusammenfassend lässt sich demnach im Hinblick auf das anwendbare Recht folgendes feststellen: DDR-Alttaten sind nach dem Grundsatz des Art 315 Abs. 1 EGStGB i.V. m. § 2 Abs. 1 und Abs. 3 StGB bloss dann strafbar, wenn sie sowohl nach dem zur Tatzeit geltenden Recht der DDR als auch nach dem seit der Wiedervereinigung geltenden Bundesrecht strafbar sind. Die Bestrafung erfolgt dann aus dem milderen Gesetz. 1.2 Ausnahmeregelung nach Art. 315 Abs. 4 EGStGB Von diesem täterfreundlichen Grundsatz mach Art. 315 Abs. 4 EGStGB eine Ausnahme, „soweit für die Tat das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland schon vor dem Wirksamwerden des Beitritts gegolten hat“. Diese gesetzliche Formulierung betrifft dem Wortlaut nach bloss die Voraussetzung, unter welcher Art. 315 Abs. 4 EGStGB eine Ausnahme statuiert. Es unterliegt aber keinem Zweifel, welche Rechtsfolge Art. 315 Abs. 4 EGStGB für diesen Ausnahmefall anordnet, nämlich die Anwendung des bundesdeutschen Strafrechts. Sie erfolgt unabhängig davon, ob die Tat zur Tatzeit auch nach dem Recht der DDR strafbar war. Somit führt die Ausnahmeregelung des Abs. 4 auch zur Bestrafung von Handlungen, die nach dem zur Tatzeit geltenden Recht der DDR straflos waren. Dementsprechend sind in solchen Fällen im Sinne des Milderungsgebots des § 2 Abs. 3 StGB bloss Änderungen des bundesdeutschen Rechts zu beachten. Die Ausnahmeregelung verstösst ferner insoweit nicht gegen das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG, als sie nur solche Handlungen betrifft, für die das bundesdeutsche Recht bereits vor dem Beitritt, mithin zur Tatzeit, galt. Welche Handlungen dies im Einzelnen sind, ist in Lehre und Praxis umstritten. Einigkeit herrscht dahingehend, dass die Ausnahmeregelung nicht alle DDR-Alt-Taten erfassen kann, da ansonsten die Ausnahme die Regel bilden und die Abs. 1, 2 und 3 der Bestimmung sinnlos wären. Rechtsaufassungen, die diese Ansicht vertreten, insbesondere die Meinung, die ehemalige DDR sei Inland im Sinne des § 3 StGB; in einem weiteren Sinne auch die Meinung, die Bürger der DDR seien zur Tatzeit (Bundes-)Deutsche gewesen im Sinne des § 7 StGB, sind folglich mit Art. 315 unverträglich. 9 1.3 Ergebnis Nach Art. 315 Abs. 1 EGStGB i.V.m. § 2 Abs. 1 StGB kann die Tat der beiden Mauerschützen nur dann bestraft werden, wenn sie nach dem zur Tatzeit geltenden Recht der DDR strafbar war. Erst wenn diese Frage zu bejahen ist, stellt sich die weitere Frage, ob heute DDRRecht oder Bundesrecht anzuwenden ist. Diese Frage wäre dann gemäss § 2 Abs. 3 StGB danach zu entscheiden, welches Gesetz das mildere ist. Im vorliegenden Fall ist folglich im Hinblick auf die Bestimmung des anwendbaren Rechts die Frage entscheidend, ob die Tat der beiden Grenzsoldaten zur Zeit der Tat nach dem Recht der DDR strafbar war. War sie es nicht, so waren sie infolge der intertemporalen Lex mitior-Regelung des § 2 Abs. 3 StGB freizusprechen. 2. Die Frage der Strafbarkeit nach dem zur Tatzeit geltenden positiven Recht der DDR 2.1 Tatbestandsmässigkeit Die Tat erfüllte nach dem damaligen DDR Strafrecht entweder den Tatbestand des Mordes (§ 112 DDR-StGB) oder den des Totschlags (§ 113 DDR-StGB). Dennoch war sie nicht strafbar, wenn sie durch einen Rechtfertigungsgrund erlaubt war und es der Tat somit an der Rechtswidrigkeit als Strafbarkeitsvoraussetzung fehlte. 2.1.1 Ergebnis Das Verhalten der Grenzsoldaten erfüllt die Tatbestandsmässigkeit des Mordes i.S.v. § 112 DDR-StGB oder diejenige des Totschlags i.S.v. § 113 DDR-StGB. Rechtswidrig ist indessen bloss jenes tatbestandsmässige Verhalten, das nicht durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt wird. Es stellt sich mithin die Frage, ob das tatbeständliche Verhalten der Grenzsoldaten i.S. der §§ 112 und 113 DDR-StGB auch rechtswidrig ist, oder ob es nicht allenfalls durch einen Rechtfertigungsgrund erlaubt war. 10 2.2 Rechtswidrigkeit 2.2.1 § 27 DDR-Grenzgesetz Als die Strafbarkeit hindernder Rechtsfertigungsrund kommt vorliegend § 27 des Grenzgesetzes der DDR (DDR-GrenzG) vom 25. März 1982 in Frage. Den Kerngehalt der Bestimmung bildet Abs. 2 Satz 1: « Die Anwendung der Schusswaffe ist gerechtfertigt, um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer Straftat zu verhindern, die sich den Umständen nach als ein Verbrechen darstellt. » Der Schusswaffengebrauch wird nach den weiteren Vorschriften dieser Norm als « äusserste Massnahme » (Abs. 1 Satz 1) bezeichnet, der erst dann erfolgen darf, wenn kein anderes Mittel Erfolg verspricht (Abs. 1 Satz 2 und 3). Das Leben von Menschen ist ferner « nach Möglichkeit zu schonen » (Abs. 5 Satz 1). Der Waffengebrauch ist sodann grundsätzlich durch Zuruf oder einen Warnschuss anzudrohen (Abs. 3). Auf Kinder soll überhaupt nicht (Abs. 4 Satz 1 lit. b) und auf Jugendliche und Frauen nach Möglichkeit nicht geschossen werden (Abs. 4 Satz 2). Der Wortlaut des § 27 Abs. 2 Satz 1 DDR-GrenzG lässt ohne weiteres eine Auslegung zu, die das Verhalten der beiden Mauerschützen rechtfertigt. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Grenzsoldaten geschossen haben, um einen « unmittelbar bevorstehenden » unerlaubten Grenzübertritt zu verhindern. Für ihre Rechtfertigung und somit Straflosigkeit nach § 27 Abs. 2 Satz 1 DDR-GrenzG ist alsdann bloss erforderlich, dass sich der unerlaubte Grenzübertritt « den Umständen nach als ein Verbrechten darstellte ». Als Verbrechen wurden nach § 1 Abs. 3 DDR-StGB u.a. « gesellschaftsgefährliche » Straftaten gegen « Rechte und Interessen der Gesellschaft » verstanden, die eine « schwerwiegende Missachtung der sozialistischen Gesetzlichkeit darstellen und […] für die innerhalb des vorgesehenen Strafrahmens im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von über zwei Jahren ausgesprochen wird ». Der ungesetzliche Grenzübertritt war, wenn ein schwerer Fall vorlag, mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bedroht (§ 213 Abs. 3 Satz 1 DDR-StGB). Ein schwerer Fall lag nach § 213 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 DDR-StGB u.a. dann vor, wenn die Tat « unter Anwendung gefährlicher Mittel oder Methoden » durchgeführt wurde. Nach der damals in der DDR herrschenden Auslegung, die u.a. in den sog. « Gemeinsamen Standpunkten » des Obersten Gerichts und des Generalstaatsanwalts der DDR zum Ausdruck kam, wurde die in casu vorliegende Verwendung einer Steighilfe zur Überwindung von Grenzsicherungsanlagen als die Anwendung einer gefährlichen 11 Methode qualifiziert i.S.v. § 213 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 DDR-StGB. Üblicherweise wurde hierfür eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren ausgesprochen. Ferner ist es offensichtlich, dass unerlaubte Grenzübertritte auch als « gesellschaftsgefährliche » Straftaten und als « schwerwiegende Missachtung der sozialistischen Gesetzlichkeit » angesehen wurden. Damit stellte sich der unerlaubte Grenzübertritt nach dem damaligen, mithin nach dem Zeitpunkt der Tat geltenden Recht der DDR, als ein Verbrechen dar. Auch die sonstigen Voraussetzungen des § 27 DDR-GrenzG waren erfüllt. Zwar bezeichnet § 27 Abs. 1 Satz 1 DDr-GrenzG den Einsatz der Schusswaffe als « äusserste Massnahme ». Da andere Massnahmen, den unerlaubten Grenzübertritt zu verhindern, im vorliegenden Fall indessen nicht in Frage kamen, durfte diese Massnahme, mithin der Einsatz der Schusswaffe, im Sinne der Norm eingesetzt werden. Ferner verlangt § 27 Abs. 5 Satz 1 DDR-GrenzG nicht, das Leben in jedem Fall, sondern nur « nach Möglichkeit zu schonen ». Der unerlaubte Grenzübertritt hätte ohne die Schüsse auf S überhaupt nicht und bei Einzelfeuer angesichts der Tatsache, dass es um Sekunden ging, nicht mit gleicher Sicherheit verhindert werden können. Sofern man die Verhinderung des unerlaubten Grenzübertritts als ein in jedem Fall zu erreichendes Ziel einstuft, ist daher auch § 27 Abs. 5 Satz 1 DDR-GrenzG erfüllt. Der Wortlaut des DDR-Grenzgesetzes lässt somit die Auslegung zu, dass mit bedingtem Tötungsvorsatz geschossen werden durfte, wenn ein unerlaubter Grenzübertritt nicht auf andere Weise und mit anderen Mitteln verhindert werden konnte. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn § 27 DDR-GrenzG nach der zur Tatzeit herrschenden Praxis gegen damaliges höherrangiges positives Recht der DDR verstossen hätte. 2.2.2 Höherrangiges positives Recht der DDR Es stellt sich hierunter vorerst die Frage, ob die damals herrschende Auslegung des § 27 DDR-GrenzG einen Verstoss gegen die Verfassung der DDR vom 6. April 1968 in der Fassung vom 7. Oktober 1974 darstellte. Die Verfassung der DDR kannte keinen grundrechtlichen Schutz der Ausreisefreiheit und auch kein explizit positiviertes Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Allerdings herrschte Einigkeit darüber, dass der Schutzbereich des Art. 30 Abs. 1 DDR-Verf., welcher die « Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers » der DDR für « unantastbar » erklärte, jenes Grundrecht mitumfasste. Allerdings garantierte die Bestimmung das Leben und die körperliche Unversehrtheit nicht unbeschränkt. Gemäss Abs. 2 der Bestimmung waren Einschränkungen u.a. dann zulässig, wenn diese (i) « gesetzlich begründet » waren, (ii) « im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen » 12 vorgenommen wurden, (iii) sich im Rahmen dessen hielten, was « gesetzlich zulässig » war, und schliesslich (iv) « unumgänglich » waren. Mit dem Inkrafttreten des DDR-GrenzG 1982 war die erste Voraussetzung erfüllt. Ferner erfolgten die Schüsse an der Grenze zur Verhinderung eines nach §213 Abs. 3 DDR-StGB strafbaren unerlaubten Grenzübertritts, weshalb auch die zweite Bedingung erfüllt ist. Dass die Schützen, wie im vorliegenden Fall, den Rahmen dessen, was « gesetzlich zulässig » war, eingehalten haben, ist aufgrund des Ausgeführten evident. Folglich stellt sich die Frage, ob das Schiessen im Sinne der vierten Bedingung « unumgänglich » war. Wie aus dem Sachverhalt und den bisherigen Ausführungen ersichtlich, war das Schiessen notwendig und somit unumgänglich, um einen unerlaubten Grenzübertritt zu verhindern. Es stellt sich mithin die Frage i.S. eines Abwägungsproblems, ob die DDR-Verf. im Rahmen ihrer positiven Geltung das Verhältnis zwischen dem individuellem Recht auf Leben und der Staatsräson anders bestimmte, als es in der Staatspraxis tatsächlich geschah. Die Frage ist insoweit zu verneinen, als die Verfassung der DDR keine Verfassung eines liberalen Rechtstaates war. Art. 1 Abs. 1 Satz 2 DDR-Verf. bezeichnete die DDR als « die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistischleninistischen Partei ». Die « Unverletzlichkeit ihrer Staatsgrenzen » war durch Art. 7 Abs. 1 DDR-Verf. zu einem Rechtsgut von Verfassungsrang erhoben worden. Zudem herrschte ein sozialistisches Grundrechtsverständnis vor, das sich selbst aus der Perspektive des Klassenkampfes heraus begriff. Angesichts dieser Befunde läge eine unzulässige rückwirkende Umwertung vor, wollte man die der Staatspraxis entsprechende Interpretation des § 27 DDR-GrenzG an der DDR-Verf. scheitern lassen. 2.2.3 Völkerrecht Im Hinblick auf einen Verstoss gegen höherrangiges positives Recht der DDR konnte § 27 DDR-GrenzG in der der Staatspraxis entsprechenden Interpretation folglich allenfalls bloss noch an Normen des Völkerrechts scheitern. In erster Linie ist hier der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 (IPBPR), dem die DDR am 23. März 1976 beigetreten ist, einschlägig. Art. 6 Abs. 1 IPBRP schütz das Leben des Einzelnen und Art. 12 Abs. 2 IPBRP garantiert die Ausreisefreiheit. Der IPBRP konnte allerdings bloss dann zur Nichtigkeit des § 27 DDR-GrenzG in der damalig vorherrschenden Auslegung führen, wenn er erstens (i) in innerstaatliches Recht der DDR transformiert oder diesem inkorporiert war und zweitens (ii) er in der damaligen Auslegung mit dem IPBPR unvereinbar war und der IPBPR drittens (iii), falls er transformiert oder inkorporiert worden war, im Rang über einem Volkskammergesetz 13 stand, so dass ein späteres Volkskammergesetz wie das GrenzG ihm nicht nach dem Grundsatz des „lex posterior derogat lex anterior“ die Geltung wieder entziehen konnte. Es mangelt hierbei bereits an der ersten Voraussetzung, um § 27 DDr-GrenzG angesichts höherrangigen Völkerrechts hinfällig werden zu lassen: Trotz dem 1974 erfolgten Beitritt der DDR zum IPBPR ist es nie zu der von Art. 51 Satz 1 DDR-Verf. vorgesehenen Bestätigung durch die Volkskammer gekommen. In anderen Worten, wurde der IPBPR weder in positiv geltendes innerstaatliches Recht der DDR transformiert noch diesem Recht inkorporiert. Die DDR war zwar völkerrechtlich verpflichtet, den Grundsätzen des IPBPR innerstaatliche Wirksamkeit zu verschaffen, ein Verstoss einer innerstaatlichen Norm gegen die im IPBPR enthaltenen völkerrechtlichen Normen konnte jedoch schon mangels Transformation oder Inkorporation nicht zur Nichtigkeit einer gegen die völkerrechtlichen Bestimmungen verstossenden innerstaatlichen Norm führen. Daneben ist es nicht ohne weiteres evident, ob die damalige Interpretation des § 27 Abs. 2 Satz 1 DDr-GrenzG gegen Art. 12 (Garantie der Ausreisefreiheit) oder Art. 6 (Garantie des Rechts auf Leben) IPBPR verstossen hat. Die Ausreisefreiheit nach Art. 12 Abs. 2 IPBPR wird infolge der in Abs. 3 der Bestimmung enthaltenen sog. „Schrankenklausel“ nicht vorbehaltlos gewährleistet, darf mithin in bestimmten Fällen eingeschränkt werden. Solche Beschränkungen sind zulässig, sofern sie « gesetzlich vorgesehen [sind] und zum Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist und die Einschränkung mit den übrigen im Pakt anerkannten Rechten vereinbar sind ». Die DDR ging damals von der Auffassung aus, dass ihr Grenzregime durch die Schrankenklausel des Art. 12 Abs. 3 IPBPR gedeckt war. Die DDR-Interpretation basierte auf einem sozialistischen Menschenrechtsverständnis, wonach es keine systemneutralen universellen Menschenrechte gab. Ein solches Menschenrechtsverständnis, welches im Weiteren noch durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker nach Art. 1 Abs. 1 IPBPR untermauert wurde, schloss im Sinne der DDR eine universell liberale Menschenrechtskonzeption aus und gestattete danach der DDR ohne Einmischung von aussen über ihr Rechts- und Menschenrechtsverständnis autonom zu entscheiden. Eine Einschränkung der Menschenrechte im sozialistischen Sinne zugunsten der Staatsräson war daher ohne weiteres mit dem IPBPR vereinbar. Folglich konnte auf dieser Grundlage auch kein Verstoss des § 27 Abs. 2 Satz 1 DDR-GrenzG in der damaligen Auslegung gegen Art. 12 IPBPR festgestellt werden. Ein Verstoss gegen Art. 6 IPBPR kam auch nicht in Frage, da der Wortlaut des § 27 Abs. 2 Satz 1 DDR-GrenzG in der sozialistischen Auslegung keine willkürliche Tötung von Flüchtlingen zuliess. Somit scheidet eine Verletzung des IPBPR durch § 27 Abs. 2 Satz 1 DDR-GrenzG einerseits aufgrund mangelnder Transformation in innerstaatliches Recht und andererseits aufgrund mangelnden Verstosses gegen das IPBPR im Rahmen der sozialistischen Interpretation der Menschenrechte aus. 14 Im Rahmen der Völkerrechtsverträglichkeit des § 27 DDR-GrenzG ist im Weiteren zu prüfen, ob die Norm allenfalls gegen das Völkerstrafrecht verstösst und in diesem Sinne sog. Verbrechen gegen die Menschlichkeit für zulässig erklärt. Dies ist insbesondere deshalb von einiger Bedeutung, da die DDR den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Art. 91 DDR-Verf. positiviert hat und danach die « allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts über die Bestrafung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit und von Kriegsverbrechen » als unmittelbar anwendbar erklärt hat. Entsprechend enthielt das StGB der DDR Straftatbestände, wie etwa § 91 Abs. 1 DDR-StGB wonach Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Strafe gestellt wurden. Allerdings kann die Vorschrift im vorliegenden Fall nicht mehr angewendet werden, da gemäss Art. 8 Einigungsvertrag und Art. 315 EGStGB i.V.m. § 2 Abs. 3 StGB der Grundsatz der lex mitior gilt, mithin die Anwendung des milderen Gesetzes vorgeschrieben wird. In diesem Fall ist das mildere Gesetz das bundesdeutsche StGB, da es keine dem Art. 91 Abs. 1 DDR-Verf. entsprechende Vorschrift enthält. 2.2.4 Ergebnis Da das Verhalten der beiden Grenzsoldaten durch den Rechtfertigungsgrund von § 27 DDR-GrenzG, welches in der damaligen sozialistischen Auslegung weder gegen höherrangiges DDR-Recht noch gegen Völkerrecht verstiess, gedeckt war und auch kein Exzess im Sinne dieser Bestimmung (Tötung, ohne dass dies zur Verhinderung einer Flucht erforderlich war) vorlag, haben sie sich nach dem damals geltendem positiven Recht der DDR nicht strafbar gemacht und wären danach frei zu sprechen. Infolge dieser Rechtslage stellt sich allerdings die Frage, ob die damals durch positives Recht der DDR gewährte Rechtfertigung allenfalls durch metapositives Recht, wie insbesondere durch die Anwendung der Radbruchschen Formel, ex-post beseitigt werden kann. Im Weiteren soll deshalb zunächst diese Formel in den Grundzügen erörtert werden. 2.3 Radbruchsche Formel GUSTAV RADBRUCHS Bemühen, den Rechtspositivismus in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg angesichts der Rechtsperversion des nationalsozialistischen Unrechtsregimes mit einer unverfügbaren Gerechtigkeitsidee zu versöhnen, versteht sich als ein methodendualistischer Relativismus, den RADBRUCH selbst "antinomistisch" bezeichnet hat, da Gerechtigkeit, Zweckmässigkeit und Rechtssicherheit als höchste Kategorien der Rechtswerte "einander fordern, aber zugleich einander widersprechen". Es geht im Kontext solcher Antinomien um die Feststellung von objektiven, intransponiblen "Vorstellungen" und ferner um einen Diskurs über eine konkrete axiologische, mithin wertrelevante Materialität, welche einer Universalisierung offenbar nicht zugänglich sind. Das Recht erweist sich demnach als der konstitutive Wille zu einer egalitaristischen, auf die Menschenrechte rekurrierenden Gerechtigkeitskonzeption, die im Rahmen von Rechtsetzung und Rechtsanwendung zumindest als eine materiale Minimalvorgabe zu 15 beachten ist, ansonsten, mithin im Falle krasser Verletzungen des Gerechtigkeitsgrundsatzes, der Rechtscharakter und folglich die Rechtsgeltung der in Frage stehenden positiven Satzung abzusprechen ist. RADBRUCH selber hat diesen Gerechtigkeitsrekurs in seiner prominenten Schrift „Fünf Minuten Rechtsphilosophie“ (S. 210) wie folgt formuliert: "Gewiss, neben der Gerechtigkeit ist der Gemeinnutz ein Ziel des Rechts. Gewiss, auch das Gesetz als solches, sogar das schlechte Gesetz, hat noch immer einen Wert – den Wert, das Recht Zweifeln gegenüber sicher zu stellen. Gewiss, menschliche Unvollkommenheit lässt im Gesetze nicht immer alle drei Werte des Rechts: Gemeinnutz, Rechtssicherheit, Gerechtigkeit, sich harmonisch vereinigen, und es bleibt dann nur übrig, abzuwägen, ob dem schlechten, dem schädlichen oder ungerechten Gesetze um der Rechtssicherheit willen dennoch Geltung zuzusprechen, oder um seiner Ungerechtigkeit oder Gemeinschädlichkeit willen die Geltung zu versagen sei: es kann Gesetze mit einem solchen Mass von Ungerechtigkeit und Gemeinschädlichkeit geben, dass ihnen die Geltung, ja der Rechtscharakter abgesprochen werden muss."1 Im Sinne dieser Ausführung postuliert die Formel keine vollständige Kongruenz von Recht und Moral, mithin kann auch wirksames Recht, welches ungerecht ist, Geltung beanspruchen. Andererseits ist dem positiven Recht indessen eine äusserste Begrenzung inhärent, wonach es bei Überschreitung der Schwelle zum extremen Unrecht seines Rechtscharakters und seiner Rechtsgeltung verlustig geht. Damit ist der Rechtpositivismus insofern überwunden, als der Rechtsbegriff nicht nur an seiner Positivität und Wirksamkeit, sondern auch an seiner materialen Richtigkeit im Sinne eines geltungstheoretischen Grenzkriteriums gebildet wird. Trotz dem Bemühen, dem positiven Recht sittliche Komplementärkriterien anhand der Gerechtigkeitsidee unter Rekurs auf ein vorgegebenes Naturrecht beizugeben, bleibt RADBRUCH einerseits insoweit Rechtspositivist, als er im Kollisionsfall der Rechtssicherheit, selbst im Falle von inhaltlich ungerechten und unzweckmässigen positiven Regelungen, den grundsätzlichen Vorrang vor der Gerechtigkeitsidee zuspricht. Allerdings argumentiert er andererseits insoweit naturrechtlich, als er die Gerechtigkeitsidee vorgehen lässt, sofern die inhaltliche Ungerechtigkeit und Unzweckmässigkeit des positiven Rechts ein "unerträgliches Mass" erreicht hat. Im Kontext dieser Formel ist im Hinblick auf das Verhältnis von Recht und Moral insbesondere auf die ex-post Sanktionierung von gesetzlichem Unrecht hinzuweisen. RADBRUCH differenziert dabei zwischen metaphysisch/religiöser, sittlicher, politischer und juristischer Schuldkategorien, wobei davon ausgegangen wird, dass einerseits sittliche, mithin moralische Schuld, eine schuldhafte Mitwirkung und juristische, mithin kriminelle Schuld, andererseits eine rechtswidrige und schuldhafte Begehung strafbarer Tatbestände voraussetzen. Dabei kann eine Bestrafung ex-post angesichts des „Nulla-poena Prinzips“ bloss insofern erfolgen, als die vormalige Straflosigkeit "gesetzliches Unrecht" im Sinne der Formel darstellt, wobei der Rekurs auf das Prinzip des „nullum crimen“ zum Zwecke der Begründung der Straflosigkeit ex-post gerade keinen Naturrechtsrekurs, sondern einen 1 RADBRUCH, Fünf Minuten Rechtsphilosophie, 210. 16 Rekurs auf die durch Positivität garantierte Rechtssicherheit impliziert, was insbesondere von HART hervorgehoben wurde.2 Im Weiteren begründet RADBRUCH die Anwendbarkeit des Naturrechtsrekurses selbst bei Anerkennung eines völkerrechtlichen Nulla-poena-Prinzips auf der Grundlage einer universal vorgegebenen Strafbarkeit von "Unmenschlichkeitsverbrechen", die in jedem Fall ein schweres Unrecht darstellen.3 Allerdings hat RADBRUCH einerseits gerade nach den Erfahrungen der Nazi-Moral und Recht gleichsetzenden Diktatur und andererseits trotz der Kritik am positivistischen Rechtsbegriff auf die Garantiefunktion des positiven Rechts im Hinblick auf die Rechtssicherheit, die ihrerseits selbst dem Gerechtigkeitsprinzip dient, hingewiesen. Im Kontext der Radbruchschen Formel stellt Gerechtigkeit im Hinblick auf die Rechtsgeltung eine Ausnahmekategorie dar, die mit Bezug auf die Rechtsanwendung bloss insofern relevant wird, als RADBRUCH analog zum "richtigen Recht", welches durch die Unerträglichkeitsimplikation begrenzt ist, die "richtige Gerechtigkeit" – die nicht bewusst verleugnet werden darf - qua Gleichheitsprinzip bestimmt und vorgegeben, das Recht mithin material gefasst hat. Demnach differenziert RADBRUCH im Hinblick auf eine materiale Konzeption von Recht und Gerechtigkeit zwischen Unerträglichkeits- und Verleugnungsformel und konzipiert folglich eine Vermittlungsthese zwischen Positivismus und Naturrecht. Im Sinne dieser Theoriebasis konstituiert sich die Radbruchsche Formel anhand einer Kombination des negativen Kriteriums eines unerträglichen Widerspruchs zur Gerechtigkeit, mithin eines extremen Unrechts und des positiven Kriteriums eines vorhandenen Willens zur Gerechtigkeit.4 OSTERKAMP qualifiziert in seiner 1994 erschienen Studie RADBRUCHS Unrechtsargument in erster Linie als moralisches Unrecht, was andererseits die Frage nach sich zieht, ob es sich auch als juristisches Unrecht erweisen könne und folglich bei der Anwendung durch die Gerichte eine Begründung der Nichtanwendbarkeit erfordern würde.5 Sofern die Radbruchsche Formel die Verpflichtung enthält, eine gesetzliche Norm im Falle des Widerspruchs zu grundlegenden moralischen Prinzipien nicht anzuwenden, weise sie nach OSTERKAMP auf eine "Argumentationslast" hin, wonach die Rechtssicherheit 2 S. hierzu HART, der in diesem Fall das Nulla-poena-Prinzip selbst dem Naturrecht zurechnet und somit der Rechtssicherheit den Vorrang vor der Gerechtigkeit zuspricht. 3"Verschuldetes Unrecht ist aber, wie Kant gezeigt hat, mit Strafwürdigkeit identisch, und solchen zu dienen, die trotz erkennbarer Strafwürdigkeit sich auf mangelnde positive Strafbarkeit berufen, kann nicht wohl der Sinn des Prinzips nulla poena sein"(RADBRUCH, Nachwort, 202). 4"Radbruch ist eine Brücke, die die antagonistischen Positionen von gestern überspannt, seine Rechtsphilosophie hat, sieht man nur recht zu, ihren Standort jenseits von Positivismus und Naturrecht. Das erhellt ganz deutlich aus seinem Rechtsbegriff. Dieser Rechtsbegriff war von allem Anfang an ein wertbezogener Begriff, der besagt, dass das Recht die Wirklichkeit ist, die den Sinn hat, dem Rechtswert, d.h. der Gerechtigkeit zu dienen. Insoweit hat es bei Radbruch zwischen Früher und Später keinerlei Umbruch gegeben. Das war auch nicht nötig. Denn Radbruchs Rechtsbegriff weist seit jeher zwei Eigentümlichkeiten auf. Er ist erstens nicht positivistisch. Der positivistische Rechtsbegriff besagt nur, dass das Recht ein Inbegriff von formal korrekt erlassenen Normen beliebigen Inhalts ist. Radbruch dagegen betont, dass Rechtsqualität nur Normen haben, die auf die Gerechtigkeit bezogen, die an ihr orientiert sind. Das ist von grundlegender Bedeutung, weil sich bereits hier beim Rechtsbegriff zeigt, dass Radbruchs spätere Lehre vom „gesetzlichen Unrecht“ schon in der „Rechtsphilosophie“ von 1932, genau genommen sogar schon in den „Grundzügen der Rechtsphilosophie“ von 1914 angelegt war. Zweitens ist Radbruchs Rechtsbegriff nicht naturrechtlich, da „richtiges Recht“ nicht mit dem absoluten Rechtswert gleichgesetzt wird. Das Recht muss zwar an der Rechtsidee orientiert sein, aber es ist auch dann Recht, wenn es nicht in jeder Hinsicht mit der Rechtsidee überienstimmt, so es ihr nur nicht generell widerspricht. Es gibt nach Radbruch nur „annäherungsweise“ richtiges Recht"(KAUFMANN, A., Über Gerechtigkeit, 474). 5 OSTERKAMP, aaO., 42. 17 gegenüber der Ungerechtigkeit nicht mehr ins Gewicht fällt, mithin die Argumente für das Festhalten an der Rechtssicherheit nicht mehr greifen.6 Auf dieser Grundlage erweisen sich "die tragenden Gründe" der Radbruchschen Formel als moralischer und nicht juristischer Natur, wobei OSTERKAMP allerdings konzediert, dass keine klare Grenze zwischen moralischer und juristischer Argumentation gezogen werden könne. Damit soll indessen keine Resignation, sondern vielmehr das redliche Eingeständnis verbunden sein, dass die Anwendung der Radbruchschen Formel jenseits des Rahmens einer "juristischen Legitimation" stehe.7 Demnach müsse an der positivistischen Trennungsthese insofern festgehalten werden, als das positive Recht bloss am Kriterium einer relativen Richtigkeit und in Relation zu der in Frage stehenden Rechtsordnung an einer relativen Verbindlichkeit und nicht an Kriterien einer absoluten Gerechtigkeit, mithin an einer absoluten Richtigkeit, zu messen und zu beurteilen sei. Zwar konzediert auch OSTERKAMP dem Unrechtsargument eine Qualität als Entscheidungshilfe in Kollisionsfällen zwischen Recht und Moral im Sinne einer "moralisch notwendige[n] Ergänzung" der positivistischen Trennungsthese, lehnt ihre Anwendung indessen im Kontext der Mauerschützen infolge Rückwirkungsverbot ab und plädiert für eine positivrechtliche Begründung8 im Hinblick auf einen legitimen juristischen Gerechtigkeitsrekurs.9 Die These OSTERKAMPS läuft am Ende gerechtigkeitstheoretisch auf einen methodenimmanenten Rekurs auf positivierte Gerechtigkeitsprinzipien, wie insbesondere Menschenwürde und Menschenrechte, hinaus. Infolgedessen begründet er einerseits das Widerstandsrecht auf der Grundlage von "staatsphilosophischen Argumentationsmodellen" und die ex-post Bestrafung von staatlichen Unrechts anhand von verfassungs- und völkerrechtlich positivierten "Massstäben" andererseits.10 6"Die Überzeugungskraft dieser Lösung wird dabei von der Vermutung unterstützt, dass extreme Widersprüche zur Gerechtigkeit auch ein hohes Mass an Evidenz aufweisen. Auch der Radbruchschen Formel liegt daher die Einsicht zugrunde, dass es leichter fällt, eine Frage wie die nach der Gerechtigkeit negativ zu beantworten, also zu benennen, was eindeutig ungerecht ist, ohne genau zu wissen, was die Gerechtigkeit positiv ausmacht. Offenbar ist der menschliche Ungerechtigkeitssinn zuverlässiger als der entsprechende Gerechtigkeitssinn, da psychologisch die konkrete Erfahrung von Ungerechtigkeit einer abstrakteren Reflexion über Gerechtigkeit vorausgeht. Eben darin bestand auch die grundlegende moralphilosophische Lehre aus der Erschütterung durch den nationalsozialistischen Terror: dass über alle Unterschiede in der Konzeption von Gerechtigkeit hinweg Einigkeit bestehen kann im negativen Urteil über Ungerechtigkeit"( aaO., 43). 7 AaO., 45. 8 AaO., 57. 9"Hinzu kommt, dass die Kriterien für den festzustellenden evidenten Widerspruch gegen die Gerechtigkeit von den Gerichten nicht einer abstrakten Moralphilosophie entnommen wurden, sondern (meist freilich unausgesprochen) den Massstäben ihrer eigenen Rechtsordnung. Jedenfalls in der praktischen Anwendung ging es deshalb weniger um einen Konflikt zwischen positivem Recht und überpositiver Gerechtigkeit als um die legitime Grenze einer Rückwirkung von nicht überpositiv, sondern verfassungsrechtlich begründeten Gerechtigkeitsvorstellungen, die dann nach Möglichkeit noch völkerrechtlich untermauert wurden. Kein bundesdeutsches Gericht ist bisher auf den Gedanken gekommen, die Radbruchsche Formel auch auf Rechtsnormen anzuwenden, die unter der Geltung des Grundgesetzes zustande gekommen sind. Praktisch blieb sie auf die Fälle des Systemwechsels beschränkt. Als inhaltlicher Massstab diente dabei nicht (wie bei Radbruch selbst) der Zusammenhang von Gerechtigkeit und Gleichheit, der etwa bei den Mauerschützenprozessen auch wenig weitergeholfen hätte, sondern die Achtung der Menschenwürde und fundamentaler Menschenrecht. Dies sind die zentralen Massstäbe sowohl des Grundgesetzes als auch des geltenden Völkerrechts. Auf ein wie auch immer verstandenes Naturrecht griff man nur deshalb zurück, weil sich andere Vorgaben eben dieser Rechtsordnungen nicht bruchlos in das gewünschte Ergebnis einfügen liessen und ein Rückgriff auf „übergesetzliches Recht“ insofern schmerzhafte Abwägungen erspart hat. Gerade im Umgang mit staatlicher Herrschaft, die selbst die Vorgaben der eigenen Rechtsordnung immer wieder missachtet hat, sollte man dieser Verführungskraft des politisch erwünschten Ergebnisses aber nicht erliegen"( aaO., 56). 10 AaO., 57. 18 Hierzu ist indessen kritisch anzumerken, dass OSTERKAMP mit diesem Argument die "Richtigkeit" der jeweiligen Verfassungen und des Völkerrechts bereits voraussetzt, was nicht weniger ein zirkuläres Argumentationsmodell darstellt, als OSTERKAMPS eigene These von der Zirkularität des Unrechtsarguments.11 Sofern OSTERKAMP die Kriterien zur Feststellung extremen Unrechts nicht der Moral, sondern den Massstäben der völkerrechtlichen oder auch einer jeweiligen positiven Rechtsordnung entnehmen will, setzt er eben nicht bloss, wie von ihm behauptet, die relative Richtigkeit, sondern gerade eine absolute Richtigkeit der anzuwendenden Rechtsordnungen fest, was indessen andererseits bloss metapositiv und nicht im Rahmen des von OSTERKAMP postulierten methodenimmanenten "juristischen" Argumentationsmodells begründet werden kann. Es ist im Weiteren folglich auch nicht klar, in welcher Weise das Unrechtsargument, welches nach OSTERKAMP zwar als eine Entscheidungshilfe in Kollisionsfällen von Moral und Recht fungiert, als "Ergänzung zur positivistischen Trennungsthese" hinzutreten soll, sofern die Begründungs- und Sanktionskriterien des Widerstandsrechts und des extremen Unrechts allein dem positiven Recht, welches eben keinen moralischen Begrenzungskriterien zugänglich ist, entnommen werden sollen. Andererseits soll das geltende Recht auf seine ethisch-moralische Grundlegung hin untersucht werden, um ein Prinzipientraktat für ein juristisches Argumentationsmodell zu erarbeiten, was im Sinne eines methodischen "Überlegungsgleichgewichts" zwischen moralischen und juristischen Kriterien Ansätze für ein juristisches Gerechtigkeitsmodell jenseits von Naturrecht und Positivismus eröffnen soll. Allerdings wird dabei nicht auf eine universale Moral, sondern vielmehr auf eine konsenstheoretisch legitimierte Moral einer jeweiligen Rechtsgemeinschaft rekurriert, was indessen näher betrachtet insbesondere OSTERKAMPS Argument von der Menschenwürde und den Menschenrechten als universale Wertmassstäbe des geltenden Völkerrechts selbst relativiert. Das folglich theoretisch inkohärente Argumentationsmodell legt eben die Vermutung einer zumindest latenten Unterstellung einer absoluten Richtigkeit der Rechtsordnung nahe, was folgerichtig auch zur These einer am Verfassungsrecht orientierten Moraltheorie führt.12 Es kann OSTERKAMP angesichts dieser Ergebnisse im Hinblick auf das Unrechtsargument, wonach die Anwendung der Radbruchschen Formel im Kontext von extremer Ungerechtigkeit abzulehnen sei, da "damit der spezifische Charakter juristischer Argumentation aufgehoben wird", nicht gefolgt werden. Denn juristische Kohärenz wird nicht bloss durch eine methodische Bindung an positive Verfassungsgrundlagen gewährleistet, sondern vielmehr, hier durchaus im Sinne ALEXYS, durch eine gesamtheitliche Beachtung der Vorgaben des formellen und materiellen Rechtsstaates, welche die Möglichkeit von Diskursbedingungen für eine vernünftige moralische Urteilsbildung garantieren. Wie RADBRUCHS Schüler ARTHUR KAUFMANN ausführt, war RADBRUCH bereits infolge seiner Definition des Rechtsbegriffs gehalten,13 eine materiale Rechtsphilosophie zu entwickeln, 11 AaO., 56. OSTERKAMP, aaO., 7. 13 RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 34 ff. 12 19 wofür er einen, auf das Toleranz- und Demokratieprinzip rekurrierenden, werttheoretischen Relativismus,14 aber gerade keinen ethischen Indifferentismus, in Kauf nahm.15 Die Rückbindung des werttheoretischen Relativismus auf das Toleranzprinzip ermöglichte im Weiteren eine materiale Konzeption der Demokratieformel, wonach aus der Begrenzung des Mehrheitsprinzips und dem Apriori der Menschenrechte der Primat des Rechtsstaatsprinzips im Hinblick auf das Demokratieprinzip begründet werden konnte.16 Der Rückgriff auf die Relation von Menschenwürde und Toleranzprinzip indizierte im Weiteren eine personalistisch gefasste "kreatürliche Realität" des Menschen, welcher zufolge das Recht, im Sinne der These vom "Grenzfrevel", der rein juristischen Sphäre entzogen und in einen grösseren kulturellen, geschichtlichen, politischen und religiösen Kontext integriert werden konnte.17 Es stellt sich nunmehr im Anschluss an die bisherigen Ausführungen im vorliegenden Fall die Frage nach der konkreten Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit der Formel im Hinblick auf die ex-post Bestrafung gesetzlichen Unrechts. 2.4 Begründung der Strafbarkeit anhand überpositiven Rechts : Die Anwendung der Radbruchschen Formel Der Radbruchsche Naturrechtsrekurs setzt die Existenz extremen Unrechts voraus und im vorliegenden Fall die Qualifizierung der Todesschüsse als extremes Unrecht, was indessen umstritten ist.18 Im Folgenden ist deshalb vorerst die Frage zu beantworten, ob die Todesschüsse extremes Unrecht im Sinne der Formel darstellen und wenn ja, ob allenfalls positive Anwendungsschranken, wie etwa das Rückwirkungsverbot zu beachten sind und der Anwendung der Formel folglich entgegenstehen. Der deutsche Bundesgerichtshof ging in seinem besagten Entscheid davon aus, dass in casu extremes Unrecht vorlag. Er begründete diesen Standpunkt vornehmlich unter Hinweis darauf, dass im normativen und faktischen Kontext der damaligen Schiesspraxis universell anerkannte Menschenrechte verletzt worden seien und diese Rechte der Staatsraison, welche ein personelles und wirtschaftliches Ausbluten der DDR zu verhindern suchte, geopfert. ROBERT ALEXY weist in diesem Zusammenhang19 (Mauerschützen, 486), den vom Bundesgerichtshof verwendeten argumentativen Kontext erweiternd, auf die totalitäre Staatsstruktur der DDR als Strukturmerkmal des Unrechts hin. Ein solcher Totalitarismus, der das Entstehen von diskursiven Gesellschaftsstrukturen nicht zuliess, implizierte in ihrer Gesamtheit ein solch unerträgliches Mass an Unrecht, dem gewisse 14 AaO., 17. KAUFMANN, A., Über Gerechtigkeit, 474. 16 AaO., 475. 17 AaO., 478. 18 ALEXY, Mauerschützen, 482. 19 AaO., 486 15 20 Menschen, selbst um den Preis ihres Todes, mit allen verfügbaren Mitteln zu entkommen versuchten. Dieser Ansicht ALEXYS, welche die Begründung extremen Unrechts vorliegend durchaus ermöglicht, ist im Ergebnis nicht viel entgegen zu setzen, wenn auch meiner Meinung nach der vom Bundesgerichtshof unterstellte argumentative Kontext weniger anhand des Totalitarismuskriteriums – wie ALEXY vorgibt - sondern vielmehr anhand des Kriteriums der personalen Würde, dessen Nichtbeachtung den Totalitarismus erst ermöglicht, zu erweitern wäre. Nimmt man nun – sofern man will – mit dem Bundesgerichtshof das Vorliegen extremen Unrechts in casu an, stellt sich die Frage nach allfälligen positiven Anwendungsschranken der Radbruchschen Formel, wie etwa dem Rückwirkungsverbot oder auch dem Gebot der lex scripta. Insbesondere könnte in diesem Zusammenhang gegen eine ex-post Bestrafung gesetzlichen Unrechts das Folgende vorgebracht werden: Im Sinne des Rückwirkungsverbots können die Grenzsoldaten infolge der zu beurteilenden Handlungen bloss dann bestraft werden, wenn deren Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor sie begangen wurden. Da die Handlungen der Grenzsoldaten, wie ausgeführt, nach den positiv gesetzten Rechtsnormen der DDR nicht strafbar waren, käme die im Sinne der Formel von RADBRUCH metapositiv begründete Strafbarkeit einer ex-post gesetzten Strafbarkeitsbegründung gleich und verstiesse folglich gegen das Rückwirkungsverbot, wie auch gegen das Gebot der lex scripta. Es stellt sich mithin die allgemeine Frage, ob die Anwendung der Radbruchschen Formel auf spezielle Rechtfertigungsgründe eines Unrechtsregimes gegen das Rückwirkungsverbot und das Gebot der lex scripta im Sinne des Art. 103 Abs. 2 GG verstösst. Sofern dies bejaht wird, bleibt für die Anwendung der Radbruchschen Formel zumindest im Bereich des Strafrechts kein Raum. 2.4.1 Rückwirkungsverbot Im Hinblick auf das Rückwirkungsverbot ist folgendes zu sagen: Vorliegend geht es nicht um die rückwirkende Neuschaffung von Straftatbeständen, welche mit Art. 103 Abs. 2 GG offensichtlich unvereinbar wäre, sondern um die Nichtanerkennung eines speziellen Rechtfertigungsgrundes eines Unrechtsstaates im Sinne von Art. 27 Abs. 2 Satz 1 DDR-GrenzG, dessen Vereinbarkeit mit Art. 103 Abs. 2 GG umstritten ist. Von Gegnern der Anwendung der Radbruchschen Formel, wie etwa von GÜNTHER JAKOBS, wird deshalb geltend gemacht, dass die auf diese Weise vorgenommene Beseitigung eines Rechtsfertigungsgrundes einer offensichtlich verbotenen Neuschaffung eines Straftatbestandes gleichkäme. 21 Dem ist insofern beizupflichten, als im Hinblick auf das Verhältnis von Radbruchschen Formel und Rückwirkungsverbot im konkreten Fall weniger auf der Grundlage der technischen Differenz zwischen Tatbestand und Rechtfertigungsgrund zu argumentieren ist, als vielmehr im Hinblick auf den verwendeten Rechtsbegriff. Denn mit der Anwendung des der Radbruchschen Formel unterstellten Rechtsbegriffs stellt sich das Problem der Rückwirkung insofern nicht, als den damals einschlägigen Bestimmungen des positiven Rechts der DDR, soweit sie extremes Unrecht erlaubten, bereits zur Zeit der Tat der Rechtscharakter abgesprochen werden kann. Folglich wird unter Anwendung des Radbruchschen Unrechtsarguments nicht rückwirkend die Rechtslage geändert, sondern vielmehr die Rechtslage zur Tatzeit festgestellt. Nun könnte eingewendet werden, dass dadurch dennoch eine faktische Rückwirkung erfolgt, was auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen mag, andererseits indessen den von der Radbruchschen Formel verwendeten Rechtsbegriff verkennt. Die Formel identifiziert das Recht gerade nicht mit der Faktizität des ordnungsgemäss gesetzten und sozial wirksamen Rechts, sondern verwendet einen Rechtsbegriff, der einer solchen Faktizität des Rechts mit der Figur des extremen Unrechts eine Grenze setzt, indem die Rechtsgeltung abgesprochen wird. Aufgrund dieser durch die Formel vorgegebenen Prämisse ist das Recht alsdann nicht rückwirkend geändert, sondern die Rechtslage zur Tatzeit festgestellt worden. Damit scheidet eine Verletzung des Rückwirkungsverbots aus. Wenn nun die Strafbarkeit der Grenzsoldaten infolge Anwendung des metapositiven Unrechtsarguments nicht gegen das Rückwirkungsverbot verstösst, ist im Weiteren zu prüfen, ob die Strafbarkeit gegen das ebenfalls durch Art. 103 Abs. 2 GG erfassten Gebot der lex scripta verstösst, da das Radbruchsche Unrechtsargument zur Tatzeit kein geschriebenes Recht der DDR darstellte. 2.4.2 Gebot der lex scripta Das Gebot der lex scripta ist wesentlich, denn es dient einerseits dem grundrechtlichen Schutz des Täters und garantiert andererseits ein wesentliches Element der objektiven Ordnung des demokratischen Verfassungsstaates. In diesem Sinne schützt das Gebot den Einzelnen vor richterlicher Willkür, ferner vor einer Strafe für eine Tat, deren Unrecht bei ihrer Begehung nicht klar erkennbar war, bzw. nicht verschuldet werden konnte und schliesslich soll es die rechtlichen Folgen einer Handlung des Einzelnen voraussehbar machen. Es geht dabei mithin Vorhersehbarkeitsprinzip. um das Willkürverbot, das Schuldprinzip, sowie das Es könnte in diesem Kontext gegen die Anwendbarkeit der Radbruchschen Formel geltend gemacht werden, dass das Gebot der lex scripta im Interesse der Orientierungssicherheit des Bürgers an die Bestimmung des bei Strafe Verbotenen ausnahmslos beachtet werden müsse. Dem ist im Hinblick auf gesetzlich erlaubtes Unrecht folgendes entgegenzustellen: 22 Die Nichtanerkennung gesetzlichen extremen Unrechts stellt keine richterliche Willkür dar, weshalb ein Verstoss gegen das Willkürverbot vernachlässigt werden kann. Extremes Unrecht ist darüber hinaus in aller Regel evidenter als gewöhnliches Unrecht und erzeugt schliesslich einen Risikoeffekt für Täter in einem Unrechtssystem und dient in diesem Sinne als eine Handhabe, welche den Schutz der Opfer von extremem Unrecht erlaubt. Die Täter in einem Unrechtsregime sollen sich fragen, ob es sich angesichts der ex-post Anwendbarkeit eines durch die Radbruchsche Formel vorgegebenen metapositiven Rechtsbegriffs empfiehlt, an gesetzlich erlaubten extremen Unrecht teilzunehmen, da sie die Möglichkeit in Erwägung ziehen müssen, dass sie nach dem Zusammenbruch des Unrechtsregimes durchaus zur Rechenschaft gezogen werden können. Ihr Vertrauen auf die ausnahmslose Beachtung des Gebots der lex scripta, mithin das Vertrauen darauf, dass das Regime nicht zusammenbrechen wird, oder, dass sie sich selbst nach einem Zusammenbruch auf einen Rechtsfertigungsgrund, der auch extremes Unrecht deckt, berufen können, verdient keinen Schutz, da ansonsten auch eine jede generalpräventive Wirkung im Hinblick auf zukünftiges gesetzliches Unrecht verzichtet werden müsste. Es geht mithin letztlich um die Schutzwürdigkeit von fundamentalen Opferrechten, welche eine restriktive Auslegung, mithin eine Einschränkung des Gebots der lex scripta und somit des Täterschutzes rechtfertigen und letztlich den Bestand des materiellen Rechtsstaates auf die Dauer sichern. Wenn nun die Strafbarkeit der Grenzsoldaten infolge Anwendung des Unrechtsarguments weder gegen das Rückwirkungsverbot, noch gegen das Gebot der lex scripta verstösst, kann die Strafbarkeit bloss noch infolge fehlenden Verschuldens ausgeschlossen werden. 2.5 Verschulden Die Schuld kann in casu entfallen, wenn die Grenzsoldaten auf Befehl tätig wurden oder wenn ein Verbotsirrtum vorlag. In diesem Kontext hat der BGH20 eine zugunsten der Angeklagten analoge Anwendung von § 5 Abs. 1 des Wehrstrafgesetzes (WStG) vorgegeben, wonach eine auf Befehl begangene Straftat beim Handelnden bloss dann Schuldfähigkeit nach sich zieht, wenn der Handelnde erkennt oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass es sich um eine rechtswidrige Tat handelt. Um Offensichtlichkeit handelt es sich in diesem Kontext sofern die Rechtswidrigkeit der auf Befehl ausgeführten Tat jenseits aller Zweifel liegt. Da nach den Tatsachenfeststellungen die Schützen rechtsirrtümlich handelten, mithin ohne persönlich in der Lage zu sein, das extreme Unrecht ihrer Handlung zu erkennen, und als durchschnittliche junge Menschen in einem "System der Lüge", einer zu „moralischer Blindheit“ führenden, allumfassenden Indoktrination des Staates unterlagen, fehlten ihnen die "kommunikativen Bedingungen für eine vernünftige moralische Urteilsbildung", weshalb sie persönlich nicht in der Lage waren, das durch das damalige positive Recht der DDR sanktionierte extreme Unrecht zu erkennen.21 20 BGH, NJW 1993, 141 (149). nach dem, was das Urteil des Bundesgerichtshofs und das vorausgehende Urteil des Landgerichts Berlin mitteilen, zu vermuten, dass bei den beiden hier betrachteten Schützen die eben genannten Voraussetzungen vorlagen (sc. fehlendes 21"Es ist 23 Es ist hierbei ALEXY insofern zuzustimmen, als einerseits fehlendes Verschulden die Strafbarkeit der Grenzsoldaten im vorliegenden Fall tatsächlich ausschliesst und nicht bloss – wie der Bundesgerichtshof feststellt - mildert, was selbst bei Anwendung des Unrechtsarguments feststeht. Andererseits ist der Schluss, dass die "Täter" straflos bleiben, tatsächlich stossend, was indessen nicht zur Missachtung rechtsstaatlicher Vorgaben führen darf, sondern vielmehr die Frage nach der wahren Täterschaft, mithin nach den politischen und rechtlichen Urhebern des extremen Unrechts zu stellen aufgibt.22 Wie die SED an ihrer Babelsberger Konferenz vom 2./3. April 1958 im Sinne der absolut gesetzten stalinistischen Doktrin unter dem Beifall der Juristen-Elite der DDR verkündet hatte, war das Recht der DDR unlösbar an die Beschlüsse der Partei gebunden. Die Partei hatte letztlich über den Staat und das Recht gesiegt. Verschulden). Sollte dies zutreffen, so waren sie freizusprechen und nicht nur, wie der Bundesgerichtshof meint, milde zu bestrafen. Alles andere würde verkennen, dass das komplexe Verhältnis von Recht und Moral nicht schon dann ausgewogen ist, wenn, wie von der Radbruchschen Formel gefordert, die Moral dem Recht Grenzen setzt, sondern erst dann, wenn die Moral die dem Recht unterworfenen weder motivational noch, und darum geht es hier, kognitiv überfordert"(ALEXY, aaO., 492). 22"Verkündet wurde in Babelsberg (sc. Babelsberger Konferenz vom 2./3. April 1958) getreu der stalinistischen Doktrin die absolute Herrschaft der SED über das Recht. Ulbricht band, unter dem Beifall der Juristenelite der DDR, das Recht unlösbar an die Beschlüsse der SED. Diese seien allein das Fundament, auf dem die Entwicklung des Staates und des Rechts in der DDR erarbeitet werden könne. Die Partei hatte über den Staat und das Recht gesiegt"( RÜTHERS, die Wende-Experten, 134.). 24