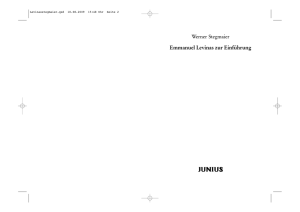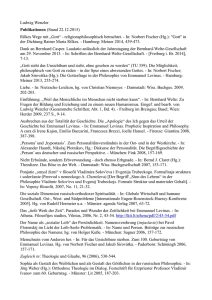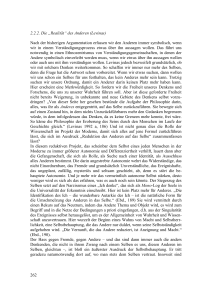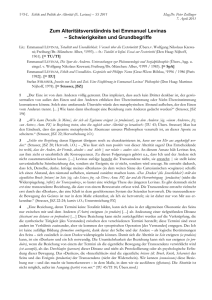Nach Ihnen, mein Herr - Theologische Hochschule Chur
Werbung

„Nach Ihnen, mein Herr!“ Ein „Nach-Ruf“ zum 10. Todestag von Emmanuel Levinas Von Andreas-Pazifikus Alkofer, Chur Salomon Malka, französischer Journalist und Essayist, seit seinem 17. Lebensjahr als Schüler der École Normale Israélite Orientale in Paris mit deren langjährigen Direktor Emmanuel Levinas vertraut, erzählt in einem der sehr persönlichen Texte, die er in seine bemerkens- und lesenswerte Biographie des Philosophen und „Fundamentalethikers“ Levinas einflicht, von einer charakteristische Spur seines Protagonisten: Levinas wäre es unmöglich gewesen, seine Vorlesungen und Vorträge zu beginnen, wenn er sich nicht zuvor der Anwesenheit seiner Frau Raissa vergewissert hätte. „Wo ist sie? Ah, da ist sie!“ – Dann erst konnte er seine Gedankenfäden und spuren auslegen. Die Rückversicherung der Nähe als Balancierung der „Andersheit“ (so Ludger Lütkehaus)? Dem Anderen auf der Spur, aber nie indiskret … Der markante Begriff ist gefallen: Andersheit (manche ziehen den Begriff „Anderheit“ vor), „alterité“. Emmanuel Levinas darf als der „Nachspürer“ der Implikationen dieser Andersheit gelten und dies phänomenologisch, philosophisch und ethisch. Und dabei kann schon hier verraten werden, dass für Levinas eine ganz spezifische Form der Ethik die erste Philosophie ist: nämliche jene, die sich in der „Intrige der Verantwortung“, der Unmöglichkeit, auf den anderen nicht zu reagieren, entspinnt. Vom anderen her wird das ethische Subjekt, das „Ich“, der „Spätankömmling in der Schöpfung“ (wie Levinas einmal sagt). Es geht ihm also nicht zuerst um das sich selbst frei und bewusst setzende Subjekt. Es geht ihm auch nicht zuerst darum, dass er exakte und präzise Regel-, Norm- oder Tugendsets entwickelt, begründet und zu implementieren sucht. Weit davon entfernt und viel grundlegender geht es ihm um die Frage, dass der/die Andere dem Ich äusserlich, exterior, letztlich unbegreiflich bleibt, ein Geheimnis. Was möglich ist, sind Spuren, Grundrisse, Annäherungen – und die haben möglichst schonend und gewaltfrei zu sein. Der Schleier dieses bleibenden Geheimnisses ist allenfalls zu „lüpfen“, jedoch nicht gewalttätig oder neugierig zu zerreissen. Hier steckt der materiale Kern der ethischen Tiefenphänomenologie Levinasscher Prägung. Der Andere ist es, der das „Ich“ überhaupt erst in die Lage versetzt zu denken, Begriffe, Ontologien etc. zu entwickeln. Aber schon bevor das „Ich“ reden lernt, denkt, Begriffe formuliert, 1 ist es eingeflochten in eine Beziehung zum Anderen. Levinas nennt das die unausweichliche „Intrige des Ethischen“. Das „Ich“ kann zwar einer bestimmten Moral, einem bestimmten Ethos, einem speziellen Ethiksystem entkommen, nicht entkommen jedoch kann es der Beziehung zum Anderen. Das ist die Grundform des Ethischen. Wie ich diese dann bewusst gestalte, ihr ausweiche (auch das ist und bleibt eine Reaktion!) oder antworte und reagiere – all das bleibt dann Thema der „üblichen“ philosophischen wie auch theologischen Ethiken. Levinas versucht, noch unterhalb dazu oder im „Vorher“ zu allen Systemen anzufangen. Riskant und sperrig bleibt dieses lebenslange Unterfangen und kennzeichnet Levinas’ Versuche am Rande des Schweigens, kurz vor dem letzten sinnvoll sagbaren Wort: Unvertrautes Gelände, kein „vertrauter Anderer“, nirgends, kein einfaches, gar begriffenes „Du“. Gerade daz, zum scheinbar vertrauten „Du“, gibt es – nota bene – einen kleinen, aber respektvollen Disput zwischen Levinas und Martin Buber. Vorrang hat der „nackte“ und hilfsbedürftige Mensch Levinas’ Leistung und Spezifikum ist, also müsste es formuliert werden, die nicht anders als revolutionär zu nennende Umorientierung der Ethik von symmetrischen Wechselseitigkeitsverhältnissen zu asymmetrischen Verantwortungsbeziehungen. Schon wieder nebenbei bemerkt: dass Hans Jonas und Levinas lebenslang aneinander vorbeigegangen sind, bleibt mehr als mirakulös. Was Levinas auch theologisch interessant, aber gleicherweise provizierend macht, ist die Tatsache, dass sein ethisch gefüllter Primat des Anderen zweifellos immer auch und je später desto mehr jenen Anderen in den Blick bekommt und hat (und das ist alles andere als beruhigend), der bei ihm „ins Denken einfällt“ – „den ganz Anderen“: Gott (und vielleicht ist das genau der angemessene Weg, in diesem Wort einen andere Attraktion zu finden, als die der „abgegriffenen Münze“). Doch die vorherrschende religionsphilosophische Lesart verkennt nach wie vor weitgehend, wie sehr Levinas dem nächsten Menschen in seiner Nacktheit und Hilfsbedürftigkeit Priorität gegeben hat, ebenso wie die theologische Rezeption zu häufig übersieht, dass der Weg zu Levinas eben nicht über eine genuine „Theologie“ führt, sondern über eine ethisch grundierte radikale Anthropologie. Der Vorrang des Anderen ist zuerst der Vorrang des anderen Menschen. Dies bedeutet nicht Selbstaufgabe des „Ich“, sondern überhaupt erst die Bedingungsmöglichkeit der Ich- und Selbstwerdung, die – nolens volens – immer wieder in die Antwort, die Ver-Ant-wortung vor den Anderen gestellt bleibt. 2 Will man diese Ethik, diese Spurensuche, auf eine Formel stimmen, so kann man sich am besten an Levinas’ (für ihn ungewohnt entspannten und witzigen) Satz halten: „Nach Ihnen, mein Herr!“. Das sollte die Summe einer Ethik sein? Oh! Man könnte aber auch an jenen Satz von E. Levinas denken, der als profilierter Nachspürer der Implikationen der Begegnung mit dem Anderen zu einer einfachen Geste verblüffenderweise notiert: „Der einzige absolute Wert, den es gibt, ist die Fähigkeit des Menschen, dem Anderen den Vortritt zu lassen. Ich glaube nicht, daß es eine Menschheit geben könnte, die dieses Ideal ablegen könnte. (...) Das ist der Beginn der Philosophie, das ist das Vernünftige, das ist das Verstehen.“ (E. Levinas, Philosophie, Gerechtigkeit und Liebe, in: ders., Zwischen uns. Versuch über das Denken an den Anderen, München 1995, 132-153, 139.) „Der Tod des Anderen ist der erste Tod.“ Vor nunmehr 10 Jahren, am 25. Dezember 1995, ist Emmanuel Levinas 89-jährig in Paris verstorben. Es hat im Nachhinein fast dem Charakter des Zwangsläufigen, dass Emmanuel Levinas den Tod der „nächsten Anderen seines Lebens“ – seiner Frau Raissa, die nur wenige Monate vorher starb – nicht lange würde überleben können. Salomon Malka streift in seiner Biographie dieses Thema in einer dezenten, freilich bewegenden Miniatur und Notiz über Levinas’ erschütternde Reaktion auf den Tod seiner Frau, an deren Beerdigung er, angeblich auf ärztliches Anraten, nicht teilnehmen konnte. So krank und hinfällig Levinas bereits war – die balancierende Nähe seiner Frau würde ihm definitiv fehlen, ihm, dem nach und (ausdrücklich) gegen Heidegger bedeutendsten Todes-Vor-Denker des vergangenen Jahrhunderts. In seinen beiden letzten Vorlesungen an der Sorbonne hat Levinas die Ethik wie auch die Todesphilosophie im Zeichen des Anderen nochmals ausdrücklich revidiert: Hat sich das abendländische Todesdenken in einem nach Levinas nur noch schwer vorstellbaren Mass auf den Eigentod und seine Heideggersche „Jemeinigkeit“ kapriziert, so erinnert er daran: „Der Tod des Anderen ist der erste Tod.“ Levinas stirbt seiner Frau nach … Wer ist da gestorben? Todeserfahrungen, Todesnähen. Nicht ausgespart, verschwiegen bleiben dürfen die Vernichtungslager, vor denen verschont zu bleiben Levinas ausgerechnet seiner Kriegsgefangenschaft zu danken war (er, Litauer von Geburt, wurde französischer Staatsbürger und hatte zu Beginn des 2. 3 Weltkrieges einzurücken). Als kriegsgefangener Soldat ging er in ein POW-Loger, nicht in ein Vernichtungslager. Und doch schneitet Vernichtung ein: Nach seiner Heimkehr musste Levinas erfahren, dass seine ganze Familie – Eltern, Brüder – in Kaunas von einem deutschen „Sonderkommando“ ermordet worden war. Einzig Raissa, mit der er seit 1932 verheiratet ist, überlebt den Krieg (versteckt von Franziskanern) … – vorsterben, nachsterben, noch nicht sterben. Was bleibt, wenn niemand bleibt? Oder fast …? Levinas schwört: Sein Gelöbnis, Deutschland, das Land der Mörder wie der für ihn maßgeblichen Denker, nicht wiederzubetreten, hat Levinas wahr gemacht. Die Kommunikation hat er nie abgebrochen. Welche Leistung! Die Wunden der Shoah, die Traumata der Massenvernichtung werden je länger je mehr zur Antriebsfeder einer phänomenologischen Tiefenethik, die sich der „einfachen“ Frage stellt, was der eine dem anderen antun kann und angetan hat – in Gedanken, Worten und Werken, in Taten, Handlungen und Haltungen. Die Grundrisse des vergangenen Jahrhunderts zerreissen für Levinas philosophische und ethische Gewissheiten und „Selbstverständlichkeiten“. Es ist nichts selbstverständlich: der Glaube nicht (Levinas ringt nach dem Krieg lange und intensiv mit seinem jüdischen Glauben), philosophische oder ethische Prinzipien nicht – angesichts des zerbrechlichen und quälbaren Anderen in seiner Bedürftigkeit, seiner Fragilität und seinem unausweichlichen Ruf nach Antwort auf ihn, auf Schutz. In diesen Rissen ist nicht das abstrakte Gute das eigentliche Wunder, sondern die konkrete Güte, die sich dem Blick des Anderen nicht entzieht – und an den seltsamsten Stellen, noch mitten im Chaos der Vernichtung aufleuchten kann. Kann, wohlgemerkt. Der Zusammenhang von Leben und Werk, von Erfahrungen und Hinterherdenken scheint bei Levinas immer auf, verortet sich hier – als Grundriss und Grund-Riss zwischen dem „Anderen“ und dem „Ich“. Levinas’ grosse Bücher mit ihren suggestiv anziehenden und rätselhaften, „Alterität“ signalisierenden Titeln (Die Zeit und der Andere, 1947; Totalität und Unendlichkeit. Essay über die Exteriorität, 1961; Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, 1974; Wenn Gott ins Denken einfällt, 1982) kreisen, um dieses Thema, umrunden es geduldig und demütig. Und auch wenn seine Texte dem Leser, der Leserin einiges an Konzentration und Mühe abverlangen – seit den fünfziger Jahren findet Levinas – erst zögerlich, dann immer massiver – Gehör, erst im romanischen, dann englischsprachigen Raum. Dass sich Jacques Derrida in „Die Schrift und die Differenz“ (1967, dt. 1975) mit Levinas intensiv auseinandersetzt, trägt zu seiner Wirkung bei. Dennoch gehörte Levinas nie zu den publicityträchtigen Ikonen der Postmoderne, allen Inspirationen zum Trotz, die er ihr am – vermeintlichen? – „Ende der Eindeutigkeit“ (Zygmunt Bauman) gegeben haben mag. 4 Aufschlussreicher und ethisch wie politisch wichtiger – aber vielleicht auch schon wieder vergessener ? – ist da schon die Rezeption, die Levinas in der lateinamerikanischen Befreiungstheologie findet. Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone und Pablo Sudar etwa versuchen sich an Übersetzungen hinein in Lebens-, Politik- und Kirchenkontexte, in denen der Andere leicht (?) mit dem Armen, dem Indigenen identifiziert werden kann. So verständlich das bleibt und ist, Anfragen bleiben auch hier. „Orte“ und „Angesichter“ … Die Orte. Da wären das litauische Kaunas, die Stadt der jüdischen Herkunft, wo er 1906 geboren wurde, Straßburg, Ort der ersten philosophischen Studien des 17-Jährigen bis zu der Promotion über Die Theorie der Anschauung in der Phänomenologie Husserls und der Übersetzung von Husserls Cartesianischen Meditationen, 20 Jahre, bevor diese erstmals auf Deutsch erscheinen – beides wird für die französische Rezeption der Phänomenologie zentral; zwischenzeitlich, im Studienjahr 1928/9, der Aufenthalt in Freiburg i.Br., die persönliche Begegnung mit Husserl und Heidegger dort, dessen Ontologie ohne Ethik Levinas für Heideggers nationalsozialistischen „Sündenfall“ verantwortlich macht, dann 1929 das Zwischenspiel auf dem „Davoser Zauberberg“ (so Lütkehaus in Anspielung auf Thomas Mann) in Graubünden, wo Levinas der grossen Konfrontation zwischen Cassirer und Heidegger beiwohnt, der Stalag XI B, das Stammlager für französische Kriegsgefangene im niedersächsischen Fallingbostel, das für fünf Jahre zum Ort des Schreckens und, nicht weit von Bergen-Belsen, zum Überlebensort wird, schließlich Paris, wo der Exilant Levinas 1932 eingebürgert wird und wohin er nach der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt. In einer Fülle von Miniatur-Porträts liessen sich (mit Salomo Malka etwa) für Levinas wichtig gewordene „Gesichter“ skizzieren: Maurice Blanchot und Jean Wahl; den geheimnisumwitterten genialischen Talmudisten Mordechai Schuschani und Jacques Derrida; Jean-Paul Sartre (den Levinas auf Heidegger aufmerksam macht!), den jüngst verstorbenen Paul Ricœur und – seine erst kardinale, dann papale Heiligkeit Johannes Paul II., der als Schüler des polnischen Phänomenologen Roman Ingarden schon sehr früh an Levinas interessiert war und ihn dann zu den berühmten Gesprächen in Castel Gandolfo eingeladen hat. „Dass im Denken von Levinas ‚Gott’ wieder ‚ins Denken einfiel’, musste auch seinem katholischen ‚Stellvertreter’ gefallen“ – formuliert Ludger Lütkehaus durchaus etwas salopp. Für Levinas wird es paradoxerweise zum Spezifikum des Jüdischen, dass alles Dogmatische, und sei es das Rechtgläubigste, zweiter Ordnung ist, was nicht heisst, dass es irrelavant wäre. Wie die Ethik statt der Ontologie zur „ersten Philosophie“ wird, so ordnet er das Tun dem Glauben vor. Sein Antifundamentalismus beharrt darauf, dass die „Verpflichtungen dem anderen Men5 schen gegenüber noch vor seinen Verpflichtungen Gott gegenüber kommen … Die einzige Art, Gott zu respektieren, ist, den Nächsten zu achten.“ Was bleibt …? „In Wahrheit setzt jeder Satz, der mit ‚Die Deutschen‘, ‚Die Engländer‘, ‚Die Juden‘, ‚Die Russen‘ beginnt und Aussagen über die Charaktereigenschaften eines Volkes macht, eine Lüge in die Welt; er negiert das Individuum. Er schließt alle aus, die nicht unter den Satz fallen. Er liquidiert den Menschen, erst im Denken, dann in der Tat.“ – Nimmt man diesen Satz des Essayisten Benjamin Korn Wort für Wort und Wort für Wort ernst, dann bewegt man sich auf einer Spur des Antifundamentalismus und des AntiVorurteils, die Levinas auslegt. Ethisches Handeln angesichts des Angesichts des Anderen beginnt schon im Sprechen, in der Wortwahl, beginnt die Aufmerksamkeit für die Frage des Anderen und der Achtung vor ihm – in der ganzen Wucht der Brüchigkeit der Existenz. Am Grab … Jacques Derrida (sein Todestag jährte sich jetzt am 8. Oktober 2005) sei am Ende dieses verhallenden Nachrufs zitiert. Derrida hält am 27. Dezember 1995 auf dem Friedhof von Pantin (Paris) die Grabrede auf Emmanuel Levinas, sucht nach Worten und findet etwa diese: „Schon seit langer, seit so langer Zeit hatte ich die Befürchtung, Emmanuel Levinas adieu sagen zu müssen. Ich wußte, daß mir dabei die Stimme brechen würde, vor allem, wenn ich es laut sagen müßte, hier, vor ihm, so nahe bei ihm, wenn ich dieses Wort aussprechen würde, das Wort ‚à-dieu’, das ich gewisser Weise ihm verdanke, jenes Wort, das zu denken beziehungsweise anders auszusprechen er mich gelehrt hat. (…) Das Heil des à-Dieu bedeutet nicht Ende. ‚Das à-Dieu ist keine Finalität’, sagt er unter Zurückweisung jener Alternative zwischen Sein und Nichts, die nicht das allerletzte ist. Das à-Dieu grüßt den Anderen jenseits des Seins in dem, was jenseits des Seins das Wort Ruhm bedeutet.“ Ein Adieu ist auch ein Gruss, ein Abschiedsgruss, endgültig, so scheint es, zudem schwer zu entschlüsseln – ein „à-Dieu“ ist aber auch und eigentlich zuerst eine Richtungsangabe. Der Weg des „à-Dieu“ ist – wenigstens mit Levinas – die radikale und zugleich dezent-geduldig-demütige Suche angesichts des anderen Menschen. „Der Weg der Kirche ist der Mensch“ – sagt einer, der nicht unwichtig war und ist für diese Kirche in seiner Enzyklika. 6 Wer sich auf die Schriften von Emmanuel Levinas einlässt, wird Spuren dazu und reichlich Verunsicherungen finden … – und ein Erbe. Lesehinweise: Emmanuel Levinas, Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philippe Nemo, Edition Passagen, Wien 31996. Jacques Derrida, Adieu. Nachruf auf Emmanuel Levinas, Edition Akzente Hanser, München 1999. Salomon Malka, Emmanuel Levinas. Eine Biografie, aus dem Französischen von Frank Miething; Verlag C.H. Beck, München 2004. 7