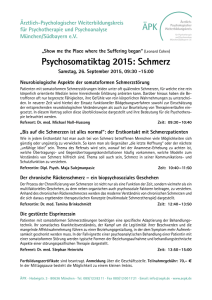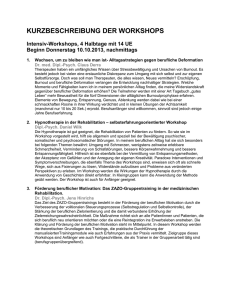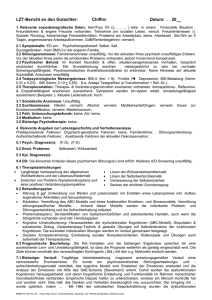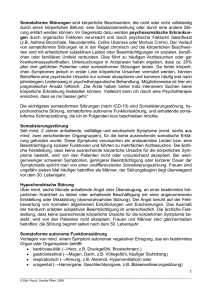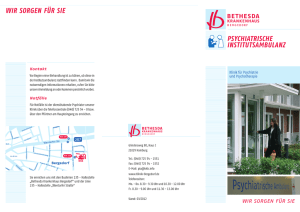Jahresbericht 2009 - Klinische Psychologie Mainz
Werbung

of Poliklinische InstitutsambulanzKlinische für Psychotherapie Psychologie und Psychotherapie Jahresbericht 2009 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, im abgelaufenen Jahr sind das Psychologische Institut und die Institutsambulanz für Psychotherapie umgezogen. Unser Domizil befindet sich jetzt nicht mehr auf dem Campus, sondern mitten in der Stadt im Bürokomplex am Taubertsberg. Die Universität Mainz hatte sich aufgrund von Platzproblemen zur Auslagerung entschlossen. Die neuen Räume sind modern und schick. Für die Institutsambulanz haben sich durch den Umzug enorme Verbesserungen ergeben, da das Platzproblem der Vergangenheit angehört. Insgesamt stehen jetzt 18 Einzel- und drei Gruppentherapieräume zur Verfügung. Die Gruppenräume werden auch für Lehrveranstaltung der Therapeutenausbildung genutzt. Die sehr hellen, freundlichen und großzügigen Räume in der 7. Ebene sind auch bei unseren Patienten, Therapeuten und Mitarbeitern auf ein sehr positives Echo gestoßen. Mit diesem Jahresbericht wollen wir Ihnen wie in den Vorjahren einen Einblick in die Inhalte und Ergebnisse unserer Arbeit geben. Die Klinische Psychologie der Universität Mainz ist ein starkes Fach. Wir arbeiten an einer Vielzahl von Forschungsprojekten, in denen wir den Entstehungsbedingungen und Behandlungsmöglichkeiten psychischer Störungen nachgehen. 2 Die Mainzer Institutsambulanz für Psychotherapie ist mittlerweile die größte Hochschulambulanz ihrer Art an den deutschen Universitäten. Noch immer sind wir die einzige zertifizierte Ambulanz! Teil dieser Erfolgsstory ist die sehr starke Nachfrage nach unserem Weiterbildungsstudiengang „Psychologische Psychotherapie“, was im letzten Jahr dazu geführt hat, dass wir die Zahl unserer Ausbildungsplätze von 17 auf 34 verdoppelt haben. Unsere Arbeit ist fest in ein Netz von wissenschaftlichen, klinischen und ausbildungsbezogenen Kooperationen eingebunden. Für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns bei allen, die uns 2009 wohlwollend und fair unterstützt haben, herzlich bedanken! Prof. Dr. Jürgen Oldenstein Vizepräsident der Universität Mainz Prof. Dr. Wolfgang Hiller Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie 3 Experimentelle Psychopathologie mulus dargeboten wurde oder nicht. Der zusätzliche Lichtreiz führte nicht nur zu einer allgemeinen Zunahme der Wahrnehmungsgenauigkeit, sondern auch zu einer generell liberaleren Antworttendenz beim Erkennen der Vibrationsreize (d = 0,45). Das heißt, bei beiden Gruppen kam es zu Wahrnehmungsillusionen (fälschliches Erkennen von Vibrationen), jedoch unterschieden sie sich nicht in deren Ausmaß. Präzisere taktile Wahrnehmung bei Personen mit somatoformen Störungen Lassen sich somatoforme Symptome auf gestörte Wahrnehmungsprozesse zurückführen? Dieser Frage sind wir in einem Experiment zur Erfassung von Wahrnehmungsschwellen und Wahrnehmungsgenauigkeit nachgegangen. 46 Personen erhielten die Aufgabe, sehr schwache taktile Vibrationen mit Hilfe ihres Zeigefingers zu erkennen. Zunächst maßen wir die individuellen Wahrnehmungsschwellen. Im anschließenden Versuch wurden die taktilen Vibrationssignale in 50% der Testdurchläufe dargeboten. Die Hälfte der Testdurchläufe wurde außerdem in zufälliger Reihenfolge von einem Lichtreiz begleitet (siehe Abbildung rechts). Auf diese Weise konnten wir die Wahrnehmungsgenauigkeit (Sensitivität) bestimmen und erfassen, ob und wie oft die Personen Vibrationen wahrzunehmen meinten, obwohl in Wirklichkeit gar kein Signal vorlag (Antworttendenz). Ein Mechanismus der Störungsgenese? Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Personen mit somatoformen Symptomen zwar keine auffällige Antworttendenz haben, die dargebotenen Signale aber intensiver und genauer wahrnehmen als gesunde Kontrollpersonen. Diese besondere Sensitivität und Wahrnehmungsgenauigkeit könnte ein Mechanismus der Störungsgenese sein. Dieser Befund passt gut in ein Modell der britischen Forschergruppe um Richard Brown: Bestehen kognitive Repräsentationen von Symptomen, so kann die hohe Wahrnehmungsgenauigkeit die tatsächliche subjektive Wahrnehmung von Körperbeschwerden fördern (Studie von Dipl.-Psych. Anna Katzer). Gruppenvergleich klinischer und gesunder Personen Diverse Fragebögen und ein klinisches Interview dienten der genauen Diagnostik somatoformer Beschwerden und anderer psychopathologischer Symptome. Damit konnten wir die Teilnehmer in zwei Gruppen einteilen: Eine Experimentalgruppe mit diagnostizierter somatoformer Störung (medizinisch unklare körperliche Symptome) und eine gesunde Kontrollgruppe. Präzisere Wahrnehmung, aber keine Wahrnehmungsillusionen Die Daten zeigten, dass Personen der Experimentalgruppe deutlich niedrigere Wahrnehmungsschwellen hatten und dadurch die schwachen Vibrationssignale präziser erkennen konnten (Tabelle unten), und zwar unabhängig davon, ob ihnen ein zusätzlicher visueller Sti Personen mit somatoformen Symptomen N = 28 Wahrnehmungsschwelle Sensitivität Antworttendenz 4 Gesunde Personen N = 18 Signifikanztest Effektstärke M SD M SD t-Wert p-Wert d-Wert 46,3 1,66 0,45 20,2 0,76 0,36 61,8 1,21 0,52 20,7 0,70 0,32 2,52 1,99 0,76 < 0,01 < 0,05 n.s. 0,76 0,61 -- 5 Studie zu körperlichen und psychischen Beschwerden in Mainzer Hausarztpraxen Patienten mit medizinisch unerklärten Symptomen haben ein vielfach erhöhtes Depressionsrisiko Als Teil einer deutschlandweiten Studie haben wir Patienten aus zwei Mainzer Hausarztpraxen im Hinblick auf körperliche und psychische Beschwerden untersucht. Medizinisch unklare körperliche Symptome waren sehr häufig und mit erhöhtem Depressionsrisiko verbunden. Somatoforme Störungen zählen mit Lebenszeit-Prävalenzraten von etwa 15% neben depressiven und Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen. Die Patienten leiden unter körperlichen Symptomen, die nicht durch medizinische Krankheitsfaktoren erklärt werden können. Die Therapie der Wahl ist in den meisten Fällen psychotherapeutisch-verhaltensmedizinisch. Die erste Anlaufstelle vieler Betroffener ist der Hausarzt. Daher sind Erkenntnisse aus Hausarztpraxen über das Vorkommen körperlicher Beschwerden mit psychosomatischem Hintergrund von Bedeutung. 308 Patienten mit Interview untersucht Wir untersuchten 308 erwachsene Hausarztpatienten, die im Mittel 47,2 (SD 16,3) Jahre alt waren, mit einem strukturierten Interview und Fragebögen. Mittels des „Patient Health Questionnaire“ (PHQ-15) war ein Screening an 614 konsekutiven Patienten vorausgegangen, um Hochrisikopatienten mit besonders vielen körperlichen Symptomen zu identifizieren. Die Ärzte beurteilten das Vorliegen oder Fehlen einer organischen Erklärung der Körpersymptome. ----- Screening durch PHQ-15 -----Sehr wenige Symptome PHQ 0-4 Anteil der Patienten * Somatoforme Symptome (Anzahl pro Patient) Organisch bedingte Symptome (Anzahl pro Patient) Somatoforme Störung Major Depression (in den letzten 12 Monaten) 23,6% 1,5 1,1 0% 2,6% Wenige Symptome PHQ 5-9 Viele Symptome PHQ 10-14 Sehr viele Symptome PHQ > 14 Prävalenz 39,7% 4,9 2,0 17,0% 5,7% 27,5% 8,9 2,5 37,2% 16,1% 9,1% 13,2 1,7 64,4% 44,4% 22,9% 11,3% * N = 614, alle anderen Werte basieren auf N = 308; Prävalenzwerte gewichtet. Häufigkeit körperlicher Symptome Die obige Tabelle zeigt, dass Personen mit höheren Screeningwerten sowohl mehr medizinisch unerklärte als auch organische Symptome hatten. Die 308 ausführlich untersuchten Patienten berichteten für den Zeitraum der letzten 12 Monate insgesamt 2.838 Symptome (durchschnittlich 9,2 pro Patient), von denen die Ärzte 78,2% als medizinisch nicht oder nicht vollständig erklärt einstuften. Am häufigsten wurden genannt: Müdigkeit und Energielosigkeit (186 Nennungen), Übelkeit oder Verdauungsbeschwerden (166), Schmerzen in Armen, Beinen oder Gelenken (141), Rückenschmerzen (138) und Schlafstörungen (106). Etwa jeder fünfte Patient erfüllte die Kriterien einer somatoformen Störung. Zusammenhänge mit Depression Die Tabelle zeigt auch, dass mit dem Anstieg der medizinisch ungeklärten Symptome ein Anstieg der Depression einherging. Die Prävalenz der Diagnose Major Depression betrug 11,3% (für den Zeitraum der letzten 12 Monate). Wir fanden einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Depressionsdiagnose und somatoformen Schmerzsymptomen: Patienten mit Major Depression wiesen im Schnitt 3,35 (SD 1,82) Schmerzsymptome auf, während es bei Patienten ohne diese Diagnose nur 1,54 (SD 1,60) waren (p < 0,01). Handelte es sich nur um Schmerzsymptome mit klarem medizinischen Hintergrund, so war dieser klare Zusammenhang nicht mehr zu erkennen (0,53 vs. 0,78 Symptome, p > 0,05). Schlussfolgerungen Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung somatoformer Symptome und Störungen in der Hausarztpraxis, insbesondere wegen des erhöhten Depressionsrisikos. Die frühe Erkennung und Behandlung dieser Patienten ist eine klinische Herausforderung (Studie von Dipl.-Psych. Stephanie Körber, Dipl.-Psych. Dirk Frieser und Dipl.-Psych. Natalie Steinbrecher in Kooperation mit den Mainzer Hausarztpraxen Dr. Rix/ Dr. Syhr-Schmitt und Dr. Dörflinger/ Hofmann). 6 7 Therapie somatoformer Störungen Wie wirksam ist Psychotherapie bei multiplen somatoformen Symptomen? – Eine Metaanalyse Erstmals in der bisherigen Forschung haben wir die Wirksamkeit von Psychotherapie bei somatoformen Störungen metaanalytisch untersucht. Die Ergebnisse: Die Behandlungseffekte sind nachweisbar, bewegen sich auf mittlerem Niveau und bleiben nach Therapieende stabil. Patienten mit multiplen körperlichen Symptomen ohne organmedizinische Ursache gelten als kostenintensiv und schwierig zu behandeln. In biopsychosozialen Störungsmodellen spielen psychotherapeutische Interventionen eine wichtige Rolle. Diese werden seit etwa 10-15 Jahren weltweit von mehreren Arbeitsgruppen entwickelt und erprobt. Wir zogen eine Bilanz, basierend auf allen in der internationalen Literatur berichteten Studien. Die Datenbasis: 27 internationale Studien Mittels einer mehrstufigen systematischen Recherche der Literatur fanden wir 27 einschlägige Therapiestudien. In diesen wurden insgesamt 1.781 erwachsene Patienten psychotherapeutisch behandelt. In 63% wurden kognitiv-verhaltenstherapeutische, in 26% verhaltensmedizinische und in 11% sonstige Psychotherapien angewandt. 74% der Therapien fanden im ambulanten, die übrigen im stationären Setting statt. Bei 59% der Studien waren die Therapeuten Spezialisten für psychische Erkrankungen (z.B. Psychotherapeuten, Psychiater), in den übrigen andere Fachleute (z.B. Hausärzte). Bei 63% der Studien erfolgten Einzeltherapien, bei den restlichen Gruppentherapien oder Kombinationen aus beiden. Es wurden ausschließlich Kurzzeitinterventionen mit im Mittel nur elf Therapiesitzungen publiziert. Die Effektstärken und Moderatorvariablen Die Auswertung folgt zwei Fragestellungen: (1) Wie sind die Prä-Post-Therapieeffekte der behandelten Gruppen? (2) Wie sind die Therapieeffekte im Vergleich zu randomisierten Kontrollgruppen? Wir berücksichtigten als Outcome die Zahl und Intensität körperlicher Symptome ebenso wie Depressivität, allgemeine Psychopathologie und Lebensqualität. In der Abbildung auf der nächsten Seite sind die Ergebnisse der ersten Fragestellung grafisch zusammengefasst. Es handelt sich um Veränderungen der Kernsymptomatik (körperliche Beschwerden) mit einer Gesamteffektstärke von d = 0,65. Bei den katamnestischen Nachuntersuchungen bis 12 Monate nach Therapieende blieb dieses Therapieergebnis stabil (d = 0,74). Die Depressivität besserte sich zwischen Therapiebeginn und -ende um d = 0,64, die allgemeine Psychopathologie um 0,58 und die Lebensqualität um 0,38. 8 d+ (95 %-KI) Studie Grafische Darstellung der Metaanalyse durch standardisierte Mittelwertsdifferenzen. Die schwarzen Punkte bezeichnen die in der jeweiligen Studie ermittelten Effektstärken. Größere Punkte erhalten statistisch eine größere Gewichtung. Die Linien kennzeichnen den Streuungsbereich. Allen (2001) Allen (2001) Arnold (2009) Bleichhardt (2004 a) Bleichhardt (2004 b) Burwell-Walsh (2002) Escobar (2007) Hiller (2003) Kolk (2004) Larisch (2004) Leibbrandt (1997) Lupke (1996) Martin (2007) Nickel (2006 a) Nickel (2006 b) Schweickhardt (2007) Smith (2006) Speckens (1995) Sumathipala (2000) Sumathipala (2008) Van der Feltz (2006) Zaby (2008 a) Zaby (2008 b) Total -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Bei den strengeren Kontrollgruppenvergleichen zeigten sich etwas niedrigere Effektstärken von d = 0,10 (Lebensqualität) bis 0,34 (Psychopathologie). Als Moderatorvariablen identifizierten wir Alter, Geschlecht und Therapeutenstatus. Jüngere Patienten und Frauen erreichten bessere Therapieergebnisse, ebenso Behandler, die auf psychische Störungen spezialisiert waren. Die Einordnung der Ergebnisse Unsere Ergebnisse belegen global die Wirksamkeit psychotherapeutischer Behandlungen bei somatoformen Störungen. Jedoch sollten die Therapiekonzepte weiterentwickelt werden, um größere Effektstärken zu erreichen. Auch muss die Frage gestellt werden, ob längere Therapien bessere Ergebnisse erzielen. Eine Studie mit 25-stündiger kognitiver Verhaltenstherapie wird derzeit an unserer Institutsambulanz durchgeführt (Metaanalyse von Dipl.-Psych. Maria Kleinstäuber). 9 Hypochondrische Patienten richten ihre Aufmerksamkeit selektiv auf körper- und krankheitsbezogene Reize Entwickeln Menschen eine Hypochondrie, weil sie ihre Umgebung ständig nach Informationen zu den Themen Krankheit und Tod absuchen? Wir haben die automatischen Aufmerksamkeitsprozesse dieser Patientengruppe näher untersucht. Das Stichwort heißt „selektive Aufmerksamkeit“: Die Neigung, seine Umgebung unwillkürlich nach potentiell bedrohlichen Reizen abzusuchen und sich diesen ausführlich zuzuwenden. Solche Aufmerksamkeitsprozesse laufen meist unbemerkt ab, ohne bewusste Intention. Es wird vermutet, dass eine verzerrte Aufmerksamkeit bei allen Angststörungen eine wichtige Rolle spielt. Bei hypochondrischen Patienten wird sie mutmaßlich bevorzugt auf Umgebungsreize mit Bezug zu Krankheit und Tod gerichtet, bei der Panikstörung auf Reize aus dem Körperinnern (vor allem des vegetativen und kardiovaskulären Systems). Wir haben in einer Studie versucht, solche Aufmerksamkeitsprozesse objektiv beobachtbar zu machen und verschiedene klinische Gruppen miteinander verglichen. Der Emotionale Stroop-Test (EST) Wir arbeiteten mit dem Paradigma des EST. Bei diesem Test werden Wörter in verschiedenen Farben auf einem Bildschirm dargeboten. Die untersuchte Person erhält die Aufgabe, unabhängig vom Wortinhalt möglichst schnell die Farbe zu benennen (siehe Abbildung unten). Bei emotional bedeutsamen Wörtern verlängern sich die Reaktionszeiten. Wir verglichen vier Gruppen: 29 Patienten mit Hypochondrie, 23 mit einer anderen somatoformen Störung, 30 mit einer Panikstörung und 30 gesunde Kontrollpersonen. Die dargebotenen Wörter waren inhaltlich auf diese Gruppen bezogen, indem sie ernsthafte Krankheiten (z.B. Krebs), körperliche Symptome (z.B. Kopfschmerzen), physiologische Erregung (z.B. Herzklopfen) und neutrale Gegenstände (z.B. Küche) beschrieben. 10 Krebs Atemnot Herzklopfen Elektroherd AIDS Schluckstörung Schwindel Rührschüssel Chemotherapie Kopfschmerz Rückenschmerzen Milchkännchen Wörter über Krankheiten 50 Wörter über Körpersymptome 40 Wörter über physiologische Erregung Reaktionszeiten (Differenzwerte) Automatische Aufmerksamkeitsprozesse 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Hypochondrie Somatoform Panikstörung Kontrollgruppe Längere Reaktionszeiten bei hypochondrischen Patienten Die obige Grafik zeigt Verlängerungen (positive Werte) bzw. Verkürzungen (negative Werte) der gemessenen Reaktionszeiten, jeweils unterteilt in die drei Wortkategorien mit kritischen Inhalten (berechnet als Differenzwerte zu den neutralen Wörtern). Nur die hypochondrischen Personen zeigten in allen Wortkategorien signifikant längere Reaktionszeiten (alle p < 0,05; Effektstärken d = 0,15 bis 0,24), was mit fehlgesteuerten Aufmerksamkeitsprozessen erklärt werden kann. Patienten mit somatoformen Störungen zeigten längere Reaktionszeiten nur bei den Wortbezügen zu Krankheit und Körpersymptomen (beide p < 0,05; d = 0,16 und 0,17). Panikpatienten waren dagegen auffällig bei Wörtern, die Aspekte physiologischer Erregung zum Wortinhalt hatten (p < 0,05; d = 0,10). Fazit der Ergebnisse Zwar sprechen unsere Ergebnisse für selektive Aufmerksamkeitsverzerrungen bei hypochondrischen Patienten, jedoch scheinen Umgebungsreize, die mit Krankheit in Verbindung stehen, auch für Patienten mit anderen somatoformen Störungen und Panikstörung kritisch zu sein. Somit scheint diese Aufmerksamkeitsveränderung nicht spezifisch zu sein. Insgesamt unterschied sich das Reaktionsmuster der hypochondrischen Personen von den anderen Gruppen, auch wenn die Effektstärken eher gering sind (Studie von Dipl.-Psych. Maria Gropalis). 11 Wann fühle ich mich angeschaut? Sozialphobiker haben einen erweiterten Blickkegel Ganz subtil spüren und registrieren wir in sozialen Kontakten, ob uns andere anschauen und beobachten. Ist dieser fundamentale Wahrnehmungsprozess bei Personen mit sozialer Phobie verändert? Fühlen sie sich schneller angeschaut als andere Menschen? Das Kernmerkmal der sozialen Phobie ist die starke Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich in sozialen und Bewertungssituationen peinlich oder demütigend zu verhalten. Der Blickkontakt steuert viele Aspekte der sozialen Interaktion. Durch die Wahrnehmung des Blicks können wir die emotionale Verfassung, die Wünsche und Absichten des Gegenübers einschätzen und angemessen reagieren. Vorstudien legen nahe, dass bei Sozialphobikern der sogenannte „Blickkegel“, also der Bereich, in dem sie sich angeschaut vorkommen, verbreitert ist (Gamer und Hecht, 2009). Diese Wahrnehmungsbesonderheit könnte zur Entstehung, aber auch zur Aufrechterhaltung dieser Störung beitragen. Ein virtueller Kopf mit drehbaren Augen In einer experimentellen Studie haben wir Blickkegelbesonderheiten bei 16 Sozialphobikern und 13 gesunden Kontrollpersonen untersucht. Beide Gruppen waren bezüglich Alter, Geschlecht und Bildungsstand vergleichbar. Allen Teilnehmern wurde auf einem Flachbildschirm ein computeranimierter Kopf präsentiert. Sie saßen einen Meter von dem virtuellen Kopf entfernt und konnten die Augen des Kopfes nach links oder rechts drehen. Die Instruktion lautete, die Augen so zu drehen, dass der Computerkopf gerade eben an ihnen vorbeischaut. Über alle 120 Durchgänge hinweg konnten wir anschließend den Blickkegel des Sich-angeschautFühlens bestimmen. Bei der Hälfte der Durchgänge wurde neben dem schauenden Kopf ein zweiter virtueller Kopf eingeblendet, dessen Augen nicht verändert werden konnten. E Darstellung der Ansicht mit zwei virtuellen Köpfen. Links der Zielkopf des Schauenden, bei dem die Versuchsperson die Einstellung der Augen vorzunehmen hat. Der Kopf ist 10° nach links gedreht, die Augen blicken rechts an der Versuchsperson vorbei. Der rechte Kopf ist hier nicht gedreht (0°) und schaut geradeaus. 12 Verbreiterter Blickkegel bei anwesendem zweiten Kopf Unsere Daten zeigten, dass sich Sozialphobiker und Kontrollpersonen in der Blickkegelbreite nicht unterschieden, wenn lediglich ein Kopf anwesend war. Der Blickkegel betrug über beide Gruppen hinweg im Mittel 18,7° (SD 11,2). Wurde hingegen der zweite Kopf eingeblendet, so bestätigte sich unsere Hypothese, dass bei den Personen mit sozialer Phobie der Blickkegel signifikant verbreitert war (p < 0,05). Dies ist in den untenstehenden Boxplots grafisch verdeutlicht. Die Effektstärke betrug d = 0,61. 35 30 Blickwinkel in Grad Psychologische Mechanismen bei sozialen Phobien 25 20 15 10 5 Soziale-Phobie-Patienten Gesunde Kontrollpersonen Versuchspersonengruppen Weitere Forschungsfragen Aus diesen Ergebnissen ergeben sich weitere Forschungsfragen, die wir derzeit in nachfolgenden Untersuchungen prüfen. So wollen wir der Frage nachgehen, ob sich die veränderte Blickwahrnehmung von Sozialphobikern nach erfolgreicher psychotherapeutischer Behandlung verändert bzw. normalisiert. Auch ist die Frage offen, ob die gefundenen Unterschiede spezifisch für die soziale Phobie sind oder auch bei anderen Angststörungen zu finden sind. Wir untersuchen außerdem, ob der emotionale Ausdruck des Gegenübers oder eine größere Anzahl anwesender Personen einen Einfluss auf die Blickwahrnehmung haben (Studie von Dipl.Psych. Julia Spiegel und Dipl.-Psych. Johannes Harbort). 13 Soziale Wahrnehmung Das Bedingungsgefüge sozialer Ängste Studie zur sozialen Phobie zeigt Hinweise auf Zusammenhänge mit sozialer Intelligenz Unterschiedliche Annahmen existieren über den Zusammenhang zwischen sozialen Ängsten und sozialer Intelligenz. Entstehen Kontakt- und Beziehungsängste vor dem Hintergrund sozialer Defizite? Oder beeinträchtigen Ängste kluges Sozialverhalten? Wir sind derartigen Fragen in einer Querschnittsstudie nachgegangen. Hierfür stand uns der Magdeburger Test zur Sozialen Intelligenz (MTSI) zur Verfügung, der diese Merkmale objektiv und leistungsorientiert erfasst. Der MTSI basiert auf dem integrativen Modell der sozialen Intelligenz von Weis, Seidel und Süß (2006). Soziale Intelligenz wird danach als ein „multidimensionales Fähigkeitskonstrukt“ verstanden, bestehend aus den Komponenten soziale Wahrnehmung, soziales Verständnis und soziales Gedächtnis. Stichprobe von 110 Personen Wir untersuchten eine nichtklinische Stichprobe von 110 Personen zwischen 19 und 66 Jahren (Durchschnittsalter 31,5 Jahre, SD 13,2). Neben dem MTSI wurden Fragebögen zur Erfassung von folgenden Merkmalen sozialer Ängste eingesetzt: Dispositionale Selbstaufmerksamkeit (SAM), sozialphobische Einstellungen (SPE), sozialphobische Kognitionen (SPK), sozialphobisches Verhalten (SPV). Den Ausprägungsgrad der sozialen Angst erfassten wir mit der Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) und der Social Phobia Scale (SPS). Analyse mit Strukturgleichungsmodellen 30 Studienteilnehmer hatten klinisch auffällige SIAS- und SPS-Werte. Eine Analyse mittels Strukturgleichungsmodellen ergab einige signifikante Zusammenhänge zwischen den latenten Faktoren der sozialen Intelligenz und den manifesten Subskalen der sozialen Ängste. Bei einem exzellenten Modellfit (χ2 = 24,0; p = 0,40) waren insbesondere das sozialphobische Verhalten negativ sowohl mit der sozialen Wahrnehmung (r = -0,30; p < 0,05) als auch dem sozialem Verständnis (r = -0,35; p < 0,05) korreliert. Soziale Ängste scheinen daher mit verlangsamten Reaktionen bei den Testaufgaben zur sozialen Wahrnehmung und mit schlechteren Leistungen bei den Aufgaben zum sozialen Verständnis in Verbindung zu stehen. Interessant ist, dass eine erhöhte öffentliche Selbstaufmerksamkeit (Subskala des SAM) mit einer schnelleren sozialen Wahrnehmungsreaktion (r = 0,19; p < 0,05) und einer besseren Leistung des sozialen Gedächtnisses einherging (r = 0,35; p < 0,05). 14 -0,18 -0,30 Sozialphobische Einstellungen 0,66 0,84 0,19 0,12 Sozialphobisches Verhalten Soziales Gedächtnis 0,41 0,34 0,43 0,35 Sozialphobische Kognitionen 0,38 0,46 -0,35 0,18 -0,35 Soziales Verständnis Selbstaufmerksamkeit Die obige Abbildung veranschaulicht das Strukturgleichungsmodell mit den einzelnen Komponenten. Die positiven und negativen Korrelationen zeigen an, wie eng jeweils zwei Komponenten in ihrem Ausprägungsgrad miteinander verbunden sind. Fazit der Studie Die Resultate weisen darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialen Ängsten und sozialer Intelligenz gibt, insbesondere für die Komponente des sozialphobischen Verhaltens. Aussagen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen bleiben jedoch spekulativ. Um diese zu untersuchen, wären weitere experimentelle oder Längsschnittstudien notwendig (Studie von Dipl.-Psych. Sandra Hampel). 15 Unsere Publikationen im Jahr 2009 Bischoff, C., Gönner, S. (2009). Flexibilität und Flexibilitätstraining. In: Linden, M., Weig, W. (Hrsg.). Salutotherapie in Prävention und Rehabilitation, pp. 185-196. Köln: Dt. Ärzte-Verlag. Chernyak, N., Petrak, F., Plack, K., Hautzinger, M., Müller, M.J., et al. (2009). Cost-effecti­ve­ ness analysis of cognitive behaviour therapy for treatment of minor or mild-major depression in elderly patients with type 2 diabetes: study protocol for the economic evaluation alongside the MIND-DIA randomized controlled trial (MIND-DIA CEA). BMC Geriatrics, 9:25. de Zwaan, M., Petersen, I., Kaerber, M., Burgmer, R., Nolting, B., Legenbauer, T., Benecke, A., Herpertz, S. (2009). Obesity and quality of life: a controlled study of normal-weight and obese individuals. Psychosomatics, 50, 474-482. Gass, P., Martini, M., Witthöft, M., Bailer, J., Dreßing, H. (2009). Prevalence of stalking vic­timization in journalists: an e-mail survey of German journalists. Violence and Victims, 24, 163-171. Gönner, S., Ecker, W., Leonhart, R. (2009). Diagnostic discrimination of OCD patients with different main symptom domains from each other and from anxious and depressive controls. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 31, 159-167. Gönner, S., Hahn, S., Leonhart, R., Ecker, W., Limbacher, K. (2009). Identifikation der Haupt­symptome von Zwangspatienten anhand von Symptomskalen - Kriteriumsvalidität und dia­ gnostische Genauigkeit des OCI-R. Verhaltenstherapie, 19, 251-258. 16 Leichsenring, F., Hoyer, J., Beutel, M., Herpertz, S., Hiller, W., et al. (2009). The Social Phobia Psychotherapy Research Network. The first multicenter randomized controlled trial of psychotherapy for social phobia: rationale, methods and patient characteristics. Psychotherapy and Psychosomatics, 78, 35-41. Gönner, S., Ecker, W., Leonhart, R. (2009). Obsessive-Compulsive Inventory - Revised (OCIR) - Deutsche Adaptation. Manual. Frankfurt: Pearson. Legenbauer, T., Vocks, S., Schäfer, C., Schütt-Strömel, S., Hiller, W., Wagner, C., Vögele, C. (2009). Preference for attractiveness and thinness in a partner: influence of internalization of the thin ideal and body dissatisfaction in hetero- and homosexual women and men. Body Image, 6, 228-234. Hiller, W., Bleichhardt, G., Schindler, A. (2009). Evaluation von Psychotherapien aus der Perspektive von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 57, 7-22. Legenbauer, T., de Zwaan, M., Benecke, A., Mühlhans, B., Petrak, F., Herpertz, S. (2009). De­pression and anxiety: their predictive function for weight loss in obese individuals. Obesity Facts, 2, 227-234. Hiller, W., Leibing, E., Sulz, S.K.D. (Hrsg.) (2009). P1 Prüfungsfragen und Antworten zum Lehrbuch der Psychotherapie mit Simulation der staatlichen Prüfung, Band 1: Grundlagen der Psychotherapie (herausgegeben von S.K.D. Sulz). München: CIP Medien. Rist, F., Witthöft, M., Bailer, J. (2009). Grundlagen der Kognitiven Verhaltenstherapie. In: Arolt, V., Kersting, A. (Hrsg.). Psychotherapie in der Psychiatrie. Berlin: Springer. Hiller, W., Rief, W. (2009). Somatoforme Störungen. In: Berger, M. (Hrsg.). Psychische Erkrankungen - Klinik und Therapie (3. Aufl.), pp. 719-736. München: Urban & Fischer. Thomas, P., Hiller, W. (2009). Therapieresistenz in der Behandlung somatoformer Störungen. In: Schmauß, M., Messer, T. (Hrsg.). Therapieresistenz bei psychischen Erkrankungen, pp. 145-160. München: Urban & Fischer. Kornadt, A. E., Witthöft, M., Rist, F., Bailer, J. (2009). Affekt-modulierte Aufmerksamkeitsprozesse unter Arbeitsgedächtnisbelastung bei Krankheitsangst. Zeitschrift für Klinische Psy­chologie und Psychotherapie, 38, 194-202. Vocks, S., Hechler, T., Röhrig, S., Legenbauer, T. (2009). Effects of a physical exercise session on state body image: the influence of pre-experimental body dissatisfaction and concerns about weight and shape. Psychology & Health, 24, 713-728 17 Vocks, S. Stahn, C., Loenser, K., Legenbauer, T. (2009). Eating and body image disturbances in male-to-female and female-to-male transsexuals. Archives of Sexual Behavior, 38, 364-377. Weitere Forschungsprojekte 2009/10 Weck, F., Bleichhardt, G., Hiller, W. (2009). The factor structure of the Illness Attitude Scales in a German population. International Journal of Behavioral Medicine, 16, 164-171. In den verschiedenen Beiträgen dieses Jahresberichts haben wir einige unserer Forschungsprojekte mit ersten Ergebnissen dargestellt. Weitere Projekte wurden ebenfalls bereits begonnen oder sind für das Jahr 2010 in Planung: Weck, F., Bleichhardt, G., Hiller, W. (2009). Stellen Erfahrungen mit Krankheiten einen spezifischen Risikofaktor für Krankheitsängste dar? Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 38, 89-99. Witthöft, M., Rist, F., Bailer, J. (2009). Abnormalities in cognitive-emotional information processing in idiopathic environmental intolerance and somatoform disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 70-84. Witthöft, M., Sander, N., Süß, H.-M., Wittmann, W.W. (2009). Adult age differences in inhibitory processes and their predictive validity for fluid intelligence. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 16, 133-163. 2008: 2007: 2006: 2005: insgesamt 21 Publikationen insgesamt 11 Publikationen insgesamt 16 Publikationen insgesamt 23 Publikationen Interozeption bei somatoformen Störungen: In dieser neuen Studie soll die Hypothese geprüft werden, dass die interozeptive Wahrnehmung von Patienten mit somatoformer Symptomatik defizitär ist. Untersucht wird dies im Labor mit der Wahrnehmung des eigenen Herzschlags und der Muskelanspannung. Beim Vorliegen von Defiziten soll die Wahrnehmungsgenauigkeit durch ein Sensibilitätstraining verbessert werden. Emotionsregulationsstile in der Bevölkerung: In einer postalisch durchgeführten Bevölkerungsstudie erfassen wir Strategien und Stile der Emotionsregulation. Insbesondere soll das Konzept der „emotionalen Kaskaden“ in seiner Bedeutung für psychische Störungen untersucht werden. Die international am häufigsten verwendeten Instrumente für Emotionsregulation werden hinsichtlich ihrer psychometrischen Merkmale miteinander verglichen. Ambulantes Monitoring: Mittels kleiner tragbarer Computer (PDA = Personal Digital Assistant) sollen im natürlichen Alltag Zusammenhänge zwischen dem Auftreten körperlicher Beschwerden und Stimmungsschwankungen untersucht werden. Wir fragen uns, ob negative Stimmungen ausgelöst werden, sobald man (ängstlich) auf körperliche Signale achtet. Naturalistische Psychotherapieforschung: Durch unser systematisches Dokumentationsund Evaluationssystem verfügen wir mittlerweile über mehrere Tausend Datensätze von Patienten, die regulär in unserer Ambulanz behandelt wurden. Detaillierte Auswertungen erfolgen derzeit für depressive, Angst- und Essstörungen. Eine weitere Studie wird sich mit der selten beforschten Frage beschäftigen, durch welche Risikofaktoren vor oder während des Therapieverlaufs Abbrüche bedingt sind. Ferner untersuchen wir metaanalytisch die Effekte naturalistischer Psychotherapien. Internettherapie bei chronischem Tinnitus: Erste internationale Studien weisen darauf hin, dass das Internet als Therapiemedium vielversprechend ist. Wir richten 2010 eine Internettherapie für chronische Tinnituspatienten ein. Es handelt sich um eine gemeinsame Studie mit Prof. Dr. Gerhard Andersson und Dr. Cornelia Weise von der Universität Linköping in Schweden. Das Studiendesign ist randomisiert mit einer Wartekontrollgruppe. 18 19 Anzahl der Behandlungsstunden (Einzeltherapie) pro Jahr; nur Forschungs- und Lehrambulanz Die Poliklinische Institutsambulanz Kostenträger im Jahr 2009 %-Anteil 11,9 % 19,5 % 7,2 % 0,6 % 388 98 111 8 31 174 19 12 453 144 5 990 39,2 % 9,9 % 11,2 % 0,8 % 3,1 % 17,6 % 1,9 % 1,2 % 45,8 % 14,5 % 0,5 % 100,0 % Anzahl Facharzt Psychiatrie/Neurologie 39 Hausarzt- oder anderer Facharzt 215 Psychologe/Psychotherapeut 79 Psychiatrische Klinik/Tagesklinik 130 Psychosomatische Klinik 34 Andere Klinik (z.B. Schmerzklinik, Reha) 43 Beratungsstelle 71 Empfehlung durch Bekannte/Verwandte 91 Eigeninitiative (z.B. Internet, Zeitungsartikel) 218 Empfehlung der Krankenkasse 6 Wiederbehandlung 19 Sonstige 45 Anzahl der Patienten 2009 990 6000 4000 1000 0 2000 2005 2006 2007 2008 Dauer der Patientenbehandlungen 2009 500 2009 56,3% 557 24,1% 239 200 %-Anteil 3,9 % 21,7 % 8,0 % 13,1 % 3,4 % 4,3 % 7,2 % 9,2 % 22,0 % 0,6 % 1,9 % 4,5 % 100,0 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 Altersverteilung der Patienten 2009 30,4% 301 250 300 100 0 300 400 Zuweiser im Jahr 2009 Anzahl 118 193 71 6 8000 2000 Die Poliklinische Institutsambulanz besteht aus einer Ausbildungs- sowie einer Forschungsund Lehrambulanz. In den Tabellen und Grafiken dieser und der folgenden Seiten haben wir erstmals die Leistungen beider Teilambulanzen zusammengefasst. In der Ausbildungsambulanz wurden im abgelaufenen Jahr 652 Patienten (plus 4,5% gegenüber 2008) mit insgesamt 10.798 Therapiestunden (plus 13,6%) behandelt. In der Forschungs- und Lehrambulanz registrierten wir 338 Patienten mit insgesamt 3.731 Therapiestunden. Die Grafiken der nächsten Seite zeigen, dass Personen aller Alters- und Bildungsgruppen unsere Ambulanz aufsuchten. Ähnlich wie in den Vorjahren waren etwa zwei Drittel weiblich. Langzeittherapien fanden mehr als doppelt so häufig statt wie Kurzzeittherapien. Die wichtigste Zuweisergruppe stellen die Haus- und medizinischen Fachärzte dar, gefolgt von psychiatrischen und Tageskliniken. PRIMÄRKASSEN insgesamt BEK DAK Hamburg-Münchner KKH TK GEK andere Ersatzkassen ERSATZKASSEN insgesamt PRIVATE KRANKENKASSEN SONSTIGE KOSTENTRÄGER Anzahl der Patienten Gesamt 10000 3000 Insgesamt 990 Patienten wurden 2009 in unserer Institutsambulanz diagnostisch untersucht und psychotherapeutisch behandelt. Es waren alle wichtigen psychischen Störungen vertreten. Die Zahl der Therapiestunden stieg 2009 auf insgesamt 14.529. AOK BKK IKK LKK 12000 4000 Die Leistungsbilanz 2009 Anzahl der Behandlungsstunden (Einzeltherapie) pro Jahr; nur Ausbildungsambulanz 8,8% 87 9,0% 89 150 1,8% 18 0 einmalige maximal KZT Untersuchung 5 Sitzungen (Erstgespräch) (probatorisch) 22,0% 200 17,0% Umwandlung von KZT in LZT 8,9% 88 100 LZT KZT=Kurzzeittherapie LZT=Langzeittherapie Geschlechterverteilung der Patienten 2009 50 0 18–25 Jahre N = 667 Frauen 3,2% 32 26–35 Jahre 36–45 Jahre 46–55 Jahre 56–65 Jahre 66 Jahre und älter Schulbildung der Patienten 2009 2,5 % 0,7 % 32,6 % 18,5% 183 168 19,2 % 17,6 % ohne Schulabschluss Hauptschule Realschule N = 323 Männer Abitur 24,5 % 67,4 % 35,5 % 20 218 Hochschulabschluss Anderer 21 Diagnosenverteilung 2009 Diagnosen (Komorbidität) Anzahl als Diagnosen insgesamt Alkoholabhängigkeit (F10.2) 5 (0,5%) 19 (1,0%) Schädlicher Gebrauch von Alkohol (F10.1) 0 (0,0%) 29 (1,5%) Substanzabhängigkeit (F1x.2) 1 (0,1%) 27 (1,4%) Schädlicher Gebrauch von Substanzen (F1x.1) 0 (0,0%) 11 (0,6%) Schizophrenie (F20.x) 12 (1,2%) 12 (0,6%) Andere Diagnosen aus F2 (Störungen aus dem Formenkreis schizophrener Erkrankungen) 11 (1,1%) 14 (0,7%) Depressive Episode oder Rezidivierende depressive Störung (F32/F33) Dysthymia (F34.1) 272 (27,5%) 509 (26,2%) 32 (3,2%) 62 (3,2%) Manische oder bipolare Störungen (F30/F31/F34.0) 8 (0,8%) 11 (0,6%) Andere Diagnosen aus F3 (Affektive Störungen) 0 (0,0%) 2 (0,1%) 60 (6,1%) 8 (0,8%) Soziale Phobie (F40.1) 95 (9,6%) Spezifische Phobie (F40.2) 13 (1,3%) 52 Generalisierte Angststörung (F41.1) 17 (1,7%) 27 (1,4%) Zwangsstörung (F42) 15 (1,5%) 32 (1,6%) Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie (F41.x und F40.01) Agoraphobie ohne Panikstörung (F40.00) 115 (5,9%) 24 (1,2%) 160 (8,2%) (2,7%) Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) 14 (1,4%) 41 (2,1%) Anpassungsstörung (F43.2) 16 (1,6%) 25 (1,3%) Somatoforme Störung (F45 außer Hypochondrie) Hypochondrische Störung (F45.2) 112 (11,3%) 171 (8,8%) 47 (4,7%) 4 (0,4%) 9 (0,5%) Anorexia nervosa und Atypische Anorexien (F50.0 und F50.1) 20 (2,0%) 48 (2,5%) Bulimia nervosa und Atypische Bulimien (F50.2 und F50.3) 46 (4,6%) 98 (5,0%) Andere Essstörungen (sonstige Diagnosen aus F50) 54 (5,5%) 105 (5,4%) Schlafstörungen (F51) 1 (0,1%) 2 (0,1%) Sexuelle Funktionsstörungen oder sexuelle Deviationen (F52 und F64-66) 1 (0,1%) 6 (0,3%) 53 (5,4%) 97 (5,0%) Andere Diagnosen aus F4 (Angst-, Zwangs-, Belastungs-, dissoziative und somatoforme Störungen) Psychische Störungen im Zusammenhang mit einer medizinischen Grunderkrankung (F54) In den dargestellten Diagnosenstatistiken sind alle Patienten der Ausbildungs- sowie Forschungs- und Lehrambulanz des Jahres 2009 zusammengefasst. In unserer Ambulanz erfolgt eine sehr sorgfältige Diagnostik psychischer Störungen nach den Kriterien von DSM-IV. Standardmäßig werden die Internationalen Diagnosen-Checklisten (IDCL) oder das SKID-Interview eingesetzt. Die drei größten klinischen Gruppen sind die affektiven Störungen (31,5%), Angststörungen (20,9%) und somatoformen Störungen (16,1%). Zusammen stellen sie etwa zwei Drittel unserer Hauptdiagnosen. Die größeren Behandlungsschwerpunkte Essstörungen und Soziale Phobie sind mit weiteren 12,1% bzw. 9,6% vertreten. Hervorzuheben ist auch der Anteil von Borderline-Persönlichkeitsstörungen mit 2,9%. 56 (2,9%) Persönlichkeitsstörungen (F60) (ohne Borderline-Persönlichkeitsstörung) 20 (2,0%) 79 (4,1%) Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31) 29 (2,9%) 48 (2,5%) Störungen der Impulskontrolle (F63) 8 (0,8%) 10 (0,5%) Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (F90.0) 5 (0,5%) 14 (0,7%) Sonstige psychische Störungen (oben nicht aufgezählt) 7 (0,7%) 31 (1,6%) (Psychische Störung in Erstuntersuchung ausgeschlossen) 4 (0,4%) 0 (0,0%) 990 (100,0%) 1.946(100,0%) Gesamt 22 Häufigkeit als Hauptdiagnose Verteilung der Diagnosen 2009 (nur Hauptdiagnosen – jeweils 1 Diagnose pro Patient) 1 = Substanzmissbrauch und -abhängigkeit N = 6 2 = Psychotische Störungen N = 23 3 = Affektive Störungen N = 312 4 = Angststörungen N = 207 5 = Zwangsstörungen N = 15 6 = Somatoforme Störungen N = 159 7 = Essstörungen N = 120 8 = Psychische Störungen im Zusammenhang mit einer medizinischen Grunderkrankung N = 53 9 = Persönlichkeitsstörungen N = 49 10 = Sonstige N = 46 5% 1% 2% 5% 5% 9 8 10 2 1 3 12% 7 16% 32% 6 5 2% 4 21% 23 Evaluation unserer Therapien 2009 Response Remission Alle Therapien der Institutsambulanz werden routinemäßig im Jahresrhythmus evaluiert. Im Jahr 2009 wurden 175 Therapien abgeschlossen. Die untenstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Prä-Post-Ergebnisse für die Ergebnismaße der allgemeinen Psychopathologie, Depressivität und Angst. 80 70 60 50 69,8 % 60,0 % 50,0 % 43,1 % 40 30 Wir erreichten 2009 über alle Messzeitpunkte hinweg eine Rücklaufquote von 91,2%, so dass die Datenqualität sehr hoch ist und ein repräsentatives Bild unserer Therapieergebnisse entsteht. Die Effektstärke der allgemeinen Psychopathologie war mit d = 0,76 zufriedenstellend. Ähnlich wie in den Vorjahren waren die Behandlungsergebnisse für Patienten mit den Diagnosen Major Depression oder Dysthymer Störung sehr gut (d = 1,22). Dagegen fallen die Resultate für das Störungsbild der Panikstörung/Agoraphobie deutlich schlechter aus. Wir stellten zwar signifikante Verbesserungen der körperliche Angstsymptomatik (BSQ) sowie des Vermeidungsverhaltens (MI) fest, die Effektstärken liegen aber (mit Ausnahme der körperlichen Symptomatik) in einem nur gerade noch moderaten Bereich. Sie sind insgesamt schlechter als im Vorjahr, wo wir Effektstärken von über 1 erzielten. Daher sind Verbesserungen unserer Angsttherapien erforderlich. Skala Beginn der Therapie Ende der Therapie 20 10 0 Depressivität Response und Remission Für wieviele Patienten war die Therapie so hilfreich, dass sie dadurch eine klinisch bedeutsame Besserung ihrer Symptomatik erreichen konnten? Und wieviele davon waren bei Therapieende sogar symptomfrei? Signifikanztest Effektstärke M SD M SD t-Wert p-Wert d-Wert Patienten jeglicher Diagnose BSI GSI-Gesamtwert (N = 130) BSI Skala Ängstlichkeit (N = 93) BSI Skala Aggressivität/Feindseligkeit (N = 113) 1,27 1,70 1,27 0,57 0,73 0,67 0,82 0,96 0,75 0,62 0,83 0,67 8,23 9,74 7,23 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,76 0,95 0,78 Patienten mit depressiver Störung (N = 86) Beck Depressions-Inventar (BDI) 24,4 7,6 13,9 9,6 10,06 < 0,01 1,22 Patienten mit Panikstörung/Agoraphobie Agoraphobic Cognitions ACQ (N = 17) Body Sensations BSQ (N = 15) Mobilitätsinventar MI, Vermeidung in Begleitung (N= 17) Mobilitätsinventar MI, Vermeidung alleine (N = 18) 2,30 3,04 2,49 3,26 0,69 0,48 0,71 0,92 2,04 2,44 2,07 2,66 0,59 0,66 0,95 1,17 1,53 2,82 2,56 3,11 n.s. < 0,05 < 0,05 < 0,01 0,41 1,05 0,51 0,57 nur Therapien, die im Evaluationsjahr 2009 abgeschlossen wurden; nur Patienten mit pathologischem Score bei Therapiebeginn; Intention-to-treat-Analyse, d.h. Patienten mit und ohne regulär abgeschlossene Therapie 24 Allgemeine Psychopathologie In der Therapieforschung werden üblicherweise Mittelwertsveränderungen und Effektstärken berechnet (siehe Tabelle S. 24). Solche Daten lassen jedoch keinen Rückschluss über den Anteil der Patienten zu, die individuell eine erhebliche Besserung (Response) oder sogar klinische Symptomfreiheit (Remission) erreichen. Daher haben wir eine entsprechende Analyse für den Intention-to-Treat-Datensatz des Jahres 2009 durchgeführt. Response ist definiert als mindestens 50-prozentige Wertereduktion zwischen Therapiebeginn und -ende. Zwei Drittel bessern sich klinisch bedeutsam Die obenstehende Grafik zeigt die Ergebnisse für die allgemeine Psychopathologie (BSI-GSI) und die Depressivität (BDI). Bei etwa zwei Drittel der Patienten wurde das Response-Kriterium erreicht, exakt bei 78 von 130 Patienten (60,0%) für den BSI-GSI und 60 von 86 Patienten (69,8%) für die Depressivität. Remission lag bei Therapieende bei genau der Hälfte der Patienten für die depressive Symptomatik und bei rund 43% für die allgemeine Psychopathologie vor. Remission gilt nur dann als erreicht, wenn der betreffende Patient gleichzeitig auch das Response-Kriterium erfüllt. Bei Anwendung des international gebräuchlichen Reliable Change Index (RCI) betragen die Response-/Remissionswerte für den GSI 33,8/21,5% und für den BDI 59,3/43,0%. 25 Evaluation der Kundengruppen im Jahreszyklus erbindung: Mainzer Volksbank · BLZ 551 900 00 · Konto-Nr. 400 283 016 Zertifiziertes QM-System DIN EN ISO 9001:2000-12, Zertifikat Nr. 8817D Das Qualitätsmanagement der Ambulanz nach DIN EN ISO 9001 Das seit 2005 zertifizierte Qualitätsmanagement (QM) der Ambulanz hat auch 2009 einen hohen Standard der Betriebsabläufe und Behandlungen garantiert. Im Jahreszyklus werden Kennwerte erhoben, um die eigenen Qualitätsansprüche zu prüfen. Die Kernelemente des QM sind die jährlichen Befragungen unserer drei wichtigsten Kundengruppen, nämlich Patienten, Mitarbeiter und Therapeuten. Die Zufriedenheit der Patienten verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr leicht und bewegt sich auf einem sehr hohem Niveau (s. Tabelle unten). Das Befragungsergebnis beruht auf 358 ausgefüllten Fragebögen. Durch den hohen Rücklauf von 97,5% repräsentiert das Ergebnis die tatsächliche Einstellung der in der Ambulanz behandelten Patienten. Eine sehr gute Bewertung erhielten wir auch von den in der Ambulanz tätigen Mitarbeitern. Nicht erreicht wurde dagegen das Qualitätskriterium der Therapeutenzufriedenheit. Wir erhielten eine Gesamtnote von 2,09 (SD 0,55), was leicht schlechter ist als der selbstgesetzte Anspruch (besser als 2,0). In den bisherigen sechs Jahren der QM-bezogenen Evaluation wurde das Kriterium nur ein einziges Mal erreicht, nämlich 2006 mit der Note 1,76 (SD 0,55). Der bislang schlechteste Wert 2,27 (SD 0,92) stammt von 2005 und der Notendurchschnitt 2004 bis 2008 ist 2,08 (SD 0,71). Der Wert von 2009 entspricht also ziemlich genau dem langjährigen Durchschnitt. Wir müssen leider feststellen, dass die vielen bisherigen Maßnahmen nicht die erwünschte Zufriedenheit erbracht haben und wir vor einem gewissen Rätsel stehen. Therapieschwerpunkte der Institutsambulanz Einige unserer Qualitätskriterien und Kennwerte im Jahr 2009 Durchschnittsnote 1,69 (Schulnote) bei Rücklauf 97,5 % Durchschnittsnote 1,62 (Schulnote) Ja 93,9 %; Eingeschränkt 6,1 %; Nein 0 % Durchschnittsnote 1,45 (Schulnote) bei Rücklauf 100 % Durchschnittsnote 2,09 (Schulnote) bei Rücklauf 100 % 26 gegenüber Vorjahr verbessert unverändert verschlechtert eigener Qualitätsanspruch erreicht • Qualitätsanspruch nicht erreicht, Maßnahmen erforderlich • Patientenzufriedenheit Gesamt Patientenzufriedenheit Therapie Weiterempfehlungsquote durch Patienten Mitarbeiterzufriedenheit Zufriedenheit der Therapeuten Tendenz Bewertung Ergebnisse 2009 Qualitätsmerkmale • • • • • Essstörungen: Wir verfügen über ein kombiniertes einzel- und gruppentherapeutisches Programm nach dem Ansatz von Legenbauer/Vocks. In der Body-Image-Gruppe kommen Techniken wie die Spiegelkonfrontation zum Einsatz (Leiterin Dipl.-Psych. Katja Schnicker). Soziale Phobien: Dieser Schwerpunkt ist aus einer BMBF-geförderten multizentrischen Therapiestudie hervorgegangen. Die Therapie erfolgt nach dem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz von Clark/Stangier (Leiter Dipl.-Psych. Michael Schäfer). Somatoforme Störungen: Patienten mit medizinisch unklaren Körperbeschwerden werden als Teil einer randomisiert-kontrollierten Studie nach einem neuen verhaltenstherapeutischen Konzept behandelt (Leiter Dr. Michael Witthöft und Dipl.-Psych. Maria Kleinstäuber). Krankheitsängste und Hypochondrie: Dieser Behandlungsansatz nach Bleichhardt/Weck ist in den vergangenen Jahren mit sehr guten Ergebnissen evaluiert worden. Viele Komponenten der Angstbehandlung werden eingesetzt (Leiterin Dipl.-Psych. Maria Gropalis). Chronische Schmerzerkrankungen: Der interdisziplinär ausgerichtete Schwerpunkt kooperiert eng mit schmerztherapeutischen Einrichtungen in der Region. Die Therapie ist verhaltensmedizinischen Prinzipien verpflichtet (Leiterin Dr. Katrin Mauer-Matzen). Arbeitsplatzbelastungen: Die Integrierte Versorgung „Fit im Job“ ist ein standardisiertes Gruppenprogramm für Personen mit arbeitsbezogenen psychischen Belastungen wie Mobbing, Burnout oder Leistungsabfall (Leiterin Dr. Nadine Schuster). Borderlinestörungen: Wie verfügen über eine Skillsgruppe nach dem Ansatz der Dialektisch-Behavioralen Borderlinetherapie (DBT). Die Gruppe umfasst 30 Doppelstunden und wird ergänzt durch speziell supervidierte Einzeltherapien (Leiterin Dr. Andrea Dascalescu-Fritsch). 27 Schmerztherapeutische Ausbildung der Therapeuten Am Jahresende 2009 waren 12 Therapeuten im Schwerpunkt tätig. Alle absolvieren begleitend die Weiterbildung zur speziellen Schmerztherapie. Diese umfasst ein 80-stündiges Theoriecurriculum der Deutschen Gesellschaft für Psychologische Schmerztherapie und -forschung (DGPSF), die regelmäßige Fachsupervision der Behandlungen und den Besuch von interdisziplinären Schmerzkonferenzen. Schwerpunkt Chronische Schmerzerkrankungen Therapeutenausbildung und Schmerzpsychotherapie nach wissenschaftlichen Konzepten Die Institutsambulanz hat im Herbst 2008 einen Schwerpunkt für chronische Schmerzstörungen eingerichtet. Die Entwicklung des vergangenen Jahres zeigte: Interesse und Bedarf an qualifizierten verhaltensmedizinischen Schmerzbehandlungen sind enorm groß. Daten zur Diagnostik Im Jahr 2009 wurden 66 Patienten in den Behandlungsschwerpunkt aufgenommen. Von 49 Patienten lagen uns bei Jahresende Daten aus der Diagnostikphase vor. Das Durchschnittsalter der zu etwa zwei Drittel weiblichen Patienten betrug 48,1 Jahre (SD 8,9). Im nebenstehenden Diagramm ist dargestellt, wie häufig die einzelnen Schmerzformen vorkamen. Chronischer Schmerz gehört mit Prävalenzraten um 20% zu den häufigsten Erkrankungen. In der Mehrzahl der Fälle liegen Kopf- oder Rückenschmerzen vor, oft in Verbindung mit multiplen Schmerzen. Bei einer erheblichen Zahl der Betroffenen kommt es begleitend und als Folge der Schmerzerfahrung zu gravierenden psychischen und sozialen Komplikationen. Weiterbildung: Spezielle Schmerztherapie Leiterin unseres Schwerpunkts ist Dr. Katrin Mauer-Matzen. Sie verfügt über die Weiterbildungsermächtigung für spezielle Schmerztherapie der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Der Schwerpunkt kooperiert besonders eng mit dem DRK-Schmerzzentrum Mainz, der ärztlichen Facharztpraxis Dr. med. Sabine Hesselbarth und Oliver Löwenstein und der Schmerzambulanz der Universitätsmedizin Mainz. Darüber hinaus sind wir offen für Kooperationen mit allen interessierten Haus- und Fachärzten. 8% 15% Multiple (multilokuläre) Schmerzen Rückenschmerzen Kopfschmerzen 63% Sonstige Schmerzen Bei der Eingangsdiagnostik setzen wir den Fragebogen zur Erfassung der Schmerzverarbeitung (FESV) von Geissner (2001) ein. Wie das untenstehende Skalenprofil für die 2009 aufgenommenen Patienten zeigt, sind die schmerzbedingte psychische Beeinträchtigung und Schwierigkeiten der kognitiven bzw. behavioralen Schmerzbewältigung ähnlich ausgeprägt wie in der Normierungsstichprobe des FESV (gemischte Gruppe stationärer und ambulanter Schmerzpatienten). Nur bei 10% unserer Patienten wurde ausschließlich eine Schmerzstörung diagnostiziert, bei den übrigen bestand Komorbidität insbesondere mit depressiven und Angststörungen. Das Behandlungskonzept Entsprechend aktueller wissenschaftlicher Standards der Schmerzpsychotherapie (z.B. Kröner-Herwig et al., 2007) sieht unser Konzept Einzelbehandlungen als Kurz- und Langzeittherapien vor. 28 14% Einige Komponenten der verhaltensmedizinischen Schmerzpsychotherapie 5 • Edukation zum biopsychosozialen Schmerzmodell • Systematische Selbstbeobachtung: Analyse schmerz- und stressfördernder Bedingungen • Fertigkeitentraining zur Schmerz- und Stressbewältigung: Entspannungstechniken, Aufmerksamkeitslenkung, Problemlösekompetenzen • Optimierung des Aktivitätsniveaus: Balance von Ruhe und Aktivität, Abbau angstmotivierter Vermeidung, Aufbau von Aktivitäten • Modifikation katastrophisierender und depressiver Kognitionen • Entwicklung realistischer Zukunftsperspektiven / Krankheitsakzeptanz 4 3 2 Schmerzpatienten der Mainzer Ambulanz Vergleichsgruppe ambulanter und stationärer Schmerzpatienten 1 0 Handlungskompetenzen Kognitive Kompetenzerleben Umstrukturierung Mentale Ablenkung Gegensteuernde Aktivitäten Ruhe- und Entspannungstechniken Schmerzbedingte Schmerzbedingte Schmerzbedingter Depression Angst Ärger 29 Schwerpunkt Diabetes mellitus Theorie und Praxis der Verhaltensmedizin: Ausbildung zum qualifizierten Psychodiabetologen Unser Forschungs- und Behandlungsschwerpunkt für Patienten mit Diabetes mellitus hat 2009 durch die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz die Weiterbildungsermächtigung für Psychodiabetologie erhalten. Seit Mitte 2008 nehmen wir gezielt Patienten auf, die im Zusammenhang mit ihrer Diabeteserkrankung psychisch belastet sind. Inzwischen wurden enge Kooperationen mit mehreren medizinisch-diabetologischen Schwerpunktpraxen bis hin nach Ludwigshafen und Limburg aufgebaut. Ende Oktober waren Diabetologen und Diabetesberaterinnen aus sechs Institutionen (diverse Schwerpunktpraxen, Universitätsklinik Mainz und Städtisches Krankenhaus Offenbach) der Einladung in unsere Ambulanz gefolgt, um Erfahrungen auszutauschen und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Zehn Therapeutinnen waren Ende 2009 im Schwerpunkt tätig, um sich als Psychodiabetologinnen zu spezialisieren. Dipl.-Psych. Ulrike Löw, selbst Fachpsychologin für Diabetes, unterstützt seit Juli die Leiterin des Schwerpunkts, Dr. Andrea Benecke. Wir bieten regelmäßige interne Fortbildungsveranstaltungen an, in denen auf die spezifischen Probleme und Behandlungsmöglichkeiten bei Diabetes eingegangen wird, z.B. Insulintherapie, Besonderheiten im Umgang mit Hypoglykämien und Krankheitsakzeptanz. Aus den klinischen Fragestellungen heraus sollen konkrete Forschungsprojekte entwickelt werden. Patienten und Diagnosen Im vergangenen Jahr fanden 24 Erstgespräche mit Diabetespatienten statt. Es handelte sich um 17 Frauen und 7 Männer. Am Jahresende befanden sich 35 Patienten in Therapie mit einem Durchschnittsalter von 41,8 Jahren (SD 13,7). In 22 Fällen lag ein Diabetes vom Typ I und in 13 Fällen vom Typ II vor. Neben der Hauptdiagnose F54 (Körperliche Erkrankung mit psychosomatischer Begleitsymptomatik) war die häufigste komorbide Diagnose die einer Major Depression (51,3%). Daten der DAD-Studie kommen 2010 Die Behandlungen in der seit 2006 laufenden Diabetes-Depressions-Studie DAD wurden 2009 abgeschlossen (Projektleiter PD Dr. Frank Petrak). Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Auswertungen sind 2010 geplant. 30 Fallbeispiel: Aus der Panik heraus zum Überperfektionismus Die 31-jährige Versicherungsangestellte ist übervorsichtig. Auf keinen Fall Risiken eingehen, wenn sie vermeidbar sind! Diese Grundeinstellung prägt vieles in ihrem Leben, besonders aber auch den Umgang mit dem seit 18 Jahren bestehenden Typ-I-Diabetes. Mit strengster Disziplin beobachtet sie fortlaufend ihre Blutzuckerwerte, um das Risiko etwaiger Folgeerkrankungen so gering wie möglich zu halten. Ihr aktueller HbA1c-Wert (Langzeitblutzuckerwert) liegt bei 4,3% und damit deutlich unter der Norm. Die Kehrseite der Medaille: Schon bei völlig unbedenklichen (normoglykämischen) Blutzuckerwerten (> 120 mg/dl) steigert sie sich in heftigste Sorgen hinein, wird unruhig, unkonzentriert, hektisch. Manchmal kommen sogar körperliche Belastungsreaktionen mit Übelkeit und vermehrtem Harndrang hinzu. „Mein Verstand sagt mir, dass alles in Ordnung ist. Trotz komme ich immer wieder in die Angstspirale bis fast an die Panik“, bekennt sie der Therapeutin aufgelöst unter Tränen. Um ihre Ängste in den Griff zu bekommen, misst sie täglich bis zu 10 mal ihren Blutzucker oder spritzt mehr Einheiten Insulin als vom Arzt empfohlen. Die Folge sind häufige Unterzuckerungen, bei denen sie auf Fremdhilfe angewiesen ist. Die Therapeutin erarbeit mit der Patientin Kriterien für angemessenes Krankheitsverhalten. Es werden Techniken der Angstkonfrontation und Habituation eingesetzt. Es gelingt Schritt für Schritt, die Zahl der Blutzuckerkontrollen und Insulininjektionen auf das medizinisch empfohlene Maß zu verringern. Die Patientin erlebt die erreichten Erfolge dankbar als deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität. 31 Schwerpunkt „Fit im Job“ Therapieeffekte Depression Die mit Abstand meisten der behandelten Patienten litten an einer depressiven Störung. In 53 von 94 Fällen (56,4%) wurde die Hauptdiagnose „Major Depression“ gestellt. Untenstehende Tabelle zeigt die Veränderungen der Depressionswerte beim Ende der Gruppentherapie. Die Intention-to-Treat-Analyse umfasst alle Patienten unabhängig davon, ob sie die Therapie regulär beendet haben oder nicht (n = 50). Dagegen sind in der Completer-Analyse nur regulär abgeschlossene Therapien enthalten (n = 38). Die Effektstärken bewegen sich in einem mittleren bis sehr guten Bereich. Bessere Distanzierung, weniger Resignation und mehr Ausgeglichenheit gegen Burnout-Risiko Die Integrierte Versorgung „Fit im Job“ wurde 2005 gemeinsam mit den rheinland-pfälzischen Ersatzkassen eingerichtet. Bis Ende 2009 haben wir 94 Personen (davon 70,3% Frauen) in das Gruppenprogramm aufgenommen. Hier präsentieren wir erste Evaluationsdaten. Die Gesundheitsreporte der Krankenkassen berichten seit längerem über die brisanten Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf die Arbeitsunfähigkeitszeiten. Vieldiskutierte Stichworte sind Mobbing, Burnout oder Leistungsabfall aufgrund von Rationalisierung und Personaleinsparung. Unser Forschungs- und Behandlungsschwerpunkt wird von Dr. Nadine Schuster geleitet. In dem manualisierten, aus diversen Modulen bestehenden Gruppenprogramm „Fit im Job“ werden schwerpunktmäßig die Themen „Umgang mit der Arbeit“, „Stressabbau“, „Depressions- und Angstbewältigung“ sowie „Erwerb sozialer Kompetenzen“ behandelt. Eingeschriebene Patienten können maximal ein halbes Jahr lang teilnehmen. d = 0,40 23,38 d = 0,49 d = 0,42 21,59 20,81 Mittelwert 20,29 20 d = 0,44 17,74 Effektstärke M SD t-Wert p-Wert d-Wert Intention-to-Treat-Analyse Therapiebeginn Therapieende 23,9 17,9 6,7 9,9 4,87 < 0,01 0,71 Completer-Analyse Therapiebeginn Therapieende 23,7 15,8 6,7 9,8 5,27 < 0,01 0,94 Nur Patienten mit pathologischem Score bei Therapiebeginn Signifikante Veränderung von Erlebens- und Verhaltensmustern Die untenstehende Grafik zeigt die Prä-Post-Effekte unserer Gruppentherapie. Mit Hilfe des AVEM-Fragebogens von Schaarschmidt und Fischer wurden arbeitsplatzbezogene Erlebensund Verhaltensmuster erfasst. Die Veränderungen auf vier von 11 Skalen waren statistisch signifikant (p < 0,05) und die Behandlungseffekte bewegten sich im mittleren Bereich. 25 Signifikanztest Beck-Depressionsinventar (BDI) Vor der Therapie Bewertung und Ausblick Die erhobenen Daten belegen die Wirksamkeit der Therapie. Die Auswertung des AVEM weist auf eine Verbesserung von Merkmalen hin, die als typisch für Burnout gelten (Steigerung der Distanzierungsfähigkeit, Verringerung der Resignationstendenz, mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit). Die Besserung der depressiven Symptomatik geht vermutlich mit einer erhöhten Leistungsfähigkeit einher, so dass wir davon ausgehen, mit der Gruppentherapie einen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit zu leisten. Es ist daher vorgesehen, dass „Fit-im-Job“Programm 2010 weiter auszubauen. Nach der Therapie 19,00 16,80 15,76 15 0 32 Datenbasis N = 53 Completer-Analyse Verausgabungsbereitschaft Perfektionsstreben Distanzierungsfähigkeit Resignationstendenz 33 Durchschnittsnote 1,93 (Schulnote) bei Rücklauf 92,1 % Durchschnittsnote 2,47 (Schulnote) bei Rücklauf 82,8 % Durchschnittsnote 1,57 (Schulnote) bei Rücklauf 100 % 100% Durchschnittsnote 1,57 bei 20 Teilnehmern • Hintergrund der Erweiterung ist die in den letzten Jahren sehr große Nachfrage nach der universitären Psychotherapeutenausbildung in Mainz. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten hatten wir wiederholt ausgezeichnet vorqualifizierte Bewerber abweisen müssen. In Zukunft werden sowohl zum Sommer- als auch Wintersemester Ausbildungsgruppen mit zunächst jeweils 15 Teilnehmern angeboten. Die erste zusätzliche Gruppe hat bereits im Oktober 2009 begonnen. In den neuen Räumen des Psychologischen Instituts am Taubertsberg stehen deutlich mehr Seminar- und Behandlungsräume als bisher zur Verfügung. Der Weiterbildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie der Universität Mainz bietet die drei- bis fünfjährige Ausbildung in Verhaltenstherapie seit 1998 entsprechend des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) an. Personelle und strukturelle Veränderungen Im Zuge der Erweiterung wurde eine neue Mitarbeiterstelle eingerichtet (Dipl.-Psych. Maria Gropalis). Unsere bisherige Mitarbeiterin Dipl.-Psych. Sabine Wagner hat unser Team nach sechsjähriger Tätigkeit verlassen. Ihre Nachfolgerin wurde Eva Krause, die für Organisation des Curriculums und andere Aufgaben zuständig ist. 2009 wurden zahlreiche neue Dozenten und Selbsterfahrungsleiter gewonnen. Darüber hinaus wurden drei weitere Kliniken für die Praktische Tätigkeit I (Psychiatrie) als kooperierende Ausbildungsstätten anerkannt. 34 Tendenz Bewertung • • • • • Ergebnisse 2008/09 Zufriedenheit mit Seminaren und Workshops Zufriedenheit mit Selbsterfahrungsseminaren Zufriedenheit mit den Supervisionen Bestehen der Staatsprüfungen Note der Staatsprüfungen Qualitätsmerkmale gegenüber Vorjahr verbessert unverändert verschlechtert eigener Qualitätsanspruch erreicht • Qualitätsanspruch nicht erreicht, Maßnahmen erforderlich An der Universität Mainz können zukünftig mehr Psychologische Psychotherapeuten als bisher ausgebildet werden: Das Gesundheits- und Sozialministerium in Mainz hat 2009 die Zahl der Ausbildungsplätze von bisher 17 auf 34 erhöht. DIN EN ISO 9001:2000-12, Zertifikat Nr. 8817D Zahl der Studienplätze aufgrund großer Nachfrage nach universitärer Ausbildung verdoppelt Einige unserer Qualitätskriterien und Kennwerte im Evaluationsjahr 2008/09 Zertifiziertes QM-System Weiterbildungsstudiengang Psychotherapie erbindung: Mainzer Volksbank · BLZ 551 900 00 Psychologische · Konto-Nr. 400 283 016 Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 Der Weiterbildungsstudiengang verfügt über ein Qualitätsmanagement (QM), das seit 2007 nach der internationalen Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Nach wie vor sind wir das einzige universitäre Ausbildungsinstitut in Deutschland, das diesen Qualitätsstandard erreicht hat. Ein externes Überwachungsaudit im Frühsommer 2009 verlief problemlos. Die oben­stehende Tabelle gibt einen Überblick über die Qualitätsprüfungen im vergangenen Jahr. Einige statistische Angaben zum Weiterbildungsstudiengang 2009 Gesamtzahl der Bewerbungen Zahl neu aufgenommener Teilnehmer Durchschnittsalter der neuen Teilnehmer (in Jahren) Anteil Frauen (%) Zahl der Staatsprüfungen 81 32 27,7 81,3 16 Mittelwerte bis 2008 49,6 14,2 30,1 77,0 10,1 35 Organigramm Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2009 (Stand: 31.12.2009) Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hiller Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie Dr. Michael Witthöft Wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Andrea Benecke Geschäftsführerin des Weiterbildungsstudiengangs und stellv. Leiterin der Institutsambulanz Claudia Stadler Mitarbeiterin Diabetes-Studie Karen Steinhoff Mitarbeiterin Fit im Job Annette Hoffmann Mitarbeiterin Sekretariat Weiterbildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie Ina Freitag Mitarbeiterin Sekretariat Dipl.-Psych. Maria Gropalis Maike Polon Mitarbeiterin Sekretariat Poliklinische Institutsambulanz für Psychotherapie Leitende Psychologen der Ausbildungsambulanz: Dr. Katrin Mauer-Matzen Dr. Andrea Dascalescu-Fritsch Dipl.-Psych. Sascha Gönner (bis 30.09.09) Leiter der Schwerpunktbereiche: Dr. Nadine Schuster (Fit im Job) Dr. Margarethe Brockmann (bis 31.07.09) und Dipl.-Psych. Katja Schnicker (Essstörungen) Dr. Ulrike Kerber (bis 30.11.09) und Dipl.-Psych. Michael Schäfer (Soziale Phobien) Dipl.-Psych. Maria Gropalis (Hypochondrie) Dr. Michael Witthöft (Somatoforme Störungen) Dr. Andrea Benecke (Diabetes mellitus) Leiterin der Evaluation Leiterin Evaluation (Psychotherapieforschung): (Psychotherapieforschung): Dipl.-Psych Amrei Schindler Dipl.-Psych Schindler Carolin Engelien Mitarbeiterin Evaluation Sandra Schreiber Mitarbeiterin Sekretariat Dipl.-Psych. Christine Volz Therapeutin in Ausbildung Olga Oschmann Mitarbeiterin Diabetes-Studie Dipl.-Psych. Carolin Ochs Therapeutin in Ausbildung Christine Manke Mitarbeiterin Sekretariat 36 Martha Kuta Mitarbeiterin Sekretariat 37 Dipl.-Psych. Julia Stahl Therapeutin in Ausbildung Lioba Schmitt Mitarbeiterin Soziale-Phobie-Schwerpunkt Mirjam Haas Mitarbeiterin Evaluation Dipl.-Psych. Kathrin Riebel Therapeutin in Ausbildung Lisa Schröder Mitarbeiterin Hypochondrieschwerpunkt Dipl.-Psych. Ina Unger Therapeutin in Ausbildung Helena von Versen Mitarbeiterin Evaluation Dipl.-Psych. Eva Hans Doktorandin und Therapeutin in Ausbildung Dipl.-Psych. Sabine Christian Therapeutin in Ausbildung Nicola Comes Mitarbeiterin Sekretariat Rita Leist Sekretärin Dipl.-Psych. Natalie Steinbrecher Doktorandin und Therapeutin in Ausbildung Dipl.-Psych. Helge Poesthorst Therapeutin in Ausbildung Kirsten Litzel Mitarbeiterin Evaluation Janine Ranft Mitarbeiterin im Essstörungsschwerpunkt Mana Saadati Mitarbeiterin Essstörungsschwerpunkt Dipl.-Psych. Irene Warnecke Therapeutin in Ausbildung Dipl.-Psych. Noelle Loch Doktorandin und Therapeutin in Ausbildung Dipl.-Psych. Simin Paulus Therapeutin in Ausbildung Malin Stutte Mitarbeiterin Sekretariat 38 Eva Krause Mitarbeiterin Weiterbildungsstudiengang Dipl.-Psych. Sandra Hampel Doktorandin und Therapeutin in Ausbildung Dipl.-Psych. Sandra Siekmann Therapeutin in Ausbildung 39 Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Psychologisches Institut, Abteilung Klinische Psychologie & Psychotherapie; Wallstraße 3, 55122 Mainz; Tel. 06131- 39 39100, Fax 06131 – 39 39102; E-Mail: [email protected] Weiterbildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten sowie von Forschung und Lehre, – Poliklinische Institutsambulanz –, e.V. Die Ausbildungsstätte ist akkreditiert im Verbund der universitären Ausbildungsinstitute in Deutschland (Unith) und Mitglied im Deutschen Fachverband Verhaltenstherapie (DVT); ferner ist sie Teil des Ausbildungsverbunds Psychologische Psychotherapie Rhein-Main der Universitäten Frankfurt, Mainz und Darmstadt Der Weiterbildungsstudiengang und die Poliklinische Institutsambulanz sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Zertifiziertes QM-System DIN EN ISO 9001:2000-12, Zertifikat Nr. 8817D Besuchen Sie uns im Internet: www.klinische-psychologie-mainz.de