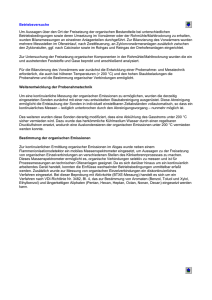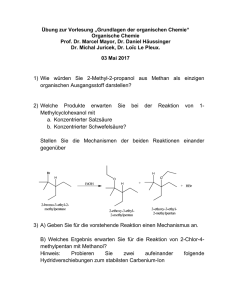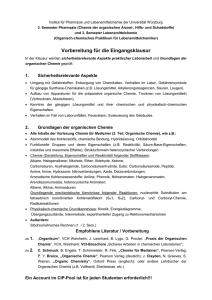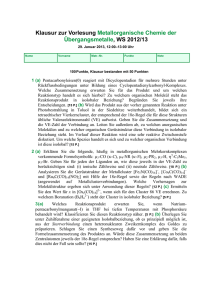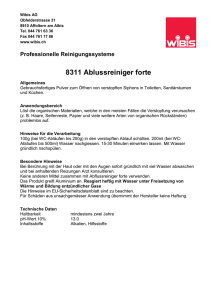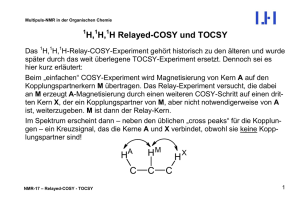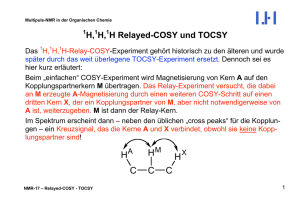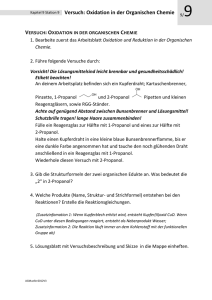DIE FORMALEN BEDINGUNGEN DER ZELLEN
Werbung
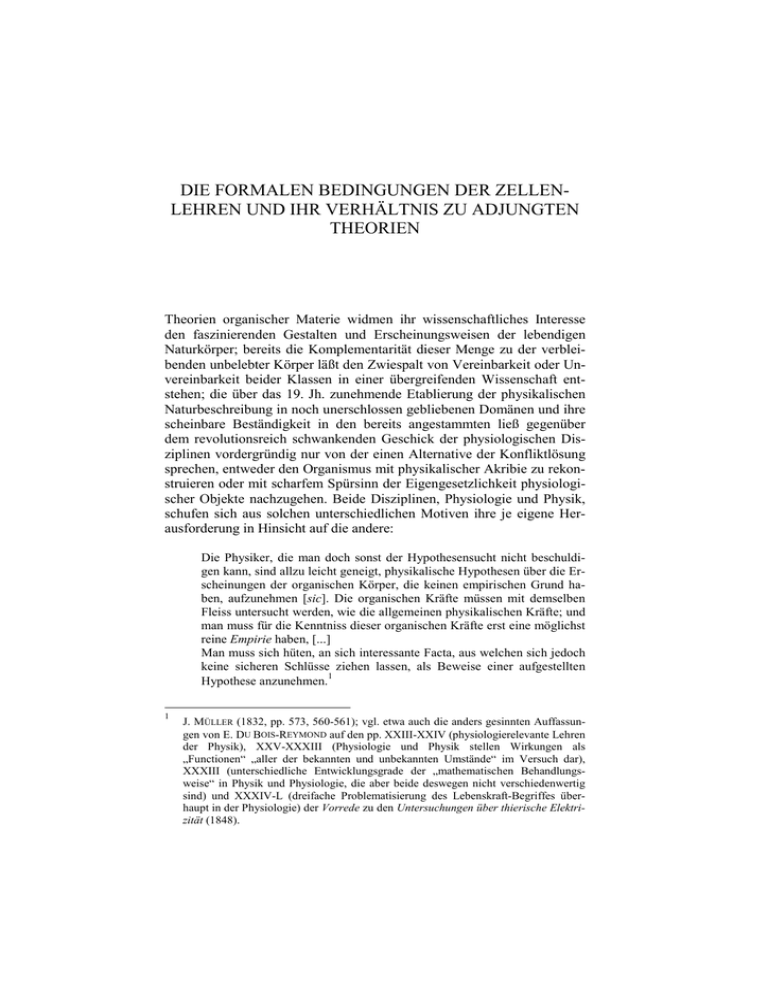
DIE FORMALEN BEDINGUNGEN DER ZELLENLEHREN UND IHR VERHÄLTNIS ZU ADJUNGTEN THEORIEN Theorien organischer Materie widmen ihr wissenschaftliches Interesse den faszinierenden Gestalten und Erscheinungsweisen der lebendigen Naturkörper; bereits die Komplementarität dieser Menge zu der verbleibenden unbelebter Körper läßt den Zwiespalt von Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit beider Klassen in einer übergreifenden Wissenschaft entstehen; die über das 19. Jh. zunehmende Etablierung der physikalischen Naturbeschreibung in noch unerschlossen gebliebenen Domänen und ihre scheinbare Beständigkeit in den bereits angestammten ließ gegenüber dem revolutionsreich schwankenden Geschick der physiologischen Disziplinen vordergründig nur von der einen Alternative der Konfliktlösung sprechen, entweder den Organismus mit physikalischer Akribie zu rekonstruieren oder mit scharfem Spürsinn der Eigengesetzlichkeit physiologischer Objekte nachzugehen. Beide Disziplinen, Physiologie und Physik, schufen sich aus solchen unterschiedlichen Motiven ihre je eigene Herausforderung in Hinsicht auf die andere: Die Physiker, die man doch sonst der Hypothesensucht nicht beschuldigen kann, sind allzu leicht geneigt, physikalische Hypothesen über die Erscheinungen der organischen Körper, die keinen empirischen Grund haben, aufzunehmen [sic]. Die organischen Kräfte müssen mit demselben Fleiss untersucht werden, wie die allgemeinen physikalischen Kräfte; und man muss für die Kenntniss dieser organischen Kräfte erst eine möglichst reine Empirie haben, [...] Man muss sich hüten, an sich interessante Facta, aus welchen sich jedoch keine sicheren Schlüsse ziehen lassen, als Beweise einer aufgestellten 1 Hypothese anzunehmen. 1 J. MÜLLER (1832, pp. 573, 560-561); vgl. etwa auch die anders gesinnten Auffassungen von E. DU BOIS-REYMOND auf den pp. XXIII-XXIV (physiologierelevante Lehren der Physik), XXV-XXXIII (Physiologie und Physik stellen Wirkungen als „Functionen“ „aller der bekannten und unbekannten Umstände“ im Versuch dar), XXXIII (unterschiedliche Entwicklungsgrade der „mathematischen Behandlungsweise“ in Physik und Physiologie, die aber beide deswegen nicht verschiedenwertig sind) und XXXIV-L (dreifache Problematisierung des Lebenskraft-Begriffes überhaupt in der Physiologie) der Vorrede zu den Untersuchungen über thierische Elektrizität (1848). 8 Formale Bedingungen der Zellenlehren In der physikalistischen Denkungsart wurde die Komplexität des Organismus dasjenige, auf welches in immer entschuldigender Geste verwiesen werden konnte, wenn physikalische Prinzipien in der Anwendung am biologischen Objekt nicht den gewünschten Erfolg herbeiführten; in der Physiologie hingegen wurde es der Begriff der Lebenserscheinung, der lebenstypische Phänomene kontrastierend mit den physikalischen der unorganischen Natur hervorheben sollte, aus welcher Abgrenzung sich die physiologische Disziplin wiederum die Berechtigung zu einer eigenen wissenschaftlichen Methodik herleitete; dennoch liebäugelte sie zugleich mit dem hochangesetzten Ruf des Physikalismus, der eine Übertragung auf das eigene Gebiet entgegen allen Sonderheiten der Lebenserscheinungen um so reizvoller machte, so daß sich aus diesen gegenläufigen Tendenzen Zuneigung und Ablehnung zweier Disziplinen wechselweise bedingten. Eine der größten Herausforderungen für Theorien der organischen Materie wurde bereits im Rahmen der anatomischen Zergliederungskünste des 18. Jh. der Hinweis einiger Naturforscher auf die mikroskopisch erschließbare Binnenstruktur von Pflanzen und Tieren und dann – in nicht mehr schleichendem Maße – die Lehre von der Zellstruktur; die Herausforderung der letzteren Lehre wurde im 19. Jh. in fast übersteigerter Weise durchlebt – alleine schon wegen der progredienten Dienlichkeit technischer Randbedingungen (Mikroskopie, Gewebs-Präparation, Mikro-Manipulation). Die Herausforderung bestand darin, den Binnenstrukturen – und besonders denen der Zelle als iterierter Struktur – Funktionen beizuordnen, aus deren Multiplizität die Erscheinungsformen der Organismen derivierbar würden. Seitdem kommt eine Theorie organischer Materie ohne einen mikroskopisch gefaßten Strukturbegriff nicht mehr aus; die Mikrostruktur ist dabei das nächste Beschreibbare am Organismus, welches demjenigen gegenübertritt, was in der Homogenität der einbettenden Substanz untergeht; dieser Mikrokosmos wird im ‚invertierten Teleskop’ der klassischen Zellforschung emporgehoben und auf einer Ebene zur Schau gestellt, in der auch das Komplementäre, das ferne Makroskopische, seinen sinnlichen Niederschlag findet. In der gegenwärtig praktizierten Molekularbiologie sind die Verhältnisse dazu insofern konträr, als durch diese neuere Forschungsmethodik die submikroskopische stoffliche Basis der organischen Materie in das gebänderte Muster der Gelchromatogramme transformiert wird; der zell-strukturelle Aspekt ist viel entschiedener vorausgesetzt und der gesuchte funktionale weit offener. Eine erste Orientierung an der organischen Individualgestalt läßt zuvorderst zwei Strukturbegriffe unterscheidbar werden; die innere Struktur Formale Bedingungen der Zellenlehren 9 der Gestalt und die äußere, von der sie umgeben ist; die Zelltheorie wäre ein Exempel für den ersten, die Evolutionstheorie für den zweiten Fall. Unter Zugrundelegung eines möglichst weitgefaßten Strukturbegriffes wären somit Zell- und Evolutionstheorie in bezug auf die Individualgestalt komplementäre Theorien; denn wesentliche Anteile der Zelltheorie bzw. der Evolutionstheorie befassen sich mit der inneren Struktur des Individuums Zelle bzw. der äußeren, umgebenden Struktur des gewöhnlich verstandenen Organismus in der Erscheinung als Tier oder Pflanze.2 Zusammen mit der regulativ gearteten Auffassung, daß Zellen aus einem inneren Prinzip heraus und daher als Zellindividuen in Wechselwirkung mit äußeren Momenten des organischen Kollektivs eine Metamorphose durchlaufen können, verbindet sich sogar eine formale Übertragbarkeit der Zellenlehre auf die Evolutionstheorie bzw. auf den Widerstreit des Individualprinzips der Variation mit dem kollektiven Prinzip der Selektion; diese Möglichkeit zu einer Transformation beider zunächst komplementärer Lehren ineinander soll in dieser Arbeit jedoch nicht weiter herausgefordert werden; es sollte hier nur der historisch gegebenen Möglichkeit erwähnt werden, daß die Zellenlehre in zweifacher Weise ein gedankliches Experimentierfeld für ihre gleichsam jüngere Schwester hatte bilden können. Eine andere Form der Transformation wird hingegen in 2 Es kann wohl darüber gestritten werden, ob ein weitgefaßter Strukturbegriff nicht besser durch ein Prinzip der Ordnung zu ersetzen wäre; dann könnte unter Umständen eine sehr dynamisch zu begreifende Struktur substituiert werden durch ein ziemlich konstantes Ordnungsmaß, – z.B. die eines Bienenschwarmes durch das ihres höchsten Produktes; denn die diffuse Struktur des Schwarms beinhaltet nur insofern einen hohen Grad an Ordnung, als aus ihr eine neue Struktur hervorgehen kann – wie es bereits ein einfallsreicher Kenner der Metamorphosenlehre gezeichnet hat: Die Pflanze geht von Knoten zu Knoten und schließt zuletzt ab mit der Blüte und dem Samen. In der Tierwelt ist es nicht anders. Die Raupe, der Bandwurm, geht von Knoten zu Knoten und bildet zuletzt einen Kopf; bei den höherstehenden Tieren und Menschen sind es die Wirbelknochen, die sich anfügen und anfügen und mit dem Kopf abschließen, in welchem sich die Kräfte konzentrieren. Was so bei Einzelnen geschieht, geschieht auch bei ganzen Korporationen. Die Bienen, auch eine Reihe von Einzelnheiten, die sich aneinander schließen, bringen als Gesamtheit etwas hervor, das auch den Schluß macht, und als Kopf des Ganzen anzusehen ist, den Bienen-König. Wie dies geschieht ist geheimnisvoll, schwer auszusprechen, aber ich könnte sagen, daß ich darüber meine Gedanken habe. (J. W. GOETHE, Freitag den 13. Februar 1829, in: J. P. ECKERMANN, 1998, p. 326) 10 Formale Bedingungen der Zellenlehren einigen Ansätzen der folgenden Analysen thematisiert werden; sie bezieht sich auf das Verhältnis formaler Elemente der Zellenlehre zu denjenigen der Chromosomentheorie. Diese Reflexionen mögen zudem eine Konfrontation der historisch geschöpften Elemente mit solchen der gegenwärtig praktizierten molekularbiologischen Forschung anregen. Die Lehre von der Zelle ist also aus historischer Sicht primär eine Strukturlehre; diese Entwicklungsrichtung evozierte nachträglich weitere Fragen; einmal wie die Substanz es vollbringe, Strukturen zu bilden, und wie diese Gebilde dann die Erscheinungen bedingen würden, die am Organismus zu Tage treten und den Inhalt des Lebensbegriffes ausmachen. Wie auch immer der Durchlaufungssinn zwischen diesen drei Komponenten bestimmt werden mag – der angebotene von Substanz zu Struktur und Funktion entspricht eher der physiologisch gängigen Denkungsart – , so ist doch zuzugestehen, daß die Zellenlehre mit der Zeit ganz besonders in Abhängigkeit von den Funktionen geriet, die Substanz oder Struktur übernehmen konnten; die wissenschaftliche Arbeit überführte die morphologische Zellenlehre so weit in eine Funktionenlehre, daß in einer Umkehr der früheren Verhältnisse die Funktionen es schließlich sein konnten, von denen die Bestimmungen der Strukturen ausgingen.3 Der Begriff der Funktion ist absichtlich seiner Doppeldeutigkeit wegen gewählt, um nicht sogleich in die Diskussion um mechanistische oder teleologische Kausalität zu verfallen; die Doppeldeutigkeit des Begriffs zeigt sich in der zweifachen Auffassungsweise der übergeordneten Frage nach der Funktion eines organischen Teiles, etwa des Auges; in der direkten Formulierung, wie das Auge funktioniere, läßt sich eine mechanistische Antwort erwarten; dazu wird eine Kausalkette als die gedankliche Verknüpfung sinnlicher Momente errichtet, z.B. der jeweiligen Halbstrahlen des gebrochenen Lichtstrahls durch das Brechungsgesetz. Und in der alternativen direkten Formulierung, welches die Funktion des Auges sei, läßt sich eine teleologische Antwort erwarten, bei der einem irgendwie bereits verstandenen Mechanismus ein Moment der Zweckmäßigkeit beigelegt wird; das Auge diene z.B. der Zubereitung von Wechselwirkungen des Organismus mit der Umwelt für eine effektive Gestaltung des visuellen Sinnes. Nur der Mechanismus ist von seiner sinnlichen Seite einer empirischen Überprüfung zugänglich; nicht der teleologische Gehalt, da selbst ein abweichend errichteter Mechanismus – etwa eine Emanationstheorie des Sehens – den Zweckgedanken nicht aufzuheben braucht. Funktionen zeichnen sich also auch dadurch aus, daß in ihnen die sinnlich erfaßbare Welt überstiegen wird; dieser Hinübergang kann auf 3 Vgl. etwa die weiter unten präsentierte Auffassung von Th. HUXLEY (1853). Formale Bedingungen der Zellenlehren 11 unterschiedlichen Wegen vollzogen werden, – durch den Einsatz spekulativer Gedanken, durch regulative oder konstitutive Hypothesen oder durch eine zweite Art der Beobachtung im Experiment; das Beilegen von Funktionen ist folglich methodenrelativ; die Wahl der Methode liegt im Ermessensbereich menschlichen Handelns und kann sich daher einer ethischen Dimension nicht entziehen. Und noch in einer zweiten Hinsicht tauchen bezüglich des Funktionsbegriffs bioethische Fragestellungen auf, – insofern diese nämlich nach einer Aufklärung des Begriffes vom organischen Leben streben. Organisches Leben zeigt sich seitens der Physiologie entweder unmittelbar in den Lebenserscheinungen oder mittelbar in solchen Funktionen, die zu lebensspezifischen Funktionen erhoben werden können; nur die letzteren bieten eine Erklärung der Lebenserscheinungen organischer Materie und tragen zum Gehalt eines wissenschaftlichen Begriffs des organischen Lebens bei. Die Lebenserscheinungen bemessen sich aber wiederum an der ethisch bestimmten Idee des Lebens; damit ergibt sich die Frage, ob der wissenschaftlich erhaltene Begriff des organischen Lebens den bioethischen Diskurs bereichern kann oder nicht. Der methodenrelative Zusammenhang von Strukturen und Funktionen und der an der Idee des Lebens gemessene von Funktion und Lebenserscheinung werden also jeweils ethischen Anforderungen entsprechend verknüpft; wenn beide Aspekte in der folgenden historisch und analytisch gehaltenen Darlegung der Entwicklungen des Zellbegriffs nicht zur Sprache gebracht werden, dann ist bereits jetzt darauf hinzuweisen, daß durch diese Enthaltsamkeit gerade gezeigt werden soll, unter welchen Gesichtspunkten die Bio- sowie Medizinethik eine Verständigung über den Begriff des organischen Lebens mit den Lebenswissenschaften erreichen können und unter welchen eben nicht; denn dazu bedarf es vorweg eines Verständnisses der forschungsimmanenten Handhabung vitaler Gebilde; diese letztere Weise der Einsicht kann und soll auch nur von einer analytischen Geschichte des Zellbegriffs vermittelt werden. Abschließend wäre der Sichtweise vorzubeugen, daß eine am Zellbegriff orientierte Analyse in ihrer Tragweite selbst für die physiologischen Wissenschaften eine nur restringierte Gültigkeit der Beschreibung und Erfassung dieser Wissenschaft in Anspruch nehmen könne; die gebotene Analyse ist aber nur scheinbar thematisch gebunden, sie ist vielmehr in einem weitergehenden Sinne exemplarisch; denn ihr prinzipieller Gehalt ist auf andere Gebiete der Forschung in den Lebenswissenschaften übertragbar, in denen durchweg morphologische Daten und funktional verstandenes Geschehen eine Verbindung zu Konzepten organischer Materie eingehen.