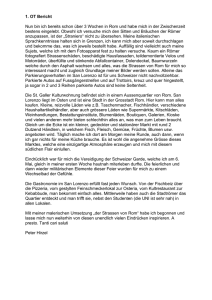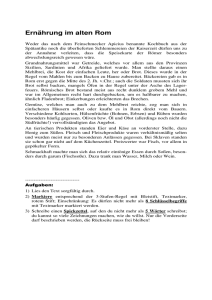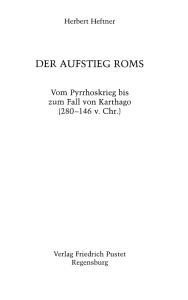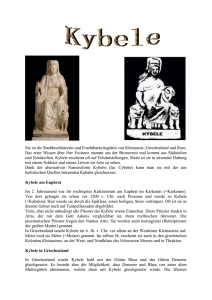Superblocco
Werbung

Seite 16 / Süddeutsche Zeitung Nr. 218 HF2 Dienstag, 22. September 2009 LITERATUR Im Namen des Gemeinwohls Für Ultra-Narzissten Amélie Nothomb sucht Schokolade und findet Zuckerwerk Simone Weils Plädoyer für die Abschaffung der Parteien Wer heute sämtliche politischen Parteien abschaffen wollte, würde rasch totalitärer Neigungen verdächtigt werden. Die Existenz mehrerer Parteien und deren geregelter Wettkampf um die Macht gelten inzwischen als wertvoll an sich. Simone Weil sah dies anders. „Die Demokratie, die Macht der größeren Zahl sind keine Güter“, heißt es in ihrer erstmals 1950, also posthum veröffentlichten „Anmerkung zur generellen Abschaffung der politischen Partei“, die nun auch auf Deutsch vorliegt. Demokratie und Macht der größeren Zahlen seien lediglich „Mittel zum Guten, die zu Recht oder zu Unrecht für wirksam gehalten werden.“ Simone Weil, 1909 in einer liberalen jüdischen Familie in Paris geboren, schrieb die „Anmerkung“ im Londoner Exil, während sie über die politische Nachkriegsordnung Frankreichs nachdachte. Im Namen der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls plädierte sie, wenige Monate vor ihrem frühen Tod im August 1943, gegen Parteien überhaupt. Diese schienen ihr durch drei Merkmale hinreichend charakterisiert: Eine Partei sei erstens „eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft“, als Organisation übe sie zweitens „kollektiven Druck auf das Denken“ ihrer Mitglieder aus; ihr einziger Zweck sei schließlich das eigene, unbegrenzte Wachstum. „Aufgrund dieser drei Merkmale ist jede Partei in Keim und Streben totalitär. Wenn sie es nicht in Wirklichkeit ist, dann nur, weil die anderen Parteien um sie herum es nicht weniger sind als sie.“ Die kurze Schrift ist überreich an solchen sehr klaren, sehr strengen Sätzen. Das ist eine Sprache, die zur Meditation einlädt, nicht zum Gespräch. Ein Gutes kann Weil der Existenz der Parteien nicht abgewinnen. Deren Abschaffung sei legitim und wünschenswert und könne nur gute Wirkungen zeitigen. Parteien zwängen dazu, die Öffentlichkeit, sich selbst und die Partei zu belügen. Sie seien also ein Übel: „Vertraute man die Organisation des öffentlichen Lebens dem Teufel an, er könnte nichts Tückischeres ersinnen.“ Unverzüglich wird man Weil zustimmen wollen, wenn sie darüber spottet, einer sei aufgefordert, den kommunistischen Standpunkt oder den sozialistischen oder den radikalen darzulegen. Wer auf Wahrheit aus ist, sollte sich nicht darum kümmern, ob dies mit einem bestimmten Standpunkt, einer vorgefassten Meinung konform sei. Das informative Nachwort von Thomas Macho und Helen Thein skizziert die politischen Erfahrungen Weils. Dazu gehörte der Spanische Bürgerkrieg, in dem sie die Erfordernisse des Krieges über die Ideale triumphieren sah, zu deren Verteidigung er geführt wurde. Vergleichbares, so glaubte sie, habe sich bereits in Lenins Sowjetrussland ereignet. Die Entwicklung des Gaullismus ließ Ähnliches befürchten. Darauf reagiert ihre melancholische Radikalität. Der heutige Leser sucht unwillkürlich nach einem dritten, einem gangbaren Weg jenseits von unangefochtener Herrschaft der Lüge oder genereller Abschaffung. Ist das politische Leben tatsächlich zur Verlogenheit, zu Gruppenzwang und Hetze verdammt, solange Parteien existieren? In England scheint es anders auszusehen oder doch wenigstens einmal anders gewesen zu sein. Dort, so Weil, eigne den Parteien ein „Element von Spiel, von Sport“ – ein Moment der aristokratischen Tradition und daher nicht übertragbar. Französische Parteien seien dagegen vom Ernst geprägt, wie alle Institutionen mit plebejischer Herkunft. In Deutschland werden die Parteileidenschaften inzwischen durch programmatische Angleichung gemildert, durch das, was man „Sozialdemokratisierung“ nennt. Der gegenwärtige Wahlkampf zeigt vor allem, wie schwer es fällt, politische Emotionen zu wecken, glaubwürdig Propaganda für Parteiinteressen zu betreiben. Zu allgemein ist die Vorliebe für Kompromisse und pragmatische Lösungen geworden, zu häufig scheinen Sachfragen und technokratisches Wissen wichtiger als Doktrin und Standpunkt. Wenn Simone Weils „Anmerkung“ heute dennoch berührt, dann vor allem durch den klaren Duktus, die rousseauistische Leidenschaft fürs Gemeinwohl und den ungeheuren Ernst der Argumentation. JENS BISKY SIMONE WEIL: Anmerkung zur generellen Abschaffung der politischen Parteien. Aus dem Französischen von Esther von der Osten. Diaphanes Verlag, Zürich, Berlin 2009. 60 Seiten, 10 Euro. Alain Claude Sulzer Erhält den Hesse-Literaturpreis Der mit 15 000 Euro dotierte Hermann-Hesse-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer. Der 1953 in Basel geborene Autor erhalte die Auszeichnung für seinen Roman „Privatstunden“, teilte die von der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe betreute Stiftung Hermann Hesse Literaturpreis am Wochenende mit. Mit dem Roman zeige sich Sulzer als „eleganter Stilist und einfühlsamer Psychologe“, hieß es. Er entfalte „diskret, aber sehr eindringlich ein bewegtes Seelendrama, das bis in die feinsten Verästelungen hinein behutsam ausgeleuchtet wird“. Der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis geht in diesem Jahr an den 1978 in Wiesbaden geborenen Autor Christophe Fricker für „Das schöne Auge des Betrachters“. Die Preisübergabe ist für den 26. November in Karlsruhe geplant. dpa Einer der Dioskuren vor dem „Palazzo della Civiltà italiana“ im Stadtviertel EUR in Rom. Das Gebäude wurde von den Architekten Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La Padula und Mario Romano entworfen und zwischen 1938 und 1943 erbaut. Foto: Siephoto / Masterfile Superblocco Hier ging’s mit Furie ans Werk: Franz J. Bauers brillante Geschichte des modernen Rom Die Stadt Rom ist das begehbare Realsymbol der europäischen Kultur. Hier werden ihre Zusammenhänge anschaulich und greifbar wie nirgendwo sonst: der Zusammenklang von heidnisch-antikem Fundament mit christlich-päpstlicher Neugründung und der daraus entspringende unendlich fruchtbare Mechanismus ästhetischer Reprisen und Renaissancen. Für deutsche Rom-Besucher pflegt dieser gigantische Kurs kurz vor dem Zeitalter Goethes zu enden, im Hochbarock mit seinen Kirchen, Plätzen und Brunnen. Der Rest ist Literatur: zahllose Italienische Reisen, die Geschichtsepen von Mommsen und Gregorovius, die Künstlerbiographien von Herman Grimm und Carl Justis „Leben Winckelmanns“. Dabei muss man viel übersehen, denn die Geschichte der Stadt Rom ging weiter. Das größte Bauwerk der Stadt neben dem antiken Colosseum und dem katholischen Petersdom ist ein unchristlicher Altar des Vaterlands. Ihre höchste Erhebung am Gianicolo trägt nicht das Standbild eines Apostels, sondern die Reiterstatue eines modernen Freischärlers, der den Katholizismus verachtete: Giuseppe Garibaldi. Am Sockel darunter liest man eine politische Parole von heidnischer Gewaltsamkeit: Roma o morte – Rom oder der Tod. Das war der Schlachtruf der Italiener, die seit 1848 die Ewige Stadt der erdumspannenden Kirche entwinden und einen bisher ökumenischen Besitz nationalisieren wollten; was ihnen 1870 im Schatten des deutsch-französischen Krieges endlich gelang. Seither ist Rom gleichzeitig die Hauptstadt eines modernen Staates und der Sitz einer Weltreligion, und dies wunderbarerweise ganz friedlich, wenn auch nach einem generationenlangen Konflikt, der erst 1929 mit der gegenseitigen Anerkennung von Vatikanstaat und Italien gelöst werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt regierte längst ein moderner Imperator Italien, der Duce Mussolini, der auch die Stadt Rom ein letztes Mal radikal umbaute, in einem neuheidnischen, gewaltsamen Stil von schillernder Modernität. Der Duce baute Rom ein letztes Mal um, in einem neuheidnischen, gewaltsamen Stil Diesen großen Vorgang, der das Jahrhundert von 1848 bis 1943 umspannt, erzählt in deutscher Sprache zum ersten Mal umfassend der Regensburger Historiker Franz J. Bauer. Sein zupackendes, knappes und doch anschauliches Buch bewältigt souverän den Dreiklang, den dieser Stoff verlangt: Politische Geschichte, Ideologiegeschichte und architektonische Stadtgeschichte müssen in ein Gleichgewicht kommen, das die Wechselbeziehungen sichtbar macht, ohne einen Faktor einseitig zu bevorzugen. Angesichts solcher Schwierigkeit nötigt die Leichthändigkeit von Bauers Synthese Bewunderung ab – eine enorme, hierzulande kaum be- kannte italienische Forschung wird dabei jedem Gebildeten zugänglich. Der Leser erfährt, wie das päpstliche Rom aussah, die scheinbar zeitlose Ruinenkapitale von Religion und Bildung; er sieht, wie in dieses Reservat Alteuropas das Neue einbricht, eine moderne Hauptstadt mit Hof, Parlament und Ministerien. „Man baut mit Furie“, schrieben entnervte deutsche Bildungsreisende, und mancher Bewohner Ostberlins konnte es ihnen in den letzten zwanzig Jahren nachfühlen. Das neue Rom hat zu kämpfen: Alles in der Stadt spricht von glorreicher Vergangenheit, also müssen neue Denkmäler, breite Straßen, große Plätze her, gebauter Liberalismus mit vielen historischen Zitaten. Jetzt wird das hellenistisch-römisch-moderne Monstrum am Kapitol entworfen, in dessen Mitte ein zwergenhafter König über der Stadtgöttin reitet, den stolzen Blick auf die Peterskuppel geheftet. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung von 200 000 auf eine halbe Million Einwohner, die Bauindustrie boomt, Rom bekommt „amerikanische“ Neubauviertel, bald aber münden Finanzkrisen auch in Immobilienpleiten. Trotzdem entwickelt Rom bis 1914 eine moderne Stadtplanung, einen rationalen Wohnungsbau, der sich neben Berlin und Paris nicht verstecken muss. Ja, im Faschismus wird hier eine Alternative zur Stahl-, Beton- und Glasmoderne des Bauhauses entwickelt, die – dem südlichen Klima mit seinen Kühlungsbedürfnissen angepasst – an Stein und Ziegel festhält und heute längst wie- derentdeckt wurde. Doch die faschistische Rom-Ideologie hält sich nicht bei noch so imponierender urbanistischer Bedürfnisbefriedigung für eine weiter wachsende Stadt auf. Sie rasiert mit antiliberaler und antihumanitärer Geste altes Gewinkel zwischen isolierten und ins Heroische vereinsamten Denkmälern der Vorzeit. Die barocken Sichtachsen zwischen den Obelisken bekommen Konkurrenz durch eine breite Prachtstraße zwischen Kapitol und Colosseum für Aufmärsche, Reden und Rituale. In Rom wird der Stil der totalitären Epoche, der bis in Speers Berlin und Stalins Moskau ausstrahlt, mitbegründet. Im monumental modernen Projekt der EUR, des für 1942 geplanten Weltausstellungsviertels an der Straße nach Ostia, mündet der faschistische Gewaltstil in eine unfertige Baustelle, in der dann die leichtlebigeren fünfziger Jahre fast bruchlos weitermachen konnten – in den Filmen Federico Fellinis lässt es sich traumhaft besichtigen. Dieses Buch gehört ins Gepäck jedes Rom-Fahrers, der Zeit für mehr als die üblichen zehn Höhepunkte hat und der seine Aufmerksamkeit nicht nur RenaissancePalästen widmen will, sondern auch der babylonischen Modernität eines „Superblocco“ am Viale Eritrea aus den zwanziger Jahren. GUSTAV SEIBT FRANZ J. BAUER: Rom im 19. und 20. Jahrhundert. Konstruktion eines Mythos. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2009. 352 S., 34,90 Euro. Schlaue Narzissten erkennt man daran, dass sie sich ausgiebig über sich selbst lustig machen. Sie lachen charmant darüber, dass sie sich für bemerkenswert, grandios und gottgleich halten. Das Abgefeimte dieser Camouflagetechnik: Sie glauben, Gelächter hin oder her, trotzdem an ihre gottgleiche Persönlichkeit. Die Selbstironie ist nur ein Präventivschlag, der dem Verlachen durch andere zuvorkommt. Die belgische Autorin Amélie Nothomb ist eine Galionsfigur der Ultra-Narzissten: Seit 1992 schreibt sie einen Bestseller nach dem anderen, und sehr oft geht es in diesen Büchern um monströs-niedliche kleine Mädchen, die sich mit entwaffnender Komik beim Großwerden zuschauen und dabei den Lebenslauf der Amélie Nothomb selbstironisch in Szene setzen. Auch die „Biographie des Hungers“ handelt vom Aufwachsen der kleinen Amélie: Als Diplomatenkind besucht sie in Japan den Kindergarten, geht in China zur Schule, nimmt Ballettunterricht in New York und durchlebt die Pubertät in Bangladesch. Und wie kommt da der Hunger ins Spiel? Die Icherzählerin beschreibt sich als gefräßiges Monster, das nach Süßigkeiten giert und allmählich die Sprache entdeckt. Es „hungert“ und „dürstet“ sie nach Literatur, nach Liebe, nach Alkohol, nach Aufregung, ja, nach dem Leben im Allgemeinen. Ein Ego also, das ständig befüllt und betankt sein will – mit wachsendem Erstaunen nimmt man zur Kenntnis, dass ein derart schlichter Gedanke tatsächlich auf 207 Seiten ausgebreitet wird. Das „Schleckermäulchen“ sucht Schokolade, doch dann wird das Lesen zum „Zuckerwerk für den Geist“. Nach solchen stilistischen Aussetzern und Plattitüden rechnet man mit dem Schlimmsten – mit einer Vokabel wie „Naschkatze“ zum Beispiel (die zwar nicht auftaucht, aber das angestrebte neckisch-verspielte Image auf den Punkt gebracht hätte). Der dauererregte Tonfall komplettiert das Bild der exaltierten Diplomatentochter: „Ich umarmte die Welt bis zum Ersticken“, heißt es, Birma ist zum Zusammenbrechen schön und New York bedeutet „Jubel, Jubel, Jubel“. Da hilft es auch nicht mehr, dass sich die Icherzählerin auf durchaus komische Weise über ihren kindlichen Größenwahn lustig macht. Klar, es geht auch um Alkoholismus und Anorexie, um Probleme also, die bedrohlich unter der Oberfläche des Lebenshungers lauern und der Luxusgöre das Leben schwermachen. Und dennoch ertappt man sich immer häufiger bei niedrigen Wünschen in Nazi-Opa-Manier: Dass dieses Ego wenigstens einmal im Leben richtig Hunger haben müsste. JUTTA PERSON AMÉLIE NOTHOMB: Biographie des Hungers. Roman. Aus dem Französischen von Brigitte Große. Diogenes Verlag, Zürich 2009. 207 Seiten, 18,90 Euro. Kathrin Schmidt Preis der SWR-Bestenliste 2009 Die Schriftstellerin Kathrin Schmidt erhält in diesem Jahr den mit 10 000 Euro dotierten „Preis der SWR-Bestenliste“. Sie wird ausgezeichnet für ihren Roman „Du stirbst nicht“, der im Mai, Juli/ August und September auf der SWR-Bestenliste stand. Kathrin Schmidt wurde 1958 in Gotha/Thüringen geboren. Sie studierte Psychologie und arbeitete als Kinderpsychologin. Seit 1994 ist sie freie Schriftstellerin. Der „Preis der SWR-Bestenliste“ wird seit 1978 jedes Jahr von den Jury-Mitgliedern der SWR-Bestenliste bei einem gemeinsamen Treffen in Baden-Baden vergeben. SZ Die Plötzlichkeit des Blitzlichts In seinem Roman „Lazarus“ verknüpft Aleksandar Hemon das Schicksal eines vermeintlichen Anarchisten in Chicago und den Bosnienkrieg in Europa Am frühen Morgen des 2. März 1908 klingelt ein dürrer junger Mann in abgerissener Kleidung an der Haustür des Polizeipräsidenten Chicagos und wird zunächst abgewiesen. Als er zum zweiten Mal vorstellig wird, hat man sich schon ein Bild von ihm gemacht: Er sieht aus wie ein Anarchist. Er verhält sich wie ein Anarchist. Und wie ein Anarchist wird er vom Polizeichef erschossen. Sein Name ist Lazarus Averbuch. Er ist 19 Jahre alt geworden, und seine Hoffnung, den Pogromen in seiner osteuropäischen Heimat zu entkommen, hat sich nicht erfüllt. Fast ein Jahrhundert später stößt der junge Bosnier Vladimir Brik auf diese Geschichte, die vage Parallelen zu seiner eigenen aufweist. Wie der 1964 in Sarajevo geborene Aleksandar Hemon ist auch sein Protagonist 1992 bei einem USA-Besuch vom Krieg in seiner Heimat überrascht worden und dageblieben. Während sich Hemon dort als Schriftsteller etabliert hat und für diesen Roman höchstes Lob erhielt, steckt sein Held noch in den Vorarbeiten. Der Originaltitel lautet deshalb „The Lazarus Project“ und verschränkt Szenen der an realen Vorkommnissen orientierten Lazarus-Handlung mit einer Gegenwartserzählung, in der Brik sich dank eines Stipendiums in Europa auf die Suche nach Averbuchs Vorgeschichte macht. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Fotografen und begnadeten Geschichtenerzähler Rora, reist er durchs marode Hinterland des alten Kontinents und gerät dabei aus den verblassenden Spuren Averbuchs in die seiner eigenen Herkunft. In Träumen verfließen die Grenzen zwischen Projekt und Projektion, und schließlich wird Rora durch einen dummen Zufall in Sarajevo erschossen. Diese dramatische und unvermittelte Zuspitzung wirkt so, als sei es bei Briks Reise weniger um Lazarus gegangen als um ein Nachholen seines eigenen, bosnischen Schicksals. Der in Amerika mit einer erfolgreichen Neurochirurgin verheiratete Brik läuft mit seiner Europareise nämlich auch vor dem drohenden Scheitern in der Neuen Welt davon. Das Schicksal Averbuchs wird damit zum historischen Beleg für eine Geschichte, die auch AntiIntegrationsroman sein soll. Hemon lässt Parallelen zwischen der Anarchistenhysterie von 1908 und der Islamistenjagd nach dem 11. September 2001 ebenso durchschimmern wie zwischen antijüdischen Pogromen im alten und dem Bosnienkrieg im neuen Europa. Geschickt hat er damit an das schlechte Gewissen eines Amerikas der ausgehenden Bush-Ära appelliert. Gerade der Erfolg seiner Romans in den USA aber belegt, dass es um deren Integrationsfähigkeit so schlecht nicht stehen kann. Der Romanheld Brik erschmeichelt sich ein Stipendium, indem er für die Frau eines Geldgebers den wilden Mann vom Aleksandar Hemon, geboren 1964 in Sarajevo, und Lazarus Averbuch (rechts), der 1908 in Chicago erschossen wurde. Fotos: getty images (links), Knaus Verlag Balkan mimt, während Hemons Lazarusprojekt von der John Simon Guggenheim Foundation und der John D. and Catherine T. MacArthur Foundation gefördert wurde. Entstanden ist auf dieser Basis ein uneinheitliches Werk – eine eher schwache Geschichte getragen von einer starken, garniert mit Signalen postmodernen Erzählens und Kriegsanekdoten Roras. Das Buch beginnt zwar mit der Feststellung: „Zeit und Ort sind die einzigen Dinge, deren ich mir sicher bin“, schreitet nach die- „Plötzlich plärrten alle Radios und Fernseher wieder los, ganze Gebäude erwachten“ ser salvatorischen Klausel aber forsch voran und stützt sich auch auf alte Fotos, die unter anderem den toten Averbuch zeigen. Doch als dem noch lebenden die Tür des Polizeichefs geöffnet wird, folgt der Einschub „(die sicher bedrohlich knarrt)“, was sich am Gartentor noch einmal wiederholt. Man mag das als ironisches Spiel mit der Souveränität des Erzählers verstehen, doch ist es hier deplaziert. In einem Viertel, dessen Häuser „wahre Schlösser“ sind, wäre 1908 wohl nicht nur Averbuch, sondern auch der nachlässige Hausdiener erschossen worden, wenn eine Tür geknarrt hätte. Da winkt jemand mit dem falschen Zaunpfahl. Auch dass in beiden Strängen der Handlung ein Reporter namens Miller auftaucht und dass ein Barkeeper den Namen Bruno Schultz trägt, was trotz des überzähligen „t“ an den Verfas- ser der „Zimtläden“ denken lässt, fällt zwar auf, aber wozu? All das wirkte weniger aufgesetzt, wenn Briks eigene Geschichte diesen Roman tragen würde, aber das gelingt ihr nicht. Was den Bosnienkrieg angeht, so stammen die wichtigsten Beiträge von Rora. Im belagerten Sarajewo, so berichtet er einmal, habe es monatelang keinen Strom gegeben. „Als er wieder kam, brannten plötzlich alle Lichter, die vor Wochen nicht ausgeschaltet worden waren, alle Radios und Fernseher plärrten los, ganze Gebäude erwachten, wurden hell.“ Plötzlich habe man die Stadt „in einem anderen Licht gesehen“, aber nicht das Licht habe sich verändert, sondern Sarajevo sei von den „Hässlichkeiten des Krieges“ entstellt worden: „ausgebrannte Autos wie zerquetschte Kakerlaken, Hunde, die in den Schatten trotteten, Paare, die sich im Dunklen geliebt hatten und plötzlich sahen, wie ausgemergelt ihre Körper waren“. Verglichen damit erscheint Briks eigene Geschichte blass und hätte keinerlei Aufmerksamkeit erregt, hätte Hemon sie nicht auf die Schultern eines Lazarus gestellt, der sich unter dieser Last schwerlich erholen wird. Gesunden wird hingegen Briks rechte Hand, die er sich beim Kontakt mit der postjugoslawischen Wirklichkeit gebrochen hatte: „Die brauchen Sie zum Schreiben“, sagt eine Ärztin mit dem letzten Satz des Romans. So tief kann Tiefsinn sinken. ULRICH BARON ALEKSANDAR HEMON: Lazarus. Roman. Aus dem Amerikanischen von Rudolf Hermstein. Knaus Verlag, München 2009. 352 Seiten, 19,95 Euro.