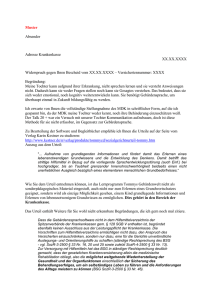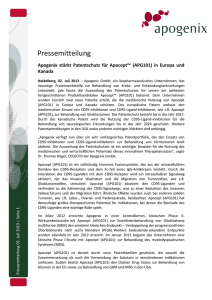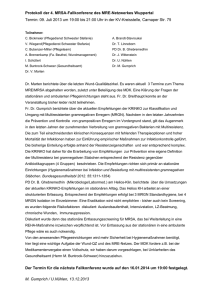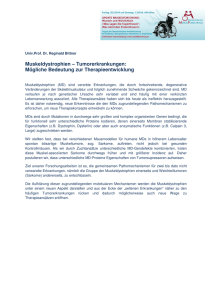MDK-Forum Heft 2/2008
Werbung

Heft 12. Jahrgang Juni 2008 MDK2 Forum Das Magazin der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung In dieser Ausgabe Neues Begutachtungsverfahren zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit Seite 16 Deutliche Verbesserungen für Demenzkranke Seite 19 Patientenschulungen – Jacqueline kriegt keine Luft! Seite 21 Unbestechliche Ärzte – „Mein Essen zahl‘ ich selbst“ Seite 30 MDS mit neuem Träger – Umstieg mit Augenmaß Seite 31 ISSN 1610-5346 Fern und doch so nah? Telemedizin in Deutschland Editorial Liebe Leserinnen und Leser, „Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen … thun kund und fügen hiermit zu wissen“, so begann die Kaiserliche Botschaft am 17. November 1881. Sie wurde verlesen durch Otto von Bismarck im Weißen Saal des Schlosses – „mit ausdrucksvoller Stimme“ wie es in zeitgenössischen Berichten heißt. Damit wurde der Grundstein für das im Mai 1883 verabschiedete und im Juni 1883 verkündete „Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter“ gelegt. Explodierende Bevölkerungszahlen, schwerste Arbeitsbedingungen und schlechte Wohnverhältnisse führten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu massivem sozialen Elend der Arbeiter. Bismarck erkannte die Sprengkraft dieser sozialen Problematik. Aber es war weniger der soziale Fürsorgegedanke als der Versuch, der erstarkenden Sozialdemokratie den politischen Nährboden zu entziehen, der ihn die Krankenversicherung einführen ließ. Seine politischen Mittel waren erst Repression, dann Reform – erst Sozialistengesetze, dann Sozialgesetzgebung. In den 1880er Jahren entstanden die noch heute tragenden Systeme der sozialen Sicherung: Krankenversicherung, Unfallversicherung und Invaliditäts- und Altersversicherung. Zwei Weltkriege, wirtschaftlich schwierigste Zeiten und unzählige Reformen hat das Modell überstanden – und es funktioniert noch immer! Allerdings haben die aktuellen Probleme kaum noch mit denen zu tun, deretwegen die Krankenversicherung vor 125 Jahren eingeführt wurde: Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung im Jahr 2007 von 76,6 Jahren für neugeborene Jungen und 82,1 Jahren für neugeborene Mädchen geht es heute darum, dass jeder Bürger gleichberechtigt vom Know How der Medizin profitieren und an modernen Entwicklungen teilhaben soll. Ein Beispiel für die rasanten Entwicklungsmöglichkeiten ist die Telemedizin, das Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Die Möglichkeiten, die in Diagnostik und Therapie selbst unter Überwindung zeitlicher und räumlicher Distanzen zwischen Ärzten und Patienten durch die Telemedizin bereit stehen, waren noch vor wenigen Jahren unvorstellbar. Die Fragen, die uns heute beschäftigen, lauten daher: Was ist machbar? Was ist sinnvoll und nützt dem Patienten? Und: Was ist bezahlbar? Die Möglichkeiten scheinen beinahe unbegrenzt – die Mittel nicht! Ihr Dr. Ulf Sengebusch MDK-Forum 2/2008 Inhalt 3 Die Gesetzliche Krankenversicherung hat Geburtstag 2 Schwerpunkt Fern und doch so nah? – Telemedizin in Deutschland 3 „Datenschutz nicht über Patientenschutz stellen!“ 6 Interview mit Prof. Dr. Roland Trill Muss die Telemedizin in Zukunft eine größere Rolle in der medizinischen Versorgung spielen? 8 Pro und Contra Telemedizinische Projekte in Deutschland – Drei Beispiele 12 9 Intelligentes Wohnen im Alter Kann eine High-Tech-Wohnung den Umzug ins Pflegeheim ersetzen? 12 Elektronische Krankenakte auf „Google Health“ 13 Telemedizin für Reisende 14 Kranken- und Pflegeversicherung Neues Begutachtungsverfahren zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit 16 PEA-Begutachtungs-Richtlinie tritt zum 1. Juli in Kraft Deutliche Verbesserungen für Demenzkranke 21 Was leisten Patientenschulungen? Jacqueline kriegt keine Luft 19 21 Neue Gefahren durch Online-Spieleplattformen Ambulanz für Spielsucht eröffnet 23 Gesundheits- und Sozialpolitik Gesundheitsreform Jetzt kommt der Fonds erst recht! 28 26 24 Demenz Vorzeigeprojekte in Rheinland-Pfalz 26 Bessere Koordination von Beratung und Betreuung BMG wählt Pilot-Pflegestützpunkte aus Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte „Mein Essen zahl‘ ich selbst“ 28 30 Organisation und Management MDS mit neuem Träger Umstieg mit Augenmaß 31 „Inhaltlich steht der Übergang für Kontinuität“ 32 Interview mit Dieter F. Märtens und Dr. Volker Hansen MDK im Dialog 34 MDK Niedersachsen und MDK Westfalen-Lippe MDK-Fortbildungen zur Palliativ-Versorgung 34 Menschen und Nachrichten Veranstaltungen 1 36 MDK-Forum 2/2008 Die Gesetzliche Krankenversicherung hat Geburtstag V or 125 Jahren, am 31. Mai 1883, wurde das „Gesetz betreffend die Krankenver­ sicherung der Arbeiter“ auf Ini­ tiative des Reichskanzlers Otto von Bismarck im Reichstag ver­ abschiedet. Es legte den Grund­ stein für die große Karriere der Prinzipien Solidarität, Selbst­ verwaltung und Sachleistung, die bis heute weiter wirken. Dieses Gesetz war kluges politisches Kalkül. Kaiser Wilhelm I und sein Reichkanzler wollten verhindern, dass immer mehr Menschen, die unter unzumutbaren Bedingungen in Fabriken arbeiten und in feuchten Wohnungen mehr vegetieren als leben mussten, sich der sozialistischen Bewegung zuwandten. Das Krankengeld wurde die erste und wichtigste Leistung der neuen Pflichtversicherung. Ärztliche Behandlung, Arzneien, Krankenhausbehandlung, Sterbegeld und Unterstützung für Wöchnerinnen kamen wenig später hinzu. Die Beiträge der neu eingeführten Pflichtversicherung wurden zu einem Drittel von den Arbeitgebern und zu zwei Dritteln von den Versicherten finanziert. Kasseneigenes Versorgungs­ angebot 1911 wurde die Reichsversicherungsordnung eingeführt, mit der alle Zweige der Sozialversicherung in einem einheitlichen Gesetzeswerk zusammengeführt wurden. In den 1920er Jahren bauten vor allem die großen Ortskrankenkassen kasseneigene medizinische Versorgungsangebote auf. In ernste finanzielle Schwierigkeiten geriet die Krankenver­ MDK-Forum 2/2008 sicherung ebenso wie die anderen Versicherungszweige mit beginnender Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren. Leistungen wurden eingeschränkt und zusätzliche Gebühren zum Beispiel bei Arzneimitteln erhoben. Wenn Entlassung drohte, war das Krankengeld neben dem Arbeitslosengeld häufig die einzige sichere Einnahmequelle. Viele Arbeiter meldeten sich krank, um wenigstens für ein paar Wochen noch Krankengeld zu erhalten. Die Krankenkassen reagierten mit scharfen Kontrollen. Vertrauensärztlicher Dienst ins Leben gerufen 1930 wurden die Krankenkassen per Gesetz verpflichtet wurden, so genannte Vertrauensärzte einzustellen. In der Rechtsverordnung hieß es, „dass die Kassen verpflichtet sind, die Bescheinigung des behandelnden Arztes über die Arbeitsunfähigkeit und seine Verordnungen, insbeson­ dere soweit sie ärztliche Sach­ leistungen betreffen, in den erforderlichen Fällen durch einen anderen Arzt (Vertrauensarzt) rechtzeitig nachprüfen zu lassen.“ Dies war die Geburtsstunde des Vertrauensärztlichen Dienstes (VÄD). Der VÄD war organisatorisch bei der Rentenversicherung angesiedelt, wurde aber von Krankenversicherung finanziert. Die Kontrolle der Arbeitsunfähigkeit machte den größten Teil seiner Tätigkeit aus. Bis zur Einführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch die Arbeitgeber im Jahr 1969 wurde nahezu jeder dritte Arbeitsunfähigkeitsfall dem VÄD vorgelegt. Entsprechend war das Image des Vertrauensarztes schlecht: Vielen 2 Arbeitnehmern galt er als Kontrolleur und „Gesundschreiber“. Gesundheitsreform 1989: Aus VÄD wird MDK In den 1970er und 1980er Jahren verstärkten sich die Bestrebungen der Krankenkassen, einen medizinischen Beratungs- und Begutachtungsdienst in eigener Trägerschaft zu begründen. Das Gesundheitsreformgesetz, das am 1. Januar 1989 in Kraft trat, brachte den Durchbruch: Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung wurde ins Leben gerufen. Nicht mehr nur Begutachtung, sondern die medizinische Beratung der Krankenkassen und ihrer Verbände sollte im Vordergrund stehen. Die Krankenversicherung ist durch das Fünfte Sozialgesetzbuch aufgefordert, selbst gesundheitspolitisch gestaltend aktiv zu werden. Darin wird sie von ihrem Medizinischen Dienst zum Beispiel durch dessen Mitwirkung in den Arbeitsgremien des gemeinsamen Bundesausschusses oder in den Ausschüssen für Fragen der pflegerischen Versorgung auf Bundes- und Landesebene unterstützt. Die Geschichte der GKV ist bis heute eine Erfolgsstory: Für rund 86 Prozent der Bevölkerung bietet die Gesetzliche Krankenversicherung die Sicherheit, im Krankheitsfall schnelle und umfassende medizinische Unterstützung zu erhalten. Fast 220 Kassen, über 2.000 Kliniken und rund 136.000 Vertragsärzte garantieren eine medizinische Versorgung nach neuestem Stand und auf höchstem Niveau. Herzlichen Glückwunsch, GKV! (se) Schwerpunkt Fern und doch so nah? Telemedizin in Deutschland Von Melanie Volberg T elemedizin hat sich vor allem bei der räumlichen Trennung von Arzt und Patient bewährt. Die Regierungen Eu­ ropas sind überzeugt: Sie wird die Qualität der Versorgung vor allem chronisch Kranker verbessern und die Kosten im Gesundheitssystem senken. Realität oder Illusion? Wo geht die Entwicklung hin? Scotty, Ingenieur von „Raumschiff Enterprise“, wird plötzlich ohnmächtig und atmet kaum noch. Problem: Die Enterprise ist auf Mission im Weltall und Licht­ jahre von der Erde entfernt. Für die Ärzte an Bord aber kein Grund zur Sorge: Nur einmal mit einer Art Scanner über Scottys Körper, die gesammelten Daten an den Computer gefunkt, und schon spuckt der, nachdem er mit den Experten auf der Erde gesprochen hat, die Behandlungsmethode aus. Den Weg zur Weltall-Apotheke kann sich das Raumschiff auch sparen, denn der Computer mixt auch gleich das passende Medikament. In Friedrichshafen wurde auch geprüft, wie Patienten sich fühlen, wenn die Sprechstunde mit dem Kardiologen vor dem heimischen Fernseher stattfindet. Die meisten Patienten fühlen sich zu Hause wohler. „Die private Umgebung wirkt sich positiv auf das Befinden, und damit auf die Genesung der Patienten, aus“, sagt Jäger. Betreuung rund um die Uhr Telemedizinanwendungen gibt es in Deutschland bisher nur ansatzweise. Sie sind noch nicht Teil der Gebührenordnung der Ärzte. Sie müssen in der Regel von den Kliniken selbst finanziert werden, wenn sie nicht im Rahmen von Forschung (Universitätskliniken, Programme der EU oder einzelner Bundesländer) gefördert werden. Diana Schmidt, Professorin im Studiengang Medizinische Informatik an der Hochschule Heilbronn, ist letztes Jahr von einer Forschungsreise zum Vergleich der Telemedizin in Deutschland und den USA zurückgekehrt. Ihre Ergebnisse: In den USA hat Home Telehealth eine 20-jährige Geschichte und ist entsprechend weit entwickelt. Im Gegensatz dazu gab es in Deutschland vor der Jahrtausend­ wende kaum Publikationen zu diesem Thema. Die Episode der Serie aus den 1960er Jahren ist längst keine Science Fiction mehr. Zwar gibt es noch nicht den Super-Scanner, aber medizinische Befunde oder Vitaldaten können heute mittels der Internet- und Telekommunikationstechnik bequem ausgetauscht werden. „Die Telemedizin nimmt uns Arbeit und dem Patienten viel Fahrtund Wartezeit ab“, stellt Detlef Jäger, Kardiologe und Chefarzt am Klinikum Friedrichshafen, zufrieden fest. Das Klinikum testete die Betreuung von Herzpatienten zu Hause per Datenleitung. Medizinische Sensoren am Körper erfassen zum Beispiel rund um die Uhr Herzschlag- und Blutdruckwerte. Ist der Patient außerhalb seiner Wohnung, trägt er ein Empfangs­ gerät. Das kann auch einfach sein bluetooth-fähiges Handy sein. Kommt es zu auffälligen Veränderungen, sendet das Handy eine SMS an ein telemedizinisches Zentrum, einen Arzt oder das Krankenhaus. Die werten die Informationen aus und rufen den Patienten bei Gefahr sofort an. 3 Bei Langzeitanwendungen lässt Patientenmotivation nach An der 20-jährigen Entwicklung der Projekte sehe man, wie lange es dauere, bis ein solches Projekt reif für die klinische Routine ist. Und die Forscherin Schmidt stellte fest, dass die Erfahrungen der USA-Ärzte aus einem Langzeitprojekt, der Behandlung von Mukoviszidose, hochfliegende MDK-Forum 2/2008 Schwerpunkt Pläne auf den Boden der Tatsachen zurückholen: Die Motivation der Patienten ließ nach einem Jahr nach, Messungen blieben aus. Wenn aber die häuslichen Messungen nicht langfristig anhaltend durchgeführt werden, nutzen auch die besten Daten nichts. Eine weitere Erfahrung aus den USA: Die Menge der Daten, die häusliche Messungen erzeugen, ist für die manuelle Auswertung durch vor­ handenes klinisches Personal oft zu groß. Der Sprung in die klinische Routine gelingt nur, wenn die Daten automatisch ausgewertet werden. Telemedizin bei Herzinsuffizienz: Per Messgerät werden Vitaldaten wie EKG-Werte kontinuierlich erfasst und vom Patienten an die Klinik gesendet Auf dem Land oft die Rettung Trotzdem ist die Gesundheitsversorgung zu Hause per Datenübertragung das am schnellsten wachsende Gebiet der Telemedizin in den USA. Die Staaten sind ländlich strukturiert: 32 Menschen leben auf einem Quadratkilometer (Deutschland: 222). Telemedizin ist auch in Deutschland für Patienten auf dem Land oft die Rettung. Die Klinik im westfälischen Balve beispielsweise, einem Ort mit 6.000 Einwohnern, kann sich keine medizinischen Experten für verschiedene Fachgebiete leisten. Sie sendet ihre Befunde an ein kooperierendes Krankenhaus, wo Experten zeitnah ein Feedback geben. „Schnell lebensrettende Entscheidungen treffen“, darin sieht auch Dr. Uwe Engelmann, Wissen­schaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum und Koordinator der jährlich stattfindenden Telemed-Tagung des Berufsverbandes Medizinischer Informatiker, die Vorteile der Telemedizin: „Beim Schlaganfall eines Patienten müssen sie als Arzt sehr schnell die lebensentscheidende Wahl zwischen zwei Behandlungsmethoden treffen. Ist die Ursache eine Blutung oder eine Verstopfung? Bei einer Verstopfung müsste das Blut verdünnt werden. Ist die Ursache aber eine Blutung und man MDK-Forum 2/2008 würde das Blut auch noch verdünnen, kann der Patient sterben.“ Finanzierung der Telemedizin Die Ärzte fordern daher IT-Maß­ nahmen, die ihre Kommunikation untereinander unterstützen; sind aber skeptisch, wenn es um die Behandlung der Patienten geht: „Telematik ist eine Geldvernichtungsmaschine,“ sagt der Hausarzt und Vorstandsmitglied der KV Westfalen-Lippe, Dr. Arnold Greitemeier. Das Geld solle lieber ins Personal gesteckt werden als in Geräte, die vor allem ältere Patienten nicht bedienen können. Und Ärzteverbände betonen, dass Telemedizin das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch nicht ersetzen, sondern nur ergänzen darf. Die Krankenkassen stehen den meisten Telematikprojekten kritisch gegenüber: „Oft fehlt ein klarer Kosten-Nutzen-Nachweis,“ sagt Steffen Hilfer vom AOK-Bundesverband. Bei Home Telehealth sehe er die Gefahr, dass zu viele Daten gesammelt werden, die nicht ausgewertet werden können. „Wichtig ist, dass Prozesse und Inhalte verbessert werden können.“ Handelt es sich dabei aber um Investitionen in die informationstechni- 4 sche Infrastruktur des Krankenhauses, wie beim Beispiel der Röntgenbilder, ist die Krankenkasse gar nicht zuständig. Auch fehle ihm bei vielen Projekten der unmittelbare Patientennutzen, sagt Hilfer. Als positives Beispiel nennt der Kassenvertreter die Betreuung von Herzinsuffizienz-Kranken. Die Patienten schicken ihre Gewichts- und EKG-Werte während der Projektzeit in die Klinik und lernen so, selber mehr auf ihre Gesundheit zu achten. An einem ähnlichen Projekt ist die Techniker Krankenkasse beteiligt. Neue Form des Gesundheitswesen Die Telemedizinoptimisten sehen in der Technik eine Vision: „E-Health wird die Gesellschaft verändern“, ist Reinhold Mainz überzeugt. Der Informatiker beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit der Informationstechnik in der Medizin. Während seiner beruflichen Stationen im Bundes­ gesundheitsministerium und bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat er den Wandel des Begriffes von der Telemedizin zu E-Health beobachtet. „Bei EHealth geht es um eine patienten­ zentrierte Dienstleistung. Das geht über die technische Betrach­ tungsweise hinaus.“ Ein chronisch Schwerpunkt Kranker brauche mehrere Ärzte und Sektoren. Und bei jedem Besuch bei einem neuen Arzt müsse er seine Krankheitsgeschichte neu erzählen und Dokumente durch die Weltgeschichte tragen. Die IT-Systeme zwischen ambulantem und stationärem Sektor sind nicht kompatibel. Die Bundesregierung arbeitet daher daran, mit der Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte und elektronischen Gesundheitsakte sämtliche Gesundheitsinformationen über einen Patienten zu digitalisieren und die Infrastruktur anzupassen. Die integrierte und auf den Patienten ausgerichtete Versorgung könnte wirklich realisiert werden. Die Versorgung des Patienten würde verbessert. Viele Märchen „Im Bereich der Versorgungsverbesserung werden viele Märchen erzählt,“ sagt Achim Jäckel, längjähriger Herausgeber des „Telemedizinführer Deutschland“. Dass zum Zeitpunkt der Behandlung wirklich alle Daten über den Patienten vorliegen, hält er für eine Idealvorstellung. Auch dass mit wenig Aufwand Kosten eingespart werden können, hält er für nicht richtig: Die Beteiligten müssten zum Beispiel geschult werden, der ganze Prozess müsse organisiert werden – solche Kosten werden oft außer Acht gelassen. Auch Mainz gibt zu Bedenken: „Nicht jeder Arzt braucht alle Informationen. Zudem sind zum Beispiel die Operationsberichte für die Krankenkassen geschrieben worden, um die Leistung abzurechnen oder Statistiken anzufertigen. Die ärztlichen Kollegen, die den OP-Bericht schnell auswerten wollen, müssen sich durch für sie unnötige Details quälen und vermissen auf der anderen Seite medizinische Informationen. Der Arzt steht unter Druck, denn er hat neben dem Zeit- auch ein Haftungsproblem. Die Frage ist daher: Wer wählt die richtigen Informationen aus? Der Compu- Telematik: Telematik (zusammengesetzt aus Telekommunikation und Informatik) verknüpft die Technologiebereiche Telekommunikation und Informatik. Sie ist Mittel der Informationsverknüpfung von mindestens zwei EDV-Systemen mit Hilfe eines Telekommunikationssystems, sowie einer speziellen Datenverarbeitung. Telemedizin: Telemedizin ist ein Teilbereich der Telematik im Gesundheitswesen und bezeichnet Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen („asynchron“) Distanz zwischen Arzt und Patienten oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation. E-Health: Was der Kunstbegriff E-Health bzw. E-Gesundheit genau bezeichnet, darüber herrscht bisher keine Einigkeit. Eine gemeinsame Definition fehlt. Entsprechend umfassend angelegt ist daher der Definitionsversuch für den Begriff E-Health von Eysenbach (2001): Er sieht darin nicht nur „eine technische Entwicklung, sondern auch eine [...] (besondere) Denkweise, Einstellung und Verpflichtung zu vernetztem und globalem Denken, um die Gesundheitsversorgung [...] durch den Gebrauch von Informationsund Kommunikationstechnologie zu verbessern“. ter?“ Mainz setzt auf intelligente Software, deren Entwicklung aber seine Zeit bräuchte. Von den skandinavischen Ländern könne man hier durchaus lernen. Deutschland holt auf Diese Einschätzung bestätigen auch die im Mai veröffentlichten Ergebnisse der Europäischen Kommission: Für die Dänen, Schweden, Finnen und mit etwas Abstand die Niederländer sind E-Health Anwendungen selbstverständlich. Der Grund: Es gibt vielfach bereits eine funktionierende Vernetzung zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren, Apotheken und Wohnungen der Patienten. Die Europäische Kommission bescheinigt Deutschland gute Chancen, die Verspätung auf dem Weg ins digitale Zeitalter bald wieder aufzuholen. Der Optimismus begründet sich so: Im Bereich E-Government (Serviceverbesserung der öffentlichen Hand durch Onlinetechnik) habe sich Deutschland gerade letztes Jahr um 30 Prozent gesteigert und liege damit unter den zehn Besten Europas. Alle europäischen 5 Länder stehen unter Druck. Denn Gesundheit wird hier über­ wiegend aus staatlichen Töpfen finanziert und die steigende Lebenserwartung sowie veränderte Haushaltsstrukturen fordern neue Lösungen zum Beispiel in der häuslichen Pflege. Fazit Achim Jäckel meint, dass aus heutiger Sicht von der Telemedizin für Deutschland keine flächendeckende Versorgungsverbesserung erwartet werden kann. Aber Telemedizin könne in einem von Sparzwang und Kostendruck geprägten Gesundheitssystem helfen, die schlimmsten zukünftigen Engpässe in Organisation und Versorgung zu begrenzen. Und Reinhold Mainz weist da­ rauf hin, dass die europäischen Regierungen zunehmend Telematikprojekte mit finanziellen Mitteln fördern. Dies verleihe auch den in der Medizintechnik wettbewerbsstarken deutschen Herstellern Auftrieb. Es sei allerdings ein langer Atem nötig. Melanie Volberg ist freie Journalistin MDK-Forum 2/2008 Schwerpunkt „Datenschutz nicht über Patientenschutz stellen!“ Wachstumsmarkt eHealth – Interview mit Prof. Dr. Roland Trill N eben dem klassischen Ge­ sundheitssektor, zu dem u.a. Dienstleistungen wie ärztliche Behandlung oder häusliche Krankenpflege zählen, spielt auch der so genannte „neue Gesundheitsmarkt“ wirtschaft­ lich eine immer größere Rolle. An der Fachhochschule Flens­ burg arbeitet Prof. Dr. Roland Trill vom Fachgebiet „Kranken­ hausmanagement & eHealth“ schon länger zu diesem Thema. Mit MDK-Forum sprach er über seine Einschätzung des Wachs­ tumsmarktes eHealth in Deutschland. Der Begriff eHealth fasst in diesem Kon­ text den „Einsatz moderner Technologien der Telekommu­ nikation und Informatik im Gesundheitswesen“ zusammen. der Zukunft Partner und nicht „Opfer“ des Gesundheitswesens sein will. Das gewollte PatientEmpowerment verlangt nach Transparenz, was ein gestiegenes Informationsbedürfnis beinhaltet. ? MDK-Forum: Wie definieren Sie in diesem Kontext den Begriff „eHealth“? ! Prof. Roland Trill: Ich möchte eHealth ganz allgemein ? MDK-Forum: Herr Prof. Trill, vor einem Jahr haben Sie die Studie „eHealth in Deutschland – Bestandsaufnahme, Per­ spektiven und Chancen eines Wachstumsmarktes!“ veröffentlicht. Am Ende des Titels steht ein Ausrufezeichen. Warum? ! Prof. Roland Trill: Weil die Herausforderungen des Gesundheitswesens der Zukunft ohne Unterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnologien nicht werden bewältigt werden können. Ein Gesundheitswesen, das vor der Bewährungsprobe steht, eine immer älter werdende Bevölkerung mit sich dynamisch entwickelndem medizinischen Fortschritt zu versorgen, muss ganz einfach auf diese Technologien zurückgreifen, will es Qualität mit Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen. Und vergessen Sie bitte nicht, dass der Patient MDK-Forum 2/2008 Stellenwert von eHealth auch für die kommenden Jahre eindrucksvoll bestätigt. Wenn über 80 Prozent der Leistungsanbieter (und wir haben alle Sektoren abgefragt) eHealth-Applikationen als wichtigen Wettbewerbsfaktor sehen, dann ist das ein beeindruckendes Ergebnis und ein Hinweis auf die Investitionsnotwendigkeiten in den kommenden Jahren. Noch „dramatischer“ scheint mir die Einschätzung hinsichtlich des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass eHealth im globalen Wettbewerb immer wichtiger werden wird. Der Gesund­heitsmarkt ist in allen Industrieländern ein Wachstumsmarkt. Sich hier zu behaupten, wird von großer Bedeutung sein! ? MDK-Forum: Wenn Sie die Entwicklung im internationalen Kontext sehen: Wo steht Deutschland? Prof. Dr. Roland Trill, Fachhochschule Flensburg als den Technologie-Einsatz (IT und KT) in einem vernetzten Gesundheitswesen verstehen, in dem der Bürger – nicht nur in seiner Rolle als Patient – eine aktive Rolle übernimmt. In diesem Sinne ist Telemedizin eine eHealth-Anwendung. ? MDK-Forum: Können Sie die Ergebnisse der Studie und ihren Nutzen für uns kurz umreißen? ! Prof. Roland Trill: Die Studie hat den schon heute hohen 6 ! Prof. Roland Trill: Leider nicht vorn, da wo es hingehört! Mittlerweile gibt es in sehr vielen europäischen Ländern eCardoder Portalprojekte, die weiter sind als unser deutsches Projekt. Gerade der Blick nach Nordeuropa, z.B. nach Dänemark, zeigt, wie es gehen kann. Wir sollten uns davon verabschieden, den Datenschutz über den Patientenschutz zu stellen. Der selbstbewusste Bürger braucht keine Behörde, um seine Daten zu schützen, er kann und will selber entscheiden, wo im Gesundheitssystem seine Daten gespeichert werden und wie sie angewendet werden sollen. In unserer Studie wurde sehr deutlich, dass Schwerpunkt dem Bürger seine Sicherheit in Gesundheitsfragen mehr bedeutet als das abstrakte Gut „Datenschutz“. ? MDK-Forum: Auf welchen Feldern ist die eHealth-Entwicklung am weitesten fortgeschritten? Gibt es Ihrer Erfahrung nach inhaltliche „Mega-Trends“? ! Prof. Roland Trill: Sie erwarten jetzt bitte nicht, dass ich die eCard als Erfolgsmodell einordne. Leider wird dieses Beispiel von Gegnern der eHealthApplikationen dazu verwandt, um die Umsetzbarkeit generell in Frage zu stellen. Dabei wird aber übersehen, dass das wichtigste Element der Entwicklung die Telematikplattform und nicht die eCard ist. Sehr positive Erfahrungen wurden beispielsweise mit der Teleradiologie gemacht. Und durch telemedizinische Unterstützung konnten auch bei der Betreuung im Bereich der Kardiologie große Fortschritte erzielt werden. Fortschritte, die dem Patienten dienen (z.B. seine Überlebenswahrscheinlichkeit verbessern), aber auch die Wirtschaftlichkeit der Versorgung positiv verändert haben. Qualität und Wirtschaftlichkeit gegeneinander auszuspielen ist beliebt, geht aber an der Sache vorbei! Die Zukunft wird den Patienten­und Gesundheitsakten gehören, die eine arztmoderiert, die andere bürgermoderiert. Die ersten Erfahrungen mit der elektronischen Fallakte machen Mut, diesen Weg konsequent weiter zu gehen. Beeindruckend finde ich, dass das Projekt von Krankenhäusern angestoßen wurde! ? MDK-Forum: Sie bezeichnen die Studie als Hilfe für Entscheidungsträger im Gesundheitswesen. Wozu wurden die Erkenntnisse bisher verwandt? ! Prof. Roland Trill: Unsere Studie kursiert bei fast allen Technologieanbietern, erlaubt sie doch eine Abschätzung der Entwicklung des Marktpotenzials, nicht nur global, sondern auch auf einzelne Anwendungen bezogen. Interessant ist auch, dass sich die Kostenträger besonders für technologische Verfahren interessieren. In ihnen sehe ich persönlich wichtige Anwender in den kommenden Jahren. Und nicht zuletzt hat uns die Studie in den Planungen bestätigt, einen Masterstudiengang „eHealth“ an unserer Hochschule zu implementieren. Obwohl noch kein Absolvent „auf dem Markt“ ist, nehmen die Stellenangebote kein Ende. Der nächste Durchgang beginnt übrigens in Herbst 2008. ? MDK-Forum: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Grenzen telemedizinischer Anwendungen? ! Prof. Roland Trill: Technologisch sehe ich kaum Grenzen. Wir haben ja bereits alle notwendigen Basistechnologien. Neben dem Datenschutz bleiben noch zwei Punkte: die Finanzierung und die Grenzen in den Köpfen der Entscheidungsträger. eHealth muss natürlich finanzierbar sein und ich habe keine Bedenken, dass geeignete Business-Modelle entwickelt werden können. Sie müssen Eingang in die Finanzierungssysteme finden, auch indem mehr Wettbewerb zugelassen wird. Und der Einsicht, dass „eHealth einen Wettbewerbsfaktor“ darstellt, müssen vermehrt auch Taten folgen. Den Mutigen, den Vorreitern soll dann aber auch die Zukunft gehören. Diese Forderung muss dann gegebenenfalls auch gegen die Verbände durchgesetzt werden. ? MDK-Forum: Was wünschen Sie – als Befürworter moderner Technologien und Projekte im Gesundheitswesen – sich für die kommenden fünf Jahre? ! Prof. Roland Trill: Unser Gesundheitssystem ist bereits jetzt und in Zukunft abhängig von intelligenten eHealth-Lösungen. 7 Es muss uns gelingen, zukünftig mehr ältere Menschen länger in ihren Haushalten medizinisch zu versorgen. Wir müssen es schaffen, auch in der Fläche (z.B. auf den Inseln) eine hochwertige medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten. Ich verspreche mir von den Kostenträgern Anreize, um eHealthLösungen auch in die Regelversorgung zu übernehmen. Ich erwarte, dass sich zunehmend der Druck der Bürger erhöht, aktiver am Gesundheitswesen teilzunehmen. Auch hier sind die Kostenträger mit ihren Überlegungen oft schon viel weiter als viele Leistungsanbieter. Ich bin überzeugt, dass das Jahrzehnt der eHealth-Anwendungen erst noch beginnen wird. Alle Beteiligten sollten versuchen, ihre nur die Partikularinteressen sehenden Brillen abzulegen und an einem Gesundheitswesen zu arbeiten, das Technologien dort einsetzt, wo sie zum Wohle der Bürger heute und zukünftig notwendig sein werden. Die Fragen stellte Andrea Steidle, MDS Zur Person Prof. Dr. Roland Trill Fachhochschule Flensburg University of Applied Sciences Fachgebiet „Krankenhausmanagement & eHealth“ Kanzleistraße 91-93 24943 Flensburg Tel: 0461 / 805 1473 E-Mail: [email protected] www.wi.fh-flensburg.de/rolandtrill.html www.fh-flensburg.de/eHealth Die Studie „eHealth in Deutschland“ (Hrsg.: Fachhochschule Flensburg und GEMINI Executive Search) kann in der 2. Auflage bei Prof. Trill angefordert werden. MDK-Forum 2/2008 Schwerpunkt Muss die Telemedizin in Zukunft eine größere Rolle in der medizinischen Versorgung spielen? JJa Nein , meint Dr. Heinrich Audebert, Consultant Stroke Neurologist am St. Thomas Hospital in London. Bis 2006 leitete er das TEMPiS-Netz­ werk (Telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung) am Klinikum Harlaching in München. , ist Martin Grauduszus überzeugt. Der Facharzt für Allgemeinmedizin und Sport­ medizin mit Praxis in Erkrath bei Düsseldorf steht seit Juni 2005 an der Spitze der Freien Ärzteschaft. Speziell in der Prävention, der Notfallbehandlung, der Rehabilitation bis hin zu „ferngesteuerten“ Operationen wurden telemedizinische Verfahren in den vergangenen Jahren evaluiert. Bewährt haben sich vor allem jene Anwendungen, bei denen die Übermittlung entscheidender Untersuchungsparameter einfach und ohne Zeitverzögerung zu relevanten Therapieentscheidungen führt. Dies gilt z. B. beim Telemonitoring von Herzfrequenz und Körpergewicht bei herzinsuffizienten Patienten. Medizin ist heute ohne moderne Technologien nicht mehr vorstellbar. Die zeitnahe Übermittlung von Informationen durch Telemedizin ist technisch möglich und wird deshalb auch immer mehr Einzug in den Alltag halten. Aber: Eine zentrale Rolle wird sie dabei nicht spielen können. Im Mittelpunkt ärztlicher Behandlung steht immer der Mensch als Individuum, und er muss ganzheitlich betrachtet werden. Das setzt in aller Regel einen direkten Kontakt am selben Ort zwischen Arzt und Patient voraus. Telemedizin wird häufig als unpersönliche Fernsteuerung der Patientenbehandlung interpretiert. Gerade die persönliche Beziehungsbildung lässt sich jedoch durch die moderne Videotechnologie wesentlich besser fördern als nur durch das Telefon. Telefonische Therapieanweisungen ohne persönliche Untersuchung werden von jeher zu Recht kritisch betrachtet und sind meist nur bei persönlicher Kenntnis des Patienten möglich. Die Übermittlung von Bildern, Befunden und weiteren Informationen kann deshalb nur ein unterstützendes Element im gesamttherapeutischen Kontext sein – mehr aber auch nicht! Telemedizin macht spezialisiertes Fachwissen auch in unterversorgten Regionen verfügbar. Nachdem die Erwartungen an medizinische Expertise immer höher werden, Spezialwissen aber nicht überall und immer vorgehalten werden kann, wird der Stellenwert der Telemedizin in Zukunft noch zunehmen. Drei wesentliche Vorzüge sind aus meiner Sicht: • Telemedizin macht Spezialwissen leichter verfügbar • ermöglicht Therapieentscheidungen ohne Zeit verzug • kann als Kommunikations- und Qualitäts sicherungsinstrument verwendet werden Unterschätzt wird vielfach die belastende Seite von Telemedizin: Denn was zunächst faszinierend klingt, kann auch weitreichende negative Konsequenzen haben. Bei einem Patienten, der kontinuierlich überwacht wird, kann der Leidensdruck so stark werden, dass dieser krank macht. Es ist bekannt, dass Patienten, die einen ICD-Schrittmacher tragen, häufig an der Überwachung durch das Gerät leiden. Für die kommenden Jahre ist vor allem wünschenswert, dass die Telemedizin in abgestimmte, evidenz­basierte Behandlungs­konzepte integriert wird, dass es Maßnahmen der Qualitätssicherung für telemedizinische Prozesse und EffektivitätsNachweise für jeden Indikationsbereich gibt. Moderne Technologien werden heute bisweilen zum Selbstzweck und der tatsächliche Nutzen für Patienten bleibt gering. Deshalb ist der Nachweis einer deutlichen Verbesserung der Behandlungsbzw. Ergebnisqualität zwingende Voraussetzung für die Anwendung von Telemedizin. MDK-Forum 2/2008 8 Schwerpunkt Telemedizinische Projekte in Deutschland – Drei Beispiele Von Andrea Steidle K rankheiten wie Diabetes, Herzinsuffizienz oder Glau­ kom überwachen, gesundheit­ liche Auffälligkeiten frühzeitig diagnostizieren oder Schlag­ anfallpatienten gezielt helfen: Telemedizinische Projekte sind vielfältig motiviert und werden auf verschiedensten medizini­ schen Feldern praktisch erprobt. Drei der jüngsten Projekte wollen wir Ihnen hier vorstellen. Projekt „HerzAs“ Mehr Selbstverantwortung durch Kontrolle Dr. Heinrich Körtke vom Institut für Angewandte Telemedizin (IFAT). „Durch unser Projekt sollen die Patienten lernen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen“, erklärte Dr. Körtke auf einer Tagung des Zentrums für Telematik im Gesundheitswesen GmbH (ZTG) am 27. Mai in Düsseldorf. „Die Maßnahmen helfen dabei, sich zum Manager der eigenen Gesundheit zu qualifizieren“. Das IFAT steht den Patienten mit seinen 35 Mitarbeitern, zu denen auch elf Ärzte zählen, dabei rund um die Uhr zur Verfügung. Institut für Angewandte Telemedizin wertet Daten aus Mobil und überwacht: Patientin mit Meßgerät Für Patienten mit Herzinsuffi­ zienz bietet beispielsweise im Bundesland Nordrhein-Westfalen seit Anfang des Jahres das Projekt „HerzAs“ gezielte telemedizinische Unterstützung. Hinter „HerzAs“ stehen die AOK Westfalen-Lippe, der Bundesverband Nieder­gelasse­ner Kardiologen (BNK), der Landesverband Praxisnetze Westfalen-Lippe (LPWL) und das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen. Am Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen arbeitet auch Doch wie genau funktioniert das Projekt „HerzAs“? Freiwillige Teilnehmer mit nachgewiesener Herzinsuffizienz werden eingangs ausführlich geschult und beraten. „Sie werden zunächst über Ernährung, Bluthochdruck und über Maßnahmen zur Rauch­ entwöhnung informiert“, so Dr. Körtke. Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmer Geräte zur täglichen Übermittlung von Daten wie Gewicht, Blutdruck und EKG, die vom IFAT ausgewertet werden. Gibt es auffällige Abweichungen bei den Ergebnissen oder weiteren Klärungsbedarf, so setzt sich ein betreuender 9 Arzt oder Kardiologe ohne Zeitverluste mit dem Betroffenen in Verbindung. Vorteile für die Patienten: Die engmaschigen Messungen, begleitet von regelmäßigen Telefonaten mit den Betreuern, geben den Herzkranken deutlich mehr Sicherheit. Durch die gezielte Eingangsschulung und den Umgang mit den Messergebnissen lernen sie im Laufe der Zeit ihren Körper bzw. das individuelle Krankheitsbild besser kennen und Symptome und Entwicklungen besser einzuschätzen. Langfristiges Ziel der AOK ist es auch, dass die Zahl der Selbsteinweisungen ins Krankenhaus durch „Herz­ As“ nachweislich sinkt. Enge Zusammenarbeit von Kardiologen und Hausärzten Insgesamt dauert das Projekt jeweils zwölf Monate. Im Verlauf dieses Zeitraums gehen die Patienten mindestens viermal zur Kontrolle zum Hausarzt und dreimal zu einem Kardiologen. Von Jahresbeginn bis Ende Mai hatten sich bereits rund 100 Versicherte für „HerzAs“ eingeschrieben, Tendenz steigend. Auf der Mediziner-Seite nehmen 90 Kardiologen und 26 Hausärzte, die eng zusammen arbeiten, am Projekt teil. MDK-Forum 2/2008 Schwerpunkt „Teleaugendienst GmbH“ hilft Patienten mit Glaukom (Grüner Star) Mit einem Selbsttonometriesystem können Patienten mit Grünem Star Messwerte, wie den Augeninnendruck, zu Hause selbst ermitteln und versenden Im vergleichsweise dünn besiedelten Mecklenburg-Vorpommern spielt die räumliche Distanz zwischen Arzt und Patient und deren Überwindung eine ganz besondere Rolle. Daher gibt es im Nordosten der Re­ publik auch relativ viele telemedi­ zi­nische Ansätze zur Behandlung und Betreuung der immer älteren Versicherten. Außerdem war ecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland, das gemäß dem telemedizinischen Motto „Bewege die Daten, nicht den Patienten“ ein dezentrales digitales Mammographie-Screening eingeführt hat. Mit der telemedizinischen Überwachung von Glaukompatienten (Teletonometrie) befasst sich ein bereits 2004 gestartetes Forschungsprojekt an der Universitäts-Augenklinik Greifswald unter der Leitung von Prof. Dr. Frank Tost (Leitender Oberarzt). In seinem siebenköpfigen interdisziplinären Team arbeiten Informatiker, Augenärzte, Physiker und Gesundheitsökonomen zusammen. Vertrag zur Integrierten Versorgung mit TK Im Jahr 2006 wurde das Projekt, an dem bislang rund 170 Patienten teilnahmen, im Rahmen des 29. Deutschen Hausärztetages in Potsdam mit dem Richard- MDK-Forum 2/2008 Merten-Preis zur Förderung der Qualitätssicherung in der Medizin ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde mit der Techniker Krankenkasse ein Vertrag zur Integrierten Versorgung abgeschlossen. Im Bereich der Augenheil-­ kunde ist das medizinische Angebot der inzwischen von der Universität ausgegründeten „Teleaugendienst GmbH“ somit einzigartig in ganz Deutschland. Ziele bei der Vorsorge von Patienten mit einer Glaukomerkrankung sind eine rechtzeitige Diagnose und ausreichende Behandlung. Von besonderer Bedeutung ist dabei unter anderem die Bestimmung eines Zielwertes für den Augeninnendruck sowie die Berechnung des okulären Perfusionsdruckes (OPD). Dieser wird aus Blutdruck und Augeninnendruck errechnet. Der okuläre Perfusionsdruck ist ein wichtiger Prognosefaktor für den Erkrankungsverlauf, der sich zur Beurteilung der Augendurchblutung eignet. Rico Großjohann, Geschäftsführer der Teleaugendienst GmbH, erklärt, wie Interessenten zum Teletonometrie-Angebot kommen: „Normalerweise überweisen Augenärzte ihre GlaukomPatienten an unsere Klinik. In einer Folgeuntersuchung ermitteln wir dann auch, ob sich der 10 Patient auch wirklich für die Teilnahme an unserem Angebot eignet“, so Physiker Großjohann. Falls ja, so erhält der potenzielle Teilnehmer ein e-learning-Modul mit Software (lesbar am PC oder Handy), das die Hintergründe zum Einsatz des Messgerätes erklärt. Den konkreten Umgang mit dem Selbsttonometriesystem erlernen die teilnehmenden Patienten dann jedoch unter fachlicher Anleitung. Messwerte werden telefonisch übertragen Im Anschluss daran steht dem praktischen Einsatz der Messung und des telemetrischen Übertragungssystems nichts mehr im Weg. „Die Messwerte werden von den Patienten selbst ermittelt und von zu Hause in die Arztpraxis und in die Klinik gesendet“, so Großjohann. Alle automatisch gespeicherten Messwerte werden verschlüsselt durch den Patienten per Knopfdruck über Telefon in ein Kon­ trollzentrum übertragen. Im Bedarfsfall wird so eine sofortige Rückmeldung an den Patienten und seinen Augenarzt gewährleistet. „Auf diese Weise können Patienten nicht nur den Augeninnendruck, sondern auch ihren Blutdruck und ihren Blutzucker selbst kontrollieren. In Ergänzung zum Arztbesuch können Messwerte sowohl zu beliebig gewählten Zeitpunkten als auch im vorgegebenen Tagesverlauf erfasst werden“, erläutert Großjohann. Die Messwerte werden automatisch in eine speziell entwickelte elektronische Patientenakte (EPA) eingetragen. Durch die verschlüsselte elektronische Patientenakte bleibt der Versicherte stets Herr seiner Daten und entscheidet selbst, wer Einblick in seine Daten hat. Schwerpunkt Projekt ASTER will Akutversorgung von Schlaganfallpatienten optimieren Noch in der Aufbauphase befindet sich das Projekt ASTER (Akut-Schlaganfall-VersorgungTelemedizin im Rettungswagen) in Sachsen-Anhalt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der „Initiative Unternehmen Region“ gefördert wird. Durchgeführt wird ASTER von Innomed e.V., einem „Netzwerk für Neuromedizintechnik“, und dem Lehr­ stuhl für Medizinische Telematik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. In Deutschland ereignet sich alle drei Minuten ein Schlaganfall, und etwa jeder dritte Betroffene stirbt an den Folgen. Ein weiteres Drittel überlebt mit schweren Behinderungen. Der Schlag kann jeden treffen, tritt jedoch am häufigsten im Alter auf. Aufgrund der demographischen Entwicklung rechnet man mit direkten Behandlungskosten von über 100 Milliarden Euro in Deutschland in den nächsten zwei Dekaden. Gerade bei Schlaganfällen zählt – mehr als bei manch anderem medizini- schen Notfall – die erste Behandlungsphase nach Eintritt der Symptome. Für die häufigste Schlaganfallart gibt es eine sehr effektive, aber risikoreiche Therapie – die Thrombolyse (Auflösung eines Blutpfropfes). Da hierbei die Blutgerinnung maximal gehemmt wird, kann es zu Blutungs­komplikationen kommen. Die Thrombolyse kann jedoch nur innerhalb von drei Stunden nach Symptombeginn von erfahrenen Ärzten durchgeführt werden. Dazu ist zunächst eine Computertomographie des Kopfes und eine Begutachtung durch eine Schlaganfallspezialeinheit (Stroke Unit) nötig. Einsatzmöglichkeiten „Präklinischer Telemedizin“ Das Projekt ASTER will so früh wie möglich ansetzen und die Schlaganfallversorgung innerhalb der Rettungskette optimieren. Dazu gehört, dass der Rettungsdienst die Krankheit zuverlässig erkennt, eine geeignete Klinik auswählt und diese frühzeitig in das Rettungsszenario einbindet. Langfristig soll so die Schlaganfallversorgung, vor allem im medizinisch nicht flächendeckend gut versorgten Bundesland Sach­ sen-Anhalt deutlich verbessert werden. Entwicklung von Szenarien und Konzepten ASTER untersucht dazu die Telemedizin-Technologie „Intelligenter Rettungswagen“ und entwickelt gemeinsam mit Notfall­versorgern, Ärzten und Kranken­kassen geeignete Szena­ rien und Konzepte. Konkret will ASTER • ein überregionales Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Notfallver­ sorgern, Krankenkassen, Ärzte­kammern und Kliniken initiieren, • Innovationspotenziale aufzeigen und neue Konzepte für innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln, • eine Informations- und Kommunikationsplattform entwickeln. Bisheriger Höhepunkt des Projektes war ein Innovationsforum in Magdeburg Mitte Februar, an dem über 100 Fachbesucher teilnahmen. Dort wurde vor allem der Ansatz der „Präklinischen Telemedizin“ diskutiert, also der gezielte Einsatz telemedizinischer Geräte noch vor einem Klinik­ aufenthalt. Weitere Informationen unter: www.telestroke.net/aster Mit dem „Intelligentem Rettungswagen“ soll die Schlaganfallversorgung innerhalb der Rettungskette optimiert werden 11 Andrea Steidle ist Mitarbeiterin im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim MDS E-Mail: [email protected] MDK-Forum 2/2008 Schwerpunkt Intelligentes Wohnen im Alter Kann eine High-Tech-Wohnung den Umzug ins Pflegeheim ersetzen? Von Friederike Geisler G erne gibt man es nicht zu, aber irgendwann erreicht jeder einmal das Alter, in dem einfach nicht mehr alles mög­ lich ist. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man den Fern­ seher immer lauter stellt oder es plötzlich nicht mehr so ein­ fach ist, aus seinem Lieblings­ sessel aufzustehen. Wenn sich diese Einschränkungen häufen oder stärker werden, ist es an der Zeit, über Hilfe nachzu­ denken – eventuell sogar einen Umzug ins Pflegeheim zu erwä­ gen. Dieser Schritt fällt vielen nicht leicht – und ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Das Informatik-Institut OFFIS in Oldenburg hat eine senio­ rengerechte „High-Tech-Woh­ nung“ entwickelt, die es Allein­ stehenden möglich machen soll, in ihren eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben. Eine Wohnung voller Technik Auf den ersten Blick wird man von der ganzen Technik und EDV förmlich erschlagen. Zur Veranschaulichung haben die Mitarbeiter von OFFIS (Oldenburger Forschungs- und Ent- Nahezu alle elektronischen Geräte können per Touch-Screen gesteuert werden MDK-Forum 2/2008 Bildschirme, Kameras und eine Menge EDV zeichnen das Bild der DemoWohnung beim Informatikinstitut OFFIS in Oldenburg wicklungsinstitut für InformatikWerkzeuge und -Systeme) einen Prototyp der Spezial-Wohnung in ihrem Institut eingerichtet. „Hier haben wir natürlich alles installiert, was möglich ist. So viel Technik würde es in einer realen Wohnung nicht geben“, erklärt OFFIS-Bereichsleiter Jochen Meyer. Wenn man die Wohnung betritt, empfängt den Bewohner ein Bildschirm, auf dem der Grundriss abgebildet ist. „Von hier aus kann man fast alle elektronischen Elemente bedienen“, sagt Meyer und schaltet per Touch-Screen verschiedene Lampen in der Wohnung an. Diese Art der Überwachung bietet Sicherheit – unter anderem zeigt das System an, ob Herdplatten in der Küche eingeschaltet sind. Und weil man sogar einen Zugang per Internet hat, kann man auch von unterwegs prüfen, 12 welche Geräte in der Wohnung eingeschaltet sind – und sie sogar ausschalten. Diese Funktion könnte zum Beispiel für Angehörige oder Pflegefachkräfte interessant sein. Fernseher mit Hörgerät Auch über den Fernsehapparat kann der Bewohner auf das System zugreifen. Dabei handelt es sich natürlich nicht um einen Standard-Fernseher, sondern um ein spezielles Gerät für Hörgeschädigte. Durch eine außergewöhnliche Technologie muss der Zuschauer beim Fernsehen das Hörgerät nicht tragen – der Fernseher wandelt den Ton so um, dass auch Schwerhörige einwandfrei hören können. „Diese Unterstützung ist für den Nutzer sehr angenehm“, meint Meyer, „weil es eine alltägliche Tätigkeit Schwerpunkt wieder erlebbar macht, ohne für den Bewohner einen zusätzlichen Aufwand darzustellen.“ Genau hier liegt ein Problem der HighTech-Wohnung. „Bei vielen der speziellen Anfertigungen fühlen sich die Benutzer stigmatisiert. Der Bewohner der Wohnung hat zum Beispiel die Möglichkeit einen Notfall-Knopf bei sich zu tragen. Da man ihn sich um den Hals hängt – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist das für viele sehr unangenehm. Man hat den Eindruck als würde man ein Schild tragen, auf dem steht: Seht her, ich bin hilflos“, sagt Meyer. Ein intelligentes Fahrrad Für die körperliche Fitness haben sich die Informatiker auch etwas einfallen lassen: Ein TrainingsFahrrad mit spezieller EDV. Vor dem Training muss der Patient einige Fragen beantworten. Wie ist der aktuelle Gesundheitszu- stand? Wie intensiv soll trainiert werden? Während des Fahrens messen Puls- und Blutdrucksensoren den Zustand des Patienten. Auf diese Weise hat er einen Überblick über seinen TrainingsVerlauf. Auch der behandelnde Arzt kann – zum Beispiel bei Patienten mit Herzinfarkt-Risiko – die Daten einsehen und damit die Behandlung optimieren. Nicht alles ist sinnvoll Zur Entwicklung der Wohnung haben die Informatiker verschiedene Experten aus den Bereichen Medizin und Pflege herangezogen, die auch die Handhabung der Wohnung prüften. „Dabei sind natürlich auch Schwierigkeiten aufgetaucht“, sagt Meyer. „Zum Beispiel stellt der Teppich, unter dem Drucksensoren angebracht sind, die einen Sturz registrieren können, eine Stolperfalle dar, die selbst zum Sturz führen kann.“ Ließe man die eigene Wohnung mit den Entwicklungen von OFFIS aufrüsten, würde jeder Fall individuell betrachtet. „Nicht jede Anfertigung ist für jeden Bewohner sinnvoll, das ist einmal altersabhängig und richtet sich auch nach dem Krankheitsbild des Nutzers“, sagt Meyer. Bis die Spezial-Entwicklungen in eine richtige Wohnung installiert werden, kann es noch eine Weile dauern: „Ein entscheidender Faktor ist dabei das Finanzielle. Zunächst müsste geklärt werden, ob Kostenträger einen Teil des Umbaus übernehmen.“ Weitere Informationen unter: www.offis.de Friederike Geisler ist Mitarbeiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation beim MDK Niedersachsen E-Mail: [email protected] Elektronische Krankenakte auf „Google Health“ Das Internet macht‘s möglich: Nachdem man im World Wide Web Überweisungen tätigen, sein gesamtes Hab und Gut versteigern und den Partner fürs Leben finden kann, bietet der Provider Google nun eine elektronische Krankenakte an, die jeder selbst bearbeiten und nach Belieben für andere freigeben kann. Das Gesundheitsportal „Google Health“ bietet den Nutzern (zunächst nur in den USA) eine kostenlose Plattform für die eigenen medizinischen Daten. Die ersten Nutzer waren die Patienten der Cleveland Clinic. Die behandeln­ den Ärzte haben die Daten – mit dem Einverständnis der Patienten – online gestellt. Nun können alle US-Amerikaner das Portal nutzen, um ihre Daten einzustellen. Dabei hat zunächst nur der Patient selbst das Recht, die Informationen einzusehen und zu bearbeiten, er entscheidet selbst, ob er auch anderen den Zugriff gewähren will. Die Vorteile sind klar: Der Nutzer hat einen besseren Überblick über seine Krankengeschichte und wird an Termine, Impfungen oder die Einhaltung von Diäten erinnert. Der Arzt weiß, welche Behandlungen vorgenommen wurden und welche Medikamente der Patient einnimmt, um Wechselwirkungen zu verhindern. Wie mit allen Daten, die man im Internet preisgibt, sollte man jedoch auch mit „Google Health“ vorsichtig umgehen. Zwar verspricht der Konzern, die Informationen nicht weiterzuverkaufen und verschlüsselt den Zugang mit einem hohen Sicherheitsstandard – eine hundertprozentige Garantie, dass die Daten nicht an 13 Dritte gehen, gibt es jedoch nicht. Gerade private medizinische Daten würden viele Abnehmer finden. Google ist nicht das einzige Unternehmen, das eine elektronische Krankenakte anbietet. Bereits 2007 startete Microsoft das Portal „Health Vaulth“, das sich im Gegensatz zu „Google Health“ durch Werbung finanziert. Auch in Deutschland gibt es erste Versuche in diese Richtung. So bieten einige Kassen Kunden die Möglichkeit, die Daten elektronisch einzusehen. Das Angebot hat sich allerdings bisher nicht durchgesetzt. Neben der Kritik an der Sicherheit der Daten stellt auch der hohe Verwaltungsaufwand ein Hindernis dar. Friederike Geisler, MDK Niedersachsen MDK-Forum 2/2008 Schwerpunkt Telemedizin für Reisende F ür viele gehört zur Urlaubs­ buchung der Abschluss eines Rundum-Sorglos-Paketes bei einem Reiseversicherer. Eine Auslandsreise-Krankenversi­ cherung ist darin eingeschlossen. Damit ist es für die meisten ge­ tan und den schönsten Wochen im Jahr steht nichts mehr im Wege. Doch die Wenigsten ma­ chen sich vor der Reise Gedan­ ken, wo sie im Bedarfsfall eine qualitativ hochwertige medizi­ nische Behandlung im Ausland finden können. Immerhin be­ nötigen von den rund 900 Mil­ lionen Reisenden im Jahr schätzungsweise 70 Millionen medizinische Hilfe. In einem Projekt zertifizieren zurzeit das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) und die Europäische Weltraumagentur (ESA) weltweit Behandlungs­ einrichtungen. Für Urlaubs- und Geschäftsreisende soll dadurch ein Netzwerk von international hochwertigen Behandlungsan­ geboten entstehen. Telematische Anwendungen helfen den Pro­ jektentwicklern dabei. Zu den Aufgaben des Institutes für Luft- und Raumfahrtmedizin beim DLR gehört auch die Betreuung der mobilen Gesellschaft, die über die Mobilität von Piloten und Astronauten hinaus geht. Daraus entstand das Projekt „Tele­ medicine for the Mobile Society“ (TEMOS), mit dem das Institut seinen gewohnten Aufgabenbereich erweitert und sich an die Zielgruppe der Reisenden wendet. Das TEMOS-Projekt setzt sich aus drei Teilprojekten zusammen. Neben den Bereichen Telemedizin-Anwendung und Teleteaching startete im Jahr 2004 zunächst das erste Teilprojekt, das sich mit der Bildung eines internationalen Netzwerkes von Kliniken befasst. „Ziel des Pro- MDK-Forum 2/2008 jektes ist es, die Versorgung von deutschen Touristen und Geschäftsleuten im Ausland im Falle eines krankheitsbedingten Notfalles zu optimieren“, sagt Projektmanagerin Dr. Claudia Mika vom DLR. Dazu wird ein Netzwerk von Partnerkliniken aufgebaut, die nach festgelegten „TEMOS“-Qualitätskriterien zertifiziert werden. In der Abstimmung des Anforderungskatalogs waren auch führende Reisekrankenversicherer beteiligt. Mahlzeiten sind nicht überall Standard Die Evaluation und Zertifizierung der Klinken wird vom DLR durchgeführt. Die Namen dieser zertifizierten „TEMOS“-Kliniken werden über das Centrum für Reisemedizin (CRM) veröffentlicht, so dass alle Ärzte, Apotheken und natürlich auch Reisende direkt Zugang zu diesen Informationen bekommen können. Für einen akuten Behandlungsfall kann man sich also schon vor der Reise über die nächste Anlaufstelle informieren. „Uns ist wichtig, dass die Daten über Behandlungsangebote auch valide sind. Alle Angaben bis hin zur Telefonnummer werden von uns laufend gecheckt“, sagt Dr. Mika. Kliniken, die in das TEMOSNetzwerk aufgenommen werden wollen, müssen einen speziellen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Die Anforderungen beziehen sich auf die Bedürfnisse der Reisenden. Über die Prüfpunkte zum Qualitätsmanagement und zur Hygiene hinaus bezieht die DLR-Zertifizierung noch weitere Faktoren mit ein. Ein Patient muss zum Beispiel in der aufgesuchten Behandlungseinrichtung auch sprachlich verstanden werden. Ein weiteres Kriterium ist die Unterbringung einer Begleit- 14 Dr. Claudia Mika, Projektmanagerin beim DLR person in räumlicher Nähe. Nicht in jedem Land gehört die Versorgung mit Mahlzeiten zum Versorgungsstandard eines Krankenhauses. Auch das muss gewährleistet sein. Die Zertifizierer, zumeist Ärzte, interessieren sich vor allem für die Behandlungsprozesse. „Wir lassen uns alle Prozessschritte von der Notaufnahme bis zum Patienten­ zimmer genau zeigen und dokumentieren die Standard Operations Procederes“, sagt Dr. Mika. Spezieller Qualitätscheck Ralf Krewer, Marketingleiter des Bangkok Hospitals, hat schon einige Qualitätsprüfungen nach internationalen Standards hinter sich gebracht. „Die TEMOS-Zer­ tifizierung war für das Bangkok Hospital Medical Centre eine ganz besondere Herausforderung, da uns nicht wie bei anderen internationalen Krankenhauszertifizierungen eine Liste von erwarteten Standards zur Vorbereitung gegeben wurde. Vielmehr Schwerpunkt war dem Zertifizierungsteam daran gelegen, die Qualität des Krankenhauses im täglichen Betrieb zu beurteilen und ad hoc zu entscheiden, welche Abteilung, Apparatur oder SOP (Standard Operational Procedure) als nächstes evaluiert werden soll“, erklärt Krewer. Mit deutschem Arzt über Videokonferenz sprechen Wer Hilfe im Ausland braucht und die nächstgelegene TEMOSBehandlungsmöglichkeit aussucht, dem bieten die Häuser per Videokonferenz Konsultationen mit deutschen Fachärzten an. Die Videokonferenztechnik erlaubt es, spezielle Fachkollegen des TEMOS-Netzwerkes weltweit in den Behandlungsfall mit einzubeziehen. Solange es noch keine internationale Patientenkarte gibt, kann die Klinik über die EDV-Plattform bei TEMOS eine elektronische Patientenakte anlegen, die für spätere Behandlungsfälle wichtige Informationen enthält. Zielgruppe: Ältere und chronisch Kranke In Vorbereitung ist ein spezielles elektronisches Monitoring-System für ältere und chronisch kranke Patienten. „Darin sehen wir einen wichtigen Baustein für die Zukunft. Denn für immer mehr Menschen gehört es zur Lebensqualität, im Alter oder bei Krank­ heit auch reisen zu können“, meint Dr. Mika. In Deutschland erhobene Referenzdaten werden zum Beispiel für Herz- und Diabeteskranke in ein elektronisches Gerät eingespeist, das der Urlauber oder Geschäftsreisende mitnimmt. Weichen die auf der Reise gemessenen Daten von den Basisdaten ab, wirft das Gerät nach einem erneuten Abgleich der Daten die Empfehlung aus, die nächste TEMOS-Einrichtung aufzusuchen. Ist diese nicht in der Nähe, kann natürlich auch andere medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Sonderprojekt Teleteaching Das DLR, das Institut für Flugmedizin und das Audio-Visuelle Medienzentrum des Universitätsklinikums Aachen starteten ein Sonderprojekt: Studenten aus Aachen und von der Universität von Porto Alegre in Brasilien setzten sich mit dem didaktischen Modell des problemorientierten Lernens und der Unterstützung von Fachexperten selbst Themen und Lernziele. Sie schulten sich über die Dauer von zwei Monaten gegenseitig. Auch dabei nutzten sie die Videokonferenztechnik. Die deutschen Studenten haben sich zum Beispiel über die Krankheit FSME so weit vertraut gemacht, dass die brasilianischen Kommilitonen von den Lernergebnissen ebenfalls profitieren konnten. Mittlerweile beteiligen sich zwei weitere Universitäten aus Litauen und Polen am Teleteaching-Projekt. Fachlicher Austausch gefördert TEMOS ist für alle Behandlungs­ einrichtungen offen. „Jeder kann sich um eine Zertifizierung bewerben“, sagt Projektmanagerin Dr. Mika. „Wir greifen aber auch Empfehlungen von Reisekranken­ versicherern und Auslandsbotschaften auf und recherchieren selber. Inzwischen werden Kliniken auch durch unser eigenes Magazin „The Travel Medicus“, den Internetauftritt und über Kontakte auf Reisemessen auf uns aufmerksam.“ In dem noch jungen Projekt gehören etwa 30 zertifizierte Kliniken zum Netzwerk. Vom Antrag über die Aufnahme bis zur Aushändigung des Qualitätszertifikats vergehen etwa sechs bis neun Monate. Alle drei Jahre muss die Prüfung wiederholt werden. „Natürlich sollen noch viel mehr Kliniken zu unserem Netzwerk stoßen“, versichert Dr. Mika. TEMOS geht über die optimale Versorgung der Reisenden hinaus. Die Projektbetreiber fördern die internationale Vernetzung der Behandler. Dazu gehören zum Beispiel die Nutzung der gemeinsamen Datenbank und der Austausch von Fachvorträgen und Publikationen. Über eine eigene Videokonferenzschaltung können auch Kongressprogramme „live“ verfolgt werden. 15 Noch wissen nicht allzu viele Reisenden etwas über das TEMOS-Projekt. „Das soll sich in Zukunft ändern“, sagt Dr. Mika. „Relativ schnell stößt man zurzeit über das Internetangebot vom Centrum für Reisemedizin auf uns. Wir wollen aber mit eigenen Marketinginstrumenten die Patienten ansprechen und die Kanäle über die Ärzte, Apotheken und ReisekrankenversicherungsUnternehmen nutzen“, erklärt Dr. Mika ihr Vorhaben. Vom Projekt zum Unternehmen Das zurzeit noch von DLR und ESA finanzierte Projekt wird voraussichtlich Ende des Jahres in eine sich selbst tragende Unternehmensstruktur überführt. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Überarbeitung des Geschäfts­ plans und die Suche nach weiteren Investoren“, so Dr. Mika. (dt) Mehr Informationen unter: www.temos-international.com www.dlr.de/medizin www.temos.biz Das Magazin „The Travel Medicus“ kann per E-Mail angefordert werden bei [email protected] MDK-Forum 2/2008 Kranken- und Pflegeversicherung Neues Begutachtungsverfahren zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit Von Dr. Barbara Gansweid und Dr. Ulrich Heine E nde Februar haben der MDK Westfalen-Lippe (MDK WL) und das Bielefelder Institut für Pflegewissenschaft (IPW) einen Vorschlag für ein neues Ver­fahren zur Begutach­ tung von Pflegebedürftigkeit vorgelegt. Das neue Begutach­ tungsverfahren wird zurzeit unter der Leitung des Medizi­ nischen Dienstes der Spitzen­ verbände der Krankenkassen (MDS) in acht MDK auf seine Praktikabilität und Plausibilität hin getestet. Die Ergebnisse werden vom Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen (IPP) ausgewertet. Im Jahr 2006 hat das Bundesministerium für Gesundheit einen Beirat eingerichtet, der bis Ende 2008 Entscheidungsgrundlagen für eine Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs erarbeiten soll. Gleichzeitig gaben die Spitzenverbände der Pflegekassen eine wissenschaftliche Studie in Auftrag. Die Studie des Bielefelder Instituts für Pflegewissenschaft (IPW) kam zu dem Ergebnis, dass ein neues Begutachtungsverfahren entwickelt werden sollte. Näheres zur Studie im Kasten auf Seite 17. Begutachtungsverfahren im Detail Der jetzt vorliegende Vorschlag für ein neues Begutachtungsverfahren geht von einem umfassen­­ deren Verständnis von Pflegebedürftigkeit aus als bisher. Es berücksichtigt Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und Funktionseinbußen in den acht Bereichen („Modulen“): MDK-Forum 2/2008 1. Mobilität 2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 4. Selbstversorgung (Nahrungsaufnahme, Sich-Kleiden, Körperpflege, Ausscheidungen) 5. Umgang mit krankheitsund therapiebedingten Anforderungen 6. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte 7. Außerhäusliche Aktivitäten 8. Haushaltsführung. Diese Module sind wiederum in einzelne Aktivitäten wie z.B. in „Essen“, „Trinken“, „Toilette benutzen“ im Modul 4 unterteilt. Alle Module zusammen enthalten insgesamt 77 Items. Der Grad der Pflegebedürftigkeit wird über die Beeinträchtigungen in den ersten sechs Bereichen ermittelt. Beeinträchtigungen bei außerhäuslichen Aktivitäten und der Haushaltsführung hingegen werden als Hilfebedürftigkeit verstanden, da der daraus resultierende Bedarf primär hauswirt­ schaftlichen oder sozialen Charakter hat. Neuer Maßstab: Grad der Selbstständigkeit Im Gegensatz zum bisherigen Begutachtungsverfahren wird das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach dem Zeitaufwand bemessen, „den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirt­ schaftlichen Versorgung benötigt“ 16 (§ 15 Abs. 3 SGB XI). Neuer Maßstab für die Einschätzung von Pflegebedürftigkeit ist der Grad der Selbstständigkeit bei den Aktivitäten in den einzelnen Modulen. Im neuen Verfahren ist Selbstständigkeit definiert als die Fähig­ ­keit einer Person, die jeweilige Handlung bzw. Aktivität allein, d.h. ohne Unterstützung durch andere Personen durchzuführen. Demnach ist es ohne Bedeutung, ob Hilfsmittel verwendet werden (müssen). Als selbstständig gilt eine Person also auch dann, wenn sie die jeweilige Handlung bzw. Aktivität unter Nutzung von Hilfsmitteln ohne Hilfe durch andere Personen durchführen kann. Die Beeinträchtigung bei einer Aktivität wird ermittelt unter der Annahme, dass die Person diese ausführen möchte. So werden zum Beispiel bei einem bettlägerigen Patienten auch seine Schwierigkeiten beim Treppensteigen berücksichtigt. Dies entfiel im alten Verfahren, da der Versicherte wegen Bettlägerigkeit keinen zeitlichen Hilfe­bedarf beim Treppensteigen geltend machen konnte. Im neuen Verfahren ist es unerheblich, ob Hilfeleistungen tatsächlich erbracht werden und welche diese sind. Vier Stufen der Selbstständigkeit Selbstständigkeit wird in den meisten Modulen mit Hilfe einer vierstufigen Skala bewertet. Sie umfasst die Ausprägungen • selbstständig • überwiegend selbstständig Kranken- und Pflegeversicherung • überwiegend unselbstständig • unselbstständig Ihnen wird je ein Punktwert von null bis drei Punkten zugeordnet (s. Abb. S. 18). Dabei gilt: Je höher die Punktzahl, desto unselbstständiger. In einigen Modulen wird eine abgewandelte vierstufige Skala benutzt, z. B. für die Ermittlung der kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten oder der Häufigkeit des Auftretens von Verhaltensauffälligkeiten. In diesen Fällen wird nicht der Grad der Selbstständigkeit, sondern das Ausmaß der vorhandenen Fähigkeiten oder Häufigkeiten gemessen. Fünf statt drei Pflegestufen Fasst man die Punkte der einzelnen Aktivitäten eines Moduls zusammen, erhält man eine Aus­­ sage zum Grad der Beeinträchtigung in diesem Lebensbereich. Aus der Zusammenführung der Ergebnisse aller Module sollen die „neuen“ Pflegestufen ermittelt werden. Nach dem Vorschlag von MDK WL und IPW sollen dabei fünf Pflegestufen unterschieden werden, wobei die niedrigste Stufe auch Personen mit geringem Unterstützungs­bedarf erfasst, die heute nicht die Pflegestufe I erreichen (weil sie z.B. nur 30 statt mindestens 46 Minuten Grundpflegebedarf aufweisen), obwohl sie aus fachlicher Sicht als pflegebedürftig gelten müssen. Die höchste Stufe ist für Personen vorgesehen, die nicht nur weitreichende Verluste ihrer Selbstständigkeit, sondern gleichzeitig „besondere Bedarfskonstellationen“ aufweisen, die eine ungewöhnlich intensive pflegerische Versorgung erforder­lich machen. Modifiziertes Verfahren bei Kindern und Jugendlichen Die Einschätzung der Pflegebedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen erfolgt mit dem gleichen Erfassungsbogen. Der Bereich „Haushaltsführung“ bleibt Das Projekt „Neues Begutachtungsverfahren“ im Überblick Seit Jahren wird über eine Erweiterung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit im SGB XI diskutiert. In der Kritik steht die derzeitige enge Definition mit überwiegend somatischer und verrichtungsbezogener Orientierung. Insbesondere wurde bemängelt, dass der spezielle Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf von kognitiv oder psychisch beeinträchtigten Menschen nicht ausreichend berücksichtigt wird. Zur Entwicklung und Erprobung eines neuen Verfahrens für die Begutachtung von Pflegebedürftigkeit haben die Spitzenverbände der Pflegekassen im Jahr 2006 ein Modellprojekt nach § 8 Abs. 3 SGB XI ausgeschrieben. Den Auftrag für das Projekt erhielt eine Bietergemeinschaft. Dazu zählen: • Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Westfalen-Lippe (MDK WL) – Projektleitung: Dr. Barbara Gansweid und Dr. Ulrich Heine • Das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) – Projektleitung: Dr. Klaus Wingenfeld, Prof. Dr. Doris Schaeffer und Dr. Andreas Büscher • Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) – Projektleiter: Prof. Dr. Jürgen Windeler • Das Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen (IPP) – Projektleitung: Prof. Dr. Stefan Görres Das Projekt besteht aus drei Phasen: Vorphase: Recherche, Analyse und Bewertung von Begutachtungs­ instrumenten und Pflegebedürftigkeitsbegriffen (Projektnehmer: IPW). Ergebnisbericht: Wingenfeld K, Büscher A, Schaeffer D (2007): Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten. Projektbericht. Bielefeld 2007 Hauptphase 1: Entwicklung eines neuen Begutachtungsverfahrens (Projektnehmer: MDK WL und IPW). Abschlussbericht zur Instrumenten­ entwicklung und der Anlagenband zum Download unter http://www.vdak.de/vertragspartner/Pflegeversicherung/Modellprogramm/ Projekte/modellprg_projekt_16/index.htm Hauptphase 2: Erprobung des neuen Begutachtungsverfahrens und Auswertung der Ergebnisse (Projektnehmer: MDS und IPP). Die Erprobung läuft zur Zeit in acht MDK. Die Ergebnisse werden vom IPP ausgewertet. Geplanter Abschluss des Projektes: Oktober 2008 allerdings unberücksichtigt. Der Gutachter ermittelt den tatsächlich vorliegenden Grad der Abhängigkeit des Kindes. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beeinträchtigungen krankheitsbedingt oder noch altersgemäß bestehen. Das Ergebnis der Einschätzung beschreibt jedoch nicht den Grad der Selbstständig- 17 keit, sondern dessen Abweichung von der Selbstständigkeit gesunder, alters­­entsprechend entwickelter Kinder. Denn die ermittelten Punktewerte werden automatisch um die hinterlegten Punktwerte für die altersgemäße Abhängigkeit bereinigt. Dieser Berechnung liegt eine umfassende Literaturanalyse zur altersgemäßen kindlichen MDK-Forum 2/2008 Kranken- und Pflegeversicherung Entwicklung zugrunde, die im Anlagenband zum Abschlussbericht enthalten ist. 1. Mobilität 0 1 2 3 1.1 Positionswechsel im Bett 0 1 2 3 Praktikabel und plausibel 1.2 Stabile Sitzposition halten 0 1 2 3 Fünf Ärzte und fünf Pflege­fach­ kräfte des MDK WL haben das neue Instrument bei 100 Erwachsenen und 41 Kindern auf seine Praktikabilität hin getestet. Dieser Pretest erfolgte jeweils im Anschluss an die reguläre Pflege­­ begutachtung. Neben den mit dem neuen Instrument erfassten Daten wurden Basisinformationen wie etwa Pflegestufe, Alter des Versicherten, Diagnosen, Feststellung einer eingeschränkten Alltagskompetenz oder Dauer der Begutachtung und weitere charakteristische gesundheitliche Merkmale erfasst. Damit standen für die überwiegende Mehrzahl der einbezogenen Personen aussagekräftige Kurzprofile ihrer gesundheitlichen Situation und der Art ihrer Pflegebedürftigkeit zur Verfügung. 1.3 Aufstehen aus sitzender Position/Umsetzen 0 1 2 3 1.4 Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs 0 1 2 3 1.5 Treppensteigen 0 1 2 3 Im Test zeigte das neue Begutachtungsverfahren überzeugende Praktikabilität. Aus der Sicht der beteiligten Gut­achter erwies es sich als relativ einfaches Verfahren, das allerdings ein erhebliches Umdenken erforderlich macht (z.B. Abkehr von der Ermittlung notwendiger Pflegezeiten). Doch die neue Methodik ist nicht nur praktikabel, sie führt auch zu plausiblen Ergebnissen. Und auch das Ziel, Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen und psychischen Störungen adäquat zu beurteilen, kann den Ergebnissen des Pretests zufolge erreicht werden. Darüber hinaus sollen die Gutachter im neuen Begutachtungsformular gezielte Empfehlungen zur Verbesserung der Pflegesitua­ tion abgeben. Wie im bisherigen Verfahren sind umfangreiche Informationen zu den medizinischen und pflegerischen Problemen aus Sicht der Betroffenen, zum bisherigen Krankheits- und Behandlungsverlauf, zur Hilfs- MDK-Forum 2/2008 0 = selbstständig, 1 = überwiegend selbstständig, 2 = überwiegend unselbstständig, 3 = unselbstständig Auszug aus dem Begutachtungsbogen am Beispiel „Mobilität“ mittelversorgung, zur Wohnund Betreuungssituation und anderen Kontextfaktoren im Formular festzuhalten. Auf diesen Anamneseteil folgt der gutachterliche Befund, in dem die festgestellten Schädigungen und Beeinträchtigungen aufgeführt werden. Zusätzlich wurde ein Verfahren zur systematischen Erfassung von Risiken entwickelt. Der Gutachter wird durch einen formalisierten Fragenkatalog geleitet, um Hinweise zur Rehabi­ litationsbedürf­tig­­keit, -fähigkeit und -prognose zu erfassen. Aus der abschließen­den Gesamtbewertung ergibt sich gegebenenfalls die Feststellung einer Rehabilitationsindikation. Begutachtungsergebnisse kön­ nen individuell genutzt werden In dem neu entwickelten Begutachtungsverfahren werden vielfältige Informationen über den Versicherten und seine Lebensumstände erhoben. Diese wertvollen Informationen können außerdem für die Planung der individuellen Pflege nützlich sein. Betrachtet man das neue Begutachtungsverfahren als Ganzes (Informationssammlung plus Befunderhebung plus Assessment plus Empfehlungsteil), so liegt eine Informationsstruktur vor, die eine gute Grundlage für das pflegerische Assessment in der professionellen Pflegeprozess­ planung bietet. Nutzen für die Pflegepraxis brächte das neue Verfahren der Zusammenarbeit 18 zwischen dem Pflegebedürftigen und beruflich Pflegenden vor allem zu Beginn, d.h. in einer Situation, in der nur wenige Informationen für die Entwicklung einer ersten Pflegeplanung zur Verfügung stehen. Eine mit dem neuen Begutachtungsverfahren entwickelte Arbeitshilfe gibt Auskunft, wie die Begutachtungsergebnisse bei der individuellen Pflegeplanung genutzt werden können. Die Ergebnisse des Pretests und die bisherigen Reaktionen der Fachwelt auf das neue Begutachtungsverfahren sind vielversprechend. Wenn auch die derzeit laufende umfangreiche Erprobung in acht MDK diese Ergebnisse bestätigt und eine Harmonisierung zwischen dem neuen Verfahren und der noch ausstehenden Neufassung des sozialrechtlichen Begriffs der Pflegebedürftigkeit gelingt, kann das neue Verfahren dazu beitragen, zentrale, seit vielen Jahren intensiv diskutierte Probleme der Pflegeversicherung zu beheben. Dr. med. Barbara Gansweid ist Leiterin des Fachreferats Pflege und der Sozialmedizinischen Expertengruppe „Pflege“ (SEG 2) der MDK-Gemeinschaft beim MDK Westfalen-Lippe E-Mail: [email protected] Dr. med. Ulrich Heine ist Ärztlicher Direktor und stv. Geschäftsführer des MDK Westfalen-Lippe E-Mail: [email protected] Kranken- und Pflegeversicherung PEA-Begutachtungs-Richtlinie tritt zum 1. Juli in Kraft Deutliche Verbesserungen für Demenzkranke Von Uwe Brucker F ür Demenzkranke treten zur Jahresmitte wichtige Neuerungen des Pflege-Weiter­ entwicklungsgesetzes in Kraft: Personen mit einer einge­ schränkten Alltagskompetenz (PEA) haben nun Anspruch auf finanzielle Unterstützung – und zwar auch dann, wenn der verrichtungsbezogene Hilfebe­ darf unterhalb der Pflegestufe I liegt. Sie erhalten künftig pro Monat einen Grund-Betreuungs­ betrag von 100 Euro oder einen erhöhten Betreuungsbetrag von 200 Euro. Vom 1. Juli an soll der MDK in seinem Gutachten die Höhe der Leistung empfeh­ len. Wie das Begutachtungsver­ fahren aussieht, regelt die „Richt­linie zur Feststellung von Per­so­nen mit erheblich einge­ schränkter Alltagskompetenz und zur Bewertung des Hilfe­ bedarfs“. renden und qualitätsgesicherten Beratungsangeboten profitieren. Sie werden deshalb nicht als Geldleistungen ausgezahlt, sondern die Versicherten können damit qualitätsgesicherte niedrig­ schwellige Betreuungsangebote nutzen und mit der Pflegekasse abrechnen. Einen Anspruch auf den Betreuungsbetrag nach § 45 b SGB XI haben Pflege­bedürftige der Pflegestufen I, II und III, aber auch Personen mit einem Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaft­lichen Versorgung, der nicht das Ausmaß der Pflegestufe I erreicht. Denn viele Demenzkranke gingen bisher leer aus. Sie hatten zwar einen Betreuungsbedarf, aber der verrichtungsbezogene Hilfebedarf reichte für die Pflegestufe I nicht aus. Tatsächlicher Hilfebedarf ist entscheidend Sachleistungen und mehr Personal Mit den neuen Leistungen sollen insbesondere die Pflegenden entlastet werden und die Versicherten selbst sollen von aktivie- Auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, die an einer dementiellen Erkrankung leiden, werden ein Mehr an Leistungen erhalten: Für je 25 Demenzkranke soll es künftig speziell geschulte Betreuungskräfte geben – zusätzlich zum bereits vorhandenen Pflegepersonal. Voraussetzung ist allerdings, dass tatsächlich zusätzliches Personal eingestellt wird und dass die Pflegeeinrichtungen explizit auf diese Betreuungsangebote hinweisen. Vom 1. Juli an müssen die Gutachterinnen und Gutachter des MDK prüfen, ob bei Antragstellern dauerhaft „ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung“ besteht, wie es in der Richtlinie heißt. Wie bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit im SGB XI wird auch hierbei nicht auf bestimmte Krankheitsbilder oder Diagnosen wie z. B. Demenz abgestellt. Vielmehr kommt es auf den tatsächlichen Hilfebedarf an, den jemand hat, weil er in der Ausführung bestimmter Aktivitäten beeinträchtigt und deshalb in seiner Alltagskompetenz eingeschränkt ist. 19 Das Begutachtungsverfahren gliedert sich wie bisher in zwei Teile, ein Screening und ein Assessment, und baut auf der Pflege­ begutachtung nach § 14 ff. SGB XI auf. Grundlage für das weitere Verfahren ist die Befunderhebung (Punkt G der Begutachtungs-Richtlinien). Dort werden bestehende Schädigungen, die vorhandenen Ressourcen sowie die Beeinträchtigungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens dokumentiert. Im Kern ist das Screening die Auswertung der Befunderhebung. Hierzu ist der spezifische Hilfebedarf (nicht jedoch der Pflegebedarf) bei Personen mit demenzbedingten Fähigkeitsstö-­ run­­gen, geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung zu erfassen. Dazu müssen die Gutachter den Antragsteller bzw. sein Verhalten in den Punkten „Orientierung“, „Antrieb/Beschäftigung“, „Stimmung“, „Gedächtnis“, „Tag-/Nachtrhythmus“, „Wahrnehmung und Denken“, „Kommunikation/Sprache“, „Situatives Anpassen“ und „Soziale Bereiche des Lebens wahrnehmen“ bewerten. Für jeden Punkt müssen sie entscheiden, ob das Verhalten „unauffällig“ oder „auffällig“ ist. Erst Screening, dann Assessment Ist das Screening positiv, muss zwingend ein Assessment durchgeführt werden. Dies ist der Fall, wenn die Gutachter mindestens eine Auffälligkeit dokumentieren, die ursächlich auf demenzbedingte Fähigkeitsstörungen, geistige Behinderung oder psychische MDK-Forum 2/2008 Kranken- und Pflegeversicherung Erkrankungen zurückzuführen ist. Weitere Bedingung ist, dass hieraus ein regelmäßiger Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf resultiert, der voraussichtlich mindestens sechs Monate andauert. D.h.: der Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf besteht jeden Tag, aber nicht unbedingt rund um die Uhr. Kriterienkatalog definiert Betreuungsbedarf Ein Kriterienkatalog mit insgesamt 13 Einzelaspekten (siehe Kasten) soll Aufschluss darüber geben, ob ein „erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf“ vorliegt. Um Anspruch auf den monatlichen Grundbetrag von 100 Euro zu haben – dazu muss eine „erheblich eingeschränkte Alltags­ kompetenz“ vorliegen –, müssen zwei Aspekte aus unterschied­ lichen Bereichen mit „ja“ beantwortet werden. Mindestens einmal muss ein Item aus den Bereichen 1 bis 9 positiv beantwortet werden. Den erhöhten Betreuungsbetrag in Höhe von 200 Euro erhält ein Antragsteller, wenn zusätzlich zu den genannten Kriterien bei mindestens einem weiteren Item aus einem der Bereiche 1, 2, 3, 4, 5, 9 oder 11 ein „Ja“ angegeben wird. Diese Items erfassen die Bereiche, die für die Betroffenen besonders belastend sind. Unbürokratische Übergangsregelungen Bisher gab es für ambulant gepflegte Personen einen zusätzlichen Betreuungsbetrag in Höhe von bis zu 460 Euro pro Jahr, wenn der MDK eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt hatte. Bezieher dieser Leistung erhalten den monatlichen Grundbetrag ohne neuerliche Prüfung. Ähnlich unbürokratisch soll verfahren werden, wenn ein PEAAssessment bereits vorliegt und MDK-Forum 2/2008 Kriterienkatalog zur Erfassung der erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz 1. Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz) 2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen 3. Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Substanzen 4. Tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation 5. Im situativen Kontext inadäquates Verhalten 6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen 7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung 8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben 9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus 10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren 11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen 12. Ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten 13. Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depression der erhöhte Betrag von 200 Euro monatlich beantragt wird. Dann prüft zunächst die Pflegekasse nach Aktenlage. Wenn die Voraussetzungen für den erhöhten Betreuungsbetrag vorliegen, gewährt die Pflegekasse den erhöhten Betrag. In Zweifelsfällen soll der MDK eingeschaltet werden. Anders sieht es aus, wenn nach Auswertung eines vorliegenden PEA-Assessments die Kriterien für die Gewährung des erhöhten Betrags nicht vorliegen. In diesen Fällen muss der MDK regelmäßig in die Begutachtung eingeschaltet werden. Für die Feststellung, wie viele zusätzliche Kräfte zur Betreuung von Demenzkranken in Pflege- 20 heimen benötigt werden, sollen die Einrichtungen eine Übersicht der Heimbewohner erstellen. Die Pflegekasse soll dann die Feststellung, ob jemand in seiner Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt ist, auf der Grundlage der vorliegenden Informationen nach Aktenlage treffen. Lediglich in Zweifelsfällen kann der Medizinische Dienst in die Prüfung nach Aktenlage einbezogen werden. Diese Umsetzungsempfehlung gilt zunächst nur bis zum 31. Dezember 2009. Uwe Brucker leitet das Fachgebiet Pflegerische Versorgung beim MDS E-Mail: [email protected] Kranken- und Pflegeversicherung Was leisten Patientenschulungen? Jacqueline kriegt keine Luft Von Dr. Thomas Bode und Dr. Ulrich Heine E s war wieder einmal soweit: Jacqueline kam vom Spielen auf dem Bauernhof und rang mit schnellen, pfeifenden Atem­ zügen nach Luft. Der Kinder­ arzt konnte mit einem Medika­ ment zur Inhalation sofort helfen. Die Eltern hatten wie­ derholt die Frage nach einer „Kur“ für Jacqueline gestellt. Stattdessen empfahl der Arzt die Teilnahme an einer Asthma­ schulung für Kinder. Kranken­ kassen können die Kosten wirksamer Schulungen für chronisch Kranke übernehmen. Der MDK Westfalen-Lippe be­ rät die Kassen nicht nur zum einzelnen Versicherten, sondern insbesondere bei der Frage, ob ein spezielles Programm die Kriterien erfüllt, die in den Ge­ meinsamen Empfehlungen der Spitzenverbände der Kranken­ kassen zur Förderung und Durchführung von Patienten­ schulungen auf der Grundlage von § 43 SGB V genannt sind. Der Kinderarzt verordnete die Teilnahme am „Luftiku(r)s“, einem Schulungsprogramm für Kinder und Jugendliche mit Asthma bronchiale. Der Kurs fand in den Herbstferien statt und begann mit einem Gespräch zwischen der Kinderlungenfachärztin, der Familie und einem Psychologen, der bereits große Erfahrung mit asthmakranken Kindern hatte. Im Anschluss an die „große“ Vorstellungsrunde der insgesamt sieben Familien wurde die Krankheit Asthma bronchiale an Modellen und spielerisch erläutert. An den folgenden Tagen gab es dann getrennte Schulungsgruppen jeweils für Eltern und die betroffenen Kinder. Jacqueline konnte endlich ver- stehen, was in ihrem Fall das Asthma auslöst, wie sie Atemnotanfälle vermeiden und was sie bei akuter Atemnot selbst machen könnte. Ihre Eltern und sie erfuhren, dass bei Jacqueline insbesondere die regelmäßige „Kortison“Inhalation sehr wichtig war. Jacqueline lernte Entspannungstechniken und konnte sich beim Asthmasport unter der Leitung eines Kranken­gymnasten seit langer Zeit wieder richtig austoben, ohne Luftnot zu bekommen. Beratung der Kassen im Einzelfall Bevor die Krankenkasse jedoch eine Kostenzusage erteilte, ließ sie sich durch den MDK WestfalenLippe beraten. Der hatte dieses Schulungsprogramm bereits früher positiv bewertet, so dass in diesem Fall nur die individuellen Voraussetzungen zu prüfen waren. „Chronisch Krank“ ist ein Patient im Hinblick auf Patientenschulungen, wenn voraussichtlich mindestens ein Jahr lang ärztliche oder andere medizinische Behandlung oder Überwachung notwendig ist, um eine ausreichende „Beherrschung“ der Erkrankung zu sichern. Ziel von Patientenschulungen ist es, die Kenntnisse der Patienten über ihre Krankheit zu erweitern, ihre Therapiemotivation zu erhöhen und die Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit der Erkrankung zu stärken (Krank­­­heits­selbstmanagement). Durch die langfristige Änderung von Lebensgewohnheiten soll eine Verschlimmerung der Erkrankung vermieden bzw. ein besserer Gesundheitszustand herbeigeführt werden. 21 Jacqueline hat gelernt, mit ihrer Krankheit umzugehen, und kann endlich wieder ausgelassen toben wie diese Kinder Nur wenige Programme sozial­ medizinisch positiv bewertet Zwischen 2005 und 2007 hat der MDK Westfalen-Lippe insgesamt 31 Schulungsprogramme für chronisch kranke Kinder bewertet. Anbieter sind meist regionale Arztpraxen, aber auch Kinderkliniken. Auftraggeber sind inzwischen überwiegend die Landesverbände der Krankenkassen. Bei den meisten Programmen fehlten bei Erstvorlage wesentliche Angaben zur Konzept-, Struktur- und Ergebnisqualität, so dass erhebliche Mängel festgestellt wurden. Ergänzend vorgelegte Unterlagen führten zwar zur erneuten Prüfung des Programms, häufig jedoch nicht zur Beseitigung der Mängel. Immerhin: Nach dreimaliger Prüfung mit konkreten Verbesserungs­ MDK-Forum 2/2008 Kranken- und Pflegeversicherung vorschlägen zeigten drei Programme nur noch geringe Beanstandungen. Besonders häufig hatten die Anbieter die Teilnahme-/Einschlusskriterien deutlich niedrigschwelliger formuliert, als in den jeweils gültigen Qualitätsanforderungen festgelegt war. So sollten z.B. Adipositasschulungen häufig auch für Kinder und Jugendliche angeboten werden, die lediglich übergewichtig waren und somit nicht „chronisch krank“ im Sinne des SGB V. Außerdem konnten häufig keine Manuale für Patienten bzw. Eltern sowie für die Therapeuten vorgelegt werden. Bezüglich der Strukturqualität fanden sich oft Mängel in der Zusammensetzung des Schulungs­ teams, das häufig nicht multi­dis­ ziplinär war. Zum Teil hatten die Teammitglieder keine Erfahrungen in der Arbeit mit chronisch kranken Kindern und Jugendlichen; oft fehlte der Nachweis, dass sie in den zur Anwendung kommenden verhaltenstherapeu­ tischen Techniken geschult sind. Auch bezüglich der Wirksamkeit blieben in der Regel viele Fragen offen. Zum Wirksamkeitsnachweis ist nach den Kriterien der Evidenzbasierten Medizin eine randomisierte kontrollierte klinische Studie auf der Basis der CONSORT-Stellungnahme mit einer ausreichenden Fallzahl, so genannten Intention-to-treatAnalyse und einer für die Beurteilung der klinischen Relevanz der Ergebnisse nötigen Nachbeobachtungszeit von mindestens drei bis fünf Jahren erforderlich. Ambulante Schulung berücksichtigt die konkrete Lebens­situation Jacqueline profitierte von der Schulung in mehrfacher Hinsicht: Mit medizinisch-pädagogischem Ansatz wurden Auslöser für Asthma-Anfälle aus ihren konkreten Wohn- und Lebensumständen MDK-Forum 2/2008 identifiziert. Luftnotanfälle hatte sie nur noch selten und wenn, dann konnte sie sie durch die gelernten Verhaltensregeln selbst beherrschen. Sie war körperlich belastbarer und konnte endlich mit ihren Freundinnen im Schulsport mithalten. Die Besuche beim Kinderarzt wurden seltener, ihre Fehlzeiten in der Schule auch. Ihre Medikamente nahm Jacqueline jetzt regelmäßig und insbesondere ihr Vater verlor seine „Kortisonangst“, als er sah, dass es seiner Tochter so gut ging. Eltern und Tochter waren froh, durch die Schulung Kontakt mit gleichaltrigen Betroffenen am Wohnort gefunden zu haben, was durch eine wohnortferne „Kur“ nicht möglich gewesen wäre. Fazit Patientenschulungen haben bei der Behandlung zahlreicher Erkrankungen bereits einen festen Stellenwert, so insbesondere beim Asthma bronchiale und beim Diabetes mellitus. Zum Teil sind Schulungen daher bereits inte­ graler Bestandteil eines Disease Management Programms. In Westfalen-Lippe werden – neben Schulungen für Menschen mit Asthma bronchiale, atopischer Dermatitis, Brustkrebs, Epilepsie, Arterieller Hypertonie, rheumatischen Erkrankungen, Kopfschmerzen und ADHS – immer mehr Maßnahmen für Personen mit Übergewicht und Adipositas angeboten. Für Letztere steht der geforderte Wirksamkeitsnachweis jedoch noch aus. Bei regional begrenzten Schulungsprogrammen wird die Begutachtung in der Regel vom jeweils zuständigen MDK durch­geführt. Bei bundesweiten oder länderübergreifenden Programmen ist zu prüfen, ob die Begutachtung durch die zuständige Sozialmedizinische Expertengruppe (SEG 3) der MDK-Gemeinschaft erfolgen soll. Dr. med. Thomas Bode ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Sozialmedizin beim MDK Westfalen-Lippe E-Mail: [email protected] Dr. med. Ulrich Heine ist Ärztlicher Direktor und stv. Geschäftsführer des MDK Westfalen-Lippe E-Mail: [email protected] Begutachtungsgrundlagen „Patientenschulungsprogramme“ Grundlage der Begutachtung waren insbesondere die „Gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Förderung und Durch­ führung von Patientenschulungen auf der Grundlage von § 43 Nr. 2 SGB V“ und die Stellungnahmen der jeweiligen medizinischen Fachgesellschaften. Neben strukturierten Schulungskonzepten und pädagogisch aufbereiteten Schulungsmaterialien ist ein fachlich, pädagogisch und psychologisch quali­ fiziertes interdisziplinäres Schulungsteam unabdingbar. Patientenschulungen nehmen nicht nur in Westfalen-Lippe, sondern im gesamten Bundesgebiet an Bedeutung zu. Im Auftrag der Leitenden Ärztinnen und Ärzte der MDK-Gemeinschaft haben die Sozialmedizinischen Expertengruppen „Leistungsbeurteilung/Teilhabe“ (SEG 1), „Versorgungs­strukturen“ (SEG 3) und „Methoden- und Produktbewertung“ (SEG 7) der MDKGemeinschaft die Arbeitshilfe „Begutachtung von Patientenschulungsprogrammen“ erstellt. Diese Arbeitshilfe gilt sowohl für Patientenschulungen für Kinder/Jugendliche als auch für Schulungen für Erwachsene unabhängig von der jeweiligen Gesundheitsstörung. 22 Kranken- und Pflegeversicherung Neue Gefahren durch Online-Spieleplattformen Ambulanz für Spielsucht eröffnet Von Andrea Steidle A m Anfang war es nur ein kleiner Part in einem virtu­ ellen Rollenspiel, der Erik K. faszinierte. Schritt für Schritt verdrängte das Spiel am PC jedoch sein reales Leben. Das Studium lag brach, alte Freunde meldeten sich nicht mehr. Sein Bruder erkannte schließlich die Gefahr und nahm Kontakt zur im März neu eingerichteten Ambulanz für Spiel­sucht am Universitätsklinikum Mainz auf. Diagnose Spielsucht. Darunter wird im klassischen Sinn meist das „Daddeln“ an Automaten oder das „Zocken“ auf der Pferderennbahn oder in einem Spielcasino verstanden. Neben den bekannten Gefahren durch herkömmliche pathologische Glücks­ spiele, bei denen der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht, gibt es jedoch auch eine neue Gefahrenquelle: Medien wie das Internet, das vor allem mit seinen Spieleplattformen seit Anfang der 90er Jahre immer mehr junge Nutzer in seinen Bann zieht. Zeit und Raum im Web aufgehoben Besonders kritisch: Innerhalb einer „Gaming community“ kann man soziales Prestige erwerben, Bindungen aufbauen und pflegen wie im wahren Leben – aber es gibt niemals Aus-Zeiten. Um seinen virtuellen Status zu halten bzw. auszubauen, wird im schlimmsten Fall zu jeder Tagesund Nachtzeit gespielt. Die virtuelle Parallelwelt nimmt immer mehr Raum ein. Für das reale Leben bleibt letztlich kein Platz mehr. Doch wie erkennen Eltern, Verwandte oder Freunde eine akute Gefährdung? Ab wann wird aus dem Spiel Ernst? Ab wann besteht Handlungsbedarf, um diese neuen „Verhaltenssüchte“ zu erkennen und zu therapieren? Die Ambulanz für Spielsucht definiert einige zentrale Kriterien für problematisches Spielverhalten: • Das Spiel bzw. der Medienkonsum tritt über einen längeren Zeitraum (mindestens 12 Monate) in einer von der Norm abweichenden Form auf. • Versuche, das Spielverhalten bzw. den Medienkonsum einzuschränken oder aufzugeben, scheitern wiederholt. • Bei verhinderter Computerspielnutzung treten Entzugs­ erscheinungen auf (Nervösität, Unruhe, Schlafstörungen). •S chulische, berufliche und familiäre Verpflichtungen werden spürbar vernachlässigt. • Spiele bzw. Medien werden zunehmend zur Stimmungs- und Gefühlsregulation eingesetzt. • Anfänglich belohnendes Verhalten wird im Verlauf der Suchtentwicklung als zunehmend belastend empfunden. In den ersten drei Monaten seit Bestehen der Ambulanz für Spielsucht gingen bereits knapp 150 telefonische Anfragen ein, von denen fast 90 Prozent die Computer- und Online-Sucht vor allem junger Spieler betrafen: „Wenn es um Computernutzer zwischen 13 und 17 Jahren ging, so meldeten sich vor allem die Eltern der Betroffenen“, fasst Kai Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, zusammen. Ältere Spieler meldeten sich hingegen meist selbst. 23 Fast alle Betroffenen sind männlich, viele von ihnen Anhänger der Online-Spiele „World of Warcraft“ bzw. des Vorläufers „Warcraft III“. Hierbei handelt es sich um ein Massen-MultiplayerOnline-Rollenspiel, das Spieler gleichzeitig zusammen über das Internet spielen. Soziologen schätzen, dass bereits jeder zwanzigste der weltweit über 9 Millionen Spieler süchtig ist. Finanzierung langfristig noch zu klären Nach einem ersten Vorgespräch wird entschieden, ob ein Betroffener zu einer diagnostischen Sitzung bestellt wird. Bislang betraf dies rund 50 Anrufer. Diese ersten diagnostischen Sitzungen werden über die Krankenkasse abgerechnet. Im Falle einer Anschlusstherapie (in den meisten Fällen Gruppentherapie, wobei die Anhänger pathologischer Glücksspiele und Computerspiele getrennt voneinander behandelt werden) wird diese bislang im Rahmen des einjährigen UniProjekts mitfinanziert. Im kommenden Jahr wird über eine Fortführung des Projektes entschieden und es wird mit den Krankenkassen verhandelt, ob eventuell Integrationsverträge möglich sind. Informationen zur Ambulanz für Spielsucht am Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz finden Sie unter: www.verhaltenssucht.de Andrea Steidle ist Mitarbeiterin im Fachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim MDS E-Mail: [email protected] MDK-Forum 2/2008 Gesundheits- und Sozialpolitik Gesundheitsreform Jetzt kommt der Fonds erst recht! Von Steffen Habit N iemand will den Gesund­ heitsfonds – und dennoch wird er pünktlich starten. Daran wird auch der lautstarke Protest nichts ändern. Sechs Monate vor dem Tag X scheint es sogar, dass die wachsende Kritik die beiden Reform-Müt­ ter Angela Merkel (CDU) und Ulla Schmidt (SPD) regelrecht anspornt. Nach dem Motto: Mögen alle wettern – jetzt kommt der Fonds erst recht! Ulla Schmidt ist als resolute Politikerin bekannt. Doch die Standfestigkeit, die die Rheinländerin derzeit an den Tag legt, beeindruckt selbst den politischen Gegner. Was hat die Gesundheitsministerin nicht alles an Kritik in den letzten Monaten einstecken müssen? Erst brandmarkt der Sachverständigenrat den Fonds als „Missgeburt“. Statt den Wettbewerb im Gesundheitssystem zu stärken, behindere die Reform einen gesunden Konkurrenzkampf, so die „Fünf Weisen“. Ihr vernichtendes Resümee: „Der Gesundheitsfonds in seiner bisher geplanten Ausgestaltung ist durchweg abzulehnen.“ Eine „Autobahnbrücke ohne Autobahn“ Auch die Krankenkassen lassen kein gutes Haar an dem mühsam ausgehandelten Gesundheitskompromiss der Bundesregierung. Die Vorstände warnen vor einem „Fehlkonstrukt“, das sogar die medizinische Versorgung in Deutschland gefährde. Selbst innerhalb der Koalition wächst die Kritik: „Der Fonds ist so überflüssig wie eine Autobahnbrücke ohne Autobahn“, schimpft SPD- MDK-Forum 2/2008 Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und fordert, die Reform endlich einzustampfen. Ganz zu schweigen von den harschen Angriffen der Opposition: „Planwirtschaft à la DDR“ und „Staatsmedizin“ wirft FDP-Chef Guido Westerwelle der Gesundheitsministerin vor. Geschlossener Rücktritt Ulla Schmidt lässt alle Vorwürfe an sich abprallen. Wie quengelnde Kinder auf dem Spielplatz fertigt die Ministerin die Kritiker ab. „Alles Lobbyistengeschrei“, heißt es selbstbewusst aus Berlin. Aber die Pannenserie bei der Vorbereitung für den Fonds reißt nicht ab. Anfang des Jahres wirft der wissenschaftliche Beirat beim Bundesversicherungsamt überraschend das Handtuch. Das Gremium unter Leitung von Professor Gerd Glaeske sollte die Grundlagen für einen neuen Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen entwickeln – in Fachkreisen bekannt als morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (kurz Morbi-RSA). Zu den Gründen für den geschlossenen Rücktritt schweigen die Wissenschaftler. Angeblich habe sich das Bundesgesundheitsministerium allzu sehr in die Arbeit der Experten eingemischt, heißt es. Alles nur Gerüchte, dementiert Ulla Schmidt. Ein „Fonds auf Probe“? Schmidts Gleichgültigkeit ist jedoch brandgefährlich. Schließlich geht es nicht um eine neue Fußgängerampel oder ein paar Parkverbotsschilder, sondern um die medizinische Versorgung von 70 Millionen Versicherten. 24 Wollen am Gesundheitsfonds festhalten: Angela Merkel und Ulla Schmidt Mit dem Gesundheitsfonds wird künftig jedes Jahr die gigantische Summe von 150 Milliarden Euro umverteilt. Schon kleinste Fehler können katastrophale Auswirkungen haben. Experten fordern daher, den Fonds zunächst auf Probe einzuführen. „Jedes Unternehmen testet ein neues System, bevor es eingeführt wird. Nur bei der Gesundheitsreform meint die Politik, auf eine Probephase verzichten zu können“, kritisiert Norbert Klusen, Vorstandschef der Techniker Krankenkasse. Quasi im Blindflug steuern Klusen und seine Vorstandskollegen auf den 1. Januar 2009 zu. Während jedes vernünftige Unternehmen schon jetzt einen Finanzplan für das nächste Jahr aufstellt, bleibt den Kassenschefs nichts anderes übrig als abzuwarten. Erst Anfang November will die Große Koalition den bundeseinheitlichen Kassenbeitrag für 2009 festsetzen und damit die wichtigste Größe bei den Einnahmen. Unklar ist auch die Ausgestaltung des künftigen Finanzausgleichs Gesundheits- und Sozialpolitik Gesundheitsfonds In den Topf fließen ab 2009 die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie die für die gesetzliche Krankenversicherung zur Verfügung gestellten Steuergelder. Aus dem Fonds erhalten die Krankenkassen Pauschalen für jeden ihrer Versicherten. Zusatzbeitrag für Versicherte Kommt eine Kasse mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht aus, kann sie von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag verlangen. Dieser Zusatzbeitrag wird entweder einkommensabhängig oder pauschal erhoben. Einen Zusatzbeitrag bis zu acht Euro muss jeder bezahlen. Übersteigt der Zusatzbeitrag diese Grenze, greift eine Härtefallregelung: Danach darf der Zusatzbeitrag ein Prozent des beitragspflichtigen Einkommens des Mitglieds nicht übersteigen. Einheitlicher Beitragssatz Erstmals legt ab 2009 die Politik die Beitragshöhe jährlich neu fest. Das heißt: Alle gesetzlich Krankenversicherten zahlen den gleichen Beitrag. Bisher haben die Verwaltungsräte der Krankenkassen über die Höhe der jeweiligen Beiträge entschieden. Morbidititätsorientierter Risikostrukturausgleich Der seit 1994 bestehende Risikostrukturausgleich (RSA) wird erweitert. Mit dem neuen Morbi-RSA erhalten Krankenkassen für ihre Versicherten mit bestimmten schweren Erkrankungen höhere Pauschalen aus dem Gesundheitsfonds, weil die Behandlung teurer und aufwendiger ist. 80 Krankheiten wurden dazu definiert. Steuerzuschuss Für Aufgaben, um die sich eigentlich der Staat kümmern müsste (z. B. Leistungen für Mütter) sollen die Steuermittel schrittweise ausgebaut werden. 2009 soll ein Bundeszuschuss in Höhe von vier Milliarden Euro fließen. zwischen den Krankenkassen. Zwar hat das Bundesversicherungsamt nach monatelangem Streit eine Liste der 80 Krankheiten vorgelegt, die künftig für den Morbi-RSA berücksichtigt werden. Die Höhe der Zuschläge wird allerdings ebenfalls erst im Herbst errechnet. Kassen können Pleite gehen Da nützt es den Kassen wenig, dass sich Schwarz-Rot zumindest beim Insolvenzrecht geeinigt hat. Künftig können theoretisch alle gesetzlichen Krankenkassen Pleite gehen. Bisher waren nur Kassen unter Bundesaufsicht wie Barmer oder DAK insolvenzfähig. Allerdings soll eine Kassen-Pleite unter allen Umständen verhindert werden. „Die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse sind nur die Ultima Ratio“, verkündet Regierungssprecher Ulrich Wilhelm. Gerät eine Versicherung dennoch in finanzielle Schieflage, greifen künftig verschiedene Rettungsmechanismen. Zunächst sollen die Kassen der gleichen Kassenart einspringen – also etwa andere Ortskrankenkassen. Reicht die Finanzhilfe nicht aus, müssen im Notfall auch andere Krankenkassen Beistand leisten. Diese Regelung stößt auf heftige Kritik: „Der Versicherte zahlt aus der eigenen Tasche die Insolvenz einer 25 Kasse, die er vielleicht gerade vom Hörensagen kennt“, warnt der Vorstandsvorsitzende der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH), Ingo Kailuweit. Dies sei „grotesk und höchst unsozial“. Auch aus Bayern, das sich zuletzt erstaunlich versöhnlich gegenüber Ulla Schmidt und dem Gesundheitsfonds geäußert hat, kommt Kritik: „Ich lehne die im Referentenentwurf vorgesehene Zwangsfusion von Krankenkassen strikt ab!“, betont Bayerns Sozialministerin Christa Stewens (CSU). So will Ulla Schmidt dem Spitzenverband Bund das Recht einräumen, im Rahmen von Sanierungsbemühungen fusionsunwillige Krankenkassen zur Vereinigung mit einer anderen Kasse zu zwingen. „Das hat mit freiwilliger Vereinigung nichts mehr zu tun“, kritisiert Stewens. Dadurch werde die Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen „erheblich geschmälert“. Schlechte Umfrageergebnisse Insolvenzgesetz, Morbi-RSA und bundeseinheitlicher Beitragssatz – sechs Monate vor dem Start des Gesundheitsfonds sind noch viele Baustellen offen. Die Bevölkerung sieht die Arbeiten an der Reform zunehmend kritisch: Zwei Drittel der Bürger lehnen den Gesundheitsfonds ab. Mehr als 80 Prozent würden den Start um ein bis zwei Jahre verschieben, ergab eine Umfrage der Techniker Krankenkasse. Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsministerin Ulla Schmidt lassen die Zahlen kalt. Jeder Rückzug, jede Korrektur würde ihre Macht­ position in der Regierung schmälern. Doch die Umfragen haben auch ihre positive Seite: Offenbar erwartet niemand Verbesserungen im Gesundheitswesen – da kann die Reform im Zweifelsfall nur positiv überraschen. Steffen Habit ist Redakteur im Politikressort des Münchner Merkur MDK-Forum 2/2008 Gesundheits- und Sozialpolitik Demenz Vorzeigeprojekte in Rheinland-Pfalz Von Malu Dreyer und Dr. Gundo Zieres U m die Versorgung von Menschen mit Demenz zu verbessern, hat die Bundesre­ gierung das Projekt Leuchtturm „Demenz“ aufgelegt. Ziel des Projektes ist es, aus den vorhan­­ denen Versorgungsangeboten die besten zu identifizieren und weiter zu entwickeln. Zu den 29 vorbildlichen Projekten, die die Bundesregierung in den Jahren 2008 und 2009 mit ins­ gesamt 13 Mio. Euro fördert, sind auch drei Projekte mit Trägern aus Rheinland-Pfalz. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) fördert Projekte in den Themenfeldern: • Therapie- und Pflegemaßnahmen: Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen • Evaluation von Versorgungsstrukturen • Sicherung einer evidenzbasierten Versorgung • Evaluation und Ausbau zielgruppenspezifischer Qualifizierung Projektträger in Rheinland-Pfalz Die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Demenz ist als gesellschaftliche Herausforderung ein wichtiger landespolitischer Schwerpunkt in RheinlandPfalz. Die vielfältigen Aktivitäten im Land finden auch bei der Vergabe und Durchführung unterschiedlichster Projekte ihren Niederschlag. Aktuell haben drei Projekte aus Rheinland-Pfalz den Zuschlag für die Teilnahme am Leuchtturm-Demenz-Programm des BMG bekommen. Träger der drei Projekte in RheinlandPfalz sind der Medizinische Dienst der Krankenversicherung MDK-Forum 2/2008 (MDK) in Alzey, die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz und der Verein Projekt 3 e.V., ein Anbieter von sozialen Dienstleistungen mit Sitz in Mayen. werden sollten und wie diese einzuleiten und umzusetzen sind. Der MDK wird die positiven Effekte für die Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter evaluieren. Projektinhalte Berufsgruppenübergreifende Qualifizierung zu Demenz Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz erprobt zur Verbesserung der Frühdiagnostik ein Quali­ fizierungsprogramm für Hausärztinnen und Hausärzte und vernetzt die medizinische und psychosoziale Beratung für betroffene Familien. In einer Pflegeoase des Trägers Projekt 3 e.V. geht es um die vergleichende Evaluation der Versorgung und die Lebensqualität von Menschen mit schwerer Demenz durch den Arbeitsschwerpunkt Gerontologie und Pflege an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg in Kooperation mit dem Institut für Gerontologie der Uni Heidelberg. Das Projekt „Berufsgruppenübergreifende Qualifizierung zu Demenz“ des MDK RheinlandPfalz ist im Themenfeld „Evaluation und Ausbau zielgruppenspezifischer Qualifizierung“ angesiedelt. Der MDK wird untersuchen, welche personellen Qualifizierungsmaßnahmen in stationären Pflegeeinrichtungen bereits umgesetzt wurden (vorhandene Qualifizierungen) und welchen Nutzen sie für die Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Darüber hinaus wird er Vorschläge dazu machen, welche Optimierungspotenziale ggf. noch genutzt 26 Eine wesentliche Voraussetzung für die Pflege, Förderung und Begleitung von Menschen mit Demenz in stationären Pflegeeinrichtungen ist die umfassende Qualifizierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Spezifisches Wissen über die Erkrankung Demenz, die daraus resultierenden Symptome und Verhaltensweisen müssen bekannt sein, um das Verhalten von Menschen mit Demenz verstehen, interpretieren und adäquat reagieren zu können. Daneben ist der Umgang mit Menschen mit Demenz geprägt von der Haltung und Wertschätzung, die ihnen seitens der Pflege­ personen entgegengebracht wird. Sie ist essentiell, damit auch Menschen mit Demenz trotz ihrer kognitiven Einschränkungen Wohlbefinden, Kompetenz, Beschäftigung und Nützlichkeit empfinden können. Mit den in diesem Projekt durchgeführten Maßnahmen und Instrumenten soll dazu ein wesentlicher Beitrag geleistet werden. Bei dem Projekt geht es daher konkret um Maßnahmen, die über die unmittelbare Schulung und Wissensvermittlung hinausgehen und Ansätzen einer Organisationsentwicklung nahe kommen. Organisationen bzw. Orga­nisationseinheiten (Wohn- Gesundheits- und Sozialpolitik • eine wertschätzende Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden? • die Mitarbeiterzufriedenheit und ihr Belastungserleben verändert werden? Ausblick Das Verhalten von Menschen mit Demenz richtig verstehen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen – eine große Aufgabe für Pflegeeinrichtungen bereiche) werden als komplexe Systeme verstanden, die Qualifizierungsmaßnahmen dementsprechend für alle Hierarchieebenen der Einrichtung ange­­boten und auf ihre jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Diese an den Nutzern ausgerichtete Umsetzung verspricht die größtmögliche Wirkung und Nachhaltigkeit. Die für die Patientinnen und Patienten erfahrbaren und relevanten Aspekte stehen im Fokus aller Bemühungen. Mit Hilfe geeigneter Test- und Beobachtungsverfahren werden die Auswirkungen von Qualifizierungen auf diesen Bereich untersucht. dieser Maßnahmen auf patienten­ relevante Parameter. Im Rahmen dieses Projekts sollen die folgenden Fragestellungen bezogen auf die Bewohnerinnen und Bewohner bearbeitet werden: Kann/ können durch die Qualifizierungs­ maßnahmen Ziele des Projektes • das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner verbessert werden? • Beschäftigung und Betreuung demenzspezifisch gefördert werden? • eine Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner in Alltagsaktivitäten gefördert werden? • Eigenaktivitäten/Eigenständigkeit bei den ADL (z. B. Essen) erreicht werden? • herausforderndes Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner vermindert werden? • der Einsatz von psychotropen Medikamenten (z. B. Neuroleptika) vermindert werden? • die Ernährung und Flüssigkeits­ versorgung verbessert werden? Ziel des Projektes ist die wissenschaftliche Evaluation und Erprobung von vorhandenen Qualifizierungsmaßnahmen in der vollstationären Pflege unter Berücksichtigung der Auswirkungen Im Rahmen dieses Projekts sollen die folgenden Fragestellungen bezogen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeitet werden: Kann durch die Qualifizierungsmaßnahmen Für das methodische Vorgehen konzipiert der MDK RheinlandPfalz eine Interventionsstudie mit quantitativen und qualitativen Untersuchungen. Als Datenbasis werden validierte Test- und Beob­ achtungsverfahren sowie struk­ turierte Mitarbeiterbefragungen genutzt. 27 Nach Abschluss der Projektdokumentation werden die wesentlichen Erkenntnisse in einem Handbuch zusammengefasst und veröffentlicht. Andere Pflegeeinrichtungen können es nutzen, um ein erfolgreiches Konzept zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu etablieren. Der trägerübergreifende Charakter dieses Projektes in Rheinland-Pfalz gewährleistet eine Multiplikatorenfunktion der teilnehmenden Einrichtungen. Darüber hinaus sollen die Ergeb­nisse des Modellprojektes durch das bereits existierende Beratungs­team des MDK Rheinland-Pfalz auch für andere stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen nutzbar gemacht werden. Wie das Projekt des MDK Rhein­land-Pfalz exemplarisch zeigt, betreffen die für Rheinland-Pfalz ausgewählten Projekte zentrale Fragen der Versorgung von Menschen mit Demenz. Früherkennung, Qualifizierung und die Betreuung in einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz sind Ziele, denen sich alle Einrichtungen, Dienste und die Ärzteschaft stellen müssen. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich deshalb auch an der Förderung der Vorhaben und unterstützt die Projekte im weiteren Verlauf. Malu Dreyer, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz Dr. rer. oec. Gundo Zieres Geschäftsführer des MDK Rheinland-Pfalz E-Mail: [email protected] MDK-Forum 2/2008 Gesundheits- und Sozialpolitik Bessere Koordination von Beratung und Betreuung BMG wählt Pilot-Pflegestützpunkte aus Von Andrea Steidle U m die Pflege von Angehö­ rigen zu organisieren, sich über Unterstützungsangebote zu informieren und geeignete Lösungen zu finden, sind bis­ lang meist viele Amtsgänge und Ansprechpartner nötig. Das soll nun anders werden: Durch zentrale und vernetzte Pflege­ stützpunkte als erste Anlaufund Informationsstellen soll ein großer Teil dieser Umwege künftig entfallen. Ziel dieses mit dem Pflege-Weiter­­ entwicklungsgesetz aufgelegten Projektes der Bundesregierung ist es, in allen Bundesländern Pflegestützpunkte und Pflegeberatung zunächst modellhaft zu erproben. Jeder Pilot-Stützpunkt wird bis Ende 2008 mit 30.000 Euro gefördert; für das Modellprogramm steht eine Mio. Euro zur Verfügung. Ab dem 1. Juli, wenn das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft tritt, müssen die Länder die Entscheidung über die flächen­deckende Versorgung mit Pflege­stützpunkten jeweils einzeln treffen. Insgesamt werden hierfür 60 Mio. Euro bereitgestellt. 16 Pilot-Pflegestützpunkte ausgewählt Bereits zu Beginn des Jahres fand im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Auftaktveranstaltung zum Modell­ projekt „Werkstatt Pflegestützpunkte und Pflegeberater“ statt. Mitte März hat das BMG dann 16 Pilot-Pflegestützpunkte – je einen pro Bundesland – ausgewählt. Sie sollen nun Erfahrungen im Aufbau einer „quartiersnahen Beratungsstelle“ und im praktischen Betrieb sammeln. Dabei soll das Rad nicht neu erfunden MDK-Forum 2/2008 werden, sondern bereits vorhandene Angebote sollen maximal genutzt, sukzessive ausgebaut und künftig bes­ser miteinander vernetzt werden. Geplant ist unter anderem, dass sich die beteiligten Pflegestützpunkte regelmäßig in regionalen Konferenzen über ihre Erfahrungen austauschen, ihre Ergebnisse dokumentieren und in Form von Handlungsempfehlungen an interessierte Träger weitergeben. Neben Beratung sollen die neuen Pflegestützpunkte vor allem eine Vernetzung pflegerischer, medizinischer, rehabilitativer und sozialintegrativer Angebote leisten. Wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden die Projekte vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) in Köln. Pflegestützpunkt Berlin In Berlin ist das Pilotprojekt im März an gleich zwei Stellen offiziell angelaufen. Federführer bzw. Trä­ger der neuen Pflegestützpunkte Köpenick und Kreuzberg sind die Koordinierungsstellen „Rund ums Alter Treptow-Köpenick (Albatros e.V.)“ und „Rund ums Alter Friedrichshain-Kreuzberg (Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.)“. Seit 1999 verfügt Berlin mit den Koordinierungsstellen „Rund ums Alter“ über ein flächen­­ deckendes Netz von Beratungsstellen für ältere, behinderte und pflegebedürftige Menschen – gute Voraussetzungen für das Modell­ projekt: „Unser zentrales Ziel ist es, den Verbleib älterer Menschen in der eigenen Häuslichkeit oder die Rückkehr dorthin zu ermög- 28 lichen“, sagt Andrea Schulz vom Pflegestützpunkt Köpenick. „Und seit vielen Jahren verfügen wir über Kompetenzen und Erfahrungen in der psychosozialen Beratung, der Pflegeberatung, im Case Management sowie über fundierte sozialrechtliche Kenntnisse zur leistungserschließenden Beratung“, ergänzt Gisela Seidel vom Pflegestützpunkt Kreuzberg. Verbindliche Pfade auf der Systemebene entwickeln Was hat sich seit März in der Arbeit der Koordinierungsstellen konkret geändert? „Zur Zeit beschäftigen uns vor allem Kooperationsgespräche mit verschiedenen Partnern, zum Beispiel mit einer Kranken- und Pflegekasse, der bezirklichen Verwaltung oder speziellen Fachkräften“, beschreibt Gisela Seidel. Kooperationen gab es zwar auch zuvor bereits auf der Einzelfallebene, aber nun sollen „verbindliche Pfade auf der Systemebene“ entwickelt werden. Darüber hinaus gilt es, die Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Institutionen zu fördern, die für die Versorgung von pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zuständig sind. Denn Ziel ist es, auch für jüngere Pflegebedürftige adäquate Beratung zu erbringen. Umgestaltung zum offenen Bürgerbüro In den kommenden Wochen werden die Räume Stück für Stück so gestaltet, dass sie auch von außen deutlich als Bürgerbüro erkennbar sind. „Bei uns können Interessenten Angebote auch selbst am Rechner recher- Gesundheits- und Sozialpolitik chieren, aber die individuelle und persönliche Beratung ist und bleibt natürlich unser Kerngeschäft“, sagt Gisela Seidel. Vor allem dabei ist die Koordinierungsstelle künftig auf die Zusammenarbeit mit externen Experten wie Pflegekräften, Ärzten und Therapeuten angewiesen. Ab Juli folgt die konkrete Ansprache der Klientel, um diese auf mögliche Hilfen im Gesundheits­ wesen aufmerksam zu machen. Das Land Berlin will auch länger­ fristig an den Pflegestützpunkten festhalten, somit bleibt in den kommenden Jahren viel zu tun. Wie die Pflegestützpunkte nach Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes weiter in Erscheinung treten und wie sie ausgestattet sein werden, wird Gegenstand zukünftiger Verhand­ lungen sein. Pflegestützpunkt Langenhagen Anfang April hat in Langenhangen bei Hannover der erste PilotPflegestützpunkt in Niedersachsen seine Arbeit aufgenommen. Träger ist die „Region Hannover“. Sie kooperiert dabei mit dem Ver­ band der Angestellten-Krankenkassen (VdAK), der Stadt Langen­ hagen und einem ortsansäs­sigen Pflegedienst (als einziger Dienst im Ort auch Fachpflegedienst für Psychiatrie). Auch das „Caritas Forum Demenz“ bringt sein Wissen in das Projekt ein. Neben Leistungen des ambulanten Pflegedienstes und der stationären Pflege soll der Fokus hier langfristig auf den ehrenamtlichen Angeboten liegen. Im Unterschied zu Berlin wurde dieser Stützpunkt komplett neu eingerichtet. Bislang gab es ledig­lich ein Servicetelefon. „Seit April ging bei uns alles von Null auf Hundert“, beschreibt Tanja Krug, bei der „Region Hannover“ zuständig für Fragen der vertraglichen Koordination. In zentraler Lage wurden neue Räume angemietet, die während der Öffnungszeiten mit drei Mitarbeitern besetzt sind. Anfang April hat in Langenhangen bei Hannover der erste Pilot-Pflegestützpunkt in Niedersachsen seine Arbeit aufgenommen Bisher gute Resonanz Im Juni wurde das Angebot weiter ausgebaut ausgebaut: „Jetzt werden auch regelmäßige Beratungen angeboten, beispiels­weise zu diabetischen Pflegeproblemen und zur Palliativpflege“, sagt Tanja Krug. Auch ein Wohn­­berater bietet seit Juni seine Sprechstunde im Stützpunkt an. Das Projekt erfährt derzeit viel Aufmerksamkeit durch Pressearbeit, außerdem hilft die zentrale Lage am Marktplatz: Die Fenster des neuen Pflegestützpunktes wurden mit Werbung beklebt, ein großer Aufsteller weist vor allem Angehörigen von Pflegebedürftigen den Weg in die erste Etage, und Info-Flyer wurden ebenfalls in Auftrag gegeben. Dafür, dass erst vor wenigen Wochen mit den Arbeiten begonnen wurde, sind die Mitarbeiterinnen und Mit­ arbeiter des Projektes mit den bisherigen Erfolgen schon sehr zufrieden. Erste Bilanz und Bewertung des KDA Auch wenn ein offizieller Zwischenbericht noch aussteht, äußerte sich das KDA in der Hauszeitschrift „ProAlter“ (Ausgabe 1/2008) schon vorab zum Gesamtprojekt: Die bisherigen An- 29 sätze seien zwar chancenreich, ein erster Überblick über die PilotStützpunkte habe allerdings gezeigt, dass die bislang vorhandenen Beratungsstrukturen noch ausbaufähig seien. „Alles, was gut ist, soll und muss auch für die Pflegestützpunkte genutzt werden“, sagt Andreas Kutschke, Referent für Pflegeorganisation im KDA-Fachbereich Soziales & Pflege. Es sei sinnvoll, bereits bestehende Strukturen zu einem „koordinierten und flächen­ deckenden Netz von Pflege­stütz­ punkten um- und aus­zubauen, wenn diese sich zudem zu einer noch zu bestimmenden Beratungs­ qualität verpflichten“. Andreas Kutschke: „Doppelstrukturen sind weder geplant noch erwünscht“. Weiterer Ablauf des Projektes Ab dem 1. Juli steht die Entscheidung über die flächendeckende Versorgung mit Pflegestützpunkten an. Bis dahin soll das KDA dem BMG einen Bericht über die Konstituierungsphase und erste Projektergebnisse vorlegen. Der Abschlussbericht wird im Juni 2010 erwartet. Andrea Steidle ist Mitarbeiterin im Fachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim MDS E-Mail: [email protected] MDK-Forum 2/2008 Gesundheits- und Sozialpolitik Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte „Mein Essen zahl’ ich selbst“ Von Friederike Geisler S eit eineinhalb Jahren setzt sich die Initiative „Mezis – Mein Essen zahl‘ ich selbst“ – für die Unabhängigkeit bei Me­ dikamenten-Verordnungen ein. Ihre Mitglieder verzichten auf Besuche, Geschenke und An­ gebote von Pharma-Vertretern und garantieren ihren Patienten so eine interessenunabhängige Behandlung. Doch die meisten Ärzte sehen kein Problem in der Werbung durch die Unter­ nehmen. Wenn Dr. P. seine Woche gut plant, kommt er durch, ohne auch nur für ein einziges Essen bezahlen zu müssen: Er wandert von Fortbildung zu Fortbildung und „staubt“ auf diesem Weg auch noch das ein oder andere Werbe-Geschenk ab. Die Kehrseite der Medaille: All das wird von Pharma-Firmen gesponsert, die im Gegenzug ihre neuesten Medikamente an den Mann bringen wollen. 15.000 Vertreter von Unternehmen besuchen täglich die deutschen Praxen. Die Initiative „Mezis – Mein Essen zahl‘ ich selbst“ wehrt sich gegen die Beeinflussung der Medizin durch die Industrie. Das Neueste ist nicht immer das Beste Die Marketing-Strategen der Pharma-Konzerne lassen es sich einiges kosten, wenn es um Werbung geht: Neben Geschenken und kostenfreien Fortbildungen bieten einige Unternehmen sogar ganze Reisen an. Alles mit dem Ziel, das Verordnungsverhalten der Ärzte zu beeinflussen. Und es wirkt: „Die Ärzte selbst schätzen 64 Prozent ihrer Kollegen als beeinflussbar ein“, sagt MDK-Forum 2/2008 Dr. med. Arne Schäffler, Gründer der Initiative, „sich selbst halten sie natürlich für immun.“ Die Folgen der „Manipulation“ können schwerwiegend sein: „Die Unternehmen preisen vorrangig ihre neusten – und zumeist auch teuersten – Produkte an. In vielen Fällen gibt es eine günstigere Alternative, die manchmal sogar besser für den Patienten ist. Und das Wohl des Patienten sollte in der Praxis an erster Stelle stehen.“ Oft sind die beworbenen Produkte noch nicht sehr lange auf dem Markt: „Es kommt vor, dass die Nebenwirkungen noch nicht hinreichend erforscht sind. Das ist sehr gefährlich“, erklärt Dr. Schäffler. Hinzu kommt, dass dadurch die Arzneimittellausgaben ansteigen. „Die Umsatzprognosen gehen in schwindelerregende Höhen. Das ist irgend­wann nicht mehr bezahlbar.“ Die Forderungen von Mezis Dem will sich die Initiative von Dr. Schäffler, der selbst schon bei einer Pharma-Firma gearbeitet hat und deshalb mit der Marketing-Praxis vertraut ist, entgegen setzen: „Wir fordern: Keine Besuche von Pharma-Vertretern mehr bei niedergelassenen Ärzten. Außerdem sollte nur noch eine manipulationsfreie Praxis-Software genutzt werden – viele Programme machen Medikamen­ ten-Vorschläge bei der Rezeptausstellung, weil sie von den Un­ternehmen programmiert worden sind. Außerdem müssen die Fortbildungen unabhängig sein.“ Mehr Vertrauen Mit ihren 100 Mitgliedern ist die Initiative, die der Augsburger 30 Dr. med. Arne Schäffler, Gründer der Initiative Mezis Mediziner vor eineinhalb Jahren mitgegründet hat, noch relativ klein. Vielen Ärzten fällt die Umstellung nicht leicht oder sie empfinden die Werbung nicht als problematisch. „Klar ist, als Mitglied verzichtet man auf die geldwerten Leistungen der Hersteller“, sagt Dr. Schäffler, „aber die Vorteile liegen auf der Hand: Das Vertrauen der Patienten ist wieder hergestellt. In den Praxen unserer Mitglieder hängen Plakate, auf denen steht, dass die Patienten bei ihrem Arzt nur das verschrieben bekommen, was ihnen wirklich hilft. Wir erhalten unglaublich viele Anfragen von Leuten, die wissen wollen, ob sie in ihrer Nähe einen MezisArzt finden.“ Neue Mitglieder sind der Initiative herzlich willkommen. Der Verein erhebt eine Gebühr von 80 Euro im Jahr. Dadurch, dass die Mezis dezentral arbeitet, ist eine Mitgliedschaft nicht ortsgebunden. Weitere Informationen unter: www.mezis.de Friederike Geisler ist Mitarbeiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation beim MDK Niedersachsen E-Mail: [email protected] Organisation und Management MDS mit neuem Träger Umstieg mit Augenmaß Von Caroline Jung J etzt wird es ernst. Der Um­ bau in der GKV, der mit dem Inkrafttreten des GKVWettbewerbsstärkungsgesetzes begonnen hat, läuft auf Hoch­ touren. Der 1. Juli 2008 markiert für den MDS das Ende der Vor­ bereitungsphase: Er geht in die Trägerschaft des Spitzenverban­ des Bund der Krankenkassen über. Wenn am 1. Juli der Spitzenverband Bund offiziell die gesetzlichen Aufgaben der Spitzenverbände der Krankenkassen übernimmt, steht auch sein Medizinischer Dienst in den Startlöchern: Den Spitzenverband Bund in allen medizinischen Fragen zu beraten und die Zusammenarbeit der Medizinischen Dienste in medizinischen und organisatorischen Fragen zu koordinieren, das hat der Gesetzgeber dem neuen MDS als Aufgaben zugewiesen. Bei seinen Koordinationsaufgaben haben die Länder-MDK den MDS zu unterstützen. Was ändert sich denn nun? Der MDS agiert auch zukünftig als eingetragener Verein. So konnte eine problemlose Überleitung erfolgen und ein Zeichen für Kontinuität gesetzt werden. Hauptplayer ist der Spitzenverband Bund. Ihm stehen als fördernde Mitglieder die bisherigen Spitzenverbände zur Seite. Auch die Medizinischen Dienste können fördernde Mitglieder des MDS werden – mehr als zwei Drittel der MDK sind bereits dabei. Zentrales Selbstverwaltungsorgan des neuen MDS ist sein Verwaltungsrat. Er wird künftig die gesundheitspolitische Aus- richtung des MDS bestimmen, die Satzung beschließen und über den Haushalt entscheiden. Dem Verwaltungsrat gehören je sieben Versicherten- und Arbeitgebervertreter an, die der Verwaltungsrat des Spitzenverband Bund aus seinen Reihen gewählt hat. Dazu kommen zwei Vorstandsmitglieder des Spitzenverbandes Bund. Diese 16 Mitglieder sind stimmberechtigt. Außerdem nehmen je ein Mitglied aus den Vorständen bzw. den Geschäftsführungen der Kassenarten an den Beratungen teil. Die fördernden Mitglieder aus den Reihen der MDK schicken insgesamt je zwei Vertreter aus ihrer Selbstverwaltung und zwei Hauptamt­liche in den Verwaltungsrat. Komplettiert wird der Verwaltungsrat durch die Geschäftsführung des MDS, die den Verwaltungsrat berät. Über die Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder in die Beratungen eingebunden, insbesondere wenn es um Leitlinien und Grundsätze für die Förderung der Zusammenarbeit in der MDK-Gemeinschaft und mit den Krankenkassen geht. Die Mitgliederversammlung kann Empfehlungen an den Verwaltungsrat geben. Rückkoppelungsmechanismen ausgebaut Beratungen und Beschlüsse des MDS-Verwaltungsrates setzen häufig die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Medizinischen Dienste. Außerdem sollen die MDK den MDS in seiner Koordinierungsrolle u­nterstützen. Deshalb wollen und sollen sie sich in die Beratungen des MDS einbringen. 31 Ein Instrument hierfür ist die fördernde Mitgliedschaft im MDS. Sinnvolle Unterstützung basiert auf sinnvoller Einbindung. Deshalb ist die Einrichtung eines Beirates für MDK-Koordinierungsfragen vorgesehen, der dem Verwaltungsrat des MDS gegenüber Empfeh­lungen abgeben kann. In ihm sollen Hauptamtliche aus den Reihen der fördernden Mitglieder vertreten sein. Zwei Beiratsmitglieder sollen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen. Über die konkrete Ausgestaltung will der MDS-Verwaltungsrat im August entscheiden. Parallel zur Neu-Konstituierung des MDS wurde die Einrichtung eines Kooperationsrates in der MDK-Gemeinschaft beschlossen. Er löst die bisherige Konferenz der Selbstverwalter ab. Die Neuerung: Der Kooperationsrat kann und soll Beschlüsse mit bindender Wirkung fassen. Grundlage dafür ist der Abschluss eines Kooperationsvertrages durch MDK und MDS. Darin verpflichten sich die Vertragspartner, auf definierten Gemeinschaftsfeldern zusammen zu arbeiten und Beschlüsse des Kooperationsrates auf diesen Feldern gemeinsam umzusetzen. Als Gemeinschaftsfelder wurden insbesondere die Einheitlichkeit und Qualitätssicherung der sozialmedizinischen Beratung und Begutachtung, die Tarifpolitik, die EDV-Entwicklung und die gemeinsamen Kompetenz-Einheiten festgelegt. Caroline Jung leitet das Fachgebiet Selbstverwaltungsangelegenheiten beim MDS E-Mail: [email protected] MDK-Forum 2/2008 Organisation und Management „Inhaltlich steht der Übergang für Kontinuität“ Interview mit Dieter F. Märtens und Dr. Volker Hansen, den neuen Verwaltungsratsvorsitzenden des MDS A m 1. Juli nimmt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen seine Ar­ beit auf, und der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen geht in seine Trägerschaft über. Die Zusammenarbeit in der MDKGemeinschaft wird zudem mit dem Kooperationsvertrag auf verbindlichere Füße gestellt. MDK-Forum sprach mit den neuen MDS-Verwaltungsrats­ vorsitzenden Dieter F. Märtens und Dr. Volker Hansen über die Aus­wirkungen auf die künftige Arbeit der Medizini­ schen Dienste. ? MDK-Forum: Der 1. Juli markiert einen Umbruch: Der Spitzenverband Bund übernimmt von diesem Datum an alle gesetzlichen Aufgaben der bisherigen Spitzenverbände. Gleichzeitig konstituiert sich der MDS unter der neuen Trägerschaft des Spitzenverbandes Bund. Welche Auswirkungen werden diese Veränderungen auf die Arbeit von MDS und Medizinischen Diensten haben? ! Dr. Volker Hansen: Für den MDS ist nun klar festgelegt, dass er der Berater des neuen Spitzen­ verbandes Bund der Krankenkassen ist – und zwar in medizinischen und pflegefachlichen Fragen. Damit sind die Zuständigkeiten klargestellt. Inhaltlich steht der Übergang für Kontinuität: Der MDS wird dem neuen Träger – wie bisher schon den Spitzenverbänden – als kompetenter Berater in allen Versorgungs- und Strukturfragen unseres Gesundheitswesens zur Seite MDK-Forum 2/2008 stehen. Dies gilt unverändert auch für die medizinische Beratung des Spitzenverbandes Bund in den Arbeitsgremien der gemeinsamen Gesundheitsselbstverwaltung. ! Dieter F. Märtens: Der Gesetzgeber hat aber nicht nur die Beratungsfunktion des MDS im Dieter F. Märtens Gesetz fixiert. Es war uns als Selbstverwaltung der Spitzenverbände ein Anliegen, die Koor­ dinationsrolle des MDS klarer zu fassen, die neben den medizinischen auch organisatorische Felder einschließt. Und: Die Medizinischen Dienste der Länder sind verpflichtet, den MDS bei seiner Koordinationsaufgabe zu unterstützen. Hier gilt es, mehr Gemeinsamkeit zu entwickeln – dafür schafft der Kooperationsvertrag neue Voraussetzungen. ? MDK-Forum: In der Vergangenheit gab es zwischen Medizinischen Diensten und MDS Differenzen zum Beispiel über den Einfluss des MDS und damit der Spitzenverbände auf das 32 Geschehen in den Medizinischen Diensten. Früher gab es eine Kooperationsvereinbarung, jetzt gibt es einen Kooperationsvertrag: Was versprechen Sie sich von den neuen Regelungen? ! Dieter F. Märtens: Hintergrund der Differenzen zwischen Bundes- und Landesebene in der Vergangenheit war doch folgender: Die Spitzenverbände wollten auf wichtigen organisatorischen Felder, die den MDK betreffen, zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen. Dazu haben sie sich vorbehalten, nicht nur in medizinischen, sondern auch in wich­ tigen organisatorischen Fragen, ein Wort mitzureden. Das war letztlich auch der Ansatz, den wir mit der Kooperationsvereinbarung verfolgt hatten. Die Kooperationsvereinbarung setzte aber auf Freiwilligkeit und sah keinerlei Sanktionen für den Fall vor, wenn sich ein MDK nicht an gemeinsame Beschlüsse hielt. Deshalb hat sich die Selbst­ verwaltung nun stärker in die Pflicht genommen und eine Lösung aus eigener Kraft entwickelt. Nach dem neuen Kooperationsvertrag erhalten Vertragspartner nicht nur Rechte, sondern sie verpflichten sich auch, Beschlüsse auf den im Kooperationsvertrag genannten Gemeinschaftsfeldern umzusetzen. ! Dr. Volker Hansen: Die neuen Regelungen sind klar und verbindlich. Wer dem Vertrag beitritt weiß, was ihn erwartet. Ich gehe davon aus, dass alle, die bis jetzt schon beigetreten sind und noch beitreten werden, dies Organisation und Management mit der notwendigen inneren Überzeugung getan haben, diesen Vertrag auch konkret zu „leben“. Nur über die Verständigung auf Themenbereiche, auf denen man gemeinsam handeln und verfahren will, werden wir zu einem Mehr an Gemeinschaft kommen. Wobei – und auch das will ich klar sagen – es nur um solche Bereiche geht, auf denen Gemeinsamkeit Sinn macht und wo sie zu mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt. Der Kooperationsvertrag ist kein Instrument der Gleichmacherei! Die Medizinischen Dienste haben weiterhin alle Chancen, in organisatorischen Fragen in den Wettbewerb um beste Verfahren und Abläufe einzutreten. Dr. Volker Hansen ? MDK-Forum: Die bisherigen Spitzenverbände bleiben weiter Mitglieder des MDS. Bildet sich der Konflikt zwischen starkem Spitzenverband Bund und Kassenarten-Verbänden mit Wettbewerbsorientierung dann nicht auch in den MDS-Gremien ab? ! Dr. Volker Hansen: Wir haben in der gesetzlichen Krankenversicherung schon immer ein Nebeneinander von wettbewerblichen Bereichen und von solchen Feldern, die wir bisher unter dem Rubrum „gemeinsam und einheitlich“ abgehandelt haben. Klar ist nach dem GKVWSG, dass für den letztgenannten Bereich zukünftig der Spitzenverband Bund allein die Verantwortung trägt. Die wettbewerblichen Felder fallen in die Zuständigkeit der bisherigen Spitzenverbände bzw. deren Nachfolgeorganisationen. Klar ist auch, dass das die Diskussionen auch in den Gremien des neuen MDS beleben wird. Da solche Diskussionen aber auch in den vergangenen Jahren im Vorstand des MDS geführt wurden, ist mir davor nicht bange. ? MDK-Forum: Welchen Einfluss werden die bisherigen Krankenkassen-Verbände auf die inhaltliche Arbeit des MDS nehmen können? ! Dieter F. Märtens: Durch die Neufassung der Satzung, die am 1. Juli in Kraft tritt, werden sie zu fördernden Mitgliedern im neuen Verein MDS. Sie sind damit in der Mitgliederversammlung des MDS vertreten und beraten mit über Leitlinien und Grundsätze für die Förderung der Zusammenarbeit in der MDK-Gemeinschaft und mit den Krankenkassen. Entsprechend können sie ihren Einfluss über die Mitgliederversammlung geltend machen und Empfehlungen für den Verwaltungsrat abgeben, die die Interessen ihrer Mitglieder widerspiegeln. Da die Satzung des neuen MDS vorsieht, dass der Spitzenverband Bund in den Gremien des MDS allein entscheidungsbefugt ist, ist eine Entscheidung über derartige Empfehlungen im Verwaltungsrat zu treffen. Auch hierbei sind die Kassenarten-Verbände durch Hauptamtliche vertreten. ? MDK-Forum: Was erwarten Sie von der Beteiligung der Medizinischen Dienste als fördernde Mitglieder des MDS? ! Dr. Volker Hansen: In erster Linie ein höheres Maß an Verständnis und Akzeptanz für Entscheidungen, die auf der Bundes­ ebene im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund mit Wirkung für die Medizinischen 33 Dienste und den MDS getroffen werden. Hier steht letztlich der Leitgedanke jeder Organisations­ entwicklung Pate, Betroffene zu Beteiligten zu machen, sie einzubinden und mitzunehmen. ? MDK-Forum: Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben für die MDK-Gemeinschaft im kommenden Jahr? ! Dieter F. Märtens: Inhaltlich steht die Umsetzung der Aufgaben aus dem Pflege-Weiter­ entwicklungsgesetz im Vordergrund. Der Ausbau der Qualitätsprüfungen, die laienver­ständliche Veröffentlichung der Prüfergebnisse und die Änderungen im Begutachtungsbereich stellen die MDK vor große Herausforderungen. Die jetzt gefundenen Regelungen – davon bin ich über­zeugt – werden dazu beitragen, dass die Umsetzung auf diesen Feldern gemeinsam erfolgt und wir den Praxistest bestehen. ? MDK-Forum: Was wünschen Sie sich als frisch gewählte Vorsitzende des MDS-Verwaltungsrates für die Kooperation mit den Medizinischen Diensten? ! Dr. Volker Hansen: Ich hoffe, dass alle MDK das Angebot nutzen und dem neuen Verein MDS als fördernde Mitglieder beitreten. Mit der Neuregelung in unserer Satzung hat der MDS die Vorleistung dafür erbracht, dass Bundes- und Landesebene der Medizinischen Dienste enger zusammenrücken und Informationen besser austauschen können. ! Dieter F. Märtens: Das, was Herr Dr. Hansen gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Insgesamt sollte daraus eine größere Geschlossenheit des MDKMDS-Systems resultieren. Das kann sich für die Weiterentwicklung als kompetenter Beratungs- und Begutachtungsdienst der Kranken- und Pflegeversicherung nur positiv auswirken. Die Fragen stellte C. Grote, MDS MDK-Forum 2/2008 MDK im Dialog MDK Niedersachsen MDK Westfalen-Lippe MDK-Fortbildungen zur Palliativ-Versorgung Von Martin Dutschek, Friederike Geisler und Dr. Martin Rieger D ie MDK Niedersachsen und MDK Westfalen-Lippe machten die Behandlung und Versorgung von Palliativpatien­ ten zum Thema ihrer diesjähri­ gen Frühjahrstagungen. In Han­ nover trafen sich rund 100, in Bad Lippspringe 200 ärztliche Gutachterinnen und Gutachter mit Palliativmedizinern, Hospiz­ mitarbeitern und einer Palliativ Care-Schwester zum gemeinsa­ men Erfahrungsaustausch. Als Verena starb war sie gerade 16 Jahre alt. „So schwer dieser Moment für uns war, wir waren froh, dass wir ihn zu Hause erleben konnten“, sagt ihre Mutter. Verena hatte einen bösartigen Hirntumor. Chancen auf Heilung gab es nicht. „Verena wusste, wie ihre Krank- Prof. Dr. Friedemann Nauck, Professor für Palliativmedizin an der Universität Göttingen MDK-Forum 2/2008 heit enden würde, und sie hat immer wieder gesagt, dass sie zu Hause bleiben will“, sagt ihre Mutter. Dem Wunsch der Patienten auf einen friedlichen Tod, gut versorgt, in vertrauter Umgebung und mit vertrauten Menschen wird längst nicht immer Rechnung getragen. Rund 80 Prozent der Menschen sterben in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen. In vielen Fällen ist ein Sterben in der vertrauten Umgebung allerdings nur möglich, wenn eine qualifizierte palliativmedizinische, palliativpflegerische und hospizliche Versorgung rund um die Uhr gewährleistet ist. „Betreuen und nicht kurieren“ „Sterben wird im Krankenhaus als Zwischenfall erlebt, weil es oft keinen professionellen Umgang mit dem Tod gibt“, sagte Prof. Dr. Friedemann Nauck, Professor für Palliativmedizin an der Universität Göttingen. Als Bausteine der Palliativversorgung nannte er die optimale Symptomkontrolle, das Sensibilisieren für die Bedürfnisse von Sterbenden und Angehörigen, die Kommunikation und die ethische Orientierung. „Eine unangemessene Versorgung kann schwerwiegende Folgen haben“, meinte Prof. Nauck, „im schlimmsten Fall ist sich die Familie nicht bewusst, dass der Patient sterben wird, oder er stirbt unter starken Schmerzen.“ Die Versorgung müsse dem Grundsatz folgen: „To care not to cure“, sagte der 34 Palliativexperte. Prof. Nauck begrüßte die neue Richtlinie über die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPVRichtlinie). „Es ist ein großer Fortschritt, dass Versicherte nun einen Anspruch darauf haben.“ Ausbildung auf der Palliativstation In Deutschland sei die palliative Versorgung noch lange nicht genügend ausgebaut: „Die Ausbildung von Medizinern und Pflegepersonal auf dem Gebiet ist ungenügend. Das Angebot hat sich zwar gebessert, aber es gibt immer noch starke regionale Unterschiede.“ Als einen idealen Aus- und Fortbildungsort nannte Prof. Nauck die Palliativstationen. Dort könne das gesamte Spektrum der palliativen Behandlung studiert werden: Von der Symptomkontrolle über die Kommunikation bis zur Ethik und ganzheitlichen Behandlung. Probleme bei der Forschung Auch die Forschung auf dem Gebiet der Palliativmedizin zeige Probleme auf: „Bisher kann man nur von einer Erfahrungswissenschaft sprechen. Empirische Therapiekonzepte werden gerade erst etabliert“, sagte Prof. Nauck. Die Forschung müsse sich sowohl methodischen als auch ethischen Themen stellen. Nur wenig Palliativ-Patienten stellten sich der Forschung zur Verfügung. Außerdem stelle die Verschlechterung MDK im Dialog des Gesundheitszustandes im Untersuchungszeitraum ein Problem für die Forscher dar. Vergleichbare Daten können so nur schwer gewonnen werden. Hinzu komme, so Prof. Nauck, dass die Patienten zumeist in ihrem Bewusstsein getrübt seien, so dass sie keine klaren Aussagen geben könnten. ne Therapiemöglichkeiten zur Symptomkontrolle nutzen, jedoch ihre Grenzen erkennen“, kommentierte Lübbe den Einsatz moderner Medizin. Versorgungssituation in Niedersachsen Rund 15.000 Menschen benötigen in Niedersachsen palliative Betreuung, zwischen 70.000 und 80.000 Sterbebegleitung, sagte Dr. Rolf Holbe, Vorsitzender der Akademie für Palliativmedizin bei der Niedersächsischen Ärztekammer. Inzwischen hätten rund 300 Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen die Zusatzbezeichnung „Palliativmedizin“ erworben. Verbesserungspotenzial sah der Allgemeinmediziner aus Kreiensen in der Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen. Ärzte, Pflegedienste, Heime, Palliativstationen oder Careteams könnten noch abgestimmter vorgehen, so Dr. Holbe. Um die Zusammenarbeit ambulanter und stationärer Angebote geht es auch dem Sozialministe­ rium in Niedersachsen. Die Vernetzung des ambulanten und des stationären Versorgungsangebotes innerhalb von Palliativstützpunkten könne als Fundament für eine Überleitung in das Leistungsspektrum betrachtet werden, das der Bundesgesetzgeber den so genannten Palliative Care Teams zugedacht hat, sagte die niedersächsische Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann (CDU) in einem Statement. Trotz struktureller Fortschritte werde in Zukunft vermehrtes ehrenamtliches Engagement notwendig sein: „Denn es sind insbesondere die ehrenamtlichen Kräfte, die menschliche Begleitung und Zuwendung geben“, sagte die Ministerin. Das Netzwerk Paderborn Relevanz für die Sozialmedizin Prof. Dr. Andreas Lübbe, Chefarzt der Palliativstation der Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe, war maßgeblich beteiligt am Aufbau eines ambulanten Palliativnetzwerkes für eine typisch ländliche Region. Im ost-westfälischen Netzwerk meldet sich der Hausarzt mit seinem Patienten an und wird u.a. in der anspruchsvollen Koordinierung der regionalen Versorgungsangebote für Palliativpatienten geschult. Zusätzlich bilden zwei qualifizierte Palliativmediziner eine ambulante 24-Stundenbereitschaft für kritische Zustände und Situationen. Den Menschen soll ein würdevolles Sterben zuhause ermöglicht werden. Gezielt nutzen aber auch die Pallativmediziner die Vorteile einer Palliativstation: „Würde heisst auch: Moder- Wichtigster Berührungspunkt des MDK mit der Palliativversorgung ist die Begutachtung bei geplanter Hospizunterbringung, bei der häufig auch eine Pflegebegutachtung nötig ist. Diese Kombinationsbegutachtung erfordert nicht nur Fachwissen, sondern eine schnelle, möglichst tagesgleiche Begutachtung. Bessere Zusammenarbeit möglich In der Abschlussdiskussion in Westfalen-Lippe waren sich Palliativmediziner, Palliativ CareSchwester, Vertreter des Paderborner Hospizes „Mutter der Barmherzigkeit“ und MDK einig, dass sich die bisher enge Kommunikation zwischen Gutachtern und Einrichtung bewährt hat. „Nicht nur eine funktionierende interprofessionelle Zusammenarbeit von Hausarzt bzw. Palliativmedizinern, Pflege- 35 Palliativversorgung: Der MDK begutachtet, wenn eine Unterbringung im Hospiz geplant ist diensten und Hospizmitarbeitern ist für die Versorgung der Patienten erforderlich, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betreuenden, MDK und Krankenkasse“ resümierte Dr. Ulrich Heine, Ärztlicher Leiter und stellv. Geschäftsführer des MDK Westfalen-Lippe. Künftig an Bedeutung zunehmen wird die sozialmedizinische Beratung der Krankenkassen in Fragen zur Palliativ- und Hospizversorgung. Diese Versorgungsformen gilt es, in die sozialmedizinische Betrachtung einzubeziehen, lautete das Fazit der Fortbildung in Niedersachsen. Ansätze ergeben sich unter anderem bei der Beurteilung der Rehabilitationsfähigkeit und Rehabilitationsbedürftigkeit, insbe­sondere von palliativ versorgten Tumorpatienten oder bei Fragen zur Erwerbsunfähigkeit während palliativer Erkrankungssituationen. Martin Dutschek und Friederike Geisler sind Mitarbeiter in der Unternehmenskommunikation beim MDK Niedersachsen Dr. med. Martin Rieger ist Referent für medizinische Grundsatzangelegenheiten beim MDK Westfalen-Lippe E-Mail: [email protected] MDK-Forum 2/2008 Menschen und Nachrichten Sucht, Abhängigkeit, exzessives Verhalten – Zustände und Zuständigkeiten VER A N S TA LTUNG Veranstalter: Fachkonferenz der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) Termin: 10. - 12. November 2008 in der Stadthalle Bielefeld Vor vierzig Jahren urteilte das Bundessozialgericht: Trunksucht ist Krankheit im Sinne der Reichs­ versicherungsordnung (RVO). Es beendete einen langen Streit um die Verantwortung des Einzelnen und die Zuständigkeiten für die Behandlung. Eine rasante Entwicklung des Hilfesystems für Suchtkranke setzte ein. Die Fachkonferenzen der DHS in den Jahren 1983 bis 1985 hinterfragten diese stürmische Entwicklung – verbunden mit dem dramatischen Anstieg des Konsums illegaler Suchtmittel – und versuchten sie einzuordnen. sionen neu. Da geht es einerseits um die verhaltensbezogenen Abhängigkeiten: Steigen sie so rasant an, wie es die veröffentlichte Meinung suggeriert? Was ist krankhaft, was ist der gesellschaft­ lichen Entwicklung geschuldet? Welche Erwartungen werden damit verbunden, wenn auf einmal jedes menschliche Verhalten süchtig entarten kann? Andererseits geht es um die Weiterentwicklung des Suchtmodells und die Frage, ob die erfolgreiche Therapie von Alkohol- und Drogenabhängigen auf weitere Störungen übertragen werden kann. und Störungen in ihren Konsequenzen darzustellen, neue Tendenzen und neues Wissen bewerten und nach Wegen suchen, wie das Suchthilfe­system auf die neuen Anforderungen vorzubereiten ist. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, beginnen ähnliche Diskus­ Die Tagung will die verhaltensbezogenen Risiken, Probleme Weitere Informationen unter: www.dhs.de Ein wesentlicher Teil dieser Fachkonferenz ist der Transport von wissenschaftlich erprobten Modellen in die Praxis. Dazu werden die Suchtforschungsverbünde ihre praxisrelevanten Ergebnisse präsentieren und mit den Praktikern die Umsetzung diskutieren. Die Zukunft ist chronisch – Erwartungen an Systemberatung zur Versorgungsgestaltung Veranstalter: Kompetenz-Centren der MDK-Gemeinschaft und des Spitzenverbandes Bund Termin: 17. und 18. November 2008 in Hamburg VER AN STA LTUN G Die angemessene medizinische und pflegerische Versorgung chronisch kranker Menschen ist eine der Herausforderungen für unser Gesundheitssystem. Die Kompetenz-Centren (KC) sind Gemeinschaftseinrichtungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und der MDK-Gemeinschaft. Sie beraten die Verbände der Kranken- und Pflegekassen in Fragen zu Versorgungsstrukturen, -management und -konzeptionen. Auf ihrer dritten gemeinsamen Präsentationsveranstaltung im November 2008 wollen die Kompetenz-Centren ausführlich über ihre Systemberatungsleistungen zur Gestaltung der Versorgung von chronisch Kranken berichten. MDK-Forum 2/2008 17.11.2008: Plenum • Einführung in die System­ beratungsaufgaben der Medizinischen Dienste • Präventive Hausbesuche im Alter • Krebs – eine chronische Erkrankung • Neue Vergütungsformen in der Versorgung chronisch psychisch Kranker • Chronische Wirbelsäulen­ erkrankungen 18.11.2008: Workshops der KC •K C Geriatrie: Bedarf an datengestützten Steuerungsmöglichkeiten in der GKV. Stand und Perspektiven am Beispiel der Geriatrie •K C Onkologie: Klinische Studien in der Onkologie, Verbes- 36 serung der Strukturen bei der Versorgung onkologischer Patienten •K C Psychiatrie und Psycho­ therapie: Stationäre psycho­ somatische Therapie – Chancen, Möglichkeiten und Grenzen von Akuttherapie und Rehabilitation • KC Qualitätssicherung/Quali­ tätsmanagement: Good Governance in der Qualitätspolitik – Voraussetzung für die Nach­haltigkeit von Versorgungs­ konzeptionen? Informationen/Anmeldung: KC Geriatrie beim MDK Nord Telefon: 040/25169 – 491 E-Mail: [email protected] Internet: www.kcgeriatrie.de Impressum MDK-Forum · Das Magazin der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung Herausgeber: Medizinischer Dienst des Spitzen­verbandes Bund der Krankenkassen e. V. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Ulf Sengebusch (se), MDK Sachsen Redaktion: Martin Dutschek (dt), MDK Niedersachsen Christiane Grote (gr), MDS Wolfgang Nafziger (na), MDK in Bayern Dr. Uwe Sackmann (sa), MDK Baden-Württemberg Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bildredaktion: Elke Grünhagen, MDS Erscheinungsweise: vierteljährlich Layout: BestPage Kommunikation GmbH & Co. KG 45479 Mülheim an der Ruhr Druck: asmuth druck + crossmedia gmbh & co. kg 50829 Köln Redaktionsanschrift: Redaktion MDK-Forum MDS e.V. Martina Knop Lützowstraße 53 45141 Essen Telefon 0201 8327-111 Telefax 0201 8327-3111 E-Mail [email protected] Bildnachweis: Kurt Fuchs Presse Foto Design: S. 4 InnoMed e.V.: S. 11 Institut für angewandte Telemedizin: S. 9 Picture Press/Schwalb, Patrick: S. 21 Privat: S. 6, 8, 30, 32, 33 Martin Dutschek, MDK Niedersachsen: S. 14 Friederike Geisler, MDK Niedersachsen: S. 12 Region Hannover: S. 29 Klaus Rose/Das Fotoarchiv: S. 35 Henning Schacht: S. 24 Wolfram Steinberg/VISUM: Titel, S. 3 Teleaugendienst GmbH, Greifswald: S. 10 Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn/T.Brenner: S. 27 37 MDK-Forum 2/2008 Die Medizinischen Dienste ISSN 1610-5346 Baden-Württemberg Nord Westfalen-Lippe MDK Baden-Württemberg Ahornweg 2 77933 Lahr Telefon: 07821 938-0 Telefax: 07821 938-200 Geschäftsführer: Karl-Heinz Plaumann E-Mail: [email protected] MDK Nord Hammerbrookstraße 5 20097 Hamburg Telefon: 040 25169-0 Telefax: 040 25169-509 Geschäftsführer: Peter Zimmermann E-Mail: [email protected] MDK Westfalen-Lippe Burgstraße 16 48151 Münster Telefon: 0251 5354-0 Telefax: 0251 5354-299 Geschäftsführer: Dr. Holger Berg E-Mail: [email protected] Bayern Nordrhein MD Bundeseisenbahnvermögen MDK Bayern Putzbrunner Straße 73 81739 München Telefon: 089 67008-0 Telefax: 089 67008-444 Geschäftsführer: Reiner Kasperbauer E-Mail: [email protected] MDK Nordrhein Bismarckstraße 43 40210 Düsseldorf Telefon: 0211 1382-0 Telefax: 0211 1382-199 Geschäftsführer: Wolfgang Machnik E-Mail: [email protected] Hauptverwaltung Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 2 53175 Bonn Telefon: 0228 3077-0 Telefax: 0228 3077-160 Geschäftsführer: Burkhard Nette E-Mail: [email protected] Berlin-Brandenburg Rheinland-Pfalz Knappschaft MDK Berlin-Brandenburg e. V. Konrad-Wolf-Allee 1-3 TH III 14480 Potsdam Telefon: 0331 50567-0 Telefax: 0331 50567-11 Geschäftsführer: Dr. Rolf Matthesius E-Mail: [email protected] MDK Rheinland-Pfalz Albiger Straße 19d 55232 Alzey Telefon: 06731 486-0 Telefax: 06731 486-270 Geschäftsführer: Dr. Gundo Zieres E-Mail: [email protected] Pieperstraße 14-18 44789 Bochum Telefon: 0234 304-0 Telefax: 0234 304-8004 Geschäftsführer: Dr. Georg Greve E-Mail: [email protected] Bremen Saarland MDS e. V. MDK im Lande Bremen Falkenstraße 9 28195 Bremen Telefon: 0421 1628-0 Telefax: 0421 1628-115 Geschäftsführer: Wolfgang Hauschild E-Mail: [email protected] MDK im Saarland Dudweiler Landstraße 5 66123 Saarbrücken Telefon: 0681 93667-0 Telefax: 0681 93667-33 Geschäftsführer: Dr. Gerhard Minkenberg E-Mail: [email protected] Lützowstraße 53 45141 Essen Telefon: 0201 8327-0 Telefax: 0201 8327-100 Geschäftsführer: Dr. Peter Pick E-Mail: [email protected] Hessen Sachsen MDK Hessen Zimmersmühlenweg 23 61440 Oberursel Telefon: 06171 634-00 Telefax: 06171 634-555 Komm. Geschäftsführer: Dr. Gert von Mittelstaedt E-Mail: [email protected] MDK im Freistaat Sachsen e. V. Bürohaus Mitte – Am Schießhaus 1 01067 Dresden Telefon: 0351 4985-30 Telefax: 0351 4963157 Geschäftsführer: Dr. Ulf Sengebusch E-Mail: [email protected] Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt MDK Mecklenburg-Vorpommern e. V. Lessingstraße 31 19059 Schwerin Telefon: 0385 7440-100 Telefax: 0385 7440-199 Geschäftsführer: Dr. Karl-Friedrich Wenz E-Mail: [email protected] MDK Sachsen-Anhalt e. V. Allee-Center, Breiter Weg 19c 39104 Magdeburg Telefon: 0391 5661-0 Telefax: 0391 5661-160 Geschäftsführer: Rudolf Sickel E-Mail: [email protected] Niedersachsen Thüringen MDK Niedersachsen Hildesheimer Str. 202 30519 Hannover Telefon: 0511 8785-0 Telefax: 0511 8785-91001 Geschäftsführer: Jürgen Vespermann E-Mail: [email protected] MDK Thüringen e. V. Richard-Wagner-Straße 2a 99423 Weimar Telefon: 03643 553-0 Telefax: 03643 553-120 Geschäftsführer: Kai-Uwe Herber E-Mail: [email protected] Die MDK-Gemeinschaft im Internet: www.mdk.de