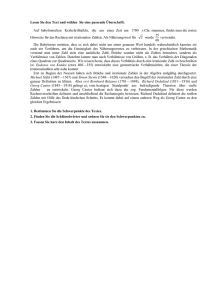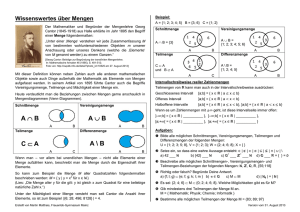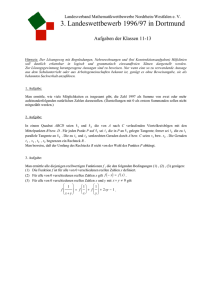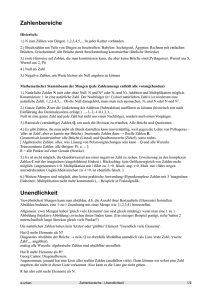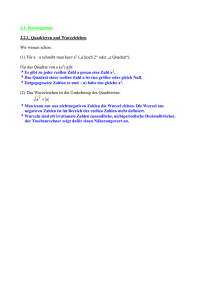2 1 Historische Notizen sische Wahrheit eine Begründung besitzt
Werbung
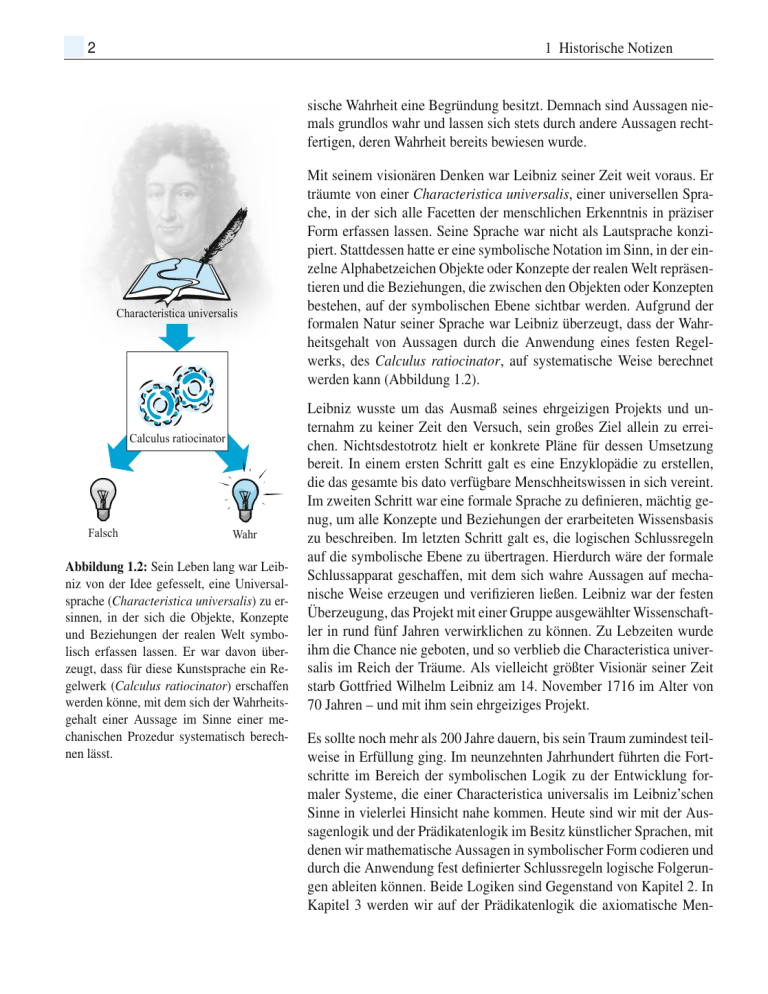
2
1 Historische Notizen
sische Wahrheit eine Begründung besitzt. Demnach sind Aussagen niemals grundlos wahr und lassen sich stets durch andere Aussagen rechtfertigen, deren Wahrheit bereits bewiesen wurde.
Characteristica universalis
Calculus ratiocinator
Falsch
Wahr
Abbildung 1.2: Sein Leben lang war Leibniz von der Idee gefesselt, eine Universalsprache (Characteristica universalis) zu ersinnen, in der sich die Objekte, Konzepte
und Beziehungen der realen Welt symbolisch erfassen lassen. Er war davon überzeugt, dass für diese Kunstsprache ein Regelwerk (Calculus ratiocinator) erschaffen
werden könne, mit dem sich der Wahrheitsgehalt einer Aussage im Sinne einer mechanischen Prozedur systematisch berechnen lässt.
Mit seinem visionären Denken war Leibniz seiner Zeit weit voraus. Er
träumte von einer Characteristica universalis, einer universellen Sprache, in der sich alle Facetten der menschlichen Erkenntnis in präziser
Form erfassen lassen. Seine Sprache war nicht als Lautsprache konzipiert. Stattdessen hatte er eine symbolische Notation im Sinn, in der einzelne Alphabetzeichen Objekte oder Konzepte der realen Welt repräsentieren und die Beziehungen, die zwischen den Objekten oder Konzepten
bestehen, auf der symbolischen Ebene sichtbar werden. Aufgrund der
formalen Natur seiner Sprache war Leibniz überzeugt, dass der Wahrheitsgehalt von Aussagen durch die Anwendung eines festen Regelwerks, des Calculus ratiocinator, auf systematische Weise berechnet
werden kann (Abbildung 1.2).
Leibniz wusste um das Ausmaß seines ehrgeizigen Projekts und unternahm zu keiner Zeit den Versuch, sein großes Ziel allein zu erreichen. Nichtsdestotrotz hielt er konkrete Pläne für dessen Umsetzung
bereit. In einem ersten Schritt galt es eine Enzyklopädie zu erstellen,
die das gesamte bis dato verfügbare Menschheitswissen in sich vereint.
Im zweiten Schritt war eine formale Sprache zu definieren, mächtig genug, um alle Konzepte und Beziehungen der erarbeiteten Wissensbasis
zu beschreiben. Im letzten Schritt galt es, die logischen Schlussregeln
auf die symbolische Ebene zu übertragen. Hierdurch wäre der formale
Schlussapparat geschaffen, mit dem sich wahre Aussagen auf mechanische Weise erzeugen und verifizieren ließen. Leibniz war der festen
Überzeugung, das Projekt mit einer Gruppe ausgewählter Wissenschaftler in rund fünf Jahren verwirklichen zu können. Zu Lebzeiten wurde
ihm die Chance nie geboten, und so verblieb die Characteristica universalis im Reich der Träume. Als vielleicht größter Visionär seiner Zeit
starb Gottfried Wilhelm Leibniz am 14. November 1716 im Alter von
70 Jahren – und mit ihm sein ehrgeiziges Projekt.
Es sollte noch mehr als 200 Jahre dauern, bis sein Traum zumindest teilweise in Erfüllung ging. Im neunzehnten Jahrhundert führten die Fortschritte im Bereich der symbolischen Logik zu der Entwicklung formaler Systeme, die einer Characteristica universalis im Leibniz’schen
Sinne in vielerlei Hinsicht nahe kommen. Heute sind wir mit der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik im Besitz künstlicher Sprachen, mit
denen wir mathematische Aussagen in symbolischer Form codieren und
durch die Anwendung fest definierter Schlussregeln logische Folgerungen ableiten können. Beide Logiken sind Gegenstand von Kapitel 2. In
Kapitel 3 werden wir auf der Prädikatenlogik die axiomatische Men-
1.1 Wahrheit und Beweisbarkeit
genlehre errichten. Diese wird sich als stark genug erweisen, um alle
Gebiete der klassischen Mathematik zu beschreiben, und dient heute
als formaler Unterbau für die gesamte moderne Mathematik.
Mit der fortschreitenden Formalisierung der Mathematik rückten Fragestellungen in den Vordergrund, die sich nicht mit Theoremen befassten,
die innerhalb eines formalen Systems abgeleitet werden konnten, sondern mit den Eigenschaften und Limitierungen der Systeme selbst. Zur
Blüte reifte dieser Forschungszweig, den wir heute als Metamathematik
bezeichnen, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Die seither gewonnenen Erkenntnisse sind gewaltig und zugleich verstörend.
Bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein zweifelte kaum ein Mathematiker ernsthaft daran, dass für jede mathematische Aussage ein Beweis
oder ein Gegenbeweis gefunden werden kann, wenn nur lange genug
danach gesucht wird. Dass Wahrheit und Beweisbarkeit in einem harmonischen Einklang stehen, war das ungeschriebene Dogma der Mathematik. Heute wissen wir, dass sich der Begriff der Wahrheit und der
Begriff der Beweisbarkeit selbst für einfache Theorien wie die Zahlentheorie nicht in Kongruenz bringen lassen. Es ist unmöglich, die Mathematik in einem formalen System einzufangen, in dem alle wahren
mathematischen Aussagen als solche bewiesen werden können.
Die Erkenntnisse des zwanzigsten Jahrhundert haben unser mathematisches Weltbild von Grund auf verändert. Indem sie fundamentale Grenzen aufzeigen, die wir niemals werden überwinden können, haben sie in
der Mathematik eine ganz ähnliche Bedeutung wie die Relativitätstheorie in der Physik. Heute wissen wir, dass ein Calculus ratiocinator nicht
existieren kann. Die Leibniz’sche Vision einer mechanisierbaren Mathematik, so verlockend sie auch sein mag, ist ein Traum, der niemals
Realität werden wird.
Die Überlegungen, die zu diesem Ergebnis führen, sind der Inhalt dieses
Buchs, und wir werden sie in den nächsten Kapiteln im Detail herausarbeiten. Soviel vorweg: Sie werden von so grundlegender Natur sein,
dass es kein Entrinnen gibt; die Mathematik entzieht sich jedem formalen Korsett.
An zwei Beispielen wollen wir demonstrieren, welche Auswirkungen
sich für die gewöhnliche Mathematik ergeben.
Vermutung 1.1 (Goldbach)
Jede gerade natürliche Zahl n > 2 lässt sich als Summe zweier
Primzahlen schreiben.
3
4
1 Historische Notizen
y
Goldbach'sche Vermutung
V
12000
10000
Abbildung 1.3: Nach der Goldbach’schen
Vermutung lassen sich alle geraden Zahlen n > 2 als Summe zweier Primzahlen
schreiben. In dem nebenstehenden Diagramm sind die geraden natürlichen Zahlen auf der x-Achse und die Anzahl der
möglichen Zerlegungen auf der y-Achse
aufgetragen. Die Goldbach’sche Vermutung ist genau dann wahr, wenn die xAchse frei von Datenpunkten bleibt. Auch
wenn vieles für die Wahrheit der Vermutung spricht, steht ein formaler Beweis bis
heute aus.
8000
6000
4000
2000
0
Gerade natürliche Zahlen > 2
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
x
Die Goldbach’sche Vermutung gehört zu den ältesten und bedeutsamsten Problemen der Zahlentheorie (Abbildung 1.3). Benannt ist sie nach
dem deutschen Mathematiker Christian Goldbach, der im Jahr 1742 in
einem Brief an den Schweizer Mathematiker Leonhard Euler die These
aufstellte, dass sich jede natürliche Zahl größer 2 als die Summe dreier
Primzahlen1 schreiben lässt (Abbildung 1.4). Die hier formulierte Variante wird auch als starke Goldbach’sche Vermutung bezeichnet, da sich
aus ihr die Gültigkeit der ursprünglich formulierten Variante ergibt.
Das zweite Beispiel stammt ebenfalls aus dem Gebiet der Zahlentheorie
und ist nicht weniger prominent:
Vermutung 1.2 (Primzahlzwillinge)
Es existieren unendlich viele Zahlen n mit der Eigenschaft, dass n
und n + 2 Primzahlen sind.
Tabelle 1.1 gibt eine Übersicht über die ersten 35 Primzahlzwillinge.
Jede der beiden hier aufgeführten Vermutungen macht eine Aussage
über die natürlichen Zahlen und ist entweder wahr oder falsch. Trotz1 In Goldbachs Definition ist die 1 ebenfalls eine Primzahl. Sonst wäre seine These
bereits für den Fall n = 4 widerlegt.
5
1.1 Wahrheit und Beweisbarkeit
Aus dem Brief von Christian Goldbach an Leonhard Euler
Leonhard Euler (1707 – 1783)
Abbildung 1.4: Im Jahr 1742 äußerte Christian Goldbach seine berühmte Vermutung in einem Brief an Leonhard Euler.
dem waren alle bisher getätigten Anstrengungen vergebens, sie zu beweisen oder zu widerlegen. Ob wir die Vermutungen mit den Mitteln
der Zahlentheorie überhaupt beweisen oder widerlegen können, wissen
wir nicht. Die Vehemenz, mit der sich beide einer Lösung bisher entzogen haben, mag den Verdacht der Unbeweisbarkeit nähren, Gewissheit
liefert sie freilich nicht.
Auch eine andere berühmte Vermutung der Zahlentheorie widersetzte
sich über dreihundert Jahre lang allen Versuchen, sie zu beweisen. Im
Jahr 1637 stellte der französische Mathematiker Pierre de Fermat die
Behauptung auf, dass die Gleichung
an + bn = cn
für n > 2 keine Lösung in den ganzen Zahlen besitzt (Abbildung 1.5).
Erst im Jahr 1995 konnte der Brite Andrew Wiles einen lückenlosen
Beweis für die Taniyama-Shimura-Vermutung vorbringen, aus der sich
der Fermat’sche Satz als Korollar ergibt [165, 195]. Ob für die Goldbach’sche Vermutung oder die Vermutung über die Existenz unendlich
vieler Primzahlzwillinge doch noch ein Beweis gefunden werden wird,
steht in den Sternen. Auch wenn sich die Anzeichen mehren [189, 191],
herrscht bis heute Unsicherheit.
Das Wissen über die Unvollständigkeit formaler Systeme ist die vielleicht größte Errungenschaft der mathematischen Logik des zwanzigsten Jahrhunderts und zweifelsfrei eine der verblüffendsten mathematischen Erkenntnisse überhaupt. In Kapitel 4 werden wir uns ausführ-
Primzahlzwillinge
(3, 5)
(5, 7)
(11, 13)
(17, 19)
(29, 31)
(41, 43)
(59, 61)
(71, 73)
(101, 103)
(107, 109)
(137, 139)
(149, 151)
(179, 181)
(191, 193)
(197, 199)
(227, 229)
(239, 241)
(269, 271)
(281, 283)
(311, 313)
(347, 349)
(419, 421)
(431, 433)
(461, 463)
(521, 523)
(569, 571)
(599, 601)
(617, 619)
(641, 643)
(659, 661)
(809, 811)
(821, 823)
(827, 829)
(857, 859)
(881, 883)
Tabelle 1.1: Die Primzahlzwillinge im Zahlenbereich zwischen 0 und 1000
6
Abbildung 1.5: Pierre de Fermat schrieb
sein berühmtes lateinisches Zitat im Jahr
1637 an den Rand seiner Ausgabe der
Arithmetica (siehe Abschnitt 1.2.1). Übersetzt lautet es wie folgt: „Es ist unmöglich, einen Kubus in zwei Kuben zu zerlegen oder ein Biquadrat in zwei Biquadrate
oder allgemein irgendeine Potenz größer
als die zweite in Potenzen gleichen Grades. Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis gefunden, doch ist der
Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen.“
Über 300 Jahre suchten Mathematiker erfolglos nach Fermats „wunderbarem Beweis“, und es gilt heute als sicher, dass
kein kurzer Beweis für seine Vermutung
existiert.
1 Historische Notizen
„Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum
in duos quadratoquadratos,
et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere. Cuius
rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.“
Pierre de Fermat
(1607 – 1665)
lich mit dieser Thematik auseinandersetzen und die Schlüsselergebnisse
sorgfältig herleiten.
In Kapitel 5 werden wir noch einen Schritt weiter gehen und den Begriff der Beweisbarkeit um einen weiteren ergänzen. Die Rede ist von
der Berechenbarkeit, einem Schlüsselbegriff, der für uns in zweierlei
Hinsicht von Bedeutung ist. Zum einen wird er uns einen alternativen
Weg aufzeigen, der uns einen schnelleren und eleganteren Zugang zu
den Grenzen der Beweisbarkeit gewähren wird als jener, den wir in Kapitel 4 beschreiten. Zum anderen spielt er eine zentrale Rolle in der
Informatik, wo sich die Grenzen der Berechenbarkeit ganz praktisch
auswirken. Heute wissen wir, dass es unmöglich ist, einen Algorithmus
zu formulieren, der für jedes vorgelegte Programm immer korrekt entscheidet, ob es eine gewisse funktionale Eigenschaft erfüllt oder nicht.
Selbst so einfache Probleme wie die Frage nach der Existenz von Endlosschleifen liegen außerhalb des Berechenbaren. Genau dies ist der
Grund, warum selbst die modernsten Compiler heute nicht viel mehr
als eine syntaktische Prüfung der Quelltexte durchführen und nur wenige funktionale Fehler selbstständig erkennen. Auch hier sind wir mit
einer ebenso grundlegenden wie unvermeidlichen Beschränkung konfrontiert, die wir nicht überwinden können.
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
1.2
7
Der Weg zur modernen Mathematik
Bevor wir uns voll und ganz den technischen Details der umrissenen
Ideen widmen, wollen wir einen Rückblick auf die bewegte Geschichte
der mathematischen Logik wagen. Nur so ist es möglich, die Ergebnisse adäquat einzuordnen und in ihrer gesamten Tragweite zu verstehen.
Verlieren wir also keine Zeit!
1.2.1
Rätsel des Kontinuums
Wir beginnen unseren Streifzug durch die Geschichte der Mathematik im Griechenland des dritten Jahrhunderts. Dort entstand jenes dreizehnbändige Werk, das die Grundlagen der modernen Algebra schaffen
sollte. Die Rede ist von der Arithmetica, einer Sammlung von über hundert algebraischen Rätseln und ihren Lösungen (Abbildung 1.6). Nur
die Bände 1 bis 3 und 8 bis 10 sind heute noch im Original vorhanden.
Für die Bände 4 bis 7 wurden arabische Übersetzung gefunden, die restlichen drei sind bis heute verschollen. Verfasst wurde die Arithmetica
von Diophantos von Alexandria, von dessen Leben wir heute keine verlässliche Kenntnis haben. Lediglich ein Rätselvers aus der Zeit nach
seinem Tod gibt uns zaghafte Hinweise über den Verlauf seines Lebens.
In einer deutschen Übersetzung lautet er wie folgt [73]:
„Wanderer, unter diesem Stein ruht Diophantos. Oh,
großes Wunder, die Wissenschaft zeigt Dir die Dauer seines Lebens. Gott gewährte ihm die Gunst, den sechsten Teil
seines Lebens jung zu sein. Ein Zwölftel dazu, und er ließ
bei ihm einen schwarzen Bart sprießen. Ein Siebtel später
war der Tag seiner Hochzeit, und im fünften Jahr ging aus
dieser Verbindung ein Sohn hervor. Ach, bedauernswerter
Jüngling: Er bekam die Kälte des Todes zu spüren, als er
nur halb so alt war, wie sein Vater schließlich wurde. Vier
Jahre danach fand dieser dann Trost für seinen Schmerz,
und mit dieser Weisheit schied er aus dem Leben. Wie lange währte es?“
Bezeichnen wir das erreichte Alter des Diophantos mit x, so lässt sich
der Rätselvers in die folgende Gleichung übertragen:
x=
x
x
x
x
+
+ +5+ +4
6 12 7
2
Abbildung 1.6: Die Arithmetica ist ein
dreizehnbändiges Werk, in dem Diophantos
von Alexandria mehr als hundert algebraische Rätsel samt ihren Lösungen zusammentrug. Die allgemeine Lösbarkeit diophantischer Gleichungen ist Bestandteil des
zehnten Hilbert’schen Problems, auf das
wir in Abschnitt 5.4.3 im Detail zu sprechen
kommen.
8
1 Historische Notizen
Die Multiplikation mit 84 eliminiert sämtliche Brüche:
x
84x = 14x + 7x + 12x + 420 + 42x + 336
10
y
Damit können wir Diophantos’ Alter als die Lösung der Gleichung
370
x + y = 10
3
x + y3 = 370
Abbildung 1.7: Im vierten Band der Arithmetica stellte Diophantos die Aufgabe, die
Seitenlängen x, y zweier Würfel so zu bestimmen, dass die Summe der Seitenlängen
gleich 10 und die Summe der Würfelvolumina gleich 370 ist.
9x − 756 = 0
(1.1)
bestimmen und erhalten das Ergebnis x = 84. Ob Diophantos wirklich
84 Jahre alt wurde und den Schmerz verkraften musste, seinen eigenen Sohn sterben zu sehen? Wir werden es wahrscheinlich niemals mit
Sicherheit wissen.
Gleichung (1.1) ist ein einfaches Beispiel dessen, was wir heute als diophantische Gleichung bezeichnen. Im allgemeinen Fall hat eine solche
Gleichung die Form
p(x1 , x2 , . . . , xn ) = 0,
(1.2)
wobei p ist ein multivariables Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten ist. Die Lösung einer diophantischen Gleichung ist die Menge der
ganzzahligen Nullstellen von p.
Wenn wir im Folgenden von diophantischen Gleichungen sprechen,
werden wir, wo immer es sinnvoll erscheint, den Symbolvorrat geringfügig anpassen und z. B. x für x1 und y für x2 schreiben. Die Gleichung
x1 3 + x2 3 + x1 + x2 − 380 = 0
liest sich dann beispielsweise so:
x3 + y3 + x + y − 380 = 0
(1.3)
Gleichung (1.3) hat eine geometrische Bedeutung und löst ein Problem
aus dem vierten Buch der Arithmetica. Wie in Abbildung 1.7 dargestellt, lassen sich x und y als die Seitenlängen zweier Würfel interpretieren, deren gemeinsames Volumen gleich 370 ist und die Summe ihrer
Seitenlängen den Wert 10 ergibt. Mit x = 7, y = 3 und x = 3, y = 7 hat
die Gleichung genau zwei Lösungen in den natürlichen Zahlen.
Unendlich viele Lösungen besitzt z. B. die nachstehende diophantische
Gleichung:
x2 + y2 − z2 = 0
(1.4)
Sie beschreibt das im zweiten Buch der Arithmetica beschriebene Problem, ein Quadrat so in zwei Quadrate aufzuteilen, dass sich der Flächeninhalt nicht ändert. Die Lösungen dieser Gleichung sind die sogenannten pythagoreischen Tripel. Nach dem Satz des Pythagoras umfassen sie alle Dreiergruppen natürlicher Zahlen (x, y, z), die als Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke vorkommen (Abbildung 1.8).
9
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
Gleichung (1.4) können wir auf nahe liegende Weise verallgemeinern
und erhalten mit
x +y −z = 0
n
n
n
I Pythagoreische Tripel
x
(1.5)
jene legendäre Gleichung, die Pierre de Fermat zu seiner berühmten
Vermutung veranlasste. Heute wissen wir, dass sie für n > 2 keine Lösung in den ganzen Zahlen besitzt.
y
Beachten Sie, dass (1.5) keine gewöhnliche diophantische Gleichung
ist, da die Variable n als Exponent auftaucht. Sie fällt in die größere
Gruppe der exponentiellen diophantischen Gleichungen, die uns in Abschnitt 5.4.3 erneut begegnen wird. Dort werden wir uns ausführlich
mit der Frage beschäftigen, ob sich die Lösbarkeit diophantischer Gleichungen durch ein systematisches Verfahren bestimmen lässt. Soviel
vorweg: Wir werden eine verblüffende Antwort erhalten.
Dass wir den Begriff der diophantischen Gleichungen heute ausschließlich dann verwenden, wenn wir Lösungen in den ganzen Zahlen suchen,
wird seinem Namensgeber nur teilweise gerecht. Diophantos stellte den
Leser der Arithmetica unter anderem vor das Problem, die pythagoreische Gleichung (1.4) für den Fall z2 = 16 zu lösen. Unter dieser Vor16
aussetzung hat die Gleichung mit 12
5 und 5 ausschließlich Lösungen in
Q, der Menge der rationalen Zahlen.
Genau wie die natürlichen Zahlen, die das Abzählen von Dingen ermöglichen, haben auch die rationalen Zahlen einen ganz praktischen
Hintergrund: Sie entstehen immer dann, wenn zwei geometrische Längen p und q zueinander in Bezug gesetzt werden, und sind in diesem
Sinne die algebraischen Grundbausteine der Geometrie.
Wir wollen an dieser Stelle nicht vorschnell über die Tatsache hinweggehen, dass die Bruchschreibweise nur eine von mehreren Darstellungsmöglichkeiten ist. Beispielsweise können wir jede rationale Zahl qp auch
in Form eines periodischen Dezimalbruchs schreiben:
1
8
1
3
1
1
= 0,125 = 0,1250
= 0,3333 . . . = 0, 3
= 1, 0 = 0, 9
Umgekehrt lässt sich jeder periodische Dezimalbruch systematisch in
die Bruchdarstellung überführen. Um z. B. die Zahl
x = 0,0238095
p
q
(1.6)
in der Form darzustellen, wenden wir einen einfachen Trick an. Zunächst multiplizieren wir beide Seiten mit 1 000 000:
1 000 000x = 23809,5238095
z
Berechnen lassen sich pythagoreische
Tripel über die Formeln
x = m(u2 − v2 )
y = m(2uv)
z = m(u2 + v2 )
Hierin sind m, u, v positive natürliche
Zahlen mit u > v.
I Beispiele
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
(m, u, v)
2
3
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
1
1
2
1
2
3
1
1
2
1
2
3
3
8
5
15
12
7
6
16
10
30
24
14
(x, y, z)
4
6
12
8
16
24
8
12
24
16
32
48
5
10
13
17
20
25
10
20
26
34
40
50
...
Abbildung 1.8: Pythagoreische Tripel
10
1 Historische Notizen
1
4
3
4
2
4
Subtrahieren wir (1.6) von dieser Gleichung, so verschwindet der periodische Anteil:
999 999x = 23809,5
6
16
12
32
4
8
3
8
2
8
Damit erhalten wir für x die folgende Darstellung:
8
16
7
16
13
32
14
32
Abbildung 1.9: Da für zwei Zahlen x, y ∈
Q auch das arithmetische Mittel x+y
2 eine
rationale Zahl ist, können wir jeden Punkt
mit einer beliebigen Genauigkeit annähern.
1
x=
238095
1
23809,5
=
=
999 999 9 999 990 42
Anders als die natürlichen Zahlen liegen die rationalen Zahlen dicht auf
der Zahlengeraden. Das bedeutet, dass wir jeden Punkt beliebig genau
durch eine Folge rationaler Zahlen annähern können. Dass die Approximation immer möglich ist, verdanken wir der Eigenschaft, dass für
zwei beliebige Zahlen x, y ∈ Q auch das arithmetische Mittel x+y
2 eine
rationale Zahl ist (Abbildung 1.9).
Dennoch weist die Menge der rationalen Zahlen Lücken auf. So war
bereits den Pythagoreern bekannt, dass die Länge der Diagonalen eines
Quadrats mit der Seitenlänge 1 nicht durch eine rationale Zahl ausgedrückt werden kann (Abbildung 1.10). Was hat es mit dieser mysteriösen Diagonallänge auf sich? Von ihr wissen wir zunächst nur, dass √
sie
2
mit sich selbst multipliziert das Ergebnis
2
liefert
und
deshalb
als
√
geschrieben werden darf. Der Wert von 2 lässt sich mit
√
2 ≈ 1,41421356237309504880168872420969807856
ziemlich genau beziffern und kann durch die Angabe weiterer Nachkommastellen beliebig angenähert werden. Trotzdem wird es uns niemals gelingen, den
√ Wert exakt niederzuschreiben. Schuld daran ist die
Eigenschaft von 2, keine Bruchdarstellung zu besitzen. Ihre Dezimalbruchdarstellung ist nichtperiodisch und setzt sich aus unendlich vielen,
unregelmäßig auftretenden Nachkommaziffern zusammen.
1
√2
Abbildung 1.10: Die rationalen Zahlen
können den Zahlenstrahl nicht lückenlos
überdecken. Beispielsweise lässt sich die
Länge der Diagonalen eines Quadrats mit
der Seitenlänge 1 nicht durch eine rationale
Zahl ausdrücken.
Indem wir die Lücken zwischen den rationalen Zahlen schließen, erreichen wir die Menge der reellen Zahlen R, den wichtigsten Zahlenraum
der gewöhnlichen Mathematik. Aufgrund ihrer Eigenschaft, den Zahlenstrahl lückenlos zu überdecken, wird die Menge der reellen Zahlen
als das Kontinuum bezeichnet.
√
Betrachten wir die Zahl 2 genauer, so tritt eine weitere wichtige Eigenschaft zum Vorschein. Sie ist eine reellwertige Lösung der algebraischen Gleichung
x2 − 2 = 0
11
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
Allgemein heißt eine Zahl x algebraisch, wenn sie eine reellwertige Lösung einer Gleichung der Form
an xn + an−1 xn−1 + . . . + a1 x + a0 = 0
(1.7)
ist, wobei die Koeffizienten ai allesamt aus der Menge der ganzen Zahlen stammen.
Offensichtlich ist jede rationale Zahl
sung der folgenden Gleichung ist:
p
q
auch algebraisch, da sie die Lö-
q·x− p = 0
Jede algebraische Zahl ist auch eine reelle, aber gilt auch die Umkehrung? Ist jede reelle Zahl auch algebraisch? Sollte es tatsächlich Zahlen
geben, die keine Lösung einer algebraischen Gleichung sind, so wären sie nicht einfach zu erfassen, da wir diese Zahlen weder als Dezimalbruch hinschreiben noch indirekt als Nullstelle eines algebraischen
Terms charakterisieren können.
L=
∞
∑ 10−k!
k=1
Einer der Ersten, die fest an die Existenz solcher transzendenten Zahlen
glaubten,
war Leonhard Euler. Konkret hegte er die Vermutung, dass die
√
Zahl a b für alle rationalen Zahlen a = 1 und alle natürlichen Zahlen
b außerhalb der Menge der algebraischen Zahlen liegen müsse. Dennoch sollte es ihm zu Lebzeiten nicht gelingen, einen Beweis für seine
Vermutung zu finden.
1!
3!
5!
= 0,1100010 ... 010 ... 010 ...
2!
4!
Erst 1844 sollte Eulers Vermutung zur Gewissheit werden. In diesem
Jahr gelang es dem französischen Mathematiker Joseph Liouville als
erstem, die Existenz transzendenter Zahlen zweifelsfrei zu belegen [18].
Liouville führte den Beweis konstruktiv und konnte eine konkrete Zahl
angeben, die sich der Beschreibung durch eine algebraischen Gleichung
entzieht (Abbildung 1.11). Es ist die berühmte Zahl
∞
L :=
∑ 10−k! ,
k=1
die nach ihrem Entdecker heute als Liouville’sche Zahl bezeichnet wird.
Ab dem Jahr 1844 war die Transzendenz nicht mehr länger eine pure
Möglichkeit; sie war zur mathematischen Realität geworden.
Liouvilles faszinierende Entdeckung blieb kein Einzelfall. 1873 bewies
der französische Mathematiker Charles Hermite die Transzendenz der
berühmten eulerschen Konstante e, der Basis des natürlichen Logarithmus. Im Jahr 1882 machte der deutsche Mathematiker Ferdinand von
Joseph Liouville
(1809 – 1882)
Abbildung 1.11: Im Jahr 1844 bewies der
französische Mathematiker Joseph Liouville die Existenz transzendenter Zahlen.
12
1 Historische Notizen
Abbildung 1.12: Die reellen Zahlen lassen sich in rationale Zahlen und irrationale Zahlen einteilen. Jede rationale Zahl ist
auch algebraisch, aber
√ nicht umgekehrt.
So lässt sich die Zahl 2 als Lösung einer
algebraischen Gleichung darstellen, aber
nicht als Bruch. Seit dem Jahr 1844 wissen wir, dass Zahlen existieren, die keine Lösung einer algebraischen Gleichung
sind. Sie bilden zusammen die Menge der
transzendenten Zahlen, der unter anderem
die eulersche Konstante e und die Kreiszahl π angehören.
Ra
tio
Zah nale
len
0, 1, 2, . . .
1 2 4
2, 3, 5,...
Irra
ti
Zah onale
len
√ √ (1+√5)
2, 5, 2 , . . .
e, π, . . .
che
rais
b
e
n
Alg Zahle
te
den
zen n
s
n
Tra Zahle
Lindemann eine weitere wichtige Entdeckung. Es gelang ihm zu beweisen, dass die Gleichung
β1 eα1 + . . . + βn eαn = 0,
in der α1 , . . . , αn und β1 , . . . , βn algebraische Zahlen sind, nur die triviale Lösung β1 = . . . = βn = 0 besitzt, falls alle αi paarweise verschieden sind. Dies ist die Aussage des berühmten Satzes von LindemannWeierstraß. Aus diesem Satz und der bekannten Beziehung eiπ = −1
folgt, dass auch die Kreiszahl π transzendent sein muss. Damit waren
mit der eulerschen Konstante e und der Kreiszahl π gleich zwei der
wichtigsten Konstanten der Mathematik als transzendent identifiziert
(Abbildung 1.12).
d = r=1
Abbildung 1.13: Unter der Quadratur des
Kreises wird die Aufgabe verstanden, zu einem gegebenen Kreis ein Quadrat mit dem
gleichen Flächeninhalt zu konstruieren. Aus
der Transzendenz der Kreiszahl π folgt,
dass eine Konstruktion mit Zirkel und Lineal nicht möglich ist.
Lindemann hatte mit seinem Ergebnis zugleich eine der berühmtesten
Fragen der Geometrie beantwortet. Die Rede ist von der Quadratur des
Kreises, also der Aufgabe, zu einem gegebenen Kreis ein Quadrat mit
dem gleichen Flächeninhalt zu konstruieren (Abbildung 1.13). Da sich
jede mit Lineal und Zirkel konstruierbare Länge als Lösung einer algebraischen Gleichung formulieren lässt, folgt aus der Transzendenz von
π die Unlösbarkeit des Quadraturproblems. Heute ist die „Quadratur
des Kreises“ eine beliebte Metapher für ein unlösbares Problem.
Schnell warf die Erkenntnis über die Existenz transzendenter Zahlen die
Frage auf, wie viele dieser schwer greifbaren Zahlen tatsächlich existieren. Ist die Transzendenz eine seltene Eigenschaft ausgewählter Zahlen
oder sollte sie gar das Kontinuum durchziehen, lautlos und für lange
Zeit unbemerkt wie die hypothetische dunkle Materie unser Universum? Es ist das Wissen über die Unendlichkeit, das uns eine erstaunliche Antwort auf diese Frage liefern wird. Wir kommen gleich darauf
zurück.
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
1.2.2
Auf den Spuren der Unendlichkeit
Die moderne Mathematik hat ihre Wurzeln im neunzehnten Jahrhundert, einem Jahrhundert des schier grenzenlosen Fortschritts, das nicht
nur auf gesellschaftliche und politische Fragen neue Antworten geben konnte, sondern auch Wirtschaft und Wissenschaft revolutionieren
sollte. Neue Erkenntnisse sorgten für eine Aufbruchstimmung in allen
Bereichen der Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Mendels Gesetze der Vererbung und Darwins Entdeckungen zur Entstehung der Arten ließen die Natur in einem neuen Licht erscheinen. Die Offenlegung
des Periodensystems der Elemente legte den Grundstein der modernen
Chemie. In der Physik revolutionierten die Maxwell’schen Gesetze das
physikalische Weltbild, und mit der Entwicklung des ersten Impfstoffs
durch Louis Pasteur nahm der Mensch todbringenden Krankheiten ihren Schrecken. Zur Jahrtausendwende wähnte sich die Wissenschaftsgemeinde an der Grenze der Allwissenheit, und für viele war es nur
eine Frage der Zeit, bis auch das letzte Rätsel dieser Welt gelüftet sein
würde. Allumfassende Theorien schienen in greifbarer Nähe.
Auch die Mathematik stand im neunzehnten Jahrhundert ganz im Zeichen des Fortschritts. Die Infinitesimalrechnung wurde durch Cauchy
und Weierstraß auf ein solides Fundament gestellt, und auch in anderen
Bereichen wurden das unendlich Große und das unendlich Kleine von
ihrer mystischen Aura befreit. Riemann und Gauß gaben der Geometrie
durch den rigorosen Einsatz analytischer Methoden ein neues Gesicht,
Dedekind und Kronecker lieferten wichtige Beiträge zur Zahlentheorie. Es war ein Jahrhundert der Spezialisierung, in dem das Interesse an
erkenntnistheoretischen Fragen allmählich zu verblassen begann.
Allen Fortschritten zum Trotz hatte die präziseste aller Wissenschaften
eines nicht erreicht: die Schaffung einer einheitlichen Grundlage, auf
der sich die Mathematik als Ganzes errichten lässt. Dass wir mit der
Mengenlehre eine solche Grundlage heute unser eigen nennen, ist keine
Selbstverständlichkeit, und wie so oft war es der Zufall, der die große
Wende herbeiführen sollte.
Es ist ein Kuriosum der Geschichte, dass ausgerechnet eine Frage der
Analysis den Anstoß zur Begründung der Mengenlehre gab. Auslöser
war die 1822 geäußerte Vermutung des französischen Mathematikers
Jean Baptiste Fourier, dass sich jede beliebige Funktion in Form einer
trigonometrischen Reihe darstellen lässt.2 Für stetige Funktionen war
Fouriers Vermutung weitgehend bewiesen, und immer mehr Mathema2 Heute wissen wir, dass Fouriers Vermutung in ihrer ursprünglichen Form falsch ist.
An ihrem wegbereitenden Charakter ändert dies jedoch nichts.
13
14
1 Historische Notizen
rz 6 Jan
3 M
Der deutsche Mathematiker Georg
Cantor wurde am 3. März 1845
in Sankt Petersburg geboren. Sein
Studium absolvierte er von 1862
bis 1867 in Zürich, Göttingen und Berlin, wo er berühmte Größen wie Karl Weierstraß, Ernst Eduard Kummer oder
Leopold Kronecker zu seinen Lehrern zählen durfte. 1867
wurde ihm von der Universität Berlin die Doktorwürde verliehen. Danach wechselte er nach Halle, wo er zuerst als Privatdozent, danach als Extraordinarius und schließlich als ordentlicher Professor lehrte und forschte.
Cantor gehört zu den bedeutendsten Mathematikern des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Er
gilt als der Begründer der Mengenlehre und legte mit dem
Begriff der Kardinalität den Grundstein für den Umgang
mit der Unendlichkeit. Der Begriff der Abzählbarkeit geht
genauso auf Cantor zurück wie die Diagonalisierungsmethode, auf die wir gleich an mehreren Stellen dieses Buchs
zurückgreifen werden.
1845 1918
Georg Cantor
(1845 – 1918)
Abbildung 1.14: Georg Cantor war der Begründer der modernen Mengenlehre. Mit
zahlreichen Beiträgen zur Untersuchung
des Unendlichen führte er die Mathematik
in die Moderne.
Cantor schreckte nie davor zurück, neue Wege zu beschreiten. Dennoch sollte das hohe Maß an Unverständnis, Misstrauen und Feindseligkeit, das ihm auf seinem einsamen
Weg entgegenschlug, tiefe Furchen in seiner Psyche hinterlassen.
Es ist ein tragischer Aspekt in seinem Leben, dass vor allem
sein Lehrer Leopold Kronecker gegen ihn rebellierte und ihn
mit blinder Wut zu bekämpfen versuchte. Kronecker, der in
ihm einen „Verderber der Jugend“ sah, nutzte seinen Einfluss geschickt aus, um einen Wechsel Cantors an die ehrwürdige Universität Berlin zu verhindern [198]. Halle sollte
für Cantor die erste und zugleich letzte Station seiner wissenschaftlichen Laufbahn sein.
Im Alter von 39 Jahren erkrankte Cantor an manischer Depression – ein Leiden, das ihn bis zu seinem Lebensende begleiten sollte. Kurz nach seinem siebzigsten Geburtstag wurde er nach einem erneuten Krankheitsausbruch in die Universitätsklinik Halle eingewiesen. Dort starb Georg Cantor
am 6. Januar 1918 im Alter von 72 Jahren.
tiker gingen dazu über, die Ergebnisse auf den unstetigen Fall zu übertragen. Der deutsche Mathematiker Georg Cantor war einer davon (Abbildung 1.14). Cantor verfolgte den Plan, die Annahme der Stetigkeit
schrittweise abzuschwächen, um sie schließlich ganz zu eliminieren.
Seine Arbeit sollte schon bald Früchte tragen. In einem ersten Schritt
gelang es ihm zu zeigen, dass Fouriers Vermutung auf Funktionen zutrifft, die endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzen. Von seinem Anfangserfolg beflügelt, ging er daran, seine Ergebnisse auf Funktionen
mit unendlich vielen Unstetigkeitsstellen zu übertragen. Cantor gelang
dies nicht uneingeschränkt, sondern nur dann, wenn die Verteilung der
Unstetigkeitsstellen bestimmten Eigenschaften genügte. Indem er die
Unstetigkeitsstellen in Mengen (Mannigfaltigkeiten) zusammenfasste,
konnte er zeigen, dass sich die Verteilungseigenschaften auf strukturelle Eigenschaften der konstruierten Mengen übertragen ließen. Noch
wurden Cantors Mannigfaltigkeiten von vielen Mathematikern als befremdliche Obskuritäten empfunden, die so gar nicht zu den bis dato
üblichen Begriffen passten. Bis sich die Mengenlehre als akzeptierte
Grundlage der gesamten Mathematik etablieren konnte, war es noch
ein langer Weg.
Das Instrumentarium, das Cantor für seine Untersuchungen geschaffen hatte, war von so allgemeiner Natur, dass er sowohl endliche als
auch unendliche Mengen in der gleichen Weise untersuchen konnte.
Der Schlüssel für den Umgang mit dem Unendlichen liegt in der Be-
15
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
trachtung der Mächtigkeit (Kardinalität) einer Menge M. Sie wird mit
|M| bezeichnet und entspricht für endliche Mengen schlicht der Anzahl
ihrer Elemente. Zum Beispiel gelten die folgenden Beziehungen:
M1 = 0/
M2 = {, ♦, ◦}
⇒ |M1 | = 0
M3 = {2, 3, 5}
⇒ |M3 | = 3
⇒
I Bijektive Abbildung von N+ nach N
0
♦ → 3,
2
3
4
5
6
7
...
1
2
3
4
5
6
7
...
|M2 | = 3
Die Mengen M2 und M3 sind gleichmächtig, da sie die gleiche Anzahl
an Elementen enthalten. In diesem und nur in diesem Fall sind wir in
der Lage, die Elemente beider Mengen eindeutig einander zuzuordnen.
Für unser Beispiel könnte die Zuordnung folgendermaßen aussehen:
→ 2,
1
◦ → 5
I Bijektive Abbildung von 2N nach N
0
2
4
6
...
Stimmt die Anzahl der Elemente nicht überein, so kann eine derartige
Zuordnung nicht gelingen.
Damit sind wir in der Lage, den Begriff der Mächtigkeit an die Existenz
einer entsprechenden Abbildung zu knüpfen:
0
|M1 | = |M2 |
2
3
4
5
6
7
...
I Bijektive Abbildung von Z nach N
Definition 1.1 (Mächtigkeit)
Mit M1 und M2 seien zwei beliebige Mengen gegeben. M1 und M2
heißen gleichmächtig, geschrieben als
1
−1
0
0
1
−2
2
1
3
−3
4
2
5
6
3
−4
...
7
...
...
wenn eine bijektive Abbildung f : M1 → M2 existiert. Wir schreiben
|M1 | ≤ |M2 |
wenn eine injektive Abbildung f : M1 → M2 existiert.
Zwei unendliche Mengen sind per Definition genau dann gleichmächtig, wenn sich ihre Elemente jeweils umkehrbar eindeutig einander zuordnen lassen. Auf den ersten Blick erscheint die Herangehensweise als
unnatürlich und unnötig umständlich. Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass die Definition darauf verzichtet, die Elemente einer Menge
explizit zu zählen. Damit sind wir in der Lage, auch dann die Kardinalität zweier Mengen zu vergleichen, wenn diese unendlich viele Elemente
enthalten.
Hieraus ergeben sich überraschende Konsequenzen. Als Erstes betrachten wir die Menge N der natürlichen Zahlen und die Menge N+ der
Abbildung 1.15: Die Existenz einer bijektiven Abbildung zwischen den natürlichen,
den positiven, den geraden und den ganzen
Zahlen beweist die Gleichmächtigkeit dieser Mengen.
16
1 Historische Notizen
positiven ganzen Zahlen. Obwohl die Menge N+ eine echte Teilmenge
von N ist, lässt sie sich mit der folgenden Zuordnungsvorschrift bijektiv
auf die natürlichen Zahlen abbilden (Abbildung 1.15 oben):
f : x → (x − 1)
In ähnlicher Weise können wir eine Abbildung zwischen 2N, der Menge
der geraden nichtnegativen Zahlen, und N herstellen (Abbildung 1.15
Mitte):
f : x →
x
2
Ebenso können wir die ganzen Zahlen, wie in Abbildung 1.15 (unten)
gezeigt, bijektiv auf die Menge der natürlichen Zahlen abbilden. Die
folgende Zuordnung ist eine von – Sie werden es ahnen – unendlich
vielen Möglichkeiten:
−2x − 1 falls x < 0
f : x →
2x falls x ≥ 0
Die Mengen der natürlichen und der ganzen Zahlen erweisen sich in
der Tat als gleichmächtig. Doch damit nicht genug. Auch die Menge Q
der rationalen Zahlen lässt sich bijektiv auf N abbilden. Abbildung 1.16
zeigt, wie eine passende Abbildung konstruiert werden kann. Alle Elemente von Q sind in einer Matrix angeordnet, die sich unendlich weit
nach rechts und nach unten ausbreitet. Fassen wir x als Spaltennummer
und y als Zeilennummer auf, so können wir jedem Bruch xy ∈ Q ein
Element der Matrix zuordnen. Ein Element (x, y) können wir mit einer
eindeutigen Zahl πN (x, y) ∈ N versehen, indem wir links oben, bei (0,0),
beginnen und uns anschließend diagonal durch die Matrix bewegen. Die
entstehende Abbildung πN : N2 → N heißt Cantor’sche Paarungsfunktion und lässt sich über die nachstehende Formel direkt berechnen:
x+y
πN (x, y) = y + ∑ i = y +
i=0
(x + y)(x + y + 1)
2
Über die Existenz einer bijektiven Zuordnung zwischen N und Q haben
wir gezeigt, dass beide Mengen die gleiche Mächtigkeit besitzen.
Mithilfe der Cantor’schen Paarungsfunktion lassen sich weitere Mengen als gleichmächtig identifizieren. Durch die rekursive Anwendung
sind wir z. B. in der Lage, nicht nur jedem Paar (x, y) ∈ N2 , sondern
auch jedem Tripel (x, y, z) ∈ N3 ein eindeutiges Element in N zuzuordnen. Diesen Zweck erfüllt die Funktion πN3 : N3 → N mit
πN3 (x, y, z) := πN (πN (x, y), z)
17
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
3
6
10
15
21
2
4
7
11
16
22
29
5
8
12
17
23
30
9
13
18
24
31
14
19
25
32
20
26
33
27
34
28
...
...
1
...
0
...
...
...
...
...
35
...
...
Abbildung 1.16: Die abgebildete Paarungsfunktion ordnet jedem Tupel (x, y) ∈
N2 eine Zahl πN (x, y) ∈ N zu. Die Abbildung ist bijektiv und beweist, dass N2 und
N gleichmächtig sind.
Führen wir den Gedanken in dieser Richtung fort, so erhalten wir mit
πN1 (x1 ) := x1
πNn+1 (x1 , . . . , xn , xn+1 )
:=
πN (πNn (x1 , . . . , xn ), xn+1 )
(1.8)
(1.9)
eine bijektive Abbildung von Nn auf N. Damit ist bewiesen, dass der ndimensionale Zahlenraum Nn stets die gleiche Mächtigkeit besitzt wie
die Grundmenge N selbst – unabhängig davon, wie groß wir die Dimension n ∈ N auch wählen.
In einer berühmten Arbeit aus dem Jahr 1874 publizierte Cantor, wie
sich auch die Menge der algebraischen Zahlen bijektiv auf die Menge
der natürlichen Zahlen abbilden lässt [19]. Hierzu ordnete er jeder algebraischen Gleichung der Form (1.7) zunächst eine Höhe N zu, die sich
wie folgt berechnet:
N := n − 1 + |an | + . . . + |a3 | + |a2 | + |a1 | + |a0 |
Für jeden Wert von N existieren nur endlich viele algebraische Gleichungen, und jede dieser Gleichungen kann maximal N Lösungen besitzen. Damit sind wir in der Lage, die algebraischen Zahlen der Reihe
nach aufzuzählen, und erhalten so eine eindeutige Zuordnung zu den
natürlichen Zahlen.
18
Cantors Arbeit aus dem Jahr
1874 trägt den unscheinbaren Titel „Über eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen“. Die Frage, warum Cantor einen Titel wählte, der dem Leser keinerlei Hinweis auf sein erzieltes Hauptergebnis,
die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen,
gibt, ist in Historikerkreisen umstritten.
Zum einen gibt es Anlass für die Vermutung, dass Cantor das eigentlich Revolutionäre seiner Arbeit zur Zeit der Veröffentlichung selbst nicht gesehen hat und
ausschließlich an einem alternativen Beweis des Liouville’schen Satzes interessiert war. Hinweise darauf finden sich in
einem Brief Cantors an Richard Dedekind
vom 2.12.1873: [129]
„Übrigens möchte ich hinzufügen, dass
ich mich nie ernstlich mit ihr [der Frage
nach der Abzählbarkeit des Kontinuums]
beschäftigt habe, weil sie kein besonderes
praktisches Interesse für mich hat und ich
trete Ihnen ganz bei, wenn Sie sagen, dass
sie aus diesem Grund nicht zu viel Mühe verdient. Es wäre nur schön, wenn sie
beantwortet werden könnte; z.B., vorausgesetzt dass sie mit nein beantwortet würde, wäre damit ein neuer Beweis des Liouville’schen Satzes geliefert, dass es transzendente Zahlen gibt.“
Dagegen ist der Cantor-Biograph Joseph
Dauben davon überzeugt, dass die Titelwahl politisch motiviert war und nur dazu
dienen sollte, seinen Erzfeind Kronecker
nicht auf die Arbeit aufmerksam zu machen [36].
„Had Cantor been more direct with a
title like ’The set of real numbers is nondenumerably infinite’ or ’A new and independent proof of the existence of transcendental numbers’, he could have counted on a strongly negative reaction from
Kronecker. After all, when Lindemann later established the transcendence of π in
1882, Kronecker asked what value the result could possibly have, since irrational
numbers did not exist.“
1 Historische Notizen
Cantors wesentlich bedeutsamere Entdeckung war aber eine andere. In
der gleichen Arbeit, in der er die Gleichmächtigkeit von N und der Menge der algebraischen Zahlen zeigte, bewies er, dass sich das Kontinuum
einer entsprechenden Zuordnung entzieht. Offenbar scheint die Anzahl
der reellen Zahlen jene der natürlichen Zahlen so sehr zu übersteigen,
dass es unmöglich ist, eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen beiden
Mengen herzustellen. Damit hatte Cantor gezeigt, dass die Menge der
natürlichen Zahlen und die Menge der reellen Zahlen stellvertretend für
verschiedene Unendlichkeiten stehen. Begrifflich bringen wir den Unterschied wie folgt zum Ausdruck:
Definition 1.2 (Abzählbarkeit, Überabzählbarkeit)
Eine Menge M heißt
I
abzählbar, falls |M| = |N|,
I
höchstens abzählbar, falls |M| ≤ |N|, und
I
überabzählbar, falls |M| ≤ |N|.
In Worten ausgedrückt ist eine Menge M höchstens abzählbar, wenn
sie endlich oder abzählbar ist.
Cantors erster Überabzählbarkeitsbeweis
Um die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen zu zeigen, führte Cantor
einen klassischen Widerspruchsbeweis. Zunächst nahm er an, dass sich
die reellen Zahlen vollständig in Form einer unendlich langen Liste aufzählen lassen:
ω1 , ω 2 , ω 3 , . . .
(1.10)
Jedes Element ωi bezeichnet eine reelle Zahl, und für jede reelle Zahl
x existiert per Annahme ein Index i mit ωi = x. Cantor gelang es zu
zeigen, dass in jedem nichtleeren Intervall (α1 , β1 ) dennoch mindestens
eine reelle Zahl ν existieren muss, die nicht in der Liste (1.10) auftaucht.
Den Widerspruch leitete er her, indem er das Startintervall (α1 , β1 ) zu
einer Intervallfolge der folgenden Bauart ergänzte:
(α1 , β1 ), (α2 , β2 ), (α3 , β3 ), . . .
Um das Folgeintervall (αi+1 , βi+1 ) zu bestimmen, wird die aufgestellte Liste der reellen Zahlen von links nach rechts durchsucht, bis zwei
19
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
Zahlen gefunden werden, die innerhalb des Intervalls (αi , βi ) liegen.
Die kleinere von beiden bildet die linke Grenze und die größere die
rechte Grenze des neuen Intervalls (Abbildung 1.17). Anschließend unterschied Cantor die nachstehenden Fälle:
I
I
Fall 1: Die Anzahl der geschachtelten Intervalle ist endlich (Abbildung 1.18 oben). Dann gäbe es ein letztes Intervall (αν , βν ), und
ν
ν
und αν +β
zwei Zahlen vor uns, von denen
wir hätten mit αν +β
2
3
mindestens eine nicht in (1.10) vorkommt.
Fall 2: Die Anzahl der geschachtelten Intervalle ist unendlich. Aus
der Tatsache, dass die Intervallgrenzen αi und βi beschränkt und
gleichzeitig streng monoton steigend bzw. fallend sind, müssen beide Folgen einem Grenzwert zustreben, den Cantor als α∞ bzw. β∞
∞
bezeichnet. Wäre α∞ < β∞ , so könnten wir mit α∞ +β
erneut eine
2
Zahl konstruieren, die in (1.10) nicht vorkommt (Abbildung 1.18
Mitte). Aber auch die letzte Alternative, α∞ = β∞ , führt zu einem
Widerspruch (Abbildung 1.18 unten). Einerseits ist der Grenzwert
in jedem der gebildeten Intervalle enthalten. Andererseits stellt die
Konstruktionsvorschrift sicher, dass jedes ωi ab einem gewissen Index j nicht mehr in (α j , β j ) liegt. Damit kann der Grenzwert nicht
in (1.10) auftauchen.
Offensichtlich gibt es kein Entrinnen! Die entstehenden Widersprüche
bringen unsere Annahme zu Fall, dass eine bijektive Abbildung zwischen den reellen und den natürlichen Zahlen existieren kann.
Aus den von Cantor erzielten Teilergebnissen ergibt sich eine weitreichende Konsequenz für die Menge der transzendenten Zahlen. Da die
Menge der algebraischen Zahlen abzählbar und die Menge der reellen Zahlen überabzählbar ist, kann keine Abbildung der transzendenten
Zahlen auf die natürlichen Zahlen gelingen. Genau wie das Kontinuum
ist auch die Menge der transzendenten Zahlen überabzählbar.
Waren in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nur eine Handvoll
transzendenter Zahlen bekannt, so wissen wir heute, dass die Transzendenz alles andere als eine exotische Eigenschaft ausgewählter Zahlen
ist. Bis auf eine kleine Teilmenge sind sämtliche Elemente des Kontinuums transzendent!
Cantor hatte für diese Behauptung einen wahrhaft eleganten Beweis
geliefert. Die inhaltliche Aussage seines Satzes war jedoch nicht neu;
Liouville hatte bereits ein paar Jahre zuvor ein ähnliches Ergebnis erzielt. Der historisch bedeutende Teil in Cantors Arbeit ist in einem sei-
3
4
9
2
10 11
8 6
1 = 2
7
5 1
1 = 1
1
1
2 = 4
2 = 5
1 2
2 1
3 = 8
1 2
3 = 6
3 3
2 1
...
Abbildung 1.17: Cantors erster Beweis der
Überabzählbarkeit des Kontinuums. Ausgehend von einer Aufzählung ωi der reellen
Zahlen konstruierte Cantor zunächst eine
Intervallfolge der Form (α1 , β1 ), (α2 , β2 ),
(α3 , β3 ), . . .
I Fall 1
α1 α2 ...
αν βν ...
β2 β1
I Fall 2
α1 α2 ...
α∞ β∞ ...
β2 β1
oder
α1 α2 ...
α∞
...
β2 β1
β∞
Abbildung 1.18: Gleichgültig, wie die
Konstruktion der Intervallfolge verlaufen
wird: Sämtliche Möglichkeiten führen zu
einem Widerspruch.
20
f (1) =
0
,
5
4
9
0
0
7
5
8
...
f (2) =
0
,
7
1
4
4
5
6
6
3
...
f (3) =
0
,
7
4
3
9
6
1
4
2
...
f (4) =
0
,
2
3
1
1
1
7
4
5
...
f (5) =
0
,
2
7
9
7
7
4
0
0
...
f (6) =
0
,
3
8
6
4
8
7
2
8
...
f (7) =
0
,
5
6
0
6
9
3
7
4
...
f (8) =
0
,
2
1
3
4
4
9
9
9
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Abbildung 1.19: Das Diagonalisierungsargument. Gäbe es eine bijektive Abbildung von den natürlichen auf die reellen Zahlen, so müsste sich die (unendlich lange) Ziffernfolge jeder reellen Zahl
in einer Zeile der Zuordnungsmatrix wiederfinden lassen. Unabhängig von der gewählten Zuordnung sind wir immer im
Stande, die Ziffernfolge einer reellen Zahl
zu konstruieren, die nicht in der Matrix
vorkommt. Diese können wir erzeugen,
indem wir uns entlang der Hauptdiagonalen von links oben nach rechts unten bewegen und die vorgefundene Ziffer um
eins erhöhen oder erniedrigen. Die konstruierte Ziffernfolge kommt nirgends in
der Matrix vor, da sie sich von jener der iten Zeile per Konstruktion in der i-ten Ziffer unterscheidet. Die Überlegung zeigt,
dass eine bijektive Zuordnung der Elemente aus R zu den Elementen aus N
nicht möglich ist. Kurzum: Die Menge der
reellen Zahlen ist nicht abzählbar.
1 Historische Notizen
ner Teilergebnisse versteckt: Es ist der Beweis der Überabzählbarkeit
der reellen Zahlen.
Cantors zweiter Überabzählbarkeitsbeweis
Drei Jahre später bewies Cantor seine Aussage erneut – diesmal auf
verblüffend einfache Weise. Den Kern des Beweises bildet das von ihm
entwickelte Diagonalisierungsargument, eine genauso leistungsfähige
wie intuitive Methode, um eine Menge als überabzählbar zu identifizieren. Cantor stellte die folgende Überlegung an: Wenn die beiden Mengen N und R gleichmächtig wären, dann müsste eine bijektive Abbildung f : N → R existieren, die jedes Element x ∈ N eineindeutig auf
ein Element f (x) ∈ R abbildet. Listen wir die Nachkommaanteile von
f (1), f (2), f (3), . . . von oben nach unten auf, so entsteht eine Matrix,
wie sie in Abbildung 1.19 skizziert ist. Formal entspricht das Element in
Spalte x und Zeile y der x-ten Nachkommaziffer der Dezimalbruchdarstellung von f (y). Natürlich können wir nur einen winzigen Ausschnitt
der entstehenden Matrix zeichnen, da die Funktion f für unendlich viele Werte y ∈ N definiert ist und sich die Dezimalbruchdarstellung der
reellen Zahlen f (y) über unendlich viele Ziffern erstreckt.
21
Erneut hat uns der Cantor’sche Zugang zur Unendlichkeit eine verblüffende Eigenschaft von Zahlenmengen offengelegt. Die Gleichmächtigkeit von R und R2 bedeutet, dass eine Gerade in der Ebene gleich viele
Punkte besitzt wie die Ebene selbst (Abbildung 1.21). Wir sind damit
in der Lage, die Punkte der Ebene verlustfrei auf die Punkte einer Geraden abzubilden. Ebenso ist es möglich, die Ebene lückenlos mit den
Punkten einer Geraden zu belegen.
πR1 (x1 )
:= x1
πRn+1 (x1 , . . . , xn , xn+1 ) := πR (πRn (x1 , . . . , xn ), xn+1 )
Am Beispiel der reellen Zahlen haben wir gesehen, dass eine Unendlichkeit existiert, die mächtiger ist als jene der natürlichen Zahlen. Das
Ergebnis wirft die Frage auf, ob es eine weitere Unendlichkeit gibt, die
0 , 1 4 3 2 5 1 5 0 0 0 8 7 4 5 0 9 7 ...
0 ,
4
2
1
0
0
7
5
9
...
Abbildung 1.20: Im Reißverschlussverfahren lassen sich zwei reelle Zahlen zu einer
einzigen reellen Zahl verschmelzen. Auf
diese Weise lässt sich eine bijektive Abbildung von R2 auf R konstruieren und damit
die Gleichmächtigkeit der beiden Mengen
zeigen.
...
...
...
Kombinieren wir die Aufrufe von πR wieder rekursiv miteinander, so
entsteht für jede natürliche Zahl n ∈ N eine Abbildung πRn , die den ndimensionalen Zahlenraum Rn bijektiv auf R reduziert. Formal ist die
Abbildung πRn , in Analogie zu den Gleichungen (1.8) und (1.9), wie
folgt definiert:
8
0
5
5
3
0 , 1
0
4
...
Trotzdem gelten einige der Eigenschaften, die wir für die Menge N herausgearbeitet haben, auch in der Menge der reellen Zahlen. So sind wir
auch hier in der Lage, ein Tupel (x, y) ∈ R2 bijektiv auf die Menge
R abzubilden. Abbildung 1.20 skizziert die zugrunde liegende Konstruktionsidee. Die beiden reellen Zahlen x ∈ R und y ∈ R werden
zu einer gemeinsamen reellen Zahl πR (x, y) ∈ R verschmolzen, indem
die Vor- und Nachkommaziffern reißverschlussartig miteinander verschränkt werden.
7
Mithilfe des Diagonalisierungsarguments können wir zeigen, dass die
Matrix nie vollständig sein kann. Unabhängig von der konkreten Wahl
von f existieren reelle Zahlen, die nicht in der Matrix enthalten sind
und damit die Bijektivität von f ad absurdum führen. Wir konstruieren eine solche Zahl, indem wir uns entlang der Hauptdiagonalen von
links oben nach rechts unten bewegen und die vorgefundenen Ziffern
jeweils um eins erhöhen oder erniedrigen. Die entstehende Ziffernfolge
interpretieren wir als die Nachkommaziffern einer reellen Zahl r. Wäre f eine bijektive Abbildung von N auf R, so müsste auch die Zahl r
in irgendeiner Zeile vorkommen. Aufgrund des gewählten Konstruktionsschemas ist jedoch sichergestellt, dass sich die reelle Zahl der i-ten
Zeile in der i-ten Ziffer von r unterscheidet. Die Annahme, eine bijektive Zuordnung zwischen N und R könnte existieren, führt zu einem
unmittelbaren Widerspruch. Folgerichtig ist jeder Versuch, die reellen
Zahlen nacheinander durchzunummerieren, zum Scheitern verurteilt.
...
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
...
...
Abbildung 1.21: Die zweidimensionale
Ebene und die eindimensionale Gerade
beinhalten die gleiche „Anzahl“ reeller
Punkte. Jeder Punkt des einen geometrischen Objekts lässt sich eindeutig auf einen
Punkt des anderen abbilden.
22
1 Historische Notizen
wiederum mächtiger ist als jene der reellen Zahlen. Der folgende Satz
von Cantor beantwortet diese Frage positiv:
Satz 1.1 (Satz von Cantor)
Für jede Menge M ist die Potenzmenge 2M mächtiger als M.
Wir können diese Aussage beweisen, indem wir ein ähnliches Diagonalisierungsargument verwenden, mit dem wir bereits die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen zeigen konnten. Auch hier gehen wir wieder von
der Existenz einer bijektiven Abbildung f : M → 2M aus und führen die
Annahme zu einem Widerspruch.
Sei f eine Funktion, die M bijektiv auf die Menge 2M abbildet. Für
jedes Element x ∈ M können wir zwei Fälle unterscheiden: Entweder
ist x im Bildelement f (x) enthalten (x ∈ f (x)) oder nicht (x ∈ f (x)).
Alle Elemente, auf die Letzteres zutrifft, fassen wir in der Menge T
zusammen:
T := {x ∈ M | x ∈ f (x)}
Da f bijektiv und damit insbesondere auch surjektiv ist, muss ein Urbild
xT existieren mit f (xT ) = T . Wie für alle Elemente aus M gilt auch für
das Element xT entweder die Eigenschaft xT ∈ T oder xT ∈ T . Beide
Fälle führen jedoch unmittelbar zu einem Widerspruch:
xT ∈ T ⇒ x T ∈
f (xT ) ⇒ xT ∈
T
xT ∈ T ⇒ xT ∈ f (xT ) ⇒ xT ∈ T
Damit haben wir gezeigt, dass es eine bijektive Funktion f : M → 2M
nicht geben kann.
Aus dem Cantor’schen Satz ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen.
Zum einen zeigt er, dass es keine maximale Unendlichkeit gibt, d. h.,
wir sind nicht in der Lage, eine Universalmenge zu konstruieren, die
mächtiger ist als alle anderen Mengen. Es scheint, als ob es die Unendlichkeit abermals schafft, sich jeglichen Grenzen zu entziehen. Zum
anderen bringt der Satz eine hierarchische Ordnung in die unendliche
Menge der verschiedenen Unendlichkeiten:
N
2N
N
22
|N| < |2N | < |22 | < |22 | < |22
| < ...
Cantor verwendete den hebräischen Buchstaben Aleph (ℵ), um die
Mächtigkeit einer unendlichen Menge zu beschreiben. Die kleinste Unendlichkeit wird mit der Kardinalzahl ℵ0 bezeichnet; sie entspricht der
23
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
Kardinalität der natürlichen Zahlen. Eine kleinere Unendlichkeit als |N|
kann es nicht geben, da sich alle unendlichen Teilmengen von N bijektiv auf N abbilden lassen. Die nächstgrößere Unendlichkeit wird durch
die Kardinalzahl ℵ1 beschrieben und so fort. Besitzt eine Menge M die
Kardinalität ℵn , so bezeichnen wir die Kardinalität der Potenzmenge
2M mit 2ℵn .
An dieser Stelle wollen wir mit dem berühmten Cantor-SchröderBernstein-Theorem (CSB-Theorem) ein wichtiges Hilfsmittel einführen, mit dem sich die Gleichmächtigkeit vieler Mengen bequem beweisen lässt. Um die Aussage des Theorems zu verstehen, werfen wir
erneut einen Blick auf Definition 1.1. Dort haben wir die Schreibweise |M1 | ≤ |M2 | eingeführt, um auszudrücken, dass sich die Menge M1
injektiv in die Menge M2 abbilden lässt. Bildlich gesprochen bedeutet
dies, dass sich die Elemente von M1 in die Menge M2 einbetten lassen,
ohne ein Element von M2 doppelt zu belegen. Da jede bijektive Abbildung auch injektiv ist, folgt aus |M1 | = |M2 | immer auch |M1 | ≤ |M2 |
und |M2 | ≤ |M1 |. Das Cantor-Schröder-Bernstein-Theorem besagt nun,
dass dieser Schluss sogar in der umgekehrten Richtung gilt:
Satz 1.2 (Cantor-Schröder-Bernstein-Theorem)
I Injektionen f und g
(−1;1)
[−1;1]
1
1
1/2
1/2
1/4
1/4
1/8
1/8
...
0
0
−1/8
−1/8
−1/4
−1/4
−1/2
−1/2
Für zwei beliebige Mengen M1 und M2 gilt:
Aus |M1 | ≤ |M2 | und |M2 | ≤ |M1 | folgt |M1 | = |M2 |.
−1
Einen Beweis dieses Satzes finden Sie beispielsweise in [46] oder [196].
An zwei Beispielen wollen wir demonstrieren, wie sich das CantorSchröder-Bernstein-Theorem einsetzen lässt.
Als erstes wollen wir es dazu verwenden, um das offene Intervall
(−1; 1) und das geschlossene Intervall [1; 1] als gleichmächtig zu identifizieren. Zunächst halten wir fest, dass sich die Menge (−1; 1) über
die identische Abbildung f : x → x auf triviale Weise injektiv in die
Menge [1; 1] einbetten lässt. Andersherum existiert mit g : x → 2x auch
eine injektive Abbildung des geschlossenen Intervalls in das offene. Damit sind wir schon am Ziel. Aus dem CSB-Theorem folgt die Gleichmächtigkeit der beiden Intervalle. Unbestritten stellt das Ergebnis unsere Intuition erneut auf eine harte Probe, da das geschlossene Intervall
[−1; 1] zwei Elemente mehr zu enthalten scheint als sein offenes Pendant (−1; 1). Abbildung 1.22 beseitigt die Zweifel, ob hier alles mit
rechten Dingen zugeht. Sie zeigt, wie eine bijektive Abbildung zwischen den beiden Intervallen konkret aussehen kann.
g
f
−1
I Bijektion h : (−1; 1) → [−1; 1]
⎧
(−)1
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
(−) 12
⎪
⎪
⎨
(−) 14
h : x →
⎪
1
⎪
⎪ (−) 8
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
x
falls
x = (−) 12
falls
x = (−) 14
falls
x = (−) 18
falls
...
sonst
1
x = (−) 16
Abbildung 1.22: Lässt sich eine Menge injektiv in eine andere Menge abbilden und umgekehrt, so kann durch die geschickte Kombination der beiden Abbildungen eine Bijektion zwischen den Mengen hergestellt werden. Dies ist die Aussage
des berühmten Cantor-Schröder-BernsteinTheorems, hier demonstriert am Beispiel
der Intervalle (−1; 1) und [−1; 1].
24
... 0 0 0 3 4 8 6 0 7 , 5 7 3 0 0 9 1 2 ...
1 Historische Notizen
Auf die gleiche Art und Weise können wir zeigen, dass sich die Menge
der reellen Zahlen bijektiv auf das Einheitsintervall [0; 1] abbilden lässt.
Eine injektive Einbettung von [0; 1] in R ist trivial. Umgekehrt können
wir durch die Zuordnung
∞
∑
i=−∞
0 , 7 5 0 7 6 3 8 0 4 0 3 9 0 1 0 2 0 ...
Abbildung 1.23: Durch die Umsortierung
der Ziffernfolge lassen sich alle reellen Zahlen injektiv in das Intervall [0; 1] einbetten.
∞ bi 10i → b0 10−1 + ∑ b−i 10−2i + bi 10−2i−1
i=1
jede reellen Zahl in das Intervall [0; 1] abbilden, ohne ein Element der
Zielmenge doppelt zu belegen (Abbildung 1.23). Damit haben wir erneut die Voraussetzungen des CSB-Theorems erfüllt und die Gleichmächtigkeit von [0; 1] und R bewiesen.
Dass sich die reellen Zahlen bijektiv auf das Intervall [0; 1] abbilden
lassen, bringt eine entscheidende Vereinfachung mit sich, die wir in den
nachfolgenden Kapiteln mehrfach ausnutzen werden. Anstatt die reellen Zahlen als Ganzes zu behandeln, ist es völlig ausreichend, unsere
Betrachtungen auf die reellen Zahlen mit dem Vorkommaanteil 0 zu
beschränken.
Jetzt sind wir gewappnet, um einen wichtigen Zusammenhang zwischen
den reellen Zahlen und der Potenzmenge der natürlichen Zahlen herzustellen. Schreiben wir eine reelle Zahl x aus dem Intervall [0; 1] im
Binärsystem auf, so besitzt sie die folgende Form:
∞
x = ∑ bi 2−i
i=1
Die Koeffizienten bi bilden aneinandergereiht eine unendlich lange Folge von Nullen und Einsen. Damit können wir x eindeutig eine Teilmenge der natürlichen Zahlen zuordnen, indem wir die Zahl n ∈ N genau
dann in die Teilmenge aufnehmen, wenn die n-te Nachkommastelle von
x gleich 1 ist:
∞
∑ bi 2−i
→ {n ∈ N | bn = 1}
(1.11)
i=1
Umgekehrt können wir jede Teilmenge von N injektiv in das Intervall
[0; 1] einbetten:
{n1 , n2 , . . .} →
∑ 2−2ni −1
(1.12)
i
Das CSB-Theorem liefert uns das Ergebnis, nach dem wir gesucht haben. Es zeigt, dass die Menge der reellen Zahlen die gleiche Mächtigkeit
besitzt wie die Potenzmenge der natürlichen Zahlen:
|R| = |2N | = 2ℵ0
(1.13)
25
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
Cantor beschäftigte sich intensiv mit der Frage, ob sich zwischen den
Mengen N und R weitere Unendlichkeiten verbergen. Schon früh hegte
er die Vermutung, dass es keine Menge geben kann, die bezüglich ihrer
Kardinalität zwischen den natürlichen und den reellen Zahlen liegt.
Demnach befänden sich die reellen Zahlen an zweiter Position (ℵ1 )
in der unendlich langen Liste der Unendlichkeiten. Genau dies ist der
Inhalt der berühmten Kontinuumshypothese, die in ihrer symbolischen
Form wie folgt lautet:
?
|R| = ℵ1
(1.14)
Aufgrund der oben herausgearbeiteten Äquivalenz (1.13) können wir
Gleichung (1.14) auch in der Form
2ℵ0 = ℵ1
?
schreiben und in naheliegender Weise verallgemeinern:
2ℵn = ℵn+1
?
(1.15)
Die in Gleichung (1.15) geäußerte Vermutung heißt allgemeine Kontinuumshypothese. Plakativ besagt sie, dass die Potenzmengenoperation,
während sie uns von einer Unendlichkeit zur nächsten führt, keine Unendlichkeiten überspringt.
Die Kontinuumshypothese sollte Cantor bis zu seinem Lebensende beschäftigen. Einige Male glaubte er sich im Besitz eines Beweises, andere Male dachte er, die Hypothese widerlegt zu haben. Doch immer
wieder tauchten Fehler auf, die seinen schon sicher geglaubten Erfolg
zunichte machten. So sehr er sich auch bemühte, es blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt, dieses große Rätsel des Kontinuums zu lüften. Cantor
konnte nicht wissen, wie sehr er zum Scheitern verdammt war.
Dass Cantors Mengenbegriff von vielen seiner Zeitgenossen abgelehnt
und von einigen sogar heftig bekämpft wurde, lässt sich nur im historischen Kontext verstehen. Cantor schuf seinen Mengenbegriff in einer
Zeit, in der die Diskussion um das Wesen der Unendlichkeit in vollem
Gange war. Zwei Begriffe standen im Mittelpunkt des Diskurses: Die
potenzielle Unendlichkeit und die aktuale Unendlichkeit.
Den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen wollen wir am Beispiel der natürlichen Zahlen
0, 1, 2, 3, . . .
Über die Zuordnungsvorschrift (1.11) haben wir es
geschafft, die reellen Zahlen aus dem Intervall [0; 1]
injektiv in die Menge 2N einzubetten.
Die Abbildung haben wir über die Binärdarstellung einer reellen Zahl definiert,
und genau hier laufen wir in eine technische Schwierigkeit hinein, die auf den
ersten Blick gern übersehen wird. Ausgelöst wird sie durch die Eigenschaft mancher reeller Zahlen, mehrere Binärdarstellungen zu besitzen. Beispielsweise besitzt
die Zahl 12 die beiden Darstellungen 0,1
und 0,0111 . . .. Das bedeutet, dass die Vorschrift (1.11) der Zahl 12 sowohl die Menge {1} als auch die Menge {2, 3, 4, . . .}
zuordnet und damit streng genommen gar
keine Abbildung definiert. Glücklicherweise lässt sich dieses Problem einfach
lösen. Die Mehrdeutigkeit verschwindet,
wenn wir per Definition immer diejenige Darstellung mit der geringsten Anzahl
Einsen zugrunde legen.
Bei der Einbettung von 2N in [0; 1] müssen
wir ebenfalls vorsichtig sein. Würden wir
z. B. die Abbildungsvorschrift
{n1 , n2 , . . .} →
∑ 2−n −1
i
i
verwenden, so wäre die Abbildung nicht
mehr injektiv. Beispielsweise würden die
Mengen {0} und {1, 2, 3, . . .} beide der
Zahl 12 zugeordnet. Genau dies ist der
Grund, weshalb ni in Gleichung (1.12)
mit 2 multipliziert wird. Erst durch diesen Trick wird die Zuordnung injektiv,
d. h., verschiedene Teilmengen der natürlichen Zahlen werden auf verschiedene reelle Zahlen abgebildet.
26
1 Historische Notizen
sichtbar machen. Außer der 0 wird jedes Element in dieser unendlich
langen Liste durch die Anwendung der Nachfolgeroperation aus seinem Vorgänger gewonnen. Mit diesem Prozess können wir fortwährend neue Zahlen generieren, ohne dass die Anzahl der Iterationen nach
oben beschränkt ist. Wir sagen, die Anzahl der Iterationen ist potenziell
unendlich. Diese Art der Unendlichkeit birgt keinerlei Risiken in sich.
Auch wenn die Anzahl der Iterationen keiner Grenze unterliegt, erreichen wir jede natürliche Zahl nach endlich vielen Schritten und müssen
die Nachfolgeroperation daher niemals unendlich oft anwenden.
„So protestiere ich gegen den Gebrauch
einer unendlichen Größe als einer
Vollendeten, welches in der Mathematik
niemals erlaubt ist.“ [60]
Carl Friedrich Gauß
(1777 – 1855)
Abbildung 1.24: Der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauß zählt zu den genialsten Mathematikern des ausgehenden
achtzehnten und beginnenden neunzehnten
Jahrhunderts. Gauß hat in verschiedenen
Gebieten der Mathematik, Astronomie und
Physik Bahnbrechendes geleistet und führte die Göttinger Mathematik zu Weltruhm.
Eine Gedenkmünze, die ein Jahr nach seinem Tod ausgegeben wurde, ehrt den brillanten Mathematiker mit dem Titel „Mathematicorum Principi“ (lat. „Dem Fürsten
der Mathematiker“).
Reden wir stattdessen von den Zahlen, die sich durch die endliche Iteration der Nachfolgeroperation erzeugen lassen, als Ganzes, so haben
wir den Sprung von der potenziellen Unendlichkeit in die aktuale Unendlichkeit vollzogen. Das besagte Ganze ist in diesem Fall nichts anderes als die Menge der natürlichen Zahlen selbst und besitzt unendlich
viele Elemente. Ob wir die natürlichen Zahlen tatsächlich als ein abgeschlossenes Ganzes betrachten können oder lediglich das potenziell
Unendliche als alleinige Grundlage akzeptieren dürfen, wurde in der
Vergangenheit kontrovers diskutiert. Schon Aristoteles gehörte zu den
Kritikern der aktualen Unendlichkeit [155].
Befeuert wurde die Kritik durch die scheinbaren Widersprüche, die sich
im Umgang mit der Unendlichkeit ergeben. Weiter oben haben wir herausgearbeitet, dass eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen den ganzen
Zahlen Z und den natürlichen Zahlen N besteht, obwohl uns die Inklusionsbeziehung N ⊂ Z das Gegenteil suggeriert. In analoger Weise lässt
sich zeigen, dass jede unendliche Teilmenge von N die gleiche Mächtigkeit besitzt wie die natürlichen Zahlen selbst. Einige Wissenschaftler, wie der namhafte Astronom Galileo Galilei, sahen hierin die Bestätigung dafür, dass Größenvergleiche zwischen unendlichen Mengen
unzulässig sind und nur im Falle endlicher Mengen einen Sinn ergeben [58, 104]. Andere Wissenschaftler, wie der berühmte Mathematiker
Carl Friedrich Gauß, lehnten den Umgang mit unendlichen Mengen als
in sich geschlossene Größen vollständig ab (Abbildung 1.24).
Für Cantor waren die angeblichen Paradoxien nichts weiter als Eigenschaften unendlicher Mengen. Er sah, dass die augenscheinlichen
Widersprüche lediglich von der unbegründeten Annahme herrühren,
dass unendliche Mannigfaltigkeiten die gleichen Eigenschaften besitzen müssen, wie die uns vertrauten endlichen Mengen. Einen Fürsprecher fand Cantor in Richard Dedekind. Genau wie er sah Dedekind in
dem, was andere als Paradoxie bezeichneten, eine definierende Eigenschaft unendlicher Mengen. Offensichtlich hat eine Menge genau dann
unendlich viele Elemente, wenn eine echte Teilmenge mit der gleichen
Mächtigkeit existiert.
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
27
„[Cantors] Widerlegung der Bedenken gegen das Unendliche
scheint mir im Ganzen wohlgelungen und treffend zu sein. Die
Bedenken entstehen dadurch, dass dem Unendlichen Eigenschaften beigelegt werden, die ihm nicht zukommen, indem
entweder Eigenschaften des Endlichen auf das Unendliche wie
selbstverständlich übertragen werden oder eine Eigenschaft,
die nur dem Absolutunendlichen zukommt, auf alles Unendliche übertragen wird. Auf die Unterschiede im Unendlichen
nachdrücklich hinzuweisen, ist ein Verdienst dieser Schrift.“ [51]
Gottlob Frege (1848 – 1925)
„Das Unendliche wird sich in der Arithmetik doch schließlich
nicht leugnen lassen, und andererseits ist es mit jener erkenntnistheoretischen Richtung unvereinbar. Hier ist, wie es scheint,
das Schlachtfeld, wo eine große Entscheidung fallen wird.“ [51]
Abbildung 1.25: Der deutsche Mathematiker Gottlob Frege begründete mit dem Logizismus eine neue Denkrichtung. Auch er
schreckte nicht vor dem aktual Unendlichen zurück; wie Cantor sah er darin den Schlüssel zu einer modernen Mathematik.
Obgleich das hohe Maß an Unverständnis, Misstrauen und Feindseligkeit tiefe Furchen in Cantors Psyche hinterließ, hielt er Kurs. Unbeirrt
steuerte er in Richtung einer neuen Mathematik, die das aktual Unendliche zum Protagonisten erheben und damit ein für allemal von seiner
Statistenrollen befreien sollte. Noch ahnte Cantor nicht, dass sein Gedankengerüst schon bald ins Wanken geraten würde.
1.2.3
Macht der Symbole
Genau wie Cantor war auch der drei Jahre später geborene Gottlob
Frege ein Verfechter des aktual Unendlichen (Abbildung 1.25). Frege
sah früh voraus, dass sich der Umgang mit der Unendlichkeit zu einer Grundsatzfrage der gesamten Mathematik entwickeln würde, die
kontrovers genug war, um die Wissenschaftsgemeinde für lange Zeit
zu spalten. Nichtsdestotrotz war er davon überzeugt, dass sich das aktual Unendliche über kurz oder lang als akzeptiertes Instrument in der
Mathematik etablieren würde. Genau wie Cantor sah er die Mathematik von einer „mächtigen akademisch-positivistischen Skepsis“ [51] beherrscht, die den Fortschritt zwar verzögern konnte, aber nicht im Stande war, ihn dauerhaft aufzuhalten.
Im Jahr 1879 publizierte Gottlob Frege sein wichtigstes Werk, die Begriffsschrift. In der Rückschau markiert das knapp hundertseitige Buch
28
v
8 No 26 Jul
1 Historische Notizen
Friedrich Ludwig Gottlob Frege
wurde am 8. November 1848 im
mecklenburgischen Wismar geboren. 1869 schrieb er sich an der
Universität Jena ein, wo er in Ernst Abbe, dem Direktor der
Carl-Zeiss-Werke, einen einflussreichen Lehrer und lebenslangen Unterstützer fand. Wahrscheinlich war es ein Vorschlag Abbes, der Frege bewog, nach vier Semestern an die
renommierte mathematische Fakultät der Universität Göttingen zu wechseln. Dort promovierte er im Jahr 1873 auf dem
Gebiet der Geometrie. Zurück in Jena reichte er 1874 seine
Habilitationsschrift ein. Nach einigen Jahren der Privatdozentur wurde er 1879 zum Extraordinarius und 1896 schließlich zum ordentlichen Professor berufen.
Frege zählt zu den Begründern der mathematischen Logik
und der analytischen Philosophie. Im Jahr 1879 schuf er mit
mit seiner berühmten Begriffsschrift einen axiomatischen
Zugang zur Logik [57], der weit über die bereits bekannte
1848 1925
Aussagenlogik von George Boole hinausging. Mit den eingeführten Begriffen und Konzepten schuf er die Grundlage
der modernen Prädikatenlogik.
Die meiste Zeit seines Lebens vertrat Frege die Auffassung,
dass die Mathematik ein Teil der Logik sei, und war damit
ein überzeugter Verfechter des Logizismus. Nach Frege müssen sich alle Wahrheiten auf eine Menge von Axiomen zurückführen lassen, die nach seinen Worten „eines Beweises
weder fähig noch bedürftig“ seien. Er stand damit in einer
Gegenposition zu anderen Mathematikern seiner Zeit, von
denen viele die Logik als isoliertes Teilgebiet der Mathematik begriffen.
Frege zog sich nach der niederschmetternden Entdeckung
der Russell’schen Antinomie weitgehend aus der Wissenschaft zurück und sollte keine bedeutenden Arbeiten mehr
publizieren. Die Trümmer seines logizistischen Programms
vor Augen, starb Frege als verbitterter Mann am 26. Juli
1925 im Alter von 76 Jahren.
einen Meilenstein in der Geschichte der mathematischen Logik und gehört zu den wichtigsten Einzelpublikation in diesem Bereich. In seinem
Werk schuf Frege das, was wir heute als symbolische Logik bezeichnen.
Ihm gelang es, eine künstliche Sprache zu ersinnen, die ausdrucksstark
genug ist, um die gesamte gewöhnliche Mathematik zusammen mit ihrem logischen Schlussapparat zu formalisieren. Dennoch wurde die Bedeutung, die Freges Werk für die Mathematik haben sollte, zur Zeit der
Drucklegung gemeinhin verkannt. Mehrheitlich trat man seiner Arbeit
mit Gleichgültigkeit entgegen oder stand seinen Ideen gar abweisend
gegenüber. Auch Cantor hielt die Begriffsschrift für weitgehend bedeutungslos.
Aber was war es genau, das Freges Arbeit so besonders machte? Schon
ein paar Jahre zuvor hatte George Boole mit der Aussagenlogik das
Grundgerüst erschaffen, um logische Relationen zwischen Elementaraussagen mithilfe symbolischer Operatoren auszudrücken [10, 11]. Freges Ansatz ging jedoch weit über die boolesche Logik hinaus. Er erkannte, dass sich die logischen Direktiven nicht nur dazu verwenden
ließen, um die Zusammenhänge zwischen elementaren Aussagen zu beschreiben; sie entpuppten sich als stark genug, um die Struktur der Elementaraussagen selbst zu formalisieren. Damit hob Frege eine wichtige
Einschränkung der booleschen Logik auf, die streng zwischen der Ebene der Elementaraussagen (Boolesche Variablen, primary propositions)
und der Ebene der logischen Relationen (Aussagenlogische Ausdrücke,
secondary propositions) unterschied.
29
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
I Negation („nicht A“)
In der Frege’schen Logik wird beispielsweise die Aussage
A
„Alle Menschen sind sterblich“
I Implikation („Aus B folgt A“)
in der folgenden Implikationsform dargestellt:
A
„Für alle x gilt: Wenn x ein Mensch ist, dann ist x sterblich.“
In ähnlicher Weise lässt sich die Aussage
B
A
B
auf die Und-Verknüpfung (Konjunktion) zurückführen:
B∧A
I Disjunktion („B oder A“)
„Für ein x gilt: x ist ein Mensch und x ist reich.“
A
Die von Frege eingeführte Darstellungsform ist die Grundlage der modernen Prädikatenlogik. Legen wir die heute gebräuchliche Schreibweise zugrunde, so lassen sich die oben formulierten Aussagen in der Form
B
x
(1.16)
(1.17)
A
∀x A
I Existenzquantifikation („Für ein x ...“)
x
(1.18)
(1.19)
B∨A
I Allquantifikation („Für alle x ...“)
oder kürzer als
∀ x (M(x) → S(x))
∃ x (M(x) ∧ R(x))
B→A
I Konjunktion („B und A“)
„Manche Menschen sind reich“
∀ x (Mensch(x) → Sterblich(x))
∃ x (Mensch(x) ∧ Reich(x))
¬A
A
∃x A
Abbildung 1.26: Die Notation in Freges
Begriffsschrift und die Schreibweise der
modernen Prädikatenlogik im Vergleich
ausdrücken.
Der Allquantor ‚∃‘ und der Existenzquantor ‚∀‘ werden verwendet, um
quantitative Aussagen über die Elemente der Grundmenge (hier die
Menge aller Menschen) zu machen. Gelesen wird ∀ x als „Für alle x
gilt ...“ und ∃ x als „Es existiert ein x, für das gilt: ...“. Die Zeichen ‚→‘
und ‚∧‘ sind die heute üblichen Symbole für die logische Wenn-DannBeziehung (Implikation) und die Und-Verknüpfung (Konjunktion).
Obwohl sich der konzeptionelle Kern der Begriffsschrift kaum von jenem der modernen Prädikatenlogik unterscheidet, könnten ihre Erscheinungsformen kaum unterschiedlicher sein. Verantwortlich hierfür ist die
komplizierte zweidimensionale Notation, in der Frege seine Formeln
niederschrieb (Abbildung 1.26). Die Art der Darstellung hat nicht nur
die Zunft der Buchdrucker vor neue Herausforderungen gestellt; sie ist
ebenso dafür verantwortlich, dass wir Freges Buch heute nur nach einer
gründlichen Einarbeitung lesen können. Um einen plastischeren Eindruck von der Notation zu erhalten, zeigt Abbildung 1.27, wie sich die
Formeln (1.18) und (1.19) in Freges Notation ausdrücken lassen.
I „Alle Menschen sind sterblich“
x
S(x)
∀ x (M(x) → S(x))
M(x)
I „Manche Menschen sind reich“
x
R(x)
∃ x (M(x) ∧ R(x))
M(x)
Abbildung 1.27: Zusammengesetzte Ausdrücke in Freges Notation
30
1 Historische Notizen
Mit der Begriffsschrift war es Frege gelungen, das logische Denken auf
eine symbolische Ebene zu heben. Doch seine eigentlichen Ambitionen
gingen deutlich weiter. Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, zu
denen auch Cantor und Boole gehörten, sah er die Logik nicht als Teil
der Mathematik, sondern umgekehrt die Mathematik als Teil der Logik
an. Mit Vehemenz verfolgte er das Ziel, sämtliche mathematischen Begriffe und Konzepte auf elementare Begriffe der Logik zurückzuführen
und auf diese Weise die gesamte Mathematik mit einem soliden Unterbau zu versehen. Mit seinem ambitionierten Projekt begründete Frege
eine neue philosophische Denkrichtung, die wir heute als Logizismus
bezeichnen.
Einen wichtigen Teilerfolg erzielte Frege im Jahr 1884 mit der Publikation der Grundlagen der Arithmetik [56]. In diesem Werk unternahm er
den Versuch, den Zahlenbegriff formal zu definieren, und erläuterte den
Plan für die Durchführung seines logizistischen Programms. Anders als
die Begriffsschrift war sein neues Werk eine rein umgangssprachliche
Abhandlung.
Frege hatte sein Ziel klar vor Augen und sollte die nächsten zwanzig
Jahre seines Lebens fast vollständig der Formalisierung seiner Ideen
widmen. Die Früchte seiner Arbeit waren die Grundgesetze der Arithmetik, ein zweibändiges Buch, das wir neben der Begriffsschrift als das
zweite Hauptwerk Freges ansehen dürfen (Abbildung 1.28) [53, 54].
Um die Arithmetik logisch zu begründen, stellte Frege einen Zusammenhang zwischen dem Begriff der Zahl und dem Begriff der Menge her. Betrachten wir beispielsweise die Menge aller Wochentage, die
Menge aller Weltwunder oder die Menge aller Siegel eines unverständlichen Buchs, so zählen wir in jedem Fall 7 Elemente. Wüssten wir
noch nichts über die Zahl 7, so könnten wir zumindest feststellen, dass
alle genannten Mengen gleich viele Elemente enthalten. Die Erkenntnis, dass wir über die Gleichmächtigkeit von Mengen sprechen können,
ohne die konkrete Anzahl ihrer Elemente zu benennen, ermöglicht es,
den Zahlenbegriff auf eine Mengeneigenschaft zurückzuführen. Frege
tat genau dies. Im Sinne seiner Logik wird die Zahl 7 mit der Menge aller Mengen identifiziert, die sich bijektiv auf eine der genannten
Beispielmengen abbilden lassen.
Genau wie Cantor war auch Frege von der Korrektheit seiner Arbeit
überzeugt. Noch waren die Wolken außer Sichtweite, die sich hinter
dem Horizont zusammenzogen und den strahlend blauen Himmel der
neu geschaffenen Mathematik schon bald verdunkeln sollten.
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
31
Abbildung 1.28: Auszug aus dem 1. Band der Grundgesetze der Arithmetik. Gottlob Frege schrieb das zweibändige Werk als
Teil seines logizistischen Programms. Es war der erste umfassende Versuch, die Mathematik auf die Logik zurückzuführen.
1.2.4
Aufbruch in ein neues Jahrhundert
In der Nacht zum 1.1.1900 begrüßten die Menschen das neue Jahrhundert voller Euphorie. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse des neunzehnten Jahrhunderts hatten die Allmachtsphantasie der Menschen befeuert, und auch die Mathematik wähnte sich dank der errungenen Erfolge auf dem richtigen Pfad. Vor diesem Hintergrund verwundert es
nicht, dass die Eröffnungsrede des 2. internationalen Kongresses der
Mathematiker in Paris nicht, wie üblich, aus einem Rückblick auf das
Gewesene, sondern einem Ausblick auf das kommende Jahrhundert bestand. Die Rede begann mit den folgenden Worten:
„Wer von uns würde nicht gern den Schleier lüften, unter
dem die Zukunft verborgen liegt, um einen Blick zu werfen
auf die bevorstehenden Fortschritte unserer Wissenschaft
32
1 Historische Notizen
n 14 Feb
David Hilbert wurde am 23.1.1862
in Königsberg als ältestes Kind einer ostpreußischen Juristenfamilie
geboren. Die in seiner Heimatstadt
ansässige Albertus-Universität (Albertina) bot ihm optimale
Voraussetzungen, um seine Talente zu entwickeln. Das Studium der Mathematik beendete er 1884 mit der Promotion,
1886 folgte die Habilitation. Nach einigen Jahren der Privatdozentur wurde er 1892 von der Albertina zum Professor
berufen.
1895 folgte Hilbert einem Ruf an die mathematische Fakultät der Universität Göttingen. Es waren Größen wie Gauß,
Dirichlet und Riemann, die der Göttinger Mathematik einst
zu großem Ruhm verhalfen. Gegen Ende des neunzehnten
Jahrhunderts drohte dieser aufgrund mangelnder Nachfolger
allmählich zu verblassen. Die Berufung Hilberts war Teil
eines Neuanfangs, der die Göttinger Mathematik zu neuer
Blüte führen sollte.
23 Ja
1862 1943
Hilbert war nicht nur ein außerordentlich begabter, sondern
auch ein ungewöhnlich vielseitiger Mathematiker. Im Laufe seiner akademischen Karriere hat er seinen Forschungsschwerpunkt mehrfach gewechselt und nicht nur im Bereich
der mathematischen Logik, sondern auch in der Geometrie,
der Zahlentheorie, der Analysis und der theoretischen Physik seine Spuren hinterlassen.
Wie kein anderer beeinflusste Hilbert die Mathematik des
beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts. Im Jahr 1900 hielt
er auf dem internationalen Kongress der Mathematiker in
Paris seine berühmte Jahrhundertrede, in der er 23 ungelöste
Probleme vortrug, die Mathematiker für Jahrzehnte beschäftigen sollten. Noch heute sind einige Probleme offen.
Hilbert starb am 14.2.1943 im Alter von 81 Jahren. Ein unauffälliger Grabstein auf dem Göttinger Stadtfriedhof erinnert leise und bescheiden an einen der größten Visionäre seiner Zeit. In Stein gemeißelt trägt er seine berühmten Worte:
„Wir müssen wissen. Wir werden wissen.“
und in die Geheimnisse ihrer Entwicklung während der
künftigen Jahrhunderte! Welche besonderen Ziele werden
es sein, denen die führenden mathematischen Geister der
kommenden Geschlechter nachstreben? Welche neuen Methoden und neuen Tatsachen werden die neuen Jahrhunderte entdecken – auf dem weiten und reichen Felde mathematischen Denkens?“ [84]
Der Redner auf dem Podium war der erst 38 jährige David Hilbert (Abbildung 1.29). Trotz seines ungewöhnlichen Alters war der junge Mathematiker kein Unbekannter. Durch zahlreiche Erfolge auf verschiedenen Gebieten der Mathematik stieg er früh in den Olymp der bedeutendsten Mathematiker auf.
David Hilbert (1862 – 1943)
Abbildung 1.29: Der deutsche Mathematiker David Hilbert zählt zu den berühmtesten
und einflussreichsten Mathematikern der
vorigen Jahrhundertwende. Im Jahr 1900
hielt er auf dem internationalen Kongress
der Mathematiker in Paris eine wegweisende Rede, an der sich die weitere Stoßrichtung der gesamten Mathematik über Jahrzehnte hinweg orientieren sollte.
In Hilbert fand die axiomatische Methode einen genauso berühmten wie
prominenten Fürsprecher, und es ist eines seiner Verdienste, dass sie
Ende des neunzehnten Jahrhunderts in den Mittelpunkt des Interesses
rückte. Für ihn war sie die einzige adäquate Antwort auf die jahrzehntelang geführte Diskussion über das Wesen der mathematischen Grundelemente.
Anders als Frege hielt Hilbert nichts von dem Versuch, die natürlichen
Zahlen durch die Rückführung auf andere Begriffe zu erklären; die verwendeten Begriffe waren für ihn kaum einsichtiger als der Begriff der
natürlichen Zahlen selbst. Ebensowenig teilte er die Ansicht des prominenten Zahlentheoretikers Leopold Kronecker, die „natürlichen Zahlen
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
habe der liebe Gott geschaffen“ [187], so dass sich jede Definition derselben als genauso überflüssig wie sinnlos erweisen müsse.
Hilberts Weg aus dem Dilemma war ein formalistischer. Anstatt die
mathematischen Grundelemente ihrem Wesen nach zu erklären, beschränkte er sich auf die Benennung der logischen Beziehungen, die
zwischen den betrachteten Objekten bestehen. Mit seiner Vorgehensweise konnte er im Jahr 1899 mit der Neuformulierung der euklidischen
Geometrie einen durchschlagenden Erfolg erzielen. Aus insgesamt 20
Axiomen, eingeteilt in 5 Axiomengruppen, lassen sich alle Sätze der
euklidischen Geometrie ableiten, ohne die verwendeten Symbole mit
einer speziellen Interpretation zu versehen [80]. Mit dieser Arbeit wies
Hilbert den Weg, auf dem ihn viele Mathematiker über Jahre hinweg begleiten sollten. In der Folgezeit wurden weite Bereiche der Mathematik
in der gleichen Art und Weise axiomatisiert und damit einer präzisen
Betrachtung zugänglich gemacht. In diesem modernen Sinn wird die
Mathematik zu einem symbolischen Spiel, in dem die Regeln und nicht
die Bedeutungen der Figuren die Partie bestimmen. Hilberts formalistische Methode bringt das Maß an Ehrlichkeit und Klarheit mit sich,
nach dem Mathematiker von jeher streben: Sie ist frei von Interpretationsspielräumen jeglicher Art.
In seiner Pariser Eröffnungsrede adressierte Hilbert 23 Probleme, die
für die Mathematik von immenser Wichtigkeit, aber bis dato eben ungelöst waren. Nur die ersten 10 Probleme wurden vorgetragen, die letzten
13 sind nur in der schriftlichen Ausarbeitung der Rede enthalten.
Hilbert war sich bewusst, welche wegweisende Rolle der Unendlichkeitsbegriff für die Zukunft der Mathematik haben würde, und so avancierte die Klärung der Kontinuumshypothese an die erste Stelle.
„[...]. Die Untersuchungen von Cantor über solche Punktmengen machen einen Satz sehr wahrscheinlich, dessen
Beweis jedoch trotz eifrigster Bemühungen bisher noch
niemanden gelungen ist; dieser Satz lautet: Jedes System
von unendlich vielen reellen Zahlen, d. h. jede unendliche
Zahlen- (oder Punkt)menge ist entweder der Menge der
ganzen natürlichen Zahlen 1, 2, 3, ... oder der Menge sämtlicher reellen Zahlen und mithin dem Kontinuum, d. h. etwa
den Punkten einer Strecke äquivalent; im Sinne der Äquivalenz gibt es hiernach nur zwei Zahlenmengen, die abzählbare Menge und das Kontinuum.“ [84]
An zweiter Stelle forderte Hilbert dazu auf, einen Beweis für die Widerspruchsfreiheit der arithmetischen Axiome zu liefern.
33
34
1 Historische Notizen
„[...]. Vor allem aber möchte ich unter den zahlreichen
Fragen, welche hinsichtlich der Axiome gestellt werden
können, dies als das wichtigste Problem bezeichnen, zu
beweisen, dass dieselben untereinander widerspruchslos
sind, d.h., dass man aufgrund derselben mittelst einer endlichen Anzahl von logischen Schlüssen niemals zu Resultaten gelangen kann, die miteinander in Widerspruch stehen.“ [84]
Konkret handelt es sich um eine Reihe von Axiomen, die nach dem italienische Mathematiker Giuseppe Peano benannt sind. Wenn wir heute
von den Peano-Axiomen reden, so sind die fünf Axiome 1, 6, 7, 8 und
9 aus Abbildung 1.30 gemeint. Sie drücken jene fünf Eigenschaften
aus, über die sich die Ordnungsstruktur der natürlichen Zahlen eindeutig charakterisieren lässt.3 Ihren Ursprung haben die Axiome in der berühmten Abhandlung Was sind und was sollen die Zahlen von Richard
Dedekind aus dem Jahr 1888 [45]. Dort waren sie noch umgangssprachlich formuliert und wurden von Peano ein Jahr später in eine symbolische Formelsprache gebracht [131] (aus dem lateinischen übersetzt
in [72]). In Abschnitt 3.1 werden wir die Axiome in einer leicht modernisierten Form wieder aufgreifen und in die moderne Prädikatenlogik
übersetzen.
Der von Hilbert eingeforderte Widerspruchsfreiheitsbeweis für die
arithmetischen Axiome ist von tragender Bedeutung für die gesamte
Mathematik, da nahezu alle ihre Teilbereiche auf der Theorie der Zahlen aufbauen. Solange die Widerspruchsfreiheit nicht garantiert werden
kann, besteht die Möglichkeit, dass sich sowohl die Gleichung 1 + 1 = 2
als auch die Gleichung 1 + 1 = 2 aus den Axiomen ableiten lässt. Die
Auswirkungen wären von fatalem Ausmaß für alle Bereiche der Mathematik.
Hilbert war fest davon überzeugt, dass sich die Widerspruchsfreiheit
axiomatischer Systeme beweisen lässt, und seine Anfangserfolge schienen ihm Recht zu geben. Im Rahmen seiner Neuformulierung der Geometrie konstruierte er einen speziellen Zahlenbereich derart, dass jede
beweisbare Beziehung zwischen den geometrischen Objekten einer beweisbaren Beziehung zwischen den Elementen dieses Zahlenbereichs
entspricht und umgekehrt. Folgerichtig würde jeder Widerspruch, der
sich aus den geometrischen Axiomen ergibt, als Widerspruch in der
3 Dass Peano die natürlichen Zahlen mit der 1 beginnen ließ und nicht, wie heute üblich
mit der 0, spielt nur eine untergeordnete Rolle, schließlich haben wir in Abschnitt 1.2.2
gezeigt, dass sich die Mengen {0, 1, 2, . . .} und {1, 2, 3, . . .} bijektiv aufeinander abbilden
lassen.
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
35
Giuseppe Peano (1858 – 1932)
Abbildung 1.30: Auszug aus der übersetzten Originalarbeit von 1889, in der
Giuseppe Peano die erste formale Axiomatisierung der natürlichen Zahlen publizierte. Das nach links geöffnete C verwendete Peano für die logische Implikation.
Später wurde es als ⊃ geschrieben und
entspricht dem heute gebräuchlichen Implikationsoperator →.
Arithmetik sichtbar werden. Mit anderen Worten: Vertrauen wir der
Arithmetik, so folgt daraus die Widerspruchsfreiheit der geometrischen
Axiome.
Was Hilbert vollbrachte, war ein relativer Widerspruchsbeweis. Er hatte die Widerspruchsfreiheit der Geometrie erfolgreich auf die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik reduziert. Für die Arithmetik selbst forderte Hilbert dagegen einen absoluten Beweis, der ohne die Annahme
der Widerspruchsfreiheit eines anderen Systems auskommt. Ganz im
Sinne des Henne-Ei-Problems würde jeder relative Beweis die Frage
nach der Widerspruchsfreiheit lediglich auf ein anderes Axiomensystem verschieben. Im Augenblick seiner Rede stand für Hilbert außer
Zweifel, dass ein absoluter Widerspruchsfreiheitsbeweis für die Arithmetik existiert. Noch war es für ihn lediglich eine Frage der Zeit, bis er
gefunden werden würde.
An zehnter Stelle forderte Hilbert dazu auf, ein Lösungsverfahren für
diophantische Gleichungen zu erarbeiten (Abbildung 1.31).
36
1 Historische Notizen
x2 + y2 z2 = 0
„Eine diophantische Gleichung mit irgend welchen Unbekannten und mit ganzen rationalen Zahlenkoeffizienten sei
vorgelegt: man soll ein Verfahren angeben, nach welchem
sich mittelst einer endlichen Anzahl von Operationen entscheiden lässt, ob die Gleichung in ganzen rationalen Zahlen lösbar ist.“ [84]
Wie in Abschnitt 1.2.1 dargelegt, hat eine diophantische Gleichung die
Form
p(x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
Unlösbar
Lösbar
Abbildung 1.31: An zehnter Stelle seiner
Jahrhundertrede forderte Hilbert dazu auf,
ein allgemeines Lösungsverfahren für diophantische Gleichungen zu erarbeiten.
wobei p ein multivariables Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten ist.
Die Lösung einer diophantischen Gleichung ist die Menge der ganzzahligen Nullstellen von p. Was Hilbert damals als Verfahren bezeichnete,
würden wir heute Algorithmus nennen. Zum Zeitpunkt seiner Rede war
der Computer noch in weiter Ferne, und es herrschte nur eine vage Vorstellung davon, was unter einem Verfahren im Hilbert’schen Sinne genau zu verstehen sei. In der Tat sollten noch mehr als 30 Jahre vergehen,
bis der Berechenbarkeitsbegriff durch Alan Turing und Alonzo Church
in eine mathematisch präzise Form gebracht werden konnte. In Kapitel 5 werden wir im Detail auf die Berechenbarkeitstheorie zu sprechen
kommen und zeigen, warum jeder Versuch, das von Hilbert eingeforderte Verfahren zu konstruieren, von Grund auf zum Scheitern verurteilt
ist.
1.2.5
Grundlagenkrise
Das neue Jahrhundert war noch jung, als Gottlob Frege im Juni 1902
einen Brief des britischen Mathematikers und Philosophen Bertrand
Russell erhielt (Abbildung 1.32). Was Frege las, sollte nicht nur seine
eigene Arbeit im Mark erschüttern, sondern die gesamte Mathematik
in die größte Krise ihrer mehrere tausend Jahre alten Geschichte stürzen. Frege erreichte der Brief just zu der Zeit, als er den zweiten Band
der Grundgesetze der Arithmetik fertigstellte. Viele Jahre seines Lebens hatte er auf diese Arbeit verwendet und sah sie auf einen Schlag in
Trümmern liegen. Für größere Änderungen war es ohnehin zu spät, und
so schließt der zweite Band mit dem folgenden Nachwort [52, 55]:
„Einem wissenschaftlichen Schriftsteller kann kaum etwas
Unerwünschteres begegnen, als dass ihm nach Vollendung
einer Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert
wird. In diese Lage wurde ich durch einen Brief des Herrn
37
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
ai 2 Feb
Bertrand Arthur William Russell
war der Enkel des zweimaligen
britischen Premierministers Lord
John Russell und wurde am 18.
Mai 1872 als drittes Kind einer liberalen Aristokratenfamilie
geboren. Als er 2 Jahre alt war, fielen Mutter und Schwester
der Diphtherie zum Opfer. Als er 1876 auch noch seinen Vater verlor, erstritten seine Großeltern das Sorgerecht. Zwei
Jahre später verstarb sein Großvater, und seine Großmutter
übernahm allein die Erziehung. Schon in frühen Jahren wurde Russells einzigartige Begabung für Mathematik und Philosophie sichtbar. Zunächst wurde er privat und später am
renommierten Trinity College in Cambridge unterrichtet.
In den Jahren 1890 bis 1894 widmete er sich dem Studium
der Mathematik und lernte in dieser Zeit seinen Lehrer und
späteren Freund Alfred North Whitehead kennen. Nach seinem Studium nutzte er bis 1901 die ihm gebotene Möglich-
18 M
1872 1970
keit, in Cambridge ohne Lehrverpflichtungen zu forschen,
und wurde 1908 in die Royal Society aufgenommen.
Eine einschneidende Veränderung erfuhr sein Leben durch
den ersten Weltkrieg. Im Jahr 1916 wurde er aufgrund wiederholter pazifistischer Aktivitäten zu einer Geldstrafe verurteilt und seiner Anstellung am Trinity College enthoben [70]. Zwei Jahre später wurde ihm erneut der Prozess
gemacht und eine zweijährige Gefängnisstrafe auferlegt.
In der Folgezeit verfasste er eine Vielzahl bedeutender Werke über philosophische und gesellschaftliche Themen und
wurde im Jahr 1950 mit dem Literaturnobelpreis geehrt.
Durch seine literarische Arbeit gelangte er zu Weltruhm,
und etliche Menschen verbinden seinen Namen heute ausschließlich mit seinem philosophischen Werk. Viele wissen
nicht, dass sich hinter dem berühmten Philosophen Bertrand
Russell zugleich einer der größten Mathematiker des zwanzigsten Jahrhunderts verbirgt.
Bertrand Russell versetzt, als der Druck dieses Bandes sich
seinem Ende näherte.“
Was konnte Freges Arbeit so grundlegend erschüttern, dass er sein gesamtes Lebenswerk gefährdet sah? Die Antwort ist in der Proposition V, seinem fünften Grundgesetz, verborgen. Aus diesem Gesetz lässt
sich das allgemeine Komprehensionsaxiom ableiten, das in moderner
Schreibweise so lautet:
∃ y ∀ x ((x ∈ y) ↔ ϕ(x))
Hierin ist ϕ eine frei wählbare Formel, in der die Variable y nicht vorkommt. In Worten liest sich das allgemeine Komprehensionsaxiom wie
folgt: Es existiert eine Menge y, die genau diejenigen Elemente x enthält, auf die die Eigenschaft ϕ zutrifft. Beschreibt ϕ beispielsweise die
Eigenschaft, eine Primzahl zu sein, so sichert uns das Komprehensionsaxiom zu, von der Menge aller Primzahlen reden zu dürfen. Das Axiom
wird häufig auch als Separationsaxiom bezeichnet, da die Bedingung
ϕ diejenigen Elemente, die in y enthalten sind, von jenen separiert, die
nicht in y enthalten sind.
Es ist ein entscheidendes Merkmal der Frege’schen Logik, dass die Formel ϕ keinerlei Einschränkungen unterliegt. Russell erkannte die Gefahr dieser Freiheit und traf die folgende Wahl:
ϕ(x) := (x ∈ x)
Bertrand Russell
(1872 – 1970)
Abbildung 1.32: Dem britischen Mathematiker und Philosophen Bertrand Russell
gelang es, die Logik der naiven Mengenlehre als widersprüchlich zu entlarven. Seine
Entdeckung stürzte die Mathematik in die
größte Krise ihrer mehrere tausend Jahre alten Geschichte.
38
1 Historische Notizen
BARBIER -PARADOXON
„You can define the barber as ’one who
shaves all those, and those only, who do
not shave themselves’. The question is,
does the barber shave himself?“ [157]
Fall 1: Der Barbier
rasiert sich selbst.
Hieraus folgt...
Die Formel beschreibt eine harmlos erscheinende Eigenschaft: Sie trifft
auf alle Mengen x zu, die sich nicht selbst als Element enthalten. ϕ ist
für die meisten Mengen wahr. So ist die Menge aller Menschen selbst
kein Mensch und auch die Menge aller Primzahlen selbst keine Primzahl. Dagegen ist ϕ für die Menge aller Mengen falsch. Da sie selbst
eine Menge ist, enthält sie sich auch selbst als Element.
Mit der getätigten Wahl von ϕ garantiert uns das Komprehensionsaxiom
die Existenz einer Menge y mit der folgenden Eigenschaft:
∀ x ((x ∈ y) ↔ (x ∈ x))
In Worten: Die Menge y ist die Menge aller Mengen, die sich nicht
selbst als Element enthalten. Jetzt können wir über die sogenannte Instanziierungsregel den Allquantor eliminieren, indem wir x durch ein
beliebiges Element ersetzen. Wählen wir für x die besagte Menge y, so
erhalten wir den Widerspruch, dass sich die Menge y genau dann selbst
enthält, wenn sie sich nicht selbst enthält:
(y ∈ y) ↔ (y ∈ y)
Fall 2: Der Barbier
rasiert sich nicht selbst.
Hieraus folgt...
X
Abbildung 1.33: Der besagte Barbier rasiert genau diejenigen Männer, die sich
nicht selbst rasieren. Die Frage, ob sich der
Barbier selbst rasiert oder nicht, führt zu
demselben Zirkelschluss, der auch der Russell’schen Antinomie zugrunde liegt.
Sowohl in der Frege’schen Logik als auch in der Cantor’schen Mengenlehre ist das allgemeine Komprehensionsaxiom eine tragende Säule. Durch ihr Wegbrechen stand die neue Mathematik mit einem Schlag
auf wackligen Füßen.
Die Russell’sche Antinomie macht deutlich, dass sowohl Frege als auch
Cantor im Umgang mit dem aktual Unendlichen zu unvorsichtig waren.
So harmlos das allgemeine Komprehensionsaxiom auch wirken mag –
es lässt uns Mengen konstruieren, die wir nicht als abgeschlossenes
Ganzes ansehen dürfen. Betrachten wir die Menge aller Mengen, die
sich nicht selbst als Element enthalten, tatsächlich als aktual existent,
so sind die entstehenden Widersprüche unausweichlich.
Heute wird der Zirkelschluss der Russell’sche Antinomie gern am Beispiel des Barbier-Paradoxons erklärt (Abbildung 1.33). Russell selbst
griff auf dieses Paradoxon zurück, um seine Antinomie mit Begriffen
des Alltags einem größeren Leserkreis nahe zu bringen.
Der hohe Bekanntheitsgrad der Russell’schen Antinomie täuscht häufig
darüber hinweg, dass der Mengenbegriff schon vorher für Ungereimtheiten gesorgt hatte. So bemerkte Cantor im Jahr 1897, dass die Menge aller Kardinalzahlen ihre eigene Kardinalzahl nicht umfassen kann.
Zwei Jahre später stieß er auf das Burali-Forti-Paradoxon, auf das wir
in Abschnitt 3.2.2 zurückkommen werden. Benannt ist es nach dem italienischen Mathematiker Cesare Burali-Forti, der schon 1897 entdeckt
39
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
hatte, dass die Definition der Menge aller Ordinalzahlen zu Widersprüchen führt.
Cantor hat die Entdeckung der Antinomien niemals publiziert, und wir
wissen von seinen Erkenntnissen ausschließlich aus Briefwechseln mit
Hilbert und Dedekind. Auch sie hielten die Antinomien wohl eher für
Kuriositäten, die aus dem unzulässigen, weil informellen Gebrauch verschiedener Begriffe herrührten.
Die Russell’sche Antinomie war anders. Zum einen war sie so elementar, dass alle Bereiche der Mathematik betroffen waren, die in irgendeiner Form auf den Begriff der Menge zurückgriffen. Zum anderen hatte
Russell nicht nur gezeigt, dass die Menge aller Mengen, die sich nicht
selbst enthalten, zu Widersprüchen führt, sondern auch, dass diese Menge innerhalb der Logik formal konstruiert werden kann. Anders als die
Antinomien der Ordinal- oder Kardinalzahltheorien, die als kuriose Begleiterscheinungen am Rande eines ansonsten intakten mathematischen Kerns gewertet wurden, ließ sich die Russell’sche Antinomie nicht
ignorieren. Was Russell entdeckte, war eine tektonische Verwerfung riesigen Ausmaßes, mitten im Herzen der Mathematik.
Frege empfand die Entdeckung der Antinomie als schweren Schlag, der
sein Lebenswerk wie eine Seifenblase zerplatzen ließ. Als zwei Jahre
später seine Frau Margarete verstarb, verfiel er in eine tiefe Depression,
von der er sich zeitlebens nicht mehr erholen sollte.
Bertrand Russell teilte den Frege’schen Pessimismus nicht. Er erkannte, dass die entdeckten Antinomien durch die Konstruktion von Mengen
entstehen, die „zu groß“ sind, um als abgeschlossenes Ganzes einen
Sinn zu ergeben. Nach Russells Ansicht musste es durch die geschickte Abwandlung der zugrunde gelegten Axiome möglich sein, genügend
Kontrolle über den Mengenbegriff zu erlangen, um die Mathematik von
ihren Widersprüchen zu befreien. Zusammen mit dem britischen Mathematiker Alfred North Whitehead (Abbildung 1.34) versuchte er, Freges
Traum doch noch zu verwirklichen. Es war der zweite Anlauf, ein widerspruchsfreies Fundament zu errichten, auf dem die Mathematik für
alle Zeiten einen sicheren Halt finden sollte.
Alfred North Whitehead
(1861 – 1947)
Nach zehn Jahren intensiver Arbeit war das Ergebnis greifbar: Die Principia Mathematica, erschienen in den Jahren 1910 bis 1913, waren fertiggestellt (Abbildung 1.35). Russell und Whitehead schufen ein monumentales Werk, das in Umfang und Tiefe weit über die Frege’sche
Arbeit hinausgeht. Auf über 1800 Seiten, verteilt auf 3 Bände, unternahmen die Autoren den Versuch, alle mathematischen Erkenntnisse
aus einer kleinen Menge von Axiomen systematisch herzuleiten. Auch
Abbildung 1.34: Der britische Mathematiker Alfred North Whitehead war der
zweite Autor der Principia Mathematica.
Genau wie sein Schüler und langjähriger Freund Bertrand Russell verabschiedete sich Whitehead in späteren Jahren von
der reinen Mathematik und wandte sich verstärkt philosophischen Themen zu.
40
Abbildung 1.35: Principia Mathematica.
Dieses monumentale Werk von Russell
und Whitehead ist für uns nicht leicht zu
lesen, da sich die Notation von der heute gebräuchlichen unterscheidet und in einigen Aspekten unglücklich gewählt wurde. So besitzt der Punkt in der Principia
eine Doppelbedeutung. In Abhängigkeit
von seiner Position wird er für die konjunktive Verknüpfung oder zum Klammern von Teilausdrücken verwendet. Die
Abbildung zeigt drei Formeln aus der Originalausgabe der Principia Mathematica
sowie deren Übersetzung in die heute übliche Schreibweise.
1 Historische Notizen
I
Drei Formeln der Principia . . .
I
und deren moderne Schreibweise
(2.03)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(p → ¬q) → (q → ¬p)
(¬p → q) → (¬q → p)
(p → q) → (¬q → ¬p)
(¬q → ¬p) → (p → q)
heute noch zählen die Principia Mathematica zu den berühmtesten mathematischen Werken unserer Geschichte.
An Russells und Whiteheads monumentalem Werk werden sowohl die
Vor- als auch die Nachteile einer vollständig formalisierten Mathematik
sichtbar. Zum einen machen die Principia deutlich, dass sich nahezu alle Bereiche der gewöhnlichen Mathematik mit einer Präzision erfassen
lassen, die in keiner anderen Wissenschaft vorhanden ist. Alle Beweise sind bis ins Detail ausgearbeitet und werden durch die Anwendung
fest definierter Schlussregeln aus den Axiomen hergeleitet. Auf der anderen Seite fordert die erreichte Präzision ihren Tribut in einer gewaltig anwachsenden Komplexität. In Abbildung 1.36 ist die vielleicht berühmteste Passage der Principia zu sehen. Sie zeigt den Abschluss des
formalen Beweises für die arithmetische Beziehung 1 + 1 = 2.
Vor dem historischen Hintergrund wird deutlich, warum ein großer Teil
der Principia der Typentheorie gewidmet ist. Hierbei handelt es sich um
eine spezielle Form der Mengenlehre, in der sich die Widersprüche der
Frege’schen Logik nicht reproduzieren lassen. Um die Antinomien zu
umgehen, verfolgte Russell den Ansatz, Mengen hierarchisch zu ordnen. Auf der untersten Stufe befinden sich die Typ-1-Mengen, die lediglich Objekte des Individuenbereichs umfassen. Auf der nächsten Stufe befinden sich die Typ-2-Mengen, die ausschließlich Typ-1-Mengen
als Elemente enthalten. Dann folgen die Typ-3-Mengen, die aus Typ2-Mengen bestehen, und so fort. Da eine Typ-n-Menge niemals selbst
ein Element vom Typ n besitzen darf, kann sich eine Menge in der Typentheorie der Principia niemals selbst enthalten. Durch die Einführung
dieser Mengenhierarchie war es Russell und Whitehead gelungen, jene
1.2 Der Weg zur modernen Mathematik
Abbildung 1.36: Formaler Beweis der arithmetischen Beziehung 1 + 1 = 2 im System der Principia Mathematica
Art von Selbstbezug zu vermeiden, die wenige Jahre zuvor die Mathematik in ihre tiefste Krise stürzte.
Dennoch hat die Typentheorie die Zeit nicht überdauert, was im Wesentlichen an zwei Gründen liegt. Zum einen schränkt sie den Begriff
der Menge so stark ein, dass sich etliche als harmlos geltende Mengen
nicht mehr bilden lassen. Zum anderen führt ihre klobige Hierarchie dazu, dass viele Beweise im System der Principia deutlich umständlicher
geführt werden müssen als beispielsweise in der Frege’schen Logik.
41