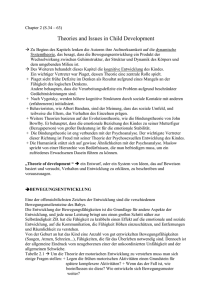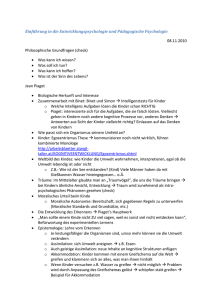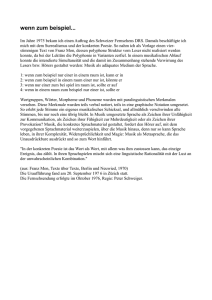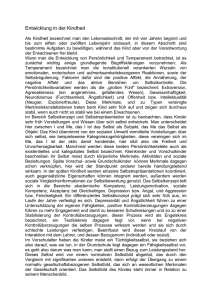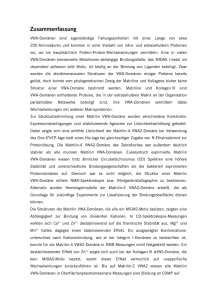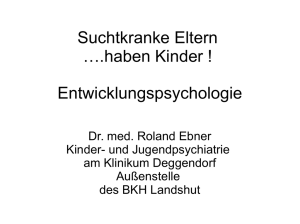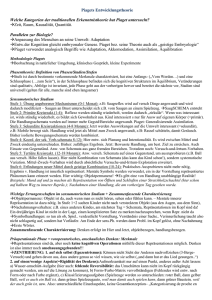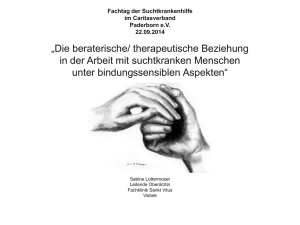Leo Montada: Kapitel 1: Fragen, Konzepte, Perspektiven
Werbung
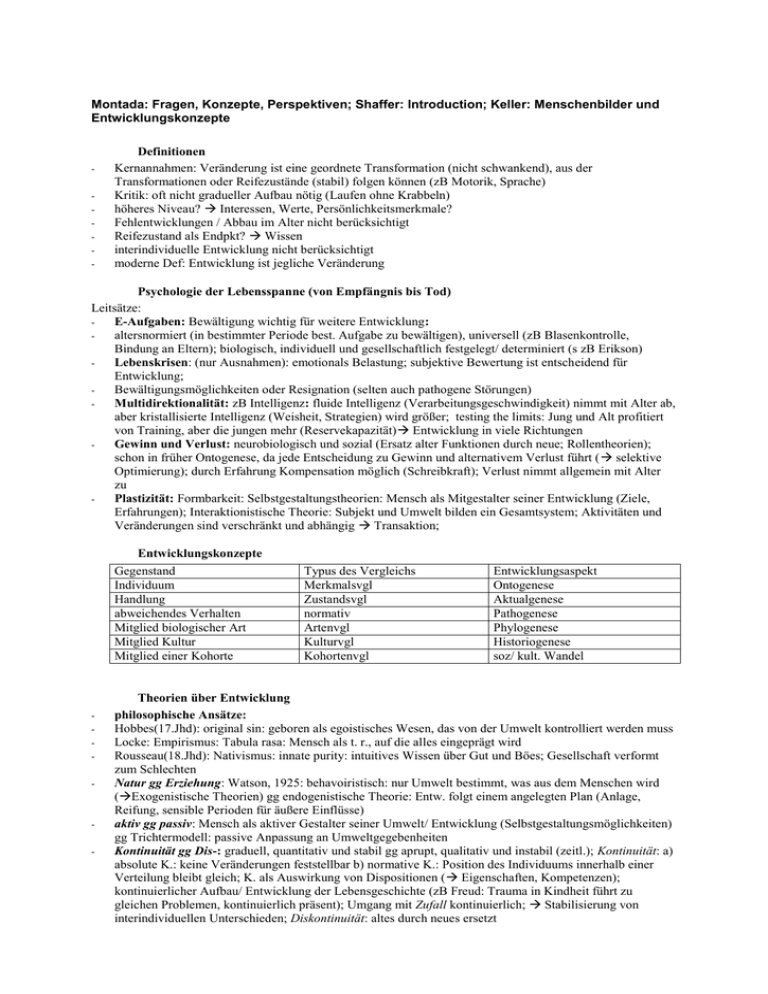
Montada: Fragen, Konzepte, Perspektiven; Shaffer: Introduction; Keller: Menschenbilder und Entwicklungskonzepte - Definitionen Kernannahmen: Veränderung ist eine geordnete Transformation (nicht schwankend), aus der Transformationen oder Reifezustände (stabil) folgen können (zB Motorik, Sprache) Kritik: oft nicht gradueller Aufbau nötig (Laufen ohne Krabbeln) höheres Niveau? Interessen, Werte, Persönlichkeitsmerkmale? Fehlentwicklungen / Abbau im Alter nicht berücksichtigt Reifezustand als Endpkt? Wissen interindividuelle Entwicklung nicht berücksichtigt moderne Def: Entwicklung ist jegliche Veränderung Psychologie der Lebensspanne (von Empfängnis bis Tod) Leitsätze: E-Aufgaben: Bewältigung wichtig für weitere Entwicklung: altersnormiert (in bestimmter Periode best. Aufgabe zu bewältigen), universell (zB Blasenkontrolle, Bindung an Eltern); biologisch, individuell und gesellschaftlich festgelegt/ determiniert (s zB Erikson) Lebenskrisen: (nur Ausnahmen): emotionals Belastung; subjektive Bewertung ist entscheidend für Entwicklung; Bewältigungsmöglichkeiten oder Resignation (selten auch pathogene Störungen) Multidirektionalität: zB Intelligenz: fluide Intelligenz (Verarbeitungsgeschwindigkeit) nimmt mit Alter ab, aber kristallisierte Intelligenz (Weisheit, Strategien) wird größer; testing the limits: Jung und Alt profitiert von Training, aber die jungen mehr (Reservekapazität) Entwicklung in viele Richtungen Gewinn und Verlust: neurobiologisch und sozial (Ersatz alter Funktionen durch neue; Rollentheorien); schon in früher Ontogenese, da jede Entscheidung zu Gewinn und alternativem Verlust führt ( selektive Optimierung); durch Erfahrung Kompensation möglich (Schreibkraft); Verlust nimmt allgemein mit Alter zu Plastizität: Formbarkeit: Selbstgestaltungstheorien: Mensch als Mitgestalter seiner Entwicklung (Ziele, Erfahrungen); Interaktionistische Theorie: Subjekt und Umwelt bilden ein Gesamtsystem; Aktivitäten und Veränderungen sind verschränkt und abhängig Transaktion; Entwicklungskonzepte Gegenstand Individuum Handlung abweichendes Verhalten Mitglied biologischer Art Mitglied Kultur Mitglied einer Kohorte - - Typus des Vergleichs Merkmalsvgl Zustandsvgl normativ Artenvgl Kulturvgl Kohortenvgl Entwicklungsaspekt Ontogenese Aktualgenese Pathogenese Phylogenese Historiogenese soz/ kult. Wandel Theorien über Entwicklung philosophische Ansätze: Hobbes(17.Jhd): original sin: geboren als egoistisches Wesen, das von der Umwelt kontrolliert werden muss Locke: Empirismus: Tabula rasa: Mensch als t. r., auf die alles eingeprägt wird Rousseau(18.Jhd): Nativismus: innate purity: intuitives Wissen über Gut und Böes; Gesellschaft verformt zum Schlechten Natur gg Erziehung: Watson, 1925: behavoiristisch: nur Umwelt bestimmt, was aus dem Menschen wird (Exogenistische Theorien) gg endogenistische Theorie: Entw. folgt einem angelegten Plan (Anlage, Reifung, sensible Perioden für äußere Einflüsse) aktiv gg passiv: Mensch als aktiver Gestalter seiner Umwelt/ Entwicklung (Selbstgestaltungsmöglichkeiten) gg Trichtermodell: passive Anpassung an Umweltgegebenheiten Kontinuität gg Dis-: graduell, quantitativ und stabil gg aprupt, qualitativ und instabil (zeitl.); Kontinuität: a) absolute K.: keine Veränderungen feststellbar b) normative K.: Position des Individuums innerhalb einer Verteilung bleibt gleich; K. als Auswirkung von Dispositionen ( Eigenschaften, Kompetenzen); kontinuierlicher Aufbau/ Entwicklung der Lebensgeschichte (zB Freud: Trauma in Kindheit führt zu gleichen Problemen, kontinuierlich präsent); Umgang mit Zufall kontinuierlich; Stabilisierung von interindividuellen Unterschieden; Diskontinuität: altes durch neues ersetzt - - - - - - - - - - Universell gg partikularistisch: normative Entw. die von allen durchlebt wird gg Variation von Person zu Person psychogenetische Rekapitulationstheorie: Hall 1904: Ontogenese als Wiederholung der biolog. und historischen Geschichte der Menschen Modellvorstellungen für die Erklärung von Entwicklung systematische ontogenetische Veränderungen Reifung: inneres, nicht von außen beeinflusstes Programm; universell in best. Altersperiode; Ggteil von Lernen; zB Laufen in12./13. Monat (auch Hopi-Kinder) Nachholbarkeit; nicht umkehrbar; Überprüfung zB bei Wolfskindern (wenn Erfahrung/ Lernen ausgeschaltet) Reifestand: readiness for learning: best. Entwicklungsstand vorausgesetzt, damit erfolgreich (zB Blasenkontrolle) sensible Perioden: Zeitfenster, in dem spezielle Erfahrungen maximale positive oder negative Auswirkungen haben (zB Bindung beim Menschen um 5 Monate; bei Ziegen um 5 Minuten nach Geburt); Periode hoher Plastizität; nach Ende der Phase sind gleiche Erfahrungen weniger wirksam (zB Angst gelernt) Prägung (Lorenz): adaptiver Vorteil: auf best. Merkmale wird in lernsensibler Phase gerpägt; erworbenes Verhalten nicht mehr reversibel Sozialisation: lebenslanger Lernprozess, in dem Menschen die Überzeugungen, Verhalten und Werte von Mitgliedern der Gesellschaft und von der Umwelt vermittelt werden; Ziel: moral. Verhaltensregulation; indiv. Persönlichkeitsentwicklung; soziale Ordnung verewigen Menschen sind sich ähnlich und doch so verschieden, obwohl Gene/ Umwelt gleich Interaktion und retroaktive Interaktion: child effekt: Kinder erziehen Eltern (Mittel: konstruktiv-aktive Steuerung; oppositionelle Steuerung; passiv-resignativ; Schmusen...) Entw. als sukzessive Konstruktion: Entw. als sachlich und logische Sequenz; Reihenfolge wichtig; Piaget: Stufenmodell; Selbstkonstruktion: Kind erkundet aktiv und unstrukturiert seine Umwelt Widersprüche und Probleme von einfachen zu komplexeren Strukturen Entwicklungsprobleme: Passungsprobleme ( Entw-standards nicht erreicht; phänotypisch sehr unterschiedlich, zB Selbstwertprobleme, Eheprobleme); Ursachen: fehlende Passung/ Diskrepanzen zwischen: Entw.zielen des Individuums Entw.potentialen Entw.anforderungen im familiären, schulischen etc Umfeld Entw.angebote in der Umwelt Bsp: Kindesmisshandlung aus Aspekt der Passung: nicht nur soz. Umfeld, sondern auch Kind als Auslöser (Vorstellungen der Eltern, was normal ist) Entwicklung durch Anlage oder Umwelt? ohne Erblanlagen keine Entw.; Entwicklung nur in spezies- normaler Umwelt problemlos gleiche Umwelt wird phäno-& genotypisch unterschiedlich aufgenommen ZZ: sind sich umweltmäßig ähnlicher; EZ sind sich genotypisch ähnlicher BSP: IQ korreliert mit dem der wahren Eltern besser als mit dem der Adoptiveltern Anlage- Umwelt-Passung: 1) passive Genom-Umwelt-P: Umweltgestaltung beim Kind durch die Eltern großer Einfluß der Umwelt; 2) aktive G.-U.-Passung: Mensch wählt die dem Genom entsprechende Umwelt selbst aktiv aus Erwachsener, Selbstgestaltung 3) evokative G.-U.-Passung: Angebote vom Genom des Kinder ausgelöst (nettes Kind ruft Freundlichkeit hervor) mit wachsendem Alter nimmt der Einfluss der Umwelt auf das Kind ab, der Einfluß des Genoms zu (Erblichkeitskoeffizient wird größer) Geschichte Altertum: Kinder wertlos; Besitz MA: Kinder = kleine Erwachsene (Strafrecht!) ( Ariès) Rousseau: Neugeborenes als amoralisches Wesen, wird sich natürlich bedingt zum Guten entwickeln 17./ 18. JHD: Kinder als schützenswerte Kreaturen Schule Darwin: Empirie 19. JHD: Baby-Biographien: Kinder = Subjekte Industrialisierung: Kinder haben keine Arbeit Zeit, Peers 1904: S. Hall: Sammlung empirischer Daten Freud: Psychoanalyse (heuristisch) in viele Kulturen noch heute kein Konzept der Kindheit! Bjorklund; Kapitel 4: Piaget`s Theorie; Keller, Kapitel 2: Theorien der kognitiven Entwicklung; Montada: Kapitel 2: Geistige Entwicklung aus Sicht Piagets - - - Grundannahmen von Piagets Theorie Metapher: Kind als Wissenschaftler Stadientheorie: geordnete Gesamtstruktur; qualitative Reorganisierung; invariante Sequenzen, universell genetische Epistemologie: experimentelle Untersuchung der Entwicklung/ Aufbaus des Denkens/ der Erkenntnis Strukturen/ Strukturalismus: mentale Systeme, die Intelligenz/ intelligentem Verhalten zugrunde liegen Basiswissen/ Repräsentationen, der Realität; durch sie wird interpretiert und erlebt angeborene Aktivität: Kind als treibende Kraft der Entw.; Kind an sich aktiv (suchen und initiieren Stimuli); aktive Anwendung v.a. neuer Strukturen; Motivation kommt nur von innen, nicht von außen ( Rolle von Lehrer/ Peers!) Konstruktivismus: intraindividuell unterschdl. Realitäten versch. Auswahl und Interpretation der Info (aktive Konstruktion der Welt) funktionale Invarianten (biolog. Systeme und ihre lebenslange Wirkung) Organisation: Koordination der Operationen, Struktureingliederung in übergeordnete Systeme (zB Daumen Bewegung und Saugen Daumenlutschen) Adaptation: Anpassung der Strukturen an die Umweltanforderungen Assimilation: aktive (da Veränderung der Daten nötig) Eingliederung eines neues Reizes in eine bestehende Struktur Akkomodation: bestehendes Schema wird verändert, um unstimmige Info passend zu machen/ zu integrieren (aktiv; zB Imitation) Gleichgewicht: Motivation: kognitive Strukturen im Gleichgewicht halten: kognitiv inkongruente Info Ungleichgewicht Unbefriedigung Gleichgewicht wiederherstellen durch: 1. Akkomodation (ergibt stabilere Strukturen) 2. ignorieren der Info 3. Assimilation (umbiegen der Info) Operationen: an Regeln gebundene, logische Strukturen, die mentales Problemlösen erlauben, internalisierte Handlungen Objektpermanenz: Wissen, dass eine Sache eine räuml. und zeitl. Existenz unabhängig von der eigenen Wahrnehmung haben Imitation: Verhalten dem eines Vorbildes angleichen Absichtliche Veränderung des eigenen Verhaltens nötig Entwicklungsstufen 1.) Sensumotorische Stufe (0-2) (0-1M.) angewandte (wenige) Basisreflexe: Anwendung auf Objekte(Akk. und Ass.) ; Objekte nur mit eigener Wahrnehmung verbunden; Verhalten durch Umwelt ausgelöst (nicht intentional) Aus den Augen, aus dem Sinn (Objekte haben keine Realität) keine Imitation (1-4M.) Primäre Zirkulärreaktionen: erworbenes, sich wiederholendes Verhalten (Gewohnheitsbildung); auf angeborene (= pimären)Reflexe, auf eigenen Körper beschränkt; generalisierende Assimilation; zufällige veränderte Reflexe (Daumenlutschen) Aus den Augen, aus dem Sinn Baby imitiert sich selbst bzw ggseitige Imitation mit Erwachsenem (keine wirkliche Imitation) (4-8M.) Sekundäre Zirkulärreaktionen: basiert auf Adaptionen, die zu neuem Verhalten führen; zufällig ausgelöst, aber gezielte Schemaaktivierung, um Reiz wiederherzustellen; interessante Dinge in der Umwelt gefunden Objekt halb verdeckt wird aufgedeckt, aber nicht ganz verdeckte Objekte erstes Auftreten der OP (8-12M.) Koordination der sekundären Z-Rkt: zielgerichtetes Verhalten; Bedürfnis Handlung; Ursache und Effekt jetzt differenziert; durch Koordination der Schemata dienen diese sich ggseitig Suche nach verdeckten Objekten, aber Objekte noch an Handlungen gebunden A non B- Fehler Imitation, aber ohne Feedback (unsichtbare Gesten, Ausweitung der Schemata); v.a. Akkomodation steigt, solange schema-nah (12-18M.) Tertiäre Z-Rkt: Bedürfnis Handlung; gekonnte Anwendung/ Änderung von Schemata; aktives Experimentieren Problemlösen durch Versuch - Fehler; Intelligenz auf physik. Handlungen bei Objekten beschränkt Suche nach Objekten, wo sie zuletzt gesehen wurden (nicht mehr A non B) - bei unsichtbarer Verlagerung erfolglos systematische und exakte Imitation in Anwesenheit des Models (18-24M.) (drastischer Übergang!)Erfindung neuer Mittel durch mentale Kombinationen: Auftreten symbol. Funktionen (Sprache, Imitation, Gesten, Symbolspiel, mentale Bilder); Kognitionen allmählich internalisiert durch mental repräsent. Schemata Objektpermanenz Erfolg bei unsichtbarer Verlagerung durch Rekonstruktion verzögerte Imitation Lösung durch Antizipation Kritik: Meltzoff: schon Neugeborene können verzögert imitieren (Zunge blecken) Baillargeon: Habituation-/ Dishabituations-Paradigma : dishabituieren an physikalisch unmögliches Ereignis: OP schon ab 3-4 Monaten ! Piaget beweist kognitive Fortschritte anhand von motorischen Fähigkeiten die kognitiven Fähigkeiten werden aufgrund mangelnder motorischer Fähigkeiten nicht erkannt Ergebnisse Piagets, weil aufgrund von Hirnreifungsprozessen die Fähigkeit zur Hemmung von Handlungstendenzen noch nicht ausgebildet ist (A non B - Fehler) 2.) präoperationales, anschauliches Stadium (2-7) intuitives Denken, Erscheinung einer Sache ist bedeutend unangemessene Generalisierung: Artifizialismus (Welt vom Mensch gemacht); Animismus (Unbelebtes personifiziert), finalistische Erklärung: Natur ist nur zum Zweck des Dienens da Egozentrismus: (adaptiver Vorteil) unfähig, andere Perspektiven zu übernehmen Animismus; zB DreiBerge-Versuch erfolglos Zentrierung/ Rigidität des Denkens: können versch. Dimensionen nicht gleichzeitig erfassen (Zeit und Geschwindigkeit, Volumen und Höhe, Masse...), Konzentration auf Zustände, nicht auf Transformationen; mgl. Erklärung: mangelnde Koordinationsfähigkeit? fehlende Reversibilität/ unidirektionales Denken: Klasseninklusion nicht gelöst ( Beziehung zw. Ober- und Untergruppen); Konservationsaufgabe nicht gelöst ohne Operationen gehandelt, nur aufgrund von internalen Repräsentationen Kritik: 3-Berge- Versuch zu schwer; bei leichter gestellten Aufgeben (zB nur ein Photo beschreiben aus 2 Sichten) kein Egozentrismus Klasseninklusion: suggestive Frage; bei genügender Kenntnis über die Klassen wird die Aufgabe gut gelöst Vorwissen beeinflusst Wissen über Umwelt ( Artifizialismus...) Zentrierung mgl, wenn ein geeigneter Maßstab gefunden wird (verständlich, zB Schokoladenrippchen als Strecke) transitives Denken nicht erfolgreich, da die genügende Gedächtnisfähigkeit fehlt (Exp: wenn lange gelernt, werden die Schlüsse richtig gezogen!) Invarinaz der Menge/ Anzahl früher gelernt als Invarianz des Volumens/ Gewichts: keine generelle strukturelle Entwicklung, sonder nur domänenspeziefisch 3.) konkret- operatorisches Stadium (7-11) konkrete operative Strukturen werden angewandt Denken nur über Objekte/ Greifbares/ schon bekanntes Wissen Reversibilität: Inversion, Kompensation (alternative Operation für gleiches Ergebnis) Egozentrismus überwunden wg, Konflikten, sozialem Austausch Klassifikationen/ Klassenhierarchien (additive Komposition von Klassen: inverse O.; Resorption, leere Klasse, Assoziativität, Tautologie transitive Schlüsse) Klasseninklussion gelöst, Klassifizierungen erlernt ( zu sehen am richtigen Gebrauch der best./ unbest. Artikel) Seriation nach einer Dimension Multiplikation von Klassen: Zahlbegriff, setzt Invarianz der Menge bei Veränderung von Anordnung voraus Perspektivenübernahme Kritik: durch Training (Konzentration auf Wesentliches) kann Konservation auch von 3Jährigen erlernt werden - formal- operative Denkstrukturen können auch schon früher angewandt werden bei entsprechend leichter Fragestellung 4.) formal- operatorisches Denken (11-16) geht über direkte/ gegebene Info hinaus abstraktes Denken hypothetisches Denken (ZB Moral, Religion) planvolles Experimentieren (zB Pendelversuch), Variablenisolierung und - Kontrolle Flexibilität des Denkens mit den zugrunde liegenden komplexen Strukturen Verständnis von Proportionen (unterschdl. Fische mit wie vielen Perlen gefüttert?) reflektive Abstraktion: Denken über das Denken möglich eigene Änderung der Strukturen mgl. mathematisches Denken: Anwendung von abstrakten, willkürlichen Symbolsystemen deduktives und induktives Denken (zB Pendelversuch) Egoismus ( adaptives Verhalten: Unabhängigkeit) Kritik: formal- operatives Denken der Erwachsenen wird überschätzt (zB Einkaufen: größeres oder kleineres teurer?) ; nicht entsprechende wissenschaftliche Ausbildung? - 3.) Allgemeine Kritik an Piagets Theorie keine einheitliche Entwicklung der Strukturen: zB gleichzeitig egozentrisch und fähig zur Perspektivenübernahme Stufenabfolge? Quantitative statt qualitative Veränderungen (= das Kind denkt wie ein Erwachsener, nur weniger?) Vernachlässigung sozialer Faktoren Vernachlässigung der Entwicklung nach der Adoleszens es gibt auch bereichsspezifisches Wissen Theorie beschreibt nur, erklärt nicht (Bedingungen..) nur genetisch Verdienste Piagets: Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung Erziehung (Erkenntnis wichtig Kind sollte selbst entdecken!) Gründer der kognitiven Entwicklungspsychologie (empirische Beobachtung) präzises Bild, wie Kinder wann denken (Strukturalismus des Denkens) heuristische Theorie Bjorklund, Kapitel 4 und 5: Neopiagetians und Informationsverarbeitungsansätze Grundannahmen: Kind als Computer- Metapher: Denken = Infoverarbeitung ( Input so bearbeiten, dass er verstanden wird) Multistore- Modell: Input (Umwelt) sensorischer Speicher KZG/ Arbeitsgedächtnis LZG viel Info - Info für Sekunden - für immer für jeden Kanal eigener - Operationen angewandt - Wissen/ Speicher - Kontakt zur Welt Erinnerung Strategien... exekutive Kontrollstrukturen: steuern, planen, durchführen jedes Verarbeitungsschrittes Gehirn = Hardware; Strategien = software Repräsentation von Wissen: deklaratives = explizites Gedächtnis: episodisches Gedächtnis, semantisches Gedächtnis (Sprache, Regeln, Konzepte) bewusster, direkter Zugang; verfügbar nondeklaratives = implizites = prozedurales Gedächtnis: Wissen von unbewusst ablaufenden Prozeduren kein direkter Zugang, nicht verfügbar - - Automatische und nicht-automatische Prozesse alle Prozesse verlaufen auf einem Kontinuum, wieviel Kapazität in Anspruch genommen wird Kennzeichen automat. Prozesse: keine mentale Anstrengung nicht dem Bewusstsein verfügbar keine Interferenz mit anderen Prozessen keine Variation wegen individuellen Unterschieden (zB Intelligenz) nicht- autom. Prozesse genau gegenteilig gekennzeichnet je weniger automatisch ein Prozess ist, desto mehr Anstrengung zum Problemlösen wird benötigt desto mehr Glucose wird verbraucht im Gehirn intelligentere Menschen brauchen weniger Glucose zum Verarbeiten Annahmen über die Faktoren zur Entwicklung der Infoverarbeitung a) Entwicklung des sensorischen Speichers: 5J Kinderhaben mehr Info im sensorischen Speicher als Erwachsene, aber sie bekommen diese Info schlechter ins KZG Unterschiede in Geschwindigkeit, Weiterleitung und Anhäufung von Info b)Entwicklung des Kurzzeitspeichers Kapazität gemessen in Gedächtnisspanne (unverbundene Worte in exakter Reihenfolge wiedergeben) linearer Anstieg der Gedächtnisspanne: 2J.2 Items; 5J4 Items; 7J.5 Items; Erw7 Gedächtniskapazität: Erstklässler, Viertklässler und Erwachsene spielen ein PC- Spiel und hören „irrelevante“ Worte nebenbei. Später sollen sie diese in richtiger Reihenfolge wiedergeben Erw: 3.5 Worte; 4.Klässler: 3; 1Klässler: 2.5 akustische Schleife: Worte in der Schleife werden wiederholt für kurze Zeit und dann im KZG bearbeitet. Dabei ziehen Unterschiede in der Wiederholungsrate Unterschiede in der Gedächtnisspanne nach sich. Die Wortlänge hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Gedächtnisspanne sprachabhängige Unterschiede der Gedächtnisspanne (Art der Sprache und Beherrschung der Sprache) Verarbeitungsgeschwindigkeit: jüngere Kinder brauchen mehr Zeit mehr der limitierten Kapazität, um kognitive Prozesse auszuführen Grund für steigende Verbesserung mit Älterwerden: Myelinisierung Bsp: in Reaktionszeitaufgaben schneiden jüngere Kinder schlechter ab Geschwindigkeit als globaler Faktor, der die spezifischen Verarbeitungsgeschwindigkeiten bedingt und so direkt und indirekt Einfluss auf die Verarbeitung nimmt Verarbeitungseffizienz: vgl. Robbie Case: durch Übung und Automatisierung: weniger Arbeitsraum benötigt Effizienz der Verarbeitung steigt Strategien: zielgerichtete, überlegt angewandte, potentiell bewusste Operationen, die Infoverarbeitung verbessern oft explizit vermittelt (Unterricht) Beispiele: Wiederholen, Fingerzählen, bildliche Vorstellung... Defizite: Defizit im Anwenden: Kinder können effiziente Strategien weder erfinden noch anwenden Defizit in der Produktion (Vorschulkinder): Kinder produzieren die Strategie nicht von selbst, wenden sie aber erfolgreich an Nützlichkeits- Defizit: Kinder verwenden gute Strategien, aber sie profitieren nicht davon Generierung und Ausführung erfolgreich Beispiel: Kinder sollen sich merken, an welchen Orten sich Teile von zwei bestimmten Kategorien befinden; erst 8jährige schauen nur in den relevanten Orten nach impliziter Strategiegebrauch: entgegen der Definition werden Strategien oft zuerst unbewusst gebraucht Bsp: die meisten Kinder verwenden unbewusst, aber richtig, die shortcut- Strategie (Aufgabe: 12+53-53=?), können sie aber nicht in Worte fassen Kosten von Strategien: Interferenz: jüngere Kinder brauchen viel Ressourcen nur für die Anwendung der Strategie Verlust von Effizienz, wenn mehrere Aufgaben vgl. Siegler c.) Wissen Infoverarbeitung und Wissen sind voneinander abhängig: Menge an bisher bekanntem beeinflusst Aufnahme, Speicherung und Geschwindigkeit) domainen- übergreifende Mechanismen führen zu domainen- speziefischem Wissen Bsp: kindliche Schachexperten können sich mehr Stellungen merken als Erwachsene Laien, aber Erwachsene können sich Zahlenfolgen besser merken Expertenvorteil: generelles und spezifisches Wissen Experten sehen Situation, Novizen sehen Einzelelemente wenn Spielkonfiguration nach Zufall kein Vorteil der Experten mehr o Verknüpfungen von Wissen bestimmen den Zugang und die Lösungen Wissen und Strategien: strategische Verarbeitung ist abhängig von Verfügbarkeit und Zugang zum relevanten Wissen (zB: gepaarte Assoziationen schneller erlernt, wenn ähnliche(=verfügbare) Paare; bei Strategieanwendung ist die Reaktionszeit noch länger, wenn die Paare nicht verfügbar sind) d.) Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit aufrechterhalten: Länge der Konzentration Aufmerksamkeitsspanne: Zeit, für die die Aufmerksamkeit erhalten bleibt, steigt mit Alter (zB freies Spiel) individuelle Unterschiede in Aufmerksamkeit sind domainen- spezifisch je verständlicher die Aufgabe (TV-Programm) ist, desto mehr Aufmerksamkeit wird ihr zugewiesen wenn viel Aufmerksamkeit auf eine Sache und Reaktion auf ein Signal verlangt wird, dann sind die Rkt umso langsamer, je aufmerksamer die Kinder die erste Aufgebe verfolgen aktiver, anstrengender Prozess selektive Aufmerksamkeit: ausblenden irrelevanter Info Fähigkeit, sich auf einen Fokus ohne Ablenkung zu konzentrieren irrelevante Info wird zunehmend mit Alter ignoriert Bsp: inzidentielles Lernen: Bildpaare, von denen nur eines Bedeutung hat jüngere Kinder erinnern weniger jüngere Kinder wiederholen genauso gut irrelevante wie relevante Info ab 11J: ausblenden möglich, Anzahl der irrelevanten Worte sinkt o bei jüngeren Kindern: große Interferenz; bei älteren: Inhibition möglich (aufgrund von Reifung des Frontalkortex) - Kurt Fisher: Skill - Theorie: Einfluss von Kind und UMWELT auf Entwicklung (Interaktion) optimales Level: diejenige Fähigkeit, die von der Umwelt gerade besonders gefordert wird, wird sehr gut ausgeprägt immer andere Anforderungen verschiedene Fähigkeiten gut ausgeprägt dynamische skills durch Koordination der skills ergeben sich qualitativ neue Systeme Entwicklung in Stufen: sensumotorisch (3-24M.): Objektbezug Repräsentation (2-12J): konkrete Objekte mental repräsentiert Abstrakt (12-26J): Kombination von Repräsentationen altersbed. Veränderung: Hirn wächst in Sprüngen, die seinen Stufeneinteilungen entsprechen Veränderungen des EEG im Frontallappen Vergleich mit Piaget: Gemeinsamkeiten: Schemata entsprechen skills (Strukturen, durch die das Kind die Welt erkennt) basierend auf Aktionen aus früheren Strukturen entwickelt Entwicklung von einfach zu komplex Unterschiede: nicht homogene Entwicklung Einfluss der Umwelt - - - - - keine invariante Reihenfolge, da individuell verschiedene Umwelten und so verschiedene optimale Levels Varianz der Verhaltensmöglichkeiten! Robbie Case`s Theorie: stufenweise Entwicklung: 4 Stufen mit je eigener typischen kognitiven Leistung: sensumotorisch: 0-18M. Objekte werden durch Bewegung repräsentiert interralational stage: -5: aufdecken und koordinieren von Beziehungen zwischen Objekten dimensional- bis 11: Vergleich von 2 Dimensionen abstrakt-dimensional: Verstehen abstrakter Systeme; verbale Analogien, psych. Denken über andere die Effizienz der Verarbeitung verändert sich (bereichsübergreifend) und beeinflusst die kognitiven Leistungen Kofferraummetapher durch Automatisierung/ Übung (= Platz im KZG) und biologische Reifung (=Myelinisierung) wird die Effizienz erhöht Entwicklung durch Ansammlung von exekutiven Kontrollstrukturen, die Repräsentationen enthalten über zB Situationen, Objekte, Strategien (Verhaltensmuster) Veränderung zentraler begrifflicher Strukturen (=bereichsspeziefische Wissenskerne/ Assotiationsnetze) Begrenzung: durch optimales Level und dessen Möglichkeiten (von Reifung abhängig) Entwicklung sehr heterogen, da interschiedl. Situationen andere Repräsentationen erfordern noch immer bereichsübergreifende Entwicklung, aber nicht von logischen (= Piaget) sondern von semantischen Strukturen (Sprache beeinflusst das Denken!) altersbedingte Vergrößerung des Arbeitsgedächtnisses (4.5-5.5 J) korreliert mit den Veränderungen von Aktivitätsmustern im EEG (zw. 4 und 6 Jahren am größten, Frontal- und Okzipitallappen) Theorie-Theorie: Grundannahmen: bereichsspeziefische, angeborene Theorien (=Wissen), die die Art und Wahl der aufgenommenen Info steuern Veränderung der kindlichen Theorien bis hin zu erwachsenen Theorien Basis = Piaget: kognitive Entwicklung als konstruktiver Prozess; aber: kein allgemeines System von logischen Strukturen, sondern Theorien structural - constraint - theory: Neo-Nativismus: richtiger Zeitpunkt zum Auftreten muss abgewartet werden (sensor./motor); zB für OP; aber: hier kein Konstruktivismus Entwicklung durch die Strukturen erzwungen, kaum Flexibilität starting- state- theory: Gopnik und Meltzoff angeborene Theorien/ Regelwerke bestimmen Art der Info, die verarbeitet wird ( zB Wissen um Sprache, OP, Raum) Regeln werden durch Erfahrung verändert Veränderungsprozess: stabile Theorie Krise/ Disorganisation stabile Theorie alle Erwachsenen haben aufgrund der spezies-typischen Umwelt ähnliche Theorien Merkmale von Theorien: strukturelle -: Abstraktheit, Kohärenz der Konstrukte, Kausalität, ontogenetisch festgelegt; funtionelle-: Prädiktion, Erklärung, Interpretation dynamische Theoriebildung, Prüfung und Revision Kinder ab 4 Jahren haben Theory of mind: können zwischen Realität und Überzeugung differenzieren - Anette Karmiloff- Smith: repräsentative Redeskriptionstheorie Grundannahmen: biologisch begrenzte Info-Verarbeitung (Reaktionen auf Reize) Wissen ist spezifisch/ modular angelegt (angeboren) aktiviert von entsprechenden Umweltreizen Wissen wird angeeignet durch: angeboren spezifiziert Interaktion mit der Umwelt repräsentationale Neubeschreibung repräsentationale Neubeschreibung: Repräsentationen der eigenen Repräsentationen; allen Strukturen im Gehirn kann spezifisches Wissen mitgeteilt werden ( vgl Piaget: reflexive Abstraktion) 4 Levels: implizites Level: Wissen wird unbewusst aufgenommen/ abgespielt Erklärungs- Level: Wissen verfügbar, aber nicht bewusst Erklärungslevel: bewusstes und verfügbares Wissen „ „ : Wissen verbalisiert, mit anderen geteilt Vergleich mit Piaget: intrinsive Aktivität, konstrukiver Prozes; aber: keine generelle, sondern spezifische Entwicklung der Gebiete, nicht homogene Entwicklung - Robert Siegler (1996): Adaptive Strategiewahl Kritik am Stufenmodell: nicht Homogenität, sondern Variabilität als Norm Grundannahmen: zu jedem Zeitpunkt eine Vielfalt an Strategien gegeben je nach Alter werden spezielle Strategien selektiert und häufig angewandt Häufigkeit der Anwendung ändert sich mit der Zeit effizienter/ audgeklügelter anfangs: einfache Strategien, werden immer komplexer (mental anstrengend) und effizienter nicht stufenweise, sondern wellenförmig - überlappend Mikrogenetische Studie: Erwerb der Min- Strategie: erst Summenstrategie, dann Min- Strategie, dann Wissensantwort (ZB 3+5=?) Neuere Theorien Inhibition und Interferenz neurologische Befunde: Inhibition hängt zusammen mit Entwicklung des Frontallappens (bis 2J schnell entwickelt, dann 4 und 7J Schübe, dann kontinuierlich bis Jugendalter) Experiment: Kinder mit noch nicht vollständig entwickeltem Frontallappen haben Schwierigkeiten, einmal Gelerntes umzulernen (bzw zu verhindern), zB Kartensortier-Test auch wenn Regel verbal formuliert werden kann, können Kinder nicht hemmen auch Sprechen kann schwer gehemmt werden (3J) Lügen!! irrelevante Info muss aus dem Arbeitsgedächtnis ausgeblendet werden können, damit genügend Speicherplatz für relevante Info zur Verfügung steht Frank Dempster (1992): Interferenzmeisterung ist spezifisch: motor. Interferenz am Anfang stark, nimmt dann ab Wahrnehmungsinterferenz steigt bis 4J, dann Abnahme sprachl. Interferenz stark um 6J, dann absinken Fuzzy- Trace- Theorie (Charles Brainerd, Valerie Reyna) neue Metapher: Kind als intuitives Wesen Grundannahmen: Gedächtnisrepräsentationen bestehen auf Kontinuum (wörtlich intuitiv/ ungenau) ein Ereignis ist durch verschiedene Spuren repräsentiert beim Problemlösen sind die Fuzzy- Spuren bevorzugt Reduktion auf das Wesentliche Fuzzy- Spuren: werden leichter abgerufen, weniger mentale Arbeit, exakte Spuren werden schneller vergessen Intuition = Fuzzy- Spur Output. Interferenz: gleichzeitig konkurrierende Lösungsspuren geben ein irrelevantes Feedback und verhindern so eine effiziente Verarbeitung („Geräusch im Kopf“) Veränderungen mit Alter: jüngere Kinder speichern nur die exakte Info statt das Wesentliche (wissen mehr Details, aber weniger im Gesamten) je älter, desto besser im Wesentlichen merken verbatim- gist- Wechsel in der Grundschule: Effizienz der verbatim- Erinnerung sinkt hier Connectionist- Perspektive Verbindung zwischen Umwelt und angeborenen Faktoren Grundannahmen: Assoziationen einzelner Knoten (Inputneuron, Output-, Inter-), inhibitoisch oder excitatorisch Erfahrung = Geschichte von Mustern der Aktivität eines Knotens Infoverarbeitung nicht sequentiell, sondern parallel (Aktivierung von Knoten) Veränderungen: angeborene Architektur wird durch lernende Algorithmen verändert (Folge von Erfahrung) Systeme werden trainiert durch Rückmeldung über Richtigkeit des Outputs: schnell und abrupte Veränderung Montada, Kapitel 10: Entwicklung der Wahrnehmung und Psychomotorik; Kapitel 5: Vorgeburtliche Entwicklung und Frühe Kindheit - Einleitung Empirismus vs. Nativismus vs. kompetenter Säugling Def. Sinnesempfindung: elementarer Prozess der Reizaufnahme und Registrierung Def. Wahrnehmung: höherer Prozesse der Organisation und Interpretation der Reizinfo Für jede Sinnesmodalität spezifische Entwicklung; Mängel der Wahrnehmung als nützliche Filter Niedere Sinne Geruchssinn: Neugeborene differenzieren verschiedene Gerüche; präferieren Erdbeere, Vanille; reagieren abstoßend auf faulige Eier, Fisch Nach 7 Tagen unterscheiden sie Brustgeruch der Mutter von dem anderer Erkennt engste Kontaktpersonen über Geruchssinn Geschmack: Bei Geburt vorhanden; Präferenz für süß; spätere Geschmacksvorliebe durch frühe Erfahrung modifiziert Hautsinne Schmerz und Berührungssinn vorhanden; Fühlen und Berühren wichtig für Aufbau emotionaler Beziehungen Gleichgewichtssinn: Schon intrauterin reagiert Fötus ab 25. Woche mit Gegenbewegung auf Änderung der Lage Hören Reizunterscheidung schon im Mutterleib: ab 28. Woche mit Lidschlag auf akustische Töne reagiert; Geschichte in Schwangerschaft vorgelesen wird nach Geburt präferiert; Mutterstimme nach 4 Tagen präferiert (nicht: Vaterstimme!) Kategoriale Lautwahrnehmung: ab 1-2 Monate; angeborene Wahrnehmungsmechanismen für Klang von Sprache (mit 1Mon: Unterscheidung zwischen sprachlichen und nicht- sprachlichen Lauten; ab 6 Mon: zw. allen sprachlichen Lauten aller Sprachen; ab 9 Monate verloren, nur noch Unterscheidung der Muttersprache von anderen Fremdsprachen) Fodor: Module angeboren für Wahrnehmung spezifischer sprachlicher Einheiten Kinder habituieren an „Ba“, dishabituieren an „Pa“ Rekalibrierung: Lokalisation der Schallquelle durch Verarbeitung, wann an welchem Ohr der Schall ankommt da Kopfwachstum ständig neu lernen; jüngere Kinder orten Schallquelle weniger gut Sehen Sehschärfe und Kontrastsensitivität: Kinder präferieren konturenreiche Muster Sehschärfe durch Präferenzmethode (Streifen immer enger, bis keine Bevorzugung mehr) bestimmbar Sehschärfe schwach nach Geburt (25-30cm); schnelle Verbesserung bis 6 Mon; mit 1 Jahr fast wie Erwachsener (45fach erhöht) Kontrastsensitivität: bei Geburt um 50fach geringer als bei Erwachsenem visuelle Unterscheidung ungefähr wie bei unserem Nachtsehen (auch schlechtes Farbensehen) Augenlinse nicht starr bei Neugeborenem, aber da keine Sehschärfe, bringt Akkomodation nichts; gute Akkomodation ab ca. 6 Monaten Distanzwahrnehmung: Visuelle Klippe: Krabelkinder gehen nicht über tiefen Teil der Platte zur Mutter nehmen Tiefe wahr; Problem: bei 2Mon. ohne Selbstbewegung führt Halten über den tiefen Teil zu keiner erhöhten Herzfrequenz, aber Halten über den hohen Teil führt zur Erhöhung; Erklärung: noch keine Erfahrung mit Angst vor der Tiefe gemacht, da nicht selbstbewegt; Muster aber erzeugen visuelle Erregung; ab 9 Monate „normale“ Reaktion Tiefeneindruck auch durch Bewegung erzeugt (Technik: looming); Bild kommt sehr schnell auf Kinder zu Abwehrreaktion bei 1Monate alten Kindern Tiefeneindruck durch binocular cues ab 3 Monaten genutzt; Tiefeneindruck durch statische Reize (Überdecken etc.); Kinder greifen nach überdeckender Karte, da näher erscheint Erfahrung notwendig, ab 6 Monaten genutzt; Bsp: Reiz der gewohnten Größe (2 Spielzeugfiguren, groß und klein, die „kleinere“ wird nach Erkunden der großen ausgewählt, weil die vorher weiter weg schien und jetzt – in groß – näher; tritt erst bei 7Mon. auf) Form- und Objektwahrnehmung: 7Mon. erkennen subjektive Figuren: Kinder habituieren an Kreise mit fehlenden Vierteln in zufälliger Konstellation; wenn Kreise ein Quadrat umschreiben Dishabituation Kriterien zur Objektwahrnehmung: 2 Gegenstände als getrennt wahrgenommen, wenn erkennbarer Abstand (3Mon) Info über Oberflächenstruktur (4Mon) Physikalischer Wissen mit einbezogen (8Mon und Erfahrung zB mit Rigidität...) Gleichgerichtete Bewegung wird für Integration zu einem einzigen Objekt verwendet Intermodale Wahrnehmung: 4Mon erkunden 2 verbundene Ringe (durch Gummi vs. Holz); Test: Kinder schauen länger auf das bewegte Gebilde (das sie dann nur sehen), das sie nicht erkundet haben Übertragung/ Verknüpfung von haptischer und visueller Info Auge/Hand- Koordination: Armbewegungen von Neugeborenen sind grob abhängig von Blickbewegung; Bemühung, Arm im Blickfeld zu lassen; ersten 2 Monate: Koppelung von Arm- und Handbewegung; ab 3 Monaten Öffnen der Hand bei Objektfixierung; gezieltes Greifen ab 4/5 Monaten Visuelle Kontrolle nicht notwendig, da Greifen nach bewegten Objekten oder nach Objekten im Dunkeln erfolgreich propriozeptive Antizipation! 8-9Monate: Gutes Greifen; präzise Auge-Hand-Ziel-Abstimmung; Anpassung der Hand- und Fingerstellung an Zielobjekt; Daumen und Zeigefinger ab 10 Monat sicher koordiniert mit zunehmendem Alter: Vermischung von Wahrnehmung und Kognition; evt. Qualitative Veränderungen der motorischen Leistungen Besonderheiten: aktives Blicklösen vom Stimulus erst ab ca, 3 Monaten Johnson, 1998: 2 angeborene Mechanismen: Orientierungsmechanismus CONSPEC Angaben über artspezifische Gesichter, Orientierung im Gesicht; ab 2-4Monat: CONLEARN intensives Gesichtererkunden, Gesichterexperten Präferenz für Gesichter (Formen rund, symmetrisch) Sekundäres visuelles System ab 2-3Mon. aktiv; wo- Bahnen zuerst aktiv; eher rechtshemisphärisch (holistisch?) erst Lokation und Bewegung verarbeitet, danach primäres visuelles System aktiviert gezieltes visuelles Abtasten, eher linkshemisphärisch Visuelle Kategorisierung ab ca 5 Mon, da ab hier Hemisphären verknüpft werden Wenn Sprachlaute und Mundstellung nicht übereinstimmen Dishabituation - Bjorklund, Kapitel 10: Problem solving and reasoning Problemlösen Entwicklung des Problemlösens: Def.: Ziele; Überwindungshindersnisse; Bewertung der Ergebnisse Piaget: Problemlösen ab ca. 8 Monaten bestätigt, zB durch Willatts (1990): Kinder sehen auf Decke ein Spielzeug, nur 8Mon. ziehen mit klarem Ziel Decke und so Spielzeug zu sich; weiteres Bsp: Kinder sollen Haus nachbauen; nur 2 Jahre alte schaffen das gezielt mit anschließender Bewertung des Ergebnissen Verbesserung des Problemlösens durch Wissen/ Vertrautheit: Kinder sollen vorhersagen, wo auf PC Figur auftaucht (ist nach Schema festgelegt) – Bedingung Figur vs. Spiel wenn Aufgabe als Spiel dargestellt, leichteres Lernen, mehr Erfolg Ab wann werden Regeln aufgestellt? Def. Regeln: spezifizieren Beziehungen zwischen 2 oder mehr Variablen Oddity-Problem: 3 Objekte, je perzeptuell oder konzeptuell passend; Kinder müssen nach unbekannter Regel sortieren 16-31 Mon. haben Probleme, 32-60Mon noch mehr, ab 6 Jahren richtig gelöst; bei sprachlicher Instruktion (explizite Regel) lösen alle Kinder die Aufgabe gut; o Erklärung: jüngere Kinder lösen die Aufgabe anders als ältere Kinder; mittlere Gruppe hat ineffektive Strategie, da in dieser Zeit vor allem auf Sprache verlassen ( weist auf qualitative Veränderung hin!) o Siegler (1976): Regel- Bewertungs- Ansatz: kognitive Entwicklung als Erwerb von immer besseren Problemlöse-Strategien, Beispiel: Waage mit Gewichten, Entwicklung des richtigen Urteils, was alles miteinberechnet werden muss Regeln befolgen: Zelazo, 1997: Wissensaufgaben (welche Sachen sind im Haus, welche draußen?) lösen alle Kinder gut, aber wenn sie handeln (entsprechend sortieren) sollen, können erst 3Jährige dies richtig Perseverationstendenz mögliche Erklärungen: - wenig hemmende Kontrolle oder aber - altersabhängige Schwierigkeiten, verschiedene Regeln zu Koordinieren (=cognitive complexity and control, Zelazo) - - - Planen Warum Kinder schlecht/ selten planen: Hemmung des aktuellen Verhaltens, Zeit/ Genauigkeit benötigt; oft erfolglos; planen ist anstrengend, aufwendig Planen erst sehr spät entwickelt (unter Anleitung ab 5 Jahren, aber nicht spontan); auch Erwachsene planen nicht oft Schlussfolgern Ergebnis oft neues Wissen Analoges Schlussfolgern: etwas Bekanntes nutzen, um etwas noch Unbekanntes zu verstehen individuelle Kompetenz, als Prädiktor für späteren IQ Zeitpunkt unklar; aber: wenn Erwachsene Lösung vormachen, können Kinder – bei genügend grpßer Ähnlichkeit – diese auf ähnliche Probleme anwenden; 4-6Jährige können nach Problemlösegeschichte das gehörte für ihr eigenes Problem anwenden Beeinflussende Faktoren: Relational shift: jüngere Kinder fokusieren auf perzeptuelle, ältere auf kontextuelle Ähnlichkeit Wissen/Vertrautheit mit der Grundrelation entscheidend, damit Folgerungen möglich Metakognition: explizite Instruktion erleichtert analoges Schlussfolgern Mentale Ressourcen, Gedächtnis etc formales Schlussfolgern : formale, nicht inhaltliche Logik; sowohl Kinder als auch Erwachsene haben Probleme damit Bsp: bei inkongruentem Schluss zw. Wissen und Logik keine formale, sondern wissenschaftliche Lösung, kongruente Schlüsse gut gekonnt wissenschaftliches Schlussfolgern: Piaget: ab Adoleszenz; Hypothesen generieren und testen, etx 6. Klässler können unter Anleitung so schlussfolgern, aber nicht spontan; auch Erwachsene verlassen sich oft auf nicht bewiesenes Wissen (ignorieren Beweise, die gegen ihre Hypothese sprechen) Montada, Kapitel 15: Sprachentwicklung - Sprache und Spracherwerbsaufgaben Spracherwerb als aktiver Induktionsprozess des Kindes; keine bloße Imitation, sondern Regeln werden generalisiert; dies kann implizit ohne Reflexion ablaufen Grundvoraussetzung: innere und äußere Bedingungen Komponenten der Sprache und des Spracherwerbs: Komponente Suprasegmental Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik Sprechakt Diskurs Funktion Intonation, Betonung, rhythmische Gliederung Lautstruktur und –Organisation Regeln der Wortbildung Regeln für Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung Sprachliches Handeln Kohärenz der Konversation Erworbenes Wissen Prosodische Kompetenz Linguistische Kompetenz Pragmatische Kompetenz (kontextadäquat etc.) die wichtigsten Meilensteine der Sprachentwicklung Phonologisch-prosodische Entwicklung Rezeptiv: (von Geburt an in sprachlicher Umwelt) Nach Geburt können schon Laute (ba vs pa) unterschieden werden schon phonologische Kategorien Bis 6 Monate können Laute aller Sprachen unterschieden werden, ab 10 Monaten nicht mehr erfahrungsmäßige Einschränkungen Mit 10 Monaten wichtigste Regeln der Lautkombination gelernt Hohe Sensitivität gegenüber Prosodie: 4 Tage alte Säuglinge unterscheiden allein aufgrund der Prosodie die Muttersprache von Fremdsprache; schon vorgeburtliche Erfahrungen mit Sprache (erinnern sich an Geschichte, die vorgelesen wurde) Präferenz, große Vertrautheit mit Muttersprache Prosodische Strukturierung beeinflusst Präferenz: Mutterstimme nur prosodisch, nicht, wenn monoton bevorzugt Syntax ab 7 Monaten erkannt: präferieren Sätze, an denen die Pausen nach Regeln gesetzt sind, nicht zufällig Intermodale Übereinstimmung muss gegeben sein: erkennen, wenn Laute nicht mit Mundbewegung übereinstimmen Techniken: Habituationsparadigma, Präferenzmethode, Verstärkungslernen (allgemeine Maße: Saugrate, Kopfbewegung, Blickdauer etc.) Produktiv: von Sprachlauten zu Wortproduktion 5 Schritte: Gurren (6-8W.); Lachen und Lautbildung, Vokale imitiert (2-4 Monate); Lallstadium mit kanonischem Lallen, zunehmende Kontrolle über Sprechwerkzeuge (6-9Mon); Erste Wörter (10-14 Mon); 50-Wort-Grenze(18Mon) Wörter anfangs noch ungenau ausgesprochen, da nicht als zusammengesetzte Einheiten betrachtet lexikalische Entwicklung mit 16: Grundwortschatz ca. 60.000 Wörter 9 Wörter pro Tag die ersten 30 Wörter sind sozial (Namen, soz. Beziehung); ab 1,5 J: Benennungsexplosion (wenn bei 2 Jahren noch nicht Störung!); Übergeneralisierung und Überdifferenzierung, bis die hierarchische Organisation der Semantik verstanden wird schneller Worterwerb für Eigenschaften und Objekte: fast mapping= schnelle Zuordnung zw. neuem Wort und vorübergehender (unvollständiger) Bedeutung Wörter können nicht erst erlernt werden, wenn die Konzepte vollständig präsent sind, sondern eher reziproke Beziehung zwischen Sprache und Kognition Induktionsproblem: ein Wort kann viele verschiedene Bedeutungen haben Markman, 1991: ab 18 Monate wird Wörterlernen durch constraints gelenkt, davor einfaches Paar- Assoziationslernen 3 wichtige Constraints: Ganzheitskonstraint: neue Wörter beziehen sich auf ganze Objekte Taxonomieconstraint: Wörter bezeichnen Objekte, die Kategorial verbunden sind (zB: Kinder wählen aus 2 Alternativen ein passendes Bild aus; wenn benennen: taxonomisch, wenn nehmen(=handeln): thematisch) Disjunktionskonstraint: jedes Objekt kann nur eine Bezeichnung haben wenn schon bekannter Name, dann muss neues Wort eine Eigenschaft/ Teil davon sein Kritik: Spezifität der Konstraints? Beschränkungen oder mehr Bevorzugungen? Ursprung der Konstraints? Erklärt nur das Erlernen von Nomen Erweiterung: schneller Erwerb von Verben durch syntaktische Konstraints: Wortbedeutung wird durch Syntax unterstützend vermittelt (Transitivität, Stellung etc.) - - - Von Wörtern zu Sätzen Ab 18 Monaten: produktive Grammatik; davor wird die Wortordnung schon für Interpretation benutzt (Video, das mit vorgelesenem Satz übereinstimmt, wird länger betrachtet als inkongruentes Video) Ab ca. 2 Jahren: 2-und 3-Wortsätze mit 4 Hauptmerkmalen: Telegraphischer Stil, der nur im Kontext verstanden werden kann Schon verschiedene Relationen der Handelnden zu den Objekten repräsentiert (geben, nehmen, behandeln, etc) Formale Wortordnungen werden fehlerlos beachtet (nie Adjektive vor Pronomen, zB schön sie) nicht Semantik, sondern formale Ordnung als Kriterium (Bsp für implizite Grammatik: Karmiloff-Smith, 1979: weiblich aussehende Phantasietierchen mit männlicher Wortendung werden von Kindern mit männlichem ( grammatischem) Artikel ausgestattet Fortschritte der morpho-syntaktischen Fähigkeiten: ab 4 Jahren gute Satzkonstruktion, davor oft falsche Strategien angewendet, die linguistisch nicht analysieren; BSP: bei passiver Satzkonstruktion wird Reihenfolge der Nomen als ausschlaggebend gesehen Karmiloff-Smith: 3PhasenModell des expliziten Sprachwissens: 5 Jahre: Sprachinfo aus Umwelt wird verarbeitet, aber noch implizit, keine Reflexion über Sprachgebrauch 6 Jahre: Hinwendung nach innen: Reorganisationsprozess, Fehler, spontane (unbewusste) Korrekturen 8 Jahre: explizites Sprachwissen, bewusste Reflexion über Sprache, Erklären von Regeln Entwicklung der pragmatischen Kompetenz: situations- und kontextpassender Sprachgebrauch soziokulturelles Wissen, Gefühle anderer müssen bekannt sein Kompetenzen schon früh vorhanden (vgl. Piaget!); zB Sprache/ Prosodie dem Gegenüber anpassen, Dialog etc.; aber noch keine Anpassung an den Inhalt des Partners Ab 2 Jahren nimmt Länge der Konverstion zu Nach Hoff-Ginsberg (1993): 3 Phasen von Kommunikation zu Sprache: 8-10 Monate: Kommunikation per Gesten (Protoimperative und –deklarative) 11. LM: Zeigen wird systematisch für die Kommunikation eingesetzt, Erwartung einer Replik 16-22 LM: Intentionen werden sprachlich ausgedrückt Erklärungsproblem: angeboren vs. erworben? Grundüberzeugungen verschiedener Theorien: Sprache ist humansprzifisch mit biologischer Basis Kind ist für Erwerbsprozess vorbereitet Ohne sprachliche Umwelt ist Erwerbsprozess nicht möglich Innere und äußere Faktoren müssen zusammenwirken 2 große Theoriefamilien: Inside-Out-Theorien: hochabstraktes grammatisches Wissen ist angeboren als autonomen Modul ( eigenständiger Prozess); Umweltsprache triggert den Erwerbsprozess und spezifiziert die Universalgrammatik Outside-In-Theorien: betonen generelle Lernmechanismen; Sprache als Ergebnis der kognitiven Entwicklung (Piaget) oder sozial interaktive Theorien: Sprachmuster entsteht durch zuvor erworbenes kommunikatives Muster Steigbügelhaltertheorien: erklären nur kleinere Phänomene, wie mit schon bekannten Konzepten neue erworben werden können Voraussetzungen und Bedingungen für den erfolgreichen Spracherwerb a) Spracherwerb als biologisch fundierter, eigenständiger Bereich Spracherwerb ist humanspezifisch Primaten erlernen keine grammatischen Strukturen Fähigkeit zum Spracherwerb sehr robust: gehörlose Kinder, die mit Lippenablesen erzogen wurden, entwickeln zum gleichen Zeitpunkt wie hörende Kinder Gesten; 2-3-Wort-Gesten Erwerb strukturierter Zeichensysteme mit Morphologie und Syntax! Bei linker Hemisphärektomie: keine generellen Sprachdefizite,meist syntaktische Defizite Erwerb der Sprache ist auch bei eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten möglich b) Kognitive Voraussetzungen: keine generellen Zusammenhänge zw. Spracherwerb und kognitiven Leistungen, aber spezifische Wechselwirkungen: Entwicklungsunterschiede in kognitiver Leistung korrelieren mit Differenzen im Sprachangebot speziell: Englische Kinder lösen Kategorisierungsaufgaben besser, weil Englisch auf Nomen zentrier; Koreanische Kinder: Mittel-Zweck-Aufgaben, da Verben bedeutsamer phonologisches Arbeitsgedächtnis als wichtigste Voraussetzung für Spracherwerb c) sozial-kognitive Voraussetzungen: gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus und Imitation sprachlicher Laute gehen der Sprache voraus und prädiktieren ihren Erfolg Gesten als Vorgänger: 3 Typen kontextgebundene Protoimperative und Deklarative; Referentielle Gesten, Konventionalisierte Gesten d) sozial-kommunikative Voraussetzungen: Sprachangebot und sprachliche Interaktion: Basis für Spracherwerb: positive emotionale Beziehung zur Mutter Bis 12 Mon.: Ammensprache intuitives, kulturunabhängiges Elternprogramm Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus begrenzt die Info, so dass soziale Routinen entstehen, die den Spracherwerb unterstützen (Wortschatz) Dialog wichtig: Mutter macht Kind auf Kontingenzen zw. Verhalten und Effekt aufmerksam und schafft so eine geordnete Erfahrungswelt, die ja durch Sprache „bearbeitet“ werden soll; wichtig: Kind muss Info selbst verarbeiten, lernt aktiv am Modell mit Sprachlehre und konstruktiver Rückmeldung (motherese für Grammatik) Montada, Kapitel 12:Entwicklung des begrifflichen Wissens; Gsowami: So denken Kinder (1) Theorien begrifflicher Repräsentationen a) Merkmalsbasierte Ansätze: Deterministisch – Problem: manche Begriffe haben keine Kriterien (zB Spiel) probabilistische Repräsentation – erklärt, warum manche Exemplare bessere Vertreter einer Kategorie sind; Reorganisationshypothese: Begriffe werden erst typisch, dann definierend wegen Erfahrungsänderung repräsentiert; deshalb für jeden Begriff individuelle Veränderung b) theoriebasierte Ansätze: begriffliches Wissen ist in Grunddomänen eingebettet und besteht deshalb aus Merkmalsassoziationen, aber auch aus kausalen Relationen c) Kategorien: Def. Neisser: Menge von Dingen werden als adäquat betrachtet, man reagiert gleich auf sie durch Kategorisierung sind direkt Erkennbares und Theorien über Objekte gegeben Hierarchische Struktur: global, basal, detailliert Kinder haben aufgrund mangelnder Erfahrung engere/weitere basale Kategorien als Erwachsene, prinzipielles Vorgehen (Form, Strukturzuordnung) ist aber gleich Rosch, 1975: Zentrale Rolle der basalen Ebene: durch regelmäßiges Auftreten von best. Merkmalskombinationen (perzeptuell) sind Objekte in die basale Ebene am leichtesten einzuordnen diese Prototypen geben die meiste Info mit dem wenigsten Aufwand wieder (also: Kategorien als perzeptuelle Prototypen organisiert) o sequentielles Berühren, Bauer und Mandler (1988): 12-15 Mon. kategorisieren auf basaler Ebene (Hunde vs. Fahrzeuge), aber die übergeordneten Ebenen müssen unterschiedlich sein o matching-to-sample-Aufgabe: ein Zielobjekt, 2 Vergleichsobjekte Kinder kategorisieren sowohl übergeordnet als auch basal richtig Mandler, 1991: zuerst werden Begriffe auf globaler Ebene gebildet, die sich dann allmählich ausdifferenzieren: nur 31 Mon. können Hunde und Pferde, die sich perzeptuell sehr ähnlich sind, auseinanderhalten, Hund und Fische können schon 19 Mon. auseinander halten, da niedrige perzeptuelle Übereinstimmung o Weiteres Experiment: Kinder untersuchen mit der Hand Objekte aus unterschiedlichen basalen Kategorien nicht länger, aber aus unterschiedlichen globalen Kategorien schon Perzeptuelle und strukturelle Ähnlichkeit oft hoch, aber nicht zwingend 2Jährige haben bei perzeptuell ähnlichen, strukturell verschiedenen Objekten Probleme, diese verschiedenen Kategorien zuzuordnen; bei verbalen Hinweisen aber (Das ist ein Vogel, macht er...?) kategorisieren sie strukturell o Sprache als nützliches Klassifikationskriterium auf über- oder untergeordneter Ebene, da diese Ebenen am meisten kulturell beeinflusst sind: Nomen global; Adjektive untergeordnet; durch Sprache also auch Relationen zwischen den Objekten gelernt Kategorien werden als Prototypen (= typischste Merkmalsträger) gespeichert: künstliche Kategorien werden vorgegeben, darunter sind Figuren, die typischer sind als andere Kinder, die die typischsten Merkmale lernten, kategorisierten nachher genauer als Kinder, die die Kategorien anhand von untypischen Exemplaren erlernten (2) Repräsentationale Entwicklung Säuglingsalter Begriffe notwendig für Organisation und Reduktion der Info Säuglinge haben Sprachlautkategorien, Gesichtsausdrüvke, Farben Kategorien als Basis für induktives Schließen: spezielle, auf Erfahrung basierende Erwartungen über Funktionen und Eigenschaften von Objekten werden aufgebaut (zB Rassel schütteln nur ähnliche Objekte werden geschüttelt) Auch Säuglinge (11Mon.) können konzeptuell, nicht nur perzeptuell sortieren (Reagieren bei Objektexamination auf Änderung der Kategorie) Kernwissen entweder angeboren oder im ersten LJ erworben Weitere Entwicklung Inhalt der Begriffe ändert sich quantitativ, oft auch qualitativ Verschiedene Theorien: Bruner (1966): Kinder bilden perzeptuelle Begriffe; Wygotski (1962): Wandel von thematisch zu taxonomisch; Piaget (1951): von konkret zu abstrakt - - - Aber: schon 1Jährige können bei entsprechender Instruktion taxonomisch sortieren („Wähle das, das so wie der Hund ist Knochen vs. Katze“); sortieren nur spontan thematisch begriffliches Wissen ist kategorial repräsentiert 3-4J. haben abstrakte Konzepte gebildet, auf deren Grundlage sie induktiv schließen können Begriffe basieren nicht nur auf Anschauung, sondern auch auf Wissen (zB alle Vögel machen piieep; macht dieser (atypische) Vogel piieep?) Veränderung von Begriffen: Carey und Spelke, 1994: zwischen den Konzepten werden Zusammenhänge hergestellt Objekte vieler Systeme werden in Beziehung gesetzt (=mapping); Wellman und Gelman, 1997: gleichzeitig werden mehrere alternative Begriffsgerüste aufgebaut, Begriffe können in mehreren Systemen auftreten Vergleich, Verschmelzung, Erneuerung (kulturabhängig, weil lernabhängig!) (3) Wissensentwicklung in den grundlegenden Domänen a) theoretische Annahmen Modell der Expertisewissens: Kind als universeller Novize kognitive Entwicklung als Erwerb von domänenspezifischem Wissen; Menge abhängig von Infoverfügbarkeit und Übungsgelegenheit Modularitätstheorien: es gibt angeborene, von Geburt an spezifizierte Module; Input aus Umwelt regt Module Verarbeitung an; Wahrnehmung und Kognition sind durch diese starren Verarbeitungsmechanismen aneinandergekoppelt Entwicklung folgt biologischen Prinzipien und ist auf festes Ziel fixiert; Erwachsene = Kinder Theorie-Theorie: kognitive Entwicklung des Kindes als Wandel intuitiver domänenspezifischer Theorien; Erfahrung verändert Theorien; Wissen der Kinder ist anders als Wissen der Erwachsenen b) intuitive Physik: basales Wissen mit 4 Mon: Wissen über Kontinuität und Solidität (Spelke, 1992: Ball rollt hinter Schirm, bleibt vor Sperre liegen oder liegt bei Aufheben der Schirms dahinter Kinder habituieren an das physikalisch unmögliche Ereignis) mit 6 Mon. verstehen Säuglinge mechanistische/ kausale Verursachungen (Kugel A stößt Kugel B an) ab 12 Mon. sind raum-zeitliche Objekteigenschaften (Identität) und Bewegungshinweise für Objekterkennung genug; davor wird Info über Identität vernachlässigt, wenn raum-zeitl. Kontinuität gegeben (10 Mon. Kinder wundern sich nicht, wenn ein Auto hinter den Schirm fährt und eine Ente rauskommt) 4 Mon. haben keine Intuition über Schwerkraft oder Trägheit: dishabituieren nicht, wenn Ball in der Luft stehen bleibt (Spelke: Trägheit gehört nicht zum Kernwissen; Erwachsene haben gleiches, nur mehr Kernwissen wie Kinder; Baillargeon, 1995: domänenspezifische Mechanismen und Erfahrung führen zu Abstraktion und Integration der Information) o Fazit: Kinder und Erwachsene haben ungefähr dieselben Intuitionen über Physik! c) Entwicklung physikalischen Wissens intuitive Theorien enthalten Fehlvorstellungen über physikalische Phänomene, die erst über lange Zeit hinweg verändert werden, nicht punktuell (zuerst Ignorieren der Gegenevidenz; zB Annahme, dass Schwerpunkt immer in der Mitte ist, auch wenn sichtlicher Gegenbeweis) Kinder differenzieren nicht zw. Begriffen Gewicht und Dichte: 8-10J. ordnen verschiedene Aluminium- und Stahlzylinder nicht nach Material, sondern nach Gewicht undifferenziertes Konzept; mögliche Erklärung von Carey: Begriffsystem muss umstrukturiert werden: Kinder sehen einen Zylinder als eine Einheit, Erwachsene können ihn als aus vielen Teilchen zusammengesetzt betrachten Fazit: Grundlagen des physikalischen Weltbildes werden früh erworben (evt. Sogar angeboren), Veränderungen graduell oder radikal ;-)) d) Intuitive Psychologie (Theory of Mind) Vorläufer des mentalen Wissens schon bei 9-12Mon. ausgeprägt: Beginn des Verständnis des intentionalen Agenten, in triadischen Situationen Ab 18 Mon. führen Kinder fehlerhafte Handlungen des Modells korrekt zum Ende; Empathie Differenzierung zw. eigenen und fremden Gefühlen; Symbolspiel (2 verschd. Welten) vgl. Piaget!! Schon 3Jährige wissen, dass Handlungsentscheidungen von Wünschen, Zielen des Agenten abhängig sind und deshalb vorhersagbar oder erklärbar sind Verständnis falschen Glaubens: Wimmer und Perner (1983): Maxi-Geschichte/ Smartiesschachtel mit Bleistiften 3Jährige konsistent falsch, 4/5J. leiten richtige Vorhersagen ab vor vier Jahren ist der Begriff „Überzeugung“ nicht repräsentiert - Erst ab 4 Jahren können Kinder beabsichtigt lügen/ täuschen: 3J. können nicht im Spiel mogeln, verstehen den Zweck der Täuschungsstrategie nicht (ab 4: gerne geschummelt ;-)) Ab 4 Differenzierung zw. Aussehen und Realität (zB Apfelkerze als Form vs. Funktion), autistische Kinder finden keine Lösung auf die false belief- Aufgaben Ab 6 Jahren wissen Kinder, ob sie ein Wort gerade neu gelernt haben, oder schon immer kennen (e) intuitive Biologie Unterschiede zw. Gegenständen und Lebewesen: Bewegungsmuster: Berenthal (1985): 5 Mon Babys dishabituieren auf Licht-Punkt-Muster, die eine aufrechte, gehende Person, nicht aber Zufälliges darstellen (Verdeckungseffekt wichtig); Regelmäßige, vorhersehbare Bewegungen werden von Kindern und Erwachsenen Maschinen zugeschrieben, unregelmäßige den Menschen; selbstgenerierte Bewegung als Kriterium für belebte Objekte (3-4J können das, auch wenn Füße an Unbelebtem oder keine an Belebtem zu sehen) Wachstum: Lebewesen werden größer und abgenutzter, Artefakte bleiben gleich (ab ca. 3 J. gekonnt: Rosengren (1991), Photos von Tierbabys und neuen Gegenständen, dann kleinere, größere oder gleiche Bilder (mit gealterten Tieren) Artefakte werden oft noch als größerwerdend eingestuft, bei Tieren keine Probleme Kerneigenschaften: 4J. können zw. äußeren und inneren Widersprüchen differenzieren: Kinder sollen sagen, welche von 3 Objekten sich innerlich, welche sich äußerlich gleichen; Kinder schreiben belebten Objekten innen Blut, Knochen etc zu, unbelebte sind bei ihnen innen gleich wie außen Keil, 1994: Lebewesen werden anhand ihrer Struktur kategorisiert, Artefakte aufgrund von Funktion: Kinder trennen unterschiedlich aussehende Lebewesen einer Art (Maus), nicht Radiogerät; ihre Erklärung: passen nicht so gut zusammen Analogie zum Menschen als wichtige Herleitung zum Verstehen biologischer Mechanismen: Lebewesen, die dem Menschen am ähnlichsten sind, werden ähnlichere physiologische Prozesse unterstellt als unähnlichen (Inagahi und Hatano, 1987) Vererbung: Gelman und Wellman, 1991: Kinder wissen, dass Känguru, das unter Ziegen aufwächst, trotzdem später einen Beutel hat, springt; Keil (1989): Operationen (Löwe Bart weg) führen für jüngere Kinder zu Identitätsveränderung ( Tiger), ab 7 nicht mehr; Kinder wissen, dass bestimmte Eigenschaften vererbt werden (Augenfarbe), andere nicht (Schnelligkeit) Natürliche Ursachen: schon 4J. wissen, dass Ereignisse unabhängig vom Menschen entstehen können; dieses Wissen wird mehr erschlossen als beobachtet - (4) Fazit: Ähnliche Begriffe Erwachsener und Kinder Bei Kategoriebildung sind typische Begriffe erst wichtiger, später definierende Säuglinge bilden Begriffe als Basis für induktives Schließen Ende 1.LJ: Konzepte sind wissensbasiert In allen Domänen frühes und spezifisches Wissen, das eine Restrukturierung erfährt Entwicklung des begrifflichen Denkens aus verschd. Infoquellen gespeist: Wahrnehmung, Sprache, Ursachenerklärungen suchen, Analogien Bjorklund & Pelegrini: Child Development and Evolutionary Psychologie; Bjorklund, Kapitel 2: Biological bases of Cognitive Development - (1) Evolutionspsychologie beschreibt die Expression angelegter Programme in sozialer und physikalischer Interaktion in der Ontogenese Annahme, dass individuelle Unterschiede nicht wegen verschiedenen Erfahrungen, sondern wegen adaptiver Antworten auf Umweltdruck zustande kommen Evolution = Genfrequenzen werden über Generationen verändert Darwin, 1859: 3 Basisprinzipien: Negative und positive Selektion: mehr Mitglieder einer Art werden geboren als überleben Variation der Eigenschaften Eigenschaften können vererbt werden, die dem Überleben und der Reproduktion dienen (wenn Nutzen größer als Kosten) Inklusive Fitness: Einfluss eines Individuums auf Anteil der Überlebenden, die seine Gene tragen (zB Enkel) 3 Produkte der Evolution: Adaptationen, Nebenprodukte, zufällige Effekte - - (2) EPM- Evolutionäre Psychologische Mechanismen Cosmides und Toobey, 1987: kognitive Prozesse in Interaktion mit dem Umweltinput erzeugen Verhalten; kognitive Prozesse werden durch EPM gesteuert Darwinistischer Algorithmus EPM- Entstehung: durch Infoverarbeitung werden spezifische Probleme gelöst domänenspezifische EPM, modular angelegt; dadurch ist Lernen beschränkt, aber nützlicher Filter für Kernwissen Kognitive Unreife ist adaptiv: zB begrenztes Arbeitsgedächtnis kann Spracherwerb erleichtern Durch Selektionsdruck zu verschiedenen Zeiten können manche gerade benötigten Verhaltensweisen optimiert werden, die später nicht mehr gebraucht werden (zB Saugreflex) Lernprozesse sind also immer auf ein festgelegtes Ende ausgerichtet (Problem gelöst) Trotzdem Flexibilität möglich, da verschiedene Umwelten zu verschiedener Expression der Gene führt (zB Nervenzellen des Gehirns, die nicht in Umwelt gebraucht werden, sterben ab) neue Probleme fördern die Weiterentwicklung der EPM EPM vor 10.000 Jahren entwickelt erklärt manche heutige Schwierigkeiten, zB Aufmekrsamkeitsdefizite, Hyperaktivität David Geary, 1995: biologisch primäre Fähigkeiten: universell, motiviert ausgeführt, zB Sprache; biologisch sekundäre Fähigkeiten: kulturspezifisch, braucht externe Motivation, zB lesen Beispiel: Theory of Mind- Entwicklung: 4 Module, die sich nacheinander entwickeln: Intentionsdetektor, Augenrichtungsdetektor (bis 9Mon), Geteilter Aufmerksamkeitsmechanismus (bis 18Mon), TOM- Modul bis 48 Monate (3) Modelle der Gen- Umwelt- Interaktion a) Ansatz der Systementwicklung: Organismen entwickeln sich in Interaktion mit der Umwelt; kein biologischer Determinismus, sondern bidirektionale Beziehung: genetische Aktivität strukturelle Reifung Funktion, Aktivität Kernkonzept von Gottlieb, 1991: Epigenese: Entstehen neuer Strukturen und Funktionen während der Entwicklung jede Entwicklung ist das Produkt der Epigenese Plastizität und Grenzen der Entwicklung: speziestypische Umwelt und speziestypisches Genom: EPM entwickeln sich erst, wenn über mehrere Generationen hinweg stabile Umweltgegebenheiten erwartet werden können, weil sie dann antizipiert werden schon Lösungen gegeben Erfahrungen in speziestypischer Umwelt dient dazu, die speziestypische Entwicklung zu fördern Notwendigkeit der typischen Umwelt für normale Entwicklung (zB Kücken hören sich und andere nicht erkennen Artgenossen nicht); Veränderung der frühen Umgebung kann das speziestypische Verhalten ändern (ungewohnte Stimulation vor allem in kritischen Perioden gefährlich!) b) die Genotyp- Umwelt- Theorie (Scarr & McCartney) Genotyp wählt die Umwelt und Erfahrungen aus, denen man begegnet 3 Typen von G.-U.- Effekten: passiver Effekt: Eltern liefern Umwelt nimmt mit Alter/ Selbständigkeit ab evokativer Effekt: Genotyp des Kindes ruft Antworten hervor konstant aktiver Effekt: Genotyp bestimmt die Umwelt, in der man Erfahrungen macht nimmt mit Alter zu Einfluss des Erziehungsstiles der Eltern recht gering, da Kinder es weltweit schaffen, sich erfolgreich zu vermehren! Fazit: beide Ansätze betonen bidirektionale Beziehung, aber einmal modifiziert Erfahrung den Organismus, einmal der Organismus die Erfahrung - (4) die Entwicklung des Gehirns menschliche und tierische Strukturen gleich, unterschiedlich sind Anteile des Neokortex (v.a. Frontalkortex) und lange postnatale Wachstumsphase 350g bei Geburt, 1400g bei Erwachsenen; 6 Mon: 50 % des Erwachsenengewichtes, 2J. 75%, 5J. 90%, 10J. 95% Neuronale Entwicklung: Proliferation (Zellbildung, bis 7Mon. nach Empfängnis); Migration (Wanderung zum Bestimmungsort, grobe Strukturen gebildet), Differenzierung (lebenslang, v.a. in ersten LJ); selektiver Zelltod durch Erfahrung; experience expectant processes schon vorbereitete typische Umwelt erleichtert Verarbeitung bestimmter Reize; experience dependant processes individuelle Erfahrungen, individuelle Synapsen neuronaler Darwinismus: Erfahrung formt das Gehirn endgültig: Neuronengruppen sprechen auf bestimmte Reize an und gruppieren sich entsprechend, bis festgefügte Strukturen entstehen, die auch wieder die Informationsaufnahme steuern nicht allein genetisch bedingt metabolitische Arbeit im Gehirn am größten zw. 4 und 5 Jahren, da hier am meisten neues gelernt werden muss Myelinisierung: steigt allmählich an, zuerst sensorische Strukturen, dann motorische, später erst integrative; verbessert die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Genauigkeit der Weiterleitung (weniger Interferenz); Ausmaß der M. beeinflusst durch Erfahrung (bis zu 20% mehr) Cerebrale Lateralisation: allmählicher Prozess in der Kindheit; zB Sprache links, weil linke Hemisphäre im Uterus früher entwickelt ist, wenn auch auditives System reif ist spricht auf akustische Reize an und verarbeitet diese; Lateralisation steigt mit Alter (weil zuverlässig), aber interindividuelle Differenzen Plastizität des Gehirns: anfangs ist Plastizität am größten, da die meisten Verbindungen noch möglich sind; wenn generelle Gehirnschäden besser kompensierbar bei älteren Menschen; wenn spezielle Funktionen betroffen sind, besser bei Kindern kompensiert Durch langsames Gehirnwachstum Plastizität des Verhaltens möglich (zB unter Deprivation aufgewachsene, später adoptierte Kinder haben sich verbessert, zB bzgl. IQ) Durch Unreife können automatische Prozesse erst spät einsetzen, was sehr flexibel macht Musik hängt mit mathematischen etc. Fähigkeiten zusammen (Förderung im musischen Bereich verbessert Matheleistungen!) - (5) Geschlechterunterschiede und deren Vorläufer Reproduktion: Frauen bevorzugen ältere Männer, Männer jüngere – weil reproduktivere – Frauen Frauen investieren mehr in Nachkommen/ Aufzucht als Männer Frauen haben andere Aggression als Männer (Verbünden vs. Gewalt auch bei Partnerwerbung, da nicht alle Männer eine Frau bekommen) Frauen kontrollieren ihr soziales und sexuelles Verhalten mehr, weil sie mehr in Beziehungen investieren müssen Kindliches Spiel als Vorbereitung auf spätere Rollen (Kämpfen vs. Puppe) Shaffer, Kapitel 3+ 4: Social and Emotional/ Personality Development; Montada, Kapitel 10: vorgeburtliche Entwicklung 1. Übersicht über die emotionale Entwicklung Emotionen wiedergeben: Entwicklung und Regulation des emt. Ausdrucks schon Neugeborene kommunizieren über emt. Gesichtsausdruck und Vokalisation Basisemotionen: schon von Geburt an vorhanden (Interesse, Kummer, Ekel, Zufriedenheit) 2,5Mon: Ärger, Traurigkeit, Überraschung, Angst, Freude 2. LJ: komplexe Emotionen selbstbewusste Emt wie Verlegenheit (erfordert Widererkennen im Spiegel); selbstbewertende Emt wie Scham (erfordern zusätzlich Normen; erst im Schulalter internalisiert also auch ohne Anwesenheit von Erwachsenen gezeigt) jede Gesellschaft hat eigene emotionale Ausdrucksnormen (emt. Display rules) wann welcher Ausdruck gezeigt werden soll und Unterdrückung des empfundenen Ausdrucks ab 3 J erste Anzeichen, Elterliches Verhalten beeinflusst dabei das emt. Verhalten des Kindes (Mütter bekräftigen besonders positives Verhalten Kind kann besser unterdrücken) 7-9J. Probleme, Enttäuschung zu verbergen; 12-13j: können Ärger nicht gut unterdrücken emotionale Selbstregulation: Neugeborene: können sich von unbeliebtem Stimulus wegdrehen 6 Mon. Geschlechterunterschiede; Jungen können negative Emt schlechter regulieren/ unterdrücken 18 Mon. Schwierigkeit bei Angstregulation, aber allgemein durch Sprache Regulation erleichtert (Kommunikation mit Erwachsenen über Gefühle; Ablenkung) wenn viel mit 3J. über Emt geredet, dann kann das Kind später besser Emt. anderer interpretieren 2-6J: Strategien wie Ablenken, gute Gedanken, andere Interpretationen, Intensivieren der Emt. Emotionen erkennen und interpretieren schon Neugeborene reagieren auf emt. Stimmen (zB mit anderen schreienden Babys mitschreien) social referencing: Emt anderer werden genutzt, um die ambivalente Situation einzuschätzen Rückversicherungsblicke ab 8-10 Mon.; gleichzeitig wird die emt. Vokalisation interpretiert ab 2J: Kinder schauen nach Ausführen der Handlung zu Eltern Emotionen dienen als Erinnerungshilfen: Fagan und Prigot, 1993: Kinder habituieren an ein Mobile mit 10 Elemente, später bekommen sie eines mit 2 Elementen gezeigt weinen; beim späteren Test wird nur das mit den 10 Elementen erinnert, wenn die Babys nicht weinen enge Verknüpfung zw. Emotion und Ereignis 4-5J: Körperbewegung wird für Emterkennung genutzt; Gründe für Emt. werden extern gesucht 6-8J: verstehen, dass es konkurrierende Emt. gibt, die sich in verschiedenen Verhaltensaspekten zeigen 8J. verstehen, dass verschiedene Menschen eine Situation als anders emt. einschätzen Emotion und frühe soziale Entwicklung kommunikative Funktion; beeinflusst auch das Elternverhalten Wissen wird ohne Erfahrung durch social referencing erlangt Schlussfolgerungen über das eigene angebrachte Verhalten erforderlich 2. Individuelle Unterschiede: Temperament Def: charakteristische Art und Weise einer Person, auf Umweltereignisse mit best. Verhalten und Emotionen zu reagieren ( prädiktiv) 5 Komponenten: Aktivitätslevel, Irritabilität, Angst, Soziabilität, Beruhigung Temperamentbewertungen sind kulturabhängig (zB Zurückhaltung) entscheidend für Ausprägung sind mäßig die Gene, bedeutender die nicht geteilten Erfahrungen Aktivitätslevel, Irritabilität, Angst, Soziabilität sind mäßig stabil; BSP: Kagan, 1992: Verhaltensinhibition (Tendenz, sich von Ungewohntem zurückzuziehen) ist für die Extreme des Kontinuums recht stabil, also vorhersagbar Thomas und Chess, 1977: unterscheiden 3 Temperamentsprofile: Leichtes Temperament: gleichmäßig, positiv, offen für Neues Schwieriges Temp.: aktiv, irritabel, unregelmäßig, wenig offen für Neues Slow-to-warm-up Temp.: inaktiv, langsam Profil beeinflusst die Anpassung an verschiedene Situationen (Interaktionen…), ruft verschiedene Reaktionen hervor - Stabilität abhängig vom Typ des Kindes/ passender Erziehung/ Eltern 3. emotionale Bindung bonding Bindung ist reziprok (Kosten/ Nutzen), verändert das soziale Verhalten des Kindes Klaus und Kennell, 1976: ersten Stunden nach Geburt als sensible Periode für Bindung? o Mütter, die ihre Kinder in den ersten Tagen mehr sehen/ kontaktieren, haben mit 1Mon. mehr zärtlichen Austausch, Kinder sind physikalisch und mental kompetenter als in Kontrollgruppe früher Kontakt notwendig für normale Entwicklung? nein, da zB auch Adoptiveltern starke emt. Bindung zu ihren adoptierten Kindern haben Verschiedene Erklärungen für die frühe elterliche Bindung: Kennell: Hormone veranlassen Bindung (Problem: Väter?) Ethologen (Bowlby): biologische Disposition, das Baby positiv aufzunehmen (gut für unerfahrene Eltern) Sozialpsychologen: durch Geburt in starke emotionale Erregung gesetzt Fehlattribution der Emotionen auf das Kind wichtiger Beitrag zur Bindung: synchronisierte Routinen ( sensible Anpassung des Verhaltens der Mutter an das des Kindes in Interaktionen); werden in den ersten Monaten mit Versorger ausgebildet schafft Zuneigung, Vertrautheit, gute Beziehung attachement Shaffer & Emmerson, 1964: 4 Stufen der emotionalen Bindung (Bindung= entspr. Protestreaktion auf Trennung von der Bezugsperson) Asoziale Phase (0-6W): Kinder antworten auf soziale und nicht- soziale Stimuli Indiskriminierte Bindung (bis 7Mon): soziale Stimuli bevorzugt, Protest gegen Verlassenwerden, Bindung an viele spezifische Bindung (7-9Mon): Bindung an eine Person stellt sichere Basis für Explorationsverhalten dar (Ainsworth, 1979) Multiple Bindung, zB an Vater, Geschwister (bis 18Mon) Ansätze verschiedener Bindungstheorien 1. Psychoanalyse: Ich liebe dich, weil du mich fütterst Freud: Kleinkind in oraler Phase Befriedigung beim Saugen Bindung an Mutter Erikson: generelle Sensibilität Urvertrauen vs. Urmisstrauen durch Mutter vermittelt Verdienst: Interaktion wichtig für Bindung, vertrauenswürdige Personen 2. Lerntheorie: Belohnung führt zu Liebe Kinder binden sich an die Personen, die ihre Bedürfnisse befriedigen Kind assoziiert Mutter immer mit Positivem Mutter wird zum sekundären Verstärker o aber: Harlow zeigt im Affenexperiment, dass Nahrung nicht die Voraussetzung für Bindung ist! 3. kognitive Entwicklungspsychologie: Bindung ist abhängig von der individuellen Entwicklung Kind muss OP kennen, damit es vermissen kann (7-9Mon!) Exp. von Lester (1974): 9Mon. bekommen OP-Test, danach werden sie kurz von der Mutter getrennt nur Kinder mit gut vorhandener OP zeigen starke Reaktion auf Trennung sind gebunden 4. Ethologen: Bowlby: Bindungsverhalten angeboren, damit Überleben/ Reproduktion sowohl Kinder als auch Eltern sind biologisch vorbereitet (Kindchenschema, Reflexlächeln, Saugen); aber: Lernerfahrung für Eltern schrittweise, Kinder lernen, richtig zu antworten Bindung geschieht nicht automatisch! Verdienst: timing wichtig, Kinder als aktive Teilnehmer bindungsbezogene Ängste Fremdeln (Spitze bei 8-10Mon, Abfall bis 2J.) und Trennungsangst (6-8Mon, Spitze bei 14-18Mon, weniger bis Grundschule) aber: in Uganda frühere Trennungsangst, da Mütter die Kinder immer bei sich haben Erklärungsansätze: 1. Konditionierte- Angst- Hypothese: (Psychoanalyse und soz. Lernen) Kinder assoziieren Negatives mit Abwesenheit der Mutter Fremdeln als Ausweitung: Angst, die Bezugsperson zu verlieren Kritik: Uganda- Phänomen nicht erklärbar, Trennungsangst zu Hause ist weniger schlimm als anderswo 2. Ethologen: manche Situationen sind evolutionär angstauslösend biologisch programmiert; fremde Gesichter als Feinde, fremde Umgebung als Trennung interpretiert Auftreten nicht bei Geburt, da Vertrautes und Fremdes erst gelernt werden muss! erklärt das Uganda- Phänomen (da Trennung etwas sehr Unvertrautes ist) absinken im 2. LJ, da durch die sichere Basis die Entfernung von der Bezugsperson selbst initiiert wird und Fremdes so sicher bekannt werden kann 3. Kognitive Entwicklungspsychologie: Kagan, 1972: Kinder protestieren gegen Trennung, wenn Unsicherheit über den Aufenthaltsort der Mutter o normalerweise stabile Schemata über Bezugsperson und Orte (ab 6-10Mon); zu Hause also nicht so viel Trennungsangst, da mögliche Verbleibs- Erklärungen Exp. von Carter et al. (1980) : 9Mon. und Mutter in fremdem Raum, Mutter geht in Raum B Kind weint nicht, sondern sucht sie dort; wieder im selben Raum Mutter geht in Raum C, Kind sucht in Raum B und weint, weil Schema verletzt keine Erklärung da Suche nicht da, wo die Mutter wahrgenommen wurde, sondern wo sie „gedacht“ wurde 4. Ethologie – und moderne evolutionäre Perspektiven Ethologie (oder: warum wir alle gleich sind) Ethologie = Wissenschaft der bioevolutionären Basis unseres Verhaltens und unserer Entwicklung Unterschied zur klassischen Evolutionstheorie: nicht Überleben der Art/ Weitergabe der Gene sichern Klassische Annahmen: Biologisch programmiertes Verhalten angeboren (Produkte der Evolution, adaptiv für das individuelle Überleben) Programme entwickeln sich durch natürliche Selektion Alle Mitglieder einer Spezies haben dieselben Programme und entwickeln sich deshalb gleich John Bowlby (1969): Menschen haben vorprogrammiertes Verhalten, das bestimmte Erfahrungen und so die normale Entwicklung sichert (Bsp: Schreien des Babys signalisiert Bedürftigkeit und Kontakt zu anderen Menschen sichert soziale und emt. Entwicklung) Wichtig: Entwicklung ist ohne Lernerfahrung nicht möglich (Bsp: Kind muss erst lernen, zwischen Vertrautem und Fremden zu unterscheiden, erst dann ist Bindung sinnvoll) Kritische Perioden: genau umgrenzte Zeit, in der der Organismus einmalig sensibel ist ggüber spezifischen Umwelteinflüssen (spätere Erfahrungen erfolglos) Sensible Periode: optimale Zeit für Entwicklung; Ausbildung des Verhaltens außerhalb möglich, wenn auch schwerer Bowlby: erste 3 Jahre als kritische Periode für soziales und emotionales Verhalten Verhaltensgenetik: Biologische Basis für individuelle Unterschiede Interaktion von Genotyp und Umwelt Determination von unterschiedlichen Verhaltensweisen trotz gleicher genetische Ausstattung Methoden, um erblichen Einfluss zu schätzen: Selektive Züchtung, Zwillings- und Adoptionsstudien Methoden, um Einfluss von Genen und Umwelt zu schätzen: Konkordanzraten bei diskreten Merkmalen (Zwillinge); bei kontinuierlichen Merkmalen: Korrelationskoeffizient, Erblichkeitskoeffizient, non-sharedenvironment, shared –environment sind Populationsschätzer! Genetische Dispositionen zu: Intro-und Extraversion; Empathie; Schizophrenie; Alkoholismus, Kriminalität, Depression, Hyperaktivität, Psychosen und neurotische Störungen ABER: genetische Veranlagung wird meist erst bei extremen Umweltbelastungen ausgelebt Fazit: die Umwelt begrenzt die phänotypischen Ausprägungen, die durch die Gene möglich wären - Theorie der ökologischen Systeme von Uri Bronfenbrenner (1979) Natürliche Umgebung als hauptsächliche Quelle der Entwicklung Mikrosystem (Kind) > Mesosystem (Familie) > Exosystem (Elterliche Arbeit)> Makrosystem (Kultur); - Chronosystem als biologische Entwicklung Moderne kognitive Ansätze Vygotsky: Soziokulturelle Theorie Grundannahmen: menschliche Entwicklung in speziellensoziokulturellen Kontexten Persönlichkeit und kognitive Fähigkeiten entstehen durch soziale Interaktion Kinder werden mit wenigen mentalen Fähigkeiten geboren, die durch die Kultur in höhere mentale Fähigkeiten transformiert werden jede Kultur liefert spezifische Mittel zur - intellektuellen Anpassung (Strategien, Denkmethoden werden durch Interaktion internalisiert) jede Kultur bestimmt, wie und was gedacht wird! Entstehung von Fähigkeiten: Kinder als neugierige Forscher, Lernen durch Interaktion Kollaboratives Lernen: ein Novize nimmt an Aktivitäten eines Experten teil, der das Lernen anleitet Kinder haben eine Zone der proximalen Entwicklung (alleine nicht, aber unter Tutoranweisung kann eine Aufgabe gelöst werden) Aufgabe des Lehrenden: scaffolding (Wissen an das Niveau des Novizen anpassen) Aufgabe des Lernenden: private speech: von verbaler Instruktion behält das Kind einige wichtige Punkte, internalisiert diese und führt so sein Verhalten an - Kritik: keine universelle Entwicklung, sondern kulturabhängige Variationen Kinder adaptieren erfolgreich an eigene Traditionen verbale Instruktion oft nicht sehr nützlich Attributionstheorien (soziale Infoverarbeitung) Menschen als aktive Infosucher und –verarbeiter generieren Kausalattributionen für jedes Verhalten; Ziel: Verstehen und kontrollieren Entwicklung hängt nicht von der Erfahrung ab, sondern von der Art der Interpretation (internale/ externale Ursache...) Entwicklung der Vorstellung über Persönlichkeitseigenschaften: Def. Eigenschaft: internale Ursache, andauernd über Zeit Ab 2: Verständnis, dass kausale Agenten Vorschule: Verhalten anderer immer beabsichtigt (internale Ursachenzuschreibung), aber nicht beständig Ab 10 Jahren verstehen Kinder Eigenschaften Montada, Kap.18: Moralische Entwicklung und moralische Sozialisation; Shaffer, Kapitel 8: Geschlechtsunterschiede, Geschlechterrolle- Entwicklung und Sexualität - 1. Moralphilosophische Konzepte Normen entstammen kulturellen/ religiösen Traditionen unterschiedliche Legitimation (Begründer) Sollen universell gültig sein (Kant: kategorischer Imperativ; a priori gegeben, in allen Kategorien gültig) Utilitarismus: Ziel von Normen sollte die Maximierung des Allgemeinwohls sein Kulturunterschiede: Kulturspezifische Normen (Zurückhaltung), v.a. zw. individualistischen und kollektivistischen Kulturen - 2. Psychologische Moralforschung Indikatoren von Moral: Wissen, Urteile über Moral, Verhalten, moralische Gefühle Normen regulieren Handeln, liefern Bewertungsmaßstäbe für eigenes und Handeln anderer moralisches Wissen muss dafür erworben und verstanden, anerkannt und befolgt werden 3. Internalisieren von Normen Def: Person nimmt vorgegebene Normen als ihre eigenen verpflichtenden Normen auf Norm als Teil der Persönlichkeit 1. Durch Konditionierung: Internalisation = trotz der Abwesenheit von Autoritäten werden Dinge unterlassen, die eigentlich bestraft werden bzw. Dinge getan, die eigentlich belohnt würden intrinsische Belohnung eines Verhaltens: normentsprechendes Verhalten wird belohnt Verhalten als konditionierter Reiz für positive Gefühle entsprechend auch Entzug extrinsischer Belohnung Strafe konditionierte Angst verhindert normdiskrepantes Verhalten (also keine freie Entscheidung) Probleme von Strafe: Eigentlich als Gegengewicht zu positivem Erleben müsste sehr hoch sein, da nur wenige Verstöße entdeckt werden Nicht konstruktiv, da keine Handlungsalternative geschaffen Keine Einsicht in die Berechtigung einer Norm schafft Widerstand, belastet Vorbild- Beziehung 2. Durch Identifikation & Beobachtung Freud: Wahl von Vorbildern: sowohl Identifikation mit Aggressor (ins Über- Ich; durch Übernahme von Bedrohlichem wird Sicherheit durch Anpassung gewährleistet), als auch mit Bezugspersonen nach Trennung (Übernahme von Merkmalen einer geliebten Person diese ist auch in Abwesenheit repräsentiert) 3. Durch familiäre Sozialisation 3 verschiedene Erziehungsstile: Macht-ausübend: verhindert Internalisierung von Normen eher, da keine freie Entscheidung Mütter mit diesem Erziehungsstil fördern nicht prosoziales Verhalten Erziehungsstil als Prädikator für antisoziales Verhalten in Kindheit und Delinquenz Induktiv: Erklären, Diskutieren eigenen Entscheidung zur Normbeachtung; humanistisch flexible Moral (ja nach Situation angepasst) Liebesentzug: schafft ängstliche, rigide Moral 4. Durch peers: Einfluss von peers auf zB Sexualnormen, Drogen, delinquentes Verhalten Einfluss von peers abhängig von Beziehung zu Eltern - 3. Entwicklung des Denkens über Moral - Piaget: von der Heteronomie zur Autonomie 2 Stadien: Heteronomie =ab Vorschulalter (4/5J); Regeln werden von Autoritäten gesetzt, Abweichungen sollen auf jeden Fall bestraft werden einseitige Achtung Autonomie: ab Grundschule; selbst Mitentscheidung gefragt, Autoritäten werden in Frage gestellt, Sinn der Norm (und so der Bestrafung) wichtiger gegenseitige Übereinstimmung; gegenseitige Achtung Bsp: gerechte Pflichtverteilung erst ab Autonomie verstanden (wenn Junge seine Arbeit nicht macht, ist es ungerecht, sie der Tochter zu übertragen); aber: wird als Autoritätsanspruch der Mutter gesehen; wenn ein Junge immer den Ball holen muss wird als ungerecht angesehen Neuere Forschung zu Piaget: Autonomie bzgl. Gesetzen erst später gelernt (15-18J), wegen mangelnder Erfahrung? unter 15: Gesetzt zur Verhinderung von Untaten, erst später als hilfreich für Individuum gesehen Kinder unterscheiden zw. sozialen und konventionellen Normen schon früh Kinder (4/5J) differenzieren zw. Privatsphäre (niemand darf reinreden) und öffentlicher Sphäre (hier gelten Normen) Differenzierung zwischen Handlungsabsicht und Handlungsausgang erst ab Grundschule, durch Sozialisation gefördert Kohlberg (1963): von der geozentrischen zur universalen Begründung normativer Urteile Untersucht die Entwicklung von normativen Begründungen Methode: moralische Dilemmata Modell: 3 Niveaus mit jeweils 2 Stufen; qualitative Unterschiede 1. das vormoralische Niveau: nur eigene Interessen werden berücksichtigt Stufe 1: moralische Entscheidungen werden getroffen aufgrund von drohenden Strafen und mächtigen Autoritäten Stufe 2: moralische Entscheidungen im eigenen Interesse begründet 2. Niveau der konventionelle Moral: Erhaltung wichtiger Sozialbeziehungen Stufe 3: Orientierung auf Familie, wichtige Bezugspersonen Stufe 4: Orientierung auf übergreifende Systeme: Staat, Religion; Gesetzt erfüllen als oberstes Gebot 3. Postkonventionelles Niveau: Gesellschaftsvertrag, Menschenrechte Stufe 5: Hinterfragen von Prinzipien; Normen sollen unabhängig von Autoritäten gelten; Utilitarismus Stufe 6: (selten erreicht) allgemeingültige ethische Prinzipien (Kant) werden durch Diskursethik gefunden Montada, Kapitel 14: Entwicklung des Gedächtnisses bei Kindern und Jugendlichen (1) Frühe Kindheit - Gedächtnis bei Säuglingen und Kleinkindern Schon nach wenigen Tagen gute Wiedererkennungsleistung Konjugiere Verstärkung (Mobile) zeigt, dass 3Mon schon assoziatives (motorisches) Lernen vornehmen Kontext (Ähnlichkeit zwischen Lern- und Abrufbedingungen) für 6Mon zur Wiedererkennung noch sehr wichtig Imitation (auch passive) schon ab 9Mon vorhanden; langfristige Erinnerung variiert steigt mit Alter an Organisation des Gedächtnisses für routinemäßige Handlungen in Skripts (vertraute Kontiguität); ab 2J Wiederholen nicht mehr so wichtig, auch einmaliges Gespeichert Durch Gedächtnishilfen (egal, ob beim Gedächtnistest oder im Behaltenszeitraum gegeben) wird die Gedächtnisleistung extrem verbessert Ortsgedächtnis abhängig von Zeitverzögerung zum Suchen; verbessert sich zw. 6 bis 12Mon beträchtlich - - Gedächtnis im Vorschulalter Kurzzeitgedächtnis: 3-4J. haben kein intentionales Gedächtnisverhalten, wenn sie explizit so instruiert wurden implizites Gedächtnis wichtiger als explizites Gedächtnis; Beweis: gute Rekognition ( erfordert nur äußere Gedächtnishilfen), aber schlechte Reproduktion ( erfordert innere Repräsentation) Kurzfristiges Lokationsgedächtnis wird immer effizienter, da retrieval cues besser genutzt werden Langzeitgedächtnis: wird gespeist von wiederholten Alltagserfahrungen, die Handlungswissen aufzeichnen (Skripts als Drehbuch) Eltern können durch häufiges Wiederholen, Nachfragen Gedächtnisleistung an bestimmte Episoden verbessern (2) Gedächtnisentwicklung zwischen 5 und 15 Jahren: Determinanten des Gedächtnisses Gedächtniskapazität Kapazität meist als Gedächtnisspanne definiert (Anzahl der Items, die gerade noch perfekt in der Reihenfolge erinnert werden); negative Korrelation zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Gedächtnisspanne zw. 3-6 J. Wenn Reihenfolge nicht berücksichtigt werden muss allgemein bessere Leistungen Erklärungen für den stetigen Anstieg: Case (1985): eine feste Verarbeitungskapazität, deren Aufteilung auf Arbeitsspeicher (mentale Operationen) und Kurzzeitspeicher sich im laufe der Zeit verändert, da für Arbeitsspeicher weniger Kapazität gebraucht wird Baddeley (1990): Zuwächse in verbaler Gedächtnisspanne ist zurückzuführen auf die Geschwindigkeit der Artikulation der Items, die in der fixen Zeitspanne der auditorischen Schleife wiederholt werden können Gedächtnisstrategien Def: potentiell bewusste, intentionale kognitive Aktivität, um eine Gedächtnisaufgabe besser zu bewältigen Enkodierstrategien (Wiederholen, Kategorisieren); Abrufstrategien (während des Erinnerns) Strategiedefizite: jüngere Kindergartenkinder haben Mediationsdefizit, Vorschulkinder ein Produktionsdefizit, beim Übergang vom fehlerhaften zum effizienten Strategiegebrauch ein Nutzungsdefizit, weil die Anwendung zuerst noch zuviel mentale Kapazität in Anspruch nimmt, was mit Wiederholung abnimmt Wiederholungsstrategien: sehr effektiv, nimmt mit Alter deutlich zu; in jeder Altersstufe bessere Leistung, wenn Wiederholung vorgenommen wurde; allerdings ist hier effizienter, wenn nicht einzelne Items wiederholt werden, sonder wenn sie in eine Memorierschleife aufgenommen werden (Gruppenbildung) Organisationsstrategien: nach Oberbegriffen kategorisieren beim Enkondieren und Abruf Verlauf ähnlich wie bei Wiederholung, nur etwas früher; Bedeutung dieser Strategie nimmt mit dem Alter – unabhängig, ob passendes Material – ständig zu ; Aber: individuelle Entwicklung nicht graduell, sondern abrupt und nicht an bestimmten Zeitplan gebunden Elaborieren (Eselsbrücken beim Paar- Assoziationslernen): tritt spontan erst ab früher Jugend auf, nicht bei allen o Gedächtnisstrategien als Produkt unserer Zivilisation, Zeitpunkt der Entwicklung durch Schule beeinflusst Wissen und Gedächtnis Inhaltswissen: Menschliches Wissen in Netzwerken organisiert; ähnliche Inhalte sind miteinander verknüpft; mit Erfahrung wird Anzahl der Knoten und der Verbindungen immer größer und so die gemeinsame Aktivierung Vorwissen nimmt großen Einfluss auf die Gedächtnisleistung (nicht nur das Alter!), zB. Chi, Schachexperten Vorteil liegt in der großen Vertrautheit, aber nur bei „sinnvollen“ Stellungen Erklärung: bei Vorwissen automatische Aktivation der umliegenden Konten je besser die Leistung, desto mehr gespeichert; abhängig von Motivation Gedächtnisleistung hängt auch von allgemeiner Intelligenz ab Metagedächtnis: Def. deklaratives Metagedächtnis: faktisch verfügbares und verbalisierbares Wissen um Gedächtnisvorgänge; aufgeteilt in Wissen um Personen- Aufgaben- und Strategiemerkmale Kindergartenkinder haben rudimentäres, vorläufiges Gedächtniswissen, das sich verbessert und gegen Ende der Grundschulzeit gefestigt ist Prozedurales Metagedächtnis: unabhängig davon, Regulation und Kontrolle gedächtnisbezogener Aktivität Überwachungsprozesse schon im Kindergarten, geringer Alterstrend (zB Vorhersagen über eigene Leistungen) Selbstregulation deutlich verbessert mit Alter (10-12J); zB sich für schwierige Wortpaare mehr Zeit zum Lernen einteilen als für leichte Bidirektionaler Zusammenhang zwischen Metagedächtnis und Gedächtnis - - - - (3) Neuere Forschungstrends Konsistenz und Stabilität von Gedächtnisleistungen: Annahme, dass Gedächtnis aus unabhängigen Fähigkeiten zusammengesetzt keine Entwicklungstrends, mäßige Korrelationen zw. ähnlichen Aufgabeninhalten Fuzzy-Trace- Theorie: verbatim und gist als Pole der Repräsentationen; Gedächtnisleistung auch abhängig von der sinkenden Sensitivität gegenüber Interferenz Vorhersage: es gibt starke und schwache Gedächtnisinhalte; Output- Interferenz beeinträchtigt die Wiedergabe von schwachen Inhalten, deshalb ist die optimale Gedächtnisleistung, wenn erst schwach, dann stark, dann wieder schwacher Inhalt erinnert (Cognitive-Triage-Effekt) Jüngere Kinder vergessen im gleichen Zeitabstand mehr als ältere Kinder; mgl Erklärung: jüngere Kinder speichern neue Info als verbatim- traces, ältere als gist- traces bei präziser Speicherung ist Abruf schwerer Implizites Gedächtnis: Nachwirkungen von Lernerfahrungen, unabhängig von Verarbeitungstiefe, weniger altersabhängig Explizites Gedächtnis: abhängig von Verarbeitungstiefe, mehr altersabhängig (da Wissen etc von großer Bedeutung) Autobiographisches Gedächtnis: Def: Teilbereich des episodischen Gedächtnisses, Erinnerung an komplexe Erlebnisse mit starkem Selbstbezug Altersunterschiede: ab 3/4J liegt dieses Gedächtnis vor, davor infanile Amnesie Erklärungsversuche: von skriptartiger Repräsentation zu sprachgebundener Verarbeitung; Verständnis des Selbst muss vorliegen Augenzeugen-Forschung: ab 7 Jahren Erinnerung wie Erwachsene, v.a. wenn sehr persönliche, intensive Erlebnisse; davor schlechtere Erinnerung, je mehr Zeit zwischen Ereignis und Fragen vergangen ist; jüngere Kinder sind sehr suggestibel Bjorklund, Kapitel 3: the social constructin of mind Soziokulturelle Perspektive: wie wir denken und uns entwickeln ist durch unsere soziale und kulturelle Umgebung bestimmt; Lew Vygotsky (1930): cognitive Entwicklung geschieht in Situationen der Zusammenarbeit von Erwachsenen und Kindern auf Die Rolle der Kultur in der Kognitiven Entwicklung 4 Levels, die in Interaktion mit der Umwelt des Menschen stehen: ontogenetische (lebenslange), mikrogenetische (Zeitspanne), phylogenetische und soziokulturelle Entwicklung a) tools of intelectual adaptation Kinder werden geboren mit wenigen elementaren Funktionen (Aufmerksamkeit, Sinne, Wahrnehmung, Gedächtnis) werden durch Kultur transformiert in höhere mentale Funktionen (damit werden mentale Funktionen möglichst adapitv) Kultur vermittelt wie und was gedacht wird Beispiel: Benennung der Zahlen (Miller et al., 1995): in China einheitlicheres Zahlensystem als in USA 3 und 5J. müssen so weit wie möglich zählen; bei 3 noch keine kulturellen Unterschiede, erst ab 4 Jahren Vorteil des leichteren chinesischen Systems kognitive Fähigkeiten durch Kultur unterschiedlich ausgeprägt (Piaget: Universalität??) b) sozialer Ursprung der frühen kognitiven Kompetenzen Kinder sind aktive neugierige Erforscher, aber meist sozial initiiertes Interesse: alle höheren kognitiven Prozesse entstehen in sozialen Situationen (durch kollaboratives Lernen); diese werden dann später internalisiert (von der interpsychologischen zur intrapsychologischen Kategorie) Innerhalb der Zone der proximalen Entwicklung werden die Problemlöse- Techniken internalisiert; scaffolding in dieser Zone sehr effektiv (Erwachsener bestimmt immer weniger, je besser Kind die Aufgabe von sich aus lösen kann) Wichtig: es geht nicht um allgemeine Kompetenz, sondern um aufgaben- und situationsspezifisches Lernen! c) Barbara Rogoff (1990) Konzept der geleiteten Partizipation: Lernen durch gemeinsamen Beteiligung an Kommunikation oder Aktivitäten (nicht explizite Lernsituation) formt die kindliche Kognition Ausführung dieses Prozesses ist abhängig von der Stellung und Sicht des Kindes in der jeweiligen Kultur: Kinder immer mit Erwachsenen zusammen mehr nonverbale Erklärungen, bessere Beobachter; Kinder eher getrennt explizites Einweisen, mehr für Wesentliches bei Verhalten empfänglich Beispiel der geleiteten Partizipation für westliche Kulturen: Kinder müssen Erwachsenen Fragen beantworten, die diese schon wissen und die unabhängig vom Kontext sind wie Erwachsene vorlesen („interacive story reading“) beeinflusst die Sprachentwicklung durch gemeinsames Symbolspiel wird vorstrukturiert, Wissen über Objekte, Subjekte und Handlungen erlangt (theory of mind; wichtig für Erfolg in Gesellschaft) Vorteile von kollaborativem Arbeíten: Höhere Motivation Genauere Analyse der eigenen Ideen (da Erklärungen etc notwendig sind) Mehr Ideen in Gruppen gefunden Nachteile: Abhängig vom Wissen/ Kompetenz des Experten der Gruppe Fehlattributionen, wer welche Lösung gefunden hat ( falsches source monitoring) Bjorklund, Kapitel 11: Soziale Kognition; Shaffer,Kap. 6: die Entwicklung des Selbst und soziale Kognition - Soziale Kognition = Kognition über soziale Beziehungen und Phänomene Selbst = Kombination von physischen und psychischen Merkmalen, einzig für jedes Individuum 2 große Theorien der sozialen Kognition: 1. Bandura (1986): Beobachtungslernen (soziale kognitive Theorie) explizite Verstärkung ist nicht notwendig, damit Kinder über die soziale Welt lernen; Lernen durch Beobachtung genügt reziproker Determinismus: Interaktion mit Umwelt (Verhalten Umwelt Denken Verhalten) nötige Fähigkeiten, damit Kinder lernen: Symbolisierung (in Worten und Bildern denken viele Aspekte können beachtet werden) Antizipation der Ergebnisse Selbstregulation (soziale und normative Standards anwenden eigenes Verhalten analysieren) Beobachtungslernen keine Imitation nötig, damit etwas gelernt wurde (zB typische Geschlechterrollen werden gelernt, aber nur die eigene wird ausgelebt) Kinder überschätzen sich, weil sie manche motorische Fähigkeiten nicht haben Tomasello (1987): auch Schimpansen können haben die Fähigkeit zur Imitation (siehe bei Menschen aufgezogene), aber die soziale Umwelt ist dafür nicht ideal (Lehren, Belohnen, Aufmerksamkeit auf Objekte) Imitation als wichtiges Werkzeug für soziales Lernen Self- Efficacy: inwiefern sich eine Person als effektiv einschätzt; abhängig von Erfahrung; domainenspezifisch; wird aufgebaut ab dem Zeitpunkt, ab dem Kinder Kontrolle über Ereignisse ausüben können (3-4Mon); schafft eine unrealistische Überschätzung der eigenen Kompetenzen diese kognitive Unreife fördert die Entwicklung Hohe Selbst- Effizienz schafft bessere Leistungen; niedrieg Hilflosigkeit, schlechtere Leistung Stipek (1992): wishful thinking (man erwartet, was man sich wünscht); 2Jährige wenden sich bei missglückter Aufgabenlösung von Erwachsenen ab, bei Erfolg: Zuwendung 2. Soziale Informationsverarbeitung: Dodge (1994) je besser soziale Info verarbeitet wird, desto besser sozial- kompetent ist ein Kind 5 Einheiten im Modell des sozialen Austausches: sozialer Stimulus; Interpretation; soziales Verhalten dient den peers als sozialer Stimulus diese verhalten sich sozial zur Info-Verarbeitung: 5 sequentielle Stufen: Enkodieren (adäquate Wahrnehmung des sozialen Reizes?) Interpretation (Vergleich mit Bekanntem/ Ähnlichem) Antwortsuche (verschiedene Alternativen generieren; wird mit Alter schnell mehr soziale Kompetenz) Antwortbewertung (Antizipation der Konsequenzen) Ausführung der ausgewählten Antwort Experiment (Dodge et al, 1986): Kinder sehen Video von 2 anderen Kindern beobachtet/ erfragt wird, wie sicher es eintreten wird in die Gruppe je besser die soziale Infoverarbeitung der Kinder, desto mehr sozial kompetent (w´licher Eintritt) Anwendungsbeispiel: aggressives Verhalten relevante soziale Reize werden nicht gespeichert/ ambigue Situationen mehr aggressiv gedeutet soziales Verhalten hat eine kognitive Basis! - Die Entwicklung des Selbst- Konzeptes Def: die Art und Weise, wie eine Person sich selbst definiert (einzigartige Merkmalskombination) Piaget: Kinder erkennen sich selbst nur allmählich als von Objekten um sie getrennt; ab 18 Monate die ersten Anzeichen für Selbstkonzept Schon Neugeborene können zwischen sich und anderen/ Objekten unterscheiden (Bsp: schreien nur bei anderen Babystimmen mit) Ab 2Mon: Neugeborene nehmen sich als kausale Agenten wahr lernen ihre Körpergrenzen früh (s. Mobile) Vorsprachliche Methode; Videoaufzeichnungen/ Spiegel Selbsterkennung ab 3 Monate (gewohnter Anblick/ Stimulus) Selbst- Rekognition: im Spiegel erkennen und Bewusstsein, dass das „ich“ bin; Methode: Rouge-Test Selbstkonzept ab 18-24 Monaten 2 Arten des Selbstkonzeptes: implizites und explizites Selbst; explizites Selbst im visuellen Rekognitionstest (Marktest) untersucht Povinelli et al. (1996): große Aufkleber auf Kinderkopf, dann gefilmt, gezeigt ab 3 Jahren erst entfernen Kinder den Sticker von ihrem Kopf (wenn Szenen nicht lange her), ab 6 Jahren erst wissen Kinder, dass das Selbst zeitstabil ist (ist Grundlage für autobiographisches Gedächtnis) Wichtige kognitive Grundlage für Selbstrekognition: sichere Bindung Sprachgebrauch: ab 3. Jahr korrekt die Personalpronomen gebraucht Erwerb des Selbstkonzeptes fördert das soziale Wissen, ist Grundlage für soziale Kompetenz, Gruppenbeziehungen, Geschlechtsidentität (Bsp: selbstbewusste Gefühle wie Scham) Selbstkonzept und soziale Kognition bis in die Grundschule noch auf konkrete Erfahrungen/ Situationen/ Handlungen beschränkt (Beschreibung durch physikalische Eigenschaften, Geschlecht; Verhaltensvergleiche); ab Jugend Beschreibung durch psychologische, abstraktere, portraithafte Eigenschaften gestaltet (psychologische Vergleiche) Marcia (1980): 4 Identitätslevels: Identitätsdiffusion: man beschäftigt sich nicht damit Festlegung: schon von vornherein in eine Identität gepresst Moratorium: man durchlebt eine Identitätskrise (Erikson) Identität erreicht: persönliche Normen, Glauben, Haltungen eingenommen (meist erst ab 20J aufwärts) laut Erikson ist die Identität Grundlage für eine gesunde, intime Beziehung - - Perspektivenübernahme Theory of mind ab ca. 4 Jahren (Piaget: ab 7/8J. nicht mehr egozentrisch); Verständnis, dass Verhalten von Wünschen/ Überzeugungen determiniert ist (public und private self) Tomasello (1993): Fähigkeit zur Perspektivenübernahme ist kritisch für menschliche Intelligenz, da Menschen kulturell lernen (Infos über Generationen weitergegeben) 3 Levels des Lernens, das folgende Level ist jeweils effektiver: Imitation, 1. LJ: der Lernende internalisiert die Absichten und Strategien des Modells ( Absichten müssen verstanden werden) Instruiertes Lernen, ab 4LJ: eine kompetente Person instruiert eine weniger kompetente Person das Verständnis des Erwachsenen wird internalisiert und verglichen Collaboratives Lernen, ab 6/7 LJ: Lernen im Prozess der Interaktion, keine Autorität o kognitive Basis für erfolgreiche soziale Interaktion! - - - Selbstwert Bewertung des eigenen Selbst anhand der Qualität des Selbstkonzeptes Bowlby (1988): sicher gebundene haben ein positives Arbeitsmodell und bewerten sich selbst als positiver 4-7J: Bewertung von 2 Dimensionen: soziale Akzeptanz, generelle Kompetenz 8J: physikalische und akademische Kompetenz, soziale Akzeptanz junge Erwachsene: verhältnismäßiger Selbstwert (abhängig von Situation und Partner) Veränderungen in der Pubertät können Selbstwert vermindern (viele Stressoren, mehr negative Ereignisse) Kulturelle Beiträge: Eltern (warm, offen, demokratischer Stil); sozialer Vergleich mit peers Selbstkontrolle Def: Kontrolle des Verhaltens inklusive Hemmung von unerwünschtem/ zielablenkendem Verhalten Grundannahme: kindl. Verhalten zuerst external kontrolliert, später werden Standards, Normen etc. internalisiert Emotionale Selbstregulation als Vorläufer: im 1. LJ durch Synchronisierung mit der Pflegeperson liefert dem Kind Strategien für Selbstkontrolle (Prädiktor für Verhaltenskontrolle im 2. LJ) 2-3J: Erikson: Autonomie vs. Scham/ Zweifel Selbstbestimmung Selbstinstruktion ab Sprachalter hilft beim Internalisieren Belohnungsaufschub- Paradigma, Ergebnis ist abhängig von Strategien (Ablenkung) und den internalisierten Normen, die Selbstkontrolle fordern Frühe Selbstkontrolle ist grundlegend für spätere soziale und akademische Kompetenzen, Selbstvertrauen - - - - Der kindliche Humor Voraussetzung ist kognitive Fähigkeit, Inkongruenzen zu erkennen zwischen Erwartetem und Erfahrenem UmgekehrtU-förmiger Verlauf: gemäßigte kognitive Anstrengung macht den Witz am lustigsten Art des Humors abhängig von den kognitiven Fähigkeiten, zB: Konservationsaufgaben; symbolische Repräsentation von Objekten Kognitive Basis der Geschlechtsidentität Entwicklung der Geschlechterkonstanz: 3J. glauben, dass sich mit Kleidung das Geschlecht verändert 3 Komponenten: Geschlechteridentität, 2.5J, -Stabilität(zeitlich) 4/5J, - Konsistenz (situativ) 6/7J Geschlechtsidentifizierung: die Rollen und Werte der eigenen Geschlechtszugehörigkeit werden internalisiert Geschlechtsschemata: beeinflussen, wie und welche Info Kinder verarbeiten; entwickelt sich v.a. durch Beobachtung; Wissen nimmt mit Alter zu Geschlechts- Skript: ab 2 Jahren imitieren v.a. Jungs mehr stereotypes männliches Verhalten, selten feminines Geschlechtertypisches Spielzeug wird generell bevorzugt bei Jungen/ androgenisierten Mädchen biologische Basis für diese Präferenz (Spielzeuge für Jungs erfordern viel Aktivität, diese wird durch vorgeburtliche Androgene verfügbar gemacht) Intelligente Kinder erwerben die Geschlechts-Schemata früher als weniger intelligente wenn hohe Geschlechterkonstanz, dann auch im Wörtertest bessere Leistungen Bjorklund, Kap. 7: Repräsentation - - Mentale Repräsentation in der Kindheit Piaget: symbolische Repräsentation erst ab 18Mon; davor: Repräsentation durch selbst- initiierte Handlung Ausdruck der symbolischen Repräsentation: verzögerte Imitation, Sprache, Symbolspiel, mentale Vorstellung (internale Repräsentation eines externen Ereignisses; dabei Unterscheidung zw. 2 Typen von Bildern: reproduktive Bilder sind starr, wirklich erfahren (bis Vorschulalter); antizipatorische Bilder sind nicht erlebt worden, ab Schule) Gegenbeweise zu Piaget: Meltzoff & Moore, 1992: Imitation von Neugeborenen (6-21Tage), danach keine Imitation mehr Erklärungen: aktives intermodales mapping: Info aus 2 Sinnen wird repräsentiert und koordiniert Tinbergen (1951): angeborener auslösender Mechanismus, von spezifischen Stimuli ausgelöst, ohne vorherige Erfahrung (vgl Piaget: epigenetisches Prinzip!!) Frühe soziale Entwicklung (Kommunikation, Beziehungen) Meltoff (1985): verzögerte Imitation ab ca. 12 Mon. (mit Verzögerung von 10 Min bis 24 Stunden!) Objaktpermanenz: schon ab 3,5Mon. (vgl. Baillargeon, 1987: Violation of Expectation- Methode: Kinder dishabituieren auf physikalisch unmögliches Ereignis müssen versteckten Holzblock repräsentiert haben) Spelke (1992): Kernwissen ist angeboren; über Kohäsion, Kontinuität und Kontakt angeborene Repräsentationen Der Gebrauch von Symbolen Interpretation von Bildern und Modellen ab 18 Mon: Symbolspiel de Loache (1995): 2 und 3J. sollen ein Spielzeug in einem Raum finden; zuvor ein Bild gezeigt, auf dem das Spielzeug hinter einem Stuhl versteckt ist 3J. benutzten die Bild- Info, um den Gegenstand zu suchen, 2J. noch nicht 3J. erkennen, dass das Bild eine symbolische Repräsentation ist, haben also die repräsentationale Einsicht (= eine Sache steht für eine andere); 2J noch nicht, weil sie die duale Repräsentation noch nicht verstehen (= ein Ding steht zur gleichen Zeit für 2 Sachverhalte); diese haben sie nicht, weil ein Photo an sich langweilig ist, wenn die Aufmerksamkeit nicht darauf gelenkt wird (Beweis: Modell aufwerten durch Ersetzten durch einen Fensterrahmen Repräsentation auch bei 2J. da) die Schein- Sein – Unterscheidung Test: Konservationsaufgabe (quantitative Verhältnisse bleiben trotz perzeptueller Veränderung gleich) laut Piaget ab 7 J. Identitätsstabilität ab 5/6J. erkannt (Katze mit Hundemaske bleibt eine Katze) o mit 3J. noch keine Schein-Seins- Aufgaben gelöst, wegen Schwierigkeit zum „dual encoding“ 3&4J. können zwischen Träumen und Realität unterscheiden; Kinder glauben viel an Zauberei, wenn sie etwas nicht erklären können - - die Theory of mind Theory= Organisation und Prädiktion; Erkennen verschiedener Kategorien des Gedächnisses (Traum, Erinnerung…) bei Erwachsenen: belief- desire- Denken (wir erklären Handeln aus dem Wissen, dass andere so handeln, weil sie Überzeugungen und Wünsche haben) 2 große Unterpunkte: Kinder als Gedankenleser Test: false- belief- Aufgabe; ursprünglich für Schimpansen entwickelt (Premack & Woodruff, 1987), dann von Wimmer und Perner (1983) für Kinder 4J lösen die Maxi- Aufgabe richtig, 3J noch nicht; universell Mögliche Erklärungen: Erinnern sich nicht, was sie ursprünglich geglaubt haben ( Smarties- Aufgabe; representational change) Repräsentations- Defizit (Perner, 1991): haben die nötigen konzeptuellen Strukturen noch nicht Probleme mit widersprüchlicher Information Mangelhafte kognitive Fähigkeiten (können die „wichtige/ richtige“ Info nicht hemmen) Ältere Geschwister stimulieren „pretend“ verbessert Ergebnisse in false- belief- Aufgaben Clements & Perner, 1994: beweisen, dass das repräsentationale Defizit keine Erklärung ist: schon 2,5J. lösen die Aufgabe explizit zwar falsch, aber implizit (suchen, Blickrichtung) richtig! 2/3J. haben schon Täuschungs- Strategien haben Verständnis, dass andere andere Dinge als sie selbst glauben! Wellman (1990): schon 3J. haben TOM, aber sie legen noch zu viel Wert auf die „Wünsche“, vernachlässigen den „Glauben“ --> vgl. Piaget, wishful thinking --> deswegen überschätzen sie auch ihre Fähigkeiten, aber können Täuschungsaufgaben lösen Baron- Cohen (1995): Mechanismen sind domainenspezifisch und modular angelegt (Evolution) -> 4 getrennte Module: Absichtsdetektor und Augenrichtungsdetektor (Wissen wird durch Augen erlangt) bis 9 Mon. entwickelt Geteilter Aufmerksamkeitsmechanismus bis 18 Mon TOMM (theory of mind modul) bis 48 Mon. entwickelt Beweis: autistische Kinder haben die ersten 2 Module, aber die weiteren Fähigkeiten fehlen ihnen (mindblindness) „Denken“ verstehen 3J. können reale Dinge von mentalen (Träumen bspw.) unterscheiden ab 8-10J: wissen, dass es viele verschiedene kognitive Prozesse gibt Shaffer, Kapitel 5: Early social and emotional development II - - - - - - - - - - Individuelle Unterschiede in der Bindungsqualität Beurteilung der Qualität durch Ainsworth`s Fremde Situation Kritik: außergewöhnliche Situation ist nicht aussagekräftig; nur für Kinder bis 2J. brauchbar; sehr unökonomisch Alternative: Attachment Q- Set: 1-5J; 90 Beschreibungen werden in 3 Kategorien eingeteilt (von Eltern etc) Wunsch, Nähe aufrecht zu erhalten, ist universal; aber: kulturelle Unterschiede in Bindungsqualität (Deutsch: vermeidend& ignorierend, da Unabhängigkeit wichtig; Japan: unsicheres Muster) abhängig von Erziehungspraxis Einflussfaktoren auf die Bindungsqualität: Qualität der Erziehung Sichere Bindung sensible, responsive Mütter Ambivalente Bindung inkonsistente Pflegepersonen Vermeidende Bindung Ungeduld, negative Gefühle oder extreme Überstimulation ; Folge: Vermeiden solcher Erwachsenen Desorientierte Bindung Angst vor Pflegeperson wegen Vernachlässigung oder Missbrauch Beispiele: depressive Mütter; Erwachsene, die selbst missbraucht wurden; bei ungewollten Schwangerschaften/ schlechter Beziehung der Eltern; bei ökonomisch schwachen Familien ist der unsichere Bindungstyp vorherrschend Eigenschaften des Kindes Kagan, 1984: Temperamentsunterschiede beeinflussen den Bindungstyp; diese werden in Wirklichkeit von der Fremde- Situation gemessen (3 Temperamentstypen nach Thomas und Chess) Kinder sind verantwortlich für Art der Bindung Kritik: mehrere Bindungsarten je nach Bezugsperson zu beobachten; schlimme Eltern schädlicher als schlimmes Kind Aber: Evidenz, dass Eltern mehr für Bindungsqualität beitragen Väter als Bindungsobjekte: Bindung zu Vätern in der 2. Hälfte des 1. LJ. Ausgebildet Väter als Spielpartner bevorzugt; dienen als sichere Basis für Explorationsverhalten Viel Kontakt mit Vater/ warme, unterstützende Beziehung: bessere intellektuelle Entwicklung Kann durch sichere Bindung den Anteil der Mutter ausgleichen (Kinder mit 2 sicher gebundenen Elternteilen sind sozial am freundlichsten, mit einem immer noch freundlicher als ohne sichere Bindung) Bindung und spätere Entwicklung Sicher gebundene sind bessere Problemlöser, attraktivere Spielpartner, neugieriger, sensibler gegenüber anderen stabile Qualität der frühen Bindung bis ins Erwachsenenalter (Bowlby: Erwachsene haben durch Erfahrung etc. stabile Arbeitsmodelle entwickelt, die einen Teil zur Persönlichkeit beitragen) Interessant: Sensibilität der Pflege und Arbeitsmodell sind unabhängige Prädiktoren, aber gute! Erklärung der Ethologen/ Bowlby: positives Arbeitsmodell über andere angelegt, wenn sicher gebunden; wenn unsicher gebunden negatives Arbeitsmodell (Erikson: kein Urvertrauen); entsprechend positives vs. negatives Arbeitsmodell des Selbst (kann man Bedürfnisse mitteilen etc.) Kombinationen ergeben die verschiedenen Bindungstypen; die Arbeitsmodelle sind beständig und beeinflussen die weitere Entwicklung Beispiel: Infoverarbeitung beeinflusst: 3J. sicher gebunden können sich mehr an die positiven als an die negativen vorgespielten Szenen erinnern Erwartet positive Ergebnisse; Muster bei unsicher gebundenen genau andersrum Das ungebundene Kind Soziale Isolation bei Hunden und Affen ergeben folgende Kenntnisse: reagieren weniger dominant, sind mehr gestresst durch neue Stimuli, wenig sozialen Kontakt suchend, abnormes Verhalten, als Erwachsene bizarres soziale und sexuelles Verhalten Harlow: 6Mon. als kritische Periode für Affen Aber: durch Therapie mit Jüngeren (weniger aggressives Spiel) konnte „normales“ Verhalten/ soziale Beziehungen neu erlernt werden Soziale Deprivation bei Menschen: vor allem in verarmten/ unterbesetzten Institutionen In der zweiten Hälfe des 1. LJ: uninteressiert in sozialem Kontakt; seltener schreien; wenn lange Zeit dort aufgewachsen niedrigerer IQ, sozial unreif, abhängig von Erwachsenen, wenig sprachlich kompetent, Einzelgänger „reactive attachment disorder“ (= Unfähigkeit, eine sichere Bindung zu bilden) Mögliche Erklärungen: Mütterliche Deprivations- Hypothese: die Wärme und liebende Aufmerksamkeit einer einzelnen Bezugsperson fehlt (aber: in Russland, China, Israel: Kinder, die von mehreren Pflegepersonen gleichzeitig aufgezogen werden, entwickeln sich sehr normal“) Soziale Stimulations- Hypothese: Kinder brauchen soziale Interaktion und Responsiveness verschafft das Gefühl von Kontrolle (wichtig für positives Arbeitsmodell, sonst evt. Gelernte Hilflosigkeit) Keller, Kapitel 3: Entwicklungsgenetik; Montada, Kapitel 2: Biologische Grundlagen der Entwicklung - - - - - - - - - Allgemeine Prinzipien des genetischen Einflusses auf die Entwicklung Entwicklungsgenetik: unterschiedliche Entwicklungsverläufe sollen anhand vom variierendem Erbgut erklärt werden Genom= gesamte genetische Information eines Menschen (= Genotyp); bleibt ein Leben lang gleich Ein Gen kann bei unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Varianten auftreten (= Allele) Gene variieren zwischen Arten, Allele zwischen Individuen einer Art Genetische Variation durch Mutation und Rekombination, Selektion durch Reproduktionserfolg von Genen (immer nur auf eine bestimmte Umwelt bezogen!!) Gene synthetisieren durch ihre Aktivität Proteine (Ablesen der Information) Andere Gene sind für die Aktivierung zuständig komplexe Wechselwirklungen als Basis für den Entwicklungsprozess Entwicklung = Zellteilung und daraus resultierende Spezialisierung Verlust an Funktionsmöglichkeiten der Zelle (aber: globaler Gewinn durch lokaler Verlust) Genetische Wirkung auf die Entwicklung immer nur in Wechselwirkung mit der Umwelt des Genoms (Umwelt kanalisiert den genetischen Einfluss) Umwelt kann die Aktivität bestimmter Gene beeinflussen (Bsp: Phenylketonurie) Einteilung in Reife und Erfahrung nicht gut! Genetische Einflüsse folgen dem kumulativen Prinzip: können sich neuronal/ anatomisch verfestigt haben und wirken weiter, auch wenn die Gene nicht mehr aktiv sind (Bsp: Diät bei Phenylketonurie nur im Kindesalter, bis Gehirnwachstum beendet ist) Es gibt genetische Dispositionen zum Erlernen spezifischer Lerninhalte: Cook und Mineka (1989): Rhesusaffen (im Zoo aufgewachsen) sehen Video mit Affen, die entweder ängstlich oder nicht auf eine Schlange/ einen Hasen reagieren nur die Angstreaktion auf die Schlange wird später beobachtet Genetischer Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung Je homogener die Umwelt, desto größer ist der genetische Einfluss auf Merkmalsunterschiede und umgekehrt Aussagen sind immer populationsabhängig und Durchschnittswerte; Alter der Population ist entscheidend (da Unterschiede in der Geschichte der Genaktivität und der Umwelt) Abschätzung des relativen Einflusses von Genom und Umwelt kann nur indirekt geschätzt werden (weil Genom nicht quantifizierbar) Zwillings- oder Adoptionsmethode (sagt etwas über die Ähnlichkeit der Allele aus) Fisher (1918): gemeinsame Varianz zweier Variablen setzt sich aus gemeinsamen Varianzanteil und speziellem Varianzanteil zusammen; gemeinsamer Varianzanteil als Korrelation der beiden Variablen (zB Messung des IQ von beiden Zwillingen) Adoptionsmethode führt oft zu niedrigeren Werten als Zwillingsmethode, weil hier nur Einschätzzungen der Eltern Kontrasteffekte (Zwillingsmethode überschätzt den genetischen Einfluss) Adoptionsmethode schätzt den Einfluss der Umwelt auf die Persönlichkeit sozial- emt. Persönlichkeitsmerkmale werden mehr von individuellen als von geteilten Umwelteinflüssen bestimmt (!) Genom- Umwelt- Interaktion: Persönlichkeit bestimmt durch Unterschiede im Genom und der Umwelt (abhängige Größen!); Bsp: Adoptivkinder und antisoziales Verhalten: nur, wenn der genetische Risikofaktor (antisoziale Mutter) und der Umwelt- Risikofaktor (problematische Pflegefamilie) zusammen auftreten, ist das Risiko erhöht/ die Vorhersage genauer (auch bei Schizophrenie, Depression so angenommen) Genom- Umwelt- Kovarianz: bestimmte Genome finden sich gehäuft in bestimmten Umwelten wieder (passiv, reaktiv und aktiv, zB Musikalität) Längsschnittstudien zur Altersabhängigkeit des genetischen Einflusses zeigten, dass IQ- Schwankungen bei eineiigen Zwillingen mit zunehmendem Alter ähnlicher wurden (r=.80), zweieiige Zwillinge synchronisierten nicht besser (r=.65) eineiige Zwillinge werden sich immer ähnlicher Neben der Kovarianz- Erklärung auch möglich: die Tests in der frühen Kindheit können schwer verglichen werden mit späteren, immer besser vergleichbaren Tests erklärt die zeitliche Stabilität mit wachsendem Alter Genomanalyse für direkte Messung des genetischen Einflusses auf Persönlichkeitsmerkmale (mit Markern Allele markieren) bisher noch sehr wenig gelungen (erfasst das Persönlichkeitspotential) Fazit: Menschen können ihre Entwicklung mitbestimmen!