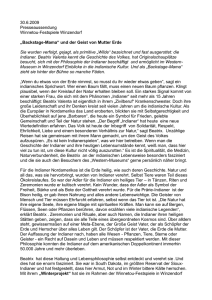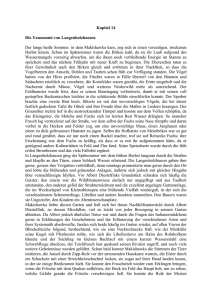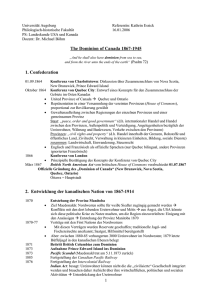2 Inuit - Friedrich-Leopold-Woeste
Werbung

Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer 1 Nordamerikanische Indianer Noch vor 400 Jahren gehörte den Navajos, Apachen, Sioux, Shoshonen, Hopis, Algonquin und vielen anderen Indianervölkern fast ganz Nordamerika. Dann fielen die Europäer ein, besetzten das Land, unterdrückten die Ureinwohner und entzogen ihnen die Lebensgrundlagen. Doch bis heute hat die indianische Tradition überlebt. Der Drang zur kulturellen Eigenständigkeit der ersten Einwohner Nordamerikas ist nach wie vor ungebrochen. Die ersten Einwanderer Amerikas Als vor etwa 30.000 Jahren die erste eisfreie Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska entstand, war dies der gängigen Theorie nach der Beginn der Besiedlung des amerikanischen Kontinents. Bis ins 15. Jahrhundert breiteten sich die Einwanderer, von den Europäern später "Indianer" genannt, auf dem ganzen Kontinent aus. Vor allem in Mittelund Südamerika entwickelten sich bekannte Hochkulturen wie die Reiche der Inkas, Mayas oder Azteken. Solche Großreiche gab es im nördlichen Teil des Kontinents nicht. Hier lebten über 400 Völker mit eigenen Kulturen und Sprachen in kleinen, eigenständigen Gemeinschaften, heute von uns als "Stämme" bezeichnet. Das Land der Indianer war Gemeinschaftsbesitz und ihre Führer, die "Häuptlinge", wurden in der Regel wegen ihrer herausragenden Fähigkeiten ausgewählt, nicht aufgrund einer familiären Erbfolge. Als die Weißen kamen Von 1497 an, fünf Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus, eroberten die Engländer Neufundland und Labrador, wenige Jahre später begannen hier Fallensteller mit dem Pelzhandel. Im Süden erreichten die Spanier Florida auf der Suche nach Gold. Die Ureinwohner, die ethnische und kulturelle Vielfalt kannten, empfingen die Fremden in der Regel freundlich. Die Europäer hingegen sahen in den "Indianern" nur "Wilde" und "Heiden". Sie machten sich keine Mühe die Religion, Politik und Gesellschaft der Ureinwohner zu verstehen. Die europäischen Invasoren schleppten Krankheiten ins Land - mit schrecklichen Folgen für die Indianer: In den nächsten Jahrhunderten starben zum Beispiel Tausende Indianer an Pocken-Epidemien, da ihr Immunsystem auf diesen Erreger nicht eingestellt war. Hinzu kam ein zunehmender Missionierungsdrang der christlichen Kirchen und eine Flut von Siedlern, die immer mehr Land in Anspruch nahmen. Zunehmend begannen die Indianer zu rebellieren, aber nur selten konnten sie sich gegen die übermächtige Schlagkraft der "Feuerwaffen" durchsetzen. In so genannten "Friedensverträgen" verloren die Indianer mehr und mehr ihrer angestammten Territorien. Umsiedlung und Vertreibung 1830 verabschiedete der Kongress der jungen Vereinigten Staaten von Amerika ein Umsiedlungsgesetz ("Indian Removal Act"), um dem Ansturm neuer Siedler Herr zu werden. Mit militärischer Gewalt wurden 100.000 Ureinwohner aus ihrer Heimat im Osten und Süden in so genannte "Reservate" vertrieben, Tausende starben während der langen Märsche ("Trail of Tears"). Aufstände, zum Beispiel der Navajos, scheiterten. Nur wenige Völker wie die Sioux oder die Seminolen konnten sich kurzfristig in ihrer Heimat behaupten. In den Reservaten sorgte eine "Indianer-Behörde" für die Umerziehung der Ureinwohner. In speziellen Internaten lernten die indianischen Kinder europäische Wertvorstellungen. Die indianische Kultur stand nicht auf dem Lehrplan. Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer Als 1869 die transkontinentale Eisenbahn vollendet wurde, kam es auch im Westen des Kontinents zu einer massiven Zunahme von Siedlern und Abenteurern. Innerhalb kurzer Zeit wurden Millionen Büffel abgeschlachtet und damit die Lebensgrundlage der Prärie-Indianer zerstört. 1883 waren die Büffel Nordamerikas nahezu ausgerottet. Immer wieder verließen Gruppen junger Krieger die Reservate und kämpften gegen die Zerstörung ihrer Heimat. Die USA antworteten mit blutigen Strafexpeditionen und Massakern an ganzen Völkern der Ureinwohner. "Little Bighorn" In fast 400 Verträgen versuchte die US-Regierung, die Indianer-Völker zur Abtretung ihres Landes zu bewegen. Teilweise kam dadurch kurzfristig Frieden zustande, allerdings brach die Regierung immer wieder ihre eigenen Verträge. Als 1874 Goldgräber in das Land der Lakota einfielen und damit den Friedensvertrag von Fort Laramie aus dem Jahr 1868 brachen, führte dies zu einem erbitterten Krieg und zu einer legendären Niederlage der US-Armee. Oberstleutnant George Armstrong Custer wurde mit seinem 200 Mann starken 7. Kavallerie-Regiment durch die Übermacht einer Cheyenne-SiouxKoalition unter den Anführern Sitting Bull und Crazy Horse komplett vernichtet. Die Indianer beklagten nur wenige Opfer. Der Triumph der Indianer sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. In der Folge veranstaltete die US-Armee grausame Hetzjagden auf Indianer in ganz Amerika. Aus "Rache für Custer" mussten Tausende Ureinwohner in blutigen Massakern sterben. Nur wenige "Rebellen", wie der Apache Geronimo, konnten sich kurzfristig gegen die militärische Übermacht der US-Regierung behaupten. Amerikanisierung Um die schwelenden Konflikte zwischen Weißen und Indianern in den Reservaten zu beenden, bemühte sich die US-Regierung ab 1880 die traditionelle Lebensweise der Indianer weiter zu durchbrechen. Sie löste den gemeinschaftlichen Landbesitz der "Stämme" auf und verteilte das Land an einzelne indianische Familien. Große Gebiete der Reservate fielen bei dieser Umverteilung allerdings an Weiße. In der schulischen Erziehung wurde das Verbot der indianischen Sprachen und Gebräuche verschärft und Männern das Tragen langer Haare verboten. Die Ureinwohner lebten wie Gefangene in ihren Reservaten, standen unter der strengen Kontrolle der Regierung und durften ihre kulturelle Identität nicht mehr ausleben. Oft hingen sie aufgrund der Landumverteilung und Vernichtung der Jagdgründe von den unregelmäßigen Verpflegungsrationen der Weißen ab. Hunger, Armut und Elend waren die Folge und führten zu zahlreichen Aufständen in den Reservaten. Nach dem fürchterlichen Massaker bei "Wounded Knee", dem rund 350 Indianer zum Opfer fielen, erstarb der Widerstand der Ureinwohner. Indianischer Alltag heute Nach dem Einsatz von indianischen Soldaten auf Seiten der USA im Ersten Weltkrieg erhielten die Ureinwohner 1924 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1934 stand man ihnen im "Indian Reorganisation Act" das Recht auf Ausübung ihrer Kultur zu. Trotzdem versuchte die US-Regierung immer wieder dann, wenn wirtschaftliche Interessen anstanden, die Rechte der Indianer zu beschneiden, zum Beispiel durch Landenteignungen. 1968 entstand deshalb die erste indianische politische Organisation: das "American Indian Movement". Die Organisation versuchte immer wieder, die Probleme der Indianer an die Öffentlichkeit zu tragen. Heute bilden die Ureinwohner nur noch eine Minderheit in ihrer Heimat. Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer 2 Inuit Die rund 150.000 Inuit sind wohl eines der bekanntesten Völker der Erde. Jahrtausende überlebten sie ohne technische Hilfsmittel in Schnee und Eis. "Inuit", "Mensch", nennen sie sich selbst, von ihren Nachbarn, den Indianern, wurden sie "Eskimo" genannt, das bedeutet "Rohfleischesser". Sie überlebten als Jäger von Karibus, Robben und Walen. Doch in der modernen Gesellschaft zählt ein guter Jäger nicht mehr viel. Was können sie von ihrem traditionellen Leben für die Zukunft bewahren? Die Ursprünge der Inuit Die Inuit stammen wahrscheinlich von einem asiatischen Volk von Jägern und Sammlern ab. Sie gelangten über die Beringstraße nach Amerika, lange nach den Indianern, etwa ab 3000 bis 2500 vor Christus. Sie siedeln heute von der Tschuktschen-Halbinsel an der Beringstraße über Alaska entlang des Arktischen Ozeans auf den Inseln des nördlichen Kanadas bis Grönland. Archäologen fanden Hinweise für mehrere Einwanderungswellen, wobei die Neuankömmlinge meist technisch weiter entwickelt waren und die Einheimischen verdrängten oder sich mit ihnen vermischten. Siedlungsgebiete der Inuit Die letzte Einwanderung, etwa 1000 nach Christus, fand wie die vorherigen in einer wesentlich wärmeren Klimaphase als heute statt. Doch die Inuit konnten sich an kälteres Klima anpassen. Sie waren als reine Jäger, auch im Unterschied zu den Indianern, nicht auf landwirtschaftliche Erzeugnisse oder gesammelte Früchte und Beeren angewiesen. Solange es genügend Jagdbeute gab, war die Existenz der InuitGemeinschaft gesichert. Selbst die sogenannte "Kleine Eiszeit" von 1550 bis 1850 konnte sie nicht als Volk gefährden. Wie lebten die Inuit? Die Inuit lebten während der Warmzeiten meist in festen Siedlungen, zumindest solange es in der Umgebung ganzjährig ausreichend Beute gab. In kälteren Phasen wechselten sie jahreszeitlich mit der wandernden Beute zwischen mehreren Jagdcamps. Je nach Region jagten sie überwiegend die unterschiedlichen Beutetiere der Arktis: Karibus, Moschusochsen, Fische, Robben, Walrösser und Wale. Dabei lebten sie üblicherweise nicht in den legendären Schneehäusern, den Iglus. Diese dienten meist nur als kurzfristige Unterkünfte während Reisen oder Jagdausflügen. Die Begegnung mit den Weißen Bis in die Neuzeit hatten Begegnungen mit Weißen für viele Inuit Nordkanadas nur geringe Auswirkungen auf ihr tägliches Leben. Allerdings gab es immer wieder Epidemien durch Krankheiten, wie Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, die auf die Inuit übertragen wurden. Besuchten Walfänger die Siedlungen oft nur für kurze Zeit, hatten Missionare schon größeren kulturellen Einfluss. So missionierten etwa um 1770 deutsche Missionare, die Herrnhuter aus Sachsen, an der Küste von Labrador. Dies hatte zur Folge, dass dort die Inuit christliche und manchmal sogar deutsche Vornamen annehmen mussten. In das dortige Inuktitut, die Sprache der Inuit, sind auch deutsche Worte mit nur geringfügig abgeänderter Schreibweise eingegangen, so etwa die Wochentage: "Sontag", "Montag", "Dinstag". Abgesehen von den südlicheren Küstenregionen waren aber weite Gebiete ohne intensiven Kontakt mit der westlichen Kultur. Ein erster Schritt waren Anfang des 20. Jahrhunderts die Aktivitäten der "Hudson Bay Company", die Pelze gegen Jagdgewehre, Zelte und ähnliche Waren tauschte. Damit kamen viele Inuit zum Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer ersten Mal mit den Regeln der modernen Wirtschaft in Kontakt. Die begehrten Waren mussten bezahlt werden. Die Inuit wurden Opfer skrupelloser Händler, die sie beim Kauf der begehrten Jagdgewehre schamlos übervorteilten. Überleben im modernen Kanada Mit dem Zweiten Weltkrieg wuchs der strategische Wert des nördlichen Kanada. Der Staat begann, sich verstärkt um die Inuit zu kümmern. Neben militärischen Interessen waren hierzu auch Rohstoffvorkommen wie Blei, Silber, Zink, Erdöl und Erdgas ein Anreiz. Die Inuit mussten innerhalb kurzer Zeit in einer modernen Gesellschaft leben, vor allem jedoch in einem Wirtschaftssystem, in dem jede Ware mit Geld bezahlt werden muss. Mit der Jagd konnten die Inuit aber kaum Geld verdienen, allenfalls Robbenfelle ließen sich verkaufen. Aber nur so lange, bis die großen Absatzmärkte in Europa und Amerika durch Boykottaufrufe von Tierschützern zusammenbrachen. Andere bezahlte Arbeit gibt es in der Arktis jedoch kaum. Zwar wird heute kein Inuk mehr verhungern. Aber viele verdienen nicht genug, um die aus dem Süden eingeführten Lebensmittel und Waren bezahlen zu können, von denen sie aufgrund der sesshaften Lebensweise zunehmend abhängig werden. Die modernen Holzhäuser sind zwar komfortabel, aber so lässt sich nicht mehr ausschließlich von der Jagd leben. Viele Inuit wurden zu Empfängern staatlicher Zuwendungen. Dramatische Folgen Die Ausweglosigkeit dieser Situation, verbunden mit einer extremen Abgeschiedenheit, führte dazu, dass in manchen Gemeinden extrem hohe Selbstmordraten auftreten. Oftmals bei Jugendlichen, die zwar im Fernsehen die weite Welt erleben, sich aber wie lebendig begraben vorkommen. Die hohen Reisekosten in der Arktis bewirken, dass sie kaum jemals auch nur das Dorf verlassen können. Auch Alkoholmissbrauch stellt ein Problem dar, vor allem dort, wo kein gewachsenes soziales Gefüge besteht, etwa in Minensiedlungen oder in der Nähe von Militäreinrichtungen. In neuerer Zeit ist der Verkauf von Alkohol in selbstverwalteten Regionen weitgehend verboten. Viele gut gemeinte Ansätze der Regierung, den Inuit aus ihrer schwierigen Lage zu helfen, verursachten jedoch neue Probleme. So führte die Schulpflicht dazu, dass die angestammte Sprache, das Inuktitut, teilweise in Vergessenheit geriet, weil es in der Schule und in Internaten nicht gesprochen werden durfte. Da in abgelegenen Gemeinden aber keine Schulen existierten, mussten viele junge Inuit Internate besuchen und empfanden die dort aufgezwungene Kultur als großen Zwang. Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer 3 Die kanadische Bevölkerung Kanada ist ein Mosaik der Kulturen. Hier leben rund 34 Millionen Menschen. Jährlich kommen 200.000 Einwanderer ins Land, das ist nach den USA die zweitgrößte Zahl weltweit. Fast die Hälfte der Kanadier ist nicht französischer oder britischer Abstammung. Und auch die Franzosen und die Briten sind vor rund 500 Jahren als Einwanderer ins Land gekommen. Multikulturalismus ist in Kanada ein politisches Programm, ist Chance und Herausforderung zugleich. Das Ziel ist kein "Melting pot", kein Schmelztiegel, wie es das US-amerikanische Idealbild darstellt, sondern ein bunter Flickenteppich der kulturellen Vielfalt. Die "Ersten Völker" Sie waren die Ersten: Über die Beringstraße kamen die Ureinwohner Kanadas aus Sibirien ins Land. Wann genau das war - vor 50.000 oder erst vor 10.000 Jahren - dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Sicher ist: Sie kamen in mehreren Schüben im Verlauf Tausender von Jahren. Einige von ihnen waren sesshaft, andere Nomaden. Für die ersten französischen und britischen Siedler waren die Ureinwohner zunächst Handelspartner. Die europäischen Einwanderer brauchten die Hilfe der Indianer, wie sie sie nannten, für den Pelzhandel. Allerdings wüteten aus Europa eingeschleppte Krankheiten unter den Stämmen und viele Ureinwohner starben daran. Auch wurden einige Stämme von den Europäern unbarmherzig bekämpft, die Beothuk auf Neufundland wurden gar vernichtet. Kanadische Namgis-Indianer Ab 1830 begann die kanadische Regierung, die Indianer in Reservate umzusiedeln - und startete ein paar Jahrzehnte später den Versuch, sie zwangsweise einzugliedern, etwa durch sogenannte Indianerinternate. Erst in den 1960er Jahren verstärkte sich der Widerstand. In den 1970ern entschied man sich in Kanada für die politisch korrektere Bezeichnung "First Nations" ("Erste Völker", Ureinwohner). 1982 bildete sich eine gemeinsame Vertretung der indianischen Völker Kanadas, die Versammlung der First Nations, um an einer neuen kanadischen Verfassung mitzuwirken. Etwa 700.000 Angehörige der First Nations leben in Kanada. Sie gehören 615 verschiedenen Gruppen an, die zehn verschiedene Sprachen und davon nochmal 50 unterschiedliche Dialekte sprechen. Auch wenn einige sich inzwischen selbst verwalten und Landansprüche eingeklagt werden konnten, leiden gerade die First Nations unter starken sozialen Problemen von Armut bis Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Die zweite Gruppe der Urbevölkerung wird Métis genannt. Sie sind die Nachfahren der ersten Siedler und Pelzhändler, die eine Verbindung mit indianischen Frauen eingegangen sind. Heute leben knapp 400.000 Métis in Kanada. Die Menschen im Eis Die dritte Gruppe der indigenen (eingeborenen) Völker bilden die Inuit. Ihr Name bedeutet "Menschen" in ihrer Sprache, dem Inuktitut. Von den Indianern wurden sie "Eskimo" genannt, "Rohfleischfresser". Zurzeit leben etwa 50.000 Inuit in Kanada, doch die Inuit sind "Baby-Boomer": Bereits 2016 könnte sich ihre Zahl auf 80.000 erhöht haben, so lauten Schätzungen. Ihr traditioneller Lebensraum ist die Arktis - im Westen vom US-amerikanischen Staat Alaska und im Osten von der Küste Labradors begrenzt. Die Inuit sind deutlich später als die Indianer nach Kanada gelangt, vermutlich etwa um 3000 vor Christus. Ursprünglich lebten sie als Nomaden, hauptsächlich von der Jagd. Zuerst kamen die Walfänger und Pelzhändler in die Gebiete der Inuit, dann folgten die Missionare. Die Inuit hat das wenig beeindruckt. Erst mit dem Zweiten Weltkrieg kam die kanadische Regierung in ihr Gebiet, um Flugplätze und Radaranlagen zu bauen. Die Inuit zogen in feste Häuser, bekamen medizinische Versorgung, Schulen - und wurden nicht selten abhängig von staatlicher Fürsorge, denn von der Jagd allein konnten sie nicht mehr leben. Die Inuit- Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer Kunst wurde zu einer Haupteinnahmequelle. 1999 konnten die Inuit einen großen Erfolg im Streben nach Unabhängigkeit verbuchen: die Gründung ihres eigenen Territoriums "Nunavut". Ein zweigeteiltes Land Der Grundstein für den Konflikt zwischen der franko- und anglokanadischen Bevölkerung wurde bereits mit der europäischen Besiedlung im 16. und 17. Jahrhundert gelegt. Damals setzten sich die Engländer und Franzosen als bedeutendste Kolonialmächte in Nordamerika durch. 1663 übernahm die französische Krone die Herrschaft über die Kolonie Neufrankreich - also die französischen Siedlungsgebiete in Nordamerika. Das war der Beginn der Erkundung und Besiedlung des Hinterlandes vom St. Lorenz-Strom aus. Den Briten in Neuengland wurde der Weg ins Hinterland abgeschnitten und damit der Pelzhandel erschwert. Heftige Kämpfe waren die Folge. Aus der entscheidenden Schlacht auf der Abraham-Ebene 1759 gingen die Briten siegreich hervor. Im Pariser Frieden von 1763 trat Frankreich seine Gebiete in Nordamerika an Großbritannien ab. Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg siedelten rund 50.000 "Loyalisten" - Getreue der britischen Krone - auf das Gebiet des heutigen Kanadas über. In der Verfassung von 1791 wurden eine französische und eine britische Provinz mit eigener Selbstverwaltung eingerichtet, 50 Jahre später wurden sie zur Provinz Kanada vereinigt, Amtssprache: Englisch. 1867 wurde der Bundesstaat gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Kanada ein souveräner Staat mit dem britischen König oder der Königin an der Spitze. Von Bi zu Multi Die französisch geprägte Provinz Québec hat in Kanada stets eine Sonderrolle gespielt. Seit der Niederlage gegen die Briten haben sich die Frankokanadier bemüht, ihre Kultur zu erhalten. Wirtschaftlich dominierten aber die Anglokanadier in Québec. Gegen die wirtschaftliche Abhängigkeit und Bevormundung lehnte sich die Bevölkerung in den 1960er Jahren mit der "Stillen Revolution" auf. Das Ziel: mehr Selbstbestimmung. Viele Frankokanadier fordern gar bis heute einen unabhängigen Staat Québec. Treibende Kraft war und ist die "Parti Québécois" (PQ), die mehrfach mit Volkabstimmungen versucht hat, die Unabhängigkeit für die Provinz durchzusetzen. Der Staat reagierte mit zahlreichen Zugeständnissen: 1965 löste etwa das Ahornblatt den Union Jack auf der Nationalflagge ab und 1969 wurde Französisch zweite Amtssprache neben Englisch. In die Debatte um das Miteinander der beiden Gründerkulturen klinkten sich die europäischen Minderheiten im Land ein. So entstand aus dem BiKulturalismus der Multi-Kulturalismus, sozusagen als unbeabsichtigtes Nebenprodukt der frankokanadischen Separationsbestrebungen. 1985 wurde er als Grundrecht in der Verfassung verankert. Mosaik der Kulturen Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland. Seit der Kolonialisierung sind Gruppen von Einwanderern in mehreren Immigrationsphasen ins Land gekommen. Los ging es im 17. und 18. Jahrhundert mit den französischen Einwanderern. Die britischen Siedlungsgebiete der "Loyalisten" lockten im 19. Jahrhundert zahlreiche britische Einwanderer an. Zu dieser Zeit kamen aber auch bereits Einwanderer aus anderen europäischen Ländern, vor allem Deutsche - rund 2,8 Millionen Kanadier haben deutsche Wurzeln. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Kanada eine explosionsartige Einwanderung. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurden vor allem aus China Arbeiter ins Land geholt. Allerdings waren diese rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Mit Slogans wie "We don't want Chinamen in Canada" ("Wir wollen keine 'Chinamen' in Kanada") wurde das Gespenst einer "gelben Gefahr" an die Wand gemalt. Das änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, weil auch die Einwanderer im Krieg ihren Blutzoll entrichtet hatten und weil in einer Zeit des Wirtschaftsbooms neue Arbeitskräfte gebraucht wurden. Bis in die 1970er Jahre kamen vor allem Italiener, Portugiesen und Griechen, dann verstärkte sich der Zuzug aus der Karibik und Lateinamerika und auch aus dem pazifischen Raum. Heute ist es schwer, die Anteile der einzelnen Gruppen genau zu berechnen. Zunehmend definieren sich die Menschen selbst als "Kanadier", in der Volkszählung von 1996 gaben 29 Prozent der Befragten als ethnische Herkunft "kanadisch" an, weitere 34 Prozent bezeichneten sich als "teilweise kanadisch". Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer 4 Polarkreis Ein wenig nördlicher des 66. Breitengrades "Nord" sowie etwas südlicher des 66. Breitengrades "Süd" auf der Erde liegt eine schon fast magische Grenze: der nördliche beziehungsweise südliche Polarkreis. Jenseits davon: die Arktis im Norden und die Antarktis im Süden. Hier herrschen Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius, und wohin man nur schaut: baum- und strauchlose Tundra, Schnee-, Eis- oder Geröllwüste. Dann: monatelang Dauertag und monatelang Dauernacht. Leben unter diesen Bedingungen? Scheinbar unmöglich! Und doch: Mit faszinierenden Strategien haben es Menschen, Tiere und Pflanzen geschafft, auch diese lebensfeindlichen Gebiete an den beiden Enden der Welt zu besiedeln. Mit schiefer Achse um die Sonne Warum es die Polarkreise auf der Erde überhaupt gibt, das hat mit der besonderen Art und Weise zu tun, mit der die Erde sich um die Sonne bewegt. In 365 Tagen eine ganze Runde auf einer elliptischen Bahn. Zusätzlich zu ihrer Jahresrunde dreht sich die Erde dabei noch alle 24 Stunden ein Mal vollständig um ihre eigene Achse. Denkt man sich jetzt eine Ebene durch die elliptische Bahn, die die Erde um die Sonne beschreibt, steht die Erdachse nicht senkrecht zu dieser Ebene, sondern in einem Winkel, der aus der Senkrechten heraus um etwa 23,5 Grad gekippt ist. Darum werden, je nach dem, wo sich die Erde im Jahreszyklus gerade befindet, verschiedene Teile der Erde unterschiedlich stark von der Sonne beleuchtet. Die schief stehende Achse ist auch der Grund, warum die Sonne, von der Erde aus betrachtet, zum Beispiel im Januar eine andere Bahn am Himmel beschreibt als im Juli und warum es bei uns im Sommer heiß und im Winter kalt ist. Polkappen in Licht und Schatten Wenn man sich beispielsweise am 21. Juni, zur Sommersonnenwende, direkt am nördlichen Polarkreis befindet, wird klar, warum es ihn genau dort gibt. Hier geht nämlich an diesem einen Tag die Sonne gar nicht mehr unter! Und je näher man dem Nordpol kommt, desto länger (bis zu mehreren Monaten) hält der Dauertag an. Am 21. Dezember, zur Wintersonnenwende, ist es genau umgekehrt. Hier geht die Sonne jenseits des nördlichen Polarkreises gar nicht mehr auf. Sommer- und Wintersonnenwende sind also diejenigen Tage, an denen die Erde wegen ihrer schiefen Achse ihre Pole genau zur Sonne "hin-" beziehungsweise "weggekippt" hat. Die Polkappen der Erde sind dann vollständig beleuchtet oder liegen ganz im Schatten. (Wenn auf der nördlichen Erdhalbkugel Sommer ist, ist auf der südlichen Winter und umgekehrt). Dass es im Sommer an den Polen nicht so heiß wird wie am Äquator, liegt an der Art und Weise, wie die Sonnenstrahlen auf der Erdoberfläche einfallen: jenseits der Polarkreise nämlich in einem ziemlich flachen Winkel. Deshalb kommt dort im Vergleich zum Äquator weniger Energie - und damit Wärme - an der Erdoberfläche an. Extremer Lebensraum für Pflanzen und Tiere Lange Dunkelphasen, Extremkälte im Winter und relativ kühle Temperaturen im Sommer machen die Polarregionen zu einem Lebensraum mit ganz besonderen Herausforderungen. Den Pflanzen dort steht zum Beispiel nur eine sehr kurze Vegetationsperiode zur Verfügung. Sie müssen mit dem spärlichen Angebot an Sommersonne auskommen, um blühen und ihre Samen verbreiten zu können. In verblüffend kurzer Zeit verwandelt sich dann die sonst eher karge Landschaft in ein saftig grün-buntes Blumenmeer. Mehr als 400 Arten arktischer Blütenpflanzen gibt es. Wegen des Permafrost-Bodens können in den Polarregionen nur Pflanzen wachsen, die keine tiefen Wurzeln bilden und Staunässe vertragen. Denn Wasser kann darin nicht absickern und der Boden saugt sich voll wie ein Schwamm. Vor allem niedrig wachsende Sträucher, Kräuter, Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer Gräser, Flechten und Moose kommen mit solchen Bedingungen ganz gut klar. Sie liefern den Moschusochsen und Rentieren, die sich in der Tundra für den Winter eine dicke Speckschicht anfressen müssen, die Hauptnahrungsgrundlage. Eisbären hingegen halten sich im Winter zur Robbenjagd hauptsächlich auf dem Packeis auf. Sie können mit ihrem dicken Pelz und einer beachtlichen Speckschicht lange in der Kälte ausharren, ohne zu frieren. Sogar im eiskalten Wasser fühlen sie sich richtig wohl. Die Inuit sind eine reine Jägerkultur Menschen in der Arktis Mensch und Eisbär kennen sich schon lange. Bereits vor 3000 Jahren kamen die ersten Ureinwohner, die Inuit, über die Beringstraße von Asien nach Alaska und ließen sich dort nieder. Im Laufe der Zeit wanderten einige von ihnen weiter nach Westen, besiedelten die nördlichen Teile Kanadas und später auch Grönland. Die Inuit konnten unter den unwirtlichen Bedingungen der Arktis nur überleben, weil sie als Jägerkultur nicht auf Ackerbau und Viehzucht angewiesen waren. Da es in den Polargebieten auch keine Bäume gibt und Holz nur als Treibgut vom Meer angeschwemmt zu finden war, verwendeten sie neben dem Fleisch ihrer Jagdbeute auch Felle, Haut und Knochen als Rohmaterial für Kleidung und den Bau ihrer Behausungen. Nichts wurde verschwendet. Heute leben die Inuit teilweise noch wie ihre Vorfahren. Viele allerdings bewegen sich in einem schwierigen Spagat zwischen zwei Welten: dem Leben in großen modernen Städten und ihrer alten nomadischen Jagdkultur. Neben den Inuit leben noch zahlreiche andere Völker mit den unterschiedlichsten Traditionen und Kulturen jenseits des nördlichen Polarkreises. Zum Beispiel die Tschuktschen, Samojeden oder Jakuten in Nordsibirien und, nicht ganz so weit im Norden, in den eher subarktischen Gebieten Finnlands, Schwedens und Norwegens, zum Beispiel das Volk der Samen. In Alaska und Kanada leben nahe dem Polarkreis die Athabasca-Indianer, die, wie die Inuit auch, zu den Ureinwohnern dort zählen. Antarktis ohne Ureinwohner Der Südpol war lange menschenleer. Es gibt dort keine Ureinwohner. Der Grund dafür: Die Antarktis ist Landmasse, die von Meer umgeben ist. (Im Gegensatz zur Arktis. Dort ist das Meer von Landmassen umgeben). Erst mit der Entwicklung hochseetüchtiger Schiffe konnten die Menschen die Antarktis erreichen. Heute leben dort - in großen Wohncontainersiedlungen - Forscherteams aus der ganzen Welt. Sie bleiben allerdings meist nicht länger als einige Monate. In einer internationalen Übereinkunft - dem Antarktisvertrag - wurde festgelegt, dass die Südpolargebiete ausschließlich friedlich genutzt werden dürfen und besonders der wissenschaftlichen Forschung vorbehalten bleiben. Ab und zu wird die Antarktis auch von Touristen besucht. Der Trend zu Kreuzfahrten in die Polargebiete hat in den letzten Jahren beachtlich zugenommen. Im Sommer wohnen bis zu 10.000 Menschen in der Antarktis. Im Winter nur zirka 1000. Globales Frühwarnsystem Die Polarregionen der Erde sind trotz der unwirtlichen Lebensbedingungen hochsensible Ökosysteme. Und sie sind heute durch den Klimawandel extrem bedroht! Messungen haben gezeigt, dass die Temperaturen an den Polkappen zwei- bis dreimal schneller ansteigen, als in der übrigen Welt. Klimatologen haben mit Simulationsprogrammen berechnet, dass in hundert Jahren große Teile des grönländischen Eisschildes abgeschmolzen sein und das Packeis im Nordpolarmeer einen Großteil seiner Fläche eingebüßt haben könnte. Für Tier und Mensch dort hat das jetzt schon teilweise verheerende Folgen. Die Eisschicht auf dem Polarmeer ist das Jagdgebiet der Inuit. Sie schmilzt in den Polarsommern immer früher und ist dann gefährlich dünn oder ganz verschwunden, so dass die Jagdsaison um mehrere Monate verkürzt ist. 5 Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer 5 Arktische Tierwelt Obwohl die Arktis durch ihre Meereis-Verbindung zu zwei Kontinenten kein hermetisch abgeschlossenes Ökosystem darstellt, hat auch dieser riesige Lebensraum aufgrund seiner klimatischen Bedingungen eine einmalige Tierund Pflanzenwelt ausgebildet. Die Nordpolarregion ist dabei nicht nur ein Lebensraum für Tiere, die auf der geschlossenen Eisdecke leben. Auch im Meereis selbst leben Algen und andere Kleinstlebewesen - und bilden den Anfang der Nahrungskette. Leben unter Null Zu den ersten Anpassungskünstlern gehören Algen und Kleinstlebewesen, die im Meereis oder an dessen Unterseite leben. Dort ist das Wasser minus zwei Grad Celsius kalt. Die Grenzschicht zwischen Eis und Wasser ist sehr nährstoffreich. Besonders die hoch konzentrierte Salzlake, die entsteht, wenn Meerwasser zu Eis gefriert, ist Lebensraum für kleine Organismen, arktische Eisalgen etwa, die kaum Licht für ihre Photosynthese benötigen. Das arktische Ökosystem hat kurze Nahrungsketten, die in einigen Fällen nur aus wenigen Gliedern bestehen: Meer- und Eisalgen werden von Zooplankton und Krill gefressen, das wiederum Kabeljau oder Hering und auch den Bartenwalen als Futter dient. Die Fische werden von Robben gefressen. Und die Meeressäuger wiederum dienen dem Eisbär, dem letzten Glied in der Kette und einzigen Arktisbewohner ohne natürlichen Fressfeind, als Nahrung. Säugetiere im Wasser ... In der arktischen Kälte ist für gleichwarme Tiere die Vermeidung von Wärmeverlust existenziell. Große Tiere haben den Vorteil, dass ihre Körperoberfläche im Verhältnis zum Körpervolumen relativ klein ist - und damit auch der Wärmeverlust. Mit dicken Fettschichten sind alle arktischen Säugetiere und auch viele Vogelarten perfekt an die Kälte zu Land und im Wasser angepasst. Im Nordpolarmeer lebt eine große Anzahl von Säugetieren im Meer. Neben den zwei größten Arten, dem Blauwal und dem Finnwal, kommen in arktischen Gewässern Wale fast aller Arten vor, Plankton fressende Grönland-, Buckel- und Zwergwale ebenso wie viele Zahnwalarten. Die großen Meeressäuger wurden und werden verschieden stark bejagt und leben deshalb zum Teil nur noch in kleinen Populationen in bestimmten Gewässern. Der mit dem Beluga verwandte Narwal ist dabei die am weitesten nördlich vorkommende Art. Robben sind geschickte Schwimmer und kommen nur zum Schlafen und Sonnen an Land aufs Eis. Da Hundsrobben, anders als die zu den Ohrenrobben gehörenden Seelöwen, keine Hinterflossen haben, auf denen sie "laufen" können, müssen sie sich an Land durch Kontraktion ihrer Rumpfmuskulatur bewegen. Das macht die in der Arktis in großer Zahl vorkommenden Seehunde langsam und zu einer leichten Beute für Eisbären - und Menschen. Walrosse gehören ebenfalls zur Familie der Robben. Die großen Stoßzähne des männlichen Tieres - noch heute ein Grund, warum diese Tiere bejagt werden - können einerseits beim Erklettern einer Eisscholle helfen, machen aber auch beim Erobern eines Weibchens und beim Abschrecken von Rivalen Eindruck. Leben in den eisfreien Regionen - Rentiere Quelle: Planet Schule Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium Hemer ... und auf dem Eis Eisbären leben zwar auf dem Eis, sind aber so exzellente Schwimmer, dass sie als Meerestiere gelten. Ihre hohe Kältetoleranz bekommen sie durch ein dichtes Fell, dessen Haare hohl sind, und eine Fettschicht unter der Haut - welche übrigens, anders als vermutet, tiefschwarz ist, um ebenfalls mehr Wärme speichern zu können. Eisbären sind Fleischfresser, Pflanzen fressen sie nur in der Not, zum Beispiel während des eisfreien Sommers. Pflanzenfresser wie Rentiere beziehungsweise Karibus und Moschusochsen hingegen könnten im permanenten Eis kaum überleben. Sie wandern im arktischen Winter in die eisfreien Regionen - die ebenfalls eine eher artenarme Vegetation aufweisen - um nach Gras, Flechten und Moosen zu suchen. Andere in den Kälteregionen lebende Tierarten sind der Polar- oder Eisfuchs, Schneehasen, Hermeline, Lemminge sowie Wölfe. Bedrohung trotz Anpassung Obwohl außer den indigenen Völkern wie den Inuit ("Eskimos") in der Arktis kaum Menschen leben (Grönland hat auf einer Fläche von etwas über zwei Millionen Quadratkilometern nur rund 56.000 Einwohner), gefährden die Menschen dennoch auch dort massiv die Tierwelt. Neben dem Problem der Überfischung des Nordatlantik wurden in den vergangenen Jahrhunderten auch viele Meeressäuger bis an den Rand der Ausrottung gejagt. Niedrige Populationen, die nicht einem natürlichen Zyklus entsprechen, bedrohen das fragile Gleichgewicht der Nahrungskette. Auch das durch Klimaerwärmung schwindende Packeis erschwert den auf dem Eis lebenden Tieren zunehmend das Leben. Schlimmer jedoch als diese relativ langsame Veränderung der Umwelt - bei der man nur hoffen kann, dass die Tiere sie durch Migration oder Nahrungsumstellung ebenso überleben können wie bisherige Eiszeit-Phasen - ist die unmittelbare Bedrohung durch Umweltgifte. Diese lagern sich im Ökosystem Arktis besonders hoch konzentriert an, wohin sie mit Wind und Meeresströmung aus aller Welt gelangen und dort nur sehr langsam bis gar nicht abgebaut werden können. Weitere Bedrohungen für die arktische Fauna bedeuten Schiffslärm oder Ölbohrungen. Insgesamt gelten zurzeit über 40 arktische Tierarten als gefährdet. Quelle: Planet Schule