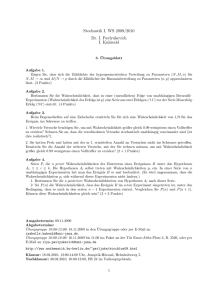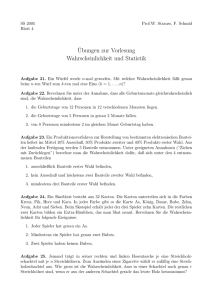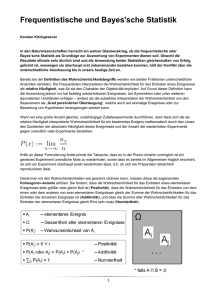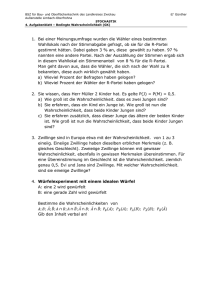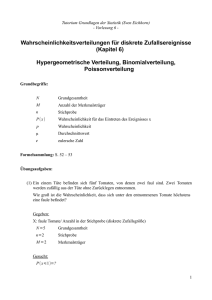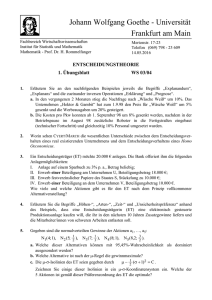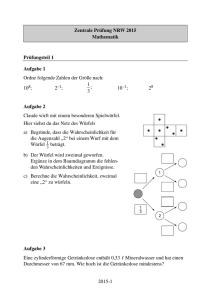2004_2 - Stochastik in der Schule
Werbung
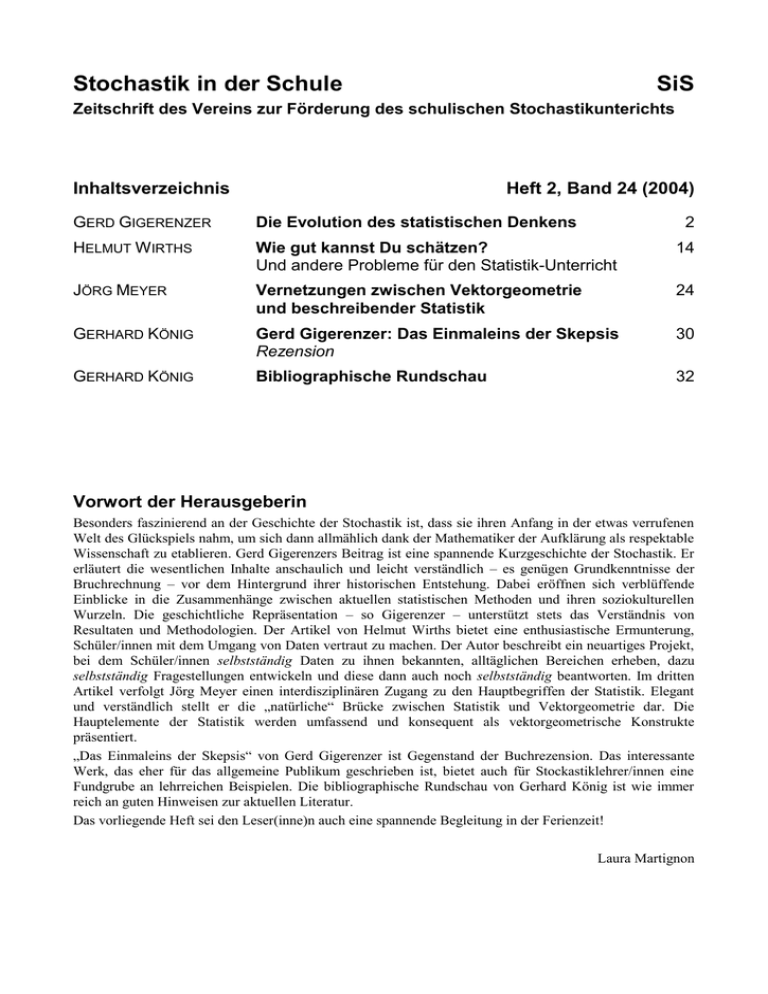
Stochastik in der Schule SiS Zeitschrift des Vereins zur Förderung des schulischen Stochastikunterichts Inhaltsverzeichnis Heft 2, Band 24 (2004) GERD GIGERENZER Die Evolution des statistischen Denkens 2 HELMUT WIRTHS Wie gut kannst Du schätzen? Und andere Probleme für den Statistik-Unterricht 14 JÖRG MEYER Vernetzungen zwischen Vektorgeometrie und beschreibender Statistik 24 GERHARD KÖNIG Gerd Gigerenzer: Das Einmaleins der Skepsis Rezension 30 GERHARD KÖNIG Bibliographische Rundschau 32 Vorwort der Herausgeberin Besonders faszinierend an der Geschichte der Stochastik ist, dass sie ihren Anfang in der etwas verrufenen Welt des Glückspiels nahm, um sich dann allmählich dank der Mathematiker der Aufklärung als respektable Wissenschaft zu etablieren. Gerd Gigerenzers Beitrag ist eine spannende Kurzgeschichte der Stochastik. Er erläutert die wesentlichen Inhalte anschaulich und leicht verständlich – es genügen Grundkenntnisse der Bruchrechnung – vor dem Hintergrund ihrer historischen Entstehung. Dabei eröffnen sich verblüffende Einblicke in die Zusammenhänge zwischen aktuellen statistischen Methoden und ihren soziokulturellen Wurzeln. Die geschichtliche Repräsentation – so Gigerenzer – unterstützt stets das Verständnis von Resultaten und Methodologien. Der Artikel von Helmut Wirths bietet eine enthusiastische Ermunterung, Schüler/innen mit dem Umgang von Daten vertraut zu machen. Der Autor beschreibt ein neuartiges Projekt, bei dem Schüler/innen selbstständig Daten zu ihnen bekannten, alltäglichen Bereichen erheben, dazu selbstständig Fragestellungen entwickeln und diese dann auch noch selbstständig beantworten. Im dritten Artikel verfolgt Jörg Meyer einen interdisziplinären Zugang zu den Hauptbegriffen der Statistik. Elegant und verständlich stellt er die „natürliche“ Brücke zwischen Statistik und Vektorgeometrie dar. Die Hauptelemente der Statistik werden umfassend und konsequent als vektorgeometrische Konstrukte präsentiert. „Das Einmaleins der Skepsis“ von Gerd Gigerenzer ist Gegenstand der Buchrezension. Das interessante Werk, das eher für das allgemeine Publikum geschrieben ist, bietet auch für Stockastiklehrer/innen eine Fundgrube an lehrreichen Beispielen. Die bibliographische Rundschau von Gerhard König ist wie immer reich an guten Hinweisen zur aktuellen Literatur. Das vorliegende Heft sei den Leser(inne)n auch eine spannende Begleitung in der Ferienzeit! Laura Martignon Die Evolution des statistischen Denkens Wiederabdruck aus: Unterrichtswissenschaft – Zeitschrift für Lernforschung, 32. Jahrgang , 2004, Heft 1, S. 4 – 22. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung. GERD GIGERENZER Lernen mit Unsicherheit zu leben – statistisches Denken – ist der wichtigste Teil der Mathematik im wirklichen Leben. Denken ist das Hinterfragen von Gewissheiten, und man lernt es anhand von guten Beispielen. Zu den besten gehören jene Probleme, welche die Entwicklung des statistischen Denkens tatsächlich geprägt haben. Genau dies ist das Programm meines Artikels. Der Beginn der mathematischen Theorie der Wahrscheinlichkeit wird auf 1654 datiert. Anders als die meisten großen Ideen, die bereits in der griechischen Antike entwickelt worden sind, ist das Konzept der mathematischen Wahrscheinlichkeit eine ungewöhnlich späte Entdeckung. Der Philosoph Ian Hacking hat dies als den „Skandal der Philosophie“ bezeichnet. Die Geschichte der Wahrscheinlichkeit ist also relativ kurz, und sie ist bestens dokumentiert (z.B. Daston, 1988; Gigerenzer et al., 1999; Hacking, 1975, 1990). Ich werde diese Entwicklung hier nicht nacherzählen, sondern einen anderen Weg gehen: eine kurze Geschichte in Form klassischer Denkprobleme und der Bedeutung des statistischen Denkens als dem Einmaleins des skeptischen Denkens, damals und heute. Ich beginne mit einem fanatischen Spieler und zwei großen Mathematikern. 1. Die Wette des Chevalier Der Chevalier de Méré war ein leidenschaftlicher Spieler und lebte im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Eines der Spiele, mit denen er seine Mitspieler verführte, war das folgende: „Wir werfen einen Würfel viermal. Wenn dabei eine oder mehrere Sechsen sind, gewinne ich. Wenn keine Sechs dabei ist, gewinnen Sie.“ Soweit wir wissen, waren seine Würfel fair; dennoch gewann der Chevalier mit diesem Spiel regelmäßig Geld. Schließlich fand er keine Opfer mehr, oder das Spiel wurde auf die Dauer eintönig - was immer der Grund war, er dachte sich eine Variante aus, die ebenso lukrativ sein sollte. Hier ist das neue Spiel, das der Chevalier seinen Mitspielern anbot: Stochastik in der Schule 24 (2004) Heft 2, S. 2 – 13 Doppel-Sechs: Wir werfen ein Paar von Würfeln 24 Mal. Wenn dabei eine DoppelSechs oder mehrere sind, gewinne ich. Wenn keine Doppel-Sechs dabei ist, gewinnen Sie. Würden Sie das Angebot annehmen? De Mérés Intuition ist durchsichtig. Er wusste aus Erfahrung, dass es von Vorteil ist, darauf zu wetten, dass mindestens eine Sechs in einer Serie von 4 Würfen auftritt. Eine Doppel-Sechs ist aber 6-mal so selten wie eine einfache Sechs. Daraus schloss er, dass es von Vorteil ist, darauf zu wetten, dass er mindestens eine Doppel-Sechs in 24 (also 6 mal 4) Würfen erhält. Fortuna jedoch enttäuschte den Chevalier; er begann zu verlieren. War er glücklos, obgleich er richtig dachte, oder war er glücklos, weil er falsch dachte? Der Chevalier konnte diese Frage nicht entscheiden, seine Intuition sprach für Ersteres, seine Erfahrung für Letzteres. De Méré wandte sich an die berühmten Mathematiker Blaise Pascal und Pierre Fermat, die im Jahre 1654 eine Reihe von Briefen über dieses und ähnliche Probleme austauschten und einen allgemeinen Lösungsweg entwickelten. Deshalb wird 1654 als das Geburtsjahr der mathematischen Theorie der Wahrscheinlichkeit angenommen. Die Enttäuschung des Chevalier de Méré war der Anlass für eine der größten intellektuellen Revolutionen. Hier ist die Analyse von Pascal und Fermat, in moderner Terminologie. Beginnen wir mit dem ersten Spiel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von mindestens einer Sechs in einer Serie von vier Würfen? Die Wahrscheinlichkeit p(Sechs) von einer Sechs in 1 einem Wurf eines fairen Würfels ist . Daher ist 6 die Wahrscheinlichkeit von „keine Sechs“ 5 . 6 Die Wahrscheinlichkeit von „keine Sechs“ in einer Serie von 4 Würfen ist daher: p(keine Sechs) = 2 p(keine Sechs in 4 Würfen) 5 5 5 5 .482 6 6 6 6 Also ist die Wahrscheinlichkeit p(mindestens eine Sechs in 4 Würfen) = .518. Wir verstehen nun, warum de Méré mit dem ersten Spiel Geld verdiente. Seine Chance zu gewinnen, war etwas höher als 50%. Die gleiche Logik lässt sich auf das Doppel-Sechs Spiel anwenden. Wenn Sie die Antwort noch nicht sehen, geben Sie nicht auf. Wir lösen jetzt ein Problem, das vor 1654 noch niemand gelöst hat. Nochmals, die Frage ist: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine Doppel-Sechs in 24 Würfen zu erhalten? Die Wahrscheinlichkeit p(Doppel-Sechs) in einem 1 Wurf mit einem Paar von Würfeln ist . Daher 36 ist die Wahrscheinlichkeit von „Keiner DoppelSechs“ p(keine Doppel-Sechs) = 35 . 36 Die Wahrscheinlichkeit von „keine Doppel-Sechs“ in einer Serie von 24 Würfen ist daher: p(keine Doppel-Sechs in 24 Würfen) 35 36 24 .509 . Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür, mindestens eine Doppel-Sechs in 24 Würfen zu erhalten gleich .491. Jetzt sehen wir, dass die Chance, das DoppelSechs-Spiel zu gewinnen, tatsächlich leicht unter 50% liegt. Der Grund warum de Méré verlor, war also nicht ein Mangel an Glück, sondern eine falsche Intuition. Doch die Genauigkeit seiner Erfahrung am Spieltisch ist faszinierend. Er muss reichlich Mitspieler gefunden und lange Zeit mit diesem Spiel verbracht haben, um den kleinen Unterschied zu 50% bemerken zu können. Dieser Widerspruch zwischen genauer Erfahrung und falscher Intuition inspirierte Pascal und Fermat, die Gesetze der Wahrscheinlichkeit zu suchen und zu finden. Hier sind sie, in moderner Terminologie: 1. Die Wahrscheinlichkeit eines unmöglichen Ereignisses ist 0 und jene eines sicheren Ereignisses ist 1. 2. Die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Ereignisse ist 1. 3. Wenn A und B unabhängige Ereignisse sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit p(A&B) dafür, dass A und B eintreten, gleich dem Produkt der individuellen Wahrscheinlichkeiten: p(A&B) = p(A)p(B). Zum Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit, eine „7“ mit einem regulären Würfel zu erhalten ist 0 und jene, eine Zahl zwischen 1 und 6 zu erhalten, ist 1. Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse 1 bis 6 beträgt 1, und die Wahrscheinlichkeit, eine „6“ im ersten Wurf und eine „1“ im zweiten zu erhalten, also von zwei 1 1 unabhängigen Ereignissen, beträgt mal , das 6 6 1 ergibt . 36 2. Pascals Wette Die Gesetze der Wahrscheinlichkeit waren eine Antwort auf Erfahrungen mit Glücksspielen, aber dies war nur eine von mehreren Wurzeln. Die Entwicklung des Denkens in Wahrscheinlichkeiten war vielmehr Teil einer großen intellektuellen Revolution: die Aufgabe des Ideals des sicheren Wissens und die Entwicklung von Formen des rationalen Umgangs mit einer unsicheren Welt. Aristoteles teilte unsere Welt einst in zwei Reiche auf: in die himmlische Welt der unveränderlichen Ordnungen und des gesicherten Wissens und die ungeordnete Welt voller Veränderungen und Ungewissheiten. Jahrhundertelang glaubten Mathematiker wie auch Theologen und ihre gläubigen Anhänger, sie lebten in einer Welt absoluter Gewissheit. Doch die Reformation und die Gegenreformation unterhöhlten weitgehend das Reich der Gewissheit. Allmählich setzte sich ein bescheideneres Ideal durch. Man fand sich damit ab, dass vollständige Gewissheit des Wissens unerreichbar ist, hielt aber trotzdem daran fest, dass das verfügbare Maß an Wissen ausreicht, um vernünftige Menschen in Theorie und Praxis zu lenken. Religiöse Überzeugungen waren und sind noch heute von emotionaler Gewissheit gefärbt, und das gilt für Gläubige wie auch für Atheisten. Man weiß mit absoluter Sicherheit, dass Gott existiert. Oder es erscheint unbezweifelbar, dass er nicht existiert. In seinen Pensées aber stellt Blaise Pascal (1669, Bd. 2, S. 141-55) die religiöse Frage in einem völlig anderen Licht. Es geht nicht mehr um die Wahrheit, sondern um die Erwartung. Eine Erwartung ist nicht sicher, sondern wie eine Wette. Pascals Wette kann man so zusammenfassen: Pascals Wette: Ich weiß nicht, ob Gott existiert. Aber ich weiß, wenn ich an ihn glaube und er 3 nicht existiert, dann werde ich einige Momente weltlicher Lust und Laster versäumen. Wenn ich aber nicht an ihn glaube und er dennoch existiert, dann werde ich mit ewiger Verdammung und ewigem Elend dafür bezahlen. Wor-auf soll ich wetten? Für Pascal ist die Antwort klar: Auch wenn man die Chance, dass Gott existiert, für beliebig gering hält, werden doch, falls er existiert, die Folgen unabsehbar hoch sein: unendlich die Seligkeit der Erlösten, aber auch unendlich das Elend der Verdammten. Unter diesen Umständen, so Pascals Argument, verlangt rationales Eigeninteresse, dass wir unsere sicheren, aber nur endlichen weltlichen Freuden dem ungewissen, aber unendlichen Gewinn der Erlösung opfern. Pascals Wette illustriert eine radikal neue Denkweise, die mit der Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie einhergeht. Religiosität ist eine Frage der Erwartung, nicht des unbedingten Glaubens, und diese Erwartung ist unsicher. Es ist wohl kein Zufall, dass zur selben Zeit, als das neue Denken in Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen Fuß fasste, der Gebrauch der Folter in Europa zurückging. In der Inquisition war die Folter das Werkzeug, um die eindeutige Wahrheit herauszufinden - ein Zweck, der die Mittel heiligte. Pascals Grundbegriff war nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Erwartung, die später als Produkt aus der Wahrscheinlichkeit pi eines Ereignisses i und seinem Wert xi bestimmt wurde: E = ∑pixi. Beispielsweise beträgt am Rouletttisch die Wahrscheinlichkeit von „Rot“ und „Schwarz“ jeweils 18/37 und jene von „Grün“ (null) beträgt 1/37. Wenn man 100 € auf „Rot“ setzt, beträgt also die Erwartung 18 200 18 0€ 1 0 € 97.79 € 37 37 37 Die Definition von rationalem Verhalten durch die Erwartung wurde zum Grundstein des neuen Verständnisses dafür, mit Unsicherheiten umzugehen, statt sie zu verleugnen, und mit falschen Sicherheiten zu leben. Aber die Definition von rationalem Handeln als Maximierung der Erwartung war noch nicht das Ende der Geschichte. Die mathematische Erwartung geriet bald in unerwartete Schwierigkeiten. 3. Das St.-Petersburg-Paradox Das St.-Petersburg-Paradox brachte den ersten großen Konflikt zwischen dem Konzept der rationalen Erwartung und dem gesunden Menschenverstand (Jorland, 1987). Nicholas Bernoulli wies als Erster in einem Brief an Pierre de Montmort auf das Problem hin; dieser veröffentlichte es in der zweiten Auflage seines Essai d’ analyse sur les jeux de hasard (1713). Daniel Bernoulli, ein Vetter von Nicholas, veröffentlichte im Jahre 1738 eine mögliche Lösung in den Jahrbüchern der Petersburger Akademie, daher kommt der Name des Problems. St.-Petersburg-Spiel: Pierre und Paul spielen ein Glücksspiel mit einer fairen Münze. Wenn das Ergebnis des ersten Wurfs „Zahl“ ist, muss Pierre an Paul 1 € zahlen und das Spiel ist beendet. Wenn „Zahl“ erst beim zweiten Wurf kommt, erhält Paul 2 €; wenn dies erst beim dritten Wurf geschieht, gewinnt er 4 € und so weiter. Wie hoch ist der faire Preis, den Paul zahlen sollte, um das Spiel zu spielen? Wie viel würden Sie bieten? Der faire Preis ist jene Summe, bei der eine Person unentschieden ist, die Rolle von Pierre oder die von Paul zu spielen. (Wenn ein Kind ein Stück Kuchen in zwei Teile teilt, und das andere Kind die Wahl hat, handelt es sich um dasselbe Prinzip von Fairness.) Nach der klassischen Theorie der Rationalität ist der faire Preis durch die mathematische Erwartung definiert: 1 1 1 E 1 € 2 € 4 € 2 4 8 1 n ... 2 n 1 € ... 2 In Worten, mit der Wahrscheinlichkeit p = gewinnt Paul 1 €, mit p = 1 2 1 gewinnt er 2 €, mit 4 1 gewinnt er 4 € und so weiter. Man kann 8 sehen, dass jedes der Glieder auf der rechten Seite 1 der Gleichung einer Erwartung von € entspricht, 2 und da deren Anzahl unendlich ist, ist der Erwartungswert ebenfalls unendlich groß. Gemäß der Theorie, dass die Erwartung der faire Preis ist, sollte jeder von uns all sein Vermögen einsetzen, um dieses Spiel zu spielen - und dies würde sogar noch von Vorteil sein, da das Vermögen ja nur endlich groß ist. Kein vernünftiger Mensch ist p= 4 jedoch bereit, mehr als eine kleine Summe, vielleicht 5 bis 10 €, für dieses Spiel zu bieten. Die Mathematiker nannten diesen Widerspruch zwischen Theorie und gesundem Menschenverstand das „St.-Petersburg-Paradox“. Nach unserem heutigen Verständnis liegt aber kein Paradox vor: Es gibt keinen Widerspruch zwischen Resultaten, die sich aus gleich validen Annahmen ableiten lassen. Nach dem klassischen Verständnis war die Theorie der Wahrscheinlichkeit jedoch keine reine, inhaltsfreie Theorie, sondern untrennbar von ihrem Gegenstand. Und dieser Gegenstand war die menschliche Vernunft. Der Widerspruch zwischen Theorie und Vernunft wurde daher als ein Paradox interpretiert. Daniel Bernoulli versuchte diesen Widerspruch zu lösen. Er argumentierte, dass es beim St.Petersburg-Problem nicht alleine um Fairness gehe und man anstelle der mathematischen Erwartung die „moralische“ Erwartung des umsichtig abwägenden Kaufmanns einführen sollte. Diese definierte er als das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses und dem, was später sein Nutzen genannt wurde. Bernoulli argumentierte, dass ein Gewinn von 200 € (in moderner Währung) nicht notwendigerweise doppelt soviel wert ist wie ein Gewinn von 100 €, und dass ein Spieler umso mehr Geld gewinnen muss, um glücklich zu werden, je reicher er schon ist. Nehmen wir an, die Beziehung zwischen € (x) und Nutzen N ist logarithmisch, N(x) = ln(x), und ihr derzeitiges Vermögen V beträgt 50.000 €. Dann berechnet sich der sichere Gewinn G, der denselben Nutzen hat wie die Teilnahme am St.Petersburg-Spiel, wie folgt: 1 1 1 N (V 1) N (V 2) N (V 4) ... 2 4 8 Die Berechnung ergibt einen Wert von etwa 9 €. In Worten ausgedrückt, für jemanden, der ein Vermögen von 50.000 € besitzt, beträgt der erwartete Nutzen dieses Spiels nur 9 €. Dieser Wert liegt im Bereich dessen, was jemand mit einem gesunden Menschenverstand bereit ist, für das Spiel zu zahlen. Mit dieser Lösung des St.-Petersburg-Paradox transformierte Daniel Bernoulli das Konzept des erwarteten Werts von Pascal-Fermat in das Konzept des erwarteten Nutzens, das auch heute noch die Wirtschaftswissenschaften dominiert. Nicholas Bernoulli, der Professor für Römisches und Kanonisches Recht an der Universität Basel war, hielt dagegen weiterhin an Fairness als Modell der menschlichen Vernunft fest, da er dieses als die N (V G) Grundlage für rechtliche Verträge ansah. Daniel Bernoulli nahm dagegen seine Inspiration aus der Welt von Handel und Gewerbe, nicht aus dem Recht. Für ihn war Vernünftigkeit kluger Geschäftssinn, und es war sicherlich nicht wirtschaftlich klug, eine hohe Summe in das St.Petersburg-Spiel zu investieren. Für sein neues Verständnis von rationalem Verhalten war der Prototyp eines vernünftigen Menschen nicht mehr der unparteiische Richter, sondern der umsichtig abwägende Kaufmann. Die mathematische Theorie der menschlichen Vernunft hatte eine Wende vollzogen. 4. Pro Monogamie: Der erste Nullhypothesentest Die mathematische Wahrscheinlichkeit hat drei Quellen: Glücksspiel, Gerichtshof und statistische Tabellen. Die drei Hauptinterpretationen des Konzepts der Wahrscheinlichkeit entstammen diesen drei Anwendungen: Propensität, subjektive Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit. Mit Propensität (Englisch: propensity) ist das Design eines Würfels oder eines Roulettrads gemeint, das die Wahrscheinlichkeit bestimmt. Das Konzept der subjektiven Wahrscheinlichkeit kommt aus rechtlichen Fragen, etwa wie hoch ein Richter die Glaubwürdigkeit von Zeugen einschätzen soll, zum Beispiel wenn diese mit dem Angeklagten verwandt oder nicht verwandt sind. Die Interpretation von Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit auf lange Sicht basiert auf statistischen Informationen wie Geburtenund Sterblichkeitstabellen. Diese Tabellen waren eine der ersten systematischen Datenbanken, die in der westlichen Welt angelegt wurden, und zugleich die Basis für den ersten Nullhypothesentest. John Arbuthnot (1710) stellte eine alte Frage: Gibt es einen aktiven Gott? Seine Methode, eine Antwort zu finden, aber war neu und revolutionär. Er suchte nach Fakten statt Rhetorik und nach einem empirischen Test. Arbuthnot beobachtete, dass Männer gefährlicher leben als Frauen und dass mehr junge Männer als Frauen durch Unfälle sterben. Wenn es einen aktiven Gott gibt und dieser Monogamie vorsieht, so argumentierte er, wird er mehr Jungen als Mädchen erzeugen, um diesen Verlust zu kompensieren. Arbuthnot testete diese Hypothese göttlicher Vorsehung gegen die Nullhypothese von blindem Zufall. Dazu untersuchte er die Geburtenstatistiken, die damals seit 82 Jahren in London geführt wurden. Er stellte fest, dass in jedem der 82 Jahre mehr Jungen als Mädchen geboren wurden, und berechnete die 5 „Erwartung“ dieses Ergebnisses (D) unter der Nullhypothese (H0): 82 1 p D | H 0 . 2 Weil diese Wahrscheinlichkeit so außerordentlich klein war, schloss er blinden Zufall aus und sah das Ergebnis als Beweis für die göttliche Vorsehung. Hier ist seine Folgerung in seinen eigenen Worten: „Scholium. From hence it follows, that Polygamy is contrary to the Law of Nature and Justice, and to the Propagation of the human Race; for where Males and Females are in equal number, if one Man takes Twenty Wifes, Nineteen Men must live in Celibacy, which is repugnant to the Design of Nature; nor is it probable that Twenty Women will be so well impregnated by one Man as by Twenty.“ Arbuthnots Idee, eine Behauptung gegen statistische Daten zu testen, war revolutionär und seiner Zeit weit voraus. Nullhypothesentests kamen erst im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert in Gebrauch und wurden durch die Arbeiten des Statistikers und Genetikers Sir Ronald Fisher popularisiert. Arbuthnots Test macht zugleich die Möglichkeiten und Grenzen eines Nullhypothesentests (Arbuthnot verwandte diesen Begriff noch nicht) so klar wie kaum ein späteres Beispiel. Dieser Test liefert die Wahrscheinlichkeit einer Serie von Beobachtungen (in jedem von 82 Jahren mehr Jungen als Mädchen), falls die Nullhypothese gilt. Die erste Beschränkung liegt darin, dass in dieser Methode per Definition die Forschungshypothese (hier: göttliche Vorsehung) selbst nicht in statistischer Form formuliert wird. Die göttliche Vorsehung gewinnt immer, falls die Nullhypothese verliert, die einzige Bedingung hier ist, dass mehr Jungen geboren werden. Welches Verhältnis aber die Forschungshypothese vorhersagt, wird nicht spezifiziert. Die zweite Beschränkung liegt darin, dass keine Alternativhypothese in statistischer Form getestet wird. Beispielsweise könnte eine Alternativhypothese besagen, dass 3% aller weiblichen Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt illegal ausgesetzt oder getötet werden und deshalb nicht in der Statistik auftauchen. Selbst wenn das der Fall ist, würde Arbuthnots Test dennoch diesen Effekt der göttlichen Vorsehung zuschreiben. Der Mangel an präzisen Forschungsund Alternativhypothesen ist das größte Problem in Arbuthnots Test, und das gilt ebenfalls für die heutigen Anwendungen von Nullhypothesentests in den Sozialwissenschaften (Gigerenzer, 1993). Die Bedeutung von Arbuthnots Vorgehen liegt jedoch nicht in der besonderen Struktur dieses Nullhypothesentests, sondern in der bahnbrechenden Idee, Fragen durch Heranziehen empirischer Daten zu entscheiden. Dies war damals ein revolutionäres Vorgehen, doch die Revolution selbst musste noch fast zwei Jahrhunderte warten. Arbuthnots Test fand keine Beachtung. Wenn wir uns darüber wundern, sollten wir nicht vergessen, dass es auch heute keine Ausnahme ist, dass Ideologien statt empirischer Evidenz über religiöse, pädagogische und politische Fragen entscheiden. 5. Wer entdeckte die Regel von Bayes? Das Testen einer Nullhypothese blieb nicht die einzige Methode, eine Hypothese zu testen. Die Regel von Bayes ist eine der bekanntesten Alternativen. Thomas Bayes (1702-1761) war ein Reverend der „Nonconformist Church“. Er hat seine berühmte Abhandlung über das Problem der „inversen Wahrscheinlichkeit“ die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese gegeben Evidenz - nie selbst veröffentlicht. Dafür hat ihm R. A. Fisher (1935) später gratuliert, denn Fisher war der Meinung, dass die Regel von Bayes für das Testen wissenschaftlicher Hypothesen nutzlos sei. In Fishers Augen hatte Bayes dies erkannt, doch seine Bewunderer nicht. Die Regel von Bayes wurde nach seinem Tod von Richard Price im Jahre 1763 publiziert. Für den einfachsten Fall mit binären Hypothesen, H1 und H2, und einem Datum (Evidenz) D ergibt sich die Regel von Bayes (in moderner Terminologie) als: p(H 1 | D) = p(H )p(D | H ) 1 1 p(H )p(D | H ) p(H )p(D | H ) 1 1 2 2 In Worten ausgedrückt, die Aposteriori-Wahrscheinlichkeit p(H1|D) ergibt sich aus der AprioriWahrscheinlichkeit p(H1) und den Wahrscheinlichkeiten p(D|H1) und p(D| H2). Betrachten wir eine moderne Anwendung, HIVScreening für Personen ohne Risikoverhalten, das heißt, HIV-Tests für Personen, die z.B. nicht intravenös Drogen spritzen (Gigerenzer, 2002). Mit einem positiven Testergebnis (D) ist hier gemeint, dass eine Blutprobe sowohl in dem Suchtest (Elisa) als auch in dem Bestätigungstest (Western-BlotTest) positiv testet. In Deutschland ist etwa einer von je 10.000 Männern ohne Risikoverhalten HIV-infiziert. Die Wahrscheinlichkeit p(D|H1), dass der Test positiv 6 (D) wird, wenn der Mann infiziert ist, beträgt .999. Die Wahrscheinlichkeit p(D|H2), dass der Test positiv wird, wenn der Mann nicht infiziert ist, beträgt .0001. Ein Mann testet positiv. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit p(H1|D), dass er wirklich mit dem Virus infiziert ist? Wenn man diese Werte in die Regel von Bayes einsetzt, dann erhält man einen Wert von p(H1|D) = .5. Nur jeder zweite, der positiv testet, hat demnach tatsächlich den Virus. Die meisten professionellen AIDS-Berater an deutschen Gesundheitsämtern teilen Klienten dagegen fälschlicherweise mit, dass es absolut sicher oder zumindest zu 99,9% sicher sei, dass man infiziert sei (Gigerenzer, Hoffrage & Ebert, 1998). Die Ausbildung dieser Berater im statistischen Denken lässt sehr zu wünschen übrig. Die Folgen dieser Fehlinformation können vom Verlust des Arbeitsplatzes bis zum Selbstmord reichen. Die Regel von Bayes ist vom Testen von Nullhypothesen zu unterscheiden. Betrachten wir das HIV-Screening einmal aus der Perspektive des Nullhypothesentestens. Die H0 postuliert hier, dass eine Person nicht durch HIV infiziert ist. Man erhält dennoch ein positives Ergebnis (D) und stellt die Frage, ob dieses Ergebnis signifikant ist. Die Wahrscheinlichkeit p(D|H0) des positiven Testergebnisses gegeben, dass die Nullhypothese wahr ist, beträgt .0001. Dies ist ein signifikantes Ergebnis. Daher wird die Nullhypothese zurückgewiesen und zwar mit einem hohen Grad von „Vertrauen“. Wie die Regel von Bayes jedoch zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit einer HIVInfektion gegeben ein positives Testergebnis nur .5. Warum kommen beide Methoden zu verschiedenen Aussagen? Die Regel von Bayes berücksichtigt die drei Wahrscheinlichkeiten p(H1), p(D|H1) und p(D|H2), während der Nullhypothesentest nur die letztere Wahrscheinlichkeit berücksichtigt. Beim HIV-Screening oder anderen Reihenuntersuchungen kennt man die Grundrate einigermaßen genau und kann daher diese als Apriori-Wahrscheinlichkeit einsetzen. Wenn es sich jedoch um eine wissenschaftliche Hypothese handelt, hat man in der Regel keine statistische Information, welche dieser Grundrate entspricht, und die Apriori-Wahrscheinlichkeit wird notwendig subjektiven Charakter haben. Die mögliche Beliebigkeit subjektiver Wahrscheinlichkeiten war das Ziel von R. A. Fishers Attacke gegen die Verwendung der Regel von Bayes für die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von Hypothesen. Zurück zu Thomas Bayes. Der Historiker der Statistik, Stephen M. Stigler (2001), hat einmal ein Gesetz über den Ursprung von Erkenntnissen aufgestellt, das er Law of Eponymy nannte. Dieses Gesetz besagt, dass keine wissenschaftliche Entdeckung nach ihrem ursprünglichen Entdecker benannt ist. Das Theorem von Pythagoras wurde nicht von Pythagoras entdeckt, Pascals Dreieck stammt nicht von Pascal, und die Gaußsche Verteilung wurde auch nicht von Gauß entdeckt. Die Regel von Bayes scheint keine Ausnahme zu sein. In einer spannenden Detektiv-Geschichte berechnete Stigler eine Wahrscheinlichkeit von drei zu eins, dass tatsächlich Nicholas Saunderson und nicht Thomas Bayes die Regel entdeckt hat. Saunderson, der seit seinem ersten Lebensjahr vollständig blind war und Optik lehrte, hatte den begehrten „Lucasian Chair of Mathematics“ in Cambridge inne, den vor ihm Newton hatte. Er starb im Jahre 1739. Man kann Bayes jedoch nicht die weniger höfliche (und falsche) Interpretation von Stiglers Gesetz vorwerfen, die besagt, dass jede wissenschaftliche Entdeckung nach der letzten Person benannt sei, die ihre Vorgänger nicht zitiert hat. Wie bereits erwähnt hat Bayes seine Abhandlung ja nie veröffentlicht. Bleibt noch die Frage: Wer entdeckte Stiglers Gesetz? 6. Die erste Nacht im Paradies Der erste Tag im Paradies geht zu Ende. Adam und Eva legen sich zur Ruhe. Sie hatten am Tag die Sonne aufgehen sehen und sie bewundert, wie sie am Himmel ihre Bahn zog und all die herrlichen Bäume, Blumen und Vögel beschien. Irgendwann wurde es aber kühler, während die Sonne unter dem Horizont verschwand. Würde es jetzt auf ewig dunkel bleiben? Adam und Eva fragen sich sorgenvoll, welche Chance sie wohl haben, dass die Sonne wieder aufgeht? Im Nachhinein könnten wir vermuten, dass Adam und Eva sicher waren, dass die Sonne wieder aufgeht. Aber sie hatten die Sonne ja erst einmal am Firmament emporsteigen sehen. Was also konnten sie erwarten? Die klassische Antwort auf dieses Problem wurde im Jahre 1812 von dem französischen Mathematiker Pierre Simon de Laplace gegeben. Wenn Adam und Eva die Sonne niemals hätten aufgehen sehen, würden sie für beide möglichen Ereignisse (das Wieder-Aufgehen und das DunkelBleiben) gleiche Wahrscheinlichkeiten ansetzen. Daher würden sie - für das Wieder-Aufgehen der Sonne - einen weißen Stein in einen Beutel stecken, außerdem einen schwarzen Stein für das Dunkel7 Bleiben. Aber sie hatten ja schon einmal gesehen, wie die Sonne aufging, und legten deshalb einen weiteren weißen Stein in den Beutel. Dort lagen jetzt also zwei weiße Steine und ein schwarzer. Das bedeutet, ihr Überzeugungsgrad, dass die Sonne 1 2 wieder aufgehen wird, war von auf gestiegen. 2 3 Nach dem folgenden Tag - also nach dem zweiten Sonnenaufgang, den sie erlebten - gaben sie einen dritten weißen Stein hinzu; nun war für sie die Wahrscheinlichkeit für einen Sonnenaufgang von 2 3 auf angewachsen. Laplaces Sukzessionsregel 3 4 (Regel der Folge) gibt allgemein die Wahrscheinlichkeit p(E|n) an, dass ein Ereignis E wieder auftritt, nachdem es n mal eingetreten ist: p(E|n) = (n+1)/(n+2). Ein 27-Jähriger hat in seinem Leben ungefähr 10.000 Sonnenaufgänge erlebt. Daher beträgt für ihn der Überzeugungsgrad, dass die Sonne auch am 10.001 nächsten Tag wieder aufgeht, . Diese 10.002 Anwendung von Laplaces Regel ist auf Kritik gestoßen. Da die Regel von Laplace aus der Regel von Bayes hergeleitet ist, zeigt diese Kritik zugleich Probleme mit der Anwendung der Regel von Bayes auf. Anders als bei dem HIV-Screening, wo der Grundanteil der Infektion in der betreffenden Population bekannt ist, konnten Adam und Eva anfangs keinen Grundanteil der Sonnenaufgänge kennen. Sie konnten also nicht wissen, wie viele weiße oder schwarze Steine sie am ersten Abend in den Beutel stecken mussten. Als Pessimisten hätten sie vielleicht einen weißen und zehn schwarze Steine genommen, als Optimisten dagegen zehn weiße und nur einen schwarzen. Wenn man keine Informationen zum Abschätzen der Wahrscheinlichkeiten hat, kann man den möglichen Ereignissen oder Ergebnissen gleich hohe Wahrscheinlichkeiten zuschreiben. Diese Faustregel nennt man Indifferenzprinzip. Seine Befürworter verteidigen es damit, dass die anfängliche Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten umso geringere Auswirkungen hat, je mehr Beobachtungen man einfließen lässt. Beispielsweise erhält man für die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne morgen aufgeht, nach zehn Jahren, also nach über 3.650 Sonnenaufgängen, praktisch denselben Wert, unabhängig davon, ob man als Pessimist oder Optimist begann. Die problematische Annahme der Indifferenz hat Laplace tatsächlich an zwei Stellen gemacht, und man kann das sehen, wenn man die Regel von Bayes verwendet. H1 und H2 stehen für die Hypothesen, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht bzw. nicht jeden Morgen aufgeht, und D dafür, dass Adam und Eva einen Sonnenaufgang beobachtet haben. Dann ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit p(H1|D) wie folgt: p(H1 | D) = p(H )p(D | H ) 1 1 p(H )p(D | H ) p(H )p(D | H ) 1 1 2 2 Nun kennen aber Adam und Eva die Grundrate nicht. Die Faustregel, das Indifferenzprinzip, 1 nimmt an: p(H1) = p(H2) = . Damit vereinfacht 2 sich die Regel von Bayes zu: p(H1 | D) = p(D | H ) 1 p(D | H ) p(D | H ) 1 2 Die Wahrscheinlichkeit p(D|H1) ist per Definition 1, aber die Wahrscheinlichkeit p(D|H2) ist nicht bekannt. Hier wird das Indifferenzprinzip nochmals 1 angewandt: p(D|H2) = . Daraus erhält man 2 schließlich: pH 1 | D 2 . 3 Die erste Nacht im Paradies illustriert die Problematik, die Regel von Bayes in Situationen anzuwenden, in denen keine oder unzureichende empirische Daten vorliegen. Das Indifferenzprinzip, so umstritten es ist, spielt auch heute eine Rolle, beispielsweise in Vaterschaftsprozessen. Um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein Mann wirklich der Vater eines Kindes ist, braucht man, wie die Regel von Bayes zeigt, eine AprioriWahrscheinlichkeit oder Grundrate. Aber was könnte diese Apriori-Wahrscheinlichkeit sein? Viele Laboratorien verwenden hier das Indifferenzprinzip und nehmen eine Apriori-Wahrscheinlichkeit von 50% dafür an, dass der Angeklagte tatsächlich der Vater ist (Gigerenzer, 2002). Diese Praxis ist umstritten, da sie voraussetzt, dass der Angeklagte genauso wahrscheinlich der Vater ist wie alle anderen Männer zusammen. Die Frage ist, wie man die beiden Fehler gewichten soll, die ein Richter machen kann: Einen Schuldigen freizusprechen oder einen Unschuldigen verurteilen. Die französischen Mathematiker Dennis Poisson und Pierre Laplace vertraten eine konservative Linie - der Schutz der Gesellschaft vor Kriminellen ist wichtiger als der Schutz des Individuums vor falscher Verurteilung - gegen die früheren liberalen Reformen des Philosophen und 8 Politikers Condorcet. Die Antwort auf diese Frage trennt Liberale von Konservativen, heute wie in den vergangenen Jahrhunderten. 7. Die Illusion von Gewissheit Die klassische Theorie der Wahrscheinlichkeit überkam das Streben nach absoluter Gewissheit mit einer epistemischen Interpretation von Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass die Ursache der Ungewissheit in der Unkenntnis des Menschen, nicht aber in der Natur selbst gesehen wurde. Die Vertreter der klassischen Theorie, von Pascal bis Laplace, waren Deterministen: Sie hielten die Welt selbst für vollständig determiniert. Gott oder seine säkulare Version, Laplaces Superintelligenz, braucht keine Statistik, nur wir Menschen können ohne diese nicht auskommen. Das war auch noch Albert Einsteins Sicht: Gott würfelt nicht. Eine ontische Interpretation der Wahrscheinlichkeit musste bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts warten, als der Begründer der Psychophysik, Gustav Theodor Fechner, und der Philosoph Charles Sanders Peirce den Zufall als eine Eigenschaft der Natur postulierten. Die Evolution des statistischen Denkens, die ich an sechs klassischen Problemen illustriert habe, ist vor allem eine Entwicklung des skeptischen Denkens. Dieses Einmaleins der Skepsis hat mehrere Seiten. Wie Pascals Wette veranschaulicht, ist die Basis für skeptisches Denken der Übergang vom Streben nach Gewissheit zum vernünftigen Umgang mit einer unsicheren Welt. Benjamin Franklin sagte einmal, „nichts ist sicher in dieser Welt außer der Tod und die Steuern“. Diese scherzhaft formulierte, aber tiefe Einsicht ist auch heute noch für viele Menschen zu schmerzhaft, um sie als Lebensgefühl zu akzeptieren. Das Streben nach trügerischer Gewissheit ist ein Teil unseres emotionalen und kulturellen Erbes. Es erfüllt die Sehnsucht nach Sicherheit und Autorität. Die Esoterik-Abteilungen der heutigen Buchhandlungen zeugen davon, dass viele Menschen sich nach schnellem Glauben sehnen. Zu allen Zeiten erdachte man Glaubenssysteme, wie Religion, Astrologie und Weissagung, die Sicherheit und Gewissheit versprechen und in denen die Menschen Trost finden können - vor allem jene, die Schweres erleiden müssen. Gewissheit ist inzwischen zu einer Ware geworden. Sie wird weltweit vermarktet: durch Versicherungsgesellschaften, Anlageberater und Wahlkämpfer, aber auch in Medizin und Pharmazie. Im 17. Jahrhundert bestand in Europa der Erwerb einer Lebensversicherung darin, eine Wette auf die Lebensdauer eines prominenten Bürgers abzuschließen. Zum Beispiel ging es darum, ob der Bürgermeister von Paris innerhalb einer bestimmten Zeitspanne sterben würde; wenn ja, dann konnte derjenige, der darauf gesetzt hatte, womöglich ein kleines Vermögen gewinnen (Daston, 1987, 1988). Das war ein Spiel wie dasjenige des Chevalier de Méré, nicht aber eine sittliche Verpflichtung. Heutzutage reden uns die Versicherungsvertreter ein, dass es bei einer Lebensversicherung um eine Absicherung gehe und es moralisch geboten sei, sozusagen Geld auf unser eigenes Leben zu setzen, damit die Hinterbliebenen im Ernstfall versorgt seien. Auch politische Parteien schüren den Drang nach Sicherheit. Vor den Bundestagswahlen 1998 warb die CDU mit dem Slogan „Sicherheit statt Risiko“. Solche Versprechungen waren nicht nur vom damaligen Kanzler Helmut Kohl und seinen Parteifreunden zu hören - auch andere Parteien behaupteten im Wahlkampf, Sicherheit zu bieten. Die Illusion der Gewissheit kann erzeugt werden, um politische oder wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Nehmen wir als Beispiel die Rinderkrankheit BSE. BSE griff im Jahr 2000 in Großbritannien, Irland, Portugal, Frankreich und der Schweiz um sich, während die deutsche Regierung ihr Land für BSE-frei erklärte. „Deutsches Rindfleisch ist sicher“ – diese Phrase wiederholten der Präsident des Bauernverbandes, der Landwirtschaftsminister und eine ganze Beamtenschar unentwegt. Die Deutschen hörten das nur zu gerne. Der Import von englischem Rindfleisch wurde verboten, und man empfahl den Verbrauchern, beim Metzger nur Fleisch von Rindern zu verlangen, die in Deutschland gezüchtet worden waren. In anderen Ländern, so wurde verbreitet, seien mangelnde Sorgfalt und Kontrolle an der Tagesordnung. Als man schließlich doch zahlreiche BSE-Tests an deutschen Rinderherden vornahm, zeigte sich die Erkrankung auch hier. Die Öffentlichkeit war völlig überrascht, Minister mussten zurücktreten, die Preise für Rindfleisch fielen drastisch, und andere Länder verboten nun ihrerseits den Import von deutschem Rindfleisch. Die Regierung gestand schließlich ein, sich zu lange an die Illusion geklammert zu haben, deutsches Vieh sei von dieser Krankheit überhaupt nicht betroffen. Das Spiel mit dem Versprechen von Sicherheit ging indes weiter, nur waren die Akteure jetzt andere. Supermärkte und Metzger hängten Plakate auf und verteilten Broschüren, in denen sie ihren Kunden versicherten: „Unser 9 Rindfleisch ist garantiert BSE-frei.“ Einige begründeten diese Aussage damit, dass ihre „glücklichen Kühe“ auf ökologischen Wiesen weiden konnten, und andere behaupteten, ihre Rinder seien sämtlich überprüft worden - kaum jemand erwähnte, dass bei diesen Tests zahlreiche Fehler auftreten. Als die Medien schließlich von einer Kuh berichteten, die negativ getestet worden war und dennoch BSE hatte, war die Öffentlichkeit erneut schockiert. Wieder war eine Illusion der Gewissheit dahin. Regierung und Supermärkte hatten vor allem die Beruhigung der Verbraucher im Sinn und weniger die Information über BSE. Die Illusion von Gewissheit ist nicht immer für alle bestimmt; zuweilen wird sie nur für ein ausgewähltes Publikum heraufbeschworen. So schilderte Jay Katz, Juraprofessor an der Yale University, einmal eine Diskussion mit einem befreundeten Chirurgen. Das Gespräch drehte sich um die Ungewissheiten bei der Behandlung von Brustkrebs. Beide waren sich darin einig, dass niemand weiß, wie die optimale Therapie aussieht. Katz fragte seinen Freund, wie er seine Patientinnen berät. Der Chirurg antwortete, er habe erst kürzlich einer Patientin mit Brustkrebs dringend eine Radikaloperation als beste Therapie empfohlen. Katz hielt seinem Freund vor, sich widersprüchlich zu verhalten: Wie könne er plötzlich so sicher sein, was die optimale Therapieform sei? Der Chirurg gab zu, die Patientin kaum zu kennen, beharrte aber darauf, dass seine Patientinnen die Ungewissheit über die beste Therapie weder verstehen noch hinnehmen würden, wenn sie davon wüssten. Wenn man dieser Ansicht folgt, dann wünschen die Patientinnen die Illusion der Gewissheit, und diese Patientin bekam sie auch. Können moderne Technologien den Rest an Unsicherheit nicht bald beseitigen und Sicherheit endlich herstellen? Auch dies ist eine verbreitete Illusion. Moderne HIV-Tests zählen beispielsweise zu den besten medizinischen Tests. Wie wir gesehen haben, ist dennoch - wegen der kleinen Grundrate von HIV-Infizierten ohne Risikoverhalten - nur etwa eine von zwei Personen, die positiv testen, tatsächlich infiziert. Die FalschNegativ-Rate liegt bei HIV-Tests bei nur etwa 0,1%; dennoch ist in der Literatur der Fall eines amerikanischen Bauarbeiters bekannt, der 35mal negativ testete, obgleich er mit dem Virus infiziert war. Medizinische Tests sind nicht absolut sicher, und das gleiche gilt für forensische Evidenz wie Fingerabdrücke, DNS-Profile und andere genetische Tests (Gigerenzer, 2002). 8. Empirisches Denken als Lebensgefühl Das Grundmotiv des skeptischen Denkens ist die Abnabelung vom Ideal sicheren Wissens. Die zweite Motivation ist eine intellektuelle Neugierde, die nicht bereit ist, Überzeugungen einfach beizubehalten oder abzulehnen, sondern diese aufgrund empirischer Evidenz bewerten möchte. Dies erfordert den Übergang von einer politischemotionalen Lebenshaltung, in der Meinungen durch die soziale Gruppe bestimmt sind, zu einem statistischen Lebensgefühl. Dieses ist relativ neu, da für viele Bereiche des menschlichen Lebens empirische Daten früher kaum vorhanden waren oder auch nicht gesucht wurden. John Arbuthnots statistischer Test war, trotz seiner offensichtlichen Mängel, ein früher Schritt in die Richtung, Überzeugungen durch Evidenz zu testen. Im 18. und 19. Jahrhundert waren statistische Informationen meist Staatsgeheimnisse, die nur einer Elite bekannt waren und der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Die Bedeutung statistischer Informationen, etwa von Bevölkerungszahlen, wurde aber von den politisch Verantwortlichen erkannt. Napoleons Gier nach Daten aus seinem bureau de statistique war legendär (Bourget, 1987). Und er wollte die Zahlen immer sofort haben. In seiner Umgebung hieß es: Wenn du etwas von Napoleon willst, gib ihm Statistiken. Die Bereitschaft, wirtschaftliche und demographische Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist dagegen jüngeren Datums. Erst ab etwa 1830 wurden Statistiken veröffentlicht, zumindest einige. Seitdem hat eine „Lawine gedruckter Zahlen“, wie sich der Philosoph Ian Hacking ausdrückte, die heutige Welt in einen gewaltigen Ozean von Informationen verwandelt, der von Medien wie Fernsehen und Zeitschriften sowie vom Internet gespeist wird. Die zunehmende Verbreitung statistischer Informationen im 19. und 20. Jahrhundert korrelierte mit dem Aufkommen der Demokratien in der westlichen Welt. 9. Statistisches Denken statt statistischer Rituale Statistisches Denken ist nicht nur skeptisch gegenüber der Illusion von Gewissheit, sondern auch gegenüber dem Umgang mit Statistik selbst. Es ist nützlich, zwei Umgangsweisen zu unterscheiden: statistisches Denken und statistische Rituale. Statistisches Denken ist selbstreflektiv; es beinhaltet die Abwägung, welche Methode oder welches Modell für eine Situation die beste ist und 10 unter welchen Annahmen das gilt. Beispielsweise macht Laplaces Geschichte von der ersten Nacht im Paradies deutlich, dass die Anwendung der Regel von Bayes besser zu rechtfertigen ist, wenn man empirische Informationen über die Grundraten und die Wahrscheinlichkeiten hat, als wenn das nicht der Fall ist. Richter lassen heute die Regel von Bayes in Strafprozessen nur zu, wenn empirische Informationen vorhanden sind, und dann auch nicht immer. John Arbuthnots Gottesbeweis illustriert dagegen die Probleme und Grenzen des Nullhypothesentestens. Statistische Rituale sind heute in den Sozialwissenschaften weit verbreitet - anders als in der molekularen Biologie, der Kernphysik oder den anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen, wo diese nie Fuß fassen konnten. Wenn auf jedes Problem ein- und dieselbe Methode unreflektiert angewendet wird, dann haben wir ein statistisches Ritual vor uns. Beispielsweise berechnet man in manchen Bereichen der pädagogischen Psychologie mechanisch Pfadanalysen, in Bereichen der Persönlichkeitspsychologie ebenso mechanisch Faktorenanalysen und in der experimentellen Sozialpsychologie erinnert das ständige Nullhypothesentesten an zwanghaftes Händewaschen. Jede Disziplin hat ihr eigenes statistisches „Überich“, das bei ihren Mitgliedern Verhaltensweisen erzeugt, die an eine Neurose erinnern. Man fühlt den Druck, die Methode anwenden zu müssen, denn ohne sie fühlt man sich nackt. Nur ein geringer Prozentsatz der akademischen Psychologen versteht überhaupt, was ein signifikantes Ergebnis bedeutet oder was man daraus schließen kann. Das gilt selbst für Dozenten, die Statistik für Psychologen lehren (Oakes, 1986; Haller & Krauß, 2002). Viele glauben irrtümlicherweise, ein signifikantes Ergebnis - wie bei Arbuthnot - würde die Wahrscheinlichkeit angeben, dass die Nullhypothese richtig sei oder dass die Alternativhypothese falsch sei. Anders als die Regel von Bayes kann jedoch ein Nullhypothesentest keine Wahrscheinlichkeit für Hypothesen erbringen, lediglich eine Wahrscheinlichkeit für die Daten unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist. Alternative statistische Methoden, wie NeymanPearson Hypothesentests, Walds Sequentielle Tests, Tukeys „exploratory data analysis“ oder Bayes’ Statistik, sind kaum bekannt, und es besteht auch geringes Interesse, diese kennen zu lernen. Statistiker wie R. A. Fisher und Jerzy Neyman haben die gedankenlose Anwendung ein- und derselben statistischen Methode immer wieder kritisiert, aber die Betroffenen scheinen dies nicht bemerkt oder schlicht verdrängt zu haben (Gigerenzer, 1993; Gigerenzer et al., 1999). Die Evolution des statistischen Denkens hat nicht nur Probleme gelöst, sie hat auch neue Probleme erzeugt. Mit der Entwicklung der Theorie der Wahrscheinlichkeit wurde die Vielfalt von Konzepten, die im begrifflichen Umfeld von Zufall und Erwartung stand, auf einige ganz wenige eingeengt. Der Begriff „probabilitas“ bedeutete ursprünglich eine durch Autorität gesicherte Meinung. Dieses Konzept wurde nicht zum Gegenstand der Theorie, genauso wenig wie die nahe liegenden Kandidaten Glück und Schicksal. Die drei Interpretationen von Wahrscheinlichkeit, mit der die Theorie begann, sind noch heute oft miteinander in Konflikt. Ist Wahrscheinlichkeit eine relative Häufigkeit in einer Referenzklasse von Ereignissen wie in statistischen Tabellen? Oder ist sie der Grad der subjektiven Überzeugung, die eine vernünftige Person hat? Oder ist sie durch das Design bestimmt wie die Konstruktion eines Würfels? Diese Frage trennt die Frequentisten, wie Richard von Mises und Jerzy Neyman, von den subjektiven Bayesianern, wie De Finetti und Leonard Savage, und von den Vertretern von Propensitäten wie Karl Popper. Die Antwort auf diese Frage bestimmt den Gegenstandsbereich der Theorie. Für einen Subjektivisten ist dieser unbegrenzt; alles in der Welt, wozu Menschen Überzeugungen haben, die den Gesetzen der Theorie folgen, ist möglicher Gegenstand. Dies schließt Wahrscheinlichkeiten für Einzelfälle mit ein, selbst für Ereignisse, die noch nie beobachtet wurden, wie die erstmalige Anhebung der Lebenserwartung auf mehr als 100 Jahre. Für einen Frequentisten bezieht sich die Theorie nur auf Aussagen über Elemente einer Referenzklasse, die als untereinander gleich angesehen werden können und für die hinreichend viel statistische Information vorliegt. Aus dieser Sicht ist die Theorie auf Situationen wie dem HIV-Screening anwendbar, wo genügend Daten vorliegen, nicht aber auf die erste Nacht im Paradies. Aus der Sicht der Wahrscheinlichkeit als Propensität (Design) ist der Anwendungsbereich der Theorie noch kleiner: Sie betrifft nur Gegenstände, deren Bauplan oder kausale Struktur wir kennen. Diese verschiedenen Auslegungen des Begriffs Wahrscheinlichkeit können unterschiedliche Abschätzungen des jeweiligen Risikos hervorrufen. Vor einigen Jahren nahm ich an einer Führung durch ein Werk der DASA (Daimler Benz Aerospace) teil, in dem die Ariane-Rakete hergestellt wird, die Satelliten in ihre Umlaufbahn 11 befördert. Ich stand mit dem Führer vor einem großen Plakat, auf dem alle bis dahin abgeschossenen 94 Raketen (Ariane, Modelle 4 und 5) aufgeführt waren, und fragte ihn, wie hoch das Risiko eines missglückten Starts sei. Er erwiderte, der Sicherheitsfaktor betrage etwa 99,6%. Das erschien mir überraschend hoch, denn auf dem Plakat sah ich acht Sterne, die für acht Unfälle standen. Ich fragte also, wie acht Unfälle von 94 Starts einem Sicherheitsfaktor von 99,6% entsprechen könnten. Daraufhin erklärte er, die DASA zähle nicht die Fehlstarts, sondern berechne den Sicherheitsfaktor aus der Konstruktion der einzelnen Teile der Rakete. Die Fehlstarts zu zählen würde menschliches Versagen einbeziehen. Er fügte hinzu, dass beispielsweise einer dieser Sterne letztlich auf ein Missverständnis zurückgehe, nämlich zwischen einem Arbeiter, der eine Schraube weggelassen hatte, und seinem Kollegen von der nächsten Schicht, der annahm, sein Vorgänger habe die Schraube eingesetzt. Somit beruhte das genannte Risiko von Fehlstarts der Ariane-Raketen auf einer Design-Interpretation und nicht auf den tatsächlichen Häufigkeiten. 10.Vom Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen Statistisches Denken ist ein Produkt der Zeit der Aufklärung. Der Philosoph Immanuel Kant begann seinen im Jahre 1784 verfassten Aufsatz „Zur Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ folgendermaßen: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Das sind klare und tiefe Gedanken. Der Schlüsselbegriff ist „Mut“. Dieser ist notwendig, weil man sich mit Hilfe des eigenen Verstandes nicht nur die Gefühle der Befreiung und der Selbstständigkeit verschaffen kann, sondern weil auch Strafe und Schmerz die Folge sein können. Kant selbst musste das erfahren. Einige Jahre nachdem er diese Sätze niedergeschrieben hatte, verbot ihm die Obrigkeit - aus Furcht, sein rationales Denken könne die Sicherheit der christlichen Lehre untergraben - weiterhin über religiöse Themen zu schreiben oder zu lehren. Ganz allgemein kann das Überwinden der Unmündigkeit bedeuten, dass man Lücken oder Widersprüche in Berichten, Tatsachen und Wertvorstellungen findet, an die man immer geglaubt hatte. Das Hinterfragen von Gewissheiten bedeutet oft das Hinterfragen von gesellschaftlicher Autorität. Mit Ungewissheiten leben zu lernen, stellt für Einzelne wie auch für Gesellschaften eine große Herausforderung dar. Ein großer Teil unserer Geschichte wurde von Menschen geprägt, die sich völlig sicher waren, dass ihre Sippe, Rasse oder Religion die von Gott oder vom Schicksal erwählte war - und die für sich daraus das Recht ableiteten, abweichende Ideen zu bekämpfen wie auch die Menschen, die davon „befallen“ waren. Es war ein langer Weg zu den heutigen Gesellschaftsformen mit größerer Toleranz gegenüber Ungewissheit und Vielfalt. Trotzdem sind wir noch weit davon entfernt, die mutigen und informierten Menschen zu sein, die Kant vor Augen hatte - ein Ziel, das sich in zwei schlichten lateinischen Wörtern ausdrücken lässt: Sapere aude. Habe den Mut, selbst zu denken. Erstveröffentlichung Gigerenzer, G. (2004). Die Evolution des statistischen Denkens. In Unterrichtswissenschaft – Zeitschrift für Lernforschung, 32. Jahrgang, Heft 1, S. 4 – 22. Weinheim: Juventa Literatur Arbuthnot, J. (1710). An argument for divine providence, taken from the constant regularity observ’d in the birth of both sexes. Philosophical Transactions of the Royal Society, 27, 186190. Bayes, T. (1763). An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical Transactions of the Royal Society, 53, 370-418. Übersetzung von: H. E. Timmerding (1908). Versuch zur Lösung eines Problems der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Leipzig: Wilhelm Engelmann (Oswalds Klassiker der exakten Wissenschaften, 169). Bernoulli, D. (1738). Specimen theoriae novae de mensura sortis. Commentarii academiae scientarum imperialis Petropolitanae, 5, 175192. Englische Übersetzung von: L. Sommer (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk. Econometrica, 22, 23-36. 12 Bourguet, M.-N. (1987). Décrire, compter, calculer: The debate over statistics during the Napoleonic period. In L. Krüger, L. Daston & M. Heidelberger (Eds.), The probalistic revolution: Vol I. Ideas in history (pp. 305-316). Cambridge, MA: MIT Press. Daston, L. (1987). The domestication of risk: Mathematical probability and insurance 1650-1830. In L. Krüger, L. Daston & M. Heidelberger (Eds.), The probabilistic revolution: Vol. I. Ideas in history (pp. 237-260). Cambridge, MA: MIT Press. Daston, L. (1988). Classical probability in the enlightenment. Princeton, NJ: Princeton University Press. Fisher, R. A. (1935). The design of experiments. Edingborgh: Oliver and Boyd. Gigerenzer, G. (1993). Über den mechanischen Umgang mit statistischen Methoden. In E. Roth (Hg.), Sozialwissen-schaftliche Methoden (3. Aufl., S. 607-618). München: Oldenbourg. Gigerenzer, G. (2002). Das Einmaleins der Skepsis. Berlin: Berlin Verlag. Gigerenzer, G., Hoffrage, U., & Ebert, A. (1998). AIDS counseling for low-risk clients. AIDS CARE, 10, 197-211. Gigerenzer, G., Swijtink, Z., Porter, T., Daston, L., Beatty, J., & Krüger, L. (1999). Das Reich des Zufalls. Heidel-berg: Spektrum. Hacking, I. (1975). The emergence of probability. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Hacking, I. (1990). The taming of change. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Haller, H., & Krauss, S. (2002). Misinterpretations of significance: A problem students share with their teachers? Methods of Psychological Research Online, 7, 1-20. Jorland, G. (1987). The St.-Petersburg-Paradox, 1713-1937. In L. Krüger, L. Daston & M. Heidelberger (Eds.), The probabilistic revolution: Vol. I. Ideas in history (pp. 157-190). Cambridge, MA: MIT Press. Krüger, L., Gigerenzer, G., & Morgan, M. (Eds.). (1987). The probabilistic revolution: Vol. II. Ideas in the sciences. Cambridge, MA: MIT Press. Laplace, P. S. (1812). Théorie analytique des probabilités. Paris: Courcies. Montmort, P. R. de. (1713). Essai d’analyse sur les jeux de hasard (2. Aufl.). Paris. Pascal, B. (1654/1970). Briefwechsel PascalFermat. In B. Pascal, Œuvres complètes (S. 1136-1158), hg. von Jean Mesnard (Œuvres diverses, Bd. 1). Paris: Bibliothèque Européenne - Desclès de Brouwer. Pascal, B. (1669/1904). Pensées. Hg. von Léon Brunschwicg (3 Bde.). Paris: Librairie Hachette. Deutsche Überset-zung von: W. Rüttenauer (1937). Gedanken. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung. Oakes, M. (1986). Statistical inference: A commentary for the social and behavioral sciences. New York: Wiley. Stigler, S. M. (1983). Who discovered Bayes theorem? American Statistician, 37, 290-196. Anschrift des Verfassers Prof. Dr. Gerd Gigerenzer Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Lentzeallee 94, 14195 Berlin [email protected] 13 Wie gut kannst Du schätzen? Und andere Probleme für den Statistik-Unterricht HELMUT W IRTHS, OLDENBURG Zusammenfassung: Es geht in diesem Beitrag um Unterrichtseinheiten, bei denen schnell Daten gewonnen oder bereitgestellt werden können, außerdem um Fragen, die sich Lernenden geradezu aufdrängen, und die sie geklärt wissen wollen. Wie sich dabei Begriffe, Methoden und Darstellungsarten der Statistik, auch die der explorativen Datenanalyse einsetzen lassen, wird in diesem Beitrag dargestellt, ebenso Hilfen, die ein zumindest graphikfähiger Taschenrechner bietet. Aufgabe: Die folgende Liste enthält die Namen von 14 bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Notiere das von Dir geschätzte Alter jeder Person, ohne mit jemanden darüber zu sprechen. Wenn Dir die Person unbekannt ist, versuche zu raten. Person Alter (geschätzt) Franziska von Almsick Franz Beckenbauer 1. Einführung Seit dem Schuljahr 2003/2004 gelten in Niedersachsen neue Richtlinien für den Mathematikunterricht in den Klassen 7 bis 10 des Gymnasiums. Für die Jahrgangsstufen 7 und 8 ist ein Lehrplanelement enthalten, in dem Statistikunterricht gefordert wird. Es soll dabei die Datenkompetenz der Lernenden gefördert und in statistisches Denken eingeführt werden. Zwar haben die Richtlinien für die Orientierungsstufe für Klasse 5 ebenfalls den Umgang mit Daten gefordert, doch konnte ich davon in Klasse 7 nichts feststellen. In der Regel wurde dieser Teil der Richtlinien dem Refrain eines Songs von Hans Scheibner folgend („Das macht doch nichts, das merkt doch keiner.“) gar nicht erst unterrichtet. Da auch für das Gymnasium keine Fortsetzung vorgesehen war, wird Unterricht in Statistik für viele Lehrende neu sein. In diesem Beitrag werden Anregungen gegeben, wie Statistik unterrichtet werden kann. 2. Schätzen des Alters bekannter Persönlichkeiten Engel [2001] habe ich die folgende Aufgabe entnommen und in mehreren Lerngruppen erprobt. Wer meint, die eine oder andere Persönlichkeit sei in seiner Lerngruppe zu wenig bekannt, setze dafür eine bekanntere ein und behalte dabei die Mischung zwischen jüngeren und älteren Personen bei. Bill Clinton Heike Drechsler Thomas Gottschalk Nelson Mandela Queen Elizabeth II Christina Rau Claudia Schiffer Michael Schumacher Arnold Schwarzenegger Katja Seizinger Wolfgang Thierse Jan Ullrich Soweit die Aufgabenstellung. Alle 14 Schätzungen sind schnell gemacht. Lernende wollen unbedingt wissen, ob sie gut geschätzt haben. Es entwickelt sich auch die Frage nach der besten Schätzung in der Lerngruppe. Um das zu entscheiden, müssen die Lernenden selbständig Kriterien entwickeln. In einer Lerngruppe wird das folgendermaßen formuliert: „Im Fußball wird die Rangfolge durch die erreichte Punktzahl festgelegt. Wer mehr Punkte hat, bekommt einen besseren Rangplatz. Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Tordifferenz, bei gleicher Tordifferenz die größere Anzahl der geschossenen Tore. Bei unserer Schätzaufgabe ist es so: Die Anzahl der richtigen Schätzungen legt die Reihenfolge fest. Aber wir Stochastik in der Schule 24 (2004) Heft 2, S. 14 – 23 14 brauchen noch ein weiteres Kriterium, das die Reihenfolge bei gleicher Anzahl an richtigen Schätzungen regelt.“ Ein zumindest graphikfähiger Taschenrechner kann die Situation veranschaulichen. Zeichnen wir ein Streudiagramm und tragen auf der x-Achse das wahre Alter und auf der y-Achse das geschätzte Alter ab. Richtige Schätzungen liegen auf der Gerade mit der Gleichung y = x, die wir noch zusätzlich einzeichnen. Die Schätzungen von Anke, Beate und Jan sind im folgenden Bild dargestellt Die Symbole bedeuten: stellt die Schätzungen von Jan, die von Beate und die von Anke dar. Man kann diesem Bild schon Hinweise entnehmen, wie die drei Personen schätzen. Wir unterstützen den Prozess, ein Kriterium zu finden, und stellen die Abweichungen des geschätzten Alters vom richtigen Alter dar. Eine negative Abweichung soll bedeuten, dass das Alter zu niedrig geschätzt wurde, entsprechend eine positive Abweichung, dass es zu hoch eingeschätzt wurde. Wir stellen eine neue Liste mit den Abweichungen her. Auch dies ist schnell geschehen, wenn wir es den Rechner durchführen lassen und im Tabellenkopf die entsprechende Gleichung eingeben. Die Abweichungen der Schätzungen der drei Personen von den wahren Werten ergeben folgendes Bild: Über Abweichungen wird in dieser Lerngruppe lange diskutiert. Thomas formuliert eine erste Bedingung: Je kleiner die Summe aller Abweichungen ist, desto besser ist die Schätzung. Seinem Beispiel die Summe 10 sei besser als 100 setzt Katharina als Gegenbeispiel entgegen, dass die Summe -100 nicht besser als -10 sei. Till fasst schließlich die Diskussion zusammen: Die Summe aller Abweichungen soll Null sein. Aber dagegen erhebt sich Widerstand aus der Lerngruppe. Dies Kriterium könne sowohl jemanden erfassen, der immer ganz schlecht schätzt, mal viel zu groß, ein anderes Mal viel zu klein, aber auch jemand, der immer nur ein wenig die richtige Lösung verfehlt. Also eignet sich das Kriterium „Die Summe aller Abweichungen soll Null sein.“ nicht zur Charakterix^^sierung des besten Schätzers. Statistik treiben heißt auch, die Fülle der Daten auf eine überschaubare Anzahl an Kennzahlen zu reduzieren, die immer noch möglichst viel Informationen über den Datensatz enthalten. Hier bieten sich die folgenden fünf Kennzahlen an, die einfach zu bestimmen und zu interpretieren sind: Das Maximum, das Minimum der Daten, der Median und die beiden Quartile. Wie diese aus einer sortierten Datensammlung bestimmt werden können, und wie daraus ein Maximum-Minimum-Boxplot oder ein Boxplot, der mögliche Ausreißern besonders hervorhebt, gezeichnet werden kann, wird zum Beispiel in Wirths [2002] dargestellt. Nun folgt der Boxplot zu den Abweichungen der Schätzungen der drei Personen von den wahren Werten: 15 Nach Meinung der Lerngruppe treten bei den Boxplots die Eigenheiten der drei Personen beim Schätzen besonders deutlich hervor. Alle schätzen mal zu viel, ein andermal zu wenig. Beate neigt stärker zum Unterschätzen, Anke zum Überschätzen, während Jans Schätzungen (fast) ausgeglichen erscheinen. Meine Frage an die Lerngruppe: Wie sieht ein Boxplot für Jemanden aus, der immer unter-(über)schätzt, und wie für eine Person, bei der sich Unterund Überschätzungen ideal ausgleichen? Bei der Diskussion, ob über die Abweichungen ein Kriterium für gute Schätzungen entwickelt werden kann, habe ich gehofft, dass aus der Lerngruppe heraus der Vorschlag kommt, die Abstände, also die Beträge der Abweichungen, zu betrachten, habe mich aber bewusst zurückgehalten. In dieser Lerngruppe kommt dieser Vorschlag erst jetzt nach der ausgiebigen Diskussion über Abweichungen. Wir stellen eine neue Liste mit den Abständen her. Auch dies ist schnell geschehen, wenn wir es den Rechner durchführen lassen und im Tabellenkopf die entsprechende Gleichung eingeben. Nach den Erfahrungen mit den Abweichungen drucke ich hier kein Streudiagramm ab, sondern sofort die Boxplots der Abstände der Schätzungen der drei Personen von den wahren Werten: Anke und Jan haben jeweils eine richtige Schätzung, während Beates beste Schätzung um ein Jahr vom richtigen Alter abweicht. Das kann man zwar auch schon am ersten Streudiagramm erkennen, aber nach Meinung meiner Lerngruppen wird es bei den Boxplots am deutlichsten. Anke und Beate haben aber auch jeweils eine Schätzung (in ihrem Boxplot mit „“) gekennzeichnet, die weit außerhalb des Bereichs ihrer übrigen Schätzungen liegt, also einen Ausreißer im Sinne der Statistik darstellt. Meine Schülerinnen und Schüler haben anstelle von Ausreißer von einer außerordentlich schlechten Schätzung gesprochen. Für Jan als besten Schätzer sprechen nach Meinung der Lerngruppe folgende statistischen Kennzahlen: Er hat den besseren Median, das bessere 3. Quartil und das niedrigste Maximum, während er im Minimum nicht schlechter als Anke und im 1. Quartil nicht schlechter als Anke und Beate ist. Außerdem ist bei Jan die Summe aller Abstände minimal. Und damit ist in dieser Lerngruppe das zweite Kriterium gefunden, das neben der Zahl der richtigen Lösungen den besten Schätzer charakterisieren soll. In anderen Lerngruppen ist die minimale Summe der Abstände das dominierende Kriterium. Jannes stellt das zum Beispiel so dar: Wenn jemand vier richtige Lösungen hat, weicht aber bei den restlichen Schätzungen zum Teil erheblich von den richtigen Werten ab, dann hat er schlechter geschätzt als jemand, der drei richtige Lösungen hat und sich sonst immer nur um ein bis höchstens zwei Jahre verschätzt. Für die Lerngruppe um Jannes gilt die minimale Summe aller Abstände als einziges Kriterium. Ich habe auch hier nicht regulierend oder formend ins Gespräch eingegriffen. Mir ist es wichtig, dass die Lernenden selbständig Ideen entwickeln und eigenständig Kri- 16 terien über den besten Schätzer unter sich aushandeln und dann konsequent anwenden. 3. Die Euro-Scheine Nach Behandlung des arithmetischen Mittelwerts, der fünf Kennzahlen der EDA und der beiden Boxplot-Typen bringen die Lernenden einer 8. Klasse unvermutet folgende Fragen in den Unterricht ein und wollen sie unbedingt behandelt wissen: Welche Euro-Scheine und Euro-Münzen gibt es? Welche davon sind in der eigenen Geldbörse oder in der der Eltern vorhanden? Die Schülerinnen und Schüler schauen zunächst in der eigenen Geldbörse nach, befragen dann Freunde, Eltern sowie weitere Bekannte und tragen ihre Ergebnisse zusammen. Jeder stellt seine Ergebnisse unter der Überschrift „Verteilung der Euro-Münzen und -Scheine in der Geldbörse von ...“ (hier folgt der Name oder auch ein Pseudonym, manchmal werden ganz penibel Datum und Uhrzeit mit vermerkt) für jede Geldbörse in einem eigenen Histogrammen dar. Auf der waagerechten Achse wird der Münz- bzw. der Geldscheinwert in aufsteigender Reihenfolge im Abstand von 0,5 cm aufgetragen, auf der dazu senkrechten Achse die Anzahl der vorgefundenen Exemplare der jeweiligen Sorte. Diese Darstellungsart ist ihnen aus dem bisherigen Unterricht bekannt und muss auch Lesern nicht mehr unbedingt vorgestellt werden. So unterschiedlich die von den Lernenden gezeichneten Verteilungen auch sind (nicht immer kommt von jeder Münzsorte oder von jeder Geldscheinsorte wenigstens ein Exemplar zum Vorschein, mal sind es mehr Münzen, mal mehr Scheine, der Gesamtwert aller Scheine und Münzen schwankt erheblich von Geldbörse zu Geldbörse, sogar die Entdeckung ausländischer Euromünzen wird registriert), eine Beobachtung ist deutlich: Es fehlen Scheine mit den Werten 500 €, 200 € und 100 €. In Schülergeldbörsen wird auch der 50 €Schein selten angetroffen. „Pro Kopf sollen es mehr als 2 000 € sein.“, sagt Lukas und beteuert, das habe er irgendwo gelesen. „Wir sind mit unseren Beobachtungen davon meilenweit entfernt.“ Die Lernenden wollen die Behauptung von Lukas nachprüfen. Dem Kalender für Lehrerinnen und Lehrer 2001/2002 aus dem Deutschen Sparkassen Verlag können wir folgende Angaben der Deutschen Bundesbank über die Anzahl der zum 1.1.2002 neu eingeführten EuroScheine in allen Euro-Ländern entnehmen: Nennwert in € Anzahl in 106 Stück 5 2 415 10 3 013 20 3 608 50 3 674 100 1 246 200 229 500 360 Außerdem sind die Motive und die Maße der einzelnen Scheine vermerkt. Der Aufforderung, so viele Informationen wie möglich zu errechnen, können die Lernenden nicht widerstehen und so wird die Gesamtzahl der Euro-Scheine, der Gesamtwert des Papiergelds, die Fläche des Papiergelds für jede Sorte, die gesamte bedruckte Fläche des Papiergelds, den auf jeden einzelnen Einwohner in den Ländern mit Euro-Währung (ca. 304 Millionen Einwohner) im Mittel entfallenden PapiergeldBetrag, der Anteil der einzelnen Geldscheinsorte an der Gesamtzahl der Scheine bzw. am Gesamtgeldwert, der mittleren Wert eines Euro-Scheins berechnet. Einige versuchen auch noch, die Papiermasse abzuschätzen. Die Behauptung von Lukas erweist sich als korrekt. Auf jeden Einwohner in den Euro-Ländern entfällt der immense Betrag von 2 133,10 €. Außerdem berechnen wir, dass ein Euro-Schein im (arithmetischen) Mittel 44,58 € wert ist. (Beide Beträge sind auf volle Cent abgerundet.) „Irgendetwas ist faul.“, sagt Ronald und setzt eine stürmische Diskussion in Gang, in der die vorher erarbeiteten Ergebnisse zum arithmetischen Mittelwert in Frage gestellt werden. „Wenn ich den Pro-Kopf-Euro-Betrag mit der Anzahl der Einwohner multipliziere, erhalte ich nicht den Gesamtwert aller Euro-Scheine. Das gleiche gilt für das Produkt aus dem Mittelwert aller Scheine und der Anzahl der Scheine.“ Haben wir gegen die Vorstellung der gleichmäßigen Verteilung, die zum arithmetischen Mittelwert gehört, verstoßen? Nun, wir haben auf volle Cent gerundet. Rechnen wir bei den Mittelwerten mit allen Stellen, die der Rechner anzeigt, dann erhalten wir die gewünschte volle Übereinstimmung. Dieses Beispiel zeigt, dass der arithmetische Mittelwert von Geldbeträgen nicht unbedingt ein Geldbetrag ist. Aber dass das 17 Runden einen Fehlbetrag von 48,9 Millionen Euro (Mittelwert pro Euro-Schein auf Cent gerundet multipliziert mit der Zahl aller Scheine) ergibt, das beeindruckt sie doch sehr. Schließlich wollen die Lernenden auch noch die 5 Kennzahlen der EDA berechnen und beide Boxplots zeichnen. Dazu denken wir uns alle 14,545109 Euro-Scheine dem Wert nach in aufsteigender Folge sortiert. Die 5 Kennzahlen erhalten wir wie folgt: Minimum Wert des 1. Geldscheins (5 €) 1. Quartil Mittelwert der Werte des 3 636 250 000. Scheins und des 3 636 250 001. Scheins (10 €) Median Mittelwert der Werte des 7 272 500 000. Scheins und des 7 272 500 001. Scheins (20 €) 3. Quartil Mittelwert der Werte des 10 908 750 000. Scheins und des 10 908 750 001. Scheins (50 €) Maximum Wert letzter Schein (500 €) Wenn wir einen Boxplo t zeichnen, fällt auf, dass der untere Whisker (Länge 5 €) im Vergleich zum oberen (Länge 450 €) extrem lang ist. Das weckt Interesse an einem Boxplot der beurteilenden Statistik. Wir rechnen: R = Q3 - Q1 = 40 € und 1,5R = 60 €. Daraus folgt: Q1 - 1,5R = -50 €. Nach unten gibt es also keine Ausreisser. Der untere Whisker reicht von 5 € bis 10 €. Ferner gilt: Q3 + 1,5R = 110 €, der obere Whisker reicht daher von 50 € bis 100 €. Die Werte der Geldscheine zu 200 € und 500 € liegen „weit außerhalb“ des Bereichs, der durch die Whisker dargestellt wird, sind also Ausreisser. Insgesamt sind das rund 4 % aller Geldscheine. Statt von Ausreißern reden die Schülerinnen und Schüler von außergewöhnlichen Geldscheinen, die man in normalen Geldbörsen in der Regel nicht oder nur ganz selten, und dann nur zu besonderen Anlässen, findet. 4. Ein Weitsprungwettbewerb Das folgende Beispiel eignet sich ebenfalls gut als Einführung in statistisches Denken. Bei solchen Wettbewerbssituationen kann man Lernende leicht zum Formulieren von Leitfragen bewegen. Das Problem lautet: Die Klassen 7a und 7b machen einen Wettbewerb im Weitsprung. Die Ergebnisse in Meter sind: Lerngruppe 7a: 2,92; 3,60; 3,47; 3,50; 3,54; 3,06; 3,08; 3,12; 3,16; 3,18; 3,17; 3,23; 3,19; 3,16; 3,36; 3,42; 3,40; 3,38; 3,37; 3,39; 3,28; 3,27; 3,34; 3,35; 3,31; 3,32; 3,30; 3,33; 3,29 Lerngruppe 7b: 3,41; 3,40; 3,42; 3,39; 3,43; 3,41; 3,02; 3,80; 3,47; 3,47; 3,53; 3,55; 3,50; 3,12; 3,07; 3,70; 3,75; 3,25; 3,20; 3,17; 3,57; 3,62; 3,65; 3,35; 3,35; 3,29; 3,27; 3,32 Aufgaben: 1. Welche Klasse die „bessere“? 2. Welche Klasse ist die „ausgeglichenere“? 3. Welche Klasse hat die „stärkere Spitze“? 4. In welcher Klasse ist eine Leistung von 3,50 m „mehr wert“, das heißt in welcher Klasse gehört man mit dieser Sprungweite zu den besseren Sportlern dieser Klasse? Lösungsskizzen zu 1: In der Regel wird der Vergleich der arithmetischen Mittelwerte der Sprungweiten von Lernenden als Kriterium genannt. In der 7a ist das arithmetische Mittel 3,29 m, in der 7b ist es 3,41 m. Damit kann man sich begnügen und die 7b als die bessere Klasse bezeichnen. Ich wollte das auch, musste aber umdisponieren, als Florian sein Unbehagen äußert: „Wenn in die 7a ein Springer hinzukommt, der erheblich weiter als alle anderen springt, dann kann sich unser Urteil ändern.“ Und Florian macht an einigen Beispielen klar, wie sich der arithmetische Mittelwert ändert, wenn wir einen besonders starken Springer (also einen Ausreißer im Sinne der Statistik) hinzunehmen. Eins macht die Diskussion deutlich. Wenn wir die Daten nicht kennen, dann müsen wir beim Vergleich von arithmetischen Mittelwerten vorsichtig sein. Bei unseren Daten ist die Situation überschaubar, es gibt keinen Ausreißer. Die Diskussion hat als Nebenergebnis gebracht, dass der Median erheblich geringere Veränderungen erfährt als der arithmetische Mittelwert. Wenn wir die fünf Kennzahlen der EDA berechnen, wird es noch deutlicher. Neben dem arithmetischen Mittelwert sind 5 weitere statistische Kennzahlen (Minimum, 1. Quartil, Median, 3. Quartil, Maximum) bei Klasse 7b größer als bei Klasse 7a. Besonders eindrucksvoll zeigt es der Vergleich der beiden Boxplots: 18 für die 7b Anne hat sich eine besonders interessante Lösung ausgedacht: Beim Eintrag in die Listen ihres Taschenrechners fällt ihr auf, dass bei jedem Listenplatz der betreffende Schüler der 7b besser ist als der auf dem gleichen Listenplatz befindliche aus der 7a. Nur für den 29. Schüler der 7a findet sich kein Vergleichspartner in der Parallelklasse. Anne hat die Sprungweiten aller Schüler der 7a und die aller Schüler aus der 7b addiert. Dabei stellt sie fest, dass die gesamte Sprungweite aller 28 Schüler der 7b nur um 1 cm kürzer ist als die der 29 Schüler der 7a. Daraus folgert sie, dass die 7b nur irgendeinen Schüler für den 29. Sprung nominieren muss. Dieser Schüler muss noch nicht einmal springen, er braucht nur einen kleinen Schritt zu machen, um die Gesamtsprungweite der 7a zu übertreffen. Daher ist für sie klar, dass im Weitsprung die 7b besser als die 7a ist. Annes Idee, die Sprungweiten zu addieren, kann ich gut ausnutzen, um die beiden Aspekte zum arithmetischen Mittelwert zu verdeutlichen: Die Verteilung der Gesamtsprungweite auf 28 (bzw. für die 7a 29) gleich große Teile führt zum arithmetischen Mittelwert und Die Summe der Abweichungen aller Sprungweiten vom arithmischen Mittelwert ist Null. Lernende müssen nicht nur die Gleichung zum Berechnen des arithmetischen Mittelwerts kennen und anwenden können, sie müssen sie auch veranschaulichen und wesentliche Eigenschaften damit verbinden können. Daher freue ich mich über jede sich bietende Gelegenheit und nutze sie zur Verankerung. S = 3,80 m - 3,02 m = 0,78 m. Nach diesem Kriterium wird man also Klasse 7a als die ausgeglichenere der beiden Klassen bezeichnen. Aber Lernende können unter „ausgeglichen“ auch etwas anderes verstehen. In Abschnitt 2 ist für sie Jan mit seinen Schätzungen am ausgeglichensten, weil sich die Abweichungen seiner Schätzungen (in etwa) ausgleichen. Wenn also die Summe aller Abweichungen Null ergibt, dann liegt in diesem anderen Sinne ideale Ausgeglichenheit vor. Lösungsskizzen zu 3: Zunächst muss man festlegen, ab welcher Sprungweite man von einer Spitzenleistung reden will. Setzen wir hier zum Beispiel 3,50 m als eine solche Grenze fest. In der Klasse 7a sind es 3 vom 29 Schülern, also rund 10 %, die mindestens 3,50 m gesprungen sind, in der 7b sind es 9 von 28 Schülern, also rund 32 %. Sowohl absolut als auch relativ sind es in der 7b mehr, sie hat also die stärkere Spitze. Lösungsskizzen zu 4: Diese Frage ist eigentlich schon in Aufgabe 3 beantwortet worden. In Klasse 7a gibt es weniger Schüler als in der 7b, die mindestens 3,50 m springen. Daher ist in Klasse 7a diese Sprungweite mehr wert. 5. Leonardos Mensch Mit der Federzeichnung von Leonardo da Vinci „Die menschlichen Proportionen“ aus dem Jahre 1509 und dem zugehörigen Text (vgl. zum Beispiel bei Engel 2001) kann man die Phantasie der Lernenden zu eigenen Tun und zu selbständigen Untersuchungen gut anregen. In einer 9. Klasse stelle ich nach Einführung des CASTaschenrechners Leonardos Überlegungen zum Menschen vor. Ein Satz fasziniert die Schülerinnen und Schüler besonders: „Die Armspanne eines Menschen ist äquivalent zu seiner Körpergröße.“ Das wollen sie näher untersuchen und dabei auch ihren neuen Rechner mit einsetzen. Für 78 Messungen ergibt sich folgendes Bild: Lösungsskizzen zu 2: Lernende nennen hier meist als Kriterium für Ausgeglichenheit den Unterschied zwischen Maximum und Minimum. Sie meinen damit eine Größe, die Spannweite S heißt und als S = Maximum Minimum definiert wird. Für die 7a ist S = 3,60 m - 2,92 m = 0,68 m, 19 Ich habe meine übrigen Lerngruppen (Klasse 7 und den Leistungskurs in Jahrgang 12) mit einbezogen und so Daten von insgesamt 78 Lernenden erfasst. Auf der waagerechten Achse des Bildes wird die Körpergröße der Lernenden und auf der dazu senkrechten Achse die zugehörige Armspannweite (beides in Meter gemessen) aufgetragen. Ein linearer Trend ist der Punktwolke durchaus zu entnehmen. Die Lernenden interpretieren „äquivalent“ mit „gleich“, offenbar im Sinne von Leonardo. Zunächst meinen sie, Leonardos Aussage müsse bei jedem Menschen immer exakt zutreffen. Sie stören sich an den Abweichungen von Körpergröße und Armspannweite, auch wenn sie gering sind, und argwöhnen, dass sie selber nicht oder nicht so ganz Leonardos Vorstellungen von einem wohlproportionierten Menschen entsprechen. Aber haben zu Leonardos Lebzeiten alle Menschen diesem Ideal entsprochen? Nach einer intensiven Diskussion formuliert die Lerngruppe als Ergebnis, Leonardos Aussage als Modell zu nehmen, die etwas über einen (gedachten) durchschnittlichen Menschen aussagt, auch als Anleitung für Künstler gedacht, die menschlichen Proportionen in Zeichnungen so wiederzugeben, dass die Darstellung von Menschen natürlich wirkt. Nun verstehen sie Leonardos Aussage so: Die Armspannweite ist (in etwa) gleich der Körpergröße, dabei sind mehr oder weniger große Abweichungen nach oben und nach unten natürlich und gleichen sich im Idealfall aus. In der Lerngruppe wird auch eine andere Interpretation geäußert: Die Armspannweite und die Körpergröße sind proportional mit einem Proportionalitätsfaktor nahe bei 1. Ich habe keine Regressionsrechnung durchführen lassen. Die Lernenden haben eine Ursprungsgerade nach Augenmaß in das Bild eingezeichnet und deren Steigung bestimmt, wobei die Steigungen in der Nähe von 1 liegen. Es herrscht Übereinstimmung darüber, dass der Graph durch den Ursprung gehen muss. Einige Lernende gehen noch weiter, haben eine Ursprungsgerade durch P( x y ) gewählt und deren Gleichung bestimmt. Sie argumentieren, dass eine Gerade, bei der die Summe aller Abweichungen Null ist, die Abweichungen sich also insgesamt ausgleichen, durch P gehen muss. Dies Ergebnis haben wir in der Diskussion, wie Leonardos Behauptung zu verstehen ist, erhalten. Da die Lernenden Steigungen erhalten, die fast 1 betragen, ist für sie klar, dass Leonardos Behauptung auch auf heutige Menschen angewandt werden kann, allerdings nicht als Aussage, die für jeden einzelnen Menschen exakt gilt, sondern als ein Modell, das Prognosewerte liefert, um die die tatsächlichen Werte schwanken. Kein Schüler hat den Regressionsmodul des Rechners eingesetzt. In der Vorbereitung habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie die dabei entstehenden Gleichungen zu interpretieren sind, vor allem, wie ein y-Achsenabschnitt ungleich Null zu erklären und zu interpretieren ist. Die Gleichung y = 0,97x + 0,0057 kann für die Daten der 7. Klasse gewonnen werden. Für die Körpergröße wähle ich die Variable x und für die Armspannweite die Variable y. Bei der Gleichung für Klasse 7 können wir den y-Achsenabschnitt noch als systematischen Fehler bei der Messung der Armspannweite interpretieren, aber das macht bei betragsmäßig größeren y-Achsenabschnitten keinen Sinn mehr. Die Schülerinnen und Schüler haben die Messungen sehr sorgfältig durchgeführt. Einen systematischen Fehler von zum Beispiel 23 cm oder -17,5 cm hätten sie bereits bei der Messung moniert und die Messung sofort wiederholt. Bei solchen Gleichungen können wir den Definitionsbereich auf Körpergrößen größer als 1,50 m einschränken und brauchen uns dann um die Interpretation des y-Achsenabschnitts keine Gedanken mehr zu machen. Die Lernenden haben selbständig begonnen, eindimensional zu arbeiten, also nur die Körpergrößen oder nur die Armspannen zu betrachten. Sie wollten noch mehr Informationen aus den Daten herausholen. Zu den drei Boxplots für die Körpergrößen der Schülerinnen und Schüler, die sie mit ihren Rechnern selbständig erstellt haben, habe ich ihnen die Aufgabe gestellt, sich ein Bild von den Größenverhältnissen in den drei Lerngruppen zu machen. 20 Konkret: Fertigt eine Zeichnung an, wie die Aufstellung der Schüler aussehen wird, wenn sie der Größe nach geordnet sind. Für die eigene Lerngruppe ist dies kein Problem, man kann die Aufstellung ja konkret durchführen und die dabei gemachten Erkenntnisse bei den Zeichnungen der anderen Lerngruppen mit einbeziehen. Dass Lernende von Jahr zu Jahr größer werden und auch von Jahrgang zu Jahrgang größer sind, ist eine Erfahrungstatsache. Es verwundert uns nicht, dies an den Boxplots zu erkennen. Aber gibt es keinen Unterschied in den Größen und in der Größenverteilung mehr zwischen den Schülern des 9. und des 12. Jahrgangs? Die beiden Boxplots zwingen zum genauen Hinschauen. Der etwas längere obere Whisker und der größere Abstand von 3. Quartil und Median beim Boxplot der 12. Klasse müssen erkannt und entsprechend interpretiert werden. Noch interessanter werden die Boxplots, wenn man nach Geschlechtern trennt. Gibt es nur bei den Jungen ein deutliches Größenwachstum? Ist es bei den Mädchen schon meist in der 7. Klasse fast abgeschlossen? Man muss schon genau hinschauen, um doch noch Unterschiede zu entdecken. Interessant ist auch, wie Ausreisser in der gesamten Klasse in den nach Geschlechtern getrennten Teilgruppen verschwinden beziehungsweise neu hinzukommen. Wenn man die Lerngruppen vor sich stehen sieht, ist dieser Effekt nicht unvermutet und wird auch von den Lernenden vorher so prognostiziert. Gibt es auch Boxplots ohne Whiskers? Der Boxplot der Jungen im LK ohne oberen Whisker provoziert diese Frage. Im LK ist die Ursache schnell entdeckt. Hier ist der Grund offensichtlich. In der 9. Klasse gebe ich folgende Informationen als Arbeitsauftrag: Es sind 5 Schüler im LK, die folgende Körpergrößen (jeweils in m) haben: 2,01; ...; 1,97; 1,91; 1,79. Wie groß ist der zweitgrößte Junge im LK? Die Lösung lautet: 2,01 m. Nun ist klar, warum es keinen oberen Whisker gibt. Bei diesem Beispiel ist noch mehr deutlich geworden: Es macht keinen Sinn, Boxplots bei weniger als 5 Daten zu zeichnen, und auch nicht, Statistik mit so wenig Daten zu treiben. „Schade, dass wir nicht die Entwicklung der gleichen Schüler von der 7. Klasse bis zum LK mit den Boxplots dokumentieren,“ meinte Janina. Recht hat sie, aber das wäre ein sehr reizvolles Vorhaben, für das man einige Jahre warten muss, bis man die Daten bereit hat. Im nächsten Schuljahr kommen die 5. Klassen in Niedersachsen wieder zum Gymnasium. Vielleicht greift ein Leser oder eine Leserin diesen Vorschlag auf und verfolgt die Entwicklung von Schülern von der 5. Klasse bis zum Abitur. Andere Schüler haben die Differenz aus der Armspannweite und der Körpergröße ausgerechnet. Das Streudiagramm mit allen 78 Daten zeigt, dass in der Mehrzahl der Fälle diese Differenz negative Werte annimmt. Die Lerngruppe meint, dass man dies beim Streudiagramm deutlicher als in der Datenliste sieht. Ich verzichte dennoch auf diesen Graphen und stelle sofort die noch informativeren Boxplots für die drei Klassen dar: 21 6. Abschlussbemerkungen Nähern sich die Körpergröße und die Armspannweite im Laufe der Jahre (in etwa) einander an? Sollte man die Gültigkeit von Leonardos Aussage vielleicht nur an erwachsenen (im Sinne von ausgewachsenen) Menschen erproben? Gibt es Jahre, in denen das Breitenwachstum stärker als das Längenwachstum ist? All das sind Fragen, die sich meine Schülerinnen und Schüler beim Betrachten dieser Boxplots stellen. Will man diesen Fragen weiter nachgehen, wird man bei einigen von ihnen neue Erhebungen gezielt durchführen müssen. Ich habe aus Zeitgründen darauf verzichten müssen. Vielleicht regt dies eine Leserin oder einen Leser zu eigenen Untersuchungen an und wir lesen hier den Bericht. Noch interessanter sind die Boxplots für die Differenz aus der Armspannweite und der Körpergröße, wenn man nach Geschlechtern trennt. Die Spannweite (Differenz zwischen Maximum und Minimum in den Boxplots) wird im Laufe der Jahre kleiner, der Median rückt in die Nähe von Null. Aber die geschlechtsspezifischen Unterschiede in meinen Lerngruppen sind nicht zu übersehen. Man kann ein Projekt durchführen, bei dem man zuerst jahrelang Daten sammeln muss, bevor die Auswertung beginnen kann. Solch ein Projekt mit überraschenden Ergebnissen wird beispielhaft in Nordmeier[1989] dargestellt. Man kann auch von seinen Schülerinnen und Schülern einen umfangreichen Datensatz zusammentragen lassen. Ein solches projektartiges Vorhaben wird zum Beispiel in Wirths[2002] beschrieben. In diesem Beitrag möchte ich andere Vorgehensweisen vorstellen: Daten werden von den Lernenden selbst schnell erstellt, so dass die Auswertung noch in derselben Stunde zu ersten Ergebnissen führt. Nach der Datensammlung stellen Schülerinnen und Schüler selbst eine Frage, die sie geklärt wissen wollen, zu deren Beantwortung sie eine eigene Strategie entwickeln müssen. Man kann vielfältige Anässe dafür schaffen oder nutzen. Dies ist das Anliegen des ersten Beispiels. Wie man Schülerimpulse oder -fragen aufgreifen, Daten und Informationen sammeln, dabei auch vorgegebene Daten, wo immer man sie findet, integrieren und die dabei aufkommenden Fragen und Irritationen klären kann, wird im zweiten Beispiel vorgestellt. Mit gut gewählten Leitfragen, die Lernende vor allem in Wettbewerbssituationen gern selbst entwickeln, kann ebenfalls gut in statistisches Denken eingeführt werden. Dies soll im dritten Beispiel verdeutlicht werden. Wie man Anregungen aus der Geschichte in lebendigen Unterricht mit interessanten Ergebnissen integrieren kann, soll das vierte Beispiel zeigen. Diese Beispiele müssen nicht der Reihe nach abgearbeitet werden. Wenn vom kommenden Schuljahr an in Niedersachsen wieder Unterricht am Gymnasium von der 5. Klasse an möglich wird, dann sollte man diese Beispiele in den Unterricht der 5. bis 8. Klasse so integrieren, dass in jedem Schuljahr Statistik betrieben wird, und dass in jedem Schuljahr der Schatz an StatistikErfahrungen und an Fingerspitzengefühl im Umgang mit Daten vergrößert wird. Wichtig ist mir, dass Schülerinnen und Schüler von Anfang an in die Problemstellung und -findung mit einbezogen werden, Gelegenheit erhalten, selbst Daten zu sammeln oder zu produzieren, eigene Fragen zu stellen, die sie beantwortet wissen wollen, dabei Erfahrungen sammeln, Fingerspitzengefühl im Umgang mit Daten entwickeln und auch Vorurteile und Hypothesen auf den Prüfstand stellen können. 22 Wenn man das Erstellen von Daten Lernenden überlässt, kann es leider auch vorkommen, dass mit solch selbsterstellten Daten die vom Lehrenden gesetzten Lernziele nicht oder nur schwer zu erreichen sind. Damit müssen Lehrende rechnen und dürfen nicht überrascht sein, wenn dieser Fall eintritt. Häufig entsteht jedoch Material, das zu vielfältigen Fragen und Interpretationen anregt. Dieses Material sollten Lehrende gezielt sammeln, um es dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Unterricht einbringen zu können, sobald sie dies für erforderlich halten. Schülerinnen und Schüler sollen im Statistikunterricht lernen, mit den unterschiedlichen Darstellungsformen umzugehen und selbständig zu entscheiden, ob sie bereits anhand der vollständigen Datentabelle Aussagen begründen können oder andere Darstellungsformen wie zum Beispiel StengelBlatt-Diagramme oder Boxplots dazu benötigen. Ich habe in meinen Beispielen an einigen Stellen bewußt mehr Möglichkeiten aufgezeigt als unbedingt zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen erforderlich sind, um die Vielfalt an Möglichkeiten zu verdeutlichen. Auch in meinem Unterricht benötige ich diese Vielfalt; denn ich beobachte, wie unterschiedlich Lernende reagieren und argumentieren. Der eine beruft sich bei seinen Ausführungen auf die - ggfs. um zusätzlich berechnete Größen erweiterte - Datentabelle, andere wiederum benötigen verschiedene graphische Darstellungen zur Unterstützung ihrer Argumentation. Diese meinen Unterricht bereichernde Vielfalt möchte ich unterstützen und weiterentwickeln, und nicht durch einseitige Festlegung oder frühzeitige Einengung auf nur eine Möglichkeit verhindern. Literatur Engel, J. (2001): Datenorientierte Mathematik und beziehungshaltige Zugänge zur Statistik: Konzepte und Beispiele. In: Borovcnik, M./Engel, J./ Wickmann, D., Anregungen zum Stochastikunterricht. Franzbecker, Hildesheim 2001 Nordmeier, G. (1989): Erstfrühling und Aprilwetter Projekte in der explorativen Datenanalyse. Stochastik in der Schule Heft 3/1989, S. 21 - 42 Wirths, H. (2002): Sind deutsche Autos anders als ausländische? StoiS 1/2002, S. 16 - 23 Anschrift des Verfassers Helmut Wirths Cäcilienschule Oldenburg Haarenufer 11 26122 Oldenburg [email protected] 23 Vernetzungen zwischen Vektorgeometrie und Beschreibender Statistik JÖRG MEYER, HAMELN Zusammenfassung: In der Beschreibenden Statistik kommen häufig Quadratsummen vor. Deutet man diese als Skalarprodukte, so lassen sich manche Aussagen über Mittelwerte, Varianzen oder über Regressionskoeffizienten in durchsichtiger Weise vektorgeometrisch deuten und beweisen. Auch zur Matrizenrechnung wird ein Zusammenhang hergestellt. Behandelt werden die Themenkomplexe Minimalität des arithmetischen Mittels, Regressionsgeraden und Regressionsparabeln. Auch zur Lagebeziehung von arithmetischem Mittel und Median wird ein Zusammenhang hergestellt. 1. Einleitung Anders formuliert: Die Aufgabe „Bestimme c so, dass n c di 2 minimal ist“ i 1 wird durch c gelöst. Dies lässt sich auch vektorgeometrisch beweisen! Dazu führen wir zwei n-dimensionale Vektoren ein, d1 und zwar den Datenvektor D ... sowie den d n 1 Einsenvektor E ... . Mit dem Standard-Skalar1 n In den neuen Bundes-Einheitlichen Prüfungsanforderungen im Fach Mathematik steht: „Die Prüfungsaufgaben im Abitur erfordern einen Unterricht, der in den drei Sachgebieten (Analysis, Lineare Algebra / Analytische Geometrie und Stochastik) den Aufbau adäquater Grundvorstellungen der zentralen Begriffe und Methoden als Schwerpunkt hat [...].“ Das ist neu! Und das wird nur gelingen, wenn man die drei Gebiete vielfältig miteinander vernetzt. Hier geht es um Vernetzungen zwischen der Beschreibenden Statistik und der Vektorgeometrie. Zur Notation: Im Folgenden werden Punkte mit ihren zugehörigen Ortsvektoren identifiziert. produkt X Y x i yi schreibt sich die Aufgabe i 1 folgendermaßen: „Bestimme c so, dass der Vektor c d1 ... c E D minimale Länge hat“. c d n Die (geometrische) Lösung ist offensichtlich: Man muss nur D auf E senkrecht projizieren (Abb. 1). 2. Zur Minimalitätseigenschaft des arithmetischen Mittels Es seien d1 , d 2 , ...,d n irgendwelche numerischen d d ... d n Daten und deren : 1 2 n arithmetisches Mittel. Die Minimalitätseigenschaft des arithmetischen Mittels lautet so: n Für alle c ist n di c di . i 1 2 2 Abb. 1 Die Länge von c E D ist minimal, wenn c E D auf E senkrecht steht, wenn also DE c E E D E und deswegen c 2 gilt. E n d1 ... d n i 1 Stochastik in der Schule 24 (2004) Heft 1, S. 24 – 29 24 Die E D Länge n di 2 des Forderung an die zu findende Gerade besteht darin, dass n i 1 Abweichungsvektors ist Wesentlichen die Standardabweichung. Die bei der Berechnung der empirischen Varianz häufig verwendete Formel n n i 1 i 1 2 di di2 n 2 . ist nur der Satz des Pythagoras in der Form E D 2 D2 E 2 . Eine Analogisierung dieser Betrachtungen in Richtung Verknüpfung zwischen Vektorgeometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung findet sich bei Scheid, H. (1986): Stochastik in der Kollegstufe. BI: Mannheim. 3. Der Regressionskoeffizient und Projektionen x Gegeben sind n Datenpaare i ( i 1, ..., n ). yi Gesucht ist diejenige Gerade („Ausgleichs-“ oder „Regressionsgerade“) mit der Gleichung y a x b , die die Daten möglichst „gut“ annähert. Die y-Werte sind möglicherweise messfehlerbehaftet, die x-Werte nicht. a x i b yi 2 minimal i 1 wird. Abweichend von Abschnitt 1 kürzen wir die n arithmetischen Mittel hier als x xi i 1 n n und y yi i 1 n ab. Die erste Forderung n a x i b yi 0 i 1 schreibt sich dann als ax b y ; die gesuchte Gerade geht somit durch den Schwerpunkt. (Das ist auch der Fall, wenn nicht die Summe der vertikalen Abstände, sondern die Summe der zur Ausgleichsgerade senkrechten Abstände - in Abb. 3 durch Einfachlinien gekennzeichnet - verschwinden soll.) Abb. 3 Abb. 2 Daher liegt eine Koordinatenverschiebung u: x x; v: y y nahe; sie führt zu Was heißt „gut“? Sicherlich ist es sinnvoll zu fordern, dass die Summe der vertikalen Abstände (in Abb. 2 durch Doppellinien gekennzeichnet) verschwindet, d. h. dass ui xi x , vi yi y n a x i b yi 0 und die Regressionsgerade bekommt die einfache Gleichung v a u . i 1 ist. Damit ist aber die Regressionsgerade noch nicht eindeutig bestimmt. Eine weitere (fruchtbare) 25 Natürlich ist u v 0 , diese Gleichungen lassen u1 v1 1 sich mit U ... , V ... und E ... als 1 u v n n Orthogonalitätsrelationen UE VE 0 deuten. Die zweite Forderung n vi a u i (OR) 2 minimal i 1 bedeutet: Wähle a so, dass a U V möglichst kurz ist. Man bekommt dieses a, wenn man V auf U senkrecht projiziert (Abb. 4). n vi a u i b 2 minimal . i 1 Wir haben dann das Problem: Bestimme a und b so, dass u1 1 v1 a ... b ... ... a U b E V u 1 v n n möglichst kurz ist! U und E spannen eine Ebene auf. Gesucht sind dann a und b so, dass der Abstand zwischen a U b E und V minimal ist. Das erreicht man, wenn man den Vektor V auf die von U und E aufgespannte Ebene senkrecht projiziert (Abb. 5). Abb. 4 Es ist dann a so zu bestimmen, dass V a U U 0 ist, was auf a UV 2 führt. Bekanntlich heißt a U Regressionskoeffizient. An dieser Stelle sollte man wie gut die Datenpunkte beschrieben werden. Wenn alle Daten genau auf ist V a U . Genau dann ist der Frage nachgehen, durch eine Gerade einer Geraden liegen, cos(U, V) 1 . Auf der anderen Seite hat man die maximale Abweichung von einer Geradenform, falls U und V zueinander senkrecht stehen. Genau dann ist cos(U, V) 0 . Daher ist der Korrelationskoeffizient UV cos(U, V) ein gutes Maß dafür, wie gut UV die Datenpunkte durch eine Gerade beschrieben werden können. Nebenbei: Die vorgängige Bestimmung von b 0 ist sachlich überflüssig (allerdings didaktisch sinnvoll), es reicht die zweite Forderung Abb. 5 Wie bestimmt man die Projektion? Es muss sein: a U b E V U 0 und a U b E V E 0 . Dies Gleichungssystem lässt sich besonders einfach lösen, falls (E, U) eine Orthogonalbasis ist. Dies ist UV aber hier wegen (OR) der Fall. Dann ist a UU EV und b 0. EE 4. Der Regressionskoeffizient der standardisierten Daten Wir hatten die Daten xi yi zentralisiert zu ui xi x . Nun ist es eine sinnvolle Idee, die vi yi y 26 Daten auch zu normieren zu S T U U U2 0 und V . Dabei ist natürlich 0 . V Vom Standpunkt der Vektorgeometrie aus ist 1 naheliegend, vom Standpunkt der Stochastik ist es n oder n 1 . Alsdann ist S T . Berechnet man für diese normierten Daten den Regressionskoeffizienten, so bekommt man U V V ST U UV a 2 cos(U, V) . U U S U V U U Für (irgendwie) normierte Daten stimmen also Regressions- und Korrelationskoeffizient überein. 5. Der Regressionskoeffizient und Matrizen Das Problem bei der Regressionsgerade war: Bestimme a und b so, dass u1 1 a a ... b ... a U b E U, E b u 1 :M n u1 1 a a ... ... M b u b n 1 0 a UV n b 0 und hat die Lösung a UV U2 und b 0 . 6. Der Zusammenhang zwischen arithmetischem Mittel, Median und Standardabweichung Es seien d1 , d 2 , ...,d n wie in Abschnitt 1 irgendwelche numerischen Daten und d1 d 2 ... d n deren arithmetisches Mittel, : n n di 2 i 1 deren n sowie deren Median. Standardabweichung Dann gilt: Der Abstand der beiden Mittel und ist durch beschränkt, d. h. es gilt: . Wie kann man das beweisen? Wir fangen mit dem linken Term an. Nach der Dreiecksungleichung für Beträge gilt 1 n 1 n di di n i1 n i1 M und aufgrund der Minimalitätseigenschaft des Medians ist v1 sich möglichst wenig von ... V unterscheidet. v n 1 n 1 n di di . n i 1 n i 1 Zu lösen wäre also das überbestimmte System a M V . Hier liegt ein anderer b Repräsentationswechsel als bei den Projektionen vor. Man multipliziert auf beiden Seiten mit der Mt transponierten Matrix und erhält a M t M M t V . Hier ist M t M eine b quadratische und symmetrische Matrix, und dies Gleichungssystem ist lösbar! Man erhält U2 0 UV Mt M Mt V . 0 n und 0 Das Gleichungssystem lautet also Wenn nun noch n di n 1 di n i 1 i 1 n 2 gelten würde, hätte man die Behauptung bewiesen. Schreibt man, um die Struktur des zu Beweisenden klarer zu sehen, z i für di , so muss n zi i 1 n n zi2 i 1 n bzw. 2 n n 2 zi n zi i 1 i1 (U) 27 gelten. Nun kann man in der rechten Seite von (U) z1 ein Skalarprodukt zu erkennen. Mit Z ... und z n 1 E ... 1 sowie dem Standard-Skalarprodukt n X Y x i yi ist n E E , und (U) schreibt i 1 Z E 2 E2 Z2 ; das ist 2 wegen Z E E 2 Z2 cos2 E, Z . sich als Vernetzungen zwischen Vektorgeometrie lohnen Repräsentationswechsel aber richtig Stochastik sich also! und Der Quadratsumme Skalarprodukt ist häufig fruchtbar, wie an den Beispielen wohl deutlich geworden ist. hat. 7. Zur quadratischen Regression Die Methoden von Abschnitt 2 lassen sich fruchtbar machen zur Erläuterung der quadratischen Regression. Wieder haben wir n x Datenpaare i ( i 1, ..., n ), und gesucht ist yi diejenige Parabel, die die Daten möglichst „gut“ annähert. Wie im Fall der linearen Regression wird es sich als vorteilhaft erweisen, wenn man eine Schwerpunktstranslation vornimmt und zu ui xi x übergeht. Es sind dann a, b und c vi yi y so zu bestimmen, dass die v i möglichst dicht bei den jeweiligen Werten für a u i2 b u i c liegen. Mit u12 u1 v1 1 2 u2 v2 1 u2 U , Q: , V und E ... ... ... ... 2 1 un vn un Übrigens: Analysiert man den Beweis zu , so stellt man fest, dass sich genauere Aussagen machen lassen: Die Dreiecksungleichung für Beträge liefert 1 n 1 n di di . n i1 n i1 Die rechte Seite ist das zum Median gehörige n : Streuungsmaß di i 1 n absolute Abweichung. Damit ist , die mittlere . Aufgrund der Minimalitätseigenschaft des Medians gilt n i 1 n di n i 1 di Nun ist wie oben n i 1 n di n di i 1 n 2 , so dass man insgesamt die Ungleichung dicht bei Hier ist der Anlass, geometrische Grundvorstellungen auf den nicht mehr vorstellbaren vierdimensionalen Raum zu erweitern: Wenn a U V möglichst kurz sein soll, muss man V auf die durch den Richtungsvektor U aufgespannte Ursprungsgerade projizieren (Abschnitt 1). Wenn a U b E V möglichst kurz sein soll, muss man V auf die durch die Richtungsvektoren U und E aufgespannte Ursprungsebene projizieren (Abschnitt 2). . n heißt das: V soll möglichst a Q b U c E liegen. Wenn a Q b U c E V möglichst kurz sein soll, so sollte man analog V auf denjenigen dreidimensionalen Raum projizieren, der durch den Ursprung geht und durch die drei Richtungsvektoren Q, U und E aufgespannt wird. Analog zu den Abschnitten 1 und 2 führt das auf die drei Bedingungen a Q b U c E V Q 0 a Q b U c E V U 0 28 a Q b U c E V E 0 . (Man gelangt übrigens zu den gleichen Termen, i 1 n wenn man : a u i2 b u i c vi 2 nach a, b und nach c ableitet, dieser Weg hätte natürlich auch schon früher offen gestanden.) Aufrund der Orthogonalitätsrelationen (OR) und wegen schreibt sich das QE U U Gleichungssystem einfacher als a QQ bUQ cUU VQ a QU bUU UV aUU cEE 0 Das Gleichungssystem wird noch etwas einfacher, wenn man die x-Werte als äquidistant annimmt, wenn also x i 1 x i u i 1 u i von i unabhängig ist. Unter dieser Voraussetzung ist nämlich U Q 0 , und man bekommt das recht übersichtliche System a QQ cUU VQ bUU UV aUU cEE 0 1 0 Beispiel: Gegeben seien die 4 Punkte , , 2 1 1 2 und , für die die Ausgleichsparabel 3 3 1 9 und y ist 2 4 9/ 4 1/ 4 1/ 4 5 / 4 Q und V . 1/ 4 3/ 4 9/ 4 3/ 4 Abb. 6 Die Vorgehensweise überträgt sich auf Polynome höheren Grades. Bei der Parabelregression kann es natürlich passieren, dass der führende Koeffizient a verschwindet. Man sieht am Gleichungssystem, dass das genau dann der Fall ist, wenn Q auf V senkrecht steht (wie es auch zu erwarten ist). Alsdann ist natürlich auch c 0 . 1 1 0 2 Abb. 7 zeigt das Beispiel X , Y . Man 1 2 2 3 muss Y nur an einer Stelle geringfügig verändern, um aus der Geraden eine nach oben oder eine nach unten geöffnete Parabel zu erzeugen. gesucht ist. Wegen x 3/ 2 1/ 2 U , 1/ 2 3/ 2 Das Gleichungssystem hat die Lösung 1 1 5 , b , c ; 4 2 16 die Ausgleichsparabel hat somit die Gleichung Abb. 7 a v u2 u 5 ; Abb. 6 zeigt die Situation. 4 2 16 Anschrift des Verfassers Jörg Meyer Schäfertrift 16 31789 Hameln [email protected] 29 Rezensionen Gerd Gigerenzer: Das Einmaleins der Skepsis. Berlin: Berlin Verlag, 2002 (gebunden); Berlin: Btv, 2004 (broschiert) REZENSION VON GERHARD KÖNIG Medizinische Testergebnisse enthalten für die meisten Patienten unumstößliche Wahrheiten. Ob beim HIV-Test, bei der Mammographie oder bei der Früherkennung von Prostata-Krebs: Wer käme auf die Idee, das Urteil des Arztes anzuzweifeln? Dabei gibt es erwiesenermaßen Fehlurteile und trügerische Sicherheiten - mit oft gravierenden Folgen für die Betroffenen, Folgen, die sich nach Aussage des renommierten Psychologen Gerd Gigerenzer vermeiden ließen.“ So führt der Klappentext in das über 400 Seiten starke Buch ein, dass den Lesern die Illusion der Gewissheit bewusst machen will. Gigerenzer konstatiert nämlich für die westlichen Kulturkreise ein elementares Bedürfnis nach absoluten Wahrheiten. Als Glaube an eindeutige Gewissheiten bestimmt dieses Bedürfnis die Praxis von Experten - und mehr noch die Erwartung der Laien an die moderne Technologie. Ein zweites Ziel des Buches ist es, dem Leser Methoden anzubieten, mit denen er Risiken verstehen und diese anderen verständlich mitteilen kann. Gemäß dem Untertitel des Buches „Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken“ zeigt der Autor konkret an zahlreichen Beispielen, dass man im Umgang mit Zahlen, vor allem mit Prozenten und Wahrscheinlichkeiten, zu schnellgläubig ist. Anhand der detailliert ausgebreiteten Fallbeispiele leuchtet das jedem Leser ein. Dabei hat Gigerenzer zwei Anwendungsschwerpunkte: Gesundheit / Medizin und Straftaten / Kriminalität. Hauptsächlich die Medizin hat es ihm angetan und dabei die Mammographie, die er heftig bekämpft („Mammographie-Illusion“) und die deswegen zu ausführlich behandelt wird. Allein die ersten 160 von 330 Seiten befassen sich in endlosen Variationen fast nur mit diesem Thema. Wir wollen daher ein anderes Beispiel, das Gigerenzer in seinem Buch erläutert, herausgreifen: Die statistische Zuverlässigkeit von AIDS-Tests. Diese Problematik wurde zudem auch schon in Stochastik in der Schule 24 (2004) Heft 1, S. 30, 31 vielen Artikeln mathematikdidaktischer Zeitschriften behandelt. Einer seiner Studenten stellte sich in über 20 Beratungsstellen in verschiedenen Städten Deutschlands vor und fragte, was ein positiver Test in seinem Fall keinerlei Risikofaktoren - bedeuten würde. Fast alle Berater sagten ihm voller Überzeugung, die Möglichkeit eines Irrtums läge nahe bei Null, weil der Test zu 99,9 Prozent sicher sei. Die Angabe zur Testsicherheit ist richtig, aber die Schlussfolgerung daraus ist falsch: In Wirklichkeit ist sogar jede zweite positive Diagnose bei Menschen aus keiner Risikogruppe "falschpositiv". Solche Probleme gehören zu den Standardproblemen des Bayes-Theorem, dass ganz selten richtig verstanden wird. Der positive Vorhersagewert eines medizinischen Tests hängt nicht nur von seiner Güte, d.h. Sensitivität bzw. Spezifität, sondern auch wesentlich vom Vorhandensein der betreffenden Krankheit in der Bevölkerung ab, der sog. Prävalenz. Je geringer die Wahrscheinlichkeit z.B. für eine HIV-Infektion in der Bevölkerung ist - sprich, je weniger der Fall einer Risikogruppe vorliegt -, desto genauer muss getestet werden. Aber bei seltenen Krankheiten können Tests mit je z.B. 99,9% Spezifität und Sensitivität falsch-positive Werte von über 50% erzeugen. Schlussfolgerung von Arthur Engel bei der Besprechung eines ähnlichen Problems: „Bei seltenen Ereignissen sind die meisten Alarme falsche Alarme.“ Die Probleme, die dadurch entstehen, dass frau/man positiv getestet wurde, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit gar nicht infiziert ist oder Krebs hat, werden unter verschiedenen Aspekten, medizinisch, psychisch und gesellschaftspolitisch, diskutiert. Der Autor legt auch großen Wert auf eine anschauliche Erklärung des Phänomens hoher falsch positiver Raten bei seltenen Krankheiten. Dazu geht er als Folge der Ergebnisse aus seinen empirischen Untersuchungen davon aus, dass es anhand der natürlichen Häufigkeiten leichter ist, richtig zu überlegen als unter Nutzung von 30 Wahrscheinlichkeiten. „Natürliche Häufigkeiten erleichtern es uns, aus numerischen Informationen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.“ Visualiert werden die Schlüsse und Überlegungen durch zahlreiche Baumdiagramme. Warum fördert es das Verständnis, wenn man die Informationen nicht als Wahrscheinlichkeiten oder Prozentsätze, sondern als natürliche Häufigkeiten angibt? Das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Berechnung einfacher, denn die Darstellung erledigt sie schon teilweise. Der zweite Grund liegt nach Überzeugung des Psychologen Gigerenzer in der Evolution unseres Gehirns und der Entwicklung unseres Denkens: Unser Verstand ist eben an natürliche Häufigkeiten angepasst. Inzwischen verstehen wir sehr genau, warum das so ist. Wenn man eine natürliche Häufigkeit in eine bedingte Wahrscheinlichkeit umrechnet, entfernt man dabei die Information über den Grundanteil (man nimmt eine so genannte Normalisierung vor). Der Vorteil dieser Normalisierung besteht darin, dass die resultierenden Werte stets im Bereich zwischen 0 und 1 liegen. Wenn man jedoch aus Wahrscheinlichkeiten Schlüsse zieht (anstatt aus natürlichen Häufigkeiten), dann muss man die Grundanteile wieder hineinbringen, indem man die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse mit den jeweiligen Grundanteilen multipliziert. (S.74) Mit Fehldiagnosen und trügerische Sicherheiten in der Medizin räumt der Autor also gründlich auf. Nicht nur aus den ärztlichen Untersuchungszimmern, sondern auch aus Gerichtssälen (Sachverständige im Gerichtssaal) und Regierungsgremien berichtet er von schwerwiegenden Fehleinschätzungen, die alle in einem Mangel an statistischem Verständnis gründen. Er macht auf versteckte Denkfallen aufmerksam und ermuntert zur Überprüfung von Zahlen der (vermeintlichen) Experten. Schließlich gibt es noch ein Kapitel „Amüsante Aufgaben“, in dem der Autor den Leser einlädt, die reale Welt zu verlassen und in die Welt der Spiele und der Kopfnüsse einzutreten. Didaktisch sehr gut schildert Gigerenzer das Monty-Hall-Problem, auch als Drei-KastenProblem, Gefangenenproblem oder Drei-TürenProblem bekannt. Ein Glossar mit Erklärungen der wichtigsten im Buch verwendeten Termini sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis mit Nachweisen der behandelten Beispielsfälle runden das Buch ab. Gigerenzer hat bei der Lektüre nicht den Fachmann, Mathematiker oder sogar speziell Stochastiker, ins Visier genommen, dazu ist manches zu ausführlich und für den Wissenden zu langatmig dargestellt. Es ist eher als Pflichtlektüre für alle Mediziner, Juristen und Politiker und alle, die mit Statistiken und Risiken (Börse!) umzugehen haben gedacht. Auch die Kultusbürokratie wurde nicht vergessen: „Unsere Ergebnisse mögen alle diejenigen ermutigen, die Lehrpläne für die Oberstufe oder für Studienanfänger entwickeln“ (S. 328). Aber auch der Fachmann liest das eine oder andere Kapitel mit Gewinn. Z.B. das Kapitel 10 „Der genetische Fingerabdruck“ in dem der Autor zeigt, dass der DNA-Vergleich nicht alle Ungewissheiten beseitigt. Wie jedes neuartige Verfahren verringert der genetische Fingerabdruck nicht nur alte Ungewissheiten, etwa die über die Vaterschaft, sondern bringt auch neue Ungewissheiten mit sich. Oder kennen Sie den Kategorie-Effekt (S.265ff), der immer dann auftritt, wenn eine bestimmte Ungewissheit vorliegt, zum Beispiel wenn jemand nur eingeschränktes Wissen hat, aber trotzdem ein Verhalten beurteilen oder vorhersagen soll. Statistik ist vor allem ein unverzichtbares Instrument zur gesellschaftlichen Information und zur Entscheidungsfindung in Politik, Wirtschaft und für die Bürger selbst. Statistische Daten stellen eine wichtige Grundlage dar, um Probleme zu analysieren und darauf aufbauend fundierte Lösungen zu entwickeln. Eben so wie die Fähigkeit zu lesen und Texte zu verstehen für jeden Bürger von höchster Bedeutung im Leben ist, so ist es von ähnlich hoher Bedeutung, Daten und Zahlen zu verstehen. Dazu will das Buch beitragen. Es zeigt konkrete und frappierend einfache Möglichkeiten auf, wie sich das statistische Analphabetentum in unserer so genannten Wissensgesellschaft überwinden lässt. Verständlich und kurzweilig unterbreitet Gigerenzer Vorschläge, wie der Einzelne sein Verständnis von Risiken und Wahrscheinlichkeiten verbessern kann, um letztlich den unvermeidlichen Ungewissheiten im Leben souveräner und gelassener zu begegnen. Zum Schluss zwei Literaturhinweise zum Thema in didaktischen Fachzeitschriften: Krauss, Stefan: Wie man das Verständnis von Wahrscheinlichkeiten verbessern kann: Das 'Häufigkeitskonzept'. In: Stochastik in der Schule. (2003) v. 23(1) S. 2-9 31 Wassner, Christoph; Krauss, Stefan, Martignon, Laura: Muss der Satz von Bayes schwer verständlich sein? In: PM Praxis der Mathematik in der Schule. Sekundarstufen 1 und 2. (Feb.2002) v. 44(1) S. 12-16 Gerhard König 32 Bibliographische Rundschau GERHARD KÖNIG G. Fölsch: Welche Farbe hat mein Hut. In: PM, Praxis der Mathematik v.45(1.Dezember 2003)6; S. 289-292 Drei Spieler, die die rote oder blaue Hutfarbe jeweils der beiden anderen sehen, aber nicht die eigene, sollen diese erraten. Wird dabei eine bestimmte Strategie angewandt, die mit dem dreimaligen Werfen einer Münze zusammenhängt, so ergibt sich eine verblüffend hohe Gewinnwahrscheinlichkeit für die Gruppe. Ist dieses Spiel wesensverwandt mit der klassischen Denksportaufgabe, in der Indianer drei Weiße je an einen roten oder blauen Pfahl gebunden haben? Wolfgang Härdle; Bernd Rönz: Statistik Wissenschaftliche Datenanalyse leicht gemacht. Ein interaktives Tool zur Einführung in die Welt der Statistik. Berlin: Multimedia Hochschulservice, 2003 Die interaktiv konzipierte CD-ROM bietet ein neuartiges Tool zur Einführung in die Welt der Statistik. In zwölf Kapiteln werden alle klassischen Teilgebiete der deskriptiven und induktiven Statistik behandelt. Durch eine Vielfalt an Beispielen und interaktiven Recheneinheiten wird die Materie leichter erfassbar. Multiple-Choice-Fragen ermöglichen eine Überprüfung des gelernten Stoffes. Besonders geeignet für Studierende der Wirtschafts-, Naturund Ingenieurwissenschaften. Jacobs, Konrad; Jungnickel, Dieter: Einführung in die Kombinatorik. Berlin: de Gruyter, 2004. Ziel dieser vollständig überarbeiteten und erweiterten Neuauflage ist es, eine weitgehend elementare Einführung in ausgewählte Teile der Kombinatorik zu geben. Dabei wird stets versucht, nicht nur die Grundlagen darzustellen, sondern auch in jedem Kapitel exemplarisch einige tiefer liegende Resultate vollständig zu beweisen. Einige Highlights sind: 1. projektive Ebenen und Räume, samt des Freundschaftstheorems, 2. Anwendungen in der Kryptographie, Authentikation von Nachrichten, Zugangskontrolle zu geheimen Informationen, 3. Heiratssatz und verwandte Sätze, etwa zu Flüsse auf Netzwerken, 4. der Satz vom Diktator, 5. einige Perlen aus der Codierungstheorie, inklusive konkreter Anwendungen etwa bei Prüfziffersystemen, 6. der klassische Satz von Ramsey und verwandte Ergebnisse, 7. Partitionen und Abzählen, etwa das klassische Menage-Problem, 8. Endliche Geometrie und Graphentheorie. Katja Krüger: Ehrliche Antworten auf indiskrete Fragen – Anonymisierung von Umfragen mit der Randomized Response Technik . In: Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht, Band 8, herausgegeben von Hans-Wolfgang Henn und Katja Maaß. Hildesheim, Berlin: Franzbecker, 2004, S. 118-127 Das Thema „Umfragen“ ist Gegenstand des Stochastikunterrichts und wird z. B. in der Sekundarstufe II unter der Überschrift „Schätzen unbekannter Wahrscheinlichkeiten“ behandelt. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie die vergleichsweise neue Umfragetechnik der „Randomized Response“ im Unterricht behandelt werden kann. Einen Einstieg ins Thema bieten die Ergebnisse einer aktuellen Online-Umfrage zum Thema Steuerhinterziehung. Bei der Analyse dieses Beispiels werden grundlegende Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung wieder aufgegriffen und miteinander verknüpft. Mit Hilfe eines Baumdiagramms und der Pfadregeln wird die Wahrscheinlichkeit einer „sensitiven“ Verhaltensweise geschätzt. Stichprobenverteilungen werden erzeugt, grafisch dargestellt und miteinander verglichen, um zu Aussagen über die Genauigkeit des Schätzwertes zu kommen. Jörg Meyer: Schulnahe Beweise zum zentralen Grenzwertsatz. Hildesheim, Berlin: Franzbecker, 2004 (texte zur mathematischen forschung und lehre 31) In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob es schulnahe Begründungen für den zentralen Grenzwertsatz der Stochastik gibt. Dabei ist vorab zu klären: 1. Was soll unter "Begründung" verstanden werden?, 2. Was bedeutet "schulnah"?, 3. Von welcher Form des zentralen Grenzwertsatzes (lokal/global, Spezialfall von de Moivre/Laplace oder allgemeine Aussage von Lindeberg/Feller) soll die Rede sein? Der Hauptteil dieser Dissertation besteht in der Erläuterung und Stochastik in der Schule 24 (2004) Heft 1, S. 32 – 34 33 didaktischen Einordnung unterschiedlicher Beweise zum zentralen Grenzwertsatz. Günter Nordmeier: Es wird wärmer. In: mathematiklehren, Heft 120 (Oktober 2003), S. 2122, S.47-48 Treibhauseffekt und Kimaschutz gehen uns alle an. Aus Klimareihen lassen sich mit einfacher Mathematik kurzfristige und mittelfristige Klimaschwankungen und der langfristige Trend herausarbeiten und die zugehörigen Werte gut abschätzen eine Anregung für fächerübergreifende Probleme und experimentelle und explorative Ansätze im Mathematikunterricht. Unterrichtsprojekt zu Zeitreihen. Vancso, Oedoen: Wie verstehen die Studenten die bedingten Wahrscheinlichkeiten? In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2003. Vorträge GDM 2003 . Hildesheim: Franzbecker. 2003.S. 633-636 Im Vortrag werden die Ergebnisse eines mit ca. 300 Teilnehmern in Budapest durchgeführten Experiments vorgestellt. Solche Probleme werden durch einen Fragebogen formuliert, die ''theoretisch'' mit Bayes-Theorem beanwortet werden sollen. Die Erfahrungen werden mit den Ergebnissen anderer ähnlicher Experimente - z. B. in Berlin - verglichen. Einige didaktische Hypothesen werden untersucht, und eine Empfehlung bezüglich verschiedener Lernprozesse für den Schulunterricht gegeben. Danach wird die Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs anhand der gezeigten Probleme diskutiert, und Folgerungen gezogen. Peter Rasfeld: Einführung in beschreibende Statistik mit den Techniken der Explorativen Datenanalyse. In: Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht, Band 8, herausgegeben von Hans-Wolfgang Henn und Katja Maaß. Hildesheim, Berlin: Franzbecker, 2004 Die Behandlung herkömmlicher Methoden und Begriffe der beschreibenden Statistik wird für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I i.a. als sehr schwierig eingestuft. Oftmals „entartet“ der Statistikunterricht, sofern er überhaupt stattfindet, in einer mehr oder weniger formalen Berechnung von Kenngrößen, ohne dass diesen wie auch den Interpretationen der Ergebnisse gebührend Beachtung geschenkt wird. Im vorliegenden Beitrag soll gezeigt werden, wie die modernen Methoden der explorativen Datenanalyse hier Verbesserungen bieten können. Peter Rasfeld: Verbessert der Stochastikunterricht intuitives stochastisches Denken? Ergebnisse zu einer empirischen Studie. In: Journal für Mathematikdidaktik Jahrgang 25(2004)1, S. 33-61 Der Bildungsinhalt der Stochastik ergibt sich nicht nur, wie oftmals betont wird, aus ihrem Anwendungscharakter, sondern auch aus der Tatsache, dass Grundelemente der Stochastik unserem Denken immanent sind. Im Alltag erfolgt die Einschätzung des Grades einer Wahrscheinlichkeit meist spontan und intuitiv. Es gibt eine Reihe von heuristischen Strategien, derer sich Personen in solchen Fällen bedienen, und die zu krassen Fehleinschätzungen führen können. In der im Artikel beschriebenen Untersuchung in elf Klassen der Jahrgangsstufe 10 in NRW wird der Frage nachgegangen, inwieweit Schüler durch die verbindlich vorgegebenen Stochastikinhalte lernen, solche intuitiv getroffenen Fehlurteile zu vermeiden bzw. Intuitionen aufzubauen, die eine angemessene Beurteilung stochastischer Fragestellungen ermöglichen. Als Fazit ergab sich, dass eine Verbesserung des intuitiven Verständnisses stochastischer Problemstellungen zwar stattfindet, aber nicht im erwünschten Ausmaß. Vorschläge zur Verbesserung der Situation werden kurz skizziert. Hans J. Schmidt: Prof. Dr. Rainer Tsufall – Die Würfel sind gefallen. Kopiervorlagen Mathematik zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Köln: Aulis Verlag Deubner, 2003 Handlungsorientierte Matrialien für die Schüler der Sekundarstufe 1 sowie Demonstrationsmodelle für die Overheadprojektion, anhand derer Zufallsversuche demonstriert und kommentiert werden können. Inhalt: Zufallsversuche und ihre Ausfälle, Wahrscheinlichkeiten, mehrstufige Zufallsversuche und Baumdiagramme, Pfad-und Summenregel, Kombinatorik, Taschenrechnereinsatz, Simulation mit Zufallsziffern, Zufallsgeräte. Heinz Klaus Strick: Stochastik mit Excel. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2003. Vorträge GDM 2003 . Hildesheim: Franzbecker. 2003.S. 625-628 Im Vortrag werden Beispiele vorgestellt, in denen sich der Einsatz von EXCEL bewährt hat: Erzeugung von Pseudozufallszahlen, Überprüfung von Kriterien für die ''Zufälligkeit'', Simulation von 34 Zufallsversuchen, Berechnung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren Kenngrößen, Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten, Vereinfachung von Rechenalgorithmen, Auswertung von größeren Datenmengen im Rahmen des Unterrichts oder in Unterrichtsprojekten. Reinhard Viertl: Einführung in die Stochastik (mit Elementen der Bayes-Statistik und der Analyse unscharfer Information). Wien: Springer, 2003 (3., überarbeitete und erweiterte Auflage) Das bewährte Lehrbuch bietet eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik. Es werden die verschiedenen Wahrscheinlichkeitsbegriffe (z.B.: klassische, geometrische, subjektive, unscharfe) dargestellt, gefolgt von einer detaillierten Ausführung von stochastischen Größen und Grundkonzepten sowie den zugehörigen mathematischen Sätzen. Der zweite Teil ist der klassischen schätzenden Statistik gewidmet und bringt Schätzfunktionen, Bereichsschätzungen, statistische Tests und Regressionsrechnung. Daran schließt sich die im deutschen Sprachraum stiefmütterlich behandelte Bayes-Statistik an. Das letzte Kapitel ist der formalen Beschreibung unscharfer Daten (fuzzy data) und deren statistischer Analyse gewidmet. Dieser Teil ist völlig neu und wurde vom Autor entwickelt. Zum besseren Verständnis wurde in der zweiten Auflage eine Reihe zusätzlicher Übungen eingebaut. Helmut Wirths, Oldenburg: Sind deutsche Autos anders als ausländische? . In: Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht, Band 8, herausgegeben von Hans-Wolfgang Henn und Katja Maaß. Hildesheim, Berlin: Franzbecker, 2004, S. 107-117 In diesem Beitrag werden Überlegungen zur Vorbereitung einer Unterrichtsreihe vorgestellt, in der Methoden und Begriffe der explorativen Datenanalyse (EDA) benutzt werden, ebenso Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht sowie Beobachtungen beim Umgang mit den Begriffen und Methoden der EDA. Großer Wert wird von Anfang an darauf gelegt, die Schülerinnen und Schüler beim Sammeln der Daten, bei der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse und bei der Revision ursprünglicher Vorstellungen so intensiv wie möglich mit einzubeziehen. Teile dieser Unterrichtseinheit wurden in 8. Klassen, die vollständige Einheit in Leistungs- und Grundkursen der gymnasialen Oberstufe unterrichtet. Gerhard König 35