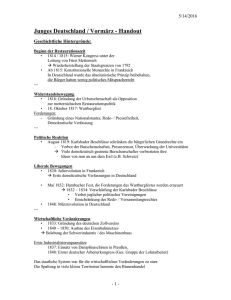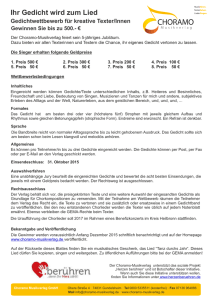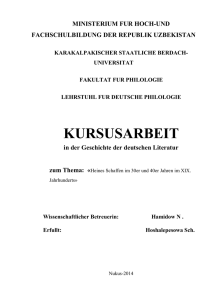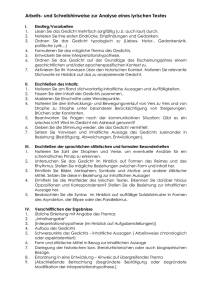BrinkmannHeine - Jan Volker Röhnert
Werbung
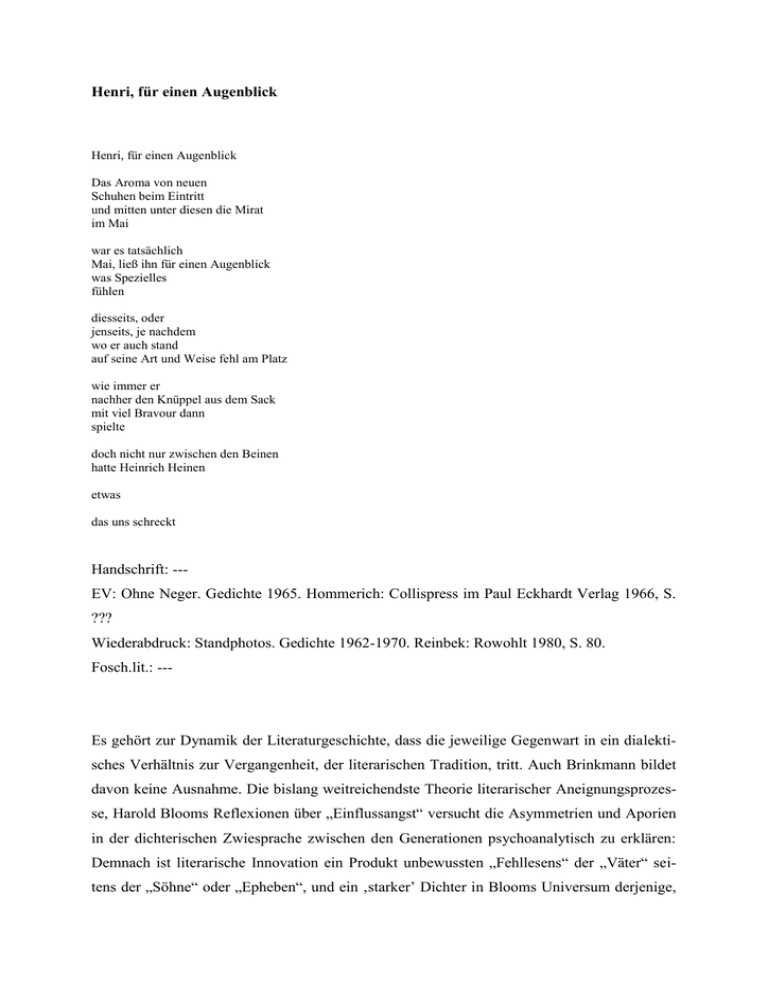
Henri, für einen Augenblick Henri, für einen Augenblick Das Aroma von neuen Schuhen beim Eintritt und mitten unter diesen die Mirat im Mai war es tatsächlich Mai, ließ ihn für einen Augenblick was Spezielles fühlen diesseits, oder jenseits, je nachdem wo er auch stand auf seine Art und Weise fehl am Platz wie immer er nachher den Knüppel aus dem Sack mit viel Bravour dann spielte doch nicht nur zwischen den Beinen hatte Heinrich Heinen etwas das uns schreckt Handschrift: --EV: Ohne Neger. Gedichte 1965. Hommerich: Collispress im Paul Eckhardt Verlag 1966, S. ??? Wiederabdruck: Standphotos. Gedichte 1962-1970. Reinbek: Rowohlt 1980, S. 80. Fosch.lit.: --- Es gehört zur Dynamik der Literaturgeschichte, dass die jeweilige Gegenwart in ein dialektisches Verhältnis zur Vergangenheit, der literarischen Tradition, tritt. Auch Brinkmann bildet davon keine Ausnahme. Die bislang weitreichendste Theorie literarischer Aneignungsprozesse, Harold Blooms Reflexionen über „Einflussangst“ versucht die Asymmetrien und Aporien in der dichterischen Zwiesprache zwischen den Generationen psychoanalytisch zu erklären: Demnach ist literarische Innovation ein Produkt unbewussten „Fehllesens“ der „Väter“ seitens der „Söhne“ oder „Epheben“, und ein ‚starker’ Dichter in Blooms Universum derjenige, welcher die literarischen Väter am intensivten – d.h. bis zum Vergessen des ursprünglichen Idols – ‚fehl’ liest.1 Blooms Theorie ließe sich sehr gut an Brinkmanns Verhältnis zu seinen literarischen Vätern darstellen. Zeit seines Schreibens hat er nichts unversucht gelassen, die Stimmen der Vergangenheit, der sogenannten ‚Tradition’ zu vergessen und in sich zum Verstummen zu bringen. Das lief nicht ohne radikale Verlautbarungen ab, die leicht zu der Vermutung führen könnten, Brinkmann habe gar kein Verhältnis zur Tradition gehabt oder sie sei ihm egal gewesen. Wer jedoch, in Anlehnung an den amerikanischen Beat-Poeten Gregory Corso, im literarischen ‚Todesjahr’ 1968 lautstark in die Welt posaunte: „Ich hasse alte Dichter“,2 dem dürfte die Tradition alles andere als egal gewesen sein; der hatte, im Gegenteil, ein sehr lebendiges, nur eben kein ungebrochenes Verhältnis zur Vergangenheit. Dass ein zu Anfang eines Krieges, der das gesamte Verhältnis der Deutschen zu ihrer Sprache und ihrer Geschichte radikal auf den Kopf stellen sollte, geborener deutscher Dichter kein entspanntes Verhältnis zum literarischen Kanon haben konnte, sondern jeden etablierten schulischen Kanon überhaupt in Frage stellen oder sich selektiv einen völlig anderen, eigenen Kanon zusammenstellen würde, sei als generationsspezifisch vorausgesetzt. Das Zeitsyndrom der „68er“ setzt jedoch die von Bloom diagnostizierte Dialektik der „Einflussangst“ nicht außer Kraft, sondern verschärft sie lediglich. Hinzu kommt der das sogenannte postmoderne Schreiben – d.h. hier zeitlich ganz einfach die westlichen Literaturen seit Ende des Zweiten Weltkrieges – kennzeichnende Zug zum literarischen Eklektizismus: ein Verständnis von Tradition, demzufolge die Autoren kaum mehr einen gemeinsamen Kanon miteinander teilen, sondern sich ihre Anregungen weit mehr als dies zu anderen Epochen der Fall war aus den verschiedensten Zeiten und Sprachen holen können; die Vergangenheit steht ihnen als Archiv oder Reservoir zur freien Verfügung. Brinkmanns eigener, zum mindesten widersprüchlicher Umgang mit den literarischen „Vätern“ bietet, soweit er bislang dokumentiert oder einsichtig gemacht worden ist, das beste Beispiel für diesen postmodernen Eklektizismus – ebenso aber für seine Arbeit an der „Einflussangst“. Den reichsten, offen liegenden Fundus stellt in beiderlei Hinsicht „Rom, Blicke“ dar – dort bildet seine anhaltende, zwischen Bewunderung, Fort- und Umschreibung pendelnde Auseinandersetzung mit zwei exponierten Außenseitern der Philosophie der frühen Neuzeit bzw. der literarischen Moderne, Giordano Bruno und Hans Henny Jahnn, einen leitmotivischen 1 Vgl. Harold Bloom: Einflussangst. Eine Theorie der Dichtung. Aus dem amerikanischen Englisch von Moniak Schweikhart. Basel: Stroemfeld 1995. [Am. Orig.: Anxiety of Influence. A theory of poetry.] 2 Vgl. Ralf Bentz et al. (Hrsg.): Protest! Literatur um 1968. Marbach a.N.: DLA 1998, S. 395-397. Kern des ganzen ziviliationszorngeschwängerten ‚Materialbandes’. Dies ist zwar bekannt, aber bislang noch längst nicht bis ins Detail nachverfolgt worden. Noch weniger erschlossen sind seine in Marbach lagernden frühen Briefe an Gottfried Benn, Hans Erich Nossack, Ernst Kreuder und den Merkur-Mitherausgeber Hans Paeschke, die eine ganz andere Sprache sprechen als die von Brinkmann v.a. bis 1970 nach außen hin zur Schau getragene brüske Ablehnung der westdeutschen Literaturszene und ihrer unmittelbaren geistigen ‚Väter’. Jenseits der deutschen Sprache ist seine Beschäftigung mit unmittelbaren ‚Vätern’ aus der französischen Moderne und Postmoderne (v.a. Céline, Butor, Robbe-Grillet), was die Prosa betrifft, sowie an der amerikanischen Lyrik-‚Szene’ von Whitman über Pound und Eliot bis zu O’Hara und Ashbery bemerkt worden. Eher zurückhaltend ist bislang allerdings Brinkmanns Verhältnis zu einzelnen Epochen der deutschen Literaturgeschichte registriert worden – so zum Barock (Gryphius), zur Aufklärung (Lessing), zur Romantik (Tieck), zur Jahrhundertwende (George, Hofmannsthal), zur Nachkriegsliteratur (Borchert, Rühmkorf, Enzensberger). Die Dialektik seines zweifellos also vorhandenen Traditionsbezugs spiegelt sich am besten in Extrempositionen wie der radikalen Ablehnung Goethes als Schaufensterfigur des offiziellen ‚bürgerlichen’ Kanons, der „jeden Katzenschiß“ zu bewundern imstande gewesen sei3 – und der Schwärmerei für den Reichtum noch ungehobener Perlen an den Rändern desselben Kanons: „Die deutsche Literatur ist schön!“4 Vor diesem Hintergrund ist sein wohl in der ersten Hälfte der 60er Jahre entstandenes HeinePorträt zu betrachten. Es ist im Band „Ohne Neger“ aus dem Jahr 1966 enthalten, im Gegensatz zu anderen Gedichten dieser frühen Zeit hat er es jedoch nicht in den 1967 bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlichten Band „Was fraglich ist wofür“ aufgenommen, der in der öffentlichen Rezeption Brinkmanns Bild als neuer, wohl innovativster Stimme seiner Generation entscheidend prägte. Auf die vor „Was fraglich ist wofür“ entstandene Lyrik sind sowohl Brinkmann in Aussagen über sich selbst als auch seine Interpreten selten eingegangen – beide wohl in der stillschweigenden Annahme, dass hier noch nicht der ‚Kern’ seiner Lyrik zu finden sei, es sich also um noch nicht völlig ‚ausgereifte’ Gedichte gehandelt habe, die als tastendes Ausprobieren von diversen Möglichkeiten oder Abarbeiten an heterogenen Vorbildern weniger diskutabel seien: Nach diesem Vorurteil wäre Brinkmann mit den immerhin vier Bänden vor „Was fraglich ist wofür“ damit noch nicht ‚bei sich selbst’ angelangt gewesen, was immer dies genau heißen mag. Egal wie man zu seiner frühen Lyrik steht, als reizlos oder Vgl. Hans-Edwin Friedrich: „Dieses Arkadien ist die reinste Lumpenschau“. Goethe und Italien in Rolf Dieter Brinkmanns „Rom, Blicke“. In: Dieter Ahrens (Hg.): Räume der Geschichte. Deutsch-Römisches vom 18.-20. Jahrhundert. Trier: Spee 1986, S. 143-156. 4 Rolf Dieter Brinkmann: Rom, Blicke. Reinbek: Rowohlt 1979, S. 346. 3 ein epigonal kann sie aber selbst unter dieser Prämisse nicht gelten. „Henri, für einen Augenblick“, in der Forschung wohl aus genannten Gründen noch unberücksichtigt, ist das beste Beispiel dafür, dass auch schon der frühe Brinkmann im Vollbesitz seiner lyrischen Fähigkeiten stand. Zu den Besonderheiten moderner Porträtgedichte gehört es, dass der Lyriker in der als Hommage sich verstehenden Gedicht-Charakteristik des Porträtierten immer auch eine poetische Selbstaussage mitliefert. Mit anderen Worten: das Porträtgedicht bietet dem modernen Lyriker die Chance, sich über sein eigenes Dichten und Trachten zu verständigen, ohne dabei seine eigene Person in den Fokus rücken zu müssen. Meister dieses Genres, von Brinkmanns Jugendidol Ezra Pound („Hommage to Sextus Propertius“, „Hugh Selwyn Mauberley“, „Gino“) bis hin etwa zu Wulf Kirsten („Gottfried Silbermann“, „der meteor“, „der lebensplan des Heinrich von Kleist“) lehren, dass ein Porträtgedicht umso mehr die eigene Poetik unterstützt, je mehr es nach außen hin um Objektivität dem Porträtierten gegenüber bemüht ist. In diesem Sinne lässt sich Brinkmanns Heine-Hommage in diese Traditionslinie von Porträtgedichten einordnen und könnte damit in einer Reihe von Heine-Reverenzen wie Peter Rühmkorfs „Hochseil“, Wolf Biermanns „Auf dem Friedhof am Montmartre“ oder Johannes Kühn „Der Chevalier von Geldern“ gelesen werden. Andererseits macht sich aber ebenso sehr die gegenläufige Tendenz bemerkbar, den Verweiszusammenhang mit dem Porträtierten zugunsten einer Radikalisierung der eigenen lyrischen Aussage – hier v.a. der Pointe, auf die das Gedicht hinausläuft – aufzusprengen oder zumindest fragwürdig erscheinen zu lassen. Ist da noch tatsächlich von Heine die Rede oder gibt er doch nur den Vorwand zur Inszenierung der eigenen Pointe ab? Dieser Frage gilt es nachzuspüren. Brinkmanns Blickwinkel auf Heine ist in jedem Fall ein besonderer, in eine spezielle Richtung zielender, der dem empirischen Heinrich Heine gegenüber wenig um lebens- und literaturgeschichtliche Objektivität bemüht ist; um ihn jedoch zu verstehen, wird einiges faktische Wissen um den empirischen Heinrich Heine vorausgesetzt. Insofern ist es ein typisches, dem Leser manches Vorwissen abverlangendes Porträtgedicht, das mit speziellen, nicht eigens ausgewiesenen Referenzen auf Biographie und Gedichte des Porträtierten spielt. Die Imitatio des Vorbildes reicht formal bis in den vierzeiligen Strophenbruch hinein, der dann jedoch gegen Ende aufgegeben wird – um in einen kalauernden, illusionszerstörenden Reim zu münden, wie er auch schon zu den Kunstgriffen von Heines poetischer Ironie gehörte. Das ist jedoch nicht alles. Zusätzlich ist die Hommage nämlich mit ebenso vielen nicht markierten Anspielungen auf Brinkmann selbst und seine Gegenwart gespickt – Anspielungen, bei denen der Hinweis auf den empirischen Heine kaum weiterhilft. Schon der Titel ist durchwirkt von diesem Ineinander intimer Heine-Kenntnisse und brinkmannesker Eigentümlichkeiten. „Henri“, so nannten die Franzosen den Dichter des „Buchs der Lieder“, welcher seit 1831 bei ihnen lebte – aber ebenso klingt darin Heines Taufname „Harry“ nach, durch dessen Verballhornungen seitens anderer Kinder ihm die ersten Demütigungen seines Lebens zugefügt wurden.5 Soweit bleibt der Heine-Bezug jedoch klar. Die Ergänzung „für einen Augenblick“ allerdings wird nur verständlich, wenn man sich Brinkmanns eigener poetologischer Maximen entsinnt, auch wenn diese erst ein paar Jahre nach der Niederschrift des Gedichtes präzise formuliert worden sind. Der „Augenblick“ ist ein entscheidendes Stichwort für Brinkmanns Poetik, der dann als „Schnappschuß“ oder amerikanisch „snapshot“ seine begriffliche Verfeinerung für das Zeitalter der Fotographie erfährt: „Ich glaube, daß HBBUJ J J J.6 Der „plötzlich“ einsetzende, emphatisch aufgeladene, als Schnittpunkt sich überlagernder Vorstellungen empfundene und das zeitliche Kontinuum außer Kraft setzende Augenblick – vergleichbar mit Joyce’ „Epiphanie“ oder Benjamins „profaner Erleuchtung“ – ist Dreh- und Angelpunkt für Brinkmanns lyrisches Verständnis. Erst in der Intensität des mit schockhafter Plötzlichkeit7 die Wahrnehmung des Ichs okkupierenden Augenblicks entfaltet sich für Brinkmann das Gedicht. Der so begriffene ‚zündende’ Augenblick – nach der einflussreichen Ästhetik Friedrich Theodor Vischers finde im Gedicht „das Zünden der Welt im Subjekte“8 statt – öffnet damit überhaupt erst die Augen für jenen Zusammenhang, den das Gedicht nachzuzeichnen sucht. Was hat es dann aber, um konkret zu werden und uns dem Gedicht zu nähern, mit dem „Aroma von neuen / Schuhen beim Eintritt“ in Brinkmanns Heine-Hommage auf sich? Auch hier kommt es zum schon diagnostizierten Ineinander von Heine’schen Intima und Brinkmann’scher Vorstellungswelt. Heine bezeichnete einmal seinen christlichen Taufschein als das „Entreebillet zur europäischen Kultur“,9 und in diesem Sinne enthält der „Eintritt“ im Gedicht auch eine Anspielung auf dieses biographische Faktum. Ein Eintritt kann aber auch mehr bedeuten als ein simples Hineingehen in eine Tür, eine Stadt oder eine Gesellschaft, in welcher man sich vorstellt und nach deren Spielregeln man sich dann verhält: Der „Eintritt“, gepaart mit dem als emphatische Plötzlichkeit verstandenen „Augenblick“, kann zum ‚Ereig5 Vgl. Heines autobiographische Fragmente in: Heinrich Heine: Werke. Bd. UVZV Hg. von Klaus Briegleb. München: Ullstein 19 UBIU, S. UBUIL. 6 Rolf Dieter Brinkmann: Notiz. In: Die Piloten. Gedichte. In: Standphotos. Gedichte 1962-1970. Reinbek: Hamburg 1980, s. HVUZVUZVUZ. 7 Zu diesem Begriff als unverzichtbarem Implikament einer Theorie der künstlerischen und literarischen Moderne, die sich freilich schon bei Heine mehr als nur andeutet (v.a. in den „Briefen aus Helgoland“ seiner BörneDenkschrift) vgl. Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Der Augenblick des ästhetischen Scheins. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981. 8 Friedrich Theodor Vischer: Die lyrische Dichtung. Zit. nach: Lyriktheorie. Hg. von Ludwig Völker. Stuttgart: Reclam 2000, S. 227-239, hier S. 233. 9 Heinrich Heine: Werke. Bd. ZBUBBUL. Hg. von Klaus Briegleb. München: Ullstein 1981, S. nIUNIPNIPN. nis’ werden – etwas Bleibendem, etwas über den initialen Augenblick hinaus Wirkendem und Denkwürdigem, so wie es Nietzsche auch von Heines literarischer Persönlichkeit selbst als blitzhaft auf- und eintretender Erscheinung auf der Bühne des Geistes beschrieb: „das letzte europäische Ereignis von Rang“.10 Und noch mehr als das. Das Verb „eintreten“ meint ja nicht nur schlicht irgendwo hineingehen oder sich emphatisch ereignen, sondern es kann genauso eine Wendung ins Drastische, Aggressive bezeichnen: etwas eintreten heißt etwas zerstören, etwas kaputtmachen oder niederschlagen, auf etwas oder jemanden eintreten; und so bedeutet „Eintritt“ nicht nur Öffnung, Eingang, Initiation, sondern auch Fußtritt, Beinhieb, „ein Tritt“ eben. Mit seiner literarischen Rhetorik, seien es seine generationsspezifischen Essays „Der Film in Worten“ bzw. die Notizen zur Anthologie „Silverscreen“ (1969), die schwere Beleidigung der Kritikers Marcel Reich-Ranicki im selben Jahr oder die Aggressivität seiner späten ‚Materialbände’, verfolgte Brinkmann durchaus die Absicht, verbal Fußtritte auszuteilen, ‚einzutreten’ – auf die ältere Generation, Kritiker, Kollegen, die Gesellschaft, die Welt schlechthin. Auch das Gedicht selbst konnte bei ihm von einer derart leibnahen Wut-Poetik mitgetragen sein: „die / Fußnote ist’n / wirklicher Tritt“ („Politisches Gedicht 13. November 1974, BRD“). Aber auch Heines Auftritte in der eleganten Welt gipfelten immer wieder in rhetorisch präzise geschliffenen Bosheiten – verbalen Fußtritten gegen die Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft, die deutsche Rückständigkeit in politicis, aber auch konkret gegen einzelne Personen wie Platen, Schlegel oder Börne. Auf dem öffentlichen Parkett machte sich Heine dadurch letztlich so unmöglich und gefürchtet, wie wir dies aus vielerlei Quellen auch von Brinkmanns sozialer Erscheinung wissen. Welche genaue Wendung der „Eintritt“ hier vollzieht, wird in der Schwebe gehalten. Fest steht jedenfalls, dass er nur mit „neuen Schuhen“ zu absolvieren ist. Auch wenn eine literarische Motivgeschichte der menschlichen Fußbekleidung erst noch zu schreiben wäre, so ist die Rolle von Schuhen in der überlieferten poetischen Bildersprache kaum zu übersehen, denkt man etwa an die „leisen Sohlen“, auf denen sich gleichermaßen Liebende ihrer Bettstatt wie Verbrecher dem Ort ihrer Tatausübung nähern, oder denkt man an die phantastischen „Siebenmeilenstiefel“, die Chamissos Peter Schlemihl für den Verlust seines Schattens entschädigen sollen: Erst sie machen ihn zum Weltreisenden und geben ihm die Möglichkeit, überall ‚einzutreten’. In der Kunst führt van Goghs Hervorhebung seines ausgetretenen Stiefelpaars auf den Nullpunkt der blanken menschlichen Existenz zurück, während der Philosoph Heidegger auf die Erde an seinen Schuhsohlen verwies, um den Begriff „Heimat“ zu illustrieren. Andy Warhol, der Vater der Pop-Art, begann seine Karriere mit 10 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Bd. Buibibn Hg. von Mazzino Montinari und Giorgio Colli. Berlin/München et al.: de Gruyter/dtv 1999, S. VUUZVU. dem Zeichnen von Schuhmodellen, und in der populären Songkultur der späten fünfziger Jahre hören wir Nancy Sinatra mit „These boots are made for walking“ und Elvis Presley mit „My bue suede shoes“. In Brinkmanns „Gedicht ‚Nacht’“, erschienen 1970 im Gedichtband „Gras“ (vgl. die hier vorgestellte Interpretation von Christian Metz), betrachtet ein Mann die italienischen Qualitätslederschuhe eines anderen, drogenberauschten Mannes, während das ein Jahr später in der Zeitschrift „Akzente“ erschienene Gedicht „Meine blauen Wildlederschuhe“ in scheinbar unbeschwertem, liedhaften Ton eine Erinnerung an eine Zeit beschwört, in der sein Autor, Brinkmann selbst, im Literaturverein „Rhetorica“ seines Heimatgymnasiums „Antonianum“ mit Vorträgen zu Heine, Hemingway u.a. deutsche und Weltliteratur sich und seinen Kommilitonen abseits kanonischer Bildungsvorhaben damaliger westdeutscher Gymnasien erschlossen hatte.11 „Meine blauen Wildlederschuhe“ ist mehr als die ob ihrer Simplizität Verblüffung stiftende Verdeutschung des Rock’n’Roll-Schlagers – in Brinkmanns Kommentar die „freie Übertragung einiger Zeilen daraus“12 – als Gedicht; es zeigt, wie das dem Schaufenster entströmende „Aroma von neuen Schuhen“ überhaupt erst salonfähig macht und zum „Eintritt“ in die Welt (der Erwachsenen, der Liebe, der von der Suggestion künstlicher Bedürfnisse zusammengehaltenen Zivilisation – die „Dialektik der Aufklärung“ lässt grüßen) befähigt: Im Sommer 1957 sah ich sie im Schaufenster eines Schugeschäfts in Vechta ausgestellt. Ich ging rein und kaufte sie mir. Sie standen mir gut, und ich sagte zu dir, mach, was du willst, aber tritt mir bloß nicht auf die neuen Wildlederschuhe. Einmal wegen des Geldes und dann wegen der Schau und schließlich sind die Schuhe so unwahrscheinlich blau; mach, was du willst, aber tritt mir nicht auf die neuen Wildlederschuhe, meine neuen, blauen Wildlederschuhe, Vgl. Gunter Geduldig / Ursula Schüssler: „Vechta! Eine Fiktion!“ Der Dichter Rolf Dieter Brinkmann. Osnabrück: secolo 1996, S. 64-67. 12 Rolf Dieter Brinkmann: Anmerkungen. In: Akzente. Zeitschrift für Literatur. Hg. von Hans Bender. Heft 1/1971, S. 96. 11 die blauen, blauen Widlederschuhe, mach, was du willst, aber tritt mir bloß nicht auf die neuen blauen Wildlederschuhe, war alles was ich denken konnte, als ich mitten in dem Sonnenlicht langsam auf dich zuschlenderte.13 Wenn wir das „dich“ in Brinkmanns obigem Gedicht als weibliches Gegenüber des männlichen Ichs verstehen, so wiederholt sich hier – nur eben unter popkulturellen Vorzeichen – eine ganz ähnliche Situation wie die im Heine-Porträt beschriebene: In seinen neuen Schuhen trifft der Protagonist eine Frau, die wir als so etwas wie die ‚Muse des Dichters/Sängers’ bezeichnen dürfen – zumindest handelt es sich auf Zeile drei von „Henri, für einen Augenblick“ namentlich um die Heine seit Paris die längste Zeit über, nicht zuletzt auch ehelich, verbundene Frau, Mathilde Mirat, die er im späten, einen Ausflug zu seinem Montmartre-Grab imaginierenden Gedicht „Gedächtnisfeier“ als „süßes, dickes Kind“14 bezeichnet. Biographisch ist überliefert, dass Heine der Blumenhändlerin, die sich und ihre Verwandtschaft höchstwahrscheinlich auch durch andere Gelegenheitsdienste über Wasser hielt, das erste Mal in der Tat zufällig während eines Pariser Stadtbummels begegnet war. Die Erscheinung der kaum des Lesens und Schreibens Kundigen, geschweige des Lesens von Heines Gedichten, wird in Brinkmanns Hommage durch einen syntaktischen Bruch herbeigeführt: „und mitten unter diesen“ ist kein folgerichtiges Verbindungsglied zu „Das Aroma von neuen Schuhen / beim Eintritt“, denn es bleibt unklar, auf welches Objekt sich das Demonstrativpronomen „diesen“ eigentlich beziehen soll: Die neuen Schuhe – nicht als die neue Bestiefelung des Dichters verstanden, sondern die „neuen Schuhe“ als Synonym für seine neue (Pariser) Lebenswelt, in der er sich bewegt? Oder sind „diese“ einfach all die Menschen, die beim „Eintritt“ erblickt werden? In der elliptischen Verknappung des Gedichts würde „Eintritt“ damit zugleich schon die Menschen implizieren, denen sich der Protagonist in seinen neuen Schuhen nähert, auf die er, sie wahrnehmend, hinzutritt – um sie womöglich in seiner ereignishaften dichterischen Erscheinung, die er verkörpert, zu ihrem Schauder und Schrecken bloßzustellen. Und all dies, so suggeriert es Brinkmann, geschieht „im Mai“, einem alten, seit dem Minnesang tradierten dichterischen Symbol für die Jahreszeit des größten Verliebtseins, die Saison 13 14 Rolf Dieter Brinkmann: Acht Gedichte. In: Akzente ebd., S. 1-10, hier S. 2. Heinrich Heine: Gedichte BZUBLUBLUI S. UIBIUBN. der meisten ‚Frühlingsgefühle’, die vom frühen Heine auch entsprechend poetisch verwertet worden war. Die Alliteration des M stiftet einen engeren Zusammenhang zwischen der hier ungewöhnlicherweise als „die Mirat“ apostrophierten Frau Heines – üblicherweise figuriert sie in Biographie und Forschung schlicht als „Mathilde“ – und der Jahreszeit der Poesie schlechthin. Der Monat scheint direkt eine Eigenschaft der Mirat zu sein, sie steht dank dieser Engführung also selber „im Mai“ ihres Lebens – und das heißt hier auch in der Blüte ihrer Jugendlichkeit und erotischen Anziehungskraft: Brinkmann scheint auf die erste Pariser Begegnung Heines mit ihr anspielen zu wollen. Allerdings wird der Mai als die poetische Jahreszeit sui generis mit den Folgeversen auch wieder in Frage gestellt („war es tatsächlich / Mai ließ ihn für einen Augenblick / was Spezielles / fühlen“), was der Ambivalenz der Poetisierung dieses Monats in Heines Gedichten durchaus gut entspricht. Es ist ja nur vordergründig und unter Ausblendung aller nach dem „Buch der Lieder“ entstandenen Verse so, dass ihm der Mai ausschließlich als Liebeswonnenmonat begegnet wäre – und wenn schon, dann eben nur „für einen Augenblick“. Das MaiEmpfinden bleibt fragil, und den bekannten emphatischen Mai-Versen des „Lyrischen Intermezzo“ von 1827 stehen (weniger bekannte) unversöhnliche Zeilen aus den Jahren der „Matratzengruft“ nach 1851 gegenüber: Im wunderschönen Monat Mai Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Vögel sangen, Da hab ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen.15 Im Mai Die Freunde, die ich geküßt und geliebt, Die haben das Schlimmste an mir verübt. Mein Herze bricht; doch droben die Sonne, Lachend begrüßt sie den Monat mit Wonne. Es blüht der Lenz. Im grünen Wald Der lustige Vogelsang erschallt, Und Mädchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich – o schöne Welt, du bist abscheulich! 15 Heinrich Heine: Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge. Hg. von Klaus Briegleb. Frankfurt a.M.: Insel 2007, S. 301. […]16 „Im wunderschönen Monat Mai“ ist noch diesseits des Rheines in der deutschen Sprachheimat Heines entstanden; „Im Mai“ hingegen jenseits des Rheins im französischen Exil. Das erste Gedicht steht diesseits der tradierten Erwartungen an die Poesie des Monats Mai; das zweite Gedicht jenseits davon, es dementiert sie mit allem Effekt. Das erste Gedicht tritt ins poetische Bild des Maimonats ein; das zweite tritt darauf ein. Mit dieser Ambivalenz dem Leben und der Poesie gegenüber, „diesseits, oder / jenseits, je nachdem / wo er auch stand“, wirkt der Poet „auf seine Art und Weise fehl am Platz“: Eine Existenz, die zwischen allen Stühlen vagabundiert. Über „seine Art und Weise“ werden wir auf den nächsten Zeilen noch etwas genauer unterrichtet: „wie immer er nachher / den Knüppel aus dem Sack / mit viel Bravour dann / spielte“. Hier wird die Konsequenz aus dem zuvor Gesagten gezogen – eine Existenz konstituiert sich, die erst im dauernden Austragen ihrer Gegensätze ihre Erfüllung findet. Der Porträtierte – sofern überhaupt noch von Heine allein die Rede ist – bleibt notwendig zwischen allen Stühlen, auch wenn er „mit viel Bravour dann / spielte“. Die Konjunktion „wie immer“ muss jedoch nicht nur einschränkend gemeint sein, in ihrer syntaktischen Unschärfe kommt auch ein zeitlicher Aspekt zur Geltung: „immer“. Da er immer „mit viel Bravour dann“ zu spielen vermag, liegt sein Heil in der Artistik. Wo immer er eintritt ist der Artist imstande, (s)ein Lied bravourös zu spielen. Dem hier Porträtierten Artisten nützt dies jedoch wenig, um auf Dauer irgendwo gelitten zu sein, denn was er so meisterhaft spielt, ist genau das, was die anderen nicht hören wollen, weil es, sie bloßstellend, ihnen die Sprache verschlägt: der „Knüppel aus dem Sack“. Das heißt, „auf seine Art und Weise fehl am Platz“ zu sein. Das Märchenmotiv vom „Knüppel aus dem Sack“, der den am gedeckten Tischlein unbefugt Sitzenden den Appetit verdirbt, hat in diesem Fall jedoch eine unverhoffte Schlusspointe, mit der Brinkmann die Tür gleichsam mit einem Knall hinter sich zuschlagen lässt. Ganz wie der Heine seines Gedichts bei jedem Eintritt den Knüppel seiner spottsauren Poesie aus dem Sack holen muss, erspart „uns“ Brinkmann nicht die in diesem Typus sich verkörpernde unmoralische ‚Moral’. Mit seinem „Knüppel aus dem Sack“ platzt der Artist in jeden falschen Konsens von Geselligkeit oder sogenannter Gemütlichkeit hinein; doch die eigentliche Provokation ist nunmehr, dass sich „Knüppel“ und „Sack“ ganz handgreiflich auch auf die Leiblichkeit des vermeintlichen Störenfrieds beziehen! Die typisch brinkmanneske Frivolität wird durch den bewusst verballhornenden, an biedere Wirtshaussprüche oder Abzählverse erinnernden Reim 16 Ebd. S. 710. in ihrer Drastik nurmehr verschärft: „Doch nicht nur zwischen den Beinen / hatte Heinrich Heinen“. Heine selbst war, ganz abgesehen von der ihm nachgesagten und vielerorts in seinen Texten anklingenden Promiskuität, ein Meister der – manchmal bis zur Zote hinabreichenden – frivolen Anspielung. Auch die später von Brinkmann mit potenzierter Wucht gern aufgegriffene blasphemische Lästerung gehört in dieses Spektrum Heine’schen Zynismus hinein: „Des Oberkirchners Töchterlein / Führt’ mich aus den heiligen Hallen; / Ihr Hals war rot, ihr Mund war klein, / Ihr Tuch vom Busen gefallen.“17 Insofern liegt Brinkmanns Pointe ganz auf Heines poetischer Linie und wird vom Genre des Porträtgedichts mit abgedeckt. Aber dabei bleibt es eben nicht. Brinkmann schlägt den Bogen zu seiner Gegenwart, zu sich selbst und den Lesern oder Hörern des Gedichts, indem er das Pronomen „uns“ einfügt. Nachträglich, wie wir auf die Pointe gestoßen werden, dass Wörtern wie „Knüppel“ und „Sack“ ein durchaus handgreiflich-derber Sinn innezuwohnen vermag, werden wir auch daran erinnert, dass das, was in Heines Typus zur Erscheinung gekommen war, nicht etwa mit ihm und seiner Epoche erledigt gewesen wäre, sondern, im Gegenteil, „uns“ noch immer „schreckt“. Es kommt nur, wie hier dank der Pointe, auf den unmittelbaren „Augenblick“ der Erkenntnis solcher wortwörtlich entblößender Sprengkraft an. Mitunter genügt die Erinnerung an den verschütteten oder ausgeblendeten Sinn eines Wortes bzw. einer Redensart durch einen, der wie Heine oder Brinkmann als Dichter jenseits aller Gemütlichkeit steht, um die moralischen Grundfesten einer Gesellschaft in Frage zu stellen. Das Porträtgedicht, das keines oder mehr als dies sein will, zeigt: Von Heines kompromisslosem Dichtertum strahlt ein Anspruch aus, der aktualisiert zu werden verdient. Brinkmann hat ihn für seine Generation aufgegriffen. An Heine nahm er, das zeigt sein Gedicht, genau jene Aspekte wahr, die in seiner unmittelbaren Gegenwart und Umgebung – die westdeutschen Nachkriegsjahre im katholisch geprägten Vechta – enorm verstörend, anstoßend und provozierend wirken mussten. Die frühe Begegnung mit Heine, die „Henri, für einen Augenblick“ dokumentiert, lieferte Brinkmann die Stichworte für seine Poetik des kalkulierten Tabubruchs und ein dichterisches Selbstbild, das aus der praktizierten Artistik die Rechtfertigung dafür bezieht, nirgendwo ganz zuhause sein zu können bzw. da, wo es ihm zu gemütlich zu werden droht, den Knüppel aus dem Sack zu holen. Das Aufgehen in diesem Selbstbild macht aber auch klar, weshalb Brinkmann von der Aufnahme dieser Heine-Hommage in seinen ersten repräsentativen Gedichtband „Was fraglich ist wofür“ abgesehen hat: er war selbst schon viel 17 Heinrich Heine: Gedichte. ZTVZIVZUKV S. ZVUZB. zu sehr in dieser Rolle aufgegangen, als dass er sich noch auf Heine, der ihm die initiale Anregung dafür geschenkt hatte, hätte berufen wollen.