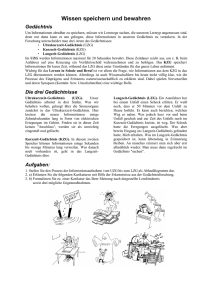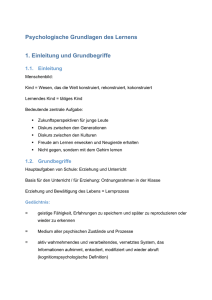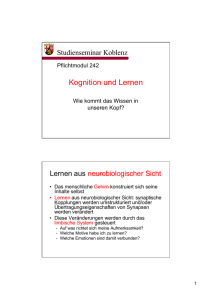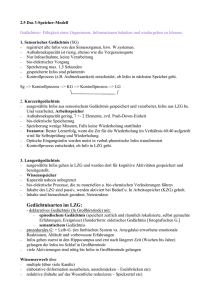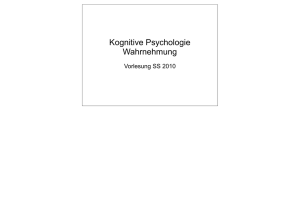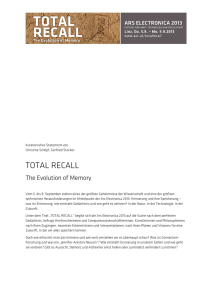Psychologische Grundlagen des Lernens
Werbung
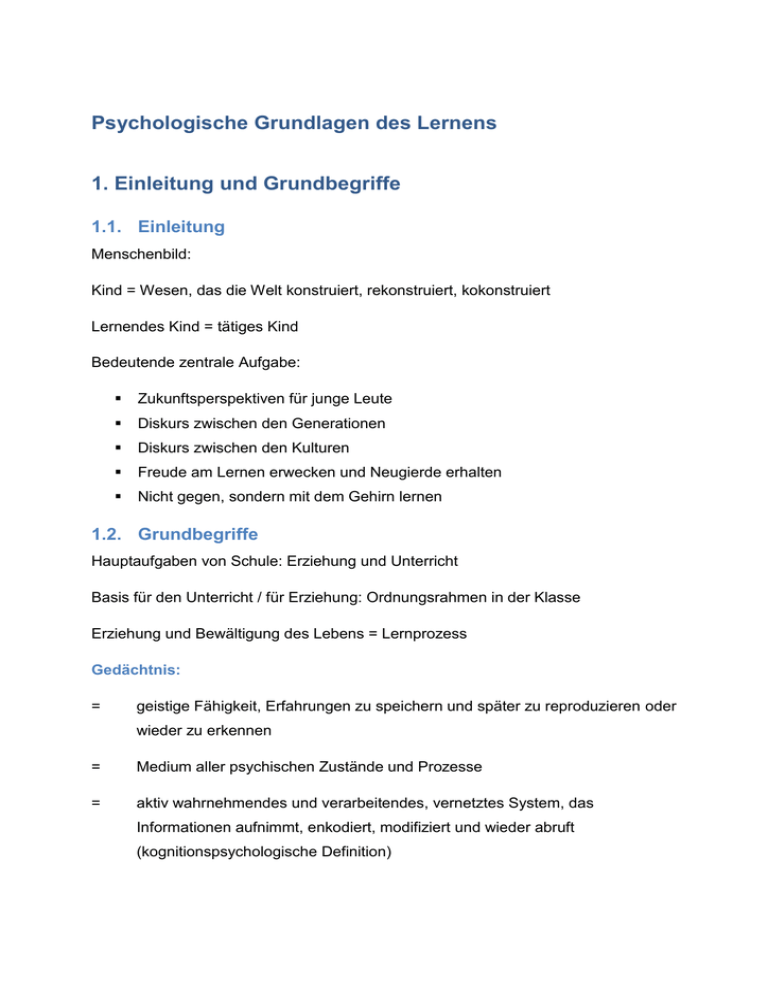
Psychologische Grundlagen des Lernens 1. Einleitung und Grundbegriffe 1.1. Einleitung Menschenbild: Kind = Wesen, das die Welt konstruiert, rekonstruiert, kokonstruiert Lernendes Kind = tätiges Kind Bedeutende zentrale Aufgabe: Zukunftsperspektiven für junge Leute Diskurs zwischen den Generationen Diskurs zwischen den Kulturen Freude am Lernen erwecken und Neugierde erhalten Nicht gegen, sondern mit dem Gehirn lernen 1.2. Grundbegriffe Hauptaufgaben von Schule: Erziehung und Unterricht Basis für den Unterricht / für Erziehung: Ordnungsrahmen in der Klasse Erziehung und Bewältigung des Lebens = Lernprozess Gedächtnis: = geistige Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern und später zu reproduzieren oder wieder zu erkennen = Medium aller psychischen Zustände und Prozesse = aktiv wahrnehmendes und verarbeitendes, vernetztes System, das Informationen aufnimmt, enkodiert, modifiziert und wieder abruft (kognitionspsychologische Definition) Gedächtnisleistungen sind Voraussetzungen für das Lernen und für schulisches Verhalten. Das Gedächtnis sichert die Konsistenz der Steuerung (Wahrnehmen, Denken, lernen, Handeln, Emotionen und Motivationen) Es braucht Wissen, um Fakten zu bewerten und einzuordnen ( Filtern des Wesentlichen, da Informationsflut). Auch Kreativität braucht Wissen (Routine, Schemata) Psychische Prozesse sind Informationsverarbeitungsprozesse (über Sinneswahrnehmung aufgenommen und gleich gefiltert). Emotionale Aspekte hängen mit früher gemachten Erfahrungen zusammen. Quellen des Gedächtnisses: Beobachten und Selbsterfahrung meist automatisiert, nicht beabsichtigt Belehren / systemat. Unterweisung / angeleitetes Lernen Schule Einsichten, die durch Denkprozesse erzeugt werden (Denken schwer überprüfbar) Informationsbegriff – zB Eiernockerl mit Salat Strukturell (3 Wörter, Buchstaben) Semantisch (Bedeutung, Zusammensetzung: Mehl, Eier, Salz,...) Pragmatisch (mag ich / mag ich nicht, Lieblingsspeise) H. Roth: „Wenn das Kind lernt, lernt das ganze Kind“ Lernen: = aktiver, konstruktiver Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder Verhaltenspotenzial führt und auf Erfahrungen aufbaut, jedoch nicht auf Reifung zurückzuführen ist = nicht beobachtbar – es wird aus dem Verhalten und den Lernleistungen erschlossen Schulisches Lernen ist kein isolierter Vorgang Kognitionen: = Strukturen und Prozesse des Wahrnehmens, Erinnerns, Schlussfolgerns, Denkens und Entscheidens = Strukturen und Begriffe des Gedächtnisses a. Wahrnehmung und Selektion des „Inputs“ – Wahrnehmung ist immer selektiv und von vorausgehenden Lernprozessen abhängig Voraussetzung: Aufmerksamkeit wird auf die ausgewählten Reize gelenkt - „Bottom up“ – Prozesse (vom Reiz aus) Datengeleitete Prozesse – Aufnahme und Organisation von Informationen aus der Erfahrung - „Topdown“ – Prozesse (vom Gehirn aus) Hypothesengeleitete Prozesse – vorhandene Strukturen bestimmen die Auswahl, Organisation, Interpretation der eingehenden Information b. Enkodierung = Übersetzen von eintreffenden Reizen in einen neuronalen Code, den das Hirn verarbeiten kann (wie speichern wir etwas ein?) Inhalte werden mit weiteren Prozessen verbunden (Zielen, Zwecken) „Eingliederung in die bisherige Erfahrungswelt“ (Karl Bühler“ Netzwerte c. Speicherung: die enkodierte Information wird über die Zeit relativ stabil aufbewahrt. Nicht alles wird dauerhaft gespeichert. Wiederholen, Übern und Anwenden haben eine besondere Bedeutung d. Abruf, Erinnern (retrieval) = Aktivierung der abgespeicherten Erfahrungen, beobachtbarer Ertrag aller vorangegangenen Prozesse 1 1http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ged%C3%A4chtnis_modell.png&fileti mestamp=20070410094220 (16.1.10, 20:05) Höhere Gedächtnisleistung bei freier Formulierung, Wiedererkennen (Multiple Choice) ist einfacher 10 Lernregeln für gehirngerechtes Lernen 1. Transparenz der Lehr- und Lernziele sinnvolles Curriculum erstellen Frage: „ WOZU?“ vermittelt dem Lernenden den Sinn des ganzen Lernens 2. Überblick vor Einzelinformationen – „Skelett“ vor Detail „WORUM“ geht es eigentlich? Überblick geben: Gehirn sucht nach geeigneten Speicherplätzen, legt neue an und ist vorbereitet auf Wahrnehmung und Verarbeitung des neuen Lerninhalts 3. Interesse wecken – Neugierde ist die beste Motivation 4. Wiederholen Wiederholen in verschiedenen Variationen – Auswendiglernen ist nicht gefragt – Abwechslung schafft Freude 5. Mehrere Sinne ansprechen – viele Eingangskanäle nutzen Informationen sollen „begriffen“ werden (nicht nur mit Ohren und Augen, sondern mit allen Sinnen) dauerhaftere Vernetzung in Schaltkreisen 6. Auf die Gefühle achten – Lernspass ermöglichen Die Rolle von Gefühlen beim Lernen und Denken ist anatomisch und physiologisch eindeutig nachweisbar (Angst und Stress behindert Lernprozess) 7. Rückmelden Richtig: ja oder nein? – Umlernen ist schwieriger als Neulernen. Rückmeldungen können durch Fremd- oder Selbstkontrolle erfolgen (wichtig: LOBEN, VERSTÄRKEN, BEKRÄFTIGEN) 8. Pausen einlegen – Interferenz vermeiden Hirnchemie benötigt Zeit, um in Ruhe am Stoff arbeiten zu können „Konsolidierung“ = Festigung (Pausen: schlafen, Musik hören,...) 9. In der richtigen Reihenfolge lehren und lernen – Altes neu verpacken „roter Faden“ muss erkennbar, logischer Aufbau gegeben sein – Einbau des Neuen in vorhandenes Wissen 10. Vernetzen und Verknüpfen mit der Realität Lernen in Zusammenhängen, mehrere Sinne ansprechen, fächerübergreifendes und projektorientiertes Lernen Variablen des Lernprozesses Grundlagen für Lernbereitschaft Lernbereitschaft: nicht müde, Kopf frei, lüften Motivation muss ich selbst einbringen Gelerntes beeinflusst Wahrnehmung Wahrnehmung Einprägen Behalten (Gedächtnis) Reproduktion Wiedererkennen Freies Reproduzieren 2.1. Wahrnehmung = „Analyse durch Synthese“ – Prozess Aus dem Reizangebot werden die wesentlichsten Merkmale analysiert – durch Vergleich mit bereits gespeichertem Wissen – und mit diesem zu einem Bild synthetisiert Zur Wahrnehmung verarbeiten wir Daten (physikalische Reize, Merkmale) und Erwartungen (Vorinformationen, Kontext, Erfahrung, Emotionen) eigene Emotion wird selber erzeugt Merkmalsanalyse: - Corticale Dedektoren „feuern“ (ansprechen, reaktiv werden) nur selektiv auf bestimmte Reize - Experiment mit neugeborenen Katzen: äußere Einflüsse der ersten Lebenswochen bestimmen, wie das Gehirn später arbeiten wird (Katzen 6 Wochen mit senkrechten bzw. waagrechten Linien umgeben waren danach „blind“ gegenüber anderen Linien Orientierungslosigkeit - Sinnesorgane müssen trainiert werden, um nicht zu verkümmern das, was nicht geübt wird, geht zugrunde - Ebenso muss das genetische Material trainiert werden, damit es nicht zugrunde geht 2.2. Lernen, Normen und Wissen in der „Wissensgesellschaft“ o Wissen (= mehr als Information) ist kein Abbild objektiver Wirklichkeit, aber auch nicht der Subjektivität überantwortet. Es kann pragmatisch durch Bewährung und Praxis überprüft und modifiziert werden o Normen sind hingegen gesetzte Bedingungen. Sie gelten, selbst, wenn sie übertreten werden (zB. Schulgesetz, Klassenordnung,...) o Die Quantität des Wissens sagt noch nichts über die Qualität aus, dennoch bedarf es in der „Wissensgesellschaft“ eines lebendigen Lernprozesses – Neuerlernens, Bewertens und Umlernens. je mehr ich über einen Bereich weiß, desto mehr Fragen tun sich auf o Risiken werden nicht mehr auf die Technik allein beschränkt. Nachteile werden in Kauf genommen (zB. Kernkraftnutzung – CO2 – Emmisionen) o Ethisches Lernen sollte daher nicht vernachlässigt werden Irrtümer der „Wissensgesellschaft“ (Informationsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Spassgesellschaft, Willkürgesellschaft) Wissen ist mehr als bloße Kenntnis von Fakten, mehr als eine Informationshalde! 2.3. Klassische Gedächtnispsychologie – Einprägen und Reproduzieren verbaler Inhalte 2.3.1. Experimente zur Unterstützung des Gedächtnisses: 1. Experiment (Methode der behaltenen Elemente) 9 sinnvolle Elemente: Vogel Vater Auto Kamm Buch Blume Sessel Haus Baum 2.Experiment 9 sinnlose Elemente: nuv rof wep gub zav rov mib wef zap Praktische Relevanz der experimentellen Erkenntnisse: o Die Behaltensleistung hängt stark vom Lernmaterial ab. Je größer der Informationsgrad (Neuigkeitswert), desto geringer das Behalten o Bedeutung des Kurzzeitgedächtnisses zB. Merken von Telefonnummern, „Zusammenschleifen“ der Buchstaben zu Wörtern (Lesen lernen), Verbinden der Wörter zu einem Satz, Kopfrechnen,... o Wiederholungen sind erforderlich, um den Inhalt fehlerfrei zu reproduzieren (zB. 1 mal 1) Die Gedächtnisspanne: Die Gedächtnisspanne für das unmittelbare Behalten bei einmaligem Hören oder Sehen (Kurzzeitgedächtnis) beträgt: 7 (Dinge) +/- 2 = magische Zahl nach Miller Miller nannte diese Einheiten „chunks“: o Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis (KZG) ist bei nur einmaliger Speicherung sehr kurz (einige Sekunden) o Im Geiste wiederholen o Das erste Objekt, das die Kapazität des KZG übersteigt, wird also dasjenige aus dem KZG verdrängen, welches schon am längsten dort ist (Interferenz Überlagerung) 2.3.2. Günstigste Verteilung des Lernstoffes Nach der Zeit (Adolf Jost) Tage für die Wiederholung der Silbereihen Wiederholungen (jeweils 24) – „workload“ immer gleich Trefferzahlen 3 6 12 8x 4x 2x 18 39 53 Fast 3facher Lerngewinn bei verteiltem Lernen! Auch Minutenabstände mit Pausen bringen Gewinn Eine Vergrößerung des Lernmaterials führt zu einer unverhältnismäßigen Steigerung der Lernzeit (vor allem beim Auswendiglernen) Neuropsychologische Erklärung: Das Gehirn lernt länger als unser Bewusstsein (G. Guttmann) H. Rohrbacher: Das Erregungsgeschehen, das den bewussten Vorgängen zugrunde liegt = mentale Erregungen (bewusst) Es gibt Erregungen in unserem Gehirn, die zu schwach sind, um bewusste Erregungen hervorzurufen = submentale Erregungen (nicht bewusst) Erregungen, die bewussten Vorgängen folgen = postmentale Erregungen Mentale und postmentale Erregungen __________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aktiver Lernprozess Gehirn lernt weiter mentales Geschehen postmentales Geschehen (störbar) ________________________________________________________________ Einprägungsvorgang 2.3.3. Ebbinghaus’sche Vergessenskurve – Der Sinngehalt des Lernmaterials und die Bedeutung für das Behalten Begründer der Gedächtnispsychologie: H. Ebbinghaus (1880 – 1910) o Gemäß einem durch Professor Hermann Ebbinghaus bekannt gewordenen Gedächtnisexperiment und der daraus aufgestellten Vergessenskurve verlieren wir nach ca. 20 Minuten schon 40 Prozent der aufgenommenen Informationen, nach einer Stunde ca. 50% und nach einem Tag ca. 70 o Die Zahlen verschiedener, ähnlicher Experimente variieren leicht - für die Praxis bleibt die Erkenntnis, Kernbotschaften mehrfach und spätestens nach 20 Minuten zu wiederholen.2 2 http://www.softskills.com/mentalkompetenz/leseundlernkompetenz/vergessenskurve/ebbinghaus.ph p (Stand: 14.1.10, 14:00) 3 %. 4 Sinnvolles Lernmaterial wird besser behalten und langsamer vergessen Vorangegangene Lernprozesse bilden die Grundlage für das Sinnverstehen Eine unmittelbare Redundanz (Bekanntheit, Wiederholungseffekt) ist für das Lernen am günstigsten Zum Lesen gehört unter anderem ein Wiedererkennen gespeicherter Inhalte „Eingliederung in die bisherige Erfahrungswelt“ (Karl Bühler) – Kognitive Netzwerke entstehen 3 Material, das über mehrere Sinnkanäle rezipiert wird, wird besser behalten http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/Vergessen.shtml (Stand: 14.1.10, 14:05) 4 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/Vergessen.shtml (Stand 14.1.10, 14:05) Experiment von Ableitinger & Duckkowitsch A Gegenstände B Bezeichnungen der Gegenstände (zB. Haus) C abstrakte Wörter (Luft, Freundschaft,...) 3. Schulstufe 4. Schulstufe 67% 75% 49% 52% 39% 46% 226 Schüler sollten sich in 3 Durchgängen je 10 Elemente von unterschiedlichem Material merken Das KZG nimmt mit dem Alter zu Je konkreter das Material, desto besser die Merkleistung CHUNKS Die Information wird in sogenannten Bündeln (chunks) gespeichert, deren Beschaffenheit sich danach richtet, was für Inhalte das Langzeitgedächtnis zur Verfügung stellt. Ein Bündel ist eine semantische Einheit, ein Konzept Beispiel: 5 Buchstaben (k c r l b) 5 Einheiten 5 Wörter wenn Sinn, dann ein Satz 1 Einheit Lesen ist kein rezeptiver, sondern ein konstruktiver Prozess mit de Ziel des Verstehens!!! Voraussetzung: man kennt die Sprache, hat Lesekompetenz 2.4. Assoziationen (Verbindungen) o Die Inhalte unserer Erlebnisse werden nicht nur eingeprägt, sondern miteinander verbunden o Beim Einspeichern stellen wir selbst Verknüpfungen her o In der modernen Lernpsychologie wird dieses Phänomen als „Aktivierungsausbreitung“ bezeichnet und ist sehr wichtig für das Verständnis des Abrufens aus dem LZG z.B „Ein Spatz kann fliegen“ aktiviert alle damit verbundenen Knoten „ist ein Vogel“, „legt Eier“, „nistet in Bäumen“,... Von den betroffenen neuen Knoten aus setzt sich dieser Prozess fort 2.4.1. Gleichzeitigkeitsassoziationen - zeitliche oder räumliche Kontinuität - physiologische Erklärung: Diesen Erlebnissen liegt ein Komplex von Erregungen zugrunde. Tritt eine Teilerregung des Komplexes auf, wird der ganze Erregungskomplex aktiviert Bewusstwerden 2.4.2. Ähnlichkeitsassoziationen o Ähnliche Inhalte verbinden sich sehr rasch. Die neurophysiologische Ursache ist nicht völlig geklärt, doch ist sicher, dass der Mensch auch aktiv diese Verknüpfung herstellt o Wir versuchen Analogien, Ähnlichkeiten oder Plausibilitäten zu konstruieren 2.4.3. Begriffsassoziationen Sehr viele Begriffe verbinden sich assoziativ (sind untereinander gekoppelt) Assoziation zwischen Begriff und Lautkomplex (Wort) Teilleistung für Sprechen und Lesen ermöglicht Verstehen anderer Menschen Gegensatzpaare werden häufig gekoppelt 2.4.4. Komplexe Assoziationen Merken dem Sinn, der Bedeutung nach zB Vortrag Lernen passiert nicht mechanisch, sondern wird durch Motive, Einsichten und aktive Konstruktion gesteuert Konstruktivismus Je mehr Begriffe miteinander vernetzt sind, desto mehr können auch aktiviert werden, wenn ein bestimmter Begriff abgerufen wird Suchprozesse laufen besser ab, wenn effiziente Vernetzung gewährleistet ist Pädagogische Konsequenz: Interessant und „semantisch“ unterrichten, dh. Sinngehalt soll gegeben sein - Nicht isolierte Fakten präsentieren, sondern wenn möglich auch fächerübergreifend und projektorientiert 2.5. Gedächtnishemmungen – Interferenzen 2.5.1. Assoziative Hemmungen Neue Merkmale, die mit alten Merkmalen eines Inhalts verbunden sind, werden viel schwerer eingeprägt und reproduziert, da die alten Assoziationen aufgelöst und neue gebildet werden müssen (zB. Neue Telefonnummer es fällt schwer, sich die neue zu merken und die alte zu vergessen) „Umlernen ist schwieriger als Neulernen“ zB. Falsch eingeprägte Schreibweise eines Wortes, Vorurteile abbauen (nichts ist prägender als der erste Eindruck Vorurteile sind schnell gebildet) Wie korrigiert man richtig? Muter falsch Fehlschreibung prägt sich ein, weil fehlender Buchstabe „t“ noch immer fehlt und doppelt unterstrichen ist! Mutter (richtig geschrieben) viel besser! Wort steht richtig da und wird daher besser gemerkt. Bei guten Schülern: korrigiere selber! 2.5.2. Retroaktive (rückwirkende) Hemmungen KG (Kontrollgruppe): Inhalt A Pause Reproduktion von A _____________________________ _____________ mentale Erregung postmentale Erregung VG (Versuchsgruppe): Inhalt A Inhalt B ____________________________ _____________ mentale Erregung postmentale und Reproduktion von A mentale Erregung Wenn gleich darauf wieder etwas Neues gelernt wird, ist die Aufnahme / Reproduktion nicht so erfolgreich VG: Reproduktion von A ist schlechter, da die postmentalen Erregungen zum Einprägen von A gestört werden. Bewegung in der Pause, Spiel, Musik,... damit sich das Gelernte vertiefen kann 2.5.3. Affektive Hemmungen Schocks verschiedener Art beeinträchtigen das Einprägen und Behalten (zB. Retrograde Amnesie nach Unfällen oder Zeugnisaussagen nach einer Gewalttat) Experiment von BROSCH: 400 SchülerInnen im Alter von 6-10 Jahren Märchen, in dem ein Waldgeist einem gefangenen Kind die Freiheit verspricht, wenn es sich 6 Wörter merken könne VG (Feueralarm dazwischen): durchschnittlich 1,3 Wörter KG (normale Pause dazwischen): durchschnittlich 3,5 Wörter Unter Angst (Prüfungssituationen) ist die kognitive Produktion eingschränkt: große interindividuelle Unterschiede – „Trainingsweltmeister“ – manche Menschen brauchen Spannung, andere nicht Was kann man gegen Prüfungsangst tun? – entspannte Situation herbeiführen, Gedächtnisübungen machen, ... Negativ: zB. Taschenaufstellen (verursacht ev. Angst) – besser: Kinder darauf aufmerksam machen, wenn zu oft abgeschrieben wird 2.5.4. Ähnlichkeitshemmungen (Ranschburgsche Hemmungen) Psychologe Ranschburg verglich das Einprägen ähnlicher und unähnlicher Lernstoffe (sinnlose Silben wie nol – nul) unähnliche Reihen wurden besser gemerkt zB. Koalition – Kohäsion Deduktion – Induktion Wichtig: Beim Erlernen zuerst eine zeitliche und eine räumliche Trennung herstellen, nicht gleich mit Gegenüberstellungen beginnen (zB. Erlernen des p und b einige Wochen dazwischen vergehen lassen). Zuerst das eine trainingen, dann das andere INDUKTION Induktives Schließen (Ableiten von Schlussfolgerungen aus vorgegebenen Fakten) ist zentrale Komponente des Denkens, wenn es darum geht, Hypothesen aufzustellen und zu überprüfen, Bedingungszusammenhänge aufzuspüren oder für das Auftreten bestimmter Ereignisse Wahrscheinlichkeiten festzulegen DEDUKTION: Unter Deduktion versteht man in der Logik ein Verfahren, dass es erlaubt, aus allgemeinen, vorausgesetzten und elementaren Sätzen speziellere und kompliziertere Sätze korrekt abzuleiten, dh. Die Deduktion ist der Weg von der Theorie (Einzelfall) zur Praxis Kinder experimentieren lassen (Experimente sind gut für das Erlernen von Neuem) 2.6. Der Prozess des Lernens und Vergessens Was geschieht im Gehirn, wenn wir vergessen? 2 Theorien: 1. Die eine besagt, dass die Gedächtnisspur einfach mit der Zeit verblasst und verschwindet 2. Die zweite Theorie geht davon aus, dass wir vergessen, indem neue Eindrücke die alten Gedächtnisspuren überlagern und so den Zugriff auf alte Erinnerungen erschweren ( Interferenztheorie) Metagedächtnis von jungen Kindern (wie sich Kinder vorstellen, dass das Hirn funktioniert) John Flavell: die gängige Vorstellung von jüngeren Kindern ist die eines Sackes, in die man etwas hineinfüllt. Wenn der Sack voll ist, passe nichts mehr hinein (naive Interferenztheorie) Konzentration und Achtsamkeit: Konzentriert sind wir, wenn wir zB 16 x 4 rechnen (etwas willentlich machen) Achtsamkeit hilft uns, wenn wir etwas Neues, Ungewöhnliches erklären sollen, zB. 1+1=1 (mathematisch falsch, aber 1 Heuhaufen + ein Heuhaufen = ein großer Heuhaufen) 2.7. Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis KZG LZG kurzfristiges Vergessen allmähliches Vergessen (Nicht-Behalten) von Datenmaterial bzw. Verblassen von langfristig Gelerntem Interferenztheorie: Verblassen der Verdrängen, Gedächtnisspuren, Überlagerungen Abbauprozesse Die 3 Speicher Sensorischer Speicher KZG LZG bis 1 sec. 10 – 30 sec. Tage bis Jahre Sensorischer Speicher (UKZG): neurophysiologische Befunde, die darauf hinweisen, dass die elektrochemischen Erregungen ausklingen. KZG (10 bis 30 Sek.) beide Prozesse (Interferenz = Überlagerung + spontaner Zerfall) LZG = langfristiges Behalten wird durch Neues nicht überlagert oder verdrängt, es kann im Laufe der Zeit etwas verblassen. Sensorisches Register: Es speichert sehr kurz (für ca. 0,1 – 1 Sec.), unkodiert weitgehend alle Sinnesdaten und übergibt diese einem Filter, der nach bestimmten Merkmalen selektiert, eine erste Musterkennung vornimmt und eine Informationsbündelung durchführt – im Sinne des „chunking“. In dieser Weise vorgearbeitet, gelagen die Informationen in einen Kurzzeitspeicher. Vom KZG ins LZG Informationen sind aufgrund der ersten Vorkodierung akustisch, visuell, taktil, olfaktorisch (geruchsempfinden) oder semantisch (sinnempfinden) repräsentiert. Eine Löschung kann aufgrund von Interferenzen oder allein durch Verstreichen von Zeit geschehen. Stabilisierung im KZG: Einfaches „erhaltendes Wiederholen“ oder „Elaborieren“, z. B. durch Neuordnung, Kategorisierung, Anbinden an vorhandene Informationen (z. B. bei Vokabeln – Verbindungen herstellen, das eine Wort klingt so ähnlich wie in der anderen Sprache) 2.8. Praktische Hinweise für das Lernen 1. Überblick verschaffen / 2x durchlesen 2. Strukturieren, aufteilen, unterstreichen 3. Auszüge von schwierigen Stellen machen 4. Zusammenhängende größere Teile lernen 5. Verteilung der Wiederholungen 6. Sich „belohnen“ 7. Kritisch reflektieren Verteiltes Lernen: zB. Bei Sprachen (Lernkartei, Rechtschreibmerkwörter) Einzelmaterialien werden besser verteilt gelernt Massiertes Lernen: Problemaufgaben lernt man besser, wenn man sich ihnen länger und intensiv widmet. Abhängig ist die Art des Lernens immer von der Komplexität der Materie. Lernstrategien / Lerntypen: Sprachliche Informationen werden im phonologischen KZG gespeichert und zwar relativ unabhängig davon, ob sie visuell oder akustisch angeliefert worden sind. Nicht sprachliche Informationen werden im visuellen KZG gespeichert Gleichzeitige Nutzung der beiden KZG Erhöhung der Speichermöglichkeit, wenn für die Darstellung der Information kombinierte sprachliche und graphische Darstellungsweisen gewählt werden Vorraussetzung: die graphischen Teile werden nicht sprachlich übersetzt, sondern bildlich 4 Eingangskanäle für den gleichen Lerninhalt (siehe Handout) für längere Festigung sollten immer mehrere Kanäle genutzt werden anschauliches Erläutern: Druck = Kraft / Fläche praktische Anwendung z.B. Bohren mit Bohrer in eine Wand haptisches Erfassen abstrakt verbal: P=F/A LZG: o Während die Inhalte des KZG als Aktivierungen von Neuronen gespeichert werden (Hirnaktivität), sind die Inhalte des LZG weitgehend in Form von Verbindungen zwischen Neuronen gespeichert (Hirnstruktur) o Das LZG hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität Elaboration und Verknüpfung Wenn eine gegeignete Vorbildung vorhanden ist, wird nicht nur das Lernen erleichtert, sondern auch das Behalten komplexer Konzepte. Die Vermittlung von Basiskonzepten ist wichtig, um den Zusammenhang eines Faktums mit diesen Basiskonzepten zu verdeutlichen. 3. Neurologische Grundlagen 3.1. Zur Neuropsychologie des KZG 3.1.1. Nervenzellen Eine Nervenzelle oder Neuron ist eine auf Erregungsleitung spezialisierte Zelle, die Bestandteil des Nervensystems höherer Lebewesen ist Optische Klassifizierung durch die Anzahl und Art der Fortsätze: 1. Unipolare Nervenzellen: ein kurzer Fortsatz (entspricht in der Regel einem Axon) – zB Sinneszellen in der Netzthaut der Augen 2. Bipolare Nervenzellen: zwei, an gegenüberliegenden Stellen des Zellkörpers befindliche Fortsätze, ein Axon und ein Dentrit (Hör- und Gleichgewichtsorgan) 3. Pseudounipolare Nervenzellen: z.B Spinalnerv Axon und Dentrid einer bipolaren Nervenzellen sind im Embrionalstadium miteinander verschmolzen 4. Multipolare Nervenzellen – zahlreiche Dentriten und ein Axon (motor. Nervenzelle im Rückenmark und als verschiedene Zellarten im Gehirn Klassifizierung nach den Funktionen der Nervenzelle: 1. Sensorische Neuronen = Nerven oder Nervenfasern, die Informationen von den Rezeptoren der Sinnesorgane oder Organe an das Gehirn /Rückenmark oder Nervenzentren des Darms weiterleiten (Wahrnehmung und motorische Koordination 2. Motorische Neuronen übermitteln Impulse von Gehrin / Rückenmark zu den Muskeln oder Drüsen Ausschüttung von Hormonen oder Kontraktionen der Muskelzellen 3. Interneuronen nicht spezifisch sensorisch oder motorisch verarbeiten Informationen in lokalen Schaltkreisen/ vermitteln Signale über weite Entfernungen zwischen verschiedenen Körperregionen 5 5 Kandel, E., Schwarz, j & Jessell, T. (1996), Neurowissenschaften o Entstehung eines Aktionspotentials in einer Rezeptorzelle 6 o Je stärker der Reiz, desto schneller feuert die Nervenzelle o Input – Zone mit graduierten lokalen Signalen 6 Lernunterlagen HPPV Prof. Kowarsch 2008/2009 Triggerzone: digitales Signal Synapsen: analoge Transmitterausschüttung o Bei der Geburt ist im Wesentlichen die Anzahl der Neuronen festgelegt, später gibt es fast nur noch Verknüpfungen Axon = langer, faserartiger Fortsatz einer Nervenzelle, der elektrische Nervenimpulse vom Zellkörper wegleitet – die Weitergabe erfolgt dann chemisch 3.3. Synapsen – Neurotransmitter Synapsen arbeiten entweder elektrochemisch oder chemisch durch entsprechende Transmittersubstanzen Exogene Verabreichung ahmt die endogene Ausschüttung in der Wirkung nach (zB. Beruhigungsmittel, Rauschmittel) Die wichtigsten Neurotransmitter sind: Acetylcholin (Übertragung von Nervenimpulsen auf die Muskulatur und im vegetativen Nervensystem; Nikotin bindet kurzfristig Acetylcholin – Rezeptoren) Adrenalin und Noradrenalin (Aktivierung: vegetatives NS, Muskulatur, Herz, Gehirn Stressgeschehen!) Serotonin (wichtige Rolle bei vielen psychischen Prozessen; Mangel führt u.a. zu Depressionen und Zwanghaftigkeit) Dopamin (psychische und psychosomatische Prozesse, Antriebssteigerung), Mangel: Pakinson’sche Krankheit, erhöhte Dopaminaktivität in bestimmten Arealen Psychosen Beispiel: 1. Schock führt zu erhöhter Ausschüttung von Serotonin und Dopamin 2. Speed (Droge) kann zum Tod führen, man hat immer Energie, kann Tag und Nacht wach bleiben 3. Viele Drogen greifen in den Dopaminhaushalt ein (Nikotin sofort, Alkohol etwas später) 3.4. Das Zentralnervensystem 7 Hauptregionen 7 1. Terencephalon (=Großhirn, Endhirn): Gedächtnis, Erinnerung, Denkvermögen 2. Diencephalon (= Zwischenhirn) besteht aus Thalamus und Hypothalamus: zuständig für Regulationsfunktion der Wärmeregulation, Schlaf/Wachrhythmus, Nahrungsaufnahme, Blutdruck- und Atemregulation 3. Mesencephalon (= Mittelhirn): zuständig für Bewegungskoordinierung 4. Pons – Brücke (Teil des Hinterhirns) 7 Lernunterlagen HPPV Prof. Kowarsch 2008/2009 5. Medulla Oblongata (= verlängertes Mark): entspringt von der Brücke, tritt durch das große Hinterhauptsloch aus dem Schädel aus und geht in das Rückenmark über; erhält das Atem- und Kreislaufzentrum 6. Rückenmark 7. Cerebellum (= Kleinhirn): erfüllt wichtige Aufgaben bei der Steuerung der Motorik Aufgaben des ZNS: Interpretation aller sensiblen Reize, die von innerhalb oder außerhalb des Organismus eintreffen Koordination sämtlicher motorischer Eigenleistungen des Gesamtorganismus Regulation aller dabei ablaufenden innerorganischen Abstimmungsvorgänge 3.5. Neuropsychologische Grundlagen des Langzeitgedächtnisses 8 Frontallappen = Vorderlappen Parietallappen = Scheitellappen Okzipitallappen = Hinterhauptlappen Temperallappen = Schläfenlappen Am Enkodieren sind besonders der Temporallappen (= Schläfenlappen), der Hippocampus sowie der präfrontale Cortex beteiligt 3.5.1. Stark Gedächtnis – assoziierte Gerhirnregionen 8http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn#Zusammenfassung_des_Aufbaus_des_menschli chen_Gehirns (16.01.10, 20:15) Schläfen- und Scheitellappen, präfrontaler Cortex – assoziative Felder (LZG) Hippocampus und Amygdala (Mandelkern): zuständig für die Zwischenspeicherung und die Transformation in eine permanente Gedächtnisform im Cortex (LZG) Thalamus: Verbindung zu allen sensorischen Arealen, Informationsfilter (Selektion und Konzentration!) und hochkomplexe Informationsverarbeitung, Beteiligung an emotionalen Prozessen 3.6. Konnex verschiedener Sprachzentren 9 1. 2. 3. 4. Analyse des Gehörten primäres akustisches Areal Bedeutungsgehalt Wernicke – Zentrum Aufbereitung für Nachsprechen Broca – Areal Impuls für Sprechmuskulatur Motorisches Areal 3.7. Verknüpfung von Emotionen und Kognitionen Limbisches System (Limbus = Saum) rot eingefärbt 9 Lernunterlagen HPPV Kowarsch 2008/2009 10 Das limbische System ist eine Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung des Triebverhaltens dient. Auch intellektuelle Leistungen werden ihm zugesprochen. Andere corticale und nicht-corticale Strukturen des Gehirns üben einen Einfluss auf das limbische System aus. Entstehung von Emotion und Triebverhalten = Zusammenspiel vieler Gehirnanteile (nicht nur limbisches System) Störungen: Unfähigkeit, emotionale Situationen einzuschätzen Gedächtnisstörungen Posttraumatische Belastungsstörungen Authismus, Depressionen, Phobien Das limbische System ist auch für die Ausschüttung von Endorphinen verantwortlich. Regionen des limbischen Systems: Hypocampus Fornix präfrontaler Cortex Gyrus cinguli Thalamus Septum Balken Hypothalamus Hypophyse Amygdala Jede dieser Regionen beitzt wichtige funktionelle Verbindungen zu Steuerungszentren in andere Hirnregionen. Als Zentrale des limbischen Systems gilt heute der Mandelkern (Amygdala) 10 http://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System (16.1.10, 20:16) 11 4. Gedächtnismodelle 4.1. Die DUAL – CODE – Theorie von PAIVIO Gedächtnismodell der Kognitionspsychologie, welches anschaulich illustriert, wie der positive Lerneffekt bei einer gleichzeitigen Repräsentation von beispielsweise Sprache und Bild zu erklären ist. Die Idee der Dual-Code Theorie besteht darin, dass es in unserem Grosshirn zwei unterschiedlich spezialisierte mentale Systeme gibt ; einerseits das verbale System, welches für die Verarbeitung und Speicherung linguististischer Informationen zuständig ist und andererseits ein non-verbales System, das für den Umgang mit Bildern, einschliesslich bildhafter Vorstellungen verantwortlich ist. 11 Lernunterlagen HPPV Prof. Kowarsch 2008/2009 Die Kernaussage dieser Theorie ist ein resultierender Gedächtnisvorteil, wenn Informationen gleichzeitig sowohl verbal als auch non-verbal repräsentiert und gespeichert werden. Dies erklärt Paivio damit, dass beide Systeme zwar unabhängig voneinander arbeiten, aber zwischen dem verbalen und dem non-verbalen System Verbindungen existieren, die gegebenenfalls aktiviert werden und es zu einer zweifachen kognitiven Repräsentation kommt – also zu einer dualen Codierung. Durch diese doppelte Codierung kann daraus gemäss Paivio eine höhere Behaltensleisung bzw. Lerneffekt resultieren. 12 Unterscheidung zwischen verbaler und nonverbaler (vorwiegend bildhafter) Verarbeitung Hirnbiologisch wird eine horizontale Integration unterstellt – d.h. beide Hemisphären sind beteiligt Das bildhafte Verarbeiten ist dem sprachlichen Kodieren grundsätzlich überlegen (stimmt aber nicht immer) 13 12 http://www.e-work.ethz.ch/praesentationen/ws_0001/gruppe_02/Homepage%20Gruppe%202/multimedia.html#Dual (15.1.10, 13:30) 13 http://hupsy03.psychologie.huberlin.de/arbpsy/studenten/beier_kaltwasser/audio.htm#Das%20Dual-CodeModell%20von%20Paivio (15.1.10, 20:00) 4.2. Dominante cerebrale Laterisation Lateralisation = Entwicklung der Differenzierung der Funktionen der beiden Gehirnhemisphären Beide Hemisphären arbeiten stets zusammen, doch hat jede eine gewisse Spezialisierung übernommen, die bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Linkshänder haben teils andere Lateralisationen Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre sprachlich Musikalisch Verbales Gedächtnis Nonverbales Gedächtnis begrifflich Bild- und Mustererkennung arithmetisch geometrisch / räumlich alalytisch / abstrakt einheitlich /konkret 4.3. Verarbeitungstiefe Alternativmodell (Craik/Lockhart 1972) Informationen werden umso besser gespeichert, je tiefer sie verarbeitet wurden. Intensive Auseinandersetzung tiefere Verarbeitung Bezieht sich auf expliziten und impliziten Gedächtnisgebrauch Eine semantische (sinnverarbeitende) Verarbeitung verbalen Materials ist für ein langfristiges Behalten entscheidend!!! 4.4. Strukturell-funktionales Multi – Code – Modell von ENGELKAMP (multiple Repräsentation) 14 beruht auf hirnpsychologischen Erkenntnissen, dass es modalitätsspezifische Verarbeitungszentren gibt (bildhafte, verbal, motorisch,...) und den funktionellen Zusammenhängen Jedes Teilsystem besteht aus spezifischen Einheiten, die Verbindungen zu anderen Einheiten haben Übergeordnet ist die Ebene der Bedeutung – das „konzeptionelle Wissen“ durch Aktivierung dessen kann längerfristiges Behalten verbessert werden 4.5. Deklaratives und prozedurales Gedächtnis ( Wissen und Fertigkeiten) Deklaratives Gedächtnis: Das deklarative Gedächtnis betrifft Erinnerungen bezüglich Fakten oder Ereignissen. 14 http://hupsy03.psychologie.huberlin.de/arbpsy/studenten/beier_kaltwasser/audio.htm#Das%20Dual-CodeModell%20von%20Paivio (15.1.10, 20:30) 1. Das episodische Gedächtnis: Das episodische Gedächtnis enthält Erinnerungen bzw. persönliche Erfahrungen, die durch die Ereignisse unserer eigenen Vergangenheit entstanden sind. Deshalb wird es oft auch als autobiographisch bezeichnet. 2. Das semantische Gedächtnis: Das semantische Gedächtnis ist unabhängig von Ort und Zeit, es enthält generelle Konzepte und Regeln, also Sinnzusammenhänge und Bedeutungen. Prozedurales Gedächtnis: Als prozedurales Gedächtnis wird das bezeichnet was uns begegnet, wenn wir Dinge tun. Es ist das prozedurale Gedächtnis was uns sagt, wie wir diese Dinge zu tun haben. Prozedurales Gedächtnis ist selten bewusst und benötigt weniger aktive Willensanstrengung und Aufmerksamkeit. Explizites und Implizites Gedächtnis: Explizites Gedächtnis: Betrifft das Gedächtnis wenn man versucht, sich bewußt, gezielt und mit Anstrengung etwas ins Gedächtnis zu rufen. Beispiel: Sie kommen in einen ihnen bekannten Raum und merken, dass sich etwas darin verändert hat. Vielleicht stehen die Möbel anders oder die Farbe der Tapete hat sich verändert. Sie versuchen bewusst und mit Anstrengung diese Veränderung herauszufinden. Sie benutzen dabei das explizite Gedächtnis. Implizites Gedächtnis: Vom impliziten Gedächtnis ist dann die Rede, wenn Gedächtnisinhalte ohne bewusste Steuerung einfließen. Beispiel: Sie betrachten ein Foto einer Küche und auf dem Küchentisch sitzt ein Fuchs. Würden sie gefragt werden, was auf dem Bild nicht stimmt, würde Ihnen sofort klar werden, daß ein Fuchs nicht auf einen Küchentisch gehört. Ohne jede Anstrengung und ohne jede bewußte Suche haben sie sich erinnert, daß ein Fuchs nicht auf einen Küchentisch zu suchen hat. Sie benutzen dabei ihr implizites Gedächtnis. 15 4.6. Das Gehirn lernt immer Angewandte neurowissenschaftliche Erkenntnisse Manfred Spitzer (Uni Ulm) Prof. Spitzer: "Das Gehirn lernt immer, aber nicht unbedingt das, was der Lehrer will ... Es liegt deshalb an uns, darauf zu achten, dass Kinder den richtigen Input bekommen."16 Lernathmosphäre ist wichtig – Lernen unter Angst: zB Bild einer Schlange im Blickwinkel; Angstreaktion, ehe die Situation richtig bewusst wird – Amygdala (Mandelkern): Pulsbeschleunigung, erhöhter Tonus,... Vokabellernen unter Angst Vokabel werden im Mandelkern gespeichert: Ein Lerninhalt, der unter Angst gelernt wird, wird mit Angst verknüpft. Ruft man den Inhalt ab, wird die Angst mit abgerufen 15 16 Neues und Überraschendes sind gut für uns Lernen und Glücksempfinden sind systemimmanent ähnlich http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/Mietzel2.gif (15.1.10, 20:35) http://vorarlberg.orf.at/magazin/klickpunkt/focus/stories/164610/ (15.1.10, 20:37) Gehen und sprechen lernen = Musterbeispiel für Frustrationstoleranz und Regellernen Wenn Kleinstkinder Sprache hören, lernen sie Schicht für Schicht von strukturell niedrigem auf ein immer höheres Niveau zum nächst höheren: Laute, Silben, Wörter, einfache Sätze Experimente mit 7 Monate alten Säuglingen: Silbenfolgen: La, li, la; Ma mi ma, da, di da erst interessiertes Zuhören, dann abwenden Wechsel: La la li, ma ma mi, da da di wieder Zuwendung Wechsel in der Grammatik: ABA – AAB Erlernen von Sprachmustern und grammatikalischen Regeln Regeln lernen – explizite Sprachmuster zB. Partizip perfekt: üblicherweise gebildet durch das Anhängen des Präfix GE-): singen – gesungen, gehen – gegangen,... ABER: rasieren – ge-rasiert, flanieren – ge-flaniert Experiment von Spitzer mit Phantasierwörtern: Quangen – gequangt, partieren – ge –partiert 4.7. Wissen ist der Schlüssel zum Können Zu lange berief man sich (ua. Unter Berufung auf Piaget) darauf, dass das Gehirn erst vor anspruchsvollen Leistungen oder schulischen Anforderungen heranreifen müsse Trotz oder gerade wegen der Gehirnentwicklung der Kinder müssen sie entsprechend gefördert und gefordert werden. Die wissensbasierte Gesellschaft braucht, da ihre Grundlagen nicht in den Genen angelegt sind, die direkte Unterweisung und Anleitung durch Mentoren (ua. LehrerInnen) 4.8. Windows of opportunity – kritische Phasen? Neugeborene Katzen wurden in den ersten 3 Monaten daran gehindert, mit einem Auge etwas zu sehen Immer blind auf diesem Auge (Hubels & Wiesel). Für das Erlernen der Sprache gibt es eine sensible Phase. Nutzung der sensiblen Phasen wird mitunter in der frühen Fremdsprachenförderung überbetont, wenn bei MigrantInnen die Muttersprache nicht wirklich beherrscht wird. Das Gehirn ist kein Schwamm, der alle Informationen aufsaugt. Im Gegenteil, es filtert ständig Umweltreize heraus, die für gerade aktuelle Handlungsziele relevant sind. Der Arbeitsspeicher ist begrenzt. Das bewirkt die Konzentration auf das Wesentliche Kinder haben noch Defizite in der Handlungs- und Planungskompetenz 4.9. Sprachentwicklung – Ein-Zwei-Dreiwort-Sätze Obwohl Kinder von Anfang an komplexe Sätze hören, bilden sie zunächst nur Einund später Zwei-Wort-Sätze, blenden Funktionswörter aus und unterlassen Konjunktionen und Deklinationen auf Grund des beschränkten Aufnahmevermögens und des beschränkten Arbeitsspeichers Die Euphorie des sehr frühen Fremdsprachenerwerbs lässt sich neuropsychologisch nur bedingt erklären 4.10. Training von Fertigkeiten und Wissenserwerb Formale Bildung ohne Inhalt gibt es nicht Latein schult nicht das logische Denken an sich. Man lernt Vokabel, grammatikalische Strukturen,... Es kommt sehr wohl auf den Inhalt an Wissenserwerb ist entscheidend Fertigkeiten trainieren macht Sinn: 1x1, Vokabel, Techniken, Sport,... Pures Kompetenztraining ist zu wenig Automatisiertes Wissen und Können sind Voraussetzungen für Verstehensprozesse es werden Kapazitäten im Arbeitsspeicher für Verstehensprozesse frei Kreativität muss ermöglicht werden Automatisiertes Wissen muss immer wieder in sinnstiftendes Lernen eingebettet werden zB. Phonologisches Bewusstsein = Erkennen der lautlichen Merkmale einer Sprache – Klatschen im Rhythmus, Reime erkennen,... ist Vorraussetzung für eine Automatisierung des Lesens 4.11. Intelligenz – Vererbung und Umwelt Untersuchungen mit ein- und zweieiigen Zwillingen haben gezeigt, dass es sowohl einen genetischen als auch einen umweltbezogenen Einfluss auf die Intelligenz gibt Die genetischen Grundlagen stecken den möglichen Rahmen der Intelligenzentwicklung ab, doch bedarf es der entsprechenden Lernangebote der Umwelt, damit sich das Potenzial eines Individuums auch entwickeln kann Denkt man an stark vernachlässigte Kinder, so ist es ein gewisser Trost, dass nicht nur die Umwelt über die Entwicklung eines Kindes entscheidet Resilienz 5. Entwicklungspsychologische Grundlagen 5.1. Kognitive Entwicklung aus neuropsychologischer Sicht Die Lebensspanne der Synapsen: Das erste Stadium – die Bildung von Synapsen – wird durch genetische und entwicklungsgemäße Prozesse gesteuert Das zweite Stadium – die Feinregulierung der gebildeten Synapsen – betrifft frühe kritische Entwicklungsphasen und benötigt als treibende Kraft ein angemessenes Aktivitätsmuster der beteiligten Neuronen, das im Notfall durch externe Reize erzeugt wird Die dritte Phase – die Regulation einer vorübergehenden oder langanhaltenden Effektivität der Synapsen – ist lebenslang und wird durch Erfahrungen bestimmt ALLE VERHALTENSOPTIONEN DES INDIVIDUUMS WERDEN DURCH GENETISCHE UND ENTWICKLUNGSBEDINGTE MECHANISMEN BESTIMMT, DIE DIREKT AUF DAS GEHIRN WIRKEN! 5.2. Das interaktionstheoretische Modell PIAGETs 2 Formen der Anpassung: 1. Assimilation: Tendenz des Kindes, Gegebenheiten der Umwelt gemäß den Möglichkeiten seines psychischen Apparates an die bestehende Strukturstufe anzupassen. Neue Reize werden so interpretiert, dass sie als vertraut erscheinen. Die Umwelt wird assimiliert. 2. Akkomodation: Anpassung des Kindes an die objektiven Gegebenheiten der Umwelt und das Lernen an ihnen, erkennbar an realitätsgerechten Verhaltensänderungen. Neue Erfahrungen werden gemacht (zB. Deckel lässt sich durch Abziehen nicht öffnen wird aufgedreht) PIAGETs 5 Entwicklungsstufen der Intelligenz: 1. Die sensumotorische Intelligenz (0 – ca. 2 Jahre) 2. Das vorbegrifflich symbolische Denken (2-4 Jahre) 3. Das anschauliche Denken (4-7 Jahre) 4. Die konkret logischen Operationen (8-11 Jahre) 5. Die formalen Operationen (ab ca. 12 Jahren) 5.3. Kognitive Entwicklungsstufen nach Jerome BRUNER Enaktive Stufe (Form) – handlungsmäßige Darstellung: der Mensch erfasst seine Umwelt durch aktionale Aktivitäten: zB. Radfahren Lernen Ikonische Stufe (Form) – die bildhafte Darstellung: Problemlösung in vorgestellten Bildern (zB. Bei geometrischen Aufgaben) Symbolische Stufe (Form) – symbolische Darstellung: Sprache, Schriftsymbole und andere Zeichensymbole (mathematische Logik)