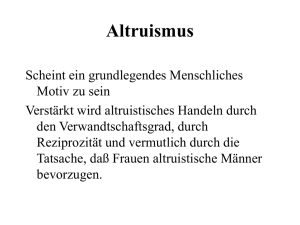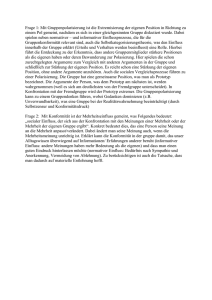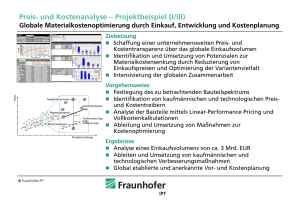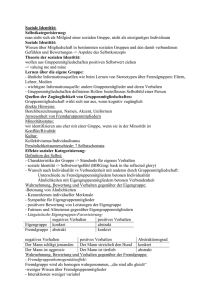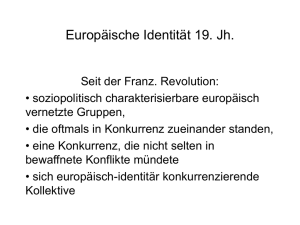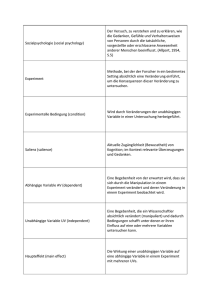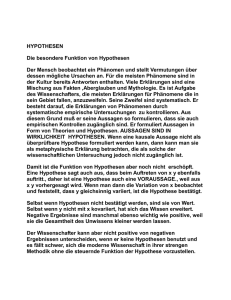Zusammenfassung Modul 2C, Sozialpsychologie
Werbung

Einführung in die Sozialpsychologie I: Personale und interpersonale Prozesse Einführung Die Sozialpsychologie wird oft definiert als der wissenschaftliche Versuch, zu verstehen und zu erklären, wie Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen von Individuen durch die tatsächliche, vorgestellte oder erschlossene Anwesenheit anderer Menschen beeinflusst werden. Es gibt zwei grundlegende Prämissen sozialpsychologischer Forschung: 1. Konstruktion der sozialen Realität, das heißt, Menschen reagieren nicht darauf, wie eine Situation "objektiv" ist, sondern darauf, wie diese Situation von ihnen selbst subjektiv wahrgenommen und interpretiert wird (s. auch "ThomasTheorem"). Und 2.: Soziales Verhalten als Funktion von Personfaktoren (P) und Umweltfaktoren (U) und deren Wechselwirkung. Eine Interaktion zwischen zwei Einflussfaktoren liegt vor, wenn die Stärke des Effekts, den eine Unabhängige Variable auf eine Abhängige Variable (z.B. ein bestimmtes Verhalten) ausübt, systematisch mit der Ausprägung einer anderen Unabhängigen Variable variiert. Beispielsweise wirkt sich die gleiche Menge konsumierten Alkohols (UV 1) bei Männern und Frauen (Geschlecht = UV2) typischerweise unterschiedlich stark auf die Fahrtüchtigkeit (AV) aus. Der Einfluss des Alkoholkonsums variiert also in Abhängigkeit vom Geschlecht. Hypothetische Konstrukte sind abstrakte theoretische Begriffe, die sich nicht direkt beobachten lassen, sondern nur mit Hilfe von Indikatoren beobachtet oder erschlossen werden können. Unter Operationalisierung wird die Art und Weise verstanden, wie ein hypothetisches Konstrukt in eine beobachtbare Variable überführt wird. Sie hat Auswirkungen auf die Validität (also der Gültigkeit) der wissenschaftlichen Schlussfolgerungen. Es gibt fünf Kriterien für die Güte einer wissenschaftlichen Theorie: 1. Innere Widerspruchsfreiheit der Hypothesen, 2. Äußere Widerspruchsfreiheit der Theorie mit gesicherten Erkenntnissen, 3. Empirische Prüfbarkeit und Falsifizierbarkeit der Hypothesen, 4. Begriffliche Sparsamkeit, 5. Nützlichkeit für die praktische Anwendung Die Methode der Beobachtung dient in erster Linie der Beschreibung sozialer Phänomene. Zur Vorhersage von sozialen Phänomenen wird häufig die Korrelationsmethode angewendet. Bei der Korrelationsmethode werden zwei oder mehrere Variablen systematisch gemessen und es wird eine Beziehung zwischen ihnen ermittelt. Die Ergebnisse von Korrelationsstudien lassen allerdings keine eindeutigen Kausalschlüsse zu. Zur Erklärung sozialer Phänomene werden oft experimentelle Methoden angewendet. Als Hauptmerkmale experimenteller Forschung werden beschrieben: das experimentelle Szenario, die unabhängige Variable, die abhängige Variable, die Manipulationsüberprüfung und die postexperimentelle Aufklärung. Die Unabhängige Variable wird auch Treatment oder Faktor genannt. Sie ist die Variable, für die eine ursächliche Wirkung angenommen wird. Sie wird manipuliert. Die Abhängige Variable wird auch Outcome genannt. Von ihrer Ausprägung wird angenommen, dass sie von der Unabhängigen Variable abhängt. Sie wird gemessen. Die Moderatorvariable wird auch Interagierende Variable genannt. Sie ist eine im Rahmen der theoretischen Annahmen relevante Variable, die die Stärke des Kausaleffektes der Unabhängigen Variablen auf die Abhängige Variable beeinflusst. Sie erklärt, wann (also unter welchen Bedingungen) ein bestimmter Effekt der unabhängigen Variable zu erwarten ist. Sie wird in Experimenten daher häufig als eine zusätzliche Unabhängige Variable manipuliert. Die Mediatorvariable wird auch vermittelnder Prozess genannt. Sie ist eine im Rahmen der theoretischen Annahme relevante Variable, die den Kausaleffekt der Unabhängigen Variablen auf die Abhängige Variable vermittelt. Sie erklärt, warum sich die Unabhängige Variable auf die Abhängige Variable auswirkt. Sie wird in Experimenten daher häufig zusätzlich zur Abhängigen Variablen gemessen oder aber gezielt manipuliert. Die Störvariable wird auch Confoundervariable genannt. Sie kann ebenfalls Einfluss auf die Ausprägung der Abhängigen Variable haben. Dieser Einfluss ist nicht von theoretischem Interesse, er beeinträchtigt aber die Interpretation des Effekts der Unabhängigen Variablen. Störvariablen müssen daher eliminiert oder kontrolliert werden. Will man aus der sozialpsychologischen Forschung eindeutige Schlussfolgerungen ziehen, erfordert dies drei Arten der Validität (also der Gültigkeit von Schlussfolgerungen): interne, externe und Konstruktvalidität. Konfundierung wurde als Gefahr für die interne Validität erörtert, Effekte sozialer Erwünschtheit, Hinweise aus der experimentellen Situation sowie Versuchsleitereffekte wurden als Gefahr für die Konstruktvalidität diskutiert. Unterschiede in Bezug auf Freiwilligkeit und Nichtfreiwilligkeit wurden als Gefahr für die externe Validität angesehen. Ein wichtiges Kriterium ist daher die Replizierbarkeit. Es gibt einige Argumente für oder gegen die Verwendung von Täuschungen in sozialpsychologischen Experimenten: Dafür spricht, dass es eine Möglichkeit ist, potentielle Störprozesse auszuschließen, um dadurch die interne Validität der Ergebnisse zu stärken. Dadurch wird der Erkenntnisgewinn erleichtert, der wiederum zur Erklärung und Lösung sozialer und gesellschaftlicher Probleme beitragen kann. Dagegen spricht die Verletzung ethischer Prinzipien im Kontext sozialer Interaktionen. Einschränkung der Wahlfreiheit der Versuchspersonen sich auf der Grundlage der Ziele der Untersuchung gegen die Teilnahme zu entscheiden, und dadurch potentielle unangenehme Selbsterkenntnisse zu vermeiden. Soziale Kognition und Attribution Soziale Kognition erklärt, wie Menschen zu ihrer subjektiven Konstruktion der sozialen Realität kommen. Es ist also der Prozess des Erwerbs, der Organisation und Anwendung von Wissen über sich selbst und die soziale Welt. Konkret beinhaltet dieser Prozess a) mentale Repräsentationen über sich selbst, über andere und über soziale Beziehungen zu erstellen und im Gedächtnis zu speichern, und b) diese mentalen Repräsentationen flexibel anzuwenden, um Urteile zu bilden und Entscheidungen zu treffen. Mentale Repräsentationen sind Wissensstrukturen, die Menschen konstruieren, im Gedächtnis speichern, aus dem Gedächtnis abrufen und in unterschiedlicher Weise verwenden können. Es werden folgende Typen unterschieden: Schema, Skripte, Kategorien, Stereotype, Prototypen oder assoziative Netzwerke. Stereotype sind sozial geteilte Überzeugungen bezüglich der Attribute, Eigenschaften, Verhaltensweisen etc. hinsichtlich derer die Mitglieder einer Gruppe einander ähneln. Duncans Experiment: er spielte weißen und schwarzen Versuchspersonen ein Video ohne Ton vor, bei der ein weißer Mann am Ende einer Diskussion einen Schwarzen und umgekehrt schubst. Zum einen wurden Persönlichkeitseigenschaften als Ursache gesehen, zum anderen situative Umstände. Es wurde also eine scheinbar objektive Realität subjektiv konstruiert. Zuerst kommt es durch einen sozialen Stimulus zu einer initialen Wahrnehmung (das heißt, dass die Aufmerksamkeit auf die Situation konzentriert sein muss, bestimmte Merkmale müssen salient sein, d.h. sozial bedeutsam), dann zu einer Enkodierung (Ein externer Stimulus wird mit bereits vorhandenen Wissen in Beziehung gesetzt, wodurch er informationshaltig wird und einen Sinn erhält), dazu muss der Inhalt zugänglich sein. Zwei Prozesse der Kategorisierung eines sozialen Stimulus beeinflussen die Informationsverarbeitung besonders: 1. Die Selektion, das heißt, dass durch die Kategorisierung bestehende Unterschiede zwischen den Stimuli, die einer gemeinsamen Kategorie angehören, zugunsten bestehender Ähnlichkeiten vernachlässigt werden und 2. Die Inferenz, also die Idee, dass die Kategorisierung eines Stimulus erlaubt, aus dem bereits gespeicherten Wissen über Mitglieder der Kategorie auf Eigenschaften oder Merkmale des Stimulus zu schließen, die nicht unmittelbar beobachtet wurden (oder werden können). Danach kommen die Schritte Urteilen und Entscheiden. Drei Aspekte der Informationsverarbeitung sind von besonderer Bedeutung: 1. Das Zusammenspiel von Stimulus und Vorwissen (also die Verarbeitung geschieht entweder konzeptgesteuert (das heißt überwiegend durch Vorwissen und Erwartungen gesteuert) oder datengesteuert (das heißt überwiegend durch die Situation gesteuert), 2. die Menge der verarbeiteten Informationen (was zu einer Unterscheidung von systematischer und heuristischer Verarbeitung führt) und 3. das relative Verhältnis von automatischen und kontrollierten Verarbeitungsprozessen. Das Kontinuum-Modell postuliert, dass die Eindrucksbildung stets mit einer automatischen Kategorisierung der fremden Person beginnt, die auf der Grundlage leicht beobachtbarer Merkmale erfolgt (z.B. der Hautfarbe, dem Geschlecht oder dem Alter). Infolge dieser automatischen Kategorisierung wird die Zielperson zunächst - ohne dass der Wahrnehmende dies beabsichtigt - im Sinne ihrer Kategorienzugehörigkeit und der damit assoziierten stereotypischen Eigenschaften wahrgenommen. Nur wenn die Motivation zu einer kontrollierten Form der Informationsverarbeitung vorhanden ist, wird die kategorien- oder stereotypenbasierte Informationsverarbeitung zugunsten einer eigenschaftsbasierten oder individualisierten Informationsverarbeitung aufgegeben, bei der die wahrnehmende Person Schritt für Schritt die individuellen Eigenschaften und Merkmale der Zielperson bei der Eindrucksbildung berücksichtigt. Infolge individualisierter Informationserarbeitung stellen kategoriale Informationen dann nur noch einen Aspekt der vielen individuellen Charakteristika dar, die in den Gesamteindruck von der Zielperson mit einfließen. Die Informationsverarbeitung dient einigen zugrunde liegenden Bedürfnissen: 1. dem Bedürfnis, akkurat zu sein, 2. dem Bedürfnis nach Konsistenz (Stichwort kognitive Dissonanz, Tendenz zur selektiven Suche nach konsistenten Informationen), 3. dem Bedürfnis nach positiver Selbstbewertung. Attribution erklärt, nach welchen Prinzipien (das heißt nach welchen subjektiven Schlussfolgerungen) Menschen Erklärungen für ihr eigenes Verhalten und das Verhalten anderer entwickeln. Weinert hat mit seinem Modell der Attributionsdimensionen versucht, mögliche Attributionen zu systematisieren: 1. Lokation: Liegen die subjektiv wahrgenommenen Ursachen für das beobachtete Verhalten oder Ereignis in der Person (personale oder interne Faktoren) oder liegen sie in der Situation und den Umständen (situationale oder externe Faktoren)? 2. Stabilität: Sind die Ursachen stabil (nicht veränderlich oder fix) oder instabil (variabel)? 3. Kontrollierbarkeit: Sind die Ursachen für den Handelnden kontrollierbar oder unkontrollierbar? Die Kombination, bzw. Ausprägung dieser Dimensionen hat Einfluss auf unsere Emotionen, Einstellungen und Verhaltensweisen (z.B. Ärger versus Mitleid, Stolz und Selbstvertrauen versus Niedergeschlagenheit). Als Attributionsstil wird die relativ zeitstabile Tendenz einer Person verstanden, welche Erklärungsmuster sie anwendet. Im Zentrum der Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen von Jones und Davis (1965) steht die Frage, wie Menschen von einer beobachteten Handlung auf die Dispositionen (Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, Motive etc.) des Handelnden schließen, die ihn zu dem Verhalten veranlasst haben (bzw. die in diesem Sinne mit dem Verhalten korrespondierten). Die Theorie postuliert zwei wesentliche Schritte: In einem ersten Schritt muss der Beobachter entscheiden, ob der Handelnde die Handlung mit Absicht ausgeführt hat - zufällig ausgeführte Verhaltensweisen haben in der Regel keinen Informationsgehalt für zugrunde liegende Dispositionen. In einem zweiten Schritt muss der Beobachter dann entscheiden, welche Disposition(en) den Handelnden zu der konkreten Handlung veranlasst haben. Als aufschlussreich für zugrunde liegende Disposition werden der Theorie zufolge vom Beobachter solche Handlungen angesehen, die unter der Bedingung der Wahlfreiheit ausgeführt wurden (das Befolgen eines Befehls unter Zwang lässt beispielsweise keine Rückschlüsse auf zugrunde liegende Dispositionen zu). Zur Analyse potentieller Ursache-Wirkungsbeziehungen nach dem Kovariationsprinzip von Kelley ziehen Menschen Informationen aus drei unterschiedlichen Quellen heran. Konsensusinformationen resultieren aus Beobachtungen der Reaktionen anderer Personen auf den Stimulus. Distinktheitsinformationen resultieren aus Beobachtungen des Verhaltens der Person in anderen Situationen (gegenüber anderen Stimuli). Konsistenzinformationen resultieren aus Beobachtungen des relevanten Verhaltens über die Zeit. Bei einer dichotomen Ausprägung der jeweiligen Informationen (hoch vs. niedrig) resultieren acht unterschiedliche Informationsmuster. Zu einer Personenattribution kommt es nach Kelley beispielsweise dann, wenn geringer Konsensus, geringe Distinktheit und hohe Konsistenz besteht. Bei hohem Konsensus, hoher Distinktheit und hoher Konsistenz attribuieren Personen hinge- gen eher auf den Stimulus; bei niedrigem Konsensus, hoher Distinktheit und niedriger Konsistenz attribuieren Personen eher auf die Umstände. Kausale Schemata sind Wissensstrukturen, in denen durch Erfahrung gewonnene abstrakte Annahmen darüber repräsentiert sind, welche Ursachenfaktoren für bestimmte Arten von Ereignissen verantwortlich sind, bzw. wie diese Ursachenfaktoren zusammenspielen. Kelley unterscheidet zwischen zwei Arten von kausalen Schemata: Solche, die zur Ergänzung unvollständiger Informationen dienen (Ergänzungsschemata) und solche, die explizit Annahmen über die möglichen und wahrscheinlichen Ursachen machen. Auf der Grundlage ihres Vorwissens neigen Menschen beispielsweise dazu, einer plausiblen Ursache für das Auftreten eines bestimmten Effekts weniger Gewicht beizumessen, wenn gleichzeitig andere plausible Ursachen für den Effekt ebenfalls gegeben sind, als wenn sie allein vorhanden wäre (Abwertungsprinzip). Faktoren, die gegen das Auftreten eines Effekts wirken, verleiten Menschen hingegen dazu, einer plausiblen förderlichen Ursache für eine Handlung eine stärkere Wirkung zuzuschreiben, als wenn diese Ursache alleine vorliegt (Aufwertungsprinzip). Daniel Gilbert und Kollegen gehen in ihrem Dual-Prozess-Modell von einem zweistufigen Attributionsprozess aus: Wenn Menschen das Verhalten einer Person beobachten, bilden sie in einem ersten Schritt zunächst relativ automatisch eine Personenattribution (d.h., sie vernachlässigen situative externe Faktoren und führen das Verhalten auf in der Person liegende bzw. interne Ursachen bzw. Dispositionen zurück). Zu einem weiteren Schritt der Informationsverarbeitung kommt es nur, wenn die Person über die nötigen kognitiven Ressourcen verfügt und sie entsprechend motiviert ist, diese zu verwenden. Sind diese Voraussetzungen gegeben, wird ein kontrollierter Attributionsprozess eingeleitet, in dem systematisch weitere Informationen zur Schlussfolgerung herangezogen werden (z.B. Informationen über den Einfluss von Situationsfaktoren). Die ursprüngliche dispositionale Schlussfolgerung wird dann ggf. modifiziert oder möglicherweise vollständig durch eine andere Attribution ersetzt (situationsbezogene Korrektur). Die Forschung hat u. a. die folgenden Verzerrungen im Attributionsprozess identifiziert: 1. Korrespondenzverzerrung. Beobachter neigen generell dazu, das Verhalten eines Handelnden eher auf interne als auf externe Faktoren zurückzuführen. Ursachen für ein Verhalten werden somit eher der handelnden Person (ihren Dispositionen, Motiven etc.) als der Situation oder den Umständen (z.B. äußeren Zwängen) zugeschrieben. Menschen aus Gesellschaften, deren Kulturen durch individualistische Ideologien geprägt werden (z.B. die USA oder westeuropäische Länder), neigen stärker zu dispositionalen Erklärungen als Menschen, die in einer kollektivistischen Kultur sozialisiert wurden (z.B. in Japan oder Indien). 2. Akteur-Beobachter-Divergenz. Obwohl Menschen (insbesondere Menschen in westlichen Gesellschaften) das Verhalten anderer Personen oft automatisch auf Dispositionen des Handelnden zurückführen, gibt es eine spezifische Divergenz zwischen Akteuren und Beobachtern, wenn es um die Zuschreibung von Ursachen geht. Interessanterweise neigen Menschen nämlich dazu, ihr eigenes Handeln (d.h., wenn sie selbst der Akteur sind) stärker auf externe oder situationale als auf interne oder dispositionale Faktoren zurückzuführen. Ein Grund hängt mit der Wahrnehmungsperspektive zusammen: Wenn Menschen das Verhalten einer anderer Person beobachten, wird diese (und deren Verhalten) als Figur vor dem Hintergrund der Situation wahrgenommen. Beim eigenen Handeln ist aufgrund der eigenen Perspektive die Aufmerksamkeit hingegen auf Merkmale der Situation gerichtet, situative Faktoren sind daher auffälliger als das Verhalten selbst. 3. Selbstwertdienliche Attributionsverzerrung. Diese Art der Verzerrung spielt insbesondere in Leistungssituationen eine Rolle; sie dient der Steigerung oder dem Schutz des Selbstwertgefühls. Um ihr Selbstwertgefühl zu steigern, führen Menschen die eigenen Erfolge typischerweise in höherem Maße auf (stabile) interne Faktoren zurück (Fähigkeiten, Begabung) als vergleichbare Erfolge anderer Personen. Um ihr Selbstwertgefühl zu schützen, werden die eigenen Misserfolge im Unterschied zu den Misserfolgen anderer Personen hingegen eher auf externe Faktoren zurückgeführt. Vom ersten Eindruck zur sozialen Beziehung Der Eindruck, den eine Person von einer anderen Person entwickelt, resultiert nicht einfach aus der Addition der wahrgenommenen Merkmale der Zielperson. Sondern die Integration wird durch implizite Persönlichkeitstheorien des Wahrnehmenden gesteuert. Implizite Persönlichkeitstheorien beinhalten Vorstellungen darüber, welche Persönlichkeitsmerkmale i. d. R. gemeinsam auftreten, zusammenpassen oder zusammengehören (Wenn Person A, die Eigenschaft X hat, dann hat sie vermutlich auch die Eigenschaft Y). Sie werden als implizit bezeichnet, weil sie dem Wahrnehmenden typischerweise nicht bewusst sind. Als zentrale Persönlichkeitsmerkmale werden Charakteristika einer Zielperson bezeichnet, die einen überproportional großen Einfluss auf den resultierenden Gesamteindruck eines Beobachters ausüben. Periphere Persönlichkeitsmerkmale haben hingegen nur einen geringen Einfluss auf die Eindrucksbildung. Nach Rosenberg gibt es zwei zentrale Dimensionen impliziter Persönlichkeitstheorien: 1. Die Soziabilität, also welche Absichten hegt der Interaktionspartner gegenüber der eigenen Person - Freund oder Feind? und 2. die Intelligenz bzw. Kompetenz, also wie hoch ist die Kompetenz des Interaktionspartners ist, seine Absichten umzusetzen? Unter dem Primacy Effekt wird verstanden, dass die Eigenschaften, die zuerst wahrgenommen werden, einen überproportional großen Einfluss auf die Eindrucksausbildung ausüben, als später wahrgenommene Eigenschaften. Wenn eine Person abgelenkt oder nur gering motiviert ist, kann es auch zu einem Recency-Effekt bei der Eindrucksbildung kommen: Der Eindruck wird dann auf der Grundlage der Informationen gebildet, die zeitlich am kürzesten zurück liegen und daher im Gedächtnis am schnellsten zugänglich sind. Im Allgemeinen ist der Primacy Effekt allerdings wesentlich wahrscheinlicher. Menschen sind anderen Menschen beim ersten Kennen lernen prinzipiell offenbar eher positiv gegenüber eingestellt. Allerdings sind sie besonders sensibel gegenüber negativen Informationen. Zwei Gründe lassen sich als Erklärung für diese Sensibilität heranziehen: 1. Negative Informationen sind eher unerwartet und ungewöhnlich und ziehen deshalb besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Dies wiederum führt zu einer intensiveren Verarbeitung. 2. Negative Informationen signalisieren potentielle Gefahr, es ist daher adaptiv auf sie zu reagieren. Es gibt mehrere sozialpsychologische Prozesse, die zur Aufrechterhaltung des ersten Eindrucks beitragen: 1. Die Tendenz zur Beharrung (Perseverance bias): Der erste Eindruck hat häufig sogar dann noch Einfluss auf die Beurteilung einer Zielperson, wenn er sich nachfolgend als falsch erwiesen hat (z.B. Ross et al., 1975); 2. Konfirmatorische Informationssuche: Menschen neigen dazu, gezielt nach Information zu suchen die ihre sozialen Hypothesen über andere Menschen bestätigen, während Informationen, die diese widerlegen könnten, vernachlässigt werden (z.B. Snyder & Swann, 1978). 3. Sich selbst erfüllende Prophezeiung: Die Erwartungen gegenüber einer Zielperson führen dazu, dass man sich dieser gegenüber so verhält, dass sie erwartungskonformes Verhalten zeigt. Dies ist abhängig von der Stärke des eigenen Selbstbildes, dem Bewusstsein über die Vorstellungen des anderen und den eigenen Motiven an der sozialen Interaktion. (z.B. Snyder, Tanke & Berscheid, 1977) Von einer sozialen Beziehung spricht man dann, wenn zwei Menschen miteinander interagieren und sich durch diese Interaktion in ihrem Erleben und Verhalten gegenseitig beeinflussen. Ein entscheidender Faktor dafür, dass sich aus einem sozialen Kontakt eine enge Beziehung entwickelt (z.B. eine Freundschaft), ist die Gegenseitigkeit der interpersonalen Attraktion. Sie wird durch folgende Faktoren begünstigt: 1. Merkmale des Kontexts (z.B. Vertrautheit, Mere-Exposure-Effekt), 2. Merkmale der Zielperson (z.B. physische Attraktivität), 3. Merkmale der Beziehung zwischen Beobachter und Zielperson (z.B. Ähnlichkeit); 4. Merkmale des Beobachters (z.B. seine Stimmung). In Austauschbeziehungen erwarten die Beziehungspartner, dass die Ressourcen, die sie dem Partner bereitstellen, vom Rezipienten durch die Bereitstellung vergleichbarer Ressourcen bezahlt werden das Geben und Nehmen orientiert sich am Gleichheitsprinzip. In Gemeinschaftsbeziehung gehen die Partner davon aus, jeder habe ein Interesse am Wohlergehen des anderen. Die Partner achten daher weniger darauf, was sie vom Beziehungspartner erhalten (oder was sie ihm schulden), sondern darauf, welche Bedürfnisse der andere hat - das Geben und Nehmen von Ressourcen orientiert sich am Bedürfnisprinzip. Die Beziehungspartner sind daher auch dann bereit, dem anderen etwas zu geben, wenn für sie absehbar ist, dass der andere dies nicht entsprechend erwidern kann (Clark & Mills, 1993). Ein wichtiger kommunikativer Faktor, der die emotionale Intensivierung interpersonaler Beziehungen fördert, ist der Grad an Selbstenthüllungen. Unter eine Selbstenthüllung versteht man die bewusste Bereitstellung von Informationen über die eigene Person, die dem Kommunikationspartner ansonsten nicht zugänglich sind. Die Wirkung von Selbstenthüllungen hängt mit dem Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Gleichheitsprinzip zusammen. Der Empfänger der Botschaft fühlt sich verpflichtet, die Selbstenthüllung eines Kommunikationspartners mit einer ungefähr gleichwertigen persönlichen Information zu erwidern. (Altmann & Taylor, 1973) Unter Commitment (z.B. Rusbult et al, 2001) wird die innere Festlegung auf eine Beziehung verstanden. Commitment beinhaltet die Absicht, die Beziehung aufrechtzuerhalten (Verhaltenskomponente), ein Gefühl der affektiven Bindung an die Beziehung (emotionale Komponente) und die Orientierung, sich und den Beziehungspartner auch zukünftig als Paar zu sehen (kognitive Komponente). Rusbult zufolge hängt die Stärke des Commitment von drei unabhängigen Faktoren ab: 1. Zufriedenheit. Das Commitment gegenüber einer Beziehung ist umso stärker, je zufriedener die Person mit der Beziehung ist. 2. Alternativen. Das Commitment gegenüber einer Beziehung sinkt, wenn die Person attraktive Alternativen zur bestehenden Beziehung wahrnimmt. 3. Investitionen. Unter Investitionen werden Faktoren verstanden, die unmittelbar mit der Beziehung verknüpft sind und dadurch die Beendigung einer Beziehung kostspielig machen. Selbst und Identität Selbst und Selbstwertgefühl: In einem basalen sozialpsychologischen Sinn bezieht sich der Begriff des Selbst auf die Gesamtheit des Wissens, über das eine Person bezüglich ihrer selbst und ihres Platzes in der sozialen Welt verfügt. Selbstwertgefühl bezeichnet die Bewertung des Selbst auf der Dimension negativ - positiv. Die sozialpsychologische Forschung nimmt an, dass die Selbstwahrnehmung einen Spezialfall der Personenwahrnehmung darstellt. Menschen ziehen zur Konstruktion ihres Selbst Informationen aus unterschiedlichen Quellen heran; die Integration dieser Informationen wird durch Informationsverarbeitungsprozesse und motivationale Prozesse beeinflusst. Selbsterkenntnis resultiert z.B. auf 1. Introspektion, also der sorgfältigen Analyse eigener Gedanken, Motive, Gefühle, Einstellungen etc. (z.B. Wilson & Dunn, 2004) 2. Selbstwahrnehmungstheorie, also dass auch eigenes Verhalten als Informationsquelle dient (z.B. Bem, 1972) 3. Reaktionen anderer Personen - "looking-glass self" (z.B. Cooley, 1902 oder Mead, 1934) 4. Soziale Vergleichsprozesse (z.B. Festinger, 1954), hierbei die Stichworte: Kritische Attribute, aufwärtsgerichtete oder abwärtsgerichtete Vergleiche. Selbstschemata erleichtern die Enkodierung und den Abruf schemakongruenter selbstbezogener Informationen. Informationen, die nicht mit dem eigenen Selbstschema kongruent sind, werden hingegen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit enkodiert, lassen sich häufig schwerer aus dem Gedächtnis abrufen und erinnern, und diesbezügliche Urteile sind mit größerer subjektiver Unsicherheit behaftet. Selbstschemata steuern allerdings nicht nur die Wahrnehmung, Enkodierung und den Abruf selbstbezogener Informationen, sondern auch die Verarbeitung von Informationen über andere Menschen. Markus, Smith und Moreland (1985) zeigten beispielsweise, dass Männer mit einem ausgeprägten maskulinen Selbstschema, Maskulinität (und damit verbundene Attribute) stärker als Erklärungskonzept für das Verhalten anderer Männer heranziehen als Männer, für die Maskulinität im Hinblick auf das eigene Selbstbild von geringerer Bedeutung ist. Selbstkomplexität resultiert aus der Anzahl distinkter und voneinander unabhängiger Selbstaspekte, durch die das Selbst einer Person charakterisiert ist. Der Begriff des Selbstaspekts ist breiter gefasst als der Begriff des Selbstschemas. Während in Selbstschemata relativ zeitstabile und zentrale Informationen bezüglich der eigenen Person organisiert sind, beziehen sich Selbstaspekte auch auf weniger relevante oder zeitlich fluktuierende Merkmale einer Person. Selbstaspekte sind jede Rolle, Beziehung, Aktivität, Eigenschaft, Gruppenzugehörigkeit etc. einer Person, die Bestandteil ihrer Selbstrepräsentation ist, sowie die jeweils dazugehörigen kognitiven Informationen und affektiven Bewertungen. (z.B. Linville, 1985). Der Grad der Selbstkomplexität resultiert aus der Anzahl von relativ von einander unabhängigen Selbstaspekten. Hohe Selbstkomplexität liegt vor, wenn das Selbst als eine große Anzahl unabhängiger Selbstaspekte repräsentiert ist; bei niedriger Selbstkomplexität weist das Selbst einer Person nur relativ wenige und zudem stark miteinander verbundene Aspekte auf. Wie Linville (1985) zeigen konnte, spielt die Selbstkomplexität im Zusammenhang mit der Emotionsregulation eine wichtige Rolle. Markus und Kunda (1987) vertreten die Auffassung, dass im Arbeitsgedächtnis jeweils nur die Teile des Selbstkonzepts aktiviert sind, die für die Verhaltenssteuerung und Informationsverarbeitung in einem bestimmten Kontext notwendig sind - dieser Teil wird von ihnen als Arbeitsselbstkonzept (working self-concept) bezeichnet. Personale vs. soziale Identität: Der Begriff personale Identität bezeichnet eine Selbstdefinition als einzigartiges und unverwechselbares Individuum, die auf einer interpersonalen (oder intragruppalen) Differenzierung auf der Basis individueller Merkmale beruht (ich versus du oder ihr). Der Begriff der sozialen Identität bezieht sich demgegenüber auf eine Selbstdefinition als austauschbares Gruppenmitglied, die aus einer intergruppalen Differenzierung zwischen Eigen- und Fremdgruppe auf der Basis gruppentypischer Merkmale resultiert (wir versus die). (Tajfel & Turner, 1986). Vertreter des sozialen Identitätsansatzes nehmen an, dass in dem Maße, in dem sich Menschen im Sinne ihrer sozialen Identität definieren, das Erleben und Verhalten dieser Person durch die in der entsprechenden Gruppe vorherrschenden Werte, Normen, Einstellungen etc. beeinflusst wird. Es gibt mehrere Prozesse, die der Aufrechterhaltung eines konsistenten Selbstkonzepts dienen. (vergl. Baumeister, 1998). Hier zu gehören u. a.: (1) Eingeschränkte Zugänglichkeit, (2) Selektives Erinnern, (3) Wegattribuieren und (4) Konzentration auf Schlüsseleigenschaften. Unter objektiver Selbstaufmerksamkeit wird der Zustand verstanden, in dem die eigene Person das Objekt der eigenen Aufmerksamkeit ist. (z.B. Duval & Wicklund, 1972). Die Selbstaufmerksamkeitstheorie legt nahe, dass Menschen v. a. zwei Strategien anwenden können, um den durch negative Diskrepanzen ausgelösten, unangenehmen emotionalen Zustand zu regulieren: 1. durch eine Verminderung der Selbstaufmerksamkeit durch Aufmerksamkeitslenkung (z.B. gezielte Ablenkung oder Vermeidung entsprechender Auslösereize); und 2. eine Verminderung der negativen Diskrepanz durch den Versuch, durch das eigene Verhalten die entsprechenden Standards oder Ideale zu erreichen. Liegt eine positive Diskrepanz vor (z.B. wenn durch die eigene Leistung ein gesetzter Standard übertroffen wurde), entstehen positive Emotionen und gesteigertes Selbstwertgefühl. Personen mit einer hohen Tendenz zur Selbstüberwachung orientieren sich in sozialen Situationen im Hinblick auf die Regulation ihres eigenen Verhaltens an äußeren Hinweisreizen - sie überwachen ihr Verhalten dergestalt, dass es der sozialen Situation angemessen ist und sie einen günstigen Eindruck auf ihre Interaktionspartner machen. Personen mit geringer Selbstüberwachungstendenz orientieren sich hingegen an inneren Reizen bzw. den Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen, die sie selbst in der gegebenen sozialen Situation als relevant erachten (vergleiche Snyder, 1974). Unter der Selbstregulation wird der Prozess der Kontrolle und Lenkung des eigenen Verhaltens bezeichnet, welcher der Erreichung angestrebter Ziele dient. Eine der einflussreichsten Selbstregulationstheorien, die Selbstdiskrepanztheorie von Tory Higgins (1987), befasst sich - ganz ähnlich wie die Selbstaufmerksamkeitstheorie - mit der Rolle wahrgenommener Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen Selbst und bestimmten Standards für die Verhaltensregulation. Es werden drei Selbstbildvarianten unterschieden: 1. das aktuelle Selbst (wie man gegenwärtig ist), 2. das ideale Selbst (wie man gemäß eigener Wünsche und Ideale gerne sein möchte) und 3. das geforderte Selbst (wie man gemäß sozialer Erwartungen und Normen sein sollte). Die für die Selbstregulation notwendigen Ressourcen erneuern sich offenbar - Erholung und positiver Affekt spielen hierbei eine wichtige Rolle. Allerdings sind die genauen psychologischen Prozesse, die die Regeneration der Fähigkeit zur Selbstregulation beschleunigen oder beeinträchtigen, bislang noch weitgehend ungeklärt. Abraham Tesser (1988) unterstreicht in seinem Modell der Selbstwerterhaltung v. a. die Rolle von sozialen Vergleichsprozessen für die Regulation des Selbstwertgefühls. Wenn man sich bezüglich einer Leistung mit anderen vergleicht, kann dies sowohl zur Selbstwertsteigerung als auch zur minderung führen. Um nun das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, könnte eine Person folgende Strategien verwenden: Sie könnte: (1) versuchen, ihre eigene Leistung zu verbessern, oder (2) sich von dem Vergleichsobjekt zu distanzieren, oder (3) die subjektive Bedeutung der Vergleichsdimension abwerten. (Wie andere Autoren herausgearbeitet haben, könnte sie auch die Vergleichsdimension wechseln und sich mit dem Freund auf einer Dimension vergleichen, auf der sie selbst besser abschneidet; sie könnte auch das Vergleichsobjekt wechseln, indem sie sich mit einem anderen und zwar schlechteren Freund vergleicht.) Unter Selbstbehinderung wird die Strategie verstanden, bei Antizipation eines selbstwertbedrohlichen Misserfolgs selbst externale Gründe zu schaffen, auf die sich der Misserfolg bei seinem Eintreten attribuieren lässt. Einstellungen Die Einstellung einer Person zu einem Objekt ist die subjektive Bewertung dieses Objekts. Einstellungsobjekte sind nichtsoziale oder soziale Stimuli (Produkte, Personen etc.), Verhaltensweisen (Rauchen, soziales Engagement etc.), Symbole (Flaggen, Embleme etc.) oder Begriffssysteme (Islam, Kommunismus etc.). Der Begriff Überzeugung bezieht sich in Abgrenzung zum Einstellungsbegriff auf die Informationen, das Wissen oder die Kognitionen, die eine Person mit einem Einstellungsobjekt verbindet. Über jedes Einstellungsobjekt kann man eine Reihe von Überzeugungen haben, die ihrerseits zu einer positiven oder negativen Einstellung gegenüber dem Objekt beitragen können. Sozialpsychologen gehen davon aus, dass Einstellungen eine kognitive (also die Überzeugungen, die eine Person über ein Einstellungsobjekt hat), eine affektive (also die Gefühle oder Emotionen, die eine Person mit einem Einstellungsobjekt assoziiert) und eine verhaltensbezogene Komponente (bezieht sich auf Informationen bezüglich des Einstellungsobjekts, die aus dem eigenen Verhalten im Umgang mit diesem Objekt abgeleitet werden) aufweisen, die auf entsprechenden Erfahrungen im Umgang mit dem Einstellungsobjekt beruhen (Rosenberg & Hovland, 1960). Kognitionen in Form von Überzeugungen sind der elementare Bestandteil des Einstellungsmodells von Martin Fishbein und Icek Ajzen (1975). Die Einstellung resultiert aus der Addition der im Hinblick auf jedes Attribut des Einstellungsobjekts ermittelten Erwartungs-x-Wert Produkte. Interessanterweise kann allerdings auch die bloße Häufigkeit der Konfrontation mit einem ursprünglich neutral bewerteten Einstellungsobjekt dazu führen, dass Menschen eine positive Einstellung gegenüber dem Objekt entwickeln. Dieses Phänomen wird auch als Mere-Exposure-Effekt bezeichnet (Zajonc, 1968). Bei der zweidimensionalen Konzeption der Einstellungsstruktur wird davon ausgegangen, dass positive und negative Elemente auf getrennten Dimensionen (positiv versus negativ) abgespeichert werden. Die zweidimensionale Konzeption ist der eindimensionalen insofern überlegen, als sie auch Einstellungsambivalenz erklären kann. Die Stärke einer Einstellung hat einen Einfluss darauf, wie schnell ein Mensch seine Einstellung ändert. In der Regel gilt: Je stärker die Einstellung, desto schwieriger lässt sie sich durch Überzeugungsversuche seitens anderer Personen verändern. Der Begriff der Einstellungszugänglichkeit bezieht sich darauf, wie leicht eine Einstellung aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann: schnell abrufbare Einstellungen werden als leicht zugänglich bezeichnet. Katz (1967) schlägt vier basale psychologische Funktionen von Einstellungen vor: 1. Die Instrumentelle, Anpassungs- oder utilitaristische Funktion. Menschen entwickeln positive Einstellungen gegenüber Objekten, die persönliche Bedürfnisse befriedigen und zu positiven Konsequenzen führen, während sie negative Einstellungen gegenüber Objekten entwickeln, die mit Frustration oder negativen Konsequenzen einhergehen. Die Valenz der Einstellung dient dann zukünftig als Hinweisreiz für die Verhaltensanpassung: Eine positive Einstellung fördert Annäherung, eine negative Einstellung Vermeidung des Einstellungsobjekts. 2. Die Ich-Verteidigungsfunktion. Unter Rückgriff auf psychodynamische Theorien postuliert Katz (1967), dass Einstellungen auch dazu dienen, Angst und Unsicherheit, die aus inneren unerwünschten Impulsen bzw. äußeren Gefahren resultieren, zu reduzieren. Dies erfolgt u. a. dadurch, dass negative Attribute, die man an sich selbst wahrnimmt, auf andere Personen (oder Gruppen) projiziert werden, was sich wiederum in einer negativen Einstellung gegenüber diesen Personen oder Gruppen niederschlägt. 3. Die Wertausdrucksfunktion. Menschen ziehen Befriedigung daraus, zentrale Werte oder Aspekte des eigenen Selbst auszudrücken, da sie dadurch ihr eigenes Selbst und ihren Platz in der sozialen Welt verifizieren (zu diesem Bedürfnis nach Selbstverifikation, siehe auch Swann, 1990). 4. Die Wissensfunktion. Einstellungen vereinfachen die Organisation, Strukturierung und Verarbeitung von Informationen und die Handlungsplanung, indem sie es erlauben, neue Ereignisse und Erfahrungen anhand bereits bestehender evaluativer Dimensionen zu interpretieren. Einstellungen sind hypothetische Konstrukte und damit nicht direkt beobachtbar. Verfahren zur Erfassung von Einstellungen fallen in zwei breite Kategorien: 1. explizite Maße, die darauf beruhen, dass Personen gebeten werden, ihre Einstellung anzugeben (sog. Selbstberichtsverfahren). Hier z.B. die Likert-Skala. 2. implizite Maße, Verfahren mittels derer die Einstellungen erfasst werden, ohne die Personen direkt um eine verbale Angabe zu ihren Einstellungen zu bitten. Z.B. der IAT. Der IAT ist eine Methode zur Messung individueller Unterschiede in der Stärke der mentalen Assoziationen zwischen Einstellungsobjekten und ihren Bewertungen. Die Logik des Verfahrens wird am Beispiel eines IAT zur Ermittlung der Einstellung gegenüber ethnischen Kategorien illustriert (Weiße versus Schwarze). In diesem IAT müssen die Vpn Bilder oder Namen von schwarzen oder weißen Personen (Objekt-Stimuli) durch Druck zweier Tasten so schnell wie möglich den Kategorien weiß oder schwarz zuordnen. Im Wechsel mit dieser Objekt-Diskriminationsaufgabe muss eine evaluative Entscheidungsaufgabe ausgeführt werden, in der normativ positive und negative Worte (Attribut-Stimuli) so schnell wie möglich den Kategorien positiv und negativ zugeordnet werden. Für die Auswertung ist der Vergleich der Reaktionszeiten der Teilnehmer im Hinblick auf zwei Varianten dieser Diskriminationsaufgaben entscheidend: In einem Fall müssen die Teilnehmer mit jeweils der gleichen Taste auf weiße Personen und positive Worte bzw. schwarze Personen und negative Worte reagieren. Im anderen Fall müssen sie dagegen mit der gleichen Taste auf weiße Personen und negative Worte bzw. schwarze Personen und positive Worte reagieren. Der Unterschied in den mittleren Reaktionszeiten zwischen assoziationskongruenter und assoziationsinkongruenter Zuordnung wird üblicherweise als Indikator für die Stärke der relativen Präferenz von Weißen gegenüber Schwarzen (oder vice versa) interpretiert. Ajzen und Fishbein (1977) wiesen darauf hin, dass sich die Maße für Einstellungen und Verhalten im Hinblick auf vier Elemente entsprechen müssen, um eine zuverlässige Verhaltensvorhersage zu gewährleisten (TACT bzw. Korrespondenzprinzip): T für Target = Zielelement: Auf welches Objekt bzw. Ziel ist das Verhalten gerichtet? A für Action = Handlungselement: Welches Verhalten soll untersucht werden? C für Context = Kontextelement: In welchem Kontext wird das Verhalten ausgeführt? und T für Time = Zeitelement: Zu welchem Zeitpunkt soll das Verhalten ausgeführt werden? Diese Korrespondenz zwischen Einstellungs- und Verhaltensmaßen war in vielen der bis zum damaligen Zeitpunkt durchgeführten Studien nicht gegeben. Ajzen und Fishbein (1977) argumentieren, dass bei hoher Korrespondenz von Einstellungs- und Verhaltensmaßen bzgl. der oben genannten Aspekte eine zuverlässige Verhaltensvorhersage möglich ist. Wie die Forschung zeigt, beeinflussen auch bestimmte Persönlichkeitsfaktoren die Stärke des Zusammenhangs zwischen (expliziten) Einstellungen und Verhalten. Personen mit einer geringen Tendenz zur Selbstüberwachung zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Verhalten in sozialen Situationen stark an ihren eigenen Gefühlen, Dispositionen oder Einstellungen orientieren. Personen mit einer starken Tendenz zur Selbstüberwachung orientieren sich hingegen in ihren Verhaltensentscheidungen stark an Anforderungen der Situation und den antizipierten Reaktionen ihrer Interaktionspartner (Snyder und Kendzierski (1982). Ein weiterer wichtiger Persönlichkeitsfaktor ist das Selbstschema, das eine Person in einem bestimmten einstellungsrelevanten Bereich entwickelt hat. Wenn die Einstellung gegenüber einem bestimmten Verhalten (z.B. Sport zu treiben) integraler Bestandteil des Selbstschemas einer Person ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie ein einstellungs- bzw. schemakonsistentes Verhalten zeigt, als wenn die entsprechende Einstellung für ihr Selbstschema von eher peripherer Bedeutung ist (z.B. Sheeran & Orbell, 2000). In der Theorie des überlegten Verhaltens wird die Verhaltensintention zum einen von der Einstellung gegenüber dem Verhalten beeinflusst. Die Einstellung gegenüber dem Verhalten resultiert aus der eingeschätzten Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Verhaltenskonsequenzen und der Bewertung dieser Verhaltenskonsequenz. Die zweite psychologische Determinante der Verhaltensabsicht in dem Modell ist die subjektive Norm. Sie wird wiederum durch zwei Faktoren bestimmt: Erstens durch die wahrgenommenen normativen Erwartungen signifikanter Anderer bezüglich des Verhaltens und zweitens durch die Motivation der Person, diesen Erwartungen zu entsprechen. Die Integration der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle in das Modell des überlegten Handelns (Ajzen & Fishbein, 1980) stellt die entscheidende theoretische Erweiterung der Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen und Madden, 1986) dar. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der Person bezieht sich darauf, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt, um ein bestimmtes Verhalten ausführen zu können. Die Verhaltenskontrolle kann das Verhalten auf zwei Arten beeinflussen: Zum einen kann die Absicht, ein Verhalten auszuführen, durch die Erwartung gestärkt werden, dass man das Verhalten tatsächlich ausüben kann. Andererseits kann die wahrgenommene Verhaltenskontrolle sich auch direkt auf die Ausführung bzw. Nicht-Ausführung des Verhaltens auswirken. Weitere ergänzende Modelle, bzw. alternative Modelle sind das Modell des wiederholten Handelns (s. Bentler & Speckart, 1979), das Modell des spontanen Verhaltens oder das MODE-Modell von Fazio (1990), was u. a. vom Konzept der leicht zugänglichen Einstellungen ausgeht. Einstellungen können durch Persuasion verändert werden. Dies kann zum einen durch direkten Kontakt mit dem Einstellungsobjekt geschehen, durch positive oder negative Verhaltensanreize oder durch kommunikative Persuasion. Die beiden vielleicht einflussreichsten Modelle zu dieser Thematik sind das Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit von Petty und Cacioppo (1986) und das heuristisch-systematische Modell der Persuasion von Chaiken (z.B. Chaiken, 1987). Eine Einstellungsänderung kann entweder über eine zentrale Route erfolgen, also aufgrund einer relativ intensiven kognitiven Auseinandersetzung mit den "neuen" Argumenten oder über eine periphere Route, wobei einfache Heuristiken verwendet werden, die sich eher auf oberflächliche, periphere Hinweisreize stützen. Diese können z.B. folgende Heuristiken sein: 1. Expertenheuristik. Menschen achten häufig eher darauf, wer etwas sagt, als was jemand sagt. Als heuristische Hinweisreize für einen (vermeintlichen) Expertenstatus fungieren z.B. ein akademischer Titel, das Alter oder das Geschlecht. 2. Attraktivitätsheuristik. Menschen lassen sich auch häufig eher von Personen überzeugen, die sie attraktiv finden. Ein Grund besteht darin, dass Menschen attraktiven Personen spontan mehr Zuneigung und Vertrauen entgegenbringen. 3. Länge der Nachricht als Heuristik. Bis zu einem gewissen Grad wirken längere Botschaften überzeugender als kürzere - und dies selbst dann, wenn es sich bei den präsentierten Argumenten gar nicht um unterschiedliche Argumente, sondern nur um unterschiedliche Formulierungen oder Varianten ein und desselben Arguments handelt. Um die Bedeutung der persönlichen Relevanz für die Verarbeitung persuasiver Argumente zu demonstrieren, spielten Petty, Cacioppo und Goldmann (1981) ihren Vpn (Studierende) eine auf Tonband aufgezeichnete Rede vor, in der Argumente für oder gegen die Einführung einer zusätzlichen Abschlussprüfung zum Ende des Studiums präsentiert wurden. Um die persönliche Relevanz zu manipulieren, wurde ein Teil der Vpn Glauben gemacht, die baldige Einführung der Prüfung wurde von der Universität für das kommende Jahr ernsthaft in Erwägung gezogen (hohe persönliche Relevanz), den übrigen Vpn wurde mitgeteilt, dass die Universität die Einführung der Prüfung zwar in Betracht ziehe, die Maßnahme allerdings erst in zehn Jahren umgesetzt werden sollte (geringe persönliche Relevanz). Zusätzlich wurden zwei weitere unabhängige Variablen experimentell variiert. Dies war zum einen die Qualität der Argumente (stark vs. schwach). Zudem wurde die Quelle der Argumente variiert (vermeintlich hohe vs. niedrige Expertise). Zentrales Ergebnis war ein Dreifach - Interaktionseffekt: Wenn das Thema für die Vpn persönlich relevant war (und nur dann), wurde ihre eigene Einstellung von der Qualität der Argumente beeinflusst, und zwar unabhängig vom Status der Quelle (d.h., die Überzeugung fand auf zentralem Wege statt). Bei geringer persönlicher Relevanz spielte hingegen der Status der Quelle eine wichtige Rolle für die Bildung der Einstellung (d.h., die Überzeugung fand auf peripherem Wege statt). Einstellungsänderung, die über die zentrale Route (d.h. durch intensives Nachdenken) erreicht wird, führt zu lang anhaltender und relativ änderungsresistenter Einstellungsänderung. Einstellungsänderungen, die über die periphere Route erreicht wurden, sind hingegen fragiler und anfällig für neue Überzeugungsversuche. Prosoziales Verhalten, Helfen und Altruismus Mit dem Begriff prosoziales Verhalten werden in der sozialpsychologischen Literatur üblicherweise Verhaltensweisen bezeichnet, die von einer Gesellschaft allgemein als vorteilhaft oder gewinnbringend für andere Menschen und/oder das bestehende politische System definiert werden. Unter dem Begriff Helfen werden Verhaltensweisen verstanden, die eine Person (der Helfer) in der Absicht ausführt, das Wohlergehen einer anderen Person (des Hilfeempfängers) zu verbessern (oder zu schützen). Eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass ein Akt als Helfen klassifiziert wird, ist die Verhaltensabsicht oder Intention des Helfers. Diese Verhaltensweisen des Helfens werden nach Pearce & Amato (1980) nach drei Dimensionen systematisiert: Planungsgrad, Schweregrad und Art des Kontaktes. Unter Altruismus werden Formen des Hilfeverhaltens verstanden, deren primäres Ziel es ist, das Wohlergehen einer anderen Person zu verbessern oder zu schützen. Ein möglicher persönlicher Nutzen, der dabei für den Helfer entsteht (z.B. soziale Anerkennung durch andere Personen) stellt lediglich ein Nebenprodukt des Hilfeverhaltens dar und ist nicht intendiert. In der Literatur wird zwischen altruistisch motiviertem und egoistisch motiviertem Helfen unterschieden. Der sozialpsychologische Altruismusbegriff bezieht sich auf Verhalten, dessen primäres Ziel es ist, das Wohlergehen einer anderen Person zu verbessern oder zu schützen. Im Zentrum der Definition steht damit eine bestimmte motivationale Orientierung. In der Biologie wird Altruismus als ein Verhalten verstanden, das mit Fitnesskosten für den Helfer und Fitnessvorteilen für den Rezipienten verbunden ist (z.B. die Weitergabe eigener Gene, der Gene von Verwandten, Prinzip der Wechselseitigkeit - Reziprozitätsnorm). Der Begriff der Verwandtenselektion stellt eine Erweiterung des Begriffs der natürlichen Selektion dar. Im Zentrum der theoretischen Überlegungen steht die Annahme, dass die natürliche Selektion insbesondere die Evolution von prosozialem Verhalten gegenüber genetisch Verwandten gefördert hat, und zwar deshalb, weil dieses Verhalten den indirekten Reproduktionserfolg eines Individuums erhöht. Die Theorie leitet sich direkt aus dem von Hamilton (1964) entwickelten Konzept der Gesamtfitness ab. Hamilton schlägt vor, dass sich der Fortpflanzungserfolg eines Individuums nicht nur an der Weitergabe seiner Gene durch die Zeugung eigener Nachkommen bemisst, sondern an der Gesamtzahl eigener Gene, die an die nachfolgende Generation weitergegeben wird. Das übergeordnete Ziel des Hilfeverhaltens besteht austauschtheoretischen Überlegungen (also so genannten Kosten-Nutzen-Analysen) zufolge in der Wahrung oder dem Ausbau des eigenen Wohlergehens nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung (egoistische Motivation). Die Kosten- und Nutzenfaktoren, die Menschen im Rahmen der Entscheidung zu helfen (oder nicht zu helfen) berücksichtigen, können prinzipiell in die folgenden Klassen fallen: 1. Materielle Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. der finanzielle Aufwand, der mit dem Hilfeverhalten verbunden ist; auf Nutzenseite ggf. eine finanzielle Belohnung, die einem aufgrund des Verhaltens zuteil wird. 2. Körperliche Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. körperliche Anstrengung, Schmerz, Verletzungen; auf Nutzenseite ggf. eine Stärkung der körperlichen Fitness und Gesundheit (z.B. durch langfristiges ehrenamtliches Engagement). 3. Soziale Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. negative soziale Reaktionen wie Verspottung oder sogar Ausgrenzung, weil man jemandem hilft, der dies vermeintlich nicht verdient; auf Nutzenseite ggf. soziale Anerkennung und Ruhm für eine heldenhafte Tat. und 4. Psychische Konsequenzen - auf Kostenseite z.B. Gefühle von Aversion und Ekel durch die Konfrontation mit Blut, Wunden oder Sekreten, auf Nutzenseite ggf. eine Steigerung des Selbstwertgefühls, das Gefühl im Einklang mit eigenen Idealen zu handeln. Pilavin (1981) u. a. haben ein Modell der möglichen antizipierten Kosten des Helfens bzw. NichtHelfens und den daraus resultierenden Verhaltenskonsequenzen entwickelt. Diesem Modell zufolge ist direktes Hilfeverhalten am ehesten unter Bedingungen zu erwarten, in denen die wahrgenommenen Kosten des Helfens gering sind, während gleichzeitig hohe Kosten durch das Nicht-Helfen antizipiert werden. Im umgekehrten Fall ist direktes Hilfeverhalten hingegen am unwahrscheinlichsten und es ist mit Ausweichstrategien zu rechnen. Das von Robert Cialidini und Kollegen entwickelte "Negative-State-Relief"-Modell liefert eine Erklärung dafür, warum eigene negative Gefühle Menschen dazu bringen, anderen zu helfen. Kerngedanke dieses Modells ist, dass negativ empfundene Gefühlszustände, wie sie z.B. bei Konfrontation mit einer hilfsbedürftigen Person entstehen, die Motivation auslösen, diese Gefühle zu reduzieren, um damit das eigene Wohlbefinden wiederherzustellen. Durch Sozialisations- und Lernprozesse haben Menschen gelernt, dass eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, darin besteht, die Notlage der hilfsbedürftigen Person zu verbessern. Menschen helfen dem Negative-State-Relief-Modell zufolge, um eigene negative Gefühle abzubauen. Die Empathie-Altruismus-Hypothese von Batson u. a. (1991) liefert jedoch auch Hinweise, dass Empathie altruistisches Verhalten begünstigt. Empathie ist eine auf eine andere Person gerichtete emotionale Reaktion, die Gefühle wie Mitgefühl, Mitleid, Besorgnis, Wärme oder Fürsorglichkeit umfasst. Ein kognitiver Faktor, der das Auftreten von Empathie begünstigen kann, ist die Übernahme der Perspektive der Not leidenden Person. In dem so genannten "Elaine"-Experiment bestätigte Batson folgendes Befundmuster die Empathie-Altruismus-Hypothese. Unter der Bedingung "hohe Empathie" (altruistische Motivation) halfen die Vpn unabhängig, von den Kosten des Nicht-Helfens. Unter der Bedingung "niedrige Empathie" (egoistische Motivation) war dies hingegen nicht der Fall - der überwiegende Teil der Vpn half nur dann, wenn Nicht-Helfen, mit hohen Kosten einherging. Cialdini u. a. (1997) gehen jedoch davon aus, dass dieses scheinbar altruistische Verhalten, nicht wahrhaft altruistisch sei. Sie gehen davon aus, dass Empathie einer Wahrnehmung des "Einsseins" mit dem anderen entspringt, und die Person sich somit eher selbst hilft, als den anderen. Stürmer, Snyder u. a. (2006) zeigen jedoch, dass eine gemeinsame soziale Identität den Effekt von Empathie auf Helfen verstärkt. Penner u. a. (1995) gehen davon aus, dass es relativ zeitstabile Persönlichkeitsmerkmale gibt, die eine prosoziale Persönlichkeit von wenig-helfenden Menschen unterscheidet. Dies sind zum einen eine empathische Veranlagung und zum anderen eine dispositionelle Hilfsbereitschaft (also der Selbsteinschätzung der eigenen Person als hilfsbereit). Typischerweise tritt ihr Einfluss jedoch dann zurück, wenn z.B. starke situative Einflüsse vorliegen, die eine "Entfaltung" der Persönlichkeit in der Situation verhindern (z.B. Zeitdruck). Eine Meta-Analyse von Alice Eagly und Maureen Crowly (1986) zeigt, dass weder Frauen noch Männer mehr helfen, sondern dass sie sozialisationsbedingt in unterschiedlichen Bereichen helfen (Eingreifen in Notfallsituationen vs. langfristige pflegerische Unterstützung). Latané und Darley (1970) haben ein Modell entwickelt, das fünf Schritte spezifiziert, die der Zeuge eines Notfalls nehmen muss, damit er einem Opfer tatsächlich hilft. Dies sind: 1. Ereignis bemerken, 2. Ereignis als Notfall interpretieren, 3. Verantwortung übernehmen, 4. Passende Art der Hilfeleistung auswählen, 5. Entscheidung umsetzen. Die Anwesenheit anderer Personen kann durch Prozesse der Pluralistischen Ignoranz (Schritt 2) - also einer auf informativen sozialem Einfluss beruhende kollektive Fehleinschätzung eines Notfalls als harmloses Ereignis, der Verantwortungsdiffusion (Schritt 3) - also einer Abnahme der wahrgenommenen individuellen Verantwortlichkeit für das Einschreiten in Notfallsituationen aufgrund der Anwesenheit anderer handlungsfähiger Personen und der Bewertungsangst (Schritt 4) - also der Angst davor, sich möglicherweise zu blamieren - zu einer Hemmung von Hilfeverhalten führen (siehe auch "Bystander-Effekt"). Aufklärung über die Faktoren, die Hilfeverhalten in Notfallsituationen verhindern, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen zukünftig Hilfe leisten. Aggressives Verhalten Der Begriff Aggression bezeichnet ein intendiertes Verhalten mit dem Ziel, einem anderen Lebewesen zu schaden oder es zu verletzen, wobei dieses Lebewesen motiviert ist, diese Behandlung zu vermeiden. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die soziale Bewertung eines Verhaltensakts als Aggression vom situativen und normativen Kontext abhängt, in dem das Verhalten stattfindet. Im Hinblick auf die subjektive Bewertung von aggressivem Verhalten spielt zudem die Perspektive des Akteurs eine entscheidende Rolle. Feindselige (heiße oder affektive) Aggression resultiert typischerweise aus dem Empfinden negativer Emotionen, wie Ärger, Zorn oder Wut; das Verhaltensziel besteht in der Schädigung eines anderen Lebewesens (z.B. der Person, über die man sich ärgert). Instrumentelle (kalte oder strategische) Aggression zielt zwar ebenfalls darauf ab, ein anderes Lebewesen zu schädigen, ist jedoch in erster Linie ein Mittel zum Zweck (z.B. Schädigung eines Konkurrenten, um sich selbst einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen). Beispiel: Ein Verteidiger foult einen Stürmer, um ein Tor zu verhindern (Instrumentelle Aggression); der gefoulte Stürmer schlägt den Verteidiger nieder (feindselige Aggression). Als Gewalt würde ein verbaler Akt klassifiziert, wenn er die Androhung körperlicher Schädigung beinhaltet. Aus der Primatenforschung ergaben sich einige zentrale Befunde für das Verständnis aggressiven Verhaltens beim Menschen. Ein erster Befund bezieht sich auf die Häufigkeit aggressiven Verhaltens unter Primaten. Systematische Sichtungen von Studien zum Sozialverhalten tagaktiver Affenarten legen z.B. nahe, dass aggressives Verhalten unter Primaten vergleichsweise selten ist. Kooperatives Verhalten, wie gegenseitiges Füttern und die Fellpflege, ist um ein Vielfaches häufiger zu beobachten als Wettbewerb und Streit. Auf der Grundlage einer Integration dieser und anderer Forschungsergebnisse schlussfolgern verschiedene Forscher, dass unter Primaten (Menschen eingeschlossen) entgegen vorherrschender Ansicht nicht Aggressionen, sondern Kooperationen das Zusammenleben regeln (z.B. Sussman & Garber, 2004). Ein zweiter Befund bezieht sich auf die hohe Kapazität zur kontextspezifischen Modulation aggressiver Impulse. Zwillingsstudien legen nahe, dass aggressives Verhalten eine genetische Grundlage hat. Menschen variieren im Hinblick auf ihre genetische Disposition zu aggressivem Verhalten. Umweltfaktoren sind aber entscheidend daran beteiligt, ob die Auswirkung dieser Disposition auf das Verhalten gefördert oder gehemmt wird. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es trotz Hinweisen auf korrelative Zusammenhänge zwischen Hormonspiegel und Aggressionen bislang an klaren Belegen mangelt, dass ein niedriger Serotonin- oder ein hoher Testosteronspiegel hinreichende Bedingungen für die Entstehung von aggressiven Verhalten darstellen. Gemäß der Frustrations-Aggressions-Hypothese (Dolart et al., 1993) erhöht Frustration die Wahrscheinlichkeit des Auftretens aggressiver Verhaltensweisen. Der Frustrations-Aggressions-Hypothese zufolge ist Frustration allerdings nicht die einzige, sondern lediglich eine von mehreren möglichen Ursachen von Aggression. Ob Frustration zu aggressiven Verhaltensweisen führt (und gegen wen sie sich richtet), hängt von zusätzlichen personalen und situativen Faktoren ab. In einem Feldexperiment instruierte Harris (1974) ihre Assistenten, sich an verschiedenen Positionen in längeren Warteschlangen (z.B. im Kino oder Supermarkt) vorzudrängeln, wobei sie eine von zwei Positionen einnehmen sollten: Entweder vor einer Zielperson, vor der nur noch zwei andere Wartende standen (d.h. einer Person, die ihr Ziel schon fast erreicht hatte) oder vor einer Zielperson, vor der noch elf andere Wartende standen. Zudem wurden folgende Variablen variiert: Das Geschlecht der Person, die sich vordrängelte (Gegenüber Frauen reagierten die Zielpersonen weniger aggressiv), ob er oder sie sich für das Vordrängeln entschuldigten oder nicht (Entschuldigungen minderten aggressive Reaktionen), und der soziale Status (gegenüber Personen mit niedrigem Status wurde aggressiver reagiert). Die Tendenz Aggressionen gegen unbeteiligte Dritte zu richten, wenn sie nicht gegenüber der ursprünglichen Quelle der Frustration zum Ausdruck gebracht werden können (z.B. aus Furcht davor, dass diese Person sich revanchiert) wird Aggressionsverschiebung genannt. Tatsächlich belegt eine Vielzahl von Studien, dass Menschen, wenn sie frustriert werden, Aggressionen von der ursprünglichen Quelle der Frustration auf weniger mächtige oder leichter erreichbare Zielpersonen verschieben (z.B. Marcus-Newhall, Pedersen, Carlson, & Miller, 2000). Entscheidend für das Auftreten aggressiven Verhaltens ist dem kognitiv-neoassoziationistischen Modell von Berkowitz (1990) zufolge, ob ein Ereignis negativen Affekt auslöst. Unangenehme Erfahrungen rufen zunächst eine unspezifische negative Affektreaktion hervor, die wiederum zwei unterschiedliche kognitive (oder assoziative) Netzwerke aktiviert. Einerseits werden durch negativen Affekt Kognitionen, Erinnerungen, Gefühle und motorische Schemata aktiviert, die mit Aggression in Verbindungen stehen. Gleichzeitig werden aber auch mentale Inhalte aktiviert, die mit Fluchtverhalten assoziiert sind. Im Zuge dieses ersten automatisch ablaufenden Assoziationsprozesses erhält der unspezifische negative Affekt eine spezifischere emotionale Qualität in Form von (rudimentärem) Ärger oder (rudimentärer) Furcht. In einem zweiten, stärker kontrolliert und systematisch ablaufenden Verarbeitungsprozess, interpretiert die Person diese rudimentären Gefühle, sie nimmt Kausalattributionen bzgl. des Ereignisses vor und überlegt, welche Gefühle und Handlungen der Situation angemessen sind (Hat mich die andere Person absichtlich verletzen wollen? Wie würden andere reagieren?). Dadurch erreicht die Person einen spezifischeren und gefestigteren emotionalen Zustand, entweder Ärger oder Furcht, der wiederum die weitere Einschätzung der Situation lenkt. Bevor sich die Person für eine Verhaltensreaktion entscheidet, werden weitere Bewertungsschritte vollzogen, indem die potenziellen Handlungsergebnisse bewertet (Was passiert, wenn ich mich an ihm räche?) und soziale Normen berücksichtigt (Wie werden andere Personen auf mein Verhalten reagieren?). Lerntheorien liefern ebenfalls zwei wichtige Ausgangspunkte für die Erklärung von aggressiven Verhalten. Zum einen ist dies das Prinzip der operanten Konditionierung, zum anderen das Modelllernen (Bandura, 1963). Am Beispiel des Zusammenhangs von Mediengewalt und Verhalten: Die Forschung unterstreicht die Bedeutung von fünf ineinander greifenden Mechanismen, die die Effekte von Gewaltdarstellungen in Medien auf das Verhalten vermitteln: 1. Modelllernen: Charaktere, die aggressives Verhalten zeigen und dadurch ihre Ziele erreichen, können als Modelle für aggressives Verhalten dienen. 2. Verfügbarkeit: Der Konsum von Gewaltdarstellungen in Medien stärkt die chronische Verfügbarkeit aggressiver Gedanken und Gefühle. 3. Soziale Normen: Die Beobachtung, dass andere ungestraft und erfolgreich Aggressionen einsetzen, kann dazu führen, dass der Zuschauer seine Wahrnehmung geltender sozialer Normen dahingehend verändert, dass er davon ausgeht, Aggression und Gewalt seien sozial akzeptierte - wenn nicht sogar erwünschte - Verhaltensweisen. 4. Abstumpfung: Der langfristige und wiederholte Konsum von Gewaltdarstellungen kann zu Abstumpfung oder Habituation gegenüber Gewalt und Aggression führen. 5. Feindseliger Attributionsstil: Medien beeinflussen das subjektive Bild von der Wirklichkeit. Die überproportional häufige Darstellung von Gewalt in Medien kann den Effekt haben, dass der Konsument die Welt zunehmend für einen gefährlichen und feindseligen Ort hält, was sich auf der Ebene von Persönlichkeitsmerkmalen in einem feindseligen Attributionsstil manifestieren kann. Es gibt einige interindividuelle Unterschiede im Auftreten von aggressivem Verhalten. Folgende Persönlichkeitsvariablen werden dabei genannt: 1. Ein feindseliger Attributionsstil, also die relative zeitstabile Tendenz einer Person, die einen Schaden verursacht hat, eine feindselige oder aggressive Verhaltensabsicht zu unterstellen, auch wenn unklar ist, ob diese den Schaden mit Absicht herbeigeführt hat. 2. Geschlechtsunterschiede. Offene und vor allem körperliche Aggression wird häufiger von Männern als von Frauen ausgeübt (z.B. Archer, 2004). Frauen und Mädchen neigen hingegen stärker dazu, aggressives Verhalten in verdeckter Form auszuüben, indem sie z.B. gezielt Gerüchte über die Person, die sie schädigen möchten, in Umlauf bringen. Bettencourt und Miller (1996) stellten fest, dass Männer zwar unter normalen Umständen aggressiver reagieren als Frauen. Diese Geschlechtsunterschiede verringern sich allerdings, wenn Provokationen ins Spiel kommen. Ebenso gibt es einige situative Auslöser aggressiven Verhaltens. Dort sind zu nennen: 1. Aversive Umweltbedingungen. Das Modell von Berkowitz (1990) betont die Rolle negativen Affekts hinsichtlich des Auftretens aggressiver Verhaltensweisen. Negativer Affekt kann durch unterschiedliche Situationsfaktoren hervorgerufen werden, v. a. durch solche, die zu einer körperlichen Beeinträchtigung führen und Schmerzen oder Unwohlsein verursachen (Berkowitz, 1993). Die Forschung zeigt, dass v. a. hohe Temperaturen und räumliche Enge zu einer Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens führen können. 2. Aggressive Hinweisreize. In einer Situation können bestimmte Hinweisreize vorliegen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Personen, bei denen bereits eine Bereitschaft zur Ausführung aggressiven Verhaltens besteht (z.B. weil sie verärgert sind), dieses Verhalten auch tatsächlich ausführen (Berkowitz und LePage, 1967). Obwohl sich dieser auch als "Waffeneffekt" bezeichnete Effekt nicht immer replizieren ließ, liefert der überwiegende Teil der empirischen Forschung doch solide Belege dafür, dass aggressive Hinweisreize die Auftretenswahrscheinlichkeit von aggressivem Verhalten erhöhen. 3. Gewaltdarstellungen in den Medien Auf individueller Ebene gibt es einige Interventionsmöglichkeiten um aggressives Verhalten zu verhindern. 1. Entschuldigungen. Die Wirksamkeit hängt jedoch erstens vom Schweregrad des Ereignisses ab und zum anderen vom Vertrauen, also das die Entschuldigung auch glaubwürdig ist. 2. Bestrafung. Es müssen aber folgende Bedingungen erfüllt sein: die verabreichte (oder zu erwartende) Strafe muss aus Sicht des Akteurs hinreichend unangenehm sein, die Strafe muss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf das Verhalten folgen, die Strafe muss in einem für die Zielperson unmittelbar nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem gezeigten Verhalten stehen und die Zielperson muss erkennen, dass in der relevanten Situation alternative und sozial akzeptierte Handlungen zur Verfügung stehen, die nicht zur Bestrafung führen (oder geführt hätten). 3. Ärgerbewältigung durch den Aufbau von Kompetenzen zur effektiven Ärgerregulation, also dem Erkennen der situativen Auslöser, dem Einüben von Selbstverbalisationen, angemessene Kommunikation und dem Erlernen von mit Ärger inkompatiblen Verhaltensweisen. Die Wirksamkeit von Ärgerbewältigungstrainings setzt allerdings die Einsicht voraus, dass aggressives Verhalten mit mangelnder Impulskontrolle zusammenhängt, sowie die Motivation, dies zu ändern. Einführung in die Sozialpsychologie II: Intragruppale und intergruppale Prozesse Gruppenpsychologie: Grundbegriffe Soziale Gruppe: Eine Menge von Individuen, die sich selbst als Mitglieder derselben sozialen Kategorie wahrnehmen und ein gewisses Maß emotionaler Bindung bezüglich dieser gemeinsamen Selbstdefinition teilen (Tajfel & Turner, 1986). Die Menge der Individuen ist unbestimmt, daher wird nicht zwischen Gruppe und sozialer Kategorie unterschieden. Unter Entitativität wird das Ausmaß verstanden, in dem eine Anzahl von Personen als miteinander verbundene, kohärente Einheit wahrgenommen wird. Der Begriff Gruppenkohäsion bezieht sich auf den inneren Zusammenhalt einer Gruppe (das "Wir-Gefühl"), der u. a. durch die Intensität und emotionale Qualität der Beziehungen der Gruppenmitglieder zueinander zum Ausdruck kommt. Der Begriff der sozialen (oder auch kollektiven) Identifikation bezieht sich auf die psychologische Beziehung zwischen Selbst und Gruppe. Gruppenbildungen haben aus biologischer Sicht zum einen einen adaptiven Wert (sie bieten einen Überlebensvorteil), zum anderen dienen sie der individuellen Bedürfnisbefriedigung (Instrumentalität). Dem sozialen Identitätsansatz (Turner et al., 1987) zufolge ist eine notwendige Bedingung für die Gruppenbildung die Wahrnehmung der eigenen Person und Anderer als gleiche Elemente einer sozialen Kategorie. Die Kategorisierung beruht auf Vergleichsprozessen hinsichtlich salienter Dimensionen, bei der einander ähnliche Elemente (Personen, Objekte) derselben Kategorie zugeordnet werden. Die soziale Identität ist der Teil der Selbstdefinition, der aus der Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen bzw. sozialen Kategorien entsteht, ohne soziale Kategorien gibt es also keine soziale Identität. Das individuelle Verhalten der Gruppenmitglieder wird durch soziale Normen koordiniert. Soziale Normen sind von den Gruppenmitgliedern konsensual geteilte Erwartungen, sie beziehen sich darauf, wie man sich als Gruppenmitglied in bestimmten sozialen Situationen verhalten sollte (und wie nicht), bzw. welche Einstellungen, Meinungen und Gefühle sozial (un-)angemessen sind, das Befolgen dieser Erwartungen wird in vorhersehbarer Weise positiv, die Abweichung negativ sozial sanktioniert und Normen sind sozial (gesellschaftlich oder kulturell) bedingt und variieren daher zwischen Gruppen (Gesellschaften oder Kulturen). Soziale Normen dienen folgenden Funktionen: Der Gruppenlokomotion (sie gewährleisten Übereinstimmungen), der Aufrechterhaltung der Gruppe, der Interpretation der sozialen Wirklichkeit und der Definition der Beziehungen zur sozialen Umwelt. Während soziale Normen definieren, wie sich Gruppenmitglieder im Allgemeinen zu verhalten haben, definieren soziale Rollen, wie Menschen sich verhalten sollen, die eine bestimmte Position innerhalb einer Gruppe (oder im weiteren Sinne einer Gesellschaft) inne haben (z.B. Berufsrollen, Geschlechtsrollen). Die Gruppensozialisation vollzieht sich nach Moreland und Levine (1982) in folgenden fünf Phasen: Aus der Perspektive des Individuums,: 1. Erkundung - das Individuum sucht nach einer Gruppe, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen; 2. Sozialisation - das Individuum versucht Veränderungen der Gruppe herbeizuführen, die die persönliche Bedürfnisbefriedigung optimieren; 3. Aufrechterhaltung Individuum und Gruppe handeln Veränderungen in Bezug auf die Rolle oder Position des Individuums in der Gruppe aus, die dem Erreichen der individuellen Bedürfnisbefriedigung dienen; 4. Resozialisierung - das individuelle Interesse an der Gruppenmitgliedschaft lässt nach, wenn die erhoffte Befriedigung individueller Bedürfnisse ausbleibt oder es attraktivere Alternativen gibt, die Resozialisierung erfolgt als Reaktion auf einen befürchteten Ausschluss aus der Gruppe (bei persönlicher Bedeutsamkeit der Gruppenmitgliedschaft für das Individuum), andernfalls tritt das Individuum aus der Gruppe aus und 5. der Erinnerung - das Individuum bewertet die Beziehung zur Gruppe und wahrt einen gewissen Kontakt zur Gruppe, sofern diese Bewertung positiv ausfällt. Gruppensozialisation aus der Perspektive der Gruppe: 1. Erkundung - die Gruppe sucht Individuen, die bei der Erreichung von Gruppenzielen hilfreich sein können; 2. Sozialisation - das Individuum wird derart beeinflusst, dass sein Beitrag zum Erreichen der Gruppenziele sich möglichst steigert und es sich den Regeln und Normen der Gruppe anpasst, 3. Aufrechterhaltung - die Gruppe versucht das Individuum durch Verhandlungen zur Übernahme bestimmter Rollen oder Positionen zu bewegen, die dem Erreichen der Gruppenziele dienlich sind, 4. Resozialisierung - wird die Erwartung der Gruppe an das Individuum enttäuscht, lässt die Festlegung der Gruppe auf das Individuum nach; Abweichler, die sich den Gruppennormen nicht anpassen wollen, werden Gruppendruck ausgesetzt, der zu ihrer Resozialisierung führen kann oder sie dazu zwingt, die Gruppe zu verlassen und 5. Erinnerung - die Mitgliedschaft des Individuums in der Gruppe wird rückblickend bewertet und ein gewisser Kontakt wird gewahrt, sofern die Bewertung positiv ausfiel. Sozialer Einfluss Unter Konformität wird die Veränderung individueller Verhaltensweisen, Überzeugungen, Einstellungen etc. infolge sozialer Beeinflussung durch eine numerische Majorität (Mehrheit) der Gruppenmitglieder verstanden. Die individuellen Positionen werden infolge des Einflusses an die Majoritätsposition angepasst. Konformität wird auf zwei unterschiedliche soziale Einflussprozesse zurückgeführt: informationalen (also dem Einfluss, der darauf beruht, dass man die von der Majorität der Gruppenmitglieder vertretenen Überzeugungen, Einstellungen etc. als angemessene Interpretationen der Realität akzeptiert) und normativen Einfluss (er beruht darauf, dass man die Erwartungen anderer Gruppenmitglieder erfüllen und negative Sanktionen bei normabweichendem Verhalten vermeiden möchten). Wenn Menschen sich in öffentlichen Situationen normenkonform verhalten, ohne dass sie die entsprechende Norm privat akzeptieren, wird dies als Compliance bezeichnet (siehe Asch, 1956). Folgende situative Bedingungen begünstigen Konformität aufgrund normativen Einflusses: 1. Interdependenz (also der Abhängigkeit der Gruppenmitglieder untereinander), 2. der Größe der Majorität (es bedarf jedoch keiner zahlenmäßig extrem überlegenden Majorität), 3. der Unabhängigkeit der Quellen (Wilder, 1977) und 4. der Einstimmigkeit der Majorität (andere Abweichler mindern den Konformitätsdruck). Am Beispiel der pluralistischen Ignoranz kann gezeigt werden, wie situative Bedingungen den informationalen Einfluss begünstigen: In Situationen, in denen sich Menschen unsicher bezüglich eines Sachverhalts sind, orientieren sie sich an anderen Personen. Im Falle der pluralistischen Ignoranz wird das Verhalten Anderer Anhaltspunkt für das verunsicherte Individuum und sein eigenes Verhalten, d.h. reagiert niemand merklich auf einen bestimmten uneindeutigen Reiz in der Umwelt, dient dies als Signal für eine unsichere Person, dass keine Reaktion auf diesen Reiz notwendig ist. Situationen, in denen womöglich Hilfe geleistet werden könnte, werden somit unter Berücksichtigung des "Nichtreagierens" anderer Personen als verhaltensirrelevant wahrgenommen. John Turner (1991) hat in seiner Analyse sozialer Einflussprozesse auf der Basis der von ihm und seinen Kollegen entwickelten Selbstkategorisierungstheorie auf einen weiteren Punkt hingewiesen: Seiner Analyse zufolge sollte es insbesondere dann zu sozialem Einfluss kommen, wenn zum einen die Einflussquelle(n) als Mitglied(er) der Eigengruppe wahrgenommen werden (Einflussversuche von Fremdgruppenmitgliedern sollten hingegen zurückgewiesen werden) und zum anderen die Position der Quelle(n) relativ prototypisch für die Eigengruppe ist (d.h. sie ist typisch für die Eigengruppe, aber wenig typisch für die Fremdgruppe). Milgram befasste sich 1974 mit dem Phänomen, dass auch ein "Durchschnittsmensch" dazu gebracht werden kann, einer Autorität Folge zu leisten, selbst wenn das Verhalten eklatant gegen eigene Werte und Überzeugungen verstößt. Dies lässt sich durch den normativen Einfluss (autoritäre Versuchsleiter), den informationalen Einfluss (Expertenstatus des Versuchsleiters) und der Selbstrechtfertigung (wenn die Versuchspersonen ja ursprünglich mal zugestimmt haben) erklären. Es gibt jedoch auch Bedingungen, die den Gehorsam gegenüber Autoritäten unterminieren. Dies sind eine verringerte Distanz zum "Opfer", eine fragliche Legitimität der Autoritätsperson oder wenn andere Personen den Gehorsam verweigern. Moscovici entwickelte 1976 eine Theorie zum Minoritätseinfluss. Dieser Theorie zufolge ist der Minoritätseinfluss eine entscheidende Triebkraft für Innovation und sozialen Wandel innerhalb von Gruppen und Gesellschaften (Majoritäten sorgen hingegen eher für Stabilität und Traditionalismus). Die Wirksamkeit von Minoritätseinfluss hängt Moscovicis Theorie zufolge entscheidend vom Verhaltensstil der Minorität ab: Eine Minorität wird insbesondere dann erfolgreich (informationalen) sozialen Einfluss ausüben, wenn sie ihren abweichenden Standpunkt konsistent vertritt d.h., wenn sie ihre Position einstimmig und über die Zeit hinweg aufrechterhält. Entscheiden und Arbeiten in Gruppen Robert Zajonc (1965) zufolge hängt es maßgeblich von der Art der Aufgabe ab, die eine Person in Anwesenheit anderer bearbeitet, ob es durch die bloße Anwesenheit anderer Personen zu einer Leistungssteigerung oder zu einer Leistungsminderung im Vergleich zu Situationen, in denen die Person die Aufgabe allein bearbeitet, kommt. Bei der Bearbeitung leichter oder hoch überlernter Aufgaben sollte die bloße Anwesenheit anderer zu einer Leistungssteigerung führen (soziale Erleichterung). Bei Aufgaben, die komplex oder neu sind oder deren Bewältigung noch nicht gut erlernt wurde, sollte sich die Anwesenheit anderer hingegen negativ auf die Leistung auswirken (soziale Hemmung). Gründe hierfür sind zum einen der Aspekt, dass die Anwesenheit anderer aufgrund verschiedener Faktoren (biologische, Bewertungsangst, Ablenkung) zu gesteigerter Erregung kommt. Diese erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine dominante (d.h. stark überlernte) Handlung auszuführen. Bei einfachen Aufgaben führt dies eher zu sozialer Erleichterung (Leistungssteigerung), bei komplexen Aufgaben, bei denen eine automatisierte Reaktion in der Regel nicht den erwünschten Erfolg bringt, folgt daraus eher soziale Hemmung (Leistungsminderung). Gruppenpolarisation meint die Tendenz, Gruppenpositionen nach erfolgter Diskussion in Richtung einer extremeren Position zu verschieben. Die Verschiebung erfolgt in die von der Majorität der Mitglieder favorisierte Richtung. Die Anpassung anderer an diese Meinung geschieht aufgrund einer einfachen Heuristik (Mehrheit hat meist recht) oder aufgrund folgender Faktoren: Majoritätsargumente sind zahlreicher (Hinsz & Davis, 1984), sie werden häufiger diskutiert (Stasser & Stewart, 1992), werden von mehr unabhängigen Quellen vertreten und Majoritätsargumente werden überzeugender präsentiert. Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Unentschlossene oder Gemäßigte sich überzeugen lassen und die durchschnittliche Meinung der Gruppe polarisiert. Ein defizitärer Entscheidungsprozess in hoch-kohäsiven Gruppen, bei dem das Streben nach einer konsensual geteilten Entscheidung derart im Vordergrund steht, dass relevante Fakten und mögliche Handlungsalternativen nicht berücksichtigt werden, wird nach Janis (1972) Gruppendenken genannt. Er wird durch folgende Bedingungen gefördert: Extrem hohe Gruppenkohäsion, Abschottung der Gruppe von externen Informationsquellen, Mangel an verbindlichen Prozeduren oder Normen, die eine systematische Berücksichtigung relevanter Fakten fördern, Direktive Führung, die den Druck zur Konformität erhöht. (Mitglieder, die eine andere Meinung vertreten, passen sich aus Angst vor Sanktionierung der vorherrschenden Meinung an und hoher Stress (z.B. Zeitdruck, äußere Bedrohung). Der unter solchen Bedingungen erzielte Konsens ist eine Illusion: Er reflektiert weder die Konvergenz unterschiedlicher Standpunkte noch gibt er die privaten Überzeugungen der Gruppenmitglieder wider. Hilfreich sind u. a. folgende Maßnahmen: die Führungsperson sollte bei der Entscheidungsfindung keine direktive Rolle einnehmen, sie sollte die Diskussion so strukturieren, dass alle relevanten Informationen, die einzelnen Mitgliedern vorliegen, mit der Gruppe geteilt werden, sie sollte zur Diskussion von abweichenden Positionen ermutigen, sie sollte die Meinung externer Experten zum Thema einholen und Abstimmungen über die endgültige Entscheidung sollten geheim, statt öffentlich stattfinden. Gruppenarbeit wird häufig eingesetzt, weil man sich davon eine Leistungssteigerung erhofft. Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Effizienz von Gruppenarbeit resultiert aus dem Vergleich des Gruppenpotenzials - also der Leistung, die aufgetreten wäre, wenn die Gruppenmitglieder unabhängig voneinander und nicht als Gruppe an der Aufgabe gearbeitet hätten - mit der tatsächlichen Gruppenleistung. Nach Steiner (1972) kann man Gruppenaufgaben in drei Typen unterteilen: 1. Additive Aufgaben (z.B. Schneeschaufeln), 2. Disjunktive Aufgaben (z.B. Problemlösen - beste individuelle Leistung) und 3. Konjunktive Aufgaben (z.B. Staffellauf - schwächste individuelle Leistung).Nach Hackman und Morris (1975) kann man folgende Formel aufstellen: Tatsächliche Gruppenleistung = Gruppenpotenzial minus Prozessverluste plus Prozessgewinne. Prozessverluste können Koordinationsverluste oder Motivationsverluste sein. Zu Koordinationsverlusten kommt es, wenn eine Gruppe nicht in der Lage ist, die individuellen Beiträge ihrer Mitglieder zur Zielerreichung optimal zu koordinieren. Dies kann u. a. folgende Gründe haben: Die Aufgabenverteilung innerhalb einer Gruppe ist unklar, die individuellen Stärken und Schwächen individueller Mitglieder wurden bei der Zuweisung von Aufgaben und Positionen nicht angemessen berücksichtigt oder die Kommunikationsstrukturen und Arbeitsabläufe innerhalb der Gruppe sind ineffektiv. Drei Prozesse, die zu Motivationsverlusten bei der Gruppenarbeit führen können, sind soziales Faulenzen (wenn individuelle Arbeitsbeiträge nicht zuzuordnen sind), soziales Trittbrettfahren (wenn der Eindruck entsteht, dass bereits genug andere Personen für das gemeinsame Ziel arbeiten) und der Trotteleffekt (wenn angenommen wird, dass andere Gruppenmitglieder nur wenig leisten und befürchtet wird, man selbst werde ausgenutzt, siehe Kerr, 1983). Bei additiven Aufgaben in großen Gruppen können potenziell alle drei Prozesse zur Leistungsminderung führen. Bei disjunktiven und konjunktiven Aufgaben ist das soziale Faulenzen typischerweise weniger wahrscheinlich, da die individuellen Beträge identifizierbar sind. Dafür kann je nach spezifischer Aufgabe ein erhöhtes Risiko für Trittbrettfahren und Trotteleffekte bestehen. Laut Baron & Kerr (2003) spielen folgende Prozesse bei Motivationsgewinnen eine Rolle: Sozialer Wettbewerb (bei leicht identifizierbaren Leistungen strengen sich die Mitglieder mehr an), Soziale Kompensation (stärkere Mitglieder strengen sich mehr an, um Defizite schwächerer Mitglieder auszugleichen) oder der Köhler-Effekt (bei leicht identifizierbaren Leistungen strengen sich schwächere Mitglieder mehr an, um nicht verantwortlich für schlechte Ergebnisse zu sein). Unter Führung wird ein Prozess der sozialen Einflussnahme verstanden, durch den ein oder mehrere Mitglieder einer Gruppe andere Gruppenmitglieder motivieren und befähigen, etwas zur Erreichung der Gruppenziele beizutragen. Stehen die Persönlichkeitseigenschaften, Fertigkeiten und Verhaltensweisen von Führungspersonen im Vordergrund spricht man von führerorientierten Ansätzen. Kontingenzansätze gehen davon aus, dass die Effektivität von Führung aus einem Zusammenspiel von Merkmalen der Führungsperson und Merkmalen der Führungssituation resultiert. Einer der bekanntesten Kontingenzansätze wurde von Fred Fiedler entwickelt (s. z.B. Fiedler, 1971). Das Modell unterscheidet zwei Führungsstile (aufgabenorientiert und beziehungsorientiert). Es wird angenommen, dass keiner der beiden Stile per se effektiver ist, Effektivität hängt eher von Merkmalen der Führungssituation ab. Hierfür sind folgende Merkmale relevant: Merkmale der Gruppenaufgabe (komplex oder einfach), Merkmale der Beziehung (Vertrauen zwischen Führungsperson und Geführten) und den Machtmitteln der Führungsperson. Effektive Führung bedeutet Erkennen der relevanten Merkmale der Situation und Reaktion mit entsprechend eher aufgaben- oder beziehungsorientierter Führung. Der Begriff "Respekt" in der Literatur zu intragruppalen Kooperationsprozessen meint eine faire und wohlwollende Behandlung durch andere Gruppenmitglieder. Er signalisiert den Status eines gleichberechtigten Gruppenmitglieds. Respektvolle Behandlung führt im Vergleich zur disrespektvollen Behandlung zu einer Steigerung der sozialen Identifikation mit der Gruppe und zu einer gesteigerten Kooperationsbereitschaft. Dieser Effekt war unabhängig von der expliziten Bewertung. Tatsächlich förderte eine respektvolle Behandlung die soziale Identifikation und die Kooperationsbereitschaft auch unter der Bedingung, dass die Vorschläge von den Anderen negativ bewertet worden waren. Für die Vpn war also die Art und Weise der Behandlung innerhalb der Gruppe (respektvoll vs. disrespektvoll) wichtiger als das konkrete Ergebnis (eine positive oder negative Bewertung). Mediationsanalysen bestätigten zudem, dass der Effekt wahrgenommenen Respekts auf die Kooperationsbereitschaft über die Stärkung der Identifikation mit der Gruppe vermittelt wurde (s. Stürmer et al., 2003). Vorurteile und Konflikte zwischen Gruppen Stereotype sind sozial geteilte Überzeugungen bezüglich der Attribute, Eigenschaften, Verhaltensweisen etc., hinsichtlich derer die Mitglieder einer Gruppe einander ähneln. Hervorzuheben ist, dass es sich bei Stereotypen nicht um individuelle, sondern um sozial geteilte Überzeugungen handelt - Stereotype sind also soziale und keine individuellen (oder idiosynkratischen) Konstruktionen. Stereotype über Fremdgruppen werden als Heterostereotype bezeichnet; Stereotype über die Eigengruppe nennt man Autostereotype. Selbststereotypisierung bezeichnet den Prozess der Definition des eigenen Selbst im Sinne der stereotypischen Merkmale, Eigenschaften von Eigengruppenmitgliedern. Vorurteile sind positive oder negative Bewertung einer sozialen Gruppe und ihrer Mitglieder aufgrund der ihr zugeschriebenen Merkmale, der mit der Gruppe assoziierten Affekte und verhaltensbezogener Informationen. Unter Sozialer Diskriminierung wird die Ablehnung oder Benachteiligung von Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit verstanden. Soziale Diskriminierung kann als isolierter Verhaltensakt, als Verhalten zwischen Gruppen und in institutionalisierter Form auftreten. Stigmata sind negativ bewertete Attribute, die als Abweichung von der Norm wahrgenommen werden und die deren Träger die gesellschaftliche Gleichberechtigung kosten. Stigmatisierung ist auch eng mit dem Begriff der Diskriminierung verbunden (Verhaltensaspekt). Die diskreditierenden Reaktionen auf ein Stigma lassen sich in der Regel nicht allein durch das spezifische Attribut erklären, sondern sie resultieren aus den mit dem Stigma assoziierten Stereotypen und Vorurteilen bezüglich der Identität oder des Charakters der Merkmalsträger. Das Akzentuierungsprinzip (Tajfel & Wilkes, 1963) stellt die Grundlage für die wahrgenommene Homogenität von Fremdgruppen dar. Einerseits werden die Unterschiede der Stimuli innerhalb einer Kategorie unterschätzt - man bezeichnet dies als Assimilation. Andererseits werden die Unterschiede zwischen Stimuli unterschiedlicher Kategorien überschätzt, dies wird als Kontrastierung bezeichnet. Experimente mit dem "Who said what?"-Paradigma (Taylor et al, 1978) demonstrieren, wie spontan aktivierte soziale Kategorien Wahrnehmung und Erinnerung im Sinne von Assimilation und Kontrastierung beeinflussen. Verwechslungen innerhalb der Kategorien traten überzufällig häufig auf, Fehler zwischen den Kategorien wurden vergleichsweise seltener gemacht. Nach Tajfel (1981) erfüllen Stereotype folgende soziale Funktionen: positive Differenzierung (also der Herstellung positiver Distinktheit), kausale Erklärungen und der sozialen Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen gegenüber Fremdgruppenmitgliedern. Nach der System-Justification-Theory von Jost et al (2004) werden ungleiche Statusbeziehungen zwischen Gruppen durch sog. legitimierende Mythen unterstützt, die von den Mitgliedern statushoher und statusniedriger Gruppen gleichermaßen akzeptiert werden, also innerhalb einer Gesellschaft weitgehend geteilte Überzeugungssysteme, die dazu dienen, bestehende Status- und Machtunterschiede zwischen Gruppen zu rechtfertigen. Soziale Repräsentationen sind sozial geteilte Meinungen und Vorstellungen über bestimmte Sachverhalte innerhalb einer Gesellschaft (Krankheiten, politische Systeme, wissenschaftliche Disziplinen etc.), die innerhalb einer Gesellschaft oder Gruppe in sozialen Diskursen konstruiert werden. Soziale Repräsentationen von Krankheiten zum Beispiel sind eine Komposition aus dem vorherrschenden medizinischen Expertenwissen sowie Alltagsvorstellungen und kulturellen oder religiösen Überzeugungen. Sie beinhalten auch eine Zuschreibung von Verantwortlichkeit für die Erkrankung, eine moralische Komponente, die direkte Implikationen für den Umgang mit den Betroffenen hat. Werden die Betroffenen als Opfer der Erkrankung gesehen, erfahren sie üblicherweise Mitgefühl und Solidarität; wird ihnen eigene Verantwortung zugeschrieben, ist es hingegen wahrscheinlicher, dass sie zur Zielscheibe moralischer Entrüstung werden und ihnen notwendige Unterstützung verwehrt wird. Soziale Repräsentationen dienen einer Reihe von sozialen Funktionen: Erklärungs- und Kommunikationsfunktion, Koordinationsfunktion und einer Legitimationsfunktion. Für die soziale Akzeptanz der Deutungen und Interpretationen sind zwei Prozesse besonders relevant: 1. Verankerung, worunter die Integration der neuen Vorstellungen in bereits bestehende Vorstellungssysteme zu verstehen ist und 2. Vergegenständlichung, was die Umwandlung eines abstrakten Konzepts in konkrete und verständliche Bilder oder Metaphern beinhaltet. Das Stereotype-Content-Model von Fiske, Cuddy, Glick und Xu (2002) macht spezifische Vorhersagen darüber, welche Merkmale Fremdgruppenmitgliedern in Abhängigkeit von spezifischen Charakteristika der Intergruppenbeziehung zugeschrieben werden. Fiske et al. konzentrieren sich dabei auf zwei inhaltliche Dimensionen: Wärme und Kompetenz. Die Zuschreibung entsprechender Eigenschaften hängt dem Modell zufolge von zwei Charakteristika der Intergruppenbeziehung ab: 1. Intergruppaler Wettbewerb. Fremdgruppen, mit denen die Eigengruppe konkurriert, sollten als wenig warm wahrgenommen werden. Ist die Beziehung hingegen durch Kooperation geprägt, sollten die Mitglieder der Fremdgruppe als relativ warm wahrgenommen werden. 2. Statusverhältnis zwischen Eigen- und Fremdgruppe. Während Mitglieder statusniedriger Gruppen als inkompetent wahrgenommen werden sollten, sollten Mitglieder statushoher Fremdgruppen als relativ kompetent angesehen werden. Die Kombination hoher und niedriger Ausprägungen auf den Merkmalsdimensionen Wärme und Kompetenz führt zur Unterscheidung von vier inhaltlich distinkten Typen von Stereotypen: Paternalistische Stereotype (hohe Wärme, niedrige Kompetenz) Bewundernde Stereotype (hohe Wärme, hohe Kompetenz) Verächtliche Stereotype (niedrige Wärme, niedrige Kompetenz) Neidvolle Stereotype (niedrige Wärme, hohe Kompetenz) Nach Devine (1989) werden Stereotype zunächst automatisch aktiviert, wenn ein relevanter Auslösereiz vorhanden ist (sie sind kognitiv gut zugänglich, also leicht abrufbar). Diese automatische Aktivierung unterliegt nicht der bewussten Kontrolle. Es folgt ein kontrollierter Verarbeitungsprozess, bei dem Verhaltensimpulse oder automatisch aktivierte Stereotype modifiziert oder unterdrückt werden können. Voraussetzungen für die Wirksamkeit des kontrollierten Prozesses sind zum einen die Motivation einer Person, den Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen zu kontrollieren und zum anderen die Verfügbarkeit notwendiger kognitiver Ressourcen. In einer Untersuchung zum Einfluss automatischer und kontrollierter Reaktionen gegenüber stigmatisierten Personen bestätigten die Analysen von Pryor et al. (2004), dass eine nachträgliche Anpassung der Verhaltensreaktion um so stärker ausgeprägt war, je höher die Motivation war, ihre Vorurteile gegenüber Menschen mit einem Stigma zu kontrollieren. Wenn Menschen motiviert sind, ihre Vorurteile zu kontrollieren, korrigieren sie spontane negative Impulse und zeigen positive Verhaltensreaktionen. Diese Korrekturreaktion ist allerdings ein relativ anspruchsvoller Prozess, der Zeit braucht und das Bewusstsein eigener Vorurteile voraussetzt. In Situationen, in denen diese Voraussetzungen nicht bestehen, wird ein offener Ausdruck der negativen Einstellung wahrscheinlicher. Es gibt u. a. zwei potentielle sozialpsychologische Konsequenzen für die Betroffenen zu einer stigmatisierten Gruppe zu gehören: 1. Effekte auf das Selbstwertgefühl und die Gesundheit und 2. Effekte auf Leistung und Berufswahl. Es gibt eine Reihe von Hinweisen darauf, dass Mitglieder sozial abgewerteter sozialer Gruppen dazu tendieren, die negativen Eigenschaften, die ihrer Gruppe innerhalb der weiteren Gesellschaft zugeschrieben werden, zu internalisieren (Tajfel, 1981). Kurt Lewin (1941) hat für diesen Prozess den Begriff Selbsthass geprägt, der aus der Übernahme des Fremdhasses resultiert. Einige Untersuchungen zeigen, dass Mitglieder stigmatisierter Gruppen im Vergleich zu Mitgliedern nicht-stigmatisierter Gruppen ein höheres Risiko aufweisen, an Selbstwertminderung, Depressionen oder Herz-Kreislaufkrankheiten zu erkranken (z.B. Jackson et al, 1996). Forschungsarbeiten zum Ablehnungs-Identifikationsmodell (Branscombe et al, 1999) legen jedoch auch nahe, dass der negative Effekt wahrgenommener Diskriminierung auf das Selbstwertgefühl durch eine starke Identifikation mit der Eigengruppe abgepuffert oder kompensiert werden kann. Hoch identifizierte Gruppenmitglieder sind besser in die Gruppe eingebunden, sie haben daher bessern Zugang zur Unterstützung durch andere Gruppenmitglieder, bekommen sie eher angeboten und sind eher bereit, sie zu akzeptieren. Von Selbstwertminderung bedroht sind daher insbesondere Personen, die sich nur gering mit ihrer Gruppe identifizieren, gleichzeitig aber von Mitgliedern der Fremdgruppe aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit diskriminiert werden. Der Stereotype-Threat-Theorie (Steele et al, 1995) zufolge löst die Befürchtung, zu einer sozial abgewerteten Gruppe zu gehören ein Gefühl der Bedrohung aus, was wiederum zu einer Leistungsminderung führen kann. Mitglieder einer sozial abgewerteten Gruppe entscheiden sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gegen die Wahl von Berufen oder Positionen, in denen sie die Konfrontation mit negativen Stereotypen befürchten müssen. Diese Selbstselektionsmechanismen sind aus gesellschaftspolitischer Sicht hochrelevant, da sie im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zur Aufrechterhaltung von Statusunterschieden zwischen Gruppen beitragen (Keller et al, 2003). Gemäß der Theorie des realistischen Gruppenkonflikts (Sherif, 1966) verändern sich Einstellungen und Verhalten der Eigengruppe gegenüber einer Fremdgruppe in Abhängigkeit der Vereinbarkeit der Eigengruppen- und Fremdgruppeninteressen. Negative Interdependenz liegt vor, wenn beide Gruppen um dieselben knappen Ressourcen konkurrieren und somit ein Zugewinn der einen Gruppe einen Verlust der anderen Gruppe bedeutet. Daraus resultieren negative Einstellungen und entsprechendes Verhalten. Relative Deprivation ist die Wahrnehmung, weniger zu haben als einem zusteht, die mit einem Gefühl der Unzufriedenheit einhergeht. Eine wichtige Quelle relativer Deprivation ist der soziale Vergleich. Egoistische relative Deprivation resultiert aus interpersonalen Vergleichen. Fraternale relative Deprivation resultiert hingegen aus intergruppalen Vergleichen (Walker & Smith, 2002). Die fraternale relative Deprivation spielt bei der Erklärung für Intergruppenkonflikten eine wichtige Rolle. Tajfel (1971) benutzte in seinem Experiment das Minimal-Group-Paradigma (keine Face-to-FaceInteraktion, keine Identifikationsmöglichkeit von Eigen- und Fremdgruppenmitgliedern, keine Verbindung zwischen Gruppeneinteilung und Aufgabe, kein persönlicher Vorteil durch die Zuteilung zu einer Gruppe). Dort entdeckte er eine systematische Tendenz zur Bevorzugung von Eigengruppenmitgliedern. Jedoch nicht im Sinne eines maximalen Eigengruppengewinns, sondern im Sinne einer maximalen Eigen-Fremdgruppendifferenzierung. Menschen streben im Allgemeinen nach einem positiven Selbstbild. Dementsprechend streben sie auch nach einer positiven sozialen Identität. Menschen ermitteln der Theorie der sozialen Identität nach den Wert oder das Prestige ihrer Eigengruppe durch soziale Vergleiche mit anderen Gruppen. Menschen sind daher bemüht, die Eigengruppe auf relevanten Vergleichsdimensionen in positiver Richtung von anderen Gruppen zu unterscheiden, bzw. positive Distinktheit herzustellen. Formen der sozialen Diskriminierung, wie sie in basaler Form in minimalen Gruppenexperimenten zu beobachten sind, lassen sich dieser Perspektive zufolge als eine Strategie verstehen, eine positive soziale Identität herzustellen. Resultiert aus den Vergleichsprozessen eine negative soziale Identität, kann das Individuum folgende Strategien anwenden: 1. Soziale Mobilität (Aufstieg nur bei durchlässigen Grenzen möglich und bei einer geringen Identifikation mit der Ursprungsgruppe. Mobilität kann durch ein Verlassen oder durch ein aktives Verbergen versucht werden). 2. Soziale Kreativität (Wahl neuer Vergleichsdimensionen, Reinterpretation der Vergleichsergebnisse oder Wechsel der Vergleichsgruppe. Diese Strategie wird bei stabilen Statusrelationen und undurchlässigen Gruppengrenzen gewählt, sie ändert die in der Gruppe geteilte Definition sozialer Identität, aber nicht die objektive Position der Gruppe in der Statushierarchie). 3. Sozialer Wettbewerb (bei instabilen Statusrelationen und undurchlässigen Gruppengrenzen gewählt. Ziel des sozialen Wettbewerbs ist sozialer Wandel, also der Verbesserung der objektiven Position der Gruppe in der Statushierarchie. Formen des sozialen Wettbewerbs unterscheiden sich je nach Kontext und Gegenreaktion der Fremdgruppe, sie beinhalten jedoch Potential für offene Intergruppenkonflikte und gewalttätige Auseinandersetzung). Verringerung von Vorurteilen und Feindseligkeiten zwischen Gruppen durch Kontakt Nach Allport (1954) kann Kontakt zwischen Gruppen zu einer Reduktion von Vorurteilen führen. Dazu müssen aber bestimmte Kontaktbedingungen erfüllt sein: 1. Gemeinsame übergeordnete Ziele (gemeint sind solche Ziele, die von beiden Gruppen angestrebt werden und nur durch gemeinsame Anstrengung auch erreicht werden können) 2. Kooperation (z.B. die Jigsaw-Methode von Aronson & Patnoe, 1997) 3. Gleicher Status in der Kontaktsituation 4. Autoritäten, Normen und Gesetze (unterstützen den Abbau von Vorurteilen) 5. Pettigrew ergänzte die Liste um Freundschaftspotential Pettigrew (1998) schlägt vier vermittelnde psychologische Prozesse vor, die unter optimalen Kontaktbedingungen zur Veränderung der Einstellung gegenüber Fremdgruppenmitgliedern beitragen: Wissenserwerb, Verhaltensänderung, Bindungsaufbau (und damit Reduktion der Intergruppenangst) und die Neubewertung der Eigengruppe (durch Deprovinzialisierung, also der Entwicklung einer neuen Perspektive, die eine Betrachtung der Eigengruppennormen, Werte und Sitten als nur eine Alternative unter vielen ermöglicht. Der Verlust des Alleinigkeitsanspruchs führt zu einer offeneren und respektvolleren Haltung gegenüber Fremdgruppen im Allgemeinen). Unter Generalisierung wird die Übertragung von positiven Kontakterfahrungen auf die gesamte Fremdgruppe verstanden. Es gibt mehrere sozialpsychologische Prozesse, die der Generalisierung von Kontakterfahrungen entgegenstehen: 1. Wegerklären, das heißt, dass ein positives und den Stereotypen widersprechendes Verhalten wegerklärt oder uminterpretiert wird und daher nicht zu einer Veränderung der Stereotype gegenüber der Gesamtgruppe, sondern sogar zu ihrer Bestätigung führt (Nadler et al, 2006). 2. Substereotypisierung - Subtypisierung bezeichnet den Prozess, durch den Gruppenmitglieder, deren Eigenschaften und Verhaltensweisen dem Stereotyp nicht entsprechen, mental in einer Unterkategorie der sozialen Kategorie zusammengefasst werden (Maurer, Park, & Rothbart, 1995). 3. Kontrastierung - als Regel von der Ausnahme. Pettigrew hat 1998 in seiner Reformulierung der Kontakthypothese die Modelle der Detkategorisierung (Brewer et al, 1984), der wechselseitigen Differenzierung (Hewstone et al, 1986) und der Rekategorisierung (Gaertner et al, 2000) berücksichtigt um eine idealtypische zeitliche Sequenz für eine optimale Wirkung von Kontakt zu entwickeln. 1. Initialer Kontakt: Durch Prozesse der Dekategorisierung soll erreicht werden, dass die Personenwahrnehmung von einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit weg zu einer individuellen Wahrnehmung anderer als Personen und nicht als Gruppenmitglieder verändert wird. Dies könnte z.B. durch die Bildung von gruppenübergreifenden Projektteams gefördert werden. 2. Etablierter Kontakt: Durch Schaffung von positiven Interdependenzsituationen (Stichwort: Kooperation) soll die Gruppenzugehörigkeit wieder in den Fokus rücken, damit es nicht zu Prozessen der Substereotypisierung oder Kontrastierung kommt. 3. Gemeinsame Gruppe: nach dem Common-Ingroup-Identity-Modell von Gaertner et al (2000) kann es durch eine Rekategorisierung zu dem Gefühl einer gemeinsamen größeren Gruppe kommen. Die Rekategorisierung hat also das Ziel, die kategoriale Wahrnehmung hin zu einer inklusiveren Variante zu verändern, die die ursprüngliche Eigengruppe und die Fremdgruppe umfasst. Das Vorhandensein der Kontaktbedingungen nach Allport zeigt aufgrund einer Meta-Analyse von Pettigrew (2006) sich nicht als notwendige Bedingungen, jedoch unbedingt als förderliche. Auch individuelle Erfahrungen und Eigenschaften liegen im Vorfeld des eigentlichen Ablaufes und bestimmen den Prozess mit. Interventionsmaßnahmen müssen auch die kollektiven und strukturellen Ursachen von Intergruppenkonflikten mit berücksichtigen. Dies verhindert eine Verschleierung weiterhin bestehender Ungerechtigkeiten durch Scheintoleranz (da die Konzentration auf individuelle Strategien soziale Veränderungen erschweren). Benachteiligte Gruppen müssen in ihren kollektiven Strategien gefördert werden, um strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. Soziale Bewegungsbeteiligung Eine Soziale Bewegung besteht aus einer großen Anzahl von Personen, die sich selbst als Gruppe definieren und von anderen so definiert werden. Ziel sozialer Bewegungen ist es, ein gemeinsames soziales oder politisches Problem zu lösen. Dabei setzen sie unterschiedliche Formen des politischen Protests ein. Nach Klandermanns (1997) können Strategien der Mitglieder sowohl nach innen, als auch nach außen gerichtet sein, wobei sie moderate oder militante Methoden einsetzen können. Die Partizipation kann ein einmaliger Verhaltensakt sein, der wenig Aufwand oder Kosten beinhalten; sie kann ein einmaliger Verhaltensakt sein, der jedoch sehr kostspielig und risikoreich ist; sie kann zeitlich unbegrenzt sein und wenig Kosten und Aufwand verursachen oder lang andauernd und aufwändig sein. Nach Klandermans muss ein potentieller Bewegungsteilnehmer bis zur Teilnahme an Aktionen einer sozialen Bewegung die folgenden vier Stufen überwinden: Er muss: 1. Teil des Mobilisierungspotentials der sozialen Bewegung werden, er muss also nach Gamson (1992) Teil eines Collective Action Frames sein. Dies meint ein System sozial geteilter Überzeugungen, die als Interpretationshilfe für soziale Problemsituationen herangezogen werden und mit deren Hilfe Reaktionen generiert werden können. Gamson unterscheidet drei Komponenten: a), die Ungerechtigkeitskomponente, also die Interpretation der sozialen Problemsituation als illegitim, b) die Identitätskomponente, also eine relevante soziale Kategorisierung mit Bezug zur Problemsituation durch die Wahrnehmung sozial geteilter Missstände, einer Ursachenzuschreibung auf einen Gegner und der Triangulation der weiteren Gesellschaft und c) eine Handlungskomponente, also der Annahme einer instabilen Statusrelation, in der Veränderung tatsächlich möglich ist und kollektive Wirksamkeitsüberzeugung (Empowermentprozess, Kieffer, 1984) - außerdem Annahmen über die Art und Weise, das Ziel zu erreichen. 2. Ziel werden von Mobilisierungsversuchen, wobei Rekrutierungsnetzwerke insbesondere die enbloc-Rekrutierung erleichtern. Massenmedien haben sich als wenig effektiv erwiesen. 3. Teilnahmemotivation entwickeln. Diese Motive kann man nach Klandermanns als drei verschiedene Typen abhängig von den erwarteten Kosten und Nutzen beschreiben: a) das kollektive Motiv (also resultierend aus einer Analyse aus dem Wert des kollektiven Ziels mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht werden kann), b) dem sozialen bzw. normativen Motiv (bezieht sich auf die Reaktionen anderer) und c) dem Belohnungsmotiv (selektive Anreize) und 4. Teilnahmebarrieren überwinden. Ob ein potentieller Teilnehmer also tatsächlich an einer kollektiven Protestaktion der Bewegung teilnimmt, hängt davon ab, wie er auf derartige Barrieren reagiert bzw. ob er annimmt, er verfüge über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen, um die Barrieren überwinden zu können (Verhaltenskontrolle). Die 4 Stufen durchlaufen teilweise noch nicht einmal 5 % der Personen, die auf Stufe 1 waren. Während die individuelle Identität eine Selbstdefinition auf der Basis individueller Eigenschaften und Interessen widerspiegelt, beruht die kollektive Identität einer Person auf ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Dem sozialen Identitätsansatz zufolge wird das Erleben und Verhalten einer Person in dem Maße im Sinne einer bestimmten Gruppenmitgliedschaft beeinflusst, in dem die soziale Identität relativ zur personalen Identität phänomenal in den Vordergrund tritt (Turner et al., 1987). Soziale Bewegungen konstituieren sich häufig aus den Mitgliedern bereits bestehender Gruppen oder sozialer Kategorien. Dies sollte insbesondere die Generierung und Verbreitung von collective action frames erleichtern (Stufe 1 des Klandermans’schen Models). Da Personen, die sich stark mit ihrer Gruppe identifizieren, eher bereit sind, sich von Mitgliedern ihrer Eigengruppe überzeugen lassen, sollte eine starke kollektive Identität auch die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs von Mobilisierungsversuchen seitens der Initiatoren einer sozialen Bewegung erhöhen (Stufe 2 des Klandermans’schen Models). Überdies ist anzunehmen, dass Personen, die sich stark kollektiv identifizieren, selbst eine aktive Rolle in der Mobilisierung übernehmen, beispielsweise indem sie ihre Freundschaftsnetzwerke aktivieren (Stufe 3 des Klandermans’schen Models). Dies geschieht durch folgende Prozesse: 1. Der Beeinflussung von Kalkulationsprozessen (also solche Kosten bzw. Nutzen, die mit der Gruppenzugehörigkeit in Verbindung stehen, fallen mehr ins Gewicht) und 2. der Internalisierung von Gruppenzielen. Der Politisierung sozialer Identität gehen mehrere Prozesse voraus: Geteilte Missstände werden eher wahrgenommen, die viele Eigengruppenmitglieder betreffen; einem politischen Gegner kann die Ursachen dieser Missstände zugeschrieben werden es erfolgt eine Triangulation der weiteren Gesellschaft. Dann definiert sich eine Person im Sinne dieser politisierten Kategorie, sie richtet sich ihr Handeln verstärkt nach den Gruppeninteressen aus. Simon, Stürmer, & Steffens (2000) haben ein Modell vorgeschlagen, das zwei Wege zur Teilnahmemotivation spezifiziert, zum einen die Kalkulation von Kosten und Nutzen, zum anderen Identifikation mit einer politisierten Gruppe. (bzw. Übernahme einer entsprechenden Aktivistenidentität). Während der Kalkulationsweg im Sinne einer instrumentellen Motivation auf der Grundlage extrinsischer Anreize interpretiert werden kann, reflektiert der Identifikationsweg intrinsische Motivation auf der Grundlage einer inneren Verpflichtung, sich für die Ziele der sozialen Bewegung einzusetzen und dadurch die eigene soziale Identität zu verifizieren (Stürmer et al., 2003; Stürmer & Simon, 2004). Prosoziales Verhalten zwischen Gruppen Intergruppenverhalten ist nicht nur durch Konflikte, Wettbewerb und Konfrontation geprägt, sondern ebenso durch prosoziales Verhalten. Bensen et al. (1976) und Gaertner et al (1971) fanden Belege für eine Fremdgruppendiskriminierung im spontanen Hilfeverhalten. Andere Forscher (z.B. Bickmann, 1973 oder Wispe, 1971) fanden keine Verbindung zwischen Eigen- und Fremdgruppenstatus. Dovido (1981) und Dutton (1973) fanden sogar Belege für eine umgekehrte Diskriminierung. Eine Meta-Analyse von Saucier et al. (2005) erbrachte keine unterschiede im Hilfeverhalten von U.S.amerikanischen Schwarzen und weißen. Es wird vermutet, dass offene Diskriminierung aufgrund veränderter Normen und moralischer Vorstellungen subtiler gezeigt wird. Wenn individuelles Verhalten jedoch nicht als Diskriminierung interpretiert werden kann oder die Situation mehrdeutig genug ist, um das Verhalten durch alternative Erklärungen zu rechtfertigen, wird offene Fremdgruppendiskriminierung wahrscheinlicher. Es gibt aber auch Beispiele für selbstloses Verhalten von Einzelnen oder Gruppen gegenüber Fremdgruppen. Die soziale Kategorisierung einer hilfsbedürftigen Person als Eigen- oder Fremdgruppenmitglied wirkt sich auf die motivationalen Prozesse aus, die Hilfeverhalten zugrunde liegen (siehe Simon et al., 2000 oder Stürmer et. al., 2006). Gegenüber Eigengruppenmitgliedern ist Hilfeleistung (eher) durch Empathie motiviert, interpretierbar als Form echten Altruismus (Batson, 1991). Gegenüber Fremdgruppenmitglieder rücken Kosten-Nutzen Erwägungen in den Vordergrund, man kann von egoistisch motiviertem Helfen sprechen. Bei Eigengruppenmitgliedern wird aufgrund der geteilten Gruppe der Andere als relative ähnlich zum Selbst wahrgenommen. Diese wahrgenommene Ähnlichkeit ist eine mögliche Grundlage für das Gefühl psychologischer Verbundenheit, das der Entstehung einer empathischen Reaktion vorausgeht. Wird Empathie (im Sinne von Mitleid, Mitgefühl) empfunden, so lassen sich Personen im Intragrup- penkontext eher davon leiten und sind motiviert, die Lage einer hilfsbedürftigen Person zu verbessern. Im Intergruppenkontext stehen Unähnlichkeiten zwischen Selbst und anderem im Vordergrund, die Signalfunktion haben und negative Intergruppenemotionen auslösen können, eine empathische Reaktion wird gehemmt, Personen lassen sich nicht oder nicht sehr davon leiten, sondern fällen ihre Entscheidung eher aufgrund von systematischen Informationsverarbeitungsprozessen. Fremdgruppenhelfen kann nach Clary et al. (1998) und Omoto & Snyder (1995) mehrere individuelle Funktionen erfüllen: Es dient der Befriedigung individueller Motive und Bedürfnisse (z.B. dem Ausdruck zentraler Werte, dem Erwerb von Wissen, persönlichem Wachstum und Selbstwertsteigerung, der sozialen Integration, der Steigerung der Berufschancen oder der Ablenkung von eigenen Problemen). Die individuelle Zufriedenheit ist ein kritischer Faktor in der Vorhersage der Dauer der Hilfeleistung (hier des Ehrenamts). Fremdgruppenhelfen hat jedoch auch soziale bzw. kollektive Funktionen. Sie dient der Aufrechterhaltung von Macht- und Statusdifferenzen (Nadler & Halabi, 2006), wenn abhängigkeitsorientierte Hilfe angeboten wird, wird dadurch der Statusunterschied zementiert. bei autonomieorientierter Hilfe jedoch die Statusangleichung. Sie dient aber auch der Aufrechterhaltung positiver sozialer Identität (Stichwort: strategisches Helfen, van Leeuwen, 2007). Politische Akteure können verschiedene Strategien einschlagen, um Mitglieder ihrer Eigengruppe zur Unterstützung einer Fremdgruppe oder gruppenübergreifender Solidarität zu mobilisieren: Sie sollten Konsens über drei Aspekte der sozialen Identitätskonstruktion erzielen: 1. über instrumentelle Interessen (prosoziales Verhalten resultiert in Vorteilen für die Eigengruppe), 2. über Normen und Werte (prosoziales Verhalten ist ein identitätsstiftendes Merkmal der sozialen Kategorie) und 3. über eine (Re)Definition der Gruppengrenzen (prosoziales Verhalten ist tatsächlich auf Eigengruppenmitglieder gerichtet, da die neudefinierte Gruppe inklusiver ist). Sozialpsychologische Vertiefung I: Prosoziales Verhalten – Grundlagen und Fördermöglichkeiten V1T1 Darley & Latanè (1968). Verantwortungsdiffusion beim Einschreiten in Notfallsituationen (Stichwort: Bystander-Effect) Ausgangslage: Fall "Kitty Genovese". Phänomen: Obwohl viele Menschen die Notlage einer Person beobachten, schreitet keiner ein. Zentrale Hypothese: Ob und wann Menschen in Notfallsituationen einschreiten, hängt von der Anzahl der Menschen ab, die ebenfalls Zeuge des Notfalls sind. Theoretische Überlegungen: Das Phänomen kann durch Verantwortungsdiffusion, Diffusion der Schuld oder Rationalisierung erklärt werden. Experiment mit epileptischen Anfall Ergebnisse: 1. Gruppengröße hatte Haupteffekt auf die Wahrscheinlichkeit, ob die Versuchsperson einschreitet, d.h. je mehr Personen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit. 2. Gruppengröße hat Einfluss auf die Geschwindigkeit des Einschreitens, d.h. je mehr Personen, desto langsamer. 3. Gruppenzusammensetzung, Geschlecht und Persönlichkeitsvariablen zeigten keinen signifikanten Zusammenhang Ergänzungen (Beispiel einer Vergewaltigung in Heide am Vatertag): Pluralistische Ignoranz: Jede Situation bietet eine gewisse Ambiguität (Mehrdeutigkeit) bezüglich ihrer Interpretation. Wir Menschen orientieren uns in Situationen, in denen wir unsicher sind, wie diese zu bewerten sind, oft an den Reaktionen der anderen anwesenden Personen (=>Affiliationstheorie von Schachter). Bleiben diese Personen in einem Notfall ruhig, so signalisiert uns dies, dass eigentlich kein Notfall vorherrscht. In Heide könnten also die Passanten sich an den Reaktionen der anderen Passanten orientiert haben und da diese die Situation nicht als Notfall bewerteten, bzw. entsprechende Reaktionen zeigten, lag der Schluss nahe, dass es sich auch tatsächlich nicht um eine Notfallsituation handelte. Verantwortungsdiffusion: Während pluralistische Ignoranz dazu führt, dass man einen Notfall nicht als solchen klassifiziert, führt Verantwortungsdiffusion dazu, dass trotz erkanntem Notfall sich keiner findet, der hilft. Die Anwesenheit anderer Personen führt dazu, dass man sich nicht mehr persönlich verantwortlich für das Eingreifen in der Situation fühlt. "Es sind ja genügend andere Menschen anwesend und eine hat sicher schon Hilfe organisiert, bzw. wird gleich Hilfe organisieren." Bewertungsangst: Das Eingreifen in Notsituationen kann durchaus zu peinlichen Situationen für die Helfenden führen, wenn sich herausstellt, dass a) das Hilfeverhalten total falsch war, oder b) es sich gar nicht um einen Notfall handelte. Menschen tendieren dazu Situationen zu vermeiden in denen sie eventuell peinlich berührt dastehen könnten. Dem entsprechend können die Passanten es vermieden haben zu helfen, aus Angst schlecht von anderen bewertet zu werden. Vatertag: An diesem Tag werden in vielen Teilen Deutschlands größere Mengen an Alkoholika konsumiert. In Folge des enthemmenden Effektes des Alkohols kommt es relativ regelmäßig zu Situationen, die anzüglicher Natur sind. Dadurch könnte an diesem Tag die Situation eine alternative Interpretation ebenfalls nahe gelegt haben. V1T2 Darley & Batson (1973). From Jerusalem to Jericho: Der relative Einfluss situationaler und dispositioneller Variablen Ausgangslage: Die Vorhersagekraft dispositioneller Variablen erwies sich in verschiedenen Studien als zu gering. Phänomen: Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Zentrale Hypothesen: a) Ob Menschen in einer Notsituation religiöse oder ethische oder triviale andere Gedanken im Kopf haben, beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, dass sie helfen, nicht. b) Je mehr Menschen unter Zeitdruck stehen, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass Sie Hilfeverhalten zeigen. c) Menschen deren Religiosität "um Ihrer selbst willen gelebt" - intrinsische Gründe oder die in ihrer Religiosität "eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn im eigenen Leben finden", sind eher bereit Hilfeverhalten zu zeigen als Menschen, deren Religiosität auf die damit verbundenen lebensweltlichen Vorteile abzielt. Theoretische Überlegungen: Psychologische Interpretation des Gleichnisses vom Barmherzigen Samariter. Experiment mit Priesterschülern und einem Hilfebedürftigen. Ergebnisse: 1. Art des Hilfeverhaltens hängt signifikant vom Grad der Eile ab, nicht aber vom Gedankeninhalt (der Einfluss von Normen scheint beim Helfen weniger stark zu sein). 2. Art der Religiosität (Persönlichkeitsvariable) spielte keinen signifikanten Einfluss. V1T3 Pilavin, Pilavin & Rodin (1975). Verantwortungsdiffusion und die erwarteten Kosten der Hilfeleistung (Stichwort: Arousal - Erregung, Cost-Reward-Model) Ausgangslage: Erregung bei Beobachtung eines Notfalls führt zu einer Motivation, diese zu reduzieren. Dabei stehen Kosten-Nutzen-Abwägungen im Vordergrund. Phänomen: 1. Die Beobachtung eines Notfalls führt zu Erregung (arousal); 2. Je stärker die Erregung ist, desto unangenehmer wird sie erlebt. Der Zeuge ist daher motiviert, die Erregung zu reduzieren; 3. Es gibt zwar (a) bestimmte Umstände und (b) bestimmte Persönlichkeitstypen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Zeugen einschreiten, ohne die Kosten und Nutzen dieses Verhaltens zu kalkulieren; 4. Im Regelfall wird der Zeuge jedoch die Handlungsalternative auswählen, die am schnellsten und wirksamsten seine Erregung reduziert und die mit den geringsten Verhaltenskosten verbunden ist - das kann Hilfeverhalten sein, muss es aber nicht. Zentrale Hypothesen: a) Die Kosten für das Hilfeverhalten beeinflussen die Wahrscheinlichkeit und die Geschwindigkeit mit der geholfen wird. b) Bei hohen Kosten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf direktes eigenes Hilfeverhalten verzichtet wird, wenn die Möglichkeit existiert, dass Verantwortung abgeschoben werden kann. Quasiexperiment: Felduntersuchung in Zügen der New Yorker U-Bahn, experimentelles Design. Ergebnisse: 1. Fahrtdauer brachte keinen signifikanten Unterschied (möglicherweise aufgrund der indirekten Operationalisierung). 2. Hohe Kosten (Stigma) führten zu signifikant weniger Hilfe. 3. Hohe Kosten in Interaktion mit der Möglichkeit Hilfe abzugeben (Anwesenheit eines kompetenten Helfers) führten zu signifikant weniger Hilfe. 4. Tatsächlich wirkt nur bei hohen Kosten die Anwesenheit eines professionellen Helfers auf die Wahrscheinlichkeit des Hilfeverhaltens ein, nicht aber bei niedrigen. Innerhalb der NichtAnwesenheitsbedingung lässt sich aber kein Unterschied im Hilfeverhalten in Abhängigkeit von den Kosten aufzeigen. D.h., der Interaktionseffekt wird bestätigt, der generelle Haupteffekt von Kosten aber nicht. 5. Verantwortungsdiffusion ist ein Versuch, die Kosten des Nicht-Helfens dann zu verringern, wenn die Kosten des Helfens hoch sind. Es scheint so, dass wenn das Opfer einer anderen Kategorie angehört (in diesem Fall ein weißer Mann) als die potentiellen Helfer (Frauen, Schwarze), dass dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass von diesen speziellen Helfern Hilfe geleistet wird. Dies ist aber unabhängig von den Kosten, die das Hilfeverhalten potentiell mit sich bringt. V1T4 Batson, Duncan, Ackerman, Buckley, & Birch (1981). Empathie als Quelle altruistischer Motivation (Stichwort: Empathie-Altruismus-Hypothese) Ausgangslage: Belege für altruistisch motiviertes Verhalten sind nicht mit Hilfe des Kosten-NutzenModells schlüssig zu erklären. Phänomen: Hilfeverhalten kann sowohl egoistisch oder altruistisch motiviert sein - das Unterscheidungskriterium ist das Ziel, nicht die Form des Verhaltens. Die Motivation zu Helfen, kann sowohl aus egoistischen als auch aus altruistischen Motiven resultieren. Die Verbesserung des Wohlergehens einer anderen Person ist sowohl notwendig als auch hinreichend, um ein altruistisches Ziel zu erreichen. Zentrale Hypothesen: Empathische Gefühle führen dazu, dass altruistische Motivation zu helfen gebildet wird. Dies soll durch die Interaktion der Effekte der UVs - Schwierigkeit die Situation zu verlassen und Empathie bzw. Ähnlichkeit auf das absolute Hilfeverhalten (dichotom) bzw. die Quantität des Hilfeverhaltens - deutlich werden. Dieser Interaktionseffekt soll den Haupteffekt der Empathiemanipulation (hier durch Ähnlichkeit) qualifizieren, d.h. bei hoher Empathie sollten die Kosten irrelevant sein. Bei geringer Empathie sollten Personen nur bei hohen Kosten des Nicht-Helfens helfen. Laborexperiment (Elaine) mit Elektroschocks Ergebnisse: 1. Signifikanter Haupteffekt für Ähnlichkeit. 2. Signifikanter Interaktionseffekt zwischen Ähnlichkeit und Schwierigkeit, die Situation zu verlassen. 3. Kein Haupteffekt für Schwierigkeit, die Situation zu verlassen. V1T5 Clark, Mills & Corcoran (1989): Interpersonales Helfen: Der Einfluss von Beziehungsnormen (Stichwort: Austausch- oder Gemeinschaftsbeziehungen) Ausgangslage: Unterschied zwischen sozial motivierten Beziehungen (communal relationships) und Austauschbeziehungen (exchange relationships). Phänomen: In einer früheren Studie von Clarks & Mills zeigte sich, dass Personen in einer Gemeinschaftsbeziehung mehr auf die Bedürfnisse achten als solche in Austauschbeziehungen. Unklar blieb dabei: kamen diese Unterschiede zustande, weil sie generell größeres Interesse an allem haben, was die andere Person anbelangt oder durch das spezielle Interesse am Wohlergehen der anderen Person. Hauptziele: 1. Replikation früherer Ergebnisse mit einem verbesserten Forschungsdesign (AV Variable). 2. Untersuchung, ob es sich bei Freundschaftsbeziehungen um sozial motivierte Beziehungen und bei Beziehungen zwischen Fremden um Austauschbeziehungen handelt. Zentrale Hypothesen: Allgemein: a) Menschen, die in Gemeinschaftsbeziehungen zueinander stehen, achten eher auf ihre gegenseitigen Bedürfnisse als Menschen, die in Austauschbeziehungen zueinander stehen. Sie achten aber nicht auf einfach alle Signale, die den anderen betreffen. b) Menschen, die in Austauschbeziehungen zueinander stehen, achten eher auf den Beitrag des anderen zu einer gemeinsamen Aufgabe, als Menschen, die in Gemeinschaftsbeziehungen zueinander stehen. Spezifisch: a) Befreundete Menschen werden mehr auf ihre gegenseitigen Bedürfnisse achten, als Menschen die sich einander nicht kennen, also sich fremd sind. b) Wenn zwei einander fremde Menschen an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, dann werden sie mehr auf den Beitrag des anderen achten, als befreundete Menschen, welche die gleiche Aufgabe gemeinsam erledigen. Laborexperiment mit angeblicher Untersuchung des Leistungsverhaltens. Ergebnisse: 1. Keine Haupteffekt, aber Interaktionseffekt zwischen Beziehungstyp und Inhalt der Rückmeldung. 2. Das heißt, dass Personen Signale für die Bedürfnisse eines Freundes mit höherer Aufmerksamkeit verfolgen, als sie dies bei Fremden tun würden (und dies selbst dann, wenn sie ihm nicht helfen können). 3. Das heißt ebenso, dass Personen Signale für den Beitrag eines Fremden zu einer gemeinsamen Aufgabe, für deren Lösung es eine gemeinsame Belohnung gibt, stärker verfolgen, als sie dies bei Freundschaftsbeziehungen tun würden. Schlussfolgerungen: Gemeinschaftsbeziehungen werden in der Regel zwischen Menschen geknüpft, die einander ähnlich sind, bzw. führen sie auch dazu, dass die Menschen sich einander ähnlich werden. Zusätzlich entsteht in Gemeinschaftsbeziehungen ein Gefühl der Verbundenheit zueinander. Ähnlichkeit bzw. Verbundenheit ist ein Merkmal/Signal das empathische Reaktionen hervorruft. Empathische Reaktionen mit dem Zustand des anderen sind die Basis für eine altruistische Motivation, dem anderen zu helfen. Austauschbeziehungen existieren zwischen vielen Menschen und stehen in keinem Zusammenhang mit einer erhöhten Ähnlichkeit aus der eine erhöhte empathische Reaktion etc. abgeleitet werden könnte. Deswegen lässt sich der Schluss ziehen, dass Helfen in Gemeinschaftsbeziehungen eher altruistischer Natur ist als in Austauschbeziehungen. In Gemeinschaftsbeziehungen ist das Wohl des anderen der primäre Fokus des Handelns und damit ist das definierende Kriterium für altruistisches Helfen erfüllt. V1T6 Charng, Piliavin & Callero (1988): Rollenidentität und Hilfeverhalten (Stichwort: Ehrenamtliches Helfen, Rollenidentität) Ausgangslage: Eines der dominierenden Modelle zur Verhaltensvorhersage ist die Theorie des überlegten Handelns (Theory of reasoned action, Fishbein & Ajzen). Im Hinblick auf die Vorhersage wiederholt ausgeführten Verhaltens ist diese Theorie unterspezifiziert. Ein potenziell relevantes Konzept für die Vorhersage wiederholt ausgeführten Verhaltens ist die Rollenidentität, die durch soziale Zuschreibungen und Internalisierungsprozesse aufgebaut wird. Phänomen: Wiederholtes, geplantes und indirektes Helfen im Gegensatz zu einmaligen, spontanen und direktem Helfen. Zentrale Hypothesen: 1. Die Theorie des Überlegten Handelns ist auch auf sich wiederholendes Verhalten anwendbar. D.h. Subjektive Einstellungen und die wahrgenommene subjektiven Normen sagen vorher, ob Menschen die Absicht entwickeln, Blut spenden zu gehen. Diese Absicht alleine wird dann das tatsächliche Verhalten vorhersagen. 2. Zukünftiges Blutspendeverhalten wird auch durch die folgenden Variablen vorhergesagt: a) RollenIdentität (als BlutspenderIn) bzw. deren Wichtigkeit oder Salienz, b) Soziale Beziehungen, die durch das Blutspenden zustande kommen, bzw. aufrecht erhalten werden und c) die Gewohnheit Blut zu spenden. 3. Die Rollen-Identität ist ein besserer Prädiktor sowohl für die Absicht Blutspenden zu gehen, als auch für das Verhalten selbst, bei Menschen, die eine längere Blutspender(in)karriere hinter sich haben. Fragebogenstudie mit Blutspendern. Korrelationsstatistisches Design (Panel) mit zwei Messzeitpunkten. Ergebnisse: 1. Bestätigung des Fishbein-Ajzen-Modells = Einstellung und subjektive Normen sagen die Intention vorher und diese wiederum direkt das Verhalten. Aber: die subjektiven Normen beeinflussen, anders als im Modell, das Verhalten. 2. erweitertes Modell: a) Einstellung, Rollenidentität und soziale Beziehungen sagen die Intention vorher; b) Gewohnheit hat keinen Einfluss auf die Intention und subjektive Normen wirken sich sogar negativ aus; c) soziale Beziehungen, Gewohnheit und Intention sagen das Verhalten vorher; d) Rollenidentität hat keinen direkten Einfluss auf das Verhalten, sondern wirkt indirekt über die Intention. 3. Das erweiterte Modell sagt sowohl Intention als auch Verhalten deutlich besser voraus als das Fishbein-Ajzen-Modell. Regressionsanalysen geben keine Antworten über kausale Schlüsse, dennoch lassen sich anhand von regressionsanalytischen Verfahren neuralgische Punkte identifizieren, die besonders wirksam sind, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen zu einem Verhalten animiert werden sollen. In diesem Sinne lassen sich z.B. personalisierte Mailings erstellen, die je nach AnsprechpartnerIn die folgenden Inhalte besonders betonen sollten: Bei Menschen die einmal gespendet haben, sollte z.B. betont werden, wie toll es das Umfeld einer jeden Person finden würde, wenn sie noch einmal spenden gehen würde. Bei Menschen, die zwei- bis viermal Blut gespendet haben, sollte an deren Absicht zu spenden gearbeitet werden. Z.B. durch Betonung ihrer Identität als BlutspenderInnen, oder durch Informationsgabe, welche die Handlung des Blutspendens positiv bewertet. Bei Drei- oder Viermalspendern sollte weiter betont werden, dass Blutspenden mit vielen positiven Sozialkontakten verbunden ist, bzw. ist dafür zu sorgen, dass diese Menschen auch tatsächlich solche Kontakte bei Blutspenden erleben (z.B. gemeinsames Frühstück organisieren). Bei Menschen, die auf eine lange Blutspenderkarriere zurückblicken, läuft ein Teil ihres Verhaltens über Gewohnheit, so dass hier nicht sehr viel verändert werden muss/kann. Trotzdem kann auch hier über eine Verbesserung der Absicht eine erhöhte Bereitschaft zum Blutspenden stimuliert werden. Die Absicht kann hier ebenfalls über eine Betonung der Identität als Blutspender erhöht werden. V1T7 Omoto & Snyder (1995): Ehrenamtliches Helfen: Der funktionale Ansatz Ausgangslage: In der Theorie wird zwischen spontanem, sozial erwarteten und ehrenamtlichen Helfen unterschieden. Bei ehrenamtlichen Helfen wird ein Phasenmodell angenommen: 1. Phase Voraussetzungen (Dispositionen, persönliche Bedürfnisse und das soziale Umfeld); 2. Phase Erfahrungen (Zufriedenheit und soziale Integration) und die 3. Phase Konsequenzen (Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit und eine Einstellungsänderung). Phänomen: Der funktionale Ansatz. Zentrale Hypothesen: 1. Unterschiedliche Personen können ein und dasselbe Verhalten aus verschiedenen Gründen ausüben. Das Verhalten kann jeweils unterschiedlichen individuellen psychologischen Funktionen dienen (funktionaler Ansatz). Solche psychologischen Funktionen sind z.B. Wertausdruck, Wissenserwerb, persönlicher Wachstum und Erwerb von Fähigkeiten, Bekämpfung der Sorge um die spezifische Betroffenengruppe oder die Steigerung des Selbstwertgefühls. 2. Für jede Phase des Modells werden Indikatoren für die kritischen sozial-psychologischen Variablen erfasst und die theoretisch vorhergesagten Beziehungen getestet. Paneldesign, natürliche Population, Kriterium wurde erst nach 1 bzw. 2 ½ Jahren bestimmt. Ergebnisse: Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung individueller Motive und der Zufriedenheit mit der Tätigkeit für die Dauer des Engagements. Von den Motiven stellten sich insbesondere eher "egoistische" Motive (Wissen zu Erwerben, Selbstwertgefühl aufbauen etc.) als signifikante Prädiktoren heraus, während eher "altruistische" Motive (Ausdruck humanitärer Werte, "Community Concern") keine signifikanten Prädiktoren der Dauer des Engagements waren. Individuelle Dispositionen im Sinne einer "Prosozialen Persönlichkeit" hatte keinen direkten Effekt auf die Dauer des Engagement. Das soziale Umfeld spielt in diesem Kontext wider Erwarten eher eine negative Rolle. Es war ein anderer Richtungszusammenhang vor der Untersuchung postuliert worden. Dieser Richtungszusammenhang war den Autoren intuitiv als richtig erschienen und in der Literatur/Forschung bereits auch schon so vorgefunden worden. Die Autoren argumentieren mit der sehr hohen Belastung, die ein ehrenamtliches Engagement für Aidserkrankte, vom EhrenamtlerIn abverlangt. Dies kann sehr frustrierend sein. Menschen, die nun eine große soziale Unterstützung oder ein großes soziales Netzwerk besitzen, ziehen sich dann bei zu großer Belastung zurück um sich dort (im eigenen Netzwerk) ein angenehmeres, fröhlicheres Leben zu ermöglichen. Menschen, die wiederum kein großes soziales Netzwerk besitzen, nutzen viel eher ihr ehrenamtliches Engagement um Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, und dies stellt einen gewichtigen Faktor dar, der für die Zufriedenheit mit der Arbeit spricht, bzw. gegen das Aufhören. V1T8 Simon, Stürmer, & Steffens (2000): Hilfeverhalten als individuelles und kollektives Phänomen Ausgangslage: Hilfeverhalten wurde typischerweise als ein individuelles oder interpersonales Phänomen betrachtet. Im Mittelpunkt der Analyse standen daher insbesondere individuelle Motive oder Merkmale der interpersonalen Beziehung zwischen Helfer und Hilfeempfänger. Bis auf wenige Ausnahmen haben Gruppenprozesse als Determinanten von Hilfeverhalten wenig Beachtung gefunden. Hauptziele dieser Untersuchung ist es, die traditionelle Forschungsperspektive durch eine Analyse von Gruppenprozessen zu erweitern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung der Frage, ob und in welcher Form Identifikationsprozesse Hilfeverhalten regulieren. Phänomen: Die spezifischen Hypothesen werden aus der Selbstkategorisierungstheorie abgeleitet, in der zwei idealtypische Varianten der Selbstdefinition unterschieden werden: 1. Die kollektive Identität (wir) und 2. die individuelle Identität (ich). Kollektive Identifikation fördert typischerweise Verhalten zugunsten der Eigengruppe und Diskriminierung gegenüber Fremdgruppen. Individuelle Identifikation führt typischerweise zu einer Minimierung der unterschiedlichen Behandlung von Eigen- und Fremdgruppenmitgliedern. Zentrale Hypothesen: 1. Kollektive-Identifikation-Moderationshypothese: Kollektive Identifikation mit der heterosexuellen ingroup verringert die Bereitschaft von AIDS-Helfern, sich ehrenamtlich für die AIDS-Hilfe zu engagieren, während kollektive Identifikation mit der homosexuellen in-group diese Bereitschaft vergrößert. 2. Individuelle-Identifikation-Moderationshypothese: Individuelle Identifikation erhöht bei heterosexuellen AIDS-Helfern die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in der AIDS-Hilfe zu engagieren, während dies bei homosexuellen AIDS-Helfern dazu führt, dass ihre Bereitschaft sich in der AIDS-Hilfe zu engagieren abnimmt. Die Sexuelle Orientierung moderiert die Zusammenhänge zwischen kollektiver und individueller Identifikation und der Bereitschaft zum Engagement. 3. Organisationale-Identifikation-Hypothese: Identifikation mit einer AIDS-Hilfeorganisation erhöht die Bereitschaft sich ehrenamtlich in der AIDS-Hilfe zu engagieren. Der Zusammenhang zwischen Identi- fikation mit der Organisation und der Bereitschaft zum Engagement wird nicht durch die sexuelle Orientierung beeinflusst. 4. Zusätzliche Motivhypothesen: Es gibt verschiedene individuelle Motive, welche die Bereitschaft sich zukünftig in der ehrenamtlichen AIDS-Hilfe zu engagieren, vorhersagen. Fragebogenstudie mit ehrenamtlichen Mitarbeitern in der deutschen AIDS-Hilfe. Ergebnisse: 1. Bestätigung der sexuellen Orientierung als Moderator. 2. Die Ergebnisse bestätigen die spezifischen Hypothesen zur unterschiedlichen Rolle individueller und kollektiver Identifikationsprozesse in Abhängigkeit von der Eigen- und Fremdgruppenbeziehung zwischen Helfer und Hilfeempfänger. 3. Die Hypothese zur Rolle organisationaler Identifikation wird ebenfalls bestätigt. 4. Zusätzliche Ergebnisse: Im Hinblick auf die beiden individuellen Motive "Wertausdruck" und "Wissen" deutet sich ein differentielles Muster in beiden Substichproben an. Es ist ein Fakt, dass Frauen eher langfristiges fürsorgliches Hilfeverhalten zeigen, wohingegen Männer eher zu einzelnen "heroischen" Akten neigen. Wenn sich Frauen und Männer nun also bezüglich ihres Genders verhalten, so sollte bei Ihnen die individuelle Identifikation gering sein. Dem entsprechend sollte ein positiver (ein nicht Hemmender) Zusammenhang zwischen individueller Identifikation und ehrenamtlichen Engagement in der Männer Sub-Stichprobe vorliegen (Diese Männer identifizieren sich ja dann eben nicht mit dem Männerstereotyp). Und es sollte ein negativer (ein Hemmender) Zusammenhang zwischen individueller Identifikation und ehrenamtlichen Engagement in der Frauen Sub-Stichprobe vorliegen. Dies wurde aber in dieser Studie empirisch nicht gefunden, sondern genau das Gegenteil. V1T9 Levine, Prosser, Evans & Reicher (2005): Soziale Kategorisierung und Helfen in Notfallsituationen. Ausgangslage: Während sich die Forschung traditionell auf individuelle Prozesse konzentriert hat, rückt in der neueren Forschung zu Hilfeverhalten zunehmend die Rolle von Gruppenprozessen in den Mittelpunkt des Interesses, also die Einbindung sozialer Identitätstheorien (Stichwort: Selbstkategorisierung). Phänomen: Hilfeverhalten in Notfallsituationen wird durch die Eigen- und Fremdgruppenbeziehung zwischen potentiellem Helfer und der hilfsbedürftigen Person auf der Grundlage sozialer Kategorien beeinflusst. Zentrale Hypothesen: a) Die Kategorisierung einer hilfsbedürftigen Person als Eigengruppenmitglied steigert die Wahrscheinlichkeit des Einschreitens in einer Notsituation. b) Die Wahrnehmung der Eigengruppe kann je nach Kontext in der Salienz ihrer Merkmale variieren und damit einhergehend unterschiedliche Inklusionsgrade einnehmen. Der Inklusionsgrad der Eigengruppe bestimmt auf wen a) angewendet wird. Variation des "Barmherziger Samariter" - Experiments, 2 Studien, Vpn sind Manchester United Fans, sie treffen auf dem Weg zu einem anderen Gebäude auf einen hingestürzten Konföderierten wahlweise im ManU- oder Liverpool-Trikot bzw. im neutralen Leibchen. Im ersten Experiment wird vorher die Salienz für die Gruppenzugehörigkeit "ManU-Fan" erhöht, im zweiten Experiment die Salienz für die erweiterte Gruppenzugehörigkeit "Fußball-Fan". Ergebnisse: Die Kategorisierung einer hilfsbedürftigen Person als Eigengruppenmitglied steigert die Wahrscheinlichkeit des Einschreitens in einer Notsituation. In beiden Experimenten wird gezeigt, dass je nach Manipulation der salienten Eigengruppe genau den Menschen häufiger geholfen wird, die in die Inklusionsmasse der Eigengruppe fallen. Mitgliedern einer Fremdgruppe wird aber nicht weniger geholfen als einer neutralen Kategorie (Experiment1). Durch einen weiter gefassten Inklusionsgrad der Eigengruppe, werden mehr Menschen zu Eigengruppenmitgliedern und als Folge davon wird diesen eher geholfen. Deswegen sollte nach übergeordneten Kategorien gesucht werden und diese im Alltag vermehrt salient gemacht werden. Dabei gibt es jedoch mehrere Probleme. 1. Problem: Mit breiten, übergeordneten Kategorien geht auch ein Verlust an Identifikationspotential einher, das dazu führt, dass der Effekt des Eigengruppenhelfens ausbleibt. Wenn ich mich nicht identifiziere, dann hat die gemeinsame Gruppenmitgliedschaft für mich keine Relevanz. 2. Problem: Wenn ich einer extrem prosozialen Kategorie angehöre, z.B. "Ärzte ohne Grenzen", dann führt die Salienz einer übergeordneten Kategorie dazu, dass das mögliche positive Aktionspotential meiner kleinen Eigengruppe (z.B. die Normen meiner Gruppe) nicht mehr salient und deswegen nicht mehr so handlungsleitend ist. V1T10 Stürmer, Snyder & Omoto (2005): Helfen innerhalb und zwischen sozialen Gruppen: Motivationale Unterschiede. Ausgangslage: Gegenstand ist der moderierende Einfluss der Gruppenzugehörigkeit von Helfendem und Hilfebedürftigem auf die psychologischen Prozesse, die dem Hilfeverhalten zugrunde liegen. Die Studie soll diese Gruppenperspektive des Helfens weiter ergründen. Das Interesse gilt im Besonderen den emotionalen Prozessen, die Hilfsbereitschaft gegenüber Eigen- oder Fremdgruppenmitgliedern fördern. Zwei emotionale Prozesse werden betrachtet: Empathie und interpersonale Attraktion. Phänomen: 1. Empathie aus Gruppenperspektive: Viele Untersuchungen konnten zeigen, dass das Gefühl von Empathie für eine bestimmte hilfsbedürftige Person (situationale Empathie) Hilfeverhalten wahrscheinlicher macht. Personen mit einer generellen Tendenz, auf die Not anderer mit Empathie zu reagieren (dispositionelle Empathie), sind am ehesten zur Hilfeleistung bereit. Besondere Rolle der Ähnlichkeitswahrnehmung: Saliente Gruppenzugehörigkeit reguliert die Wahrnehmung der Ähnlichkeit, eine geteilte Gruppenzugehörigkeit sollte die Verbindung von Empathie und Hilfeverhalten fördern. 2. Interpersonale Attraktion aus Gruppenperspektive: Attraktion resultiert u. a. aus der subjektiven (positiven) Bewertung der individuellen Charakteristika einer Zielperson (z.B. physisches Erscheinungsbild, Interessen, Wissen). Verschiedene Studien zeigen, dass attraktiven Personen mehr geholfen wird als weniger attraktiven Personen. Die wahrgenommene Attraktivität der Zielperson (Empfindung interpersonaler Attraktion) wirkt der Hemmung von Hilfeverhalten zwischen Gruppen aufgrund von Intergruppenangst und Unsicherheit entgegen. Fremdgruppenmitglieder erscheinen dann weniger prototypisch, weniger beängstigend. Für Intragruppenhelfen ist interpersonale Attraktion weniger relevant, da Eigengruppenmitglieder aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit gemocht werden (soziale statt interpersonale Attraktion) und die Bereitschaft zu Helfen unabhängig(er) von Gefühlen interpersonaler Attraktivität sein sollte. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: 1. Kommen emotionalen Prozessen tatsächlich unterschiedliche Bedeutungen zu, je nach Gruppenzugehörigkeit von Helfer und Hilfsbedürftigem? 2. Moderiert also die Gruppenzugehörigkeit den Zusammenhang zwischen Empathie bzw. Attraktion und Hilfeverhalten? Zentrale Hypothesen: 1. Empathie-Moderations-Hypothese: (Die dispositionelle) Empathie soll das ehrenamtliche Engagement homosexueller ehrenamtlicher MitarbeiterInnen (in-group HelferInnnen) besser vorhersagen, als das von heterosexuellen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen (out-group HelferInnnen). 2. Attraktions-Moderations-Hypothese: Die interpersonale Attraktivität des Geholfenen soll das ehrenamtlichen Engagement heterosexueller ehrenamtliche MitarbeiterInnen (out-group HelferInnnen) besser vorhersagen als das von homosexuellen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen (ingroup HelferInnnen). Bei diesen beiden Hypothesen wurde konstant gehalten, dass einem homosexuellen AIDSErkranktem ehrenamtlich geholfen wird/wurde. 2 Studien: 1. Studie: Fragebogenstudie zum ehrenamtlichen Engagement im Kontext von HIV/AIDS, 2. Studie: Laborexperiment. Ergebnisse: Die Ergebnisse hierarchischer multipler Regressionsanalysen unterstützen die Hypothesen. Separate Analysen für alle drei Kriterien liefern ein ähnliches und die Hypothesen bestätigendes Befundmuster. Die vorhergesagten differentiellen Effekte für Empathie und Attraktion sind auch dann intakt, wenn die Kontrollvariablen als zusätzliche Prädiktoren herangezogen wurden. Es wurde kein Maß für situationale Empathie verwendet, dispositionelle Empathie ist lediglich ein indirektes Maß für die tatsächlich empfundene Empathie der Helfer für den Erkrankten. Das Geschlecht wirkt als möglicher confounder (Störvariable); die Stichprobe homosexueller Personen bestand haupt- sächlich aus Männern, bei der heterosexuellen Stichprobe waren es hauptsächlich Frauen. Eine zweite Laborstudie sollte die Moderationseffekte der ersten Studie unter kontrollierten Bedingungen replizieren. Unterschiedliche psychologische Prozesse sind bei Eigen- bzw. Fremdgruppenhelfen wirksam. Empathie fördert Eigengruppenhelfen und ist bei Fremdgruppenhelfen inhibiert; umgekehrt ist wahrgenommene Attraktion des Hilfebedürftigen förderlich bei Fremdgruppenhilfe, nicht aber bei Eigengruppenhilfe. Dieses Muster konnte in zwei verschiedenen Settings beobachtet werden. Ein möglicher Unterschied liegt in der Qualität der Hilfe! Altruistisches versus egoistisches Motiv. Eine Möglichkeit zur Förderung von Fremdgruppenhelfen ist z.B. das "Matching" - also die Salienz von Ähnlichkeiten. V1T11 Reicher, Cassidy, Wolpert, Hopkins & Levine (2006): Mobilisierung gruppenübergreifender Solidarität. Ausgangslage: Das Thema ist der Schutz und die Rettung von Juden vor der Deportation in Bulgarien. Ein Schwerpunkt der Forschung zu diesem Thema lag auf der Identifikation von Persönlichkeitsvariablen im Sinne einer altruistischen Persönlichkeit. Die Forschungsergebnisse aus dieser Tradition weisen darauf hin, dass die "Retter" eine Inklusion der Opfer in eine gemeinsame psychologische Kategorie kennzeichnet (Stichwort: Extensitivity). Das Phänomen der kategorialen Inklusion weist auf eine Verbindung zum sozialen Identitätsansatz. Forschungsergebnisse zur Rolle von Eigen- und Fremdgruppenkategorisierungen legen nahe, dass die Wahrnehmung einer gemeinsamen Gruppenzugehörigkeit Hilfeverhalten fördert. Phänomen: Eigen- und Fremdgruppenkategorisierungen sind zwar bedeutsam für die Erklärung von Hilfeverhalten, allerdings ist es für die Erklärung von Gruppenverhalten zusätzlich wichtig zu verstehen, welche Normen die Gruppen definieren, da diese Normen das Verhalten der Gruppenmitglieder regulieren. Zentrale Hypothesen: Soziale Kategorien, Gruppennormen und Gruppeninteressen sind keine statischen Konzepte, sondern sie werden im sozialen und politischen Diskurs konstruiert. Analyse historischer Dokumente. Ergebnisse: Persönlichkeitstheoretische Ansätze gehen von einem stabilen "trait" aus, der das Verhalten der Menschen in verschiedenen Kontexten beeinflusst. Einige Helfer zu Zeiten des NS-Regimes sind aber in ihren Handlungen nicht immer so konsistent gewesen, wie es eine starke "trait-Beeinflussung" vorhersagen würde, sondern zeigten auch Verhaltensweisen, die nicht in Einklang mit z.B. einer feststehenden "altruistischen Persönlichkeit" standen. Z.B. Oskar Schindler, der zwar einerseits altruistisch Juden das Leben rettete, andererseits auch daran als Kaufmann und Industrieller eine ganze Zeit lange sehr gut verdiente. Ein festes "trait"-Merkmal mag also nicht hinreichend sein für ein bestimmtes konsistentes Verhaltensmuster. Reicher et al. gehen nun nicht von einer festen Persönlichkeit sondern von einer im jeweiligen Kontext salienten Identität aus, die wandelbar ist und unterschiedliche Grade der Inklusivität besitzt. Je nach Inklusivitätsgrad und Normen der salienten Kategorie werden unterschiedliche Verhaltensweisen als positiv sowie negativ sanktioniert wahrgenommen und dem entsprechend mit veränderten Wahrscheinlichkeiten ausgeführt. Folgende normative Attribute, aber auch Interessen definieren die Identitätskonstruktionen: 1. Nation: Als Normen: Zivilisiert, tolerant, menschlich; als Interessen: Verlust der moralischen Reputation, Verlust von allgemeinem moralischen Kapital oder die Gefahr der Destabilisierung durch den Verlust der Juden. 2. Orthodoxe Kirche: Als Interessen der Verlust von Rekrutierungspotential. 3. Anwaltskammer: Gleichheit, Kollegialität und 4. Universelle Identität: zivilisiertes Miteinander. Nach diesem Ansatz ist der Unterschied zwischen Helfer und Nicht-Helfer (oder sogar Täter) lediglich einer der subjektiv wahrgenommenen eigenen Gruppenzugehörigkeit und den daraus wahrscheinlicher gewordenen unterschiedlichen Verhaltensweisen. Reicher et al. wollen auch zeigen, dass sich Identitäten in Diskursen konstruieren und damit auch instrumentalisieren lassen. Beide Positionen überlappen sich aber in der Konstruktion einer prototypischen Helferin, die ob ihrer persönlichen Disposition oder Sozialisation eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür besitzt, dass sie in universellen Kategorien denkt und handelt. Die "Selbstkategorisierungstheorie", auf deren Basis Reicher et al. argu- mentieren, bezeichnet diese Disposition als "perciever readiness" und übernimmt damit zu einem kleinen Teil das Konstrukt eines relativ invarianten "traits", der mitunter handlungsleitend werden kann. Weitere Beispiele für solche rhetorischen Appelle von politischen Führern zu gruppenübergreifender Solidarität sind z.B. die Reden zur Bewilligung des Marshallplans, die Reden zum Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg an der Seite von Frankreichs und England oder die Reden, welche die Einführung des Solidaritätszuschlags im Bundestag fordern. V1T12 Nadler & Halabi (2006): Helfen zwischen Gruppen: Effekte auf die Rezipienten. Ausgangslage: Es wird von der Soziale Identitätstheorie ausgegangen. Helfen kann als Mechanismus dienen, mit dem Gruppen Statusbeziehungen erschaffen, aufrechterhalten und verändern. Die soziostrukturellen Charakteristika definieren die Intergruppenbeziehung (Legitimität, Stabilität, Permeabilität). Phänomen: Machtungleichheit ist ein Charakteristikum der (intergruppalen) Hilfeleistung. Hilfsangebote werden daher (von Mitgliedern der statusniedrigen Gruppe) als potenziell selbstwertbedrohlich wahrgenommen. Mitglieder, die sich stark mit ihrer Gruppe identifizieren, nehmen diese Bedrohung stärker wahr und lehnen (abhängigkeitsorientierte) Hilfsangebote eher ab. Zentrale Hypothesen: Wenn die Statusbeziehung zwischen zwei Gruppen instabil ist, führt die Annahme von Hilfe, die eine Status niedere Gruppe von einer Status höheren Gruppe erhält/angeboten bekommt, bei den Mitgliedern der Status niederen Gruppe zu folgenden Reaktionen: a) einem negativen Affekt, b) einem erhöhten Bedürfnis die eigene statusniedere Gruppe im Vergleich zur statushöheren Gruppe aufzuwerten (z.B. durch diskriminierendes Verhalten), c) zu einer gesteigerten Homogenitätswahrnehmung der beiden Gruppen (Verfestigung der Gruppengrenzen). Insgesamt 4 Studien. In Studie 1 mit dem Minimalgruppen-Paradigma. Dies experimentelle Paradigma läst die Prozesse, welche untersucht werden sollen, unverzerrter, bzw. durch weniger Drittvariablen beeinflusst, beobachten. Es handelt sich um ein mehrfach verwendetes Verfahren, das in vielen Experimenten erfolgreich als Mittel zur Manipulation von Gruppenzugehörigkeiten verwendet wurde. Die Generalisierbarkeit der Befunde ist nicht unbedingt gegeben, da es sich beim Minimalen Gruppen Paradigma um ad-hoc gegründete Gruppen ohne Geschichte, Zukunft und weitere latente Drittvariablen handelt, welche in der Realität selten anzutreffen sind. Im Alltag begegnen wir Gruppen, die einen historischen Kontext, einen sozialen Kontext, etc. immer in ihrer Gruppendefinition mittransportieren. Diese als Konnotation zur reinen Gruppenzugehörigkeit mitschwingenden Bedeutungen der Kategorisierung zu einer Gruppe können mit den beobachteten Prozessen interagieren und deren im Labor festgestellte Wirkweise abwandeln, im Extremfall sogar umkehren. Ergebnisse: Die Ergebnisse bestätigen den vermuteten Einfluss der wahrgenommenen Stabilität der Statusbeziehung: Wurde die Statusbeziehung als stabil wahrgenommen, wirkte sich ein Hilfsangebot eines Fremdgruppenmitglieds nicht negativ auf den Affekt des Adressaten bzw. Maße zur Beurteilung der Fremdgruppe aus. Wurde die Statusbeziehung hingegen als instabil wahrgenommen, dann führte ein Hilfsangebot eines Fremdgruppenmitglieds dazu, dass sich der Adressat schlechter fühlte und eine stärkere Tendenz zur Intergruppen-Diskriminierung zeigte. Die Fremdgruppe wurde dann aggressiver wahrgenommen, Eigen- und Fremdgruppe wurden homogener eingeschätzt. Die zentrale Hypothese aus Studie 3 lautet: Die Hilfe, die eine Status niedere Gruppe von einer Status höheren Gruppe erhält/angeboten bekommt, führt vor allem bei hoch identifizierten Mitgliedern der Status niederen Gruppe zu folgenden Reaktionen: a) einem negativen Affekt, b) einem erhöhten Bedürfnis die eigene statusniedere Gruppe im Vergleich zur statushöheren Gruppe aufzuwerten (z.B. durch diskriminierendes Verhalten) und c) zu einer schlechteren Bewertung der Fremdgruppe. In der Tabelle 3, auf Seite 106 sehen wir, dass tatsächlich ein negativerer Effekt vorherrscht, der Eigengruppe bei einer Verteilung wesentlich mehr gegeben und die Fremdgruppe wesentlich negativer beurteilt wird, unter der Bedingung, dass eine hohe Identifikation und gleichzeitig ein Fremdgruppenhelfen vorliegen im Vergleich zu den anderen drei Bedingungen. Daraus leiteten Nadler und Halabi einige zentrale Implikationen für die Planung von Interventionsmaßnahmen zur Förderung von Hilfeverhalten zwischen Gruppen ab. Wenn Sie in der Status höheren Gruppe sind und Hilfe geben wollen, die auch von der statusniederen Gruppe dankbar angenommen wird, dann sollten Sie entweder dafür sorgen, dass die Statusdifferenz als Legitim und konstant angesehen wird, die Identifikation des Hilfeempfangenden mit seiner eigenen Gruppe schwächen (Re- bzw. Dekategorisierungsprozesse nutzen) oder Autonomieorientierte Hilfe anbieten, nicht Abhängigkeitsorientierte Hilfe. Sie sollten nicht unbedingt ungefragt helfen und fragen ob und welche Hilfe benötigt wird. Diese Untersuchungen zeigen wie wichtig die Gruppenzugehörigkeit der helfenden Person für den Hilfeempfangenden sein kann, deswegen sollte man von Mensch zu Mensch geben, nicht als Repräsentant ihrer Gruppe (Dekategorisieren) und die gemeinsame Gruppenmitgliedschaft betonen (Rekategorisieren). Sozialpsychologie Vertiefung II: Intergruppenkonflikte und Interventionen. V2T1 Pettigrew (1958): Persönlichkeitsfaktoren und kulturelle Einflüsse. Ausgangslage: Pettigrew setzt sich in diesem Artikel auf der Grundlage kulturvergleichender Studien mit den zu seiner Zeit vorherrschenden persönlichkeitstheoretischen Erklärungen für rassistische Vorurteile auseinander. Er argumentiert, dass eine persönlichkeitstheoretische Erklärung, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt in der Lage ist, die weite Verbreitung und die Uniformität von Stereotypen und Vorurteilen in bestimmten Populationen oder Subpopulationen zu erklären. Im vorliegenden Artikel wird eine systematische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen autoritärer Persönlichkeit und rassistischen Vorurteilen berichtet, die im Südafrika unter dem Apartheidregime, den durch die Rassentrennung geprägten Südstaaten der USA und den Nordstaaten der USA durchgeführt wurde. Persönlichkeitstheoretische Erklärungsansätze werden mit Erklärungsansätzen verglichen, die annehmen, dass Vorurteile durch Prozesse der Gruppensozialisation übernommen und durch Konformität verhaltenswirksam werden. Phänomen: Einflussreiche Ansätze zur Erklärung von Vorurteilen konzentrierten sich auf intrapsychische Prozesse, insbesondere den Prozess der Externalisierung innerer Konflikte (Stichwort: Projektion). Empirische Untersuchungen weisen allerdings auch auf den Einfluss sozial-kontextueller Faktoren hin. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: Überprüfung der Rolle personaler und kultureller Faktoren bzw. ihres Zusammenspiels für die Erklärung von rassistischen Vorurteilen. Auf Seiten der Persönlichkeitsfaktoren stehen Aspekte der autoritären Persönlichkeit bzw. der Bereitschaft zur Konformität im Blickpunkt. Fragebogenstudie mit 627 Studenten der englischsprachigen University of Natal in der Union of South Africa. Ergebnisse: Es gibt kaum Unterschiede zwischen in Afrika und anderswo geborenen Studenten bei den Persönlichkeitsmerkmalen, aber deutliche Mittelwertsunterschiede auf der A-Skala (Einstellung). Der Beruf des Vaters korreliert signifikant mit dem Ausmaß von Vorurteilen gegen schwarze Afrikaner (= Hinweis auf sozial-kontextuelle Einflüsse). In Regionen mit historisch gewachsenen rassistischen Traditionen spielen Persönlichkeitsfaktoren im Sinne der autoritären Persönlichkeit zwar eine wichtige Rolle für die Erklärung von Vorurteilen und Diskriminierung; einflussreicher sind allerdings offenbar Sozialisationsfaktoren und sozialer Einfluss. Persönlichkeitsfaktoren alleine können die erhöhte Intoleranz in dieser Stichprobe nicht erklären. Südafrikaner, Südstaaten US-Amerikaner und Nordstaaten U.S. Amerikaner haben unterschiedliche politische und soziale Geschichten. Aus Untersuchungen in den 1950er Jahren geht außerdem hervor, dass rassistische Vorurteile in Südafrika und in den Südstaaten von USA stark ausgeprägt sind. Des Weiteren wird angenommen, dass mit den geschichtlichen Differenzen auch die kulturellen Faktoren in den drei Stichproben variieren. Wenn Vorurteile soziokulturell bedingt sind, dann sollten sich positive bzw. negative Zusammenhänge zwischen Vorurteilen und den soziokulturellen Faktoren in allen drei Stichproben finden. Außerdem würde man, aufgrund der soziokulturellen Unterschiede zwischen Südafrika (Apartheid) und Südstaaten von USA (Rassentrennung) einerseits und den Nordstaaten von USA andererseits, höhere rassistische Vorurteile in den ersten zwei Stichproben im Vergleich zu der dritten Stichprobe erwarten. Pettigrew findet in der südafrikanischen Stichprobe signifikante Korrelationen zwischen Konformität und Vorurteilen gegen Schwarzafrikaner. Eine Prognose von rassistischen Vorurteilen aufgrund Konformitätsneigungen ist möglich. Außerdem unterscheiden sich niedrig von hoch vorurteilsbehafteten Personen in 12 von 16 Items der Konformitätsskala signifikant voneinander: Hoch vorurteilsbehaftete Personen stimmen diesen Items in höheren Maße zu als niedrig vorurteilsbehaftete Personen. Konformität hat deshalb eine besondere Bedeutung für rassistische Vorurteile, weil sie sowohl deren Vorhandensein bzw. offenen Ausdruck als auch deren Fehlen bzw. Unterdrückung prognostizieren kann, je nachdem, welche Normen in der Kultur vorherrschen (Rassismus vs. Toleranz). Konformität kann insofern als eine Persönlichkeitsvariable betrachtet werden, die mitbestimmt, ob und in welchem Ausmaß kulturelle Faktoren die Einstellungen der Person gegenüber relevanten Fremdgruppen beeinflussen. Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus stellen Beispiele für extrem negative Einstellungen und damit häufig einhergehendes diskriminierendes Verhalten gegenüber Fremdgruppen dar. Grundsätzlich kommen dispositionelle und soziokulturelle Faktoren als Determinanten von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Frage. Um Erkenntnisse darüber zu bekommen, welche dieser Faktoren wichtiger sind, könnte man die Rechtsextremen/Fremdenfeindlichen mit nicht vorurteilsbehafteten Personen vergleichen und zwar hinsichtlich der Dispositionen (z.B. Autoritarismus) und der Merkmale des sozialen Umfeldes (z.B. Organisationszugehörigkeit, Parteipräferenz, Normen in der Clique). V2T2 Walker & Mann (1987): Relative Deprivation und sozialer Protest. Ausgangslage: Theorien der relativen Deprivation zufolge, spielt die Wahrnehmung relativer Deprivation eine zentrale Bedeutung dafür, ob statusniedrige Gruppen ihren Status akzeptieren oder stattdessen den Status quo durch politische Mittel herausfordern. Wichtige konzeptuelle Unterscheidung zwischen egoistischer und fraternaler Deprivation: Egoistische relative Deprivation resultiert aus interpersonalen Vergleichen (eine Person nimmt wahr, dass sie - ungerechterweise - weniger besitzt als eine andere Person). Fraternale relative Deprivation resultiert hingegen aus intergruppalen Vergleichen (d.h. dem Vergleich der Eigengruppe mit einer relevanten Fremdgruppe). Es gibt keine einheitlichen Forschungsbefunde, dass die Wahrnehmung relativer Deprivation tatsächlich zu sozialem Protest führt. Die Autoren führen dies darauf zurück, dass bei vielen Untersuchungen nicht unterschieden wurde zwischen egoistischer und fraternaler Deprivation. Phänomen: Unterscheidung zwischen egoistischer und fraternaler Deprivation: Sozialer Protest setzt eine Gruppenidentifikation voraus, daher sollte fraternale Deprivation ein besserer Prädiktor für die Einstellung zu sozialem Protest sein als die egoistische Deprivation. Überprüfung der differentiellen Rolle egoistischer und fraternaler Deprivation im Hinblick auf zwei unterschiedliche Kriterien: Stresssymptome und Haltung gegenüber sozialem Protest. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: 1. Die Vorhersage von kollektivem Handeln (hier sozialer Protest) gelingt besser anhand fraternaler Deprivation als anhand egoistischer Deprivation. 2. Individuelle Folgen von Deprivation (hier Stresssymptomatik) lassen sich anhand egoistischer Deprivation besser vorhersagen als anhand fraternaler Deprivation. Befragung von jüngeren Arbeitslosen (Durchschnittsalter 23,5 Jahre) in Adelaide, Australien. Ergebnisse: Die Protestorientierung korreliert signifikant mit beiden fraternalen RD-Maßen, aber mit keinem der egoistischen RD-Maße. Stress korreliert signifikant nur mit ERD2. Zwischen den vier RD-Maßen gibt es nur eine signifikante Korrelation, nämlich zwischen den beiden egoistischen Maßen. Das Fehlen dieser Korrelationen weist darauf hin, dass egoistische und fraternale RD zwei getrennt zu sehende psychologische Bedingungen sind. Die Ergebnisse bestätigen die differentielle Rolle egoistischer und fraternaler Deprivation. Sozialer Protest ist eine soziale Einstellung gegenüber kollektivem Handeln, weshalb fraternale Deprivation hierfür von größerer Bedeutung ist als egoistische Deprivation. Stress ist ein individuelles Phänomen. Daher ist egoistische Deprivation hierfür von größerer Bedeutung als fraternale Deprivation, allerdings kann aufgrund des korrelationsstatistischen Designs die kausale Richtung der Ergebnisse nur theoretisch begründet werden, d.h. Befunde über Ursache - Wirkungszu- sammenhänge sind statistisch nicht abgesichert, zudem kann der Einfluss möglicher Drittvariablen nicht ausgeschlossen werden. V2T3 Tajfel, Billig, Bundy & Flament (1971): Effekte bloßer Kategorisierung. Ausgangslage: Frage nach den notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Auftreten sozialer Diskriminierungen zwischen Gruppen. Der vorherrschende Ansatz ist die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts (z.B. Sherif 1966), d.h. negative Interdependenz als Voraussetzung für das Auftreten von Diskriminierung. Phänomen: Hauptziel ist die Untersuchung der Auswirkungen sozialer Kategorisierung auf Intergruppenverhalten unter Bedingungen, in denen weder individuelle Interessen noch vorher bestehende feindliche Einstellungen die Ursache für diskriminierende Verhaltensweisen gegenüber Fremdgruppen sein können. Experimentelles Paradigma (minimal group paradigm): 1.Keine face-to-face Interaktion, 2. Vollständige Anonymität der Gruppenzugehörigkeit, 3. Keine instrumentelle Verbindung zwischen Gruppenzugehörigkeit und Verhalten, 4. Verhalten sollte keinen utilitaristischen Wert für die VP haben, 5. Vergleich konkurrierender Strategien und 6. Möglichst relevante Verhaltensmöglichkeit. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: Unter minimalen Gruppenbedingungen und der Aufteilung der Personen in dichotome, neutrale Kategorien, kommt es zur Diskriminierung der Outgroup, bzw. zur Bevorzugung der eigenen Gruppe. Offene Fragestellung: Welchen relativen Einfluss haben verschiedene Verhaltensstrategien im Kontext minimaler Gruppen auf die Zuteilung von Belohnungen zwischen In- und Outgroupmitgliedern? Laborexperiment mit Schülern. Ergebnisse: Ergebnisse bestätigen, dass Vpn bei der Verteilung von Gewinnen die Eigengruppe begünstigen, auch wenn nur eine relativ unbedeutende Klassifikation Eigen- und Fremdgruppe unterscheiden. Die zentrale Strategie, die die Vergabe von Belohnungen beeinflusste, war die Maximierung des Unterschieds zwischen Eigen- und Fremdgruppe, selbst wenn dies mit dem Preis des Verlusts objektiver Vorteile verbunden war. V2T4 Jetten, Branscombe, Schmitt & Spears (2001): Umgang mit Diskriminierung: Die Rolle der Gruppenidentifikation. Ausgangslage: Rejection-Identification Model von Bransscombe et al., Forschungsarbeiten zum "Ablehnungs-Identifikationsmodell" von Nyla Branscombe und Kollegen legen nahe, dass der negative Effekt wahrgenommener Diskriminierung auf das Selbstwertgefühl durch eine starke Identifikation mit der Eigengruppe abgepuffert oder kompensiert werden. Phänomen: Wahrgenommene Diskriminierung gegenüber der Eigengruppe hat potenziell negative Effekte auf das kollektive Selbstwertgefühl. Dieser negative Effekt kann durch Identifikation mit der Eigengruppe abgeschwächt oder kompensiert werden. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: 1. Die Wahrnehmung von Diskriminierung führt zu stärkerer Gruppenidentifikation als positive Behandlung. 2. Die Manipulation der Diskrimierungserwartungen wirkt durch ihren Einfluss auf die Gruppenidentifikation indirekt positiv auf das kollektive Selbstwertgefühl ein. 3. Die Wahrnehmung von Diskriminierung hat einen direkten negativen Effekt auf das kollektive Selbstwertgefühl. Befragung von Kunden eines Body Piercing Shops in Holland, mit experimenteller Manipulation der wahrgenommenen Diskriminierung. Ergebnisse: Signifikante Pfadkoeffizienten bei wahrgenommene Diskriminierung zur Gruppenidentifikation (Prädiktor zu Mediator), bei Gruppenidentifikation zu Selbstwertgefühl (Mediator zu Kriterium) und nicht signifikanter Pfadkoeffizient bei wahrgenommene Diskriminierung zu Selbstwertgefühl (Prädiktor zu Kriteri- um). Die Ergebnisse bestätigen das Ablehnungs-Identifikationsmodell. Die fehlende Signifikanz auf dem Pfad "wahrgenommene Diskriminierung zu Selbstwertgefühl" wird damit erklärt, dass man Piercings im Zweifelsfall wieder entfernen bzw. verstecken kann, anders als bei Gruppen, die wegen eines natürlichen Stigmas (wie z.B. Hautfarbe, Geschlecht) diskriminiert werden. Die Identifikation mit der Eigengruppe entfaltet vermutlich ihre protektive Wirkung durch folgende psychologischen Prozesse: Positive Distinktheit aufgrund der Herausforderung von mainstream Normen. Anderssein (hier: diskriminiert sein) als prototypische Gruppenposition aus der Mitglieder z.B. Stolz darüber empfinden können, "gute" Gruppenmitglieder zu sein. Soziale Kreativität im Sinne von Ablehnung von Vergleichsdimensionen, die die diskriminierende Outgroup definiert und auf denen eine negative Distinktheit für Ingroup resultieren würde. Soziale Unterstützung von Ingroupmitgliedern (emotional, sozial, materiell). Daraus kann man z.B. für die Situation von Migranten ableiten, dass die Assimilation (Aufgabe ethnischer Identifikationen) schutzloser machen kann gegenüber negativen Folgen der Diskriminierung. Dies kann zu einem verminderten (kollektiven) Selbstwertgefühl führen. Das Beibehalten ethnischer Identifikation kann negative Diskriminierungsfolgen kompensieren (positives kollektives Selbstwertgefühl). V2T5 Mummendey, Kessler, Klink & Mielke (1999): Strategien zur Bewältigung negativer sozialer Identität. Ausgangslage: Die Autoren gehen von der Theorie der sozialen Identität (SIT) und der Theorie relativer Deprivation (RD) aus. Hauptziel ist der Vergleich der Vorhersagekraft der SIT und RD Modelle im Hinblick auf die Strategie im Umgang mit dem negativen Status der Eigengruppe, hier im Kontext der deutschen Wiedervereinigung. Explorative Testung eines integrativen Modells. Phänomen: Prüfung des Einflusses unterschiedlicher Determinanten von Strategien im Umgang mit negativer sozialer Identität bzw. negativem Eigengruppenstatus. Die Determinanten und Strategien werden aus zwei Theorien abgeleitet: Der Theorie der sozialen Identität und der Theorie relativer Deprivation. Vorhergesagte Strategien sind: a) Individuelle Strategien : 1. Individuelle Mobilität und 2. Rekategorisierung auf höherer Ebene b) Wettbewerb (kollektive Strategien): 3. Sozialer Wettbewerb und 4. Realistischer Wettbewerb c) Soziale Kreativität: 5. Wechsel der Vergleichsdimension (temporal) und 6. Abwertung der salienten Vergleichsdimension. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: 1. Wahrgenommene Stabilität und Legitimität des inferioren Status der Ingroup sowie wahrgenommene Permeabilität der Gruppengrenzen (soziostrukturelle Faktoren) sagen die Präferenzen in Bezug auf Identitätsmanagement Strategien sowie das Ausmaß an Gruppenidentifikation vorher. 2. Gruppenidentifikation mediiert den Einfluss von soziostrukturellen Faktoren auf die Wahl der Identitätsstrategie. 3. Egoistische und fraternale Deprivation dienen als Prädiktor für die gewählten Strategien. 4. Fraternaler Ärger und kollektive Wirksamkeitserwartung (group efficacy) als Mediator. Befragung von Ostdeutschen kurz nach der Wiedervereinigung. Ergebnisse: Wahrgenommene (In-)Stabilität hat folgende Effekte: Direkte Effekte: negativ auf Mobilität (individuelle Strategie) und positiv auf realistischen Wettbewerb (kollektive Strategie). Indirekte Effekte 1) über Identifikation negativ auf individuelle Strategien; 2) über fraternalen Ärger positiv auf kollektive Strategien + positiv auf Rekategorisierung (individuelle Strategie). Zweifach indirekte Effekte 1) über Identifikation und über Gruppenwirksamkeit positive Effekte auf kollektive Strategien + positiv auf temporaler Vergleich (kollektive Kreativitätsstrategie) 2) über Identifikation und über fraternalen Ärger positiv auf kollektive Strategien + positiv auf Rekategorisierung. Wenn Personen den inferioren Status der eigenen Gruppe als stabil wahrnehmen, befürworten sie kollektive und verneinen individuelle Strategien. Außerdem führt wahrgenommene Stabilität zu stärkerer Identifikation mit der Ingroup und zum fraternalen Ärger auf die Outgroup - zwei Variablen, die ihrerseits die Wahl kollektiver Strategien begünstigen (Ausnahme: Rekategorisierung). Schließlich führt die Wahrnehmung von Stabilität über die Identifikation mit der Ingroup zur Herausbildung der kollektiven Überzeugung, dass die Gruppe die Situation ändern kann sowie zum fraternalen Ärger. Diese Überzeugung und der Ärger fördern wiederum die Wahl kollektiver Strategien. SIT Prädiktoren waren mit individuellen Strategien verbunden; RD Prädiktoren waren mit kollektiven Strategien verbunden (Wettbewerb); soziale Kreativitätsstrategien konnten nur eingeschränkt vorhergesagt werden. Das integrative Modell legt nahe, dass soziale Identifikation einen indirekten Effekt auf die Bereitschaft zu kollektiven Strategien (Wettbewerb) ausübt, der über Ressentiment und kollektive Wirksamkeitswahrnehmung vermittelt wird. V2T6 Van Laar, Levin, Sinclair & Sidanius (2005): Reduktion von Vorurteilen durch Kontakt. Ausgangslage: Kontakthypothese (Allport, Pettigrew). Fehlende Befunde über die Richtung des kausalen Zusammenhangs der Wirkung der Kontaktbedingungen. Fast ausschließlich Studien über den Kontakt zwischen lediglich zwei Gruppen. Diese Lücken will die Studie schließen. Phänomen: Die Kontakthypothese besagt, dass es zu einer Reduktion von Vorurteilen zwischen Gruppen kommen kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. gleicher Status zwischen den Gruppen, 2. gemeinsame Ziele, 3. intergruppale Kooperation, 4. Unterstützung durch Autoritäten und 5. Freundschaftspotenzial. Daraus ergeben sich folgende Hauptfragestellungen: 1. Prüfung des kausalen Effekts von Kontakt auf Intergruppeneinstellungen und Vorurteile. 2. Haben spezifische Charakteristika der beteiligten Gruppen einen Einfluss auf die Kontakteffekte? 3. Führen positive Kontakterfahrungen mit Mitgliedern einer bestimmten Fremdgruppe auch zu einer positiven Veränderung der Einstellung gegenüber anderen Fremdgruppen (Generalisierung)? 4. Führt Kontakt mit Eigengruppenmitgliedern in multiethnischen Kontexten zu einer Intensivierung von Vorurteilen? Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: 1. Personen, die zufällig einer Wohnsituation mit Fremdgruppen-Mitbewohnern zugeteilt wurden, sollten als Folge dieses Kontakts verbesserte Intergruppeneinstellungen aufweisen. 2. Personen, die ihre Wohnsituation mit Fremdgruppenmitgliedern selbst gewählt haben, sollten ebenfalls als Folge dieses Kontakts verbesserte Intergruppeneinstellungen aufweisen. Fragebogenstichprobe. Ergebnisse: 1. Ergebnisse bestätigen die erwartete positive Rolle von Kontakt für die Reduktion von Vorurteilen. Insgesamt führte die Heterogenität des interethnischen Kontakts zu einer Reduktion ethnischer Vorurteile bzw. einer Verbesserung interethnischer Einstellungen. Eine Ausnahme im Zusammenhang mit dem Kontakt mit Mitbewohner/innen mit asiatischem Hintergrund ist zu beachten, hier war eine Zunahme von Vorurteilen gegenüber Angehörigen anderer ethnischer Minoritäten zu beobachten. Mögliche Erklärung: in dieser speziellen Gruppe könnten Vorurteile besonders stark ausgeprägt sein, was zur Übernahme dieser Vorurteile bei den anderen Mitbewohnern (bzw. Teilnehmern) führte. 2. Hinweise für eine Generalisierung positiver Kontakterfahrungen mit Angehörigen einer Gruppe auf andere Gruppen fanden sich hier im Zusammenhang mit Kontakt mit Schwarzen und Latinos. 3. Hinweise auf eine Intensivierung von Vorurteilen durch Eigengruppenkontakt waren im vorliegenden Kontext nicht zu beobachten. Folgende potenzielle Einschränkungen der Untersuchung werden von den Autoren diskutiert: 1. Die Unabhängigkeit der Messdaten ist möglicherweise dadurch verletzt, dass Studenten, die gemeinsam wohnten, ihre Antworten aneinander orientierten, Ergebnisse werden dadurch evtl. leichter signifikant, aber die Richtung der Koeffizienten und die Effektgrößen sind davon unberührt (Cohen et al., 2003), die Daten wären unabhängig, wenn die Unterkunft als Untersuchungseinheit fungiert hätte. Die AutorInnen argumentieren, dass das Zusammenleben mit Outgroupmitgliedern, die individuellen Einstellungen gegen diese Outgroups beeinflusst. Auf Grund der Abhängigkeit der Daten kann aber eine alternative Erklärung des positiven Kontakteffekts nicht ganz ausgeschlossen werden, nämlich, dass nicht die individuelle Einstellungsänderung den positiven Kontakteffekt vermittelt, sondern soziale Einflussprozesse in Gruppen. 2. Positiver Kontakteffekt spiegelt möglicherweise keine internalisierte veränderte Intergruppeneinstellung wider, sondern ein in diesem Kontext sozial erwünschtes Verhalten. Die Daten geben keinen Hinweis darauf, auf welchem psychologischen Level (internalisiert vs. oberflächlich), eine Veränderung stattgefunden hat, so dass über den tatsächlichen Effekt nur spekuliert werden kann. Die Auto- rInnen spekulieren auf das Vorhandensein einer internalisierten Einstellungsänderung und zwar im Zusammenhang mit der gemessenen Verhaltensänderung (z.B. in Bezug auf das Ausmaß interethnischer Verabredungen). In dem Ausmaß, wie Verhaltensänderungen auftreten, kann aus den bloßen Compliance-Effekten, echte Einstellungsänderung resultieren (z.B. über den Mechanismus der Selbstbeobachtung). Die Argumentation ist plausibel. Kommt es allerdings zu keiner Verhaltensänderung besteht die Möglichkeit, dass die gemessenen positiven Kontakteffekte nicht auf andere Kontexte generalisieren. V2T7 Gaertner, Mann, Murrell & Dovidio (1989): Reduktion sozialer Diskriminierung durch Strategien der Re- oder Dekategorisierung. Ausgangslage: Aufbauend auf Annahmen der Theorie der sozialen Identität bzw. der Selbstkategorisierungstheorie gehen die Autoren davon aus, dass die Wahrnehmung klarer Gruppengrenzen Intergruppendiskriminierung und Eigengruppenfavorisierung begünstigt. Reduziert man die Salienz der Gruppengrenzen, kommt es zu einer Abnahme des intergroup bias. Es werden zwei alternative Strategien zur Reduktion von Eigengruppenfavorisierung (d.h. der relativen Bevorzugung der Eigengruppe) untersucht: Rekategorisierung und Dekategorisierung. Phänomen: Es wird angenommen, dass beide Strategien zur Reduktion von Eigengruppenfavorisierung beitragen können, allerdings sollte die Wirksamkeit auf unterschiedlichen Prozessen beruhen: Rekategorisierung sollte zu einem Anstieg der positiven Bewertung der Mitglieder der ursprünglichen Fremdgruppe führen. Dekategorisierung sollte zu einer Abnahme der relativen Bevorzugung der Angehörigen der ursprünglichen Eigengruppe führen. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: 1. Rekategorisierung und Dekategorisierung reduzieren die Eigengruppenfavorisierung (intergroup bias). 2. Die Reduktion des intergroup bias durch Rekategorisierung geschieht über eine positivere Bewertung der ursprünglichen Fremdgruppenmitglieder. 3. Die Reduktion des intergroup bias durch Dekategorisierung geschieht über eine negativere Bewertung der ursprünglichen Eigengruppenmitglieder. Laborexperiment. Ergebnisse: Die relative Bevorzugung der Mitglieder der Eigengruppe gegenüber einer Fremdgruppe lässt sich sowohl durch Rekategorisierung als auch durch Dekategorisierungsprozesse reduzieren; die Wirkung dieser beiden Prozesse beruht allerdings auf unterschiedlichen psychologischen Mechanismen. Durch Rekategorisierung werden die ehemaligen Mitglieder der Fremdgruppe positiver bewertet im Vergleich zu einer Intergruppensituation. Durch Dekategorisierung werden die ehemaligen Mitglieder der Eigengruppe und unerwartet auch die ehemaligen Mitglieder der Fremdgruppe negativer bewertet im Vergleich zu einer Intergruppensituation. Kritisches Resümee: Vor- und Nachteile einer compound manipulation (z.B. höhere Wirksamkeit, aber die genaue Angabe der tatsächlichen Ursache bzw. Ursachenbündel ist erschwert). Alternative Erklärung der Befunde: Theorie des realistischen Gruppenkonflikts (d.h. gemeinsame übergeordnete Ziele, Kooperation und Zielerreichung erklären den Unterschied in intergroup bias zwischen den treatments). Was spricht für die alternative Erklärung? Kooperation (in den Bedingungen "zwei Gruppen" und "einzelne Individuen" gab es Wettbewerb, wogegen in der Bedingung "eine Gruppe" Kooperation vorherrschte). Positive Verstärkung (positives Feedback wurde nur in "eine Gruppe", nicht aber in "zwei Gruppen" und "einzelne Individuen" vor der Messung der AV (Bewertung der Personen) gegeben). V2T8 Ensari & Miller (2002): Intergruppenkontakt: Die Effekte von Selbstenthüllungen, Typikalität und Salienz. Ausgangslage: Grundlage der in diesem Artikel berichteten Forschung ist eine theoretische Integration von Annahmen des Modells der Dekategorisierung bzw. Personalisierung und des Modells der wechselseitigen Differenzierung. Im Blickpunkt der Analyse steht die Rolle von Selbstenthüllungen eines Fremdgruppenmitglieds in einer kooperativen Interaktionssituation. Phänomen: Selbstenthüllungen eines Fremdgruppenmitglieds in einer kooperativen Interaktionssituation haben das Potential zur Veränderung der Einstellung gegenüber der Fremdgruppe insgesamt beizutragen ("Generalisierung"): 1. sie können zur Veränderung der initialen Kategorisierung beitragen, sie stellen eine gewisse Vertrautheit her und reduzieren somit mögliche Intergruppenängste und die Wahrnehmung des Fremdgruppenmitglieds wird komplexer und differenzierter, d.h. auch individueller, 2. sie können entsprechende Selbstenthüllungen beim Interaktionspartner hervorrufen (Reziprozität), da man sehr persönliche Informationen eher selten erhält, ihnen wird daher ein höherer Wert beigemessen als unpersönlichen Informationen und da man mit einer fremden Person üblicherweise in einer Austauschbeziehung steht, lösen diese persönlichen Informationen Verhalten gemäß der Reziprozitätsnorm aus, d.h. man gibt etwas im gleichen Umfang zurück. und 3. sie können Vertrauen stiften, da das Mitteilen sehr persönlicher Informationen impliziert, dass dem Empfänger der Information Vertrauen entgegen gebracht wird. Dieses Vertrauen hat wiederum positive Effekte auf die Einstellung des Empfängers gegenüber der Person, die die Informationen preisgibt. Daraus ergibt sich folgende zentrale Frage: Diese drei Prozesse spielen sich zunächst interpersonal, also auf einer persönlichen Ebene ab. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen sich die Einstellung nicht nur dem spezifischen Fremdgruppenmitglied gegenüber ändert, sondern gegenüber der Fremdgruppe insgesamt, d.h. die veränderte Einstellung generalisiert wird. Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit Selbstenthüllungen ihre positiven Effekte entfalten? Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: Selbstenthüllungs - Typikalitäts - Interaktionshypothese: Der positive Effekt tritt nur unter der Bedingung auf, dass der Interaktionspartner als typisches Mitglied der Fremdgruppe wahrgenommen wird, d.h. ein gemeinsamer Effekt von Typikalität und Selbstenthüllung reduziert den intergroup bias stärker als die Einzeleffekte. Experiment. Ergebnisse: Individuelle Selbstenthüllungen führten wie erwartet nur dann zur Generalisierung, wenn das Fremdgruppenmitglied als typisch wahrgenommen wurde. Sowohl Selbstenthüllung als auch Typikalität sind notwendige Bedingungen für die Generalisierung. V2T9 Stürmer & Simon (2004): Kollektive Identifikation und soziale Bewegungsbeteiligung. Ausgangslage: Obwohl viele Mitglieder benachteiligter Gruppen mit den Zielen entsprechender sozialer Bewegungen sympathisieren, beteiligt sich doch nur ein geringer Prozentsatz an kollektiven Aktionen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Die sozialpsychologischen Prozesse, die die Motivation der Gruppenmitglieder beeinflussen, sich an kollektiven Aktionen zu beteiligen, ist daher eine zentrale Fragestellung der Forschung zur sozialen Bewegungsbeteiligung. Es wird Bezug genommen auf das 4-Stufen-Modell von Klandermans zur sozialen Bewegungsbeteiligung und dem sozialer Identitätsansatz. Phänomen: Die Entwicklung der Motivation zur Teilnahme (Stufe 3) wird als besonderes Problem erkannt: Im Mittelpunkt stehen in Klandermans Modell Kosten-Nutzenkalkulationsprozesse, d.h. die Motivation sich zu beteiligen wird als Funktion von erwarteten Kosten und erwartetem Nutzen betrachtet. Die Unterscheidung von drei Motiven: das kollektive Motiv, das normative Motiv und das Belohnungsmotiv – für alle drei Motive werden nach Klandermans Modell Kalkulationsprozesse angestellt. Dieser Kosten-Nutzen-Ansatz ist als übermäßig individualistisch kritisiert worden, da er die Beziehung zwischen Individuum und Gruppe vernachlässigt. Soziale Bewegungsbeteiligung als Intergruppenverhalten: Die kollektive Identifikation eines Individuums sollte eine zentrale Rolle spielen für die Teilnahmemotivation (siehe sozialer Identitätsansatz). Hauptziele dieser Untersuchung sind die Klärung der Frage: Ist kollektive Identität ein eigenständiger Prädiktor in der Vorhersage der Teilnahme an sozialen Bewegungen und darüber hinaus ursächlich dafür? Untersuchung der relativen Bedeutung von Identifikation mit zwei unterschiedlichen Gruppen: a) der benachteiligten Gruppe; b) der sozialen Bewegungsorganisation (politisierte kollektive Identifikation). Das Untersuchungsdesign sollte ermöglichen zum einen die Prüfung von Eigenständigkeitsannahme (Prognoseeffekt, der über Wirkung anderer Faktoren hinausgeht) und zum anderen die Kausalitätsannahme (Ursache geht Wirkung zeitlich voraus). Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: 1. Identifikationsprozesse: Kollektive Identifikation mit der sozialen Bewegungsorganisation sollte besonders relevant für die Verhaltensvorhersage sein. 2. Kalkulationsprozesse: Das kollektive und das normative Motiv sollten besonders relevant für die Verhaltensvorhersage sein, während das Belohnungsmotiv weniger bedeutsam sein sollte. Fragebogenstudie im Kontext der deutschen Schwulenbewegung. Ergebnisse: 1. Identifikationsprozesse (i. S. v. Selbstdefinition als Gruppenmitglied) haben einen eigenständigen Vorhersagebeitrag bzgl. kollektiver Handlungen (kollektiver Protest und organisationales Engagement). 2. Teilnahme an kollektiven Protesten wird außerdem wahrscheinlicher, wenn wichtige andere Personen positiv auf die eigene Teilnahme reagieren (normatives Motiv). 3. Identifikation mit einer Bewegungsorganisation ist Ursache und Folge der Teilnahme an kollektiven Protesten (kausale Reziprozität). 4. Identifikation mit einer Bewegungsorganisation ist Ursache für organisationales Engagement. 5. Soziopolitischer Kontext moduliert die Wirksamkeit kollektiver Identifikationen. Kritisches Resümee: Unterschiede zwischen Identifikation mit sozialen Kategorien vs. politisierten Kategorien bezüglich: Inklusivitätsgrad, vgl. Identifikation mit SVD vs. als schwuler Mann (siehe z.B. auch das Korrespondenzprinzip von Ajzen und Fishbein, 1977); Inhalte von Gruppennormen, z.B. hinsichtlich des Machtkampfes, vgl. Identifikation als schwuler Mann bei latentem vs. offenem Konflikt. Warum haben kollektive und Belohnungsmotive keine eigenständigen Effekte? Mögliche Ursachen bzw. Schlussfolgerungen: Operationalisierung der Variablen (durch Multiplikation der WertErwartungskomponenten erhöht sich der Messfehler. Aber bei separater Berücksichtigung der Komponenten in der RA gab es gleiche Ergebnisse, globale Erwartungsmessung bei kollektivem Motiv); Spezifikation des Modells in Bezug auf seinen Geltungsbereich (z.B. Vorurteilslevel moderiert die Rolle normativer Motive, Vorhandensein einer Subkultur moderiert die Rolle von Belohnungsmotiven). V2T10 Simon & Ruhs (2008): Die Rolle dualer Identität für politische Partizipation. Ausgangslage: Die kollektive Mobilisierung zur Durchsetzung eigener politischer Ansprüche durch Migranten ist ein zunehmend relevanter werdendes politisches Thema in Einwanderungsländern. In diesem Artikel wird eine Feldstudie berichtet, die Politisierungsprozesse türkischer Migranten in Deutschland untersucht. Im Zentrum der empirischen Analyse steht das Konzept der dualen Identität (im konkreten Kontext: Identifikation als Deutscher und als Türke) und seine Bedeutung für die Erklärung unterschiedlicher Formen der politischen Partizipation. Die Effekte dualer Identifikation werden mit den Effekten ethnischer und religiöser Identifikation systematisch verglichen. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, welche Formen der Identifikation Prozesse der Radikalisierung und der Beteiligung an gewaltsamen politischen Auseinandersetzungen fördern. Hauptziel ist die Untersuchung der Beziehung zwischen dualer Identität und Politisierung. Phänomen: a) Politisierungsprozess aus sozialspsychologischer Perspektive: Der Politisierung kollektiver (=sozial geteilter) Identität gehen drei Prozess voraus: 1. Wahrnehmung sozial geteilter Missstände. Die Gruppenmitglieder teilen die Auffassung, dass es sich bei der Benachteiligung nicht um individuelle, sondern um Formen kollektiver Benachteiligung handelt, die viele Mitglieder der Eigengruppe betreffen. 2. Ursachenzuschreibung auf einen Gegner. Die Gruppenmitglieder identifizieren einen politischen Gegner oder Feind, wie beispielsweise eine bestimmte Fremdgruppe, Autorität oder "das System", das für die Missstände verantwortlich ist. 3. Triangulation der weiteren Gesellschaft. Die Gruppe weitet die Konfrontation mit dem Gegner in einen umfassenderen Macht-Kampf aus, der die Gesellschaft insgesamt (oder gesellschaftliche Repräsentanten) dazu zwingt, Partei zu ergreifen. b) Politisierte kollektive Identität als duale Identität. Zentrale Hypothesen / Fragestellungen: Eine schwächere Hypothese: Duale Identifikation als Deutscher und als Türke hat einen eigenständigen prädiktiven Wert für Politisierung türkischer Migranten in Deutschland. Eine stärkere Hypothese: Duale Identifikation hat einen kausalen Effekt auf Politisierung. Beachten Sie, dass sich das Konzept der dualen Identifikation im Kontext von Politisierungsprozessen nicht auf eine beliebige Kombination zweier Identifikationen bezieht. Vielmehr sollte die eine Komponente der dualen Identifikation die Ingroup Identifikation sein und die andere jene inklusivere soziale Kategorie, in deren Rahmen der Machtkampf zwischen Ingroup und relevanten Outgroups ausgetragen werden kann. Fragebogenstudie unter türkischen MigrantInnen zur Untersuchung der Beziehung zwischen dualer Identität und Politisierung. Ergebnisse: Die duale Identifikation und separatistische Identifikation sind signifikante Prädiktoren für Politisierung. Die duale Identifikation und frühere politische Aktivitäten sind signifikante Prädiktoren für tatsächliche Partizipation (civil involvement). Politisierung mediiert den Zusammenhang zwischen dualer Identifikation (zum Messzeitpunkt T1) und der tatsächlichen Partizipation (zum Messzeitpunkt T2). Wenn man in das Modell, das den direkten kausalen Zusammenhang zwischen dualer Identifikation und zivilem Engagement schätzt, den Mediator (Politisierung) aufnimmt, verschwindet der signifikante direkte Effekt der dualen Identifikation auf das zivile Engagement. Außerdem zeigt sich, dass duale Identifikation einen signifikanten Effekt auf Politisierung hat, die ihrerseits signifikant das zivile Engagement beeinflusst. Das bedeutet, dass die duale Identifikation nicht automatisch und unmittelbar das zivile Engagement beeinflusst, sondern nur weil durch die duale Identifizierung ein Politisierungsprozess in Gang gesetzt wird. Diese Politisierung der Gruppenmitgliedschaft und nicht die duale Identifikation als solche beeinflusst direkt das zivile Engagement. Die duale Identifikation scheint nur eine bestimmte Form politisierten Handelns zu beeinflussen, und zwar ein allgemein verbreitetes, kostenniedriges und konfliktarmes politisches Engagement. Der klassische politisierende Effekt dualer Identifikation scheint außerdem gruppenspezifisch zu sein: bei Gruppen, die insgesamt wenig politisch involviert sind, bleibt der Effekt aus. Schließlich kann der klassische politisierende Effekt dualer Identifikation kontextspezifisch sein: nur wenn der Kontext genügend konflikthaft und daher im Bewusstsein der Gruppenmitglieder präsent ist, sind Effekte zu erwarten. Außerdem kann der gefundene Zusammenhang spezifisch für den Migrationskontext sein, in dem kulturelle Anerkennung möglicherweise wichtiger ist als Ansprüche auf die Verbesserung der materiellen bzw. ökonomischen Lage sozialer Minoritäten. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl duale Identifikation als auch separatistische Identifikation eigenständige Prädiktoren für Politisierung sind. Währen die duale Identifikation durch den positiven Bezug auf eine inklusivere soziale Kategorie einen befriedenden Effekt auf Politisierung erwarten lässt, dürfte die exklusivere, separatistische Identifikation auf lange Sicht für Radikalisierung als eine andere Form der Politisierung prädisponieren. Die verschiedenen Formen der Politisierung lassen sich anhand der (Non)Normativität von Mitteln, die die Gruppe einsetzt und Ziele, die sie verfolgt, unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen normativen und nicht normativen politischen Mittel und Zielen ist kontextabhängig, genauer: es sind die dominanten sozialen Gruppen, die diese Unterscheidung treffen. Ein Mittel, das also für die eine Gruppe nicht normativ ist, mag für eine andere Gruppe normativ sein. Normen und ihr Gegenteil sind also gruppenspezifisch. Mit einem solchen Verständnis des politischen Handelns distanzieren sich der Autor und die Autorin von Erklärungen für Radikalisierung und Terrorismus, die auf dem Konzept der universalen Normen oder dem Konzept essenzieller Eigenschaften (z.B. die terroristische Persönlichkeit) beruhen. Gemäßigte normative Formen der Politisierung implizieren also, dass die im Machtkampf sich gegenüberstehenden Gruppen, die jeweils andere Gruppe als zu einem gemeinsamen normativen Raum gehörig betrachten. In Bezug auf die Definition der normativen bzw. nicht normativen Mittel und Ziele gibt es zwischen beiden Gruppen keinen Dissens. Radikalisierung impliziert im Unterschied dazu, dass Normen und normatives Verhalten ausschließlich gegenüber Mitgliedern der eigenen Gruppe Gültigkeit haben. Der Machtkampf ist durch einen Dissens in Bezug auf die Definition des Normativen gekennzeichnet. Nach dieser Logik und aus der Sicht der dominanten Gruppe erscheint es stringent, die duale Identifikation in Zusammenhang mit normativen Formen der Politisierung und die separatistische Identifikation in Zusammenhang mit radikalen, nicht normativen Formen der Politisierung zu bringen.