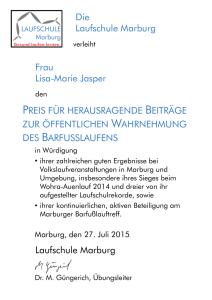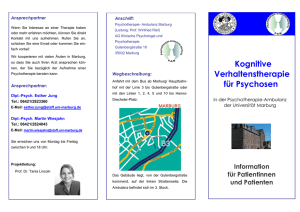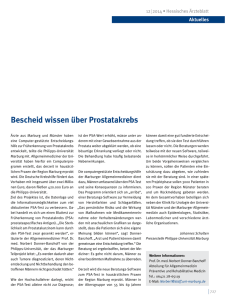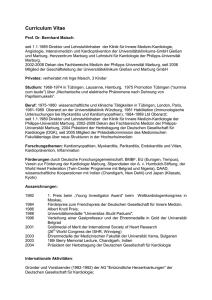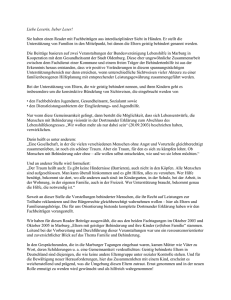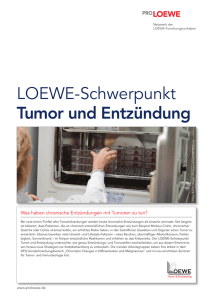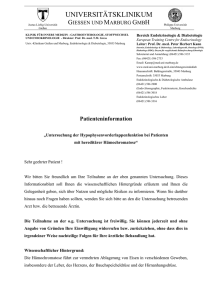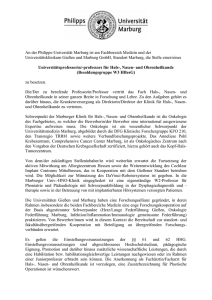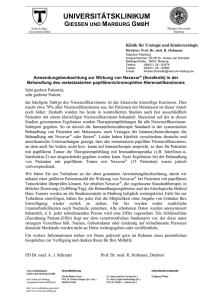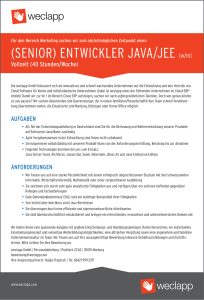Teil I
Werbung

0 13 Höfe am Schlossberg Marburgs vergessene Geschichte ein historischer Report Impressum: 13 Höfe am Schlossberg Marburgs vergessene Geschichte published by epubl g.m.b.H Berlin Copyrigth © 2012 Reinhold Drusel www.drusel-ockershausen.de ISBN 975-3-8442-2168- 1 Inhalt Inhaltsverzeichnis 2 Lageplan 4 Einleitung 5 - 16 Teil I 13 Höfe Schlossberg 17 - 85 Teil II Marburg im dreißigjährigen Krieg 86 - 130 Marburg im siebenjährigen Krieg 131 - 158 Der Marburger Aufstand vom 24. Juni 1809 159 - 199 Teil III Teil IV Kirchliches Leben am Schlossberg zu Marburg 200 - 210 Marburger Stadttore und Pforten im Mittelalter 211 - 213 Quellen 214 - 221 Kurzbeschreibung Umschlag Außenseite 2 3 Lageplan der 13 Höfe am Schlossberg zu Marburg (o.G.) 1 Der Forsthof 8 Der Weitershäuser Hof 2 Der Milchlingshof 9 Der Berlep’sche Hof 3 Der Rabenauer Hof 10 Die Wolffsburg 4 Der Hühnerhof 5 Der Scheurnschloss’sche Hof 11 Der Feigenhof 6 Die Kaplanei 12 Der Dörnberger Hof 7 Der Glaser’sche Hof 13 Der Renthof 4 Einleitung Die exakte Zeitbestimmung der Entstehung des Ortes Marburg gehört offenbar zu den großen Geheimnissen unserer Heimatgeschichte, die sich partout noch immer verweigert, exakte urkundlich belegbare Beweise dazu preiszugeben. Halten wir uns also weiterhin, mangels präziserer Hinweise, an die Aufsätze und historischen Beschreibungen, die uns kluge Heimatforscher und Historiker dazu hinterlassen haben. Einen aufschlussreichen Bericht vermittelte der Pfarrer an der lutherischen Pfarrkirche und „Eclesiast“ zu St. Elisabeth in Marburg, Wilhelm Kolbe, der am 16. September des Jahres 1878 einen ausführlichen Vortrag im Marburger Rathaus gehalten hat. Wilhelm Kolbe verweist auf den urkundlich nachweisbaren Zeitraum, der die Existenz Marburgs ab 1122 nennt. Angaben die zu einer noch früheren Entstehung von Marburg führen, werden auch bei Wilhelm Kolbe in den Bereich der Sagen verwiesen und auf die Aufzeichnungen des bekannten hessischen Chronisten Wigand Gerstenberger (1457-1522) aus Frankenberg. Danach soll Graf Otto (Otto von Nordheim und Boyneburg) der Gründer Marburgs gewesen sein, etwa in der Mitte des 11. Jh. In diesen Zeitraum führen uns auch andere Beschreibungen. Sie betreffen allein den Ort Marburg. Hinsichtlich der Entstehung der Burg dürfen wir jedoch von einem erheblich früheren Zeitpunkt ausgehen. So haben nicht zuletzt die vor einigen Jahren unter der Leitung des Stadtbaudirektors Elmar Brohl rund um das Marburger Schloss durchgeführten Ausgrabungen und Bodenuntersuchungen ergeben, dass es dort ein 5 Bauwerk gegeben hat, dessen Ursprung weit vor die Zeit der Stadtgründung im 12. Jh. zurückgeht. Ein Modell zeigt, wie die Burganlage vor der Stadtgründung, an der Schwelle des 11. und 12. Jh. ausgesehen haben könnte. Um die Burg herum siedeln sich in dieser Zeit mehr und mehr Bewohner an. Die Einwohnerschaften einiger untergegangener Ortschaften rund um Marburg, (Walpershausen, Zahlbach, Lammersbach, Allershausen u. a.) zieht es an den Ort der ihnen eine größere Sicherheit verspricht. Am Fuße der Burg wächst der Marktflecken Marburg. Er legt bald den Charakter eines Dorfes ab. Die Ansiedlung mausert sich zur Stadt am Burgberge, noch ehe sie die offiziellen Siegel und Stadtrechte im Jahr 1311 erwerben wird. Entscheidend für Marburg werden jedoch die Ereignisse, die im Zuge des Wirkens der thüringischen Landgräfin Elisabeth, 6 Witwe des Landgrafen Ludwig II., nach ihrem frühen Tode im Jahr 1231 eintreten. Der nur sehr kurze Zeitabschnitt ihres Lebens am Fuße der Burg in Marburg von 1228 bis 1231 führt im Folgenden zu einer Initialzündung der beginnenden hessischen und der frühen Marburger Geschichte. Sie ist heute auf das Engste mit Elisabeth, der Patronin von Hessen und Marburg eng verbunden. Dabei lag es gewiss nicht in Elisabeths Absicht, prägend in die politische Landesgeschichte einzugreifen. Es war vielmehr Ihre Tochter, Herzogin Sophie von Brabant, die einen günstigen Zeitpunkt dazu nutzt, die Grafschaft Hessen aus dem thüringischen Besitz zu lösen. Sie setzt durch, dass ihr Sohn Heinrich als erster Landgraf des neu entstandenen Landes Hessen eingesetzt wird. Zunächst übernimmt Sophie von Brabant die Regentschaft über das Land, bis zur Mündigkeit des Sohnes, der als Landgraf Heinrich I. (1244-1308) auf dem Schloss in der Residenzstadt Marburg residieren wird. Sophie von Brabant veranlasst den Ausbau der Burg zu einem Residenzschloss. Sie versammelt um sich eine Anzahl von Gefolgsleuten aus den Adelsfamilien der nahen Grafschaften, die als Burgmänner nun dem unmittelbaren Schutz der Landgrafschaft dienen. Rund um den Schlossberg errichten diese Burgmänner ihre Höfe. Sie bilden den Kern der Vertrauten der Landgrafen. Dafür werden sie mit Titeln versehen und mit Grundbesitz rund um den Schlossberg. Zu ihrem Unterhalt werden sie mit landwirtschaftlichen Gütern in den nahen Ortschaften belehnt. 7 Das Residenzschloss in Marburg im 17. Jh. nach einem Modell Nach ihrer Herkunft erhalten sich die Familiennamen bei einigen der frühen Anwesen am Schlossberg noch lange Zeit im Volksmund fort. Ihre besondere Stellung als Burgmannen stellt sie frei von Zins- und sonstigen Abgaben an den Landesherrn. Bei einigen Höfen gehen die ursprünglichen Namen ihrer Erbauer unter. Sie nehmen nun den jeweiligen Namen eines der späteren Besitzer an und bleiben im Volksmund unter diesen neuen Bezeichnungen bestehen, so der Berlep’sche Hof und der Glaser’sche Hof in der Ritterstrasse. Andere Hofbezeichnungen leben noch heute fort, obwohl die ursprünglichen Besitzungen untergegangen sind wie der Renthof, der Dörnberger Hof und die Wolffsburg. Die Dreizehn Höfe am Burgberg bilden ursprünglich einen Ring um die Schlossmauern. Sie gehören nicht zu den in dieser Zeit entstehenden Stadthäusern in Marburg. Bis auf wenige Ausnahmen gingen diese ursprünglichen Höfe unter, oder sie veränderten ihr Aussehen. 8 Die Skizze des Schlossberges mit den Positionen der Höfe am Schlossberg in Marburg Was nun aus ihnen wurde, dies will dieser Bericht ein wenig näher beleuchten. Bei den Spaziergängen durch unsere schöne Marbuger Altstadt, vom Marktplatz hinauf zur Ritterstrasse und Landgraf-Philipp Strasse und weiter zum Schloss erkennt man mehrere ältere Toreinfahrten und Portale. Dahinter sucht man vergeblich die offenbar dazu gehörenden prächtigen historischen Bauten aus der Zeit ihrer Entstehung im 14. und 15. Jh. Etliche davon sind in den turbulenten Ereignissen in der Geschichte des Marburger Schlossberges untergegangen. In alten Skizzen von Carl Justi und Otto Ubbelohde, die man in älteren Druckschriften noch ausfindig machen kann, erkennt man noch die alten Bauwerke, die im 19. Jh. zum Teil noch als Ruinen bestanden haben. Man ist geneigt, etwas mehr davon zu erfahren, was 9 sich hinter diesen Pforten des bergseitigen Hanges an der alten Burgstrasse, der heutigen Landgraf-Philipp Strasse, verborgen haben könnte. Die alten Häuser, die man hinter den Pforten antreffen möchte, gibt es nicht mehr. Dies führte nun den interessierten Spaziergänger zu der Idee, die fast vergessene Geschichte der alten Höfe rund um den Schlossberg und das Schicksal ihrer Bewohner zu erkunden und neu aufzuschreiben. Dabei sind es insbesondere die Häuser der Ritterstrasse und der Landgraf-Phlipp Strasse, die samt und sonders mit bemerkenswerten historischen Ereignissen aufwarten können. Die Einflüsse der Reformation in Hessen spiegeln sich in ihren Geschichten ebenso, wie der im 30jährigen Krieg ausgefochtene Bruderkrieg der Hessen-Darmstädter und der Hessen-Kasseler um das „Marburger Erbe“. Der Start in dieses Vorhaben wurde dadurch erleichtert, als man auf eine Vielzahl von historischen Berichten zurück greifen kann, die von honorigen Marburger und hessischen Historikern vor vielen Jahrzehnten zu 10 diesem Thema zusammen getragen wurden. Die von den diesen namhaften Heimatkundlern vorgenommenen Nachforschungen in den Archiven, maßgeblich nach der Auswertung der alten „Marburger Ratsprotokolle“ erleichterte die Aufgabe, eine Kurzfassung von interessanten Details der Marburger Geschichte neu zusammen zu stellen. Der Verfasser dieser Schrift bezieht sich daher im Wesentlichen auf die historischen Schriftsätze der hervorragenden Kenner unserer Stadt wie: Wilhelm Bücking, Wilhelm Kolbe, Walter Kürschner, Ferdinand Justi, Carl Justi, Ludwig Bickel und andere. Es erscheint kaum denkbar, die Geschichte der Ritterstrasse und ihre Bewohner ausführlicher und inhaltsreicher zu schildern, als dies von Carl Knetsch in seinem Werk „Der Forsthof und die Ritterstrasse zu Marburg“ aus dem Jahre 1921 dargestellt wird. Die hier vorgenommene Auswertung der erwähnten historischen Texte zur Marburger Geschichte kann nur als eine verkürzte Zusammenfassung der z. T. vor über 100 Jahren erstellten Aufsätze gelten. Die historischen Fotografien und Skizzen sowie die neueren Fotos sollen helfen die Örtlichkeit zu den hier vorgenommenen Schilderungen zu vermitteln. Die Quellen sind am Ende dieses Berichtes aufgelistet. Hinzu kommt, dass durch die neuen Medienangebote über „Wikipedia“ ergänzende Erkenntnisse zu den Ereignissen aus der Zeit des Geschehens in den Report eingebettet werden konnten. Erfasst wurde die Geschichte der dreizehn Höfe, die einst innerhalb der alten Stadtmauern, rund um den Schlossberg angesiedelt waren. Sie entstanden, wie erwähnt, nach und nach, ab dem 13. Jh. als Burglehen für die hier angesiedelten, adligen Burgmannfamilien. 11 Alle Höfe waren ursprünglich von den in Marburg residierenden Landgrafen „abgabenfrei“ an diese Schutzritterschaft zu Lehen übergeben worden. Eine geordnete und zielgerichtete Bauplanung aus dieser Zeit kann am Schlossberg in Marburg nicht ausgemacht werden. Strassen und Wege gab es nicht. Alle Grundstücke wurden über Saumpfade erreicht, bis es ab dem 16. Jh. zu den ersten Wegeanlegungen kommt. Eine Orientierung der Höfe nach heutigen Maßstäben gab es ebenfalls nicht. Strassenbezeichnungen und Hausnummern waren noch für lange Zeit unbekannt. Bei allen der 13 hier beschriebenen Höfen bezieht sich die Endbezeichnung „Hof“ nicht auf einen hier ggf. vermuteten früheren Gasthof, sondern sie weist allein auf den Namen der Erbauer, oder der später hier wohnenden Eigentümer hin. Die steile Hanglage ermöglichte den Bewohnern zu keiner Zeit die Annehmlichkeiten einer Stadtwohnung in der Ebene. Die wunderbare Fernsicht in das Lahntal dürfte indessen die Bewohner am Burgberg schon damals beglückt haben. Der Vorteil der Behausungen am Burgberg lag vor allem in der Abgabenfreiheit ihrer Besitzer. Von den üblichen Belastungen, denen alle Bürgerhäuser in der Stadt Marburg durch die ständigen Einquartierungen des Militärpersonals über viele Jahrhunderte ausgesetzt waren, blieben die privilegierten Behausungen am Schlossberg - zumindest formal – verschont. Allein an diese Befreiung hielten sich indessen die verschiedensten Belagerer und Eroberer der Stadt Marburg und der Burg in ihrer Geschichte nicht immer. Rund um das Schloss entstehen Zug um Zug neue Wohngebäude, Viehställe, Scheunen und Remisen. Der 12 Renthof unterhalb der nordseitigen Schlossmauer wird zur zentralen fiskalischen Anlauf- und Sammelstelle in der Landgrafschaft Hessen-Marburg. Der Schlossberg wird zum zentralen Bereich des städtischen Lebens. Von Anbeginn steht im Mittelpunkt der wachsenden Stadt am Burgberg das kirchliche Leben. An Stelle der zu Beginn des 13. Jh. errichteten Heiligkreuzkapelle entsteht bis zum Ende des 13. Jahrhunderts die St. Marienkirche, heute lutherische Pfarrkirche. Sie bildet - neben dem imposanten Schloss - ein prägendes Element des mittelalterlichen Stadtbildes. An ihrer Erbauung und Ausgestaltung hatten sich die adligen Familien zu allen Zeiten beteiligt. Der Kerner in der Ritterstrasse, in unmittelbarer Nähe der St. Marienkirche, diente in verschiedenen Funktionen für die Stadt Marburg, so auch als Rathaus der Stadt, bis zum Jahre 1527. Nachdem auch für die landesherrliche Ordnungsmacht die Entwicklung zu größeren Behörden und Ämtern, 13 nebst dem dazu gehörenden Personal führte, erfolgt für einige der vormaligen Höfe am Schlossberg eine einschneidende Veränderung. Etliche von ihnen fallen zurück in dass Eigentum der Landgrafen, die nun hier neue Gebäude errichten lassen. Im 16. Jh. entstehen neue Kanzleien und neue prächtige Häuser auf den alten Fundamenten. Nach dem Tode des letzten in Marburg residierenden Landgrafen Ludwig IV. von Hessen-Marburg im Jahr 1604 setzte sich die bereits eingeleitete Veränderung der Besitzverhältnisse bei fast allen Höfen fort. Anstelle der alten Burgmannfamilien bewohnen nun mehr und mehr die hohen landgräflichen Beamten und die Professoren der Marburger Universität die alten Höfe. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten nun allerdings die Namen der einzelnen Höfe oftmals mit deren neuen Besitzern. Gleichwohl ist es erstaunlich, dass einige Höfe ihre ursprüngliche Bezeichnung nicht verloren haben und für eine lange Zeit den Marburgern als Orientierung dienten. Andere Höfe gingen durch die Kriegseinwirkungen des 30jährigen Krieges völlig unter und wurden nicht wieder aufgebaut. Auch Ihre Namen bestehen noch lange Zeit im Volksmund fort, ehe sie nach und nach gänzlich in Vergessenheit geraten sind. Die Standorte der alten Höfe sind längst vergessen und werden wohl nur noch wenigen Marburgern „dem Namen nach“ bekannt sein. Der untergegangene alte „Feigenhof“ an der unteren Landgraf-Philipp Strasse wurde ebenso wenig wieder neu aufgebaut, wie die „Wolffsburg“ auf dem Gelände des ehemaligen „Hosenhofes“, der bereits im 15. Jh. unterging. Dieses Schicksal erlitten auch der „Weitershäuser Hof“, der zwischen dem „Berlep’schen und dem „Glaser14 schen Hof“ in der Ritterstrasse lag. Auch der „Rabenauer Hof“, der dem Forsthof in der Ritterstrasse gegenüber liegt, wurde nach seinem Abbruch im 30jährigen Krieg nicht wieder aufgebaut. Für alle Häuser die ihre Herkunft von den alten Höfen am Schlossberg ableiten, ergeben sich über die Jahrhunderte hinweg außergewöhnliche Geschichten und ständig wechselnde Eigentümer und Bewohner. Die lange Liste der honorigen Bewohner der Ritterstrasse erscheint noch heute als ein einziges „Stelldichein“ des hohen- und niederen deutschen und alt-hessischen Adels, der sich an der Stätte der Gründung des Landes Hessen versammelt hat, um den Ruhm Marburgs, allein schon durch ihre Anwesenheit, weiter zu tragen. Dabei kommt natürlich allen „Neuankömmlingen“ in Marburg seit je her eine ganz besondere Mentalität der Alt-Marburger entgegen. Eine in Jahrhunderten gewachsene Gastfreundschaft, die bis heute dazu führt, dass die Marburger Bürgerschaft die Gestaltung ihrer Stadt, ihrer Entwicklung und die gesamte Zukunftsplanung, seit der Stadtgründung im 13. Jh. bis heute, überwiegend bis in unsere heutige Zeit, ihren honrigen Neubürgern überlassen wird. Kaum ein Marburger, der vormals nicht dem Adel, später dem höheren Beamtenstand angehört hätte, oder aus dem Kreise der Honoratioren aus Lehre und Forschung hervorgegangen ist, hat es geschafft, in die lange Liste der Berühmtheiten unserer Stadt aufgenommen zu werden. Die Namen zahlreicher Eigentümer oder späterer der Bewohner der Ritterstrasse finden sich indessen noch heute unter den Stadtbewohnern. Einige von Ihnen gehören längst auch zu den Urgesteinen der heutigen Marburger Bürgerschaft. An ihre interessanten Fami15 liengeschichten wollen wir erinnern. Sie haben die Geschichte des Marburger Schlossberges geprägt. Die Aufzählungen der Erbauer und späteren Bewohner der Höfe am Schlossberg in Marburg gehen in diesem Bericht bis zur Zeitenwende des 19./20. Jh. Eine Fortschreibung der interessanten Familiengeschichten sollte deren Nachkommen vorbehalten bleiben. In den Teilen II, III, und IV dieses Reportes werden die bemerkenswerten überregionalen politischen Ereignisse und ihre Auswirkungen in Marburg beleuchtet. • Der 30jährige Krieg 1618 bis 1648. • Der siebenjährige Krieg 1756 bis 1763. • Der „Marburger Aufstand“ 1809. Im Zuge dieser Ereignisse bestand höchste Gefahr für die Existenz der Stadt und ihrer Bewohner. Diese Begebenheiten sind eng verbunden mit dem Schicksal der Menschen am Burgberg zu Marburg. 16 Teil I 13 Höfe am Schlossberg Der Forsthof Vom Rodenhof zum Forsthof Ritterstrasse 15 und 16 Der Forsthof (Rodenhof) Aufnahme von Ludwig Bickel 1878 17 Die bei Weitem vielseitigsten Hinweise die wir aus alter Marburger Zeit mit einem der 13 Höfe rund um den Schlossberg verbinden, betreffen den Forsthof der aus dem historischen „Rodenhof.“ hervorgegangen ist. Bemerkenswerte Stationen der Marburger und der Hessischen Geschichte begleiten diesen interessanten Hof bis heute. Die historische Fotografie aus dem Jahre 1878 zeigt den Forsthof noch frei von der Begrünung, die heute den gesamten Marburger Schlossberg umrankt. Die Mauern und ruinenartigen Mauerreste auf dem Grundstück spiegeln die zahlreichen baulichen Veränderungen wieder, die dieser imposante Gebäudekomplex in den Jahrhunderten seit seiner Entstehung erfahren hat. Das Gebäude am rechten Bildrand gehört ebenso wie die zahlreichen Nebengebäude, den Ställen und Remisen zum historischen Rodenhof, der ursprünglich als burgfreies Anwesen der begüterten Familie der „Rode“, die in früher Zeit auch als „Rufus zu Marburg“ genannt wird, mit dem Hinweis auf die roten Haarfarbe ihres Stammvaters. Auch der Ketzerrichter „Konrad von Marburg“ (frühes 13. Jh.) soll aus dieser Familie hervorgegangen sein. 18 Kellergewölbe des Rodenhofes, gezeichnet von Otto Ubbelohde Der Rodenhof wurde auf direkt in den Fels gehauenen gewaltigen Unterbauten errichtet. Über zwei Kellergeschossen erhebt sich das auffällige Haupthaus, das im Jahre 1597 völlig abbrannte und 1599 wieder neu erstellt wurde. Seit etwa 1300 liegen Urkunden vor, die auf einen ausgedehnten Besitz- und Güterstand der Burgmannfamilie „Rode“ am Burgberg hinweisen. So wird auch von einem zweiten Hofe der „Roden“ am Burgberg ausgegangen, der offenbar völlig untergegangen ist. Noch heute bezeugen die Namen: „Rotenberg, Roter Graben oder der „Rote Hof in Ockershausen“ auf umfangreiche Besitzungen der „Roden“ hin. Als eine der Burgmannfamilien gründen sie, gemeinsam neben anderen Adelsfamilien, im frühen 13. Jh. ihre Behausungen am Schlossberg. Dies geschieht zum unmittelbaren Schutze für die Landgrafen, die ihre engsten wehrhaften Getreuen in ihrer Nähe um sich versammeln. Die exponierte Lage des Anwesens der „Roden“ direkt unterhalb der Schlossmauer unterstreicht die hohe Stellung ihrer Besitzer. Die zahlreichen hoch stehenden Persönlichkeiten die den Hof in den Jahrhunderten bewohnt haben, bestätigen die herausragende Bedeutung dieser Familie in der frühen Marburger Geschichte. Nachweisliche Erwähnungen findet ein „Kraft Rode“ aus Marburg, der auch als Kirchhainer Amtmann im Jahre 1348 tätig ist. Als Grünberger Amtmann wirkt „Kraft Rode“ in den Jahren 1364 und 1371. Dessen Sohn Dietrich Rode ist landgräflicher Schultheiß von Marburg und wird als Landvogt an der Lahn genannt. Verheiratet war er mit Else, geb. von Schenck zu Schweinsberg. Eine Tochter der Familie 19 Rode ist als Nonne im Kloster von Caldern nachgewiesen. Aus den Nachkommen der Familie Rode entstammt auch Elisabeth Rode, die als Äbtissin von 1479 bis 1500 an der Spitze des Stifts zu Wetter wirkte. Ein weiterer Nachkömmling, Eberhard Rode, dient seit 1446 als Ritter des deutschen Ordens zu Marburg. Eberhard Rode wird in einer Urkunde aus 1504 als Inhaber des Rodenhofes genannt. Sein Wappen, gemalt von Johann von der Leyte im Jahre 1511, befand sich im Katharinenaltar in der Elisabethkirche. „Leonhart in der Roden Hofe“ wird 1558 zumindest als ein Teilbesitzer des Hofes in Marburg genannt. Die Familie Rode hat gegen Ende des 16. Jh. ihren Sitz nach Weilburg verlegt. Der letzte der „Rode“ in Marburg, Georg Rode, starb im Jahre 1599. Ein auf den Kopf gestelltes Wappenrelief soll bezeugen, dass mit ihm der letzte seines Stammes ausgestorben ist. Nach dem Jahre 1570 gelangt der Rodenhof wieder in den Besitz des Marburger Landgrafen Ludwig IV. (1537-1604), der ihn als freien Burgsitz dem Kammersekretarius Alexander Dietrich schenkt. Von den Erben Dietrichs wird der Rodenhof im Jahre 1596 wieder an den Landgrafen Ludwig IV. verkauft, der nun den gesamten Hof und Garten 1597 seiner Gemahlin, Maria geb. Gräfin von Mansfeld, schenkt. Seit dieser Zeit wird das große Wohnhaus von Philipp von Baumbach, Kammerjunker der Landgräfin Maria, bewohnt. Am 29. März 1598 brennt das gesamte Gebäude „nach Unvorsichtigkeit des Gesindes“ ab. Auf Veranlassung der Landgräfin Maria wird das Haus wieder aufgebaut und dient nun weiterhin ais Wohnung für den landgräflichen Kammermeister Philipp von Baumbach. Die Jahre von 1593 bis zum Tode von Landgraf Ludwig IV. 1604 sind nicht ohne Pikanterie. Philipp Ludwig 20 Wappen der adligen Familie von Baumbach Kammermeister von Baumbach hatte den in 1593 verstorbenen landgräflichen Hofmeister Hans Scheuernschloss zu Hachborn am Hofe von Ludwig IV. abgelöst. Baumbach, ein fescher junger Mann von Adel, stand in hoher Gunst des Landgrafen. Vom Hofjunker avancierte er bald zum Kammerjunker, Frauenzimmerhofmeister und zum Haushofmeister, mithin zum höchsten Beamten bei Hofe. Er machte bald Eindruck auf die Landgräfin Maria (1567 – 1635), die 3o Jahre jünger war als ihr Gemahl Ludwig IV. Es entstand offenbar ein Liebesverhältnis zwischen Baumbach und Landgräfin Maria, von dem alle Welt in Marburg zu wissen glaubte, nur nicht ihr Gemahl Ludwig. Er fand nichts dabei, dass Baumbach auf Anordnung von Maria die Stadtwohnung aufgab und in den Rodenhof, unmittelbar an der Schlossmauer und nahe der Behausung der Landgräfin, einzog. Die kaum verborgenen Begegnungen des offenkundigen Liebespaares fanden sowohl im Schloss, im Rodenhof und auf ausgedehnten Reisen statt, die Baumbach gemeinsam mit der Landgräfin unternahm. Diese Vorgänge bereiteten den landgräflichen Verwandten in Kassel und Darmstadt großes Unbehagen. Landgraf Moritz von Hessen-Kassel (1572-1632) der nach dem Tode des kinderlos verstorbenen Landgrafen Ludwig IV. im Jahr 1604 dessen Erbe in Oberhessen angetreten hatte und Hessen-Marburg in die 21 Landgrafschaft Hessen-Kassel eingliederte, nahm dies zum Anlass, der ungeliebten jungen Witwe des Onkels Ludwig die größten Erbschaftsprobleme zu bereiten. Landgraf Moritz von Hessen-Kassel Er konfiszierte die großzügigen Schenkungen Ludwigs IV. an seine Gemahlin und überzog ihren Liebhaber, den Hofmeister Philipp Ludwig von Baumbach mit Anklagen. Ludwig von Baumbach wurde am 14. April 1605 in das Gefängnis Ziegenhain eingewiesen. Gegen 245 Anklagepunkte musste sich Baumbach vor dem peinlichen Gericht verteidigen. Angeklagt wurde er der „Hexerei, Giftmischerei, Zauberei, Kristallseherei, Segensprechen, Besitzer verdächtiger Knöchlein, Alräunchen und Wolfsaugen zu sein“ und von anderen merkwürdigen Dingen, darunter eine „ziemlich zerblättert und gebrauchte Schandkarte zu besitzen mit allerhand hurerischen Gemälden“ darauf. Nur durch Vermittlung der Verwandtschaften von Baumbachs und der Landgrafenwitwe gelang es, Philipp Ludwig von Baumbach gegen Ende des Jahres 1605 wieder auf freien Fuß zu setzen. Dafür musste Maria von Mansfeld den größten Teil ihres von Landgraf Ludwig IV. erhaltenen Eigentums an den Landgrafen Moritz ab22 treten. Mit dieser Episode endet die erste historische Etappe des alten Rodenhofes. Landgraf Moritz hatte nun andere Verwendungen für das recht umfangreiche Anwesen vorgesehen. Zunächst wies er dem Landvogt und Statthalter an der Lahn, Rudolf Wilhelm Rau zu Holzhausen, das Haus als dessen Wohnung zu. Daran erinnert die kurzzeitig verwendete Bezeichnung „Vogtei“ für das Anwesen. Nach 1611 wird das Haus als Wohnung des Herrn Oberschultheißen genannt. Offensichtlich diente das Anwesen in der Folgezeit den verschiedenen landgräflichen Verwaltungen. Eine sehr lebendige Zeit erfuhr der Rodenhof, nachdem Landgraf Moritz im Jahre 1606 ein Ballhaus, angrenzend an den alten Rodenhof, errichten ließ. Unmittelbar an der Stadtmauer vor dem Kalbstor, entlang der Ritterstrasse hinauf zur Schlossmauer, befand sich auf schwierigem topografischen Terrain das Ballhaus. Es diente beinahe zweihundert Jahre lang den vielseitigsten Tanz- Spiel- und Sportarten der Zeit, den zahlreichen festlichen Anlässen der landgräflichen Beamtenschaft, den Notablen der Universität und der Marburger Bürgerschaft. Das nach den Kriegseinwirkungen des 30jährigen und des siebenjährigen Krieges völlig herunter gekommene Ballhaus wurde um das Jahr 1780 abgerissen. Auf dem Terrain des ehemaligen Ballhauses befindet sich nun ein Gartenhäuschen auch Teehäuschen genannt - aus dem Jahre 1800. In der Zeit zwischen 1625 bis 1645 als Marburg und Oberhessen unter der Obhut von Hessen-Darmstadt stand, erfolgten weitere Umbrüche rund um das geschichtsträchtige Gemäuer des alten Rodenhofes. Dafür sorgten kurzzeitig zwischen 1627 und 1630 die jungen hessen-darmstädtischen Prinzen: Heinrich und 23 Friedrich (10 und 13 jährig). Sie wohnten zunächst im Schloss. Dort verursachten sie wohl allerlei Unruhe und Schabernack, als der ältere Bruder Landgraf Georg II. im Jahre 1627 seine Braut Sophie Eleonore, Tochter des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, glanzvoll im Marburger Schloss empfing. Georg II. „beförderte“ die jungen Brüder kurzerhand in den Rodenhof, was diesen außerordentlich gelegen kam. Sie verlebten hier ihre schönsten und ungebundenen Jugendjahre. Nachdem Hessen-Marburg ab 1648 wieder an HessenKassel angeschlossen wurde, diente das Anwesen bis zum Jahre 1800 als Sitz der Landesoberförsterei und als Wohnung der Oberförster. Von diesem Zeitabschnitt her leitet sich nun der bis heute verwendete Begriff des „Forsthofes“ ab. Der bekannteste aller in Marburg dienenden Oberförster, der das Forsthaus zu seiner Wohnung und zum Arbeitsplatz machen konnte, war Ludwig Carl Eberhardt Heinrich Friedrich von Wildungen. Am 22. November 1799 hatte er sein Amt als Oberförster in Marburg angetreten, um es bis zu seinem Tode im Jahre 1822 auszuüben. Wildungen, ein begnadeter Forstmann, gestaltete den heimischen Wald mit neuen Ideen zu einem bemerkenswerten und ökonomisch bedeutenden Einkommenszweig für die landgräfliche Verwaltung. Als Dichter und Poet, als Natur liebender Forstmann und als Jäger war er in seiner Zeit ein bekannter und beliebter Zeitgenosse. Akribisch hatte er seine Bestattung und den Begräbnisplatz organisiert. Ein Denkmal das nach seinen Wünschen gestaltet wurde, befindet sich noch immer am Wege hinter der Landesheilanstalt in Marburg (Psy24 schiatriche Klinik) zwischen dem oberen und dem unteren Richtsberg. Wildungens Grabmal Sein sehnlichster Wunsch, den geliebten Forsthof zu erwerben als er im Jahre 1800 vom Landgrafen zum Verkauf angeboten wurde, ging nicht in Erfüllung. Obwohl der von ihm angebotene Kaufpreis höher war, als der Kaufpreis den Prof. Weis ein Jahr später dafür zu entrichten hatte, erhielt Wildungen den Zuschlag nicht. Die Willkür des hessischen Landgrafen Wilhelm IX. (später 1. Kurfürst von Hessen-Kassel) ließ es nicht zu, dass der Forsthof an Wildungen verkauft wurde. Der Anlass der Zurückweisung Wildungens durch den Landgrafen blieb unergründlich. Das gesamte Anwesen wird indessen im Jahre 1801 an den Professor der Jurisprudenz Philipp Friedrich Weis verkauft. Damit begann für das alte Herrenhaus mit dem unterhalb stehenden kleineren Gebäude und dem großen Garten, der an der Westseite durch die alte Stadtmauer begrenzt wurde, nebst dem alten „Pitz25 hennturm“ den man bald den „Bettinaturm“ nennen wird, ein neues Zeitalter. Teilte der alte Rodenhof in den ersten Jahrhunderten seit seiner Entstehung bis zum Ende des landgräflichen Einflusses unmittelbar das harte Schicksal der wechselnden Herrschaften und das Los der Stadt in den Kriegsstürmen des 17. und 18. Jh., so erlebt das Anwesen nun einen völlig neuen konträren Zeitabschnitt. Der jetzt im Eigentum des Professors Weis stehende Forsthof diente einer illustren Gesellschaft von Zeitgenossen als Wohn- und Begegnungsraum. Carl Friedrich von Savigny der Begründer der historischen Rechtsschule in Deutschland lehrte an der Universität in Marburg. Er wohnte im Nebenhaus seines früheren Mentors und Lehrers, des Professors für mittelalterliche Rechtswissenschaften, Philipp Friedrich Weis. Es bestand ein sehr freundschaftliches Verhältnis zwischen Weis und Savigny, sowie zu den studierenden Schülern Savignys, von denen einige im Forsthof wohnten. Es ist das Wirken dieser Schar begeisterter Studiosi die Savigny um sich versammelt hatte, die den späteren Ruhm Marburgs als romantische Stadt begründen werden. Unter ihnen sind es die Namen: Achim von Arnim, Clemens von Brentano, Bettina von Brentano, später verheiratet mit Achim von Arnim, Jakob und Wilhelm Grimm, Karoline von Günderrode, Dichterin der Romantik, Friedrich Creuzer u.a., die prägende Erfahrungen für ihr zukünftiges Schaffen im Dienste der Rechtswissenschaften und der literarischen Kunst in Marburg machen werden. Sie hinterlassen in dem kurzen Zeitabschnitt ihres Wirkens in Marburg unvergessliche Spuren. 26 Professor Dr. Friedrich Carl von Savigny Hervorzuheben ist das Wirken der Brüder Wilhelm und Jakob Grimm in Marburg, die später feststellen werden: „dass ihnen von Prof. Savigny die höchsten Inhalte des Begriffes der Wissenschaft, prägend für ihr ganzes Leben, vermittelt worden seien.“ In den umfangreichen Bibliotheken der Professoren Weis und Savigny befanden sich, neben den altjuristischen Zeugnissen, bedeutende Sammlungen von frühen romantischen deutschen Dichtungen, Minneliedern und Textsammlungen, die besonders für die von den Brüdern Wilhelm und Jakob Grimm begründeten Sprachwissenschaften von Ausschlag gebendem Wert geworden sind. Ihre Bedeutung als Begründer der Germanistik in Deutschland ist später ungleich wirkungsvoller, als ihr Erfolg auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften, zu derem Studium sie nach Marburg gekommen waren. Es hatte sich im Forsthof leider nur kurzzeitig - von 1801 bis 1805 - ein Kreis von Lehrern und Schülern zusammengefunden, der in unterschiedlicher Weise Epoche machende Erkenntnisse sammelte, diese weiter vermittelte und dadurch dazu beigetragen, hat dass auch die kleine Universitätsstadt Mar27 burg zu einer wichtigen Station der „Deutschen Romantik“ werden konnte. 28 Unter den „romantischen Schwärmern“ des Forsthofes befand sich mit der jungen Bettina von Arnim (17851859) ein wahrer „Paradiesvogel“ der mit fröhlicher Unruhe dafür sorgte, dass nun auch Lebendigkeit und Frohsinn im Forsthof Platz ergriffen hatten. Ihr beliebter Aufenthaltsort wurde der alte Wachtturm in der Stadtmauer den sie wohl täglich aufsuchte, um in luftiger Höhe ihre ersten bemerkenswerten phantastischen Texte abzufassen. Immer wieder trieb es sie in den Wintermonaten hinauf auf den Turm. Dort verfasste sie eine wahre Flut von schwärmerischen Briefen, die sie überwiegend an die Freundin Karoline von Günderrode richtete. Bettina von Arnim Der nach Bettina von Arnim benannte „Bettinaturm“. im Garten es Forsthofes. Ein alter Wachtturm in der Marburger Stadtmauer, der zeitweilig auch als Gefängnis benutzt wurde und deshalb als der „Pizzhennturm“ bekannt wurde, so benannt, nach einem Geldfälscher, der im 17. Jh. hier eingesessen hat. Rechts unten das Teehäuschen. 29 Kunigunde von Arnim, die ältere Schwester Bettinas, war mit Carl Friedrich von Savigny verheiratet. Achim von Arnim folgte mit Bettina im Jahre 1811 dem Schwager Carl F. von Savigny nach Berlin, der in Preußen in wissenschaftlichen Diensten stand. Bettina pflegte zeitlebens ausgiebige Briefwechsel mit bedeutenden Persönlichkeiten, etwa mit Carl Marx, den sie sehr schätzte. Auch mit Johann Wolfgang von Goethe pflegte sie eine Brieffreundschaft. Diesen erschien die junge Schriftstellerin wohl „allzu frei denkend“. Goethe brach die Kontakte zu ihr bald ab. Ihr großes soziales Engagement entfaltete Bettina von Arnim nach dem Tode des Ehemannes Achim der im Jahre 1831 verstarb. Einige ihrer sozialkritischen Werke wurden in ihrer Zeit nicht veröffentlicht. 1851 trat sie offen gegen die Todesstrafe ein. Ihr Ansehen, dass sie in den höheren Kreisen in Berlin hatte, verhalf ihr um Wilhelm und Jakob Grimm nach Berlin zu holen, als diese im Jahr 1831 in Göttingen gegen die Aufhebung der Verfassung von Hannover protestiert hatten (Göttinger Sieben) und dort von der Universität verwiesen wurden. Bettina von Arnim trat für die Gleichstellung von Frauen ein. Für die Juden forderte sie gleiche Bürgerrechte. Sie genießt noch heute einen hervorragenden Ruf als Frauenrechtlerin in Deutschland. Zahllose Schulen und soziale Einrichtungen sind nach ihr benannt. Das Portrait der Bettina von Arnim begleitete uns in Zeiten der „guten alten D-Mark“ auf dem Fünfmarkschein. 30 Nach Savignys Fortgang aus Marburg wird es um den Forsthof still. Im Jahre 1808 verstarb dessen Eigentümer Prof. Philipp Friedrich Weis. In den folgenden Jahren wechseln mehrfach die Eigentümer des Forsthofes. Die Namen der Nacheigentümer sind: Generaleinnehmer Georg Wilhelm Hozzel (1813), Witwe des Leutnants Scheffer, Catharina geb. Schulz (1817). Professor Carl Friedrich Vollgraff (1842). Von dessen Töchtern ging das „kleine Haus“ in 1857 an den Landbaumeister Anton Jakob Spangenberg und das Haupthaus im Jahre 1863 an den Hauptmann und Kriegskommissar a. D. Friedrich Christian Schreiner. Dieser überließ das Haus 1866 seiner Tochter Emma Clara, Ehefrau des Medizinprofessors Dr. Carl Falck. Noch einmal weht ein Hauch von literarischem Geist durch das Haus, als ein feinsinniger Poet ab 1861 hier wohnen wird. Professor der Theologie Ernst Constantin von Ranke, jüngerer Bruder des Geschichtswissenschaftlers Leopold von Ranke. Dieser weilte im Jahre 1864, nach einem Sturz den er in Frankfurt erlitten hatte, sechs Wochen lang zur Genesung bei seinem Bruder im Forsthaus, Er schrieb später in einem Brief an seinen Bruder nach Marburg: „Was waren es für schöne Tage, auf dem Schlossberg und auf Spiegelslust, in Deinem Hohen Hause dem Forsthof – und unten an der Lahn!“ Den Forsthof erwirbt schließlich Dr. der Medizin Heinrich Schick. Er überließ das Haus seiner Mutter, Frau Pfarrer Schick und seiner Schwester, Frau Pfarrer Zöckler. Unter deren Leitung wurde hier ein viel besuchtes Mädchenpensionat bis zum Jahre 1913 unterhalten. 31 Blick von der Schlossmauer auf den Forsthof. Der dichte Baumbestand lässt die Ausmaße des Hanggrundstücks mit seinen vielen Terrassen nicht mehr erkennen. 32 Der Rabenauer Hof Auf dem schmalen Grundstück an der Ritterstrasse, in Verlängerung des Hühnerhofes zum Kalbstor befand sich der Rabenauer Hof, der im 30jährigen Krieg untergegangen ist und nicht wieder aufgebaut wurde. Als sein erster Besitzer wurde nach einer Urkunde aus dem Jahre 1343 die Familie „Kalb von Weitershausen“ genannt. Nach „Otto Kalb von Weitershausen“ der erstmals 1313 erwähnt ist, leitet das noch bestehende Kalbstor in der alten Stadtmauer seinen Namen ab. Das Kalbstor in Blickrichtung zur Ritterstrasse Im 15. Jh. geht der Besitz des von Kalb über in das Eigentum der „Rabenauer“. Danach regelt ein Familienvertrag das gemeinsame Eigentum an diesem Hof für die verwandten Familien der „Nordeck zu Rabenau“ und der „ Rauen von Nordeck“. Die Burgmannfamilie 33 der „Kalb von Weitershausen“ besitzt jedoch einen weiteren Hof, angrenzend an den Hosenhof zwischen Landgraf-Philipp Strasse und der Ritterstrasse. Wappen der von Nordeck zu Rabenau Der burgfreie Rabenauer Hof befindet sich bis Mitte des 16. Jh. im Besitz der „Rauen“, die überwiegend als höhere Beamte in den landgräflichen Diensten stehen. Im Jahre 1599 befindet sich der Hof im Eigentum des Letzten der „Roden“ aus der ältesten Marburger Burgmannfamilie. Danach geht der burgfreie Besitz des Rabenauer Hofes zurück in das Eigentum des Landgrafen Ludwig IV., der es seiner Gemahlin Maria, Gräfin von Mansfeld zum Geschenk macht. In den Jahren 1626 bis 1628 bewohnt Prof. Dr. Justus Feuerborn den Hof. Nach ihm nahm hier der städtische Marktmeister Johann Lotze seine Wohnung, bis zum Untergang des Rabenauerhofes im Jahre 1647. Danach ist eine Scheuer auf dem Grundstück genannt, die wohl später einem Wohnhaus an der Ecke zur Kugelgasse weichen musste. 34 Den alten „Rabenauer Platz“ bezeichnete man später als das „Gärtchen“. Auf diesem Garten stand bis zu seinem Untergang im Jahr 1647 der „Rabenauer Hof“. Hinter dem Garten, in Blickrichtung Pfarrkirche: der „Hühnerhof“ 35 Der Hühnerhof Chronologie des Hauses Ritterstrasse 14 Das Anwesen entstammt aus dem Besitz des Geschlechtes der Burgmannfamilie: „Huhn von Ellershausen“ im 14. Jh. Danach ist auch in den nachfolgenden Jahrhunderten der Name „Hühnerhof“ abgeleitet von seinem ersten Besitzer bis heute überliefert. Schildwappen am Haus Ritterstrasse 14 heute Haustüre Ritterstrasse 14 heute 36 Von Caspar Huhn wird der Hof am 1. September 1571 an den Hessischen Kammermeister Philipp Chelius verkauft. Der Weiterverkauf durch die Erben von Chelius erfolgt am 28. Juli 1630 an den „Hessischen Rat und Oberforstmeister“ Jost Burghard Rau von und zu Holzhausen. Durch Verschuldung der „von Rau“ gelangt Kanzler Johannes Vultejus am 21. November 1636 in den Rauischen Besitz, nebst dem neben gelegenen Rabenauischen „Kellerplatz“ (Platz der abgebrochenen Scheune an der Ritterstrasse 8). Wappen der von Vultee Der hessische Kanzler Vultejus verkauft den „Hühnerhof“ am 1. Mai 1669 an seinen Neffen, den Vicekanzler Hermann von Vultee. Die Witwe des Enkels des Vicekanzlers Hermann von Vultee, Sophia Wilhelmina geb. von Baumbach, ist noch im Jahre 1749 im Besitz des Hühnerhofes. Der Hof bleibt im Familienbesitz der von Baumbach bis zum Beginn des 19. Jh. Universitätszeichenmeister Johann Martin Benjamin Kessler erwirbt den Hühnerhof im Jahr 1813. Von dessen in Frankfurt lebenden Söhnen wechselt das Anwesen am 26. Januar 1828 in den Besitz des Oekonomen Dr. Luis Richard aus Moischt. Auf Richard folgt als Eigentümer im Jahre 1879 der Rektor der Realschule: Dr. Christoph Hempfing. 37 Frau Fredericke, die Witwe des Eisenbahnbetriebsinspektors Gustav Lucas, erwirbt den Hühnerhof am 26. September 1904. Der „Hühnerhof“ Ritterstrasse 14 heute! 38 Der Milchlingshof Chronologie, Besitzer und Bewohner des Hauses Ritterstrasse 13 Ein Burgmannbesitz an der Stelle des Hofes ist im 13. und 14. Jh. benannt. Das Anwesen wird später als Milchlingshof bezeichnet, so genannt nach der Ritterfamilie Schutzbar – die man seit dem 16. Jh. als die „Milchlinge“ bezeichnet. Junker Johann Schenk bewohnt das Anwesen um 1558. Die „Ganerben von Rollshausen und Schutzbar“ werden 1574 als Eigentümer des Hofes erwähnt. Miteigentümer ist „Christoffer von Rollshausen“. Er verkauft seinen Anteil an den Hessischen Hofmeister: „Johann von Linsingen“. Im Jahre 1575 erwirbt von Linsingen den Hofanteil der noch unmündigen MilchlingBrüder: Philipp, Hans, Curt und Friedrich Schutzbar. Rentmeister Johann Saalfeld wird 1583 als Teilhaber am Hof genannt. Professor Dr. Johann Goeddaeus erwirbt den Milchlingshof im Jahre 1606. Von ihm erfolgt der Weiterverkauf des Hofes 1634 an den Hessischen Obristen Conrad Weitzel. Prof. Dr. Johann Helfrich Dexbach wird ab 1669 als dessen Besitzer aufgeführt. Von Prof. Dexbach geht 39 der Milchlingshof durch Weiterverkauf an Dr. Heinrich Klein aus Frankfurt. Nach dessen Tod (1699) wird Prof. Dr. Melchior Detmar Grolmann aus Gießen als Eigentümer genannt. Auf Grolmann folgt um 1730 Prof. Dr. Cornelius van den Velde als Besitzer. Von ihm gelangt das Anwesen in den Besitz des Hessischen Generalmajors Johann Christoph von Maurmann. Ab 1750 wird Oberamtmann Christian von Schreyvogel, vermählt mit Maria Dorothea von Baumbach, neuer Besitzer des Milchlinghofes. Nach Konkurs der „von Schreyvogel“ erwarb im Jahre 1765 Professor der Philosophie, Dr. Hermann Friedrich Kahrel den Milchlingshof. Dessen Erben verkaufen den Hof 1794 an Hofrat Prof. Dr. Dietrich Tiedemann. Im Jahre 1817 gelangte der Besitz an Obergerichtsrat Heinrich Christian Scheffer. Von dessen Nachkommen ging das Anwesen 1834 in den Besitz von Pfarrer Joseph Klöffle über. Neben der großen Zahl der honorigen Eigentümer des Milchlingshofes seit dessen Bestehen, findet sich eine lange Reihe von, ebenso honorigen Persönlichkeiten die den Hof zeitweilig bewohnt haben. Darunter Kanzleidirektor Hermann Zoll - um 1690, Luis von Pappenheim - um 1750, Henri Crabb Robinson - um 1800, Otto Rau von Holzhausen - um 1840, Prof. Dr. Ernst Heinrich Beyrich, Paläontologe, Prof. Dr. Theodor Birl, Altertumsforscher - nach 1850, Wilhelm Grimm wird im Jahr 1853 bei seinem Besuch in Marburg im Milchlingshof wohnen. 40 Links der Milchlingshof und Eingang zur Bickeltreppe Der Klingelborn in der Ritterstrasse gegenüber vom Milchlingshof 41 Der Scheuernschloss’sche Hof Chronologie der Besitzer und Bewohner der Häuser Ritterstrasse 11 und 12, Anwesen des Dr. Johann Wolff, Leibmedicus des Landgrafen Ludwig IV. Ursprünglicher Burgsitz des Marburger Burgmannes „Ritter und Schultheiß Rudolf Scheuernschloss von Hachborn“. Um 1538 bewohnt Junker Philipp Scheuernschloss das burgfreie Anwesen. Danach gelangt der Besitz in das Eigentum der Brüder Conrad, Hermann und Georg Ludwig von Nordeck zu Rabenau. Wappen von Nordeck zu Rabenau Im Jahre 1582 erwirbt Dr. Johann Wolff das Anwesen. Er teilt es auf in die beiden Häuser Rittertrasse 11 und 12. Dr. Johann Wolff bewohnt das Anwesen bis zu seinem Tode 1616. Dr. Wolff war Leibmedicus des Landgrafen Ludwig IV. von Hessen-Marburg, bis zu dessen Tod im Jahr 1604. Anschließend wirkte Dr. Wolf als Medicus für dessen Nachfolger, Landgraf Moritz von Hessen-Kassel. Der Erwerb der Häuser durch Dr. Johann Wolff war auf Drängen des Landgrafen Ludwig IV. erfolgt, der den Leibarzt ständig in seiner unmittelbaren Nähe wünschte. 42 Steinreliefwappen von Dr.Johann Wolff Dr. Johann Wolff bemühte sich in außerordentlicher Weise um die Verbesserung der Wohnqualität am Burgberg in Marburg. Die Hanglage an der die Häuser der Ritterstrasse gebaut waren brachte für deren Bewohner zu allen Zeiten erhebliche Erschwernisse. Die Abwässer vom Schloss herunter und jene aus den eigenen Behausungen suchten „im freien Lauf“ ihren Weg durch die Stadt, bis hinab zur Lahn. Dies war mit einem für heutige Zeiten unvorstellbaren Gestank verbunden. Nach starken Regenfällen verteilte sich der Unrat in allen Gassen der Stadt. Energisch erbat Wolff beim Landgrafen die Genehmigung zum Bau der „Aiducken“. Dies sind Abwasserrinnen, die etwa 40 x 40 cm im Quadrat unter dem Straßenniveau angelegt und mit Steinplatten abgedeckt wurden. Darüber hinaus erwirkte Dr. Johann Wolff nach Verhandlungen mit dem Landgrafen, dass die Häuser an der Ritterstrasse vom Schloss herab an die Wasserversorgung angeschlossen wurden. Vom Schloss herunter wurde das Wasser in einer Leitung aus ausgehöhlten Erlenholzstämmen zur Ritterstrasse geführt. Später wurden dafür Tonrohre und Gusseiserne Rohre verwendet. Das Schloss selbst wurde seit Jahrhunderten von den Marbacher Brunnen, vom Dammelsberger Brunnen, 43 vom Ockershäuser Born und mit einem Pumpwerk der „Baldewein’schen Wasserkunst“ von der Lahn herauf mit Frischwasser versorgt. Auch ein eigener Tiefbrunnen im Schlosshof wurde zeitweilig für die Wasserversorgung genutzt. Von dem meist gut gefüllten Wasserspeicher auf dem Schlossgelände führte nun ein Wasserstrahl „einen und einen halben Federkiel dick“, durch den Garten des Dr. Wolff’schen Anwesens, der von Schlossmauer bis herunter in die Ritterstrasse reichte. An diesem ständig fließenden Wasserstrahl schlossen sich die Anwohner der Ritterstrasse an. Sie stellten dazu einen Steinkumpf oder einen Holzzuber mit Deckel im Hof vor den Häusern auf. Die gefüllten Bottiche dienten zugleich als Löschwasservorrat und zur Vorbeugung gegen die ständige Brandgefahr, die von den offenen Feuerstätten in den Häusern und besonders von den Kriegsgefahren ausgingen. Das Schlosswasser wurde bald auf diese Weise auch zum Nutzen für die unterhalb der Ritterstrasse wohnenden Bürger der Stadt an einige Schöpfbrunnen weitergeleitet. ehemaliger Schöpfbrunnen in der Ritterstrasse, Foto L. Bickel 44 Wolff verkauft das Haus Nr. 11 im Jahre 1590 an die Apothekerin Sabine Gilhausen. In der 2. Hälfte des 17. Jh. werden die beiden Anwesen Ritterstrasse 11 und 12 wieder zusammengelegt. Nach Dr. Johann Wolff’s Tod (1616) ist dessen Witwe Christina geb. Ulner. Eigentümerin des Hauses Nr. 12. Sie heiratet später den Juristen Georg von Lettow. Dieser löst nach dem Tode von Christina (1631) die übrigen Erben aus dem Nachlass von Johann Wolff ab. Georg von Lettow, Assessor am Marburger Hofgericht ist ein Verwandter der aus Pommern stammenden Offiziersfamilie der „Lettows“, die im 30jährien Krieg für die katholische Liga kämpfte. Ein Offizier aus der Familie der „Lettows“ weilte mit der Armee des kaiserlichen Generals Johann Graf von Tilly im Jahre 1625 in Marburg. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass General Tilly im Jahre 1625 einen Schutzbrief für das Haus „Ritterstraße 12“ ausstellte, der bei Androhung „schärfster Repression“ das Anwesen vor Einquartierungen und sonstigen Nachteilen durch die Kriegsparteien bewahren sollte, Nach dem Tod des Georg von Lettows im Jahre 1665 gelangte der Besitz in das Eigentum seines Sohnes, Oberamtmann Erasmus von Lettow, der es bis zu seinem Tode 1681 bewohnte. Er starb kinderlos. Im Jahre 1695 gelangte das Anwesen in den Besitz des Hessen-Darmstädtischen Generalleutnant Heinrich von Baumbach zu Gießen (1615 – 1700), den Bruder der zweiten Frau des Georg von Lettow, Margarete Lucretia. Die beiden Anwesen Ritterstrasse 11 u. 12 verbleiben in der ersten Hälfte des 18. Jh. im Besitz der Familie von Baumbach. 45 Die Nachfolger und Erben von Baumbach verwalten den Besitz in den nachfolgenden Jahrzehnten. Nach 1800 erscheint die Witwe des Generalleutnants Georg Heinrich von Toll als Eigentümerin. Ihr folgen im Jahre 1851 Freiherr Adalbert von der Tann und Frau Emilia geb. von Breidenstein als neue Eigentümer. Danach gelangt das Anwesen im Jahre 1858 an Rektor Georg Winneberger. Zahlreiche weitere, hochrangige Persönlichkeiten erscheinen in der Ritterstrasse 11 und 12 als Mieter: u. a. Dr. med. Victor Hüter 1858, Carl Hüter 1874 Dr. Oskar Winneberger 1893, Pfarrer Dr. Konrad Weber 1908 Das Anwesen heute: Rittersttrase 11: Sitz des Helene Weber Heims Ritterstrasse 12 - katholische Pfarrgemeinde St. Johannes 46 Das bedeutendste Lebenswerk des Dr. Johannes Wolff hat indessen alle Zeiten seit seiner Gründung im Jahre 1611 bis heute erfolgreich überdauert: Die „Wolff’sche Stiftung“ in Ockershausen. Das ehemalige Rittergut der „Hosen von Ockershausen“ Die Dr. Johann Wolff’sche Stiftung setzt das vom Stifter begonnene Werk der sozialfürsorglichen Tätigkeit fort. Am Anfang waren es mittelose und in Not geratene Pfründtner aus Marburg und Ockershausen, die in dem ehemaligen Rittergutshof ihren versorgten Lebensabend verbringen konnten. Heute bietet die Dr. Johann Wolff’sche Stiftung für etwa 100 ältere Bürgerinnen und Bürger gut ausgestatteten Wohnraum zu erschwinglichen Mietkosten. Außerdem hatte Dr. Johann Wolff einen Teil seines Vermögens in eine Stipendiatenstiftung zu Gunsten bedürftiger evangelischer Studenten eingebracht. 47 Auch dieses löbliche Werk des Stifters findet noch heute seinen Niederschlag. Die Vergabe von Stipendien an einen bedürftigen Empfängerkreis, wird sorgfältig vom Stiftungsbeirat ausgewählt. Das Hospital in Ockershausen Haupt- und Verwaltungdgebäude aus dem Jahre 1913 48 Der Kalandshof (Die Kaplanei) Haus der Kalandsbrüder - Kalandshaus und Kaplanei Ritterstrasse 9 und 10 Ursprünglich dienten die beiden Anwesen: Ritterstrasse 9 und 10 den Pfarrern der Pfarrkirche „Unserer lieben Frauen St. Marien“ als Wohnstätte. Unter der Benennung als das „Kalandshaus“ oder Haus der „Kalandsbrüder“ dient es viele Jahrhunderte dem Kirchenkasten der Marburger Pfarrgemeinde. Im 14. Jh. wird das Anwesen von der Pfarrei als Erblehen gegen „Kirchenkastenabgaben“ an den Stadtschreiber Heinrich Roßdorf und dessen Ehefrau Emlud abgegeben. Danach erfolgt eine Teilung des Besitzes in zwei Häuser, Ritterstrasse 9 und 10. Ritterstrasse 9 und 10 heute Beide Häuser dienten weiterhin der Pfarrgemeinde als Pfarrer Wohnstätte. 49 Im 15. Jh. bewohnt Pfarrer „Bierhenne“ das Haus Nr. 9 und Kalandsbruder Johannes Henckmann wohnt im Haus Nr.10. Johannes Strack von Hatzfeld, Pfarrer in Schröck, Johannes Moller, Pfarrer in Wehrda und Kalandsbruder Jakob Heppenheimer sind als hier wohnhafte Pfarrer im 16. Jh. im Kalandshaus verzeichnet. Nach der Reformation (1527) erfolgt der Verkauf eines Teils der alten Kaplanei - das Haus Nr. 10 - aus dem Kastenbesitz an den protestantischen Kaplan Gerhardus Eobanus Geldenbauer, genannt Novomiomagus. Der Weiterverkauf des Hauses Nr. 10 erfolgt um 1571 an den landgräflichen Lichtkämmerer Hyronimus Gillhausen. Auch dessen Nachkommen bewohnen das Haus bis zum Weiterverkauf an Prof. Catharinus Dulcis im Jahre 1605. Später (1662) ging das Anwesen in den Besitz der Witwe von Linsingen, die es an den hessischen Rat und Prof. jur. Nicolaus Prick übergab. Prick war der Schul- und Lernmeister für die hessischen Prinzen und späteren Hessischen Landgrafen Wilhelm VII. und Carl. Der Weiterverkauf des Anwesens erfolgte durch die Witwe des Prof. Sophie Prick im Jahre 1696 an den berleburgischen- und nassauisch-siegischen Rat und Amtmann Valentin Friedrich Hatzfeld. Im Jahre 1705 befindet sich das Anwesen im Besitz der Witwe des Hessischen Rates und Advocatus Dr. Carl von Gehren, einer Tochter des Oberberauditeurs Reinhard Scheffer aus der hessischen Kanzleifamilie Scheffer. Deren Tochter Catharina Helene, Witwe des Pfarrers Wilhelm Fleischhut, wird um 1778 als Besitzerin genannt. Der Besitz wechselt erneut. Ab dem Jahre 1815 wird Steuersekretär Friedrich Junghenn als Eigentümer auf50 geführt. Nach ihm besitzt kurfürstlicher Steuerinspektor und Rat Klingelhöfer (1816 – 1855) das Anwesen, bevor es 1824 an den Provinzrabbiner Moses Gosen verkauft wird. Nachfolgende Besitzerin ist ab 1844 Jeanette Gosen geb. Metz. 1891 erwirbt Schreiermeister Carl Kaiser das Anwesen Ritterstrasse 10. Später entsteht hier Schreinerei Werner. Das Kalandshaus Nr. 9 wurde von der Kastenmeisterei um 1556 an Wilhelm Dulberg verkauft und von Superintendent Adam Krafft zeitweilig bewohnt. Als Pfarrersdienstwohnung diente das Haus bis zum Jahre 1832. Danach wurde das Haus an Regierungspositar Christoph Friedrich Chabert verkauft. Weitere Verkäufe erfolgten an Kreisgerichtsrendanten Ludwig Fischer im Jahr 1870 und an den Rechnungsrat Theodor Wessel in 1884. Oberbibliothekar Dr. Albert Duncker ist im Jahr 1893 Eigentümer und schließlich ab 1902 Schreinermeister Werner. Giebelansicht der alten „Kaplaneihäuser“ in der Ritterstrasse nach Zeichnung von Otto Ubbelohde 51 Der Glaser’sche Hof Chronologie der Ritterstraße 8 Ursprünglich handelt es sich auch hier um einen burgfreien Hof dessen erster Besitzer im Dunkeln bleibt. Um 1367 wird er als der Hof von Johannes von Wynden genannt. Danach wird um 1424 die Schöffenfamilie von Frohnhausen als Eigentümerin des Hofes „zum Arn“ erwähnt. Wie bei einigen anderen der alten burgfreien Burgmannbesitzungen in der Ritterstrasse geht das Eigentum nach Aussterben der Linie wieder zurück an den Landgrafen. Die Behausungen dienen verschiedenen landgräflichen Beamten als Wohnung. Ab etwa 1570 bewohnt der landgräfliche Oberförster Hans Diede das Haus, bis hier ein größerer Umbau im Jahre 1576 erfolgt. Das neue Gebäude schwenkt im rechten Winkel zum Grundstück bergseitig ein. Es entsteht nun ein größerer Innenhof, der von einer hohen Mauer zur Strasse hin abgeschlossen ist. Landgraf Moritz überlässt um 1605 das Wohnhaus dem Hofprediger Prof. Gregorius Schönfeld. 52 Ab 1626 wohnte in dem Hause Hofmeister Jost Burkhard Rau. Danach gelangte das Anwesen - offenbar durch Verkauf aus dem landgräflich hessen-darmstädtischen Besitz - im Jahre 1631 an Prof. Gregorius Tülsner. Von dessen Erben geht der Hof an den Reichskammergerichtsassessor Huldrich von Eyben, der ihn von 1684 bis zu seinem Tode 1699 bewohnte. vermauertes Renaissanceportal des Glaser’schen Hofs in der Ritterstrasse Für den Hof hatte Huldrich von Eyben vom Landgrafen im Jahr 1686 ein neues Privileg (Burgfreiheit) erhalten. Von Huldrichs Erben, dem osnabrückischen Geheimen Rat Wilhelm von Eyben, erwarb Rentschreiber Christian Meurer im Jahre 1725 das Anwesen. Aus dessen Besitz kaufte es der Geheime Rat, Leopold Ludwig von 53 Haller, der das Anwesen an seinen Schwiegersohn, den Landrat Wilhelm von Baumbach zu Amönau vererbte. Nach ihm soll es der Obrist von Oheimb besessen haben. Ein Weiterverkauf durch die zwischenzeitliche Eigentümerin, Fräulein Sophie von Trott an den Landjägermeister Gottlob von Buttlar erfolgt im Jahre 1825. Von Buttlar verkauft im Jahr 1828 das Anwesen wieter an den Kreisphysicus Dr. Carl Wilhelm Justi und Frau Johanna Christine Theodor geb. Kuchenbäcker. Von deren Erben gelangt der Besitz im Jahr 1871 an den Professor und Staatswissenschaftler Dr. Johann Carl Glaser. Seither bezeichnet man das Anwesen als den Glaser’schen Hof. Vom nächsten Eigentümer, Dr. med. Hugo Weber zu St. Johann-Saarbrücken, Glasers Schwiegersohn, erwarb der Kaufmann Otto Kratz im Jahre 1900 den Glaser’schen Hof in Marburg, Ritterstrasse 8. Tor zum Glaser’schen Hof 54 Der Weitershäuser Hof Ursprünglich besitzt der Burgmann „Otto von Weitershausen“ genannt Kalb den im 30jährigen Krieg untergegangenen „Rabenauer Hof“. Der Standort dieses Hofes befand sich ursprünglich zwischen dem nach ihm benannten „Kalbstor“ (Kalb von Weitershausen) und dem Hof des „Huhn von Ellershauen“ („Hühnerhof“). Aus dem Besitz der „von Weitershausen“ gelangt der ursprüngliche Hof am „Kalbstor“ in das Eigentum der Familie der „Nordeck von Rabenau“ und firmiert nun als der „Rabenauer Hof“ gegenüber dem Forsthof in der Ritterstrasse. Der ebenfalls im 30jährigen Krieg untergegangene zweite „Weitershäuser Hof“, der angrenzend an den alten Hosenhof zwischen dem „Berlep’schen Hof“ und dem „Glaser’schen Hof“ in der Ritterstrasse bestanden hat, befand sich seit dem Jahre 1514 im Eigentum der Brüder Sittich und Georg von Weitershausen. Nach den „Kalb von Weitershausen“ bewohnte Kammermeister Reinhard Abel den Hof. Das Anwesen wurde jedoch von Landgraf Ludwig IV. im Jahre 1586 wieder in den landgräflichen Besitz zurück genommen, da für den oberhalb dieses Hofes geplanten Neubau der Kanzlei erhebliche Geländeumplanungen durchgeführt werden mussten. Der hessische Kammersekretarius Nikolaus Becker erwarb von Landgraf Ludwig IV. im Jahre 1587 das Restanwesen des alten Weitershäuser Hofes. Beckers Witwe verkaufte 1615 dieses Anwesen an Prof. Dr. Christoph Deichmann, der es seinem Schwiegervater, dem hessischen Vicekanzler Hermann Vultejus weiter verkaufte. 55 Wappen der von Vultejus Die Nachkommen des Vicekanzlers Vultejus besitzen das Anwesen bis zu dessen völligen Untergang in den Wirren des 30jährigen Krieges. : Lageskizze des untergegangenen „Weitershäuser Hofes“ grau gekennzeichnet 56 Der Berlep’sche Hof irrtümlich Wolfsburg genannt Oberhalb des burgfreien Hosenhofes an der Schlossbergstraße – heute Landgraf Philipp Straße - unmittelbar unterhalb des Wilhelmsbaues - befand sich ursprünglich ein Weingarten, der teilweise zum burgfreien Besitz der Burgmannsfamilie der „Hosen von Ockershausen“ und der Burgmannsfamilie „Kalb von Weitershausen“ gehörte. Den Weingarten nannte man das „Rot“. Unterhalb davon befand sich die uralte „steinerne Kemenate“ die zum Hosenhof gehörte. Neben dem Hosenhof befand sich bis gegen Ende des 14. Jh. das Anwesen der mächtigen burgfreien Familie von Bicken. Dieser Besitz gelangte 1386 in das Eigentum des „Volpracht Hose von Ockershausen“ Von diesem wurde dieser Hof mit dem alten Hosenhof vereinigt. Es entstehen hier nun zwei Wohnhäuser nebst Nebengebäuden, die von einer hohen Mauer umgeben sind. Die Behausungen dienten den verschiedenen landgräflichen Dienststellen und als Wohnstätte für die Forstbeamten. Als Eigentümer - oder Benutzer - eines 57 der beiden Häuser erscheint Ende des 14. Jh. Wygand von Hachen. Das zweite Wohnhaus gelangt nach Verkauf von Johann Hose im Jahre 1514 in das Eigentum des hessischen „ Rat und Schreibers“ Dr. Johann Schmuck. Ab 1514 bezeichnet man dieses Anwesen nun als den „Schmucken Hof“ nach seinem zwischenzeitlichen Besitzer. Im Jahre 1525 ist Margaretha von Griffte als Be sitzerin des vorderen Hauses genannt, das später irrtümlich als die „Wolfsburg“, bezeichnet wird. Margarethe von Griffte verkauft ihr Anwesen an Caspar von Berlepsch. Seither wird dieses Anwesen als der Berlep’sche Hof bezeichnet. Es bleibt unergründlich, weshalb nun dieser Hof zu der Bezeichnung: die „Wolfsburg“ gelangen konnte. Diese Bezeichnung wird indessen von den heutigen Eigentümern - der studentischen Turnerschaft Schaumburgia noch immer für den alten Berlep’schen Hof verwendet. Im Jahre 1515 wird auf dem angrenzenden Gelände das ursprünglich zu dem alten Hosenhof gehörte, eine größere Scheune zu einem Wohnhaus umgebaut. Später wird diese neue Gebäude als - das „hinter liegende Haus“ - bezeichnet. Die landgräfliche Verwaltung hat offensichtlich die Verwendungsrechte für diesen Teil des ehemaligen burgfreien Hosenhofes behalten. Es finden verschiedene landgräfliche Beamte dort ihre Wohnung. Von 1576 – 1586 wohnt im „hinter liegenden Haus“ der landgräfliche Küchenmeister. Das Haus wurde jedoch bereits im Jahre 1606 durch einen neuen Bau ersetzt, der dem landgräflichen Oberforstmeister als Dienstwohnung zugewiesen wird, weil dessen vormalige Wohnung im Glaser’schen Hof neben an, nun dem Hofprediger des Landgrafen Moritz 58 von Hessen-Kassel, Prof. Dr. Gregorius Schönfeld, zugewiesen wurde. Im Jahre 1611 ist Prof. der neuen Sprache Catharinus Dulcis als neuer Besitzer des zweiten Hofs verzeichnet. Der hier zuvor wohnende offenbar sehr „trinkfeste“ Oberforstmeister Ernst von Stockheim musste den Hof auf Veranlassung von Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt 1627 verlassen, da nun andere Verwendungen für diesen Besitz vorgesehen waren. Inzwischen hatte die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt im Streit um das Marburger Erbe seit 1625 die Regentschaft in Oberhessen übernommen. Im Jahre 1628 wird der Advokat Dr. Peter Wolff - ein Neffe des Leibmedicus Dr. Johann Wolff - als Besitzer des „hinteren Hauses“ neben dem Berlep’schen Hof genannt. Möglicherweise ist es der Name der nun hier wohnenden Familie des Dr. Peter Wolff, der später irrtümlich zur Herleitung des Namens „Wolfsburg“, für den Berlep’schen Hof, geführt haben könnte. Beide Häuser auf dem Gelände des Berlep’schen Hofs ereilte das Schicksal jedoch schon bald. Sie gingen im Verlaufe des 30jährigen Krieges in den Gefechten um das „Marburger Erbe“ zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmrstadt unter. In den Jahren 1645 und 1647 werden zahlreiche Häuser in der Marburger Altstadt und auf dem Schlossberg durch Kriegseinwirkungen erheblich beschädigt. Das Reichskammergericht hatte im Jahre 1623 Hessen-Marburg der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt zugesprochen. Hessen-Kassel akzeptierte das Urteil nicht. Es setzte den Kampf um die Rückgewinnung von Hessen-Marburg fort. Niederhessische (Kasseler) Truppen besetzten 1645 das von Hessen-Darmstadt seit 1625 verwaltete Marburg. Der „hessische Bruderkrieg hatte begonnen. 59 Gegen Ende des Jahres 1647 wurden besonders heftige Kämpfe geführt. Hessen-Darmstadt setzte alles daran, die Stadt Marburg und das Schloss, von den Hessen-Kasselern (Niederhessen) zurück zu gewinnen. Über diese Ereignisse wird nachstehend in dieser Beschreibung noch ausführlich berichtet. Ruine des Berlep’schen Hof irrtümlich Wolfsburg genannt nach einer Skizze von Dr. Ludwig Justi (1860) Obergeschoss und Dachwerk waren während des 30jährigen Krieges durch Oberst Stauff (Hessen-Kassel) abgetragen worden, um ein besseres Schussfeld für seine Batterien zu erhalten. Einige der alten Höfe in der Ritterstrasse gingen im 30jährigen Krieg unter. Darunter der Berlep’-sche Hof, der alte Feigenhof, der Rabenauer Hof und der Weitershäuser Hof. Noch lange Zeit nach dem 30jährigen Krieg zeigten sich erhebliche Zerstörungen durch die 60 Kriegseinwirkungen in der Marburger Altstadt und in Weidenhausen. Eine historische Fotografie, die vor dem Jahr 1860 entstanden ist, zeigt den zerstörten Berlep’schen Hof. Das Dachwerk war im Jahr 1647 abgebrochen worden. Noch für lange Zeit nach seiner teilweisen Zerstörung blieb der Berlep’sche Hof ungenutzt. Die unzerstörten Kellergewölbe dienten zeitweilig als Wein- und Vorratslager für Marburger Gastwirte, so dem Wirt Johannes Klingelhöfer. Burghart und Eiteil von Berlepsch verkauften den verwüsteten Hof im Jahre 1679 an Prof. Dr. juris Helfrich Dexbach. Von dessen Witwe geht der Besitz 1684 an Dr. Nicolaus Jung. Im Jahre 1748 gehört eine Hälfte 61 des wüsten Anwesens der gegenüber in der Ritterstrasse wohnenden Witwe des Dr. Frantz. Ab 1750 finden wir das alte Mauerwerk im Besitz des hessischen Regierungsrates Georg Friedrich Hein. Restaurierte Ruine des Berlep’schen Hofs/Wolfsburg nach einer Skizze von Dr. Ludwig Justi (1861) 62 Später ist dessen Witwe Marie Margarethe Alette, Tochter des Vizecanzlers Prof. Dr. Johann Friedrich Hombergk zu Vach, Besitzerin des Berlep’schen Hofs. Als nächster Eigentümer folgt seit 1778 ihr Schwiegersohn, der „kurpfälzische geheime Rat“ Gerhard Wilhelm Dolaeus von Cronenberg. Ihm folgt als Besitzer ab 1813 Landrat Johann Moritz Schenk zu Schweinsberg, der das Grundstück am 7. Mai 1831 an den Bäckermeister Peter Römhild weiter verkauft. Am 7. Mai 1861 verkauft Römhild die Ruine an Obergerichtsanwalt Dr. jur. Carl Grimm. Ihm verdanken wir die Wiederherstellung des imposanten Gebäudes in seiner heutigen Gestaltung. Der Berlep’sche Hof im Vordergrund, dahinter das Alte Landgericht: Foto Ludwig Bickel um 1870 63 Mit der Wiederherstellung des Berlep’schen Hofs hatte Dr. Grimm den Restaurator der Elisabethkirche, Prof. Friedrich Lange im Jahr 1861 beauftragt. Er ließ die Ruine des Hauses mit neuen Außenwänden und Erkern versehen und verschaffte ihr dadurch das noch heute sichtbare imposante Aussehen. Die Tochter von Justizrat Grimm, „Frau Major Behrend“, verkaufte am 23. Dezember 1903 den restaurierten, Berlep’schen Hof an den Universitätsbuchhändler Georg Schramm. Ihm folgte als Eigentümer der Rentner August Lorenz. Von dessen Erben gelangte der Hof, nun „Wolfsburg“ genannt, im Jahre 1910 in das Eigentum der Turnerschaft Schaumburgia. Der Berlep’sche Hof Ritterstrasse 2, genannt Wolfsburg 64 Eine imposante Pforte zum Haus Ritterstrasse 2 führt in den Hof der „schaumburgischen Wolfsburg“. Die Existenz einer Urkunde aus dem Zeitraum um das Jahr 1050 erscheint jedoch nicht gesichert. Wandtafel neben der Eingangspforte zum Berlep’schen Hof 65 Die Wolffsburg Der alte Hosenhof Der untergegangene „Hosenhof“ aus dem 13. Jh. erstreckte sich über Grundstücke beiderseits der heutigen Landgraf-Philipp Strasse. Links und rechts der aufwärts führenden Strasse zum Schloss befanden sich verschiedene bauliche Anlagen, die für die im Jahre 1575 fertig gestellte Neue Kanzlei - das spätere Landgericht - weichen mussten. Dieses stattliche Gebäude beherrscht noch heute das Bild des südostseitigen Burgberges. Auf dem gegenüber liegenden Grundstück, oberhalb der Mauer an der rechten Seite der Landgraf Philipp Strasse, befanden sich ursprünglich einige Wirtschaftsgebäude des Hosenhofes, so benannt nach der Burgmannfamilie der „Hosen von Ockershausen“. Im Jahre 1415 wird Sygfried Hose von Ockershausen von Landgraf Ludwig I. mit dem Grundstück neu belehnt. Die „Hosen“ bewohnten bis zu ihrem Weggang aus Marburg diesen Hof, der zwischen der Landgraf-Philipp Strasse und der Ritterstrasse gelegen war. Den Rest ihres Marburger Eigentums verkauften die „Hosen“ 1550 an den Marburger Schöffen Hermann Schmalkalden. Am Bergabhang unter dem Schloss befand sich vormals ein Weingarten. Der untere Teil davon der zum alten Hosenhof gehörte, gelangte nach mehreren Besitzwechseln über die „Riedesel zu Eisenbach“ und die „von Twern“ im Jahr 1541 in den Besitz des Hessischen Kanzlers Johann Feige. Nach dem Aussterben „der Linie im Mannesstamm“ der „von Feige“ gelangte der Besitz 1625 teilweise zurück in das Eigentum des 66 inzwischen in Marburg residierenden hessen-darmstädtischen Landgrafen Georg II. Dieser ließ auf dem Platz, der bislang als Wohnstätte der landgräflichen Forstmeister diente, zwei großartige Neubauten für seinen hochgeschätzten Hofmarschall Georg Riedesel zu Eisenbach errichten. Lage der untergegangenen Höfe rund um die Neue Kanzlei Im Hintergrund: Renthof und Dörnberger Hof Auf neuen Fundamenten entstanden große Kellergeschosse, auf denen nun zwei prächtige dreigeschossige Bauten errichtet wurden: Die Neue Kanzlei und die Wolffsburg. 67 Als Baumeister hatte Landgraf Georg II. seinen genialen „Kammerrat und Oberbaumeister, Professor der Medizin und Mathematik, Kriegsrat und Artilleriedirektor Jakob Müller“ (1594-1637) beauftragt. Im Jahre 1631 verstarb Hofmarschall Georg Riedesel für den diese stattliche Behausung bestimmt war nur kur-ze Zeit nach dessen Einzug in das neue Domizil. Im Jahre 1636 schenkte Landgraf Georg II. den großen Besitz mit dem Garten der hinauf bis an die Schlossmauer reichte als „freies, erbeigenes, ganz unbeschwertes adliges Burgmannsgut“ seinem Günstling, dem geheimen Rat, Kanzler und Amtmann zu Schmalkalden und Olsberg, „Reichsfreiherrn Antonius Wolff von Todenwarth“. Der aus einer bedeutenden altdeutschen Adelsfamilie entstammende Wolff von Todenwarth gehörte zu den einflussreichsten Beamten der Landgrafschaft HessenDarmstadt. Im Jahre 1639 fiel Reichsfreiherr Wolff von Todenwarth bei Landgraf Georg II. jedoch in Ungnade. Dubiose Geldgeschäfte und „üble Nachrede gegen den Landesherrn“ sollen die Ursachen dafür sein, dass der Landgraf seinem fähigen und erfolgreichen Kanzler nicht nur das Vertrauen entzog, sondern ihm auch die erteilten Schenkungen wieder abnahm. Auch die in den landgräflichen Diensten stehende Verwandtschaft des Wolff von Todenwarth wurde von Landgraf Georg II. ihrer Ämter enthoben. Körperlich und seelisch gebrochen beschloss Wolff von Todenwarth im Jahre 1641 in Frankfurt sein Leben. Nach dem Reichsfreiherr Antonius Wolff von Todenwarth das Anwesen am Schlossberg mehrere Jahre bewohnt hatte, hier sogar kurzzeitig von Landgraf Georg II. wegen der hier erwähnten Vorgänge unter Arrest 68 gestellt worden war, entsteht im Volksmund folgerichtig die Bezeichnung „Wolffsburg“ für das große Anwesen an der Landgraf Philipp Strasse. Nach der Wiedereingliederung von Hessen-Marburg an Hessen-Kassel im Jahre 1648 lässt Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel den „Todenwarth’schen Besitz“ wieder in das landgräfliche Eigentum zurück führen, mit der Begründung, dass der Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt nicht befugt gewesen sei: „fürstliches Kammergut der Herrschaft zu entfremden“. In der Zeit der Belagerung des Schlosses durch die kaiserlichen (hessen-darmstädtischen) Truppen, gegen Ende des 30jährigen Krieges vom November 1647 bis Januar 1648 hatte der niederhessische (Hessen-Kasseler) Verteidiger des Schlosses, Obrist Stauff, das massive Bauwerk der Wolffsburg als Unterkunft für die Kanoniere der dort aufgestellten Batterien verwendet. Erste starke Beschädigungen an dem Anwesen gehen wohl auf diese Kriegshandlungen zurück. Eine dauerhafte Nutzung als Wohnstätte ist nach 1648 nicht mehr bekannt. Kurzzeitig wurden in dem Obergeschoß des stattlichen Hauses Gottesdienste durchgeführt. Der Zerfall des unbewohnten Anwesens schritt indessen rasch voran. Denis Papin (1647-1712) der Erfinder des Dampfkolbens, der in den Jahren nach 1687 als Professor der Mathematik an der Universität in Marburg lehrte zeigte Interesse an dem Bauwerk, als er vor Antritt seiner Anstellung in Marburg eine geeignete Unterkunft für sich suchte. Die geplanten Restaurierungsmaßnahmen kamen jedoch nicht mehr zustande. Im Oktober 1687 begannen die Abbrucharbeiten an dem geschichtsträchtigen Anwesen des „Wolff von Todenwarth“. 69 Teile der Ruine der Wolffsburg befanden sich noch bis um das Jahr 1900 auf dem Grundstück. Noch zu sehen ist das Portal zum alten Anwesen. Ein grün umranktes Tor lässt heute erahnen, dass sich dahinter einst ein stattliches Anwesen befunden haben mag. links: Skizze von Carl Justi, rechts: von Otto Ubbelohde Die Mauerreste einer inzwischen entfernten Ruine und die alte Pforte erinnern noch an die Wolffsburg, die im Jahre 1687 abgebrochen wurde. Heute befindet sich hier ein freier Platz und grüner Rasen in der Landgraf-Philipp-Strasse gegenüber der alten Kanzlei (altes Landgericht). Hier befand sich vormals das Anwesen des „Wolff von Todenwarth“, später die Wolffsburg genannt. Einen Gebäudekomplex ähnlich der Größe der Neuen Kanzlei (Landgericht) dürfen wir für die im Jahr 1687 abgebrochene Wolffsburg annehmen. 70 Der verwaiste Platz der Wolffsburg an der Landgraf-Phiipp-Straße .Die „Neue Kanzlei“ oder das „Alte Landgericht“ Blick vom Obergeschoss des Wilhelmsbaues Hier befindet sich derzeit die religionskundliche Sammlung der Marburger Philipps-Universität. Ein ähnlicher Gebäudekomplex wird für die gegenüber liegende im Jahr 1687 abgebrochene Wolffsburg vermutet. 71 Der „Feigenhof“ Der „Feigenhof“ am Schlossberg beherbergte ab 1485 die landgräfliche Kanzlei für Oberhessen erstmals außerhalb des Landgrafenschlosses. Nachdem Landgraf Heinrich III. (1441–1483) die Räumlichkeiten der bisherigen Kanzlei im Schloss für andere Zwecke beanspruchte, wurde der Bau einer neuen Kanzlei auf jenem Grundstück an der Schlosstreppe errichtet, das erst sehr viel später als „Feigenhof“ bezeichnet wird. „Fritsche Wynholt“ errichtet um 1445 ein neues Haus und Stallung rechter Hand am Ende der Schlosstreppe zur Landgraf-Philipp Strasse. Dessen Witwe Jutte, in 2. Ehe mit dem Wäppner von Bernynchusen verheiratet, verkauft im Jahre 1452 das Anwesen an den Marburger Schöffen Heinrich Deynhart. Von Deynhart gelangt die „burgfreie Behausung“ zurück an den Hessischen Landgrafen Wilhelm III.(14701500). Nach ihm ist der „Wilhelmsbau“ des Schlosses benannt den Wilhelm III. im Zeitraum 1490 bis 1493 errichten ließ. Wilhelm III. veranlasste auch den Umbau des Feigenhofes zur landgräflichen Kanzlei. Damit fanden die in 65 Kisten verwahrten hessisch-landgräflichen Urkunden, Belege und Planrollen eine neue Bleibe außerhalb des Marburger Landgrafenschlosses. In der neu geschaffenen Kanzlei entstand eine Wohnung für den aus Kassel stammenden Kanzler Stein. Die Ausstattung der Kanzlei wird als bemerkenswert kunstvoll und wertvoll überliefert. Der später dort wohnende Registrator Johann Plack erfreute sich einer relativ großen Behaglichkeit, nachdem dort drei Kachelöfen, eine exklusive Neuheit in dieser Zeit, auch in der kalten Jahreszeit für angenehme Temperaturen in 72 dem Haus sorgten. Die Räumlichkeiten der Kanzlei erwiesen sich jedoch schon bald als zu klein für die immer umfangreicheren Akten und Urkunden der Landgrafschaft. Landgraf Philipp (1504-1567) ließ bereits im Jahr 1519 einen weiteren Kanzlei-Neubau unterhalb der vorhandenen „Stein’schen Kanzlei“ errichten. An dieses Anwesen erinnert bis heute nur noch eine gotische Spitzbogenpforte am Weg zum Schloss. Seit 1526 diente diese ältere Stein’sche Kanzlei dem hessischen Kanzler Johann Feige als Wohnung. Johann Feige, Kanzler des Landgrafen Philipp, wurde durch die Eröffnungsrede der „Homberger Synode, im Jahr 1526 bekannt. Seine Thesen bildeten die Grundlage der neuen, lutherischen Kirchenordnung in der Landgrafschaft Hessen. Lageskizze des untergegangenen Feigenhofes am Schlossberg 73 Durch Tauschvertrag aus dem Jahr 1572 gelangte auch der zweite Bau der vormaligen Kanzlei in das Eigentum des Kanzlers Feige. Das aus zwei Gebäuden bestehende Anwesen an der unteren Landgraf-PhilippStrasse zur Schlosstreppe trägt von nun an den Namen der „Feigenhof“. Nach etwa weiteren fünfzig Jahre reichte jedoch auch die erweiterte Kanzlei im Bereich des Feigenhofes den Anforderungen der landgräflichen Verwaltung nicht mehr. An der Landgraf-Philipp Strasse, dem Feigenhof gegenüber, entsteht auf dem Gelände des alten Hosenhofes und des Weitershäuser Hofes die Neue Kanzlei. Sie wird im Jahr 1575 ihrer Bestimmung zugeführt. Nach dem Tode des letzten Feige, Anton Ludwig im Jahre 1625 fiel der Feigehof mit dem übrigen Feige’schen Lehen an die nun in „Hessen-Marburg“ residierende darmstädtische Linie des Landgrafen Georg II. (1605-1661) Dessen Kanzler Dr. Antonius Wolff von Todenwarth wird zunächst mit dem Feigenhof belehnt. Die Eigentumsübergabe bleibt jedoch strittig. Die Erben der Familie Feige pochen nachhaltig auf ihr altes Eigentumsrecht. Hilmar von Bardeleben, ein Eidam des letzten Spross der Feige, kann offenbar später einen Teilerfolg zum Erhalt des alten Familienbesitzes erwirken. Wolff von Todenwarth verzichtet danach auf weitere Ansprüche an dem Feigenhof. Im Zuge des hessischen Krieges über das „Marburger Erbe“, der im Rahmen des großen dreißigjährigen Krieges (1618-48) zwischen Hessen-Darmstadt und Hessen Kassel ausgefochten wurde, geriet auch der Feigenhof in die „Schusslinie“. Durch die Belagerung des Schlosses durch Hessen-Darmstädtische Truppen im 74 Jahre 1647 war der unterhalb des Schlosses gelegene Burgberg zum unmittelbaren Kriegsgebiet geworden. Auf der Ruine des Feigenhofes hatte der niederhessische Obrist Stauff Platz für eine Batterie seiner Kanonen einrichten lassen. Hierzu wird nachfolgend ausführlicher berichtet. Die Trümmer des Feigenhofes dienten später als Baumaterial für die Wiederherstellung des Kesseltores in der Nordstadt. Der verwüstete Hof kam 1684 in den Besitz des Dr. Klunck, der auch den gegenüber liegenden Berlep’schen Hof erworben hatte. Auf dem Ruinengrundstück befand sich nun ein Garten, der sich im Jahre 1750 im Eigentum des Professors der Ethik und Politik Johann Thielemann, genannt Schenck, befindet. Nach Tielemann folgt als Eigentümer des Gartens im Jahre 1806 der Kaufmann Friedrich Christoph Müller. Von Müller gelangt das Grundstück 1849 an den Sanitätsrat Dr. med. Carl Wilhelm Möller. Dessen Tochter verkaufte den Platz 1905. Blick durch die Pforte des alten Landgerichts zur Rundbogenpforte, die zu dem untergegangenen „Feigenhof“ an der Landgraf Philipp- Strasse führte. 75 Der Dörnberger Hof Der Dörnberger Hof am Ende der Mainzer Gasse ist neben dem Renthof der letzte in der Reihe der 13 rund um den Burgberg in Marburg angesiedelten Höfe. Eine frühe Hofanlage entstand an der Stelle des späteren Dörnberger Hofes nach der Erweiterung der ersten Stadtmauer um das Jahr 1280. Im Jahre 1211 wird Johann von Dörnberg als Brautführer der Hl. Elisabeth genannt. Er war offenbar ein Begleiter der Reise Elisabeths aus Ungarn zur Wartburg. Dort findet im Jahre 1221 ihre Verheiratung mit dem thüringischen Landgrafen Ludwig IV. statt. Wann „die Dörnberger“ Marburg als Domizil auswählten, ist unklar. Hans von Dörnberg I. ist um das Jahr 1420 Marschall der hessischen Landgrafschaft. Er könnte der erste Eigentümer des Burgmannanwesens in Marburg gewesen sein, das von nun an dessen Namen trägt. Dieses Anwesen entstand jedoch erst um das Jahr 1480. Wappen der alt-hessischen Adelsfamilie von Dörnberg Hans von Dörmberg II. (1427 – 1506) war oberhessischer Hofmeister und ein einflussreicher Ratgeber der hessischen Landgrafen Wilhelm III. und Wilhelm II. 76 Neben dem „Junkerhansenturm“ in Neustadt, der unmittelbar auf sein Wirken in der hessischen Heimat hinweist, stand offenbar auch die Marburger Besitzung unter seiner Obhut. In den nachfolgenden Jahrhunderten treten wiederholt Angehörige der berühmt gewordenen Adelsfamilie in der Marburger Geschichte in Erscheinung. Der Dörnberger Hof nach 1866 Inzwischen beherbergt das Anwesen wissenschaftliche Institute der Marburger Universität. Aufnahme: Ludwig Bickel Im Zuge der Entstehung der verschiedenen Einrichtungen und Institute der Marburger Universität wird das ausgedehnte Areal des alten Dörnberger Hofes neuen Nutzungen zugeführt. Noch vor dem Abbruch der alten Gebäude wurden Aufrisse gefertigt, die uns einen Überblick der alten Anlage vermitteln. 77 Zwei Aufrisse des „Dörnberger Hofes“ aus dem Jahre 1838 zeigen das imposante Hauptgebäude Skizzen aus der Stadtschrift „Marburger Geschichte“ 1980 78 Sehr bekannt wurde Wilhelm Caspar Ferdinand Freiherr von Dörnberg (1768-1850). Er diente in verschiedenen europäischen Armeen und nahm an zahlreichen bedeutenden Schlachten der „Koalitionskriege“ (1792–1815) teil. Zunächst in den Diensten von Hessen-Kassel gegen die französische Revolutionsarmee, später in englischen Diensten gegen Napoleon. Unter dem preußischen General Lebrecht von Blücher kämpfte er 1806 in der verlorenen Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. 1808 trat er in die Dienste des Königs von Westphalen „Jerome“ in Kassel. Insgeheim setzte sich Dörnberg jedoch für die Beendigung der napoleonischen Vormachtstellung in Deutschland ein. Seine Position als Kommandeur eines „Westphälischen Regiments“ dem auch Angehörige des vormaligen hessisch-kurfürstlichen Marburger Jägerbataillons angehörten, nutzte er, um unbehelligt konspirative Kontakte mit anderen Freiheitskämpfern im französisch besetzten Deutschland herzustellen, mit dem Ziel die napoleonische Herrschaft zu beenden. Er nahm Verbindung zu Persönlichkeiten aus den preußischen Militärkreisen auf, die wie er selbst Maßnahmen zur Befreiung Deutschlands vom französischen Joch planten. Zu den preußischen Offizieren: Neidhart von Gneisenau, Gerhard von Scharnhorst, Ferdinand von Schill und Friedrich von Katte stellte er Briefkontakte her. In Marburg traf er im Herbst 1808 mit dem Veteranen Obrist Andreas Emmerich zusammen, um mit ihm Verabredungen über den geplanten Aufstand der Kurhessen gegen Napoleon zu treffen. Das Vorhaben endete bekanntlich kläglich. Die Hoffnung „von Dörnbergs“ dass sich sein Regiment der Rebellion gegen die französischen Machthaber in Nordhessen anschließen würde, zerschlug sich. Der an der 79 Knallhütte bei Kassel im April 1809 schlecht vorbereitete „Marsch gegen Jerome“ endete in einem Fiasko für die Aufständischen. Die Rebellengruppe, zusammengewürfelt aus kurhessischen Veteranen, Bauern und Priestern der Umgebung, endete unter dem Feuer der westphälischen Truppen Jeromes. Wilhelm Caspar Ferdinand Freiherr von Dörnberg (1768 – 1850) Dörnbergs Steckbrief aus Materialien des Staatsarchivs Marburg 80 Freiherr von Dörnberg musste fliehen schloss sich der „schwarzen Schar“ des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig an, der einen Guerillakrieg gegen Napoleon führte. Die „schwarze Schar“ - und mit ihr Caspar Ferdinand von Dörnberg - floh nach England, um letztlich doch noch bei Waterloo im Jahre 1815 an Napoleons Niederlage Teil zu haben. In Marburg war die Episode des Aufstandes des Wilhelm von Dörnberg vom April 1809 mit dessen Flucht nicht beendet. Hier hatten noch im Juni 1809, als eigentlich schon alles vorüber war, der alte Oberst Emmerich - unterstützt von Prof. der Medizin Johann Heinrich Sternberg - in der Nacht des 24. auf den 25. Juni 1809 einen Aufstand gegen die französische Besatzung eröffnet, der nach wenigen Stunden zusammenbrach. Die Aufständischen, knapp 50 kaum Bewaffnete: Veteranen, ehemalige kurhessische Jäger und Füsiliere aus Marburg, Ockershausen und einigen Orten der Umgebung wurden samt den Anführern gefasst und in Kassel vor ein Kriegsgericht gestellt. 11 mit der Waffe in der Hand aufgegriffene Aufständische wurden zum Tode verurteilt. Vier von ihnen wurden noch im Juli 1809 im „Casseler Forst“ erschossen, darunter Prof. Dr. Johann Sternberg, Oberst Andreas Emmerich, Unteroffizier Daniel Muth aus Ockershausen und Husar Wendel Günter aus Sterzhausen. König Jerome begnadigte die übrigen zum Tode Verurteilten, um dadurch der schlechten Stimmung im Lande entgegen zu wirken. Im Teil IV dieser Beschreibung wird ausführlicher über diese Ereignisse berichtet. 81 Ein versteckter Findling mit Gedenktafel Ein Findling mit einer Gedenktafel für die in Kassel im Juli 1809 Erschossenen des Marburger Aufstandes befindet sich versteckt zwischen dem Dammelsberg und dem Gisonenweg. Am alten „Dörnberger Hof“ erinnert heute nichts mehr an die Ereignisse die sich mit dem historischen Namen verbinden. Markant steht indessen noch die weithin sichtbare alte Sternwarte, die auf dem Areal des „Dörnberger Hofes“ am Schlossberg den heutigen Gebäudekomplex überragt. 82 Der Renthof Die Entstehungsgeschichte des Renthofes am Nordhang des Burgberges in Marburg weicht von den übrigen Gründungen der hier geschilderten Burgmannhöfe ab. Es ist die landgräfliche Administration, die zur Bewältigung ihrer wachsenden Aufgaben einen zentralen Versorgungshof unterhalb der Schlossmauern einrichtet. Das Anwesen dient der Vorratshaltung und als Warenmagazin der unmittelbaren Bewirtschaftung der nahe liegenden landgräflichen Güter. Seit dem ausgehenden 13. Jh. ist seine Existenz nachgewiesen. Der Renthof unterhalb der Schlossmauser Die Lageskizze zeigt im Modell die Örtlichkeit des Schlossberges aus nord-östlicher Sicht, zum Zeitpunkt des ausgehenden 17. Jh. Noch ist die im Jahre 1687 abgebrochene „Wolffsburg“ unterhalb des „Willhelmsbaues“, zu sehen. 83 Neben seiner Funktion als Wirtschaftshof mit seinen ausgedehnten Scheuern diente der Renthof im siebenjährigen Krieg (1756 - 1763) als Lazarett für die französische Besatzung. Die Franzosen hatten während des gesamten Kriegsverlaufes mit wenigen Unterbrechungen in Marburg Quartier bezogen. Später diente der lang gezogene Lazarettbau als Wohnraum für Bedienstete der landgräflichen und kurfürstlichen Verwaltung. Die Aufnahme von Theodor Greifelds aus dem Jahr 1869 zeigt den Beamtenwohntrakt unterhalb der nordseitigen Schlossmauer. Das Foto erinnert an ein makaberes Ereignis aus dem siebenjährigen Krieg. Die auf dem Schlossgelände einquartierten französischen Regimenter des Marshall Herzog von Richelieu wurden von einer Ruhrepidemie erfasst. Vermutlich wurde diese Seuche durch – vorsätzlich - verseuchtes Wasser ausgelöst. Etwa Eintausend Soldaten starben daran. Sie wurden in den Gärten, unterhalb der Schlossmauer - hinter dem Renthof - beigesetzt. 84 Nach der Annexion von Kurhessen durch Preußen im Jahre 1866 erfolgte die Beendigung einer langen Stagnation der Stadtentwicklung in Marburg. Es begann eine Zeit des Aufbaues. Neben der Stadt erlebte auch die Marburger Universität eine Phase der Erweiterung und des Ausbaues ihrer wissenschaftlichen Institute. Eine Fotografie von Ludwig Bickel aus dem Jahre 1882 zeigt den fast vollständig abgebrochenen Renthof. Auf dem Platz entstehen, neben neuen wissenschaftlichen Instituten, Einrichtungen der preußischen Verwaltung, Rechts im Bild: der Rohbau des neuen Gebäudes für die preußische Oberförsterei, das im Jahre 1957 abgebrochen wurde. Zwischen den neu entstandenen wissenschaftlichen Instituten der Philipps-Universität finden sich nur noch wenige Spuren des alten Renthofes am Ende der Mainzer Gasse in Marburg. 85 Teil II Marburg im dreißigjährigen Krieg 1618-1648 86 Der Bruderkrieg um das Marburger Erbe! Während der schier endlose Krieg von 1618 – 1648 in Deutschland tobte, die Landschaften verwüstete und entvölkerte, schien es für lange Zeit so, als sollte Marburg von den unmittelbaren Kriegshandlungen verschont bleiben. Zwar hatten die ständig durchziehenden Heere der Kriegsparteien in Marburg oftmals Quartier genommen und die Bürger der Stadt durch die damit verbundenen Lasten ausgezehrt und um ihr Hab und Gut gebracht, jedoch von den schrecklichen Begleiterscheinungen der Plünderungen, der Brandschatzungen, Vergewaltigungen und sinnlosen Morden blieb man bis fast zum Ende des großen Krieges verschont. Die durchziehenden, gegnerischen Heere der „Kaiserlichen Liga“ und der „Protestantischen Union“ standen sich in nichts darin nach, das Land in dem sie sich bewegten, im wahrsten Sinne des Wortes „kahl“ zu fressen. Es machte keinen Unterschied, dass die „kaiserliche-katholische Liga“, bei ihren Durchzügen im Hessenlande die katholischen - ebenso wie die evangelischen Ortschaften - heimsuchten, dort plünderten, raubten, mordeten und vergewaltigten. Die Heere der „protestantischen Union“ verfuhren gleichermaßen. Den glücklichen Umstand der Verschonung durch unmittelbare Kriegshandlungen in Marburg, in den ersten 25 Kriegsjahren, wenn man darunter verstehen will, dass Leib und Leben nicht ständiger Gefährdung ausgesetzt waren, erlebten schon die Bürger der benachbarten Dörfer im Marburger Land nicht. Einen sehr anschaulichen Bericht darüber überliefert uns die 87 „Stausebacher Chronik“ des Caspar Preis, in seinen Schilderungen aus den Jahren von 1637 – 1648. Die bewegenden Beschreibungen von Caspar Preis geben Zeugnis vom Elend der einfachen Landleute und der Bauern, das diese über Jahrzehnte hinweg im Marburger Land und im Amöneburger Becken zu ertragen hatten. Das Heer versorgte sich bei den endlosen Durchzügen aus dem Land selbst, in dem man sich bewegte oder logierte. Alles Hab und Gut wurde der Bevölkerung abgepresst oder mit Gewalt entrissen. Kein Vieh, kein Futter, keine Vorräte der Landleute blieben verschont. Selbst die geheim angelegten Vorratslager blieben nicht unbehelligt. Die Verstecke wurden durch Folter, durch Mord und Vergewaltigung notgedrungen von den gemarterten Menschen preisgegeben, Gegen Ende des langen Krieges sollte auch Marburg noch verhängnisvoll durch unmittelbare Kriegsereignissen erfasst werden. Während die Heere der Kriegsparteien - zum großen Teil erschöpft und ausgeblutet das Ende des großen Sterbens herbei sehnten, bahnte sich in Marburg das letzte Fiasko des „Hessischen Bruderkrieges“ erst an. Die Ausgangslage schien grotesk. Hessen-Kassel (Niederhessen) und Hessen-Darmstadt stritten seit Jahrzehnten über die Herrschaft in Marburg und Oberhessen. (Das „Marburger Erbe“) Der im Jahre 1604 kinderlos verstorbene Marburger Landgraf Ludwig IV. hatte in seinem Testament verfügt, Oberhessen aufzuteilen. Der südliche Landesteil mit Gießen gelangte an Hessen-Darmstadt. Der nördliche Teil mit der Residenzstadt Marburg sollte an Hessen-Kassel angegliedert werden. Ludwig IV. hatte dies jedoch mit der Auflage verfügt, dass die in Hes88 sen-Marburg geltende lutherische Kirchenlehre weiterhin zu bestehen habe. Der niederhessische Landgraf Moritz ignorierte jedoch diese testamentarische Auflage. Er setzte mit der Eingliederung von Hessen-Marburg die in der Landgrafschaft Hessen-Kassel eingeführte calvinistische (reformierte) Kirchenlehre nun auch in Oberhessen durch. Dies führte zu großen Protesten in Marburg und im lutherisch-evangelischen Marburger Land. Die calvinistischen Glaubensbrüder setzten die „Veränderungspunkte“ mit brachialer Gewalt, unterstützt von Landgraf Moritz von Hessen-Kassel, in den lutherischen Gebieten des Marburger Landes durch. Die zum großen Teil noch aus der Zeit vor der Reformation stammenden Kirchen wurden einer spartanischen Erneuerung unterworfen. Vielfach wurden ihre filigran gestalteten Lettner und Heiligenfiguren nebst den Heiligenbildern entfernt. Die Bilderstürme in der Marburger Pfarrkirche und bei zahlreichen anderen lutherischen Kirchen zogen eine Spur der Verwüstung durch die alten Gotteshäuser. Die Marburger Professoren an der von Landgraf Philipp im Jahr 1527 gegründeten Universität verweigerten indessen die von ihnen verlangte Übernahme der calvinistischen „Verbesserungspunkte“. Sie verließen Marburg unter Protest. In der lutherischen, hessen-darmstädtischen Nachbarstadt Gießen fanden sie Aufnahme. Landgraf Ludwig V. von HessenDarmstadt (1577-1626) förderte die Einrichtung einer neuen Hochschule in Gießen, an der die Marburger Professoren ihr Lehramt zunächst fortsetzen konnten. Zugleich intervenierte Ludwig V. von Hessen-Darmstadt beim Reichshofgericht gegen den Testamentsverstoß seines Vetters, des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel. 89 Mit dem Hinweis, dass in Hessen-Darmstadt die lutherische Lehre eingeführt und damit die Testamentsauflage des Erblassers Landgraf Ludwig IV. erfüllt sei, beanspruchte Landgraf Ludwig V. die Übernahme von ganz Oberhessen mit der Residenzstadt Marburg an Hessen-Darmstadt. Es folgte daraufhin ein langwieriger Prozess vor dem Reichsgerichtshof in Speyer, der schließlich im Jahre 1627 mit dem Spruch der „rechtmäßigen“ Eingliederung von Hessen-Marburg an Hessen-Darmstadt endete. Zuvor hatte jedoch Landgraf Ludwig V. vom habsburgischen Kaiser Ferdinand III.(1578-1638) bereits im Jahre 1622 die Zusage der Eingliederung von Hessen-Marburg an Hessen-Darmstadt erhalten, als Dank für die Unterstützung, die Hessen-Darmstadt der „kaiserlichen-katholischen Liga“ in der „Schlacht von Wimpfen“ am 6. Mai 1622 geleistet hatte. Diese Fehde gegen den lutherischen Pfalzgrafen endete mit einem Sieg der Kaiserlichen. Im April des Jahres 1623 besetzt die kaiserliche Armee des Generals Johann von Tilly Marburg und Oberhessen. Im Ratsprotokoll der Stadt Marburg vom Januar 1624 wird vermerkt, dass die Bürgerschaft unter den unerträglichen Einquartierungslasten leidet. Zu den ca. 10.000 Söldnern Tillys, die vor und innerhalb der Stadt lagerten, gehörte auch der begleitende Tross der Armee aus Fuhrleuten, Marketendern, Frauen und Kindern der Soldatenfamilien, Huren und Händlern. Die Menge dieser Personen konnte sogar gelegentlich die Zahl der Armeeangehörigen übertreffen. Für sie alle mussten die Bürger in den Städten und Dörfern Quartiere vorhalten. Die immensen Aufwendungen für Essen und Trinken, für Heu und Hafer der Pferde und der übrigen beim Tross mitgeführten Tiere, wie Rinder, 90 Schweine, Hühner, Gänse und vieles Andere waren unerschöpflich Dazu waren die Unterkünfte - ausgestattet mit Bettzeug - für die Einquartierten zur Verfügung zu stellen. Oft erfolgte die Durchsetzung der Einquartierung unter kaum vorstellbarer Gewaltanwendung gegen die wehrlose Bürgerschaft. Diese Hintergründe führen uns zu der Erklärung über einen „Schutzbrief“, den General Johann von Tilly in seiner Eigenschaft als Befehlshaber der kaiserlichen Armee für das Haus Ritterstrasse 12 in Marburg am 8. Dezember 1623 ausgestellt hatte. Im Prinzip war es Usus, dass die Wohnhäuser der Angehörigen der Stände, (in Marburg waren dies die Angehörigen des Adels, der landgräflichen Verwaltungen, die Burgleute, die Professoren und die Stadträte und Bürgermeister) von den Einquartierungen eigener oder fremder Truppen verschont wurden. Die Bürde der Einquartierungen lastete man der Bürgerschaft, der Kaufmannschaft, den Handwerkern und vor allem der der Landbevölkerung in den nahen Dörfern an. Das Privileg der Befreiung der Stände von den unzumutbaren Einquartierungslasten wurde indessen nicht immer eingehalten. Fremde Armeen, die auf ihrem Zug zum nächsten Gemetzel Rast machten, fragten nicht mehr nach in Friedenszeiten geltenden und durchaus eingehaltenen Regeln der Verschonung der Stände durch Einquartierung und Verköstigung. So geht die Ausstellung eines Schutzbriefes für das Haus 12 in Marburg auf einen unmittelbaren Vorgang zurück. Dabei hatte es ein Capitän der kaiserlichen Armee gewagt, Quartier im Hause eines Angehörigen des „befreiten Standes“ zu nehmen. Sein Pech in diesem Falle war es, dass nun der Besitzer dieses Hauses, der landgräfliche Hofbeamte und Jurist Georg von 91 Lettow, ein Vetter eines hohen Offiziers aus dem Generalstab der Armee Tillys war. Bei dem Anwesen Ritterstrasse 12 handelte es sich um jenen Besitz, der aus dem „Scheuernshloss’schen Hof“ hervorgegangen war und später in den Besitz des Dr. Johann Wolff, dem Leibmedicus des Landgrafen Ludwig IV. von Hessen Marburg, gelangte. Nach dem Tod von Dr. Johann Wolff im Jahre 1616 hatte dessen Witwe Christine geb. Ullner den hessischen Hofjuristen Georg von Lettow geheiratet. Durch Vermittlung des in der kaiserlichen Armee Tyllis dienenden Vetters erwirkte Georg von Lettow die Ausstellung eines Schutzbriefes für das Anwesen Ritterstrasse 12. Vom Armeeführer der kaiserlichen Liga, Johann von Tilly, wurde am 8. Dezember 1623 das Dekret ausgestellt. Es liegt im Wortlaut vor: „ Wir Johann Graf von Tilly, Freiherr von Marbeiß, Herr zu Ballastre und Montigny, der Römischen, kaiserlichen, auch zu Ungarn und Boheind Königlichen Majestät, und der Churfürstlichen Durchlaucht Herzogs Maximilian zu Bayern Generalleutnant, Rat und respektive Kämmerer, tun hiermit und in Kraft dies kund und zu wissen, dass wir auf das wohledel und gestrengen Georgio von Lettow aus Pommern, fürstlich hessischem Canzley und Regierungsrates zu Marpurgk, adelichen befreiten Burgsitz, in der Stadt Marpurgk in der Rittergassen gelegen, samt derselben An – und Zugeborenen „Salvam Guardiam“ erteilt haben. Befehlen darauf allen und jeden, unsern unterhabenen hohen und niederen Befehlshabern, wie auch insgesamt allen Soldaten zu Roß und Fuß mit Ernst und bei unaus-pleiblicher Straf, diese unsere erteilte Salvum Guardiam in alle Wege zu respektieren, ermeldten adelichen befreiten Burgsitz und dessen adpertinentien vor aller Einquartierunge, auch sonsten vor sämptlichen feindlichen Einfallen und An- 92 greiten, Blünderungen und Beschwernissen ohnmolestiert zu lassen und allerdings zu entheben, so lieb ihnen seie, obangedrähete Straf zu vermeiden. Darnach sich ein jeder zu richten und vor Schad zu hüten wissen wird. Datum: Hersfeld den 8. Monatstag dezembris Anno Sechzehnhundert und im dreiundzwanzigsten. Tilly Johann t.Serclases von Tilly 1559 – 1632, Armeeführer der kaiserlichkatholischen Liga Er wurde von protestantischer Seite als der „brutalste und mörderischste“ Heerführer des gesamten 30jährigen Krieges bezeichnet. Zu seinen besonderen Untaten gehören die totalen Zerstörungen von Hannoversch-Münden (1626) und Magdeburg (1632). Die feindlichen Armeen haben die „Schutzbriefe“ der Gegenpartei nicht immer eingehalten. Auch die Söldnertruppen der eigenen Partei ignorierten derartige Abmachungen, wie es nach den Schilderungen der Untaten des 30jährigen Krieges im Marburger Raum überliefert wird. Am Ende des verheerenden Krieges waren fast alle Häuser in der Marburger Ritterstrasse am Schlossberg, die ja eigentlich unter die „Schutzvorschriften“ fallen sollten, verwüstet oder total zerstört. 93 Zur „Marburger Fehde“ 1645-1648 Im Jahre 1623 hatte Landgraf Ludwig V. von HessenDarmstadt unter dem Schutze von Tillys Armee Oberhessen und Marburg in die Landgrafschaft HessenDarmstadt eingegliedert. Marburg wurde im Zeitraum der folgenden 20 Jahre, bis zur Rückeroberung durch die Niederhessen im Jahre 1645, umsichtig von HesenDarmstadt regiert. Schon bald hatte Ludwig V. veranlasst, dass die Marburger Professoren die im Jahre 1604 von Marburg nach Gießen geflüchtet waren, nach Marburg an die Universität zurückkehrten. Ludwig V. bestimmte im Prinzip damit den Fortbestand der oft in ihrer Existenz gefährdeten Marburger Universität. Der in politischen Dingen eher unfähige Landgraf Moritz von Hessen-Kassel musste die neue Entwicklung in Oberhessen tatenlos hinnehmen und Hessen-Marburg aufgeben. Auch wegen anderer Versäumnisse in seiner Regierungstätigkeit, veranlassten schließlich die niederhessischen Stände im Jahre 1627 die Abdankung des glücklosen Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel. An seine Stelle trat nun sein Sohn, Landgraf Wilhelm V. (1602-1637). Wilhelm V. von Hessen-Kassel nahm den Streit um das „Marburger Erbe“ wieder auf. Er marschierte mit seinem Heer im nördlichen Oberhessen ein und löste damit die erwartete Gegenreaktion der hessen-darmstädtischen Seite aus. Wilhelm V. unterlag der Übermacht der kaiserlichen Heere Tillys und Pappenheims, die nun das „Marburger Erbe“ für Hessen-Darmstadt sicherten. Wilhelm V. musste sich dem kaiserlichen Diktat der „endgültigen“ Abtretung von Hessen-Marburg an Hessen-Darmstadt, beugen. 94 Dies führte Wilhelm V. nun unmittelbar in die Reihen der „Protestantischen Liga“. Hessen-Kassel kämpfte nun an der Seite der evangelischen Fürsten und des Schwedenkönigs Gustav Adolf, während das lutherische-evangelische Hessen-Darmstadt, nun verankert in der katholischen Liga, weiter um das mühsam errungene „Marburger Erbes“ kämpfte. Dass es auch im Übrigen in diesem großen Krieg der europäischen Mächte nur vordergründig um religiöse Fragen ging, wird durch die wechselseitigen politischen Bündnisse der Parteien belegt. So kämpfte das streng katholische Frankreich an der Seite des evangelischen Schweden, gemeinsam gegen die katholische-kaiserliche Liga. An deren Seite stand neben anderen protestantischen Fürsten das evangelische Hessen-Darmstadt. Im Vordergrund all der Kämpfe ging es nicht zuletzt um politische Vormacht und um territorialen und wirtschaftlichen Gewinn. Wilhelm V. von Hessen-Kassel erwarb sich indessen in den Kämpfen der Protestantischen Union den Ruhm eines gefürchteten Feldherrn. „Erbarmen - die Hessen kommen“, dies war ein bitterer Seufzer, der bei Annäherung der Niederhessen in den norddeutschen und süddeutschen Ländern Entsetzen und Angst auslöste. Der erneute Einfall von Wilhelm V. in das nun darmstädtisch besetzte Nieder- und Oberhessen im Jahr 1636 mit dem Ziel der Rückeroberung von HessenMarburg, blieb erfolglos. Der Kaiser verhängte nun über ihn „Acht und Bann“. Wilhelm V. floh mit Familie und seinem noch immer beachtlich starken Heer von Kassel nach Friesland. Hier verstarb Wilhelm V. infolge der erlittenen Verwundungen des Jahres 1637. Nachfolgerin des verstorbenen Landgrafen Wilhelm V. von Hessen-Kassel wurde nun dessen Witwe, Amalie 95 Elisabeth von Hanau-Münzenberg(1602-1651). Sie sollte sich als eine äußerst kluge Regentin erweisen, die bis zur Volljährigkeit ihres Sohnes Wilhelm VI. im Jahr 1650 eine sehr erfolgreiche Regierungsarbeit für Hessen-Kassel leistete. Im Schutze ihrer starken hessischen Armee kehrte Amalie Elisabeth noch im Jahr 1637 von Friesland nach Kassel zurück. Sie erneuerte das Bündnis mit Frankreich und Schweden. Sie setzte den Kampf ihres verstorbenen Mannes Landgraf Wilhelm V. zur Rückgewinnung von Hessen-Marburg mit dem nördlichen Oberhessen fort. Mit Hinweis auf ein Rechtsgutachten das sie in Auftrag gegeben hatte, ließ Amalie-Elisabeth belegen, dass der Reichsgerichtshofbeschluss des Jahres 1627 zur Abtretung von Hessen-Marburg an Hessen-Darmstadt ungültig sei. Hessen-Marburg war indessen etwa 20 Jahre lang durch die hessen-darmstädtische Landgrafschaft, nicht zum Nachteil der Stadt Marburg, umsichtig verwaltet worden. Bedeutende Staatsmänner von Hessen-Darmstadt übten in Marburg vorbildliche landgräfliche Regierungsgeschäfte aus, wie etwa der tüchtige Kanzler Johann Feige und der Kanzler und Reichsfreiherr Wolff von Todtenwarth. Nach dem Tode von Landgraf Ludwig V. von HessenDarmstadt im Jahr 1626 hatte inzwischen dessen Sohn, Landgraf Georg II. (1606-1661), die Regentschaft in Hessen-Darmstadt übernommen. Seine Brüder: Heinrich (1612-1629) und Friedrich (1616-1682) studierten in den Jahren 1627 und 1628 an der Marburger Universität. Die Marburger Bürgerschaft war der hessen-darmstädtischen Herrschaft durchaus zugetan. Nicht zuletzt konnte der evangelisch-lutherische Konflikt mit den calvinistisch Reformierten in Marburg 96 beigelegt werden. Die lutherischen Marburger fanden ihren kirchlichen Mittelpunkt in der Pfarrkirche am Schlossberg, die seit jenen Jahren nun unter der Bezeichnung „lutherische Pfarrkirche“ in Marburg firmiert. Den reformierten Calvinisten wurde die alte Dominikanerkirche, die spätere Universitätskirche als Gotteshaus überlassen. Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel, deren politische Position unter den kriegführenden europäischen Mächten gegen Ende des dreißigjährigen Krieges immer stärker geworden war, setzte indessen alles daran, die alten Verhältnisse in Hessen wieder herzustellen. Während die „großen Schlachten“ dieses endlosen Krieges offenbar geschlagen waren und infolge der Kriegsmüdigkeit im ausgebluteten Deutschland keine Entscheidungsschlacht mehr zu erwarten war, marschierte Amalie Elisabeth mit ihrem starken Heer, von Süddeutschland anrückend in den hessen-darmstädtisch besetzten Teil von Niederhessen und Oberhessen ein. Im Herbst 1645 hatte sich die niederhessische Armee unter ihrem General Geysse von Wetzlar her der Stadt Marburg genähert. Am 31. Oktober 1645 eröffnete der Hessen-Kasseler Kriegskommissar von Valentin Göddäus, ein gebürtiger Marburger, den fürstlichen (hessen-darmstädtischen) Räten in Marburg und dem Marburger Bürgermeister Johannes Bauer; dass die Landgräfin von HessenKassel Amalie-Elisabeth den rechtmäßigen Besitz von Hessen-Marburg beansprucht und dass sie dieses „angestammte“ Recht mit der Unterstützung der Kronen von Frankreich und Schweden durchsetzen werde. Dazu sei angeordnet, „dass zur Bekräftigung dieser Forderung die Stadt Marburg zum Quartier für die „fremden Völker“ (Franzosen und Schweden) ausge97 wiesen sei. Von seinem General Johann Geysse sei er angewiesen, dieses der Stadt anzumelden und man gutwillig Quartier in derselben nehmen wolle. Da dieses Vorhaben nicht die Zuständigkeit des Hauses von Hessen-Darmstadt betreffe, würden allein die Marburger Bürgermeister und Räte aufgefordert, den Bürgern in Marburg die unumgängliche Einquartierung bekannt zu machen“. Offenbar suchten die Niederhessen ihren Anspruch auf Marburg und Oberhessen zunächst ohne kriegerische Mittel durchzusetzen. Die Marburger Räte wiesen jedoch darauf hin, dass es nicht möglich sein werde, eine „große Soldateska“ in der Stadt aufzunehmen und zu verköstigen, da in den vielen Jahren des Krieges unzählige Einquartierungen verschiedenster Völker erfolgt seien und damit Plünderungen, Brandschatzungen, Erpressungen von Lösegeldern durch Freund und Feind zu ertragen waren. Die Stadt sei nun arm und erschöpft und könne weitere Lasten nicht tragen. siehe Anmerkungen 1) Die Hessen-Kassler waren jedoch nicht geneigt, von ihrem Vorhaben abzulassen. Zur Durchsetzung ihrer Forderung werde man notfalls mit militärischen Mitteln dieses erzwingen, ließ man wissen. Man werde unweigerlich die Stadt mit Feuer und Kanonen angreifen. Die Verantwortung dafür trage dann aber die Stadt alleine. Die Truppen Geysses rückten „zu Fuß und zu Ross“ aus ihren Quartieren in Weimar, Wehrda und Ockershausen an die Stadtmauern heran. Sie errichteten hinter dem „Schwanhofe“, bei dem nach Ockershausen hin gelegen Gehöft „die Sorge“ ein großes Feldlager. Von hier aus drangen die Anrückenden im Schutze von 98 eilends errichteten Laufgräben bis zu den Befestigungen der Stadt vor. Die unter dem hessen-darmstädtischen Stadtkommandanten, Obrist Christian Willich, stehende kleine Garnisonsbesatzung von etwa 400 Söldnern und etwa 250 „Bürgersoldaten“ mussten allein den erneuerten Festungsmauern und den armierten Geschütztürmen der Schlossfestung vertrauen. Hessen-Darmstadt hatte im Zeitraum zwischen 1624 und 1644 das Marburger Schloss zu einer beachtlichen Festung mit mächtigen Bastionen und starken Mauern ausgebaut. Auch die Stadtmauer war an vielen Stellen erneuert und befestigt worden. Für die Stadttore und Pforten in Marburg und Weidenhausen wurden verstärkte Bewachungen unterstützt von eilig rekrutierten Bürgerwehren eingesetzt. Den Wert und die Schlagkraft der eigenen Kräfte die ihm zur Verteidigung der Stadt zur Verfügung standen stufte Oberst Willich nicht sehr hoch ein. Schon bei der Erstürmung des Vorortes Weidenhausen, die bereits einige Tage vor Ankunft des Großteils der Niederhessen gegen Ende Oktober 1645 erfolgt war, hatten die etwa 60 darmstädtischen Söldner die zur Abwehr dort eingesetzt waren das Weite gesucht. Dagegen hatte sich die Weidenhäuser Bürgerwehr sehr tapfer gezeigt, Unter großen eigenen Opfern hatte sie den Niederhessen erhebliche Verluste beigebracht. Der größeren Feuerkraft der Angreifer hatten sie jedoch nicht lange Einhalt gebieten können. Die Hoffnung, dass die Schlossfestung den Angreifern standhalten könnte erfüllte sich nicht. Gegen die ständig wachsende Feuerkraft der Kanonen bildeten Festungsmauern und die Bastionen auch in Marburg kein Hindernis mehr für die Angreifer. 99 Die Position von Oberst Willich in Marburg war jedoch schon zuvor durch andere Erschwernisse belastet. Allein 60 Reiter waren ständig eingesetzt, die Steuern und Abgaben bei den Bürgern in der Stadt und im Umland einzutreiben. In der Regel waren von den Bürgern etwa ein Viertel der gesamten Jahreseinkünfte an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt abzuführen. Dies führte zu großem Unmut, denn die vormalige Herrschaft der HessenMarburger Landgrafen hatte sich mit einem Abgabenanteil von einem Zehntel der Jahreseinkünfte begnügt. Zur Beischaffung der Abgaben in der Stadt Marburg sah sich Oberst Willich gezwungen, drastische Mittel anzuwenden. Er quartierte den säumigen Zahlern kurzerhand 10 bis 12 zusätzliche Söldner in deren Behausungen ein. Dies bedeutete die volle Verköstigung der Einquartierten und konnte nach wenigen Wochen das Vielfache der Belastung abfordern, als es durch die Contributionen (Kriegssteuern) gefordert wurde. Diese Umstände führten zu Verstimmung gegen den zumeist in Gießen residierenden Landgrafen Georg II., obwohl man in Marburg in den ersten Jahren seiner 20 Jahre währenden Herrschaft (1625-1645) durchaus zufrieden mit ihm gewesen war. Das ausgeblutete Marburger Land konnte indessen die für eine erfolgreiche Verteidigung notwendigen Aufwendungen, weder personell, noch materiell erfüllen. Die prekäre militärische Lage in Marburg war dem Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt wohl bekannt. Er sah sich indessen nicht im Stande, Truppenverstärkungen nach Marburg zu beordern um die drohende Niederlage noch abwenden zu können. Für die Nacht zum 1. November 1645 hatte man in Erwartung eines Sturmangriffes der Niederhessen in der 100 gesamten Stadt absolute Dunkelheit verordnet. Von den Wachttürmen der Stadtmauer her waren die Geräusche der sich annähernden Truppen zu hören. Im „Reizgraben“ (Universitätsstraße) unmittelbar vor der Stadtmauer, richteten General Geysses Truppen Batterien gegen Stadt und Schloss. In der Stadt vernahm man das Spatengeklirr und die Schanzgeräusche der Angreifer, die zur Unterstützung dieser Arbeiten kurzerhand die Untertanen aus den nahen Dörfern Marbach und Ockershausen heran gezogen hatten. Sie mussten Laufgräben für die Angreifer ausheben. Mit Schüssen „auf das gerade Wohl“ in Richtung der Geräusche versuchten die Belagerten den anrückenden Feind zu behindern. Vom Grind (Grün) her hatte sich eine Batterie mit ihren Kanonen bis dicht an die Untergasse heran postiert. Stadtkommandant Willlich hatte indessen die Stadttore von innen verrammen lassen und forderte von den Bürgern zusätzliche Unterstützung, neben den 250 „Bürgersoldaten“, die ihm zur Verteidigung der Stadt zur Verfügung standen. Wohl wissend hatte Oberst Willich schon zuvor die Bauern in den Vororten dazu aufgefordert, ihr Vieh und ihre Habe vor dem anrückenden Feind in den Wäldern in Sicherheit zu bringen. Der Bürgerschaft in Marburg wurde angeordnet, vor jedem Haus in der Stadt gefüllte Wasserzuber bereit zu stellen, um gegen ausbrechendes Feuer nach der erwarteten Beschießung durch die Niederhessen gewappnet zu sein. Allerdings war es „bei Leibesstrafe“ verboten, das Wasser aus den Brunnen in der Stadt zu entnehmen. Es sollte allein aus der Lahn geholt werden. Nach Mitternacht begannen die Belagerer mit dem Kanonenfeuer auf das Schloss. Pechbrandkugeln schoss man in die Stadt und beschädigte schon mit dem er101 sten Feuerstoß etliche Häuser. Seit Tagesanbruch feuerten die Angreifer unentwegt aus den Laufgräben vor der Stadtbefestigung mit Musketen auf die Verteidiger. Mit den Kanonen traktierte man stundenlang das Schloss und die Stadtmauern, in die bald eine Bresche geschlagen war. Schon machte sich die Reiterei der Angreifer bereit, um durch die Brechen in die Stadt zu gelangen. Die zahlreichen Feuer in der Stadt konnten kaum noch gelöscht werden. Frauen und Kinder verbargen sich in tiefen Kellern. Eine verängstigte Gruppe von Stadtbürgern flehte den Stadtrat und die zögernde Stadtkommandantur vergeblich an, die Beendigung der Kämpfe zu erbitten. Nun waren es die Stadtbürger selbst, die ein Ende der Kampfhandlungen ohne Absprache mit den Räten und der darmstädtischen Stadtbesatzung forderten. Ein Tambour zog in Begleitung einer Bürgerdelegation zu den Angreifern und bat um Waffenruhe. Auch zum Schloss zog die Delegation. Danach erbat man bei Obrist Willich um Waffenruhe, zu der die Angreifer sich schon bereit erklärt hatten. Die Kriegsparteien schlossen nun einen Waffenstillstand. Man verabredete, dass die hessen-darmstädtischen Söldner ihr Quartier im Bereich der Schlossfestung behalten sollten, während die Niederhessen in den übrigen Stadtquartieren Einzug nahmen. Der Stadtrat in Marburg willigte nun ein, die harten Quartierbedingungen der Niederhessen zu erfüllen. Die Marburger Bürger versuchten Linderung von den Einquartierungslasten zu erwirken, in dem man darum bat, einen Teil der geforderten Quartiere in die Vororte zu verlegen. (Weidenhausen, Ketzerbach) Der nun in Marburg eingesetzte niederhessische Stadtkommandant Winckelstern und General Johann Geysse zeigten sich über die hartnäckigen Versuche des 102 Rates der Stadt, Linderung bei den Einquartierungen zu erfahren, sehr erbost. Es erging nun der Befehl zur sofortigen Einquartierung der schon angekündigten 600 Söldner und zusätzlich weiterer 800 Söldner, die nun in Marburg und Weidenhausen untergebracht werden mussten. Notgedrungen nahm die Stadt ihr Schicksal auf sich, in der Hoffnung, dadurch der totalen Zerstörung zu entgehen. Der niederhessische Kriegskommissar Valentin Göddäus und Generalwachtmeister Johann Geysse forderten indessen zusätzliche hohe Kontributionen von der Stadt Marburg. Nur durch persönliche Geschenke des Magistrates an die Befehlshaber der Hessen-Kasseler konnte dies abgewendet werden. Im Gegenzug stimmten die Hessen-Kasseler dem Ersuchen der Marburger Räte teilweise zu, dass nun auch die bisher unbehelligten Behausungen der in Marburg wohnhaften hessen-darmstädtischen Beamtenschaft und der Professoren, unbeachtet ihrer „Schutzbriefe“, zur Entlastung der Stadtbürgerschaft in die Einquartierungen einbezogen werden sollten. Eingehalten wurde diese Zusage nur sehr bedingt. Obrist Christian Willich hatte sich indessen mit den etwa 400 hessen-darmstädtischen Soldaten, darunter den etwa 6o Berittenen, in den Festungsbereich des Schlosses zurück gezogen. In den Festungsanlagen des alten Lustgartens hatte er während des ganzen Novembers 1645 weitere Laufgräben ausheben lassen und zusätzliche Verteidigungsstellungen errichtet. Man lebte in der Erwartung des Sturmes durch die Niederhessen auf die Schlossfestung und verharrte in der vergeblichen Hoffnung auf Entsatz durch anrückende kaiserliche Truppen. 103 Fast sechs Wochen - vom Dezember 1645 bis Anfang Januar 1646 - hatte sich ein relativ friedliches Miteinander der Angehörigen der beiden Kriegsparteien in Marburg entfaltet. Vom Schloss herab besuchten die darmstädtischen Soldaten die Gastwirtschaften und die Märkte in der Stadt. Einvernehmlich traf man sich mit den hier einquartierten Niederhessen. Indessen verstärkte sich der Ring der niederhessischen Truppen rund um das Schloss und um die hier eingeschlossenen Hessen-Darmstädtischen. Es trafen weitere Verstärkungen der Niederhessen ein. Zusätzliche 175 Soldaten wurden in Weidenhausen einquartiert. Während des Dezembers 1645 erfolgten unter dem Befehl des neuen Stadtkommandanten der Niederhessen, Obrist Johann Stauff die Vorbereitungen der Hessen-Kasseler zum Sturm auf das Schloss. Am 8. Januar 1646 begann die Kanonade auf die Schlossfestung und den Schlossberg. Es wurden an einem Tag 25 Tonnen Pulver verschossen. Das Schloss und alle Gebäude am Schlossberg waren bald durchsiebt. Aus etwa 20 Kanonen verschiedenster Kaliber feuerte man unentwegt. Zahlreiche Stadthäuser waren bald unbewohnbar geworden. Eine ernsthafte Gegenwehr der Belagerten war nicht mehr zu erwarten, da durch den starken Beschuss der Niederhessen die Bastion und die Vorwerke der Festung bereits im November 1645, nebst den hier aufgestellten darmstädtischen Batterien, weitgehend zerstört waren. Indessen wartete Obrist Willich weiter vergebens auf Entlastung durch Truppen von Landgraf Georg II., der in Gießen verweilte und Durchhalteappelle nach Marburg sendete. Am 15. Januar 1646 stellte Oberst Willich den Widerstand ein. Der Hessen-Kasseler Obrist Johann Stauff 104 gestattete den Verteidigern des Schlosses freien Abzug. Am 16. Januar um 1 Uhr verließen die HessenDarmstädter – „mit Sack und Pack, mit klingendem Spiel und brennender Lunte“ das Marburger Schloss in Richtung Gießen. Mit dem Tross nach Gießen zogen auch die hessen-darmstädtischen Prinzen, die Söhne des Landgrafen Georg II., Heinrich (1630-1678) und Georg (1632-1676) unbehelligt ab. Sie hatten an der Marburger Universität studiert. Nur die Kanonen der Verteidiger blieben zurück. Der wegen der Preisgabe von Marburg erboste Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt ließ den Obristen Willich vor ein Kriegsgericht stellen, wegen dessen „eigenmächtiger“ Kapitulation in Marburg. Auf Willich wartete das Todesurteil. Es wurde unverzüglich auf dem Giessener Marktplatz vollstreckt. Hessen-Marburg wurde indessen von Hessen-Kassel wieder in Besitz genommen. Am 6. Februar 1646 erhielt der Magistrat Order, dass nunmehr „dauerhaft 1237 Köpfe“ innerhalb der Ringmauer einquartiert und zu versorgen seien: 839 Männer, 206 Frauen 172 Kinder und 36 Pferde. Am 13. Februar 1646 wurde im Rittersaal des Schlosses die Huldigung der Bürgerschaft für die „fürstliche Frau“ Amalie-Elisabeth von Hessen-Kassel entgegen genommen. Zaghafte Versuche der Räte, eine Verschiebung der „Huldigung“ der neuen Herrschaft zu erwirken „da doch der Krieg noch nicht beendet sei“, blieben ohne Erfolg. Die Niederhessen verlangten das Gelöbnis der Räte und der Bürgerschaft auf die Landgrafschaft von Hessen-Kassel. In Marburg beruhigte sich die Situation bald, nachdem Hessen-Kassel die Hoheit über Hessen Marburg zurück erobert hatte 105 Landgräfin Amalie-Elisabeth ordnete größte Rücksichtnahme und Disziplin für die in Marburg einquartierten, niederhessischen Soldaten an. Dies wurde weitgehend eingehalten. Übertretungen dieser Anordnung führten zu strenger Bestrafung. Die Not der Marburger Bürgerschaft infolge der Einquartierungen wurde indessen immer größer. Seinen Anspruch auf Marburg und ganz Oberhessen gab Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt nicht auf. In einem Schreiben vom 16. Januar 1646, das auf geheimen Wege Marburg erreichte, hatte er bereits die Marburger Bürgerschaft zum „Festhalten an der ihm einst gelobten Untertanentreue“ ermahnt. Zielstrebig ging Landgraf Georg II. daran, Maßnahmen für eine Rückeroberung von Marburg zu treffen. Er suchte den Marsch des aus Norddeutschland nach Süddeutschland zurückkehrenden kaiserlichen Heeres auszunutzen, um mit deren Hilfe die Rückgewinnung von Hessen-Marburg für Hessen-Darmstadt durchzusetzen. Der Zug der Kaiserlichen durch das Hessenland im Jahr 1647 brachte letztmalig in dem großen Krieg Unheil und Elend in die Dörfer und Städte. Dabei zogen die in kaiserlichen Diensten stehenden Kroaten eine unvorstellbare Spur der Verwüstung und des Grauens durch Hessen. Ohne Rücksicht auf Freund und Feind. Zahllose Dörfer und viele Städte wurden zerstört, obwohl es dafür nicht den geringsten Anlass gab. Es handelte sich offenbar um einen letzten großen Beutezug, der noch einmal die Taschen der Soldateska füllen sollte. Die großen Heere der „Protestantischen Union“ zeigten sich, ebenso wie die der Kaiserlichen im Jahre 1647 106 nicht mehr geneigt, große Schlachten mit dem Gegner zu schlagen. Friedensgespräche deuteten sich an. Man ging sich aus dem Wege. Der Großteil der niederhessischen Truppen befand sich wie so oft im Verlaufe der hessischen Geschichte, nicht im eigenen Lande, als die bayrischen-kaiserlichen und kroatischen Verbände auf ihrem Zug nach Süden durch Niederhessen und Oberhessen zogen. Diesen Sachverhalt suchte Landgraf Georg II. durch einem letzten Schlag gegen Hessen-Kassel und der Rückeroberung von Hessen-Marburg auszunutzen. Welchen Vorteil die kaiserlichen Heerführer darin erblickten, vor dem sich abzeichnenden Ende des großen Ringens noch einmal ein Kriegsabenteuer einzugehen bleibt unklar. Dem Hilfsersuchen des Landgrafen Georg II. das von Hessen-Kassel gehaltene Marburg anzugreifen wurde nachgegeben. Am 24. November 1647 setzte sich das kaiserliche Heer von Treysa aus unter dem Oberbefehl des General-Feldmarschalls Melander von Holzapfel in Richtung Marburg in Bewegung. siehe Anmerkung 2) Der niederhessische Stadtkommandant in Marburg, Oberst Johann Stauff, hatte durch Kundschafter Hinweise auf den bevorstehenden Angriff erhalten. Umgehend ergriff er Maßnahmen zur Verteidigung von Stadt und Schloss. Stauff war sich bald im Klaren darüber, dass er mit den ihm zur Verfügung stehenden etwa 600 regulären niederhessischen Soldaten die Stadt nicht gegen eine anrückende Armee von 8000 – 10.000 kaiserlichen Söldnern verteidigen kann. 107 Landgräfin Amalie-Elisabeth von Hessen-Kassel weilte indessen mit dem Großteil des niederhessischen Heeres in den Niederlanden. Hilfe für die bedrohte Stadt Marburg konnte von ihr nicht erwartet werden. Oberst Stauff forderte von den Bürgern Unterstützung zur Verteidigung der Stadt. Aus einigen Ortschaften östlich von Marburg waren Bürger und Bauersleute vor den anrückenden kaiserlichen Truppen und aus Angst vor den Gräuel die von den Kroaten in Nordhessen angerichtet wurden nach Marburg geflüchtet um hinter den Stadtmauern Schutz zu finden. Etliche Hundert Bauern sind es gewesen, die in der Nacht in das Anwesen Steinweg 4, des Schultheißen Dr. Heilmann, vor den Angreifern geflüchtet waren. Sie hatten hier einen Lichtschein erblickt, in der ansonsten stockdunklen Stadt. Ihnen auf den Fersen waren bereits die in die Stadt eindringenden kaiserlichen Soldaten des Obristen Felix. Die in die Stadt geflüchteten Bauern wurden sogleich für Schanzarbeiten und das Ausheben von Gräben zur Verteidigung eingesetzt. Nur wenige Tage später hatten sie diese Dienste für die Angreifer zu leisten. Unter der Führung von General-Feldmarshall Holzapfel und den Obristen von Bardiz und Freiherrn zu Fernamont, erreichten die Angreifer am 29. November 1647 Marburg. Durch das Elisabeth-Tor drangen sie bis an die Stadtmauern zum Kesseltor am Steinweg vor. Sie brachten das schwach verteidigte Kesseltor in ihre Gewalt und verfügten nun ihrerseits über die in die Stadt geflüchteten Bauern, die sie für die weiteren Angriffsvorbereitungen zu Schanzarbeiten einsetzten. Von Dr. Heilmanns Keller und von den Kellern der angrenzenden Häuser wurden Brechen in die rückwär108 tigen Wände schlagen, um auf diesem Wege ungesehen zu den Burgmauern und Stadtgräben zu gelangen Das große massiv gebaute Anwesen des Dr. Heilmann außerhalb der Stadtmauern am Steinweg diente nun während des Angriffs als Gefechtsstand für den Generalstab der kaiserlichen Angreifer. Der Marburger Historiker Wilhelm Bücking schildert in seiner Beschreibung: -„ aus Marburgs Vergangenheit“ erschienen im Jahr 1901 gedruckt in der Elwert’schen Buchhandlung“ - sehr anschaulich die verhängnisvollen Ereignisse, die Marburg, kurz vor dem Ende des großen Sterbens, ins Verderben riss. Auf diesen Bericht wird im Nachfolgenden Bezug genommen. „Zwischen Kesseltor und der Hildweinspforte, an der Wasserscheide zwischen den Häusern der Neustadt und dem Steinweg, kam es zum ersten heftigen Gefecht. Oberst Stauff hatte hier eine Schanze der Verteidiger errichtet und leistete 2 Stunden lang Widerstand gegen den viel stärkeren Feind. Beide Seiten hatten dabei erhebliche Verluste. Auch die vom Grün her vorrückenden Kaiserlichen hatten wenig Mühe, die Stadtmauern an der Untergasse zu überwinden und in die Stadt vorzudringen. Vorsorglich waren mitgeführte Mineure der kaiserlichen aus den Erzbergwerken heran geführt worden, um die unterirdischen Zugänge zum Schlossberg und zu den Festungseinrichtungen frei zu machen. Etliche vermauerte Zugänge wurden aufge109 sprengt. Die Verteidiger brachten aber durch unmittelbare Gegensprengungen die unterirdischen Gänge zum Einsturz, so dass ein Vordringen der Kaiserlichen von dieser Seite auf das Schloss verhindert werden konnte. Die Aufforderung der Kaiserlichen zur Übergabe der Stadt und des Schlosses lehnte Oberst Stauff ab. Er zog jedoch die auf den Stadtmauern und die bei den Stadttoren postierten Wachtmannschaften zurück auf die Schlossfestung und überließ den Angreifern kampflos die Stadt. Mit den verbliebenen 400 Soldaten verschanzten sich die Niederhessen mit Oberst Stauff auf der Festung, sowie in den massiven Häusern am Burgberg, der neuen Kanzlei und der Wolffsburg. Durch die Einstellung ihrer Kampfhandlungen in der Stadt hoffte man, dass die Bürgerschaft vor weiterem unnötigem Schaden bewahrt werden könnte. Für die Stadt und die Bürgerschaft verliefen die Ereignisse indessen verhängnisvoll. Mit dem Vorwand, dass sich Teile der Bürgerschaft in „unbotmäßiger Weise“ an der Verteidigung der Niederhessen beteiligt hätten und damit gegen den geleisteten „Untertaneneid“ für Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt verstoßen hätten, überließ der „kaiserlich-darmstädtische Generalstab“ seinen Truppen die Stadt Marburg drei Tage und drei Nächte lang der Plünderung. Daran habe sich die gesamte kaiserliche Armee beteiligte. Offiziere und Gemeine verteilten sich in den Strassen und Gassen. Sie drangen in alle Häuser und durchwühlten vom Keller bis zum Boden jeden Winkel. Alles was Gefallen fand wurde weg getragen, soviel ein jeder zu tragen vermochte. Möbel, Kessel, Öfen, jeglicher Hausrat, Hemden, Leinen, Flachse, Garne, volle 110 Weinfässer, Kram- und Fleischwaren wurden zusammengetragen, auf Wagen verladen und in Richtung Gießen und Frankfurt abgefahren. Für die geraubten Waren sollten auf den Märkten gute Erlöse erzielt werden. Dazu wurden alle lebenden Tiere: wie Ochsen, Kühe, Rinder, Esel und Schafe konfisziert und auf die später abziehenden Trosse verteilt. Begehrter waren indessen die Wertsachen wie Geld, Gold und Schmuck, die unmittelbar in den Säckeln der Plünderer verschwanden. Viele Bürger konnten nichts retten, als das was sie am Leibe trugen. Manche nicht einmal dieses. Andere mussten das eigene Leben mit Geld erkaufen. In den Verzeichnissen der ausgeplünderten Bürgerschaft wurden später alle geraubten Gegenstände erfasst. Der Bürger Adolf Kremer entrichtete 8 Reichtaler an seine Peiniger, die letzten die er wohl noch hatte, um sein Leben zu retten. Die Ratsherrn Fieseler und Klunck leisteten je 20 Reichstaler Ablösung zur Rettung ihrer Kinder. Den gemeinsam erlittenen Verlust beziffern die vormals begüterten Ratsherrn mit über 5000 Reichstalern. Heinrich Peter berichtete später, ein Fähnrich der schon alles weggeräumt habe was zu fassen war, hatte gedroht, das ganze Haus zu zerschlagen, wenn er nicht das letzte versteckte Geld heraus rücke. Die Witwe des Daniel Kremer berichtete, dass nach dem 3. Tag der Plünderung ein Leutnant - nebst Frau, Kind und Knecht und zwei Pferden - in ihr Haus einquartiert seien. Alles was noch übrig war habe dieser Leutnant an sich genommen. Das restliche Heu habe er verfüttert und ihr nicht das Geringste hinterlassen. Ihr eigener kleiner Sohn habe nicht mehr ein Stück Kleidung besessen. 111 Auf 100 Reichstaler schätzt der Drechsler Heinrich Brinkheimer seinen Verlust. Das sei aber nichts gegen das Leben des ältesten Söhnchens, der beim Sturm auf die Stadt erschossen worden sei. Witwe Repperschmidt erwähnt in ihrem Bericht: „Als die Plünderer erfuhren, dass mein Mann bei der Verteidigung der Stadt gefallen ist, haben sie mir alles zerschlagen und mit meinen 2 letzten Talern rettete ich mein Leben“. Johannes Ruppersberger sagte; „Sie haben mich zu einem Bettler gemacht“ Konrad Peter, Schlosser Heinrich Wagner, Schuhmacher Johannes Römer und zahlreiche andere Handwerker berichteten später für die Aufzeichnungen im Ratsprotokoll der Stadt, dass sie durch die mutwillige Zerstörung um ihr Hab und Gut gebracht seien. Der Bäcker Johannes Römershäuser berichtet davon, dass unter dem Brauhaus in der Wettergasse ein heimlicher Keller gewesen sei, im dem einige Bürger ihre besten Sachen verwahrt hätten. Zwei Tage vor dem Abmarsch der Kaiserlichen habe eine Frau den Soldaten das Versteck verraten, die dann alles ausgeräumt hätten. Leer stehende Schuppen wurden abgebrochen und das Holz bei den Wachtfeuern verbrannt. Nur die „salvagardi“ Häuser (Schutzbriefhäuser wie das Haus 12 des Georg von Lettow) seien von der Soldateska verschont geblieben. In Gefahr geriet auch die Pfarrkirche. Die Kaiserlichen hatten die Absicht, auf dem Kirchturm einen Wachtposten einzurichten, um von der höheren Position einen besseren Überblick zur Schlossfestung und den dortigen Bewegungen zu erhalten. Obrist Stauff ließ indessen den Kaiserlichen mitteilen, dass er in diesem falle den Kirchturm zusammen schießen lassen werde 112 Zwei Marburger Ratsherren hatten es gewagt, während der Erstürmung der Stadt, den Kaiserlichen entgegen zu treten, um Schutz für die „lutherische Pfarrkirche“ zu erbitten. „Da die Hessen-Darmstädter doch selbst diese Kirche der reformierten Seite wieder entrissen hätten und die lutherische Lehre seither hier wieder verkündet werde“. Der kaiserliche Obrist Wachenheim, der auch keinen Sinn für ein „Himmelfahrtskommando“ auf dem Kirchturm“ erkennen konnte, nutzte den Vorfall, um die beiden Ratsherren kurzerhand gefangen zu nehmen. Erst nach einer Zahlung von 1.000 Reichstalern kamen die Ratsherren wieder auf freien Fuß. Ihre Familien und Freunde hatten das Lösegeld mühsam zusammengebracht. Das Haus des Schlossers Heinrich Wagner wurde mutwillig total zerstört. so dass nichts gerettet werden konnte. Es wurden indessen auch weitere, geheime Kellerräume von den Plünderern ausfindig gemacht. Am Ende blieb kein Haus verschont.“ Soweit zu den Ausführungen Wilhelm Bückings. Vom 4. Dezember bis zum 7. Dezember 1647 dauerte die angeordnete Plünderung in Marburg an. Jedoch auch danach änderte sich an der Ausbeutung der Bürgerschaft durch die Kaiserlichen nichts. Auf offener Straße wurden die Bürger ihrer Kleidung und letzten Habe beraubt, so sie denn noch etwas zum Forttragen hatten. Die Kampfhandlungen kamen für einige Tage zum Erliegen. Der von allen Beteiligten hoch angesehene Marburger Schultheiß und Quartiermeister Dr. Heilmann wurde zur Regulierung der Einquartierungen der in der Stadt zu versorgenden kaiserlichen Regimenter 113 eingesetzt. Diese Einquartierungen bildeten vielfach nur die Fortsetzung der schon bekannten Plünderungen. An die Bürger die sich bisher versteckt gehalten hatten erging der Aufruf, sich bei der kaiserlichen Kommandantur zu melden. Besonders den Ratsherren galt die Aufmerksamkeit der kaiserlichen Generalität. Man machte sie für den Widerstand verantwortlich, der von Teilen der Bürgerschaft gegen das kaiserliche Heer geübt worden war. Die Nachricht von der Gefangennahme einiger Ratsherren hatte sich in Marburg wie ein Lauffeuer verbreitet. Aus Furcht vor ihrer Gefangennahme versuchten die übrigen Ratsherren sich zu verstecken. Dies gelang nicht. Sie wurden in das Stockhaus unter Arrest genommen. Die gefangenen Ratsherren und verdächtigten Stadtbürger wurden von Oberkommissar Hofmann und General-Auditeur Groß mit markigen Worten in Angst und Schrecken versetzt. Die an sie gerichtete Ansprache im Wortlaut: „Sie, wie die ganze Bürgerschaft, sind Rebellen, die sich haben gelüsten lassen, wider des Kaisers Majestät Armee zu opponieren. Wegen ihrer Treulosigkeit gegen den Kaiser und ihren rechtmäßigen Landesherrn, Landgraf Georg, seien sie ihrer Majestät mit Leib und Gut, Ehr und Blut, Weib und Kind verfallen und verdienen, dass ihnen die Köpfe abgeschlagen und auf Pfähle gesteckt, ihre Leiber gespießt und sie auf diese Weise vom Leben zum Tode gebracht würden. Dass die Stadt in Brand gesteckt und ein Galgen darüber gemacht würde, zu ewigen Schande und zum Spott ihrer Kinder und Nachkommen. Daran sie sehen sollten, wie mit ihnen einst verfahren worden sei. Wofern aber die Stadt der Generalität 5.000 Reichstalern. Lö114 segeld versprochen wollte, sollten sie Verzeihung erlangen und am Leben bleiben, widrigenfalls gegen sie verfahren würde, wie vorher angezeigt“ Die Anhörung dieses harten Urteils hatte die Gefangenen dermaßen erschüttert, dass sie sich außerstande fühlten, eine alsbaldige Erklärung hierauf zu geben. In dieser hohen Forderung erkannten sie etwas Unmögliches, welches sie nicht zu leisten vermochten, weil sie ja schon ganz und gar ausgeplündert und des Ihrigen beraubt waren. Hierauf wurden sie wieder in das Stockhaus zurückgeführt und etliche Tage bei Hunger, Durst und Frost gefangen gehalten. Inzwischen hatte sich die kaiserliche Generalität anders besonnen und das Lösegeld auf 12.000 Reichstaler erhöht. Am 19. Dezember 1647 wurde den Gefangenen angezeigt, wenn sie sich in kurzer Zeit nicht erklären und den angebotenen Accord, der nunmehr auf 12.000 Reichstaler festgesetzt sei, nicht unterschreiben würden, dann sollte wenigstens ein Exempel zur Warnung aufgestellt und einige von ihnen hingerichtet werden. Zu den scharfen Drohungen der Eroberer gesellte sich nun noch das Lamento der Frauen, der Kinder und der Angehörigen der Gefangenen. Mit Rücksicht auf die Erhaltung ihres eigenen Lebens und auf eindringliches Zureden der Ihrigen entschlossen sie sich, den ihnen gestellten Accord anzunehmen. Am 20. Dezember 1647 wurden die Ratsherren in das Rathaus geführt. Im Namen der Stadt unterzeichneten sie die Obligation die ihnen auf erlegte, „Brandschatz- und Plünderungsgelder“ in Höhe von 12.000 Reichstalern an das kaiserliche Heer zu zahlen. Die Unterzeichner sind: Johannes Schott, Helfrich Bange, Eberhard Bierau, Pau115 lus Sauer, Matthäus Schrot, Antonius Kalb, Johannes Liebächer, Ludwig Diedenzhäuser, Heinrich Scheffer, Kaspar Giebel, Erasmus Sömmering, Ernst Sallich, Joachim Mann, Peter Scherer, Ludwig Lins, Konrad Kalb, Johann Kurt Scheffer, Peter Mai, Jeremias Selig. Im Namen des Kaisers untersiegelte Generalwachtmeister Ernst Graf von Tann die Obligation. Weitere 2.000 Reichstaler als „Glockengelder“ (Forderung für die Verschonung der Kirchenglocken vor ihrer Zerstörung durch die Kaiserlichen) machte der Feldzeugmeister Oberst von Fernamont geltend. Auch diese Forderung wurde von den Schöffen unterzeichnet. Die Eroberer der Stadt ließen indessen auch die Sichenhäuser und St.Jakobshospital nicht ungeschoren. Sie plünderten auch diese Häuser, vertrieben die Insassen von denen zahlreiche in der kalten Jahreszeit erfroren, wenn sie nicht verhungerten. In der vereinbarten Schuldverschreibung über die vor erwähnten 12.000 Reichstaler hatten die Eroberer zugesagt, nicht nur die gefangenen Bürger und Schöffen frei zu lassen, sondern auch auf alle weiteren Plünderungen und Erpressungen zu verzichten. Noch in der Stunde der Unterzeichnung dieser Vereinbarung nahmen kaiserliche Artilleristen drei Räte und etliche Bürger aufs Neue gefangen. Die Visitationen und Plünderungen wurden in den Häusern fortgesetzt. Auch die „geschützten Anwesen“ blieben nun nicht mehr verschont. Die Niederhessen die sich auf das Schloss zurückgezogen hatten, sahen dem Treiben ohnmächtig zu. Angesichts der nicht enden wollenden Torturen durch die Kaiserlichen eröffneten sie in den letzten Dezembertagen des Jahres 1647 ein heftiges Kanonen- und Kartätschenfeuer auf alle sich bietenden 116 Ziele der kaiserlichen Belagerer. Die günstigere Position auf dem Schlossberg sah die Niederhessen im Vorteil. Die Kaiserlichen erlitten durch das beständige Feuer erhebliche Verluste. Zu den Gefallenen zählten: der Generalwachtmeister Reich, 1 Obristleutnant, 7 Kapitäne, 1 Rittmeister, 1 Bergbauingenieur und mehr als 400 gefallene gemeine Soldaten. Die Gegenwehr der Kaiserlichen blieb eher wirkungslos. Auch die Versuche der Unterminierung des Schlossberges unter Ausnutzung der verschiedenen unterirdischen Gänge die bis unter die obere Schlossmauern führen sollten, blieben erfolglos. Die kaiserlichen Mineure trafen auf vermauerte und verbarrikadierte Zugänge der zwischen den Häusern verlaufenden unterirdischen Gänge und gerieten ihrerseits durch die Gegensprengungen der Belagerten, die ja ebenfalls über beste Kenntnis der Örtlichkeiten verfügten, in höchste Bedrängnis. Das Vorhaben der Unterminierung wurde von den Kaiserlichen aufgegeben. Nach den Aufzeichnungen des „Theatrum Europaeum 6. Teil S. 13“ geriet General Melander von Holzapfel selbst in höchste Gefahr durch einen vom Schlossberg herab geführten direktem Kanonenbeschuss, mit dem das Quartier der kaiserlichen Generalität im Hause des darmstädtischen Rentmeisters Daniel Seip, Am Grün 25, ins Visier genommen worden war. Durch Kundschafter war Obrist Stauff davon in Kenntnis gesetzt, wann sich die Kommandanten der kaiserlichen Belagerer zur Lagebesprechung im Quartier des GeneralFeldmarschalls aufhielten. Von zwei Seiten her ließ Stauff aus 14 Kanonen gleichzeitig gezielt auf dieses Quartier feuern. Neben der „Neuen Kanzlei“ am Schossberg hatte er den Feigenhof niederlegen lassen, um unsichtbar für die in der 117 Stadt befindlichen Belagerer eine starke Batterie auf dem freigelegten Platz eingerichtet. Über die Ruinen der Häuser in der Ritterstrasse hinweg ließ er von dort aus auf das Ziel am Grün zu feuern. Von der notdürftig wieder hergerichteten großen Schlossbastion wurde gleichzeitig das Feuer der Niederhessen durch sechs 24-Pfünder unterstützt. Das Ergebnis dieses überraschenden Feuerüberfalls in den letzten Dezembertagen des Jahres 1647 war für den kaiserlichen Generalstab verheerend. Zahlreiche zerschmetterte und tödlich getroffene Offiziere gehörten zu den Opfern. Darunter der Markgraf von Baden, dem ein Bein abgerissen wurde. Dem Generalfeldmarschall Melander von Holzapfel klebte „ein fremdes Hirn eines Gefallenen am Backen“, sowie ein Holzsplitter im Bein, der ihm eine böse Verletzung beigefügt hatte. Dies dürfte den Entschluss der Kaiserlichen, das unrühmliche Debakel in Marburg zu beenden, beschleunigt haben. Innerhalb weniger Tage zogen die kaiserlichen Belagerer aus Marburg ab. Wut, über die nicht geglückte Eroberung des Schlosses führte die Kaiserlichen noch einmal zu einem Höhepunkt ihres Zerstörungswerkes in der besetzten Stadt. Alles, was bei den Plünderungen noch nicht verdorben war, fand nun den Weg der Zerstörung. Möbel, Haustüren, Holztreppen und alles Brennbare wurde in den Wachtfeuern der letzten Tage des Jahres 1647 auf den Strassen verbrannt. Die vier großen Stadttore wurden vor dem Abzug der Kaiserlichen „zum Abschied“ gesprengt. Der Magistrat berichtete in seiner Auflistung über die erlittenen Schäden durch die Totalplünderung und muwillige Zerstörung der Stadt an die Landgräfin Amalie 118 Elisabeth von Hessen-Kassel von einem Schaden in Höhe von 1 Million Goldtaler. Der Anblick der Stadt sei so erbärmlich, dass die darinnen Wohnenden wohl zu Lebzeiten eine so ansehnliche Behausung, als zuvor nicht mehr erleben werden. Am 27. Dezember 1647 verließ die Armee die Stadt. Sie marschiert in zwei Richtungen ab. Während eine Abteilung sich in Richtung Fulda bewegt, zieht die andere über Gießen und Frankfurt weiter nach Süden. Die nach Süden ziehende Armee nahm indessen vier Geiseln aus Marburg mit, allesamt honorige Bürger. Die Schöffen Johannes Schott und Eberhard Bierau und die Bürger Heinrich Kuntz und Heinrich Briel sahen einem ungewissen Schicksal entgegen. Die Geiseln wurden von Feldzeugmeister Obrist von Fernamont mit dem Hinweis mitgeführt, sie so lange gefangen zu halten, bis die von ihm geforderten „Glockengelder“ in Höhe von 2.500 Reichstalern gezahlt seien. Zu Anfang des Abmarsches wurden die vier Geiseln „an den Händen gefesselt mitgeführt und von den „Profosen“ ungnädig behandelt“. Später erfolgte durch die Offiziere eine Aufteilung der Geiseln. Heinrich Briel wurde dem Obristen von Fermamont unterstellt. Eberhard Bierau dem Obristleutnant von Dehmb, Schott und Kuntz dem Stockhauptmann Esbron zur Überwachung unterstellt. Die Offiziere ließen die Gefangenen anfangs an ihren Tischen speisen und sorgten für ihre Gesundheit. Sie schützten sie auch vor den Rohheiten der Soldaten. Alle Beteiligten lebten in der Erwartung, dass die geforderten Lösegelder aus Marburg bald eintreffen werden. Auf ihrem Marsch nach Süden ergab sich in Nürn119 berg eine Möglichkeit, die Lösegelder durch einen Kaufmann in „Wechsel“ zu nehmen. Dieses Vorhaben scheiterte aber. Am 19 Januar 1648 brachte der Unterbürgermeister in einer Ratssitzung in Marburg vor, wie man die Unglücklichen aus ihrer misslichen Lage befreien könnte. Ein Brief der Geiseln erreichte am 27. Januar 1648 den Magistrat in Marburg, der den Bürgern in der Stadt bekannt gemacht wurde. Alle wünschten, dass man die in Not geratenen Mitbürger aus den Händen der Kaiserlichen auslösen müsste. Bürgermeister Klunck, der Schöffe Fiesler und der Stadtschreiber Crollius erhielten Vollmacht, nach Kassel zu reisen, um die Landgräfin Amalie Elisabeth um die Bereitstellung des Lösegeldes zu bitten. Außerdem sollte die Landgräfin gebeten werden, eine Kollekte im Lande zuzulassen, um so die geforderte Summe von 12.000 Reichstalern an den Generalcommissar von Traun zusammen zu bekommen. Am 30. Januar 1648 erreichten die Marburger Deputierten Kassel. Die Landgräfin hatte Bedenken gegen die Zahlung des Lösegeldes für die Geiseln, stimmte aber zu, dass eine Kollekte erhoben werden dürfe und zeichnete für sich - und den Kronprinzen Wilhelm 200 Reichstaler und 200 Körbe Korn. Letzteres zur Verteilung an die Armen in Marburg. Die Landgrafen Hermann (Hessen-Rotenburg) und Ernst (HessenRheinfels) zeichneten je 25 Viertel Korn, die für 500 Reichstaler verkauft werden konnten. Die Kollekte in Kassel erbrachte 858 Reichstaler. Am 14. Februar 1648 richtete der Stadtrat in Marburg ein Schreiben an die gefangenen Geiseln nebst einer Mitteilung an Herrn von Fernamont. Der Bote aus Marburg, Karl Koch, übergab das Schreiben am 24. Feb120 ruar bei Engelstadt an der Donau den Geiseln. Am 25. Februar erhielt der Bote die Rückantwort der Geiseln, in der mitgeteilt wurde, dass der Herr von Fernamont höchst ungehalten sei, über das Ansinnen von Marburg, mit der Hälfte des geforderten Lösegeldes zufrieden zu sein. Im Falle weiterer Verzögerung werde man die Geiseln noch viel weiter von ihrer Heimat entfernen. Schließlich bedauerten die Geiseln, dass sie auch Kosten für ihre Verköstigung in ihrer Haft nicht begleichen könnten. Diese waren inzwischen auf 150 Reichstaler angewachsen. Für die Geiselnehmer war es offenbar Usus, dass derartige Kosten von den Opfern ab verlangt wurden. In den letzten Tagen des März 1648 gelang drei der Geiseln die Flucht. Schott, Kuntz und Briel konnten mit der Hilfe ihres Barbiers, der ihnen in der Gefangenschaft zugeteilt war, nach 14 Wochen Gefangenschaft bei Regensburg entweichen. Weshalb Bierau zurück bleiben musste, bleibt unklar. Schott und Kuntz erreichten 14 Tage nach ihrer Flucht aus dem kaiserlichen Gewahrsam Heilbronn. Der im April 1647 nach Marburg zurückgekehrte Bote Karl Koch konnte dem Rat in Marburg von der Flucht der drei Geiseln berichten und deren eingeschlagenen Weg beschreiben. Der Magistrat entsandte den Geflohenen einen Boten entgegen, der die Heimkehrenden mit den nötigen Geldern für Kleidung und Logis auf dem weiteren Fluchtweg besorgte. In Butzbach trafen sich die Heimkehrer mit Karl Koch, der sich mit Botschaften aus Marburg auf dem Wege nach den kaiserlichen Heerführern bei Passau befand. Dort hatte er an den Herrn Generalfeldmeister von Fernamont eine 121 Nachricht des Herzogs Ernst Wilhelm von Gotha und des Landgrafen Georg von Darmstadt zu übergeben. Dass diese Nachricht eine Intervention zur Lösegeldfrage beinhaltete ist nahe liegend. Den Magistrat in Marburg erreichte eine Nachricht der kaiserlichen Artillerie-Offiziere, dass sie die Auszahlung der „Glockengelder“ weiterhin einfordern. Die entflohenen Schott, Briel und Kuntz hätten ihren Kameraden Bierau wie Bösewichter in Stich gelassen und gegen ihr schriftliches Gelöbnis, dass sie in Gießen, Frankfurt, Nürnberg und Regensburg gegeben hätten, verstoßen. Der zurückgebliebene Bierau berichtet später, dass er für die Flucht der anderen büßen musste. „Ich musste weiter mitmarschieren und wurde dabei von Kroaten und Musketieren auf das Schärfste bewacht. Schlafen musste ich in Ketten und die Kost war so schlecht, dass mir übel wurde.“ Als der Generalfeldzeugmeister von Fernamont einen Teil des geforderten Geldbetrag erhalten hatte, der als Kredit bei Kaufmann Johannes Ochs aus Frankfurt für den Gefangenen Bierau aufgenommenen worden war, wurden diesem die Ketten gelöst. Der Marburger Bote Karl Koch, der als Nachrichtenvermittler alle Vorgänge begleitete und auch den Kredit vermittelt und übergeben hatte berichtete, dass man den Bierau aufhängen werde, wenn nicht bald die „Glockengelder“ vollständig gezahlt werden. Koch überbrachte auch die Botschaften, die an den Generalfeldmarschall Melander von Holzapfel. Darin wurde um die Freilassung der letzten Geisel gebeten, da doch alle Kriegshandlungen inzwischen beendet seien. Holzapfel verwies jedoch auf den Herrn von Fernamont, der allein in dieser Angelegenheit zuständig sei. 122 Holzapfels Brief vom Mai 1648 an Landgraf Georg II. und alle anderen Briefe die er auf dem Rückweg nach Marburg bei sich trug, wurden dem Boten Koch von schwedischen Soldaten abgenommen. In den Briefen wird von den Parteien vermerkt, dass die Angelegenheit Bierau nicht die anstehenden Verhandlungen in Münster belasten dürfe. Der von Fernamont solle eine baldige Beendigung der Geiselnahme möglich machen. Der Inhalt dieser Nachrichten erreichte die Empfänger und nährte die Hoffnung auf baldige Rückkehr der letzten Geisel. In der Ratssitzung vom 6. Juli 1648 wird das Hilfsgesuch des Bierau an die Landgräfin Amalie Elisabeth verlesen. Die Landgräfin gestattete danach dem Magistrat, die inzwischen durch Kollekte eingesammelten „Ranzgelder“ zur Erledigung der Angelegenheit Bierau zu verwenden. Daraufhin wurden zuerst dem Kaufmann Ochs in Frankfurt die gewährten Kredite erstattet. Bierau wurde nach mehr als 30 Wochen Geiselhaft im Juli 1648 in Passau auf freien Fuß gesetzt. Mit der kaiserlichen Postkutsche gelangte er bis Regensburg. Von dort machte er sich zu Fuß auf den Weg nach Nürnberg. Unterwegs wurde er von Buschkleppern seiner Kleidung beraubt. Nach einer Woche erreichte Bierau Nürnberg, wo er sich erneut mit einem Kredit bei einem Kaufmann für die weitere Heimreise versorgen kann. Den Rest des Weges von Nürnberg über Frankfurt und Gießen nahm Bierau mit der Postkutsche. Am 1. August 1648 kam er nach 7 Monaten Geiselhaft in der Heimat an. Die 12.000 Reichstaler Brandschatzungsgelder an die Kaiserlichen hat Marburg nicht gezahlt. Beim Friedens123 schluss von 1648 hatte sich Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt mit Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel dahin gehend geeinigt, die „Angelegenheit zu regeln“. Der Marburger Rat hatte dazu eingelassen, dass die Kaiserlichen den von ihnen abgefassten Accord zur Zahlung der Brandschatzungsgelder nicht eingehalten hätten, indem sie vor ihrem Abzug aus Marburg, entgegen der Abmachung, alles geplündert, die Stadttore zerstört und Geiseln mit sich genommen hätten. Die kaiserlichen Offiziere des Artillerieregimentes von Fernamont ignorierten gleichwohl den zwischen den Friedensparteien verabredeten Verzicht der Lösegeldzahlumg. Noch bis zum Jahre 1654 drohten sie den Marburger Kaufleuten: „dass, wenn man sie bei der Frankfurter Messe erwischen sollte, so werde man sie als Geiseln so lange nehmen, bis der Accord abgegolten sei.“ siehe Anmerkung 3) Soviel zu den Schilderungen des Dr. Wilhelm Bücking über die Ereignisse der letzten Jahre des 30jährigen Krieges, der Marburg als Streitobjekt und Zankapfel der hessischen Bruderstaaten doch noch ins Unglück stürzen sollte. Noch vor Beginn des 30 jährigen Krieges im Jahre 1601 lebten in der aufblühenden Stadt Marburg etwa 4.800 Einwohner. Am Ende des Krieges, im Jahre 1648 war die Einwohnerzahl in Marburg auf unter 3.000 dezimiert. Dabei waren es nicht allein die unmittelbaren Kriegshandlungen, die zu diesem Aderlass führten, sondern deren Folgewirkungen durch Hunger und Kälte nach den Plünderungen und Brandschatzungen. Besonders waren es jedoch die wiederholten Pestepide124 mien, die in dieser Zeit zu beklagen waren. Bereits im Jahre 1612 hatte die verheerende Pest in Marburg über 1.100 Menschenleben gefordert. In den Jahren 1622 und 1624 waren es wiederum Hunderte, die ihr Leben an den schwarzen Tod verloren, bis im Jahre 1637 eine weitere Pestilenz in Marburg etwa 400 Menschen dahin raffte. Erst um das Jahr 1770 hatte die Stadt Marburg mit 5.000 Einwohnern Anzahl und Größe des Jahres 1600 wieder erreicht. Es sollten allerdings nicht die letzten Kriegsereignisse sein, die Marburg zum Schauplatz der kriegerischen Auseinandersetzungen fremder Mächte und fremder Heere machen sollten. Darüber wird im Folgenden noch zu berichten sein. Anmerkung 1: In den fürstlichen Militärstandorten waren eigens eingerichtete Kasernenanlagen zur ständigen Unterbringung bis in das 19. Jh. allgemein nicht üblich. Stattdessen waren die Militärangehörigen in ihren Standorten in den Wohnhäusern der Bürgerschaft einquartiert.. Dort wurden sie in der Regel auch mit Lebensmitteln und – sofern notwendig – mit dem Futter für die Pferde - versorgt. Die Einquartierung erfolgte auch in der Garnisonstadt Marburg über viele Jahrhunderte hinweg nach strengen Regeln. Für die einzelnen Stadtbezirke hatte der Rat der Stadt Quartiermeister eingesetzt, die die Bereitstellung der Unterkünfte und die Versorgung der Einquartierten zu überwachen hatten. Von der Einquartierung waren alle Bürgerhäuser der Stadt betroffen. Bessere Quartiere waren den Offizieren vorbehalten. Die Abstufung der Qualität der Quartiere entsprach der Rangordnung der Quartier125 nehmer. Die Kosten für die Unterbringung und Verköstigung waren in „Friedenszeiten“ von den Untergebrachten zu erheben und wurden vom Sold einbehalten. Die Beträge hierfür waren, entsprechend der Rangordnung abgestellt. Allerdings waren nicht alle Stadtbürger gleichermaßen von den Einquartierungen betroffen. Ausgenommen waren in Marburg die Angehörigen der Stände, des Klerus, der landgräflichen Beamten, der Professoren und der Bürgermeister, Räte und Beigeordneten. In besonders begründeten Fällen wurden herrschaftliche „Schutz- oder Freibriefe“ für einzelne Häuser ausgestellt. Naturgemäß führten die Regelungen der Einquartierung zu Unruhen unter der betroffenen Bürgerschaft. Man war erbost, dass der in der Nachbarschaft wohnende Beamte oder Professor unbehelligt blieb, während die eigene Familie sich immer mehr einschränken musste. In den Kriegszeiten, etwa im 30jährigen Krieg (16181648) oder im siebenjährigen Krieg, (1756-1763) als die Stadt Marburg sehr oft unter wechselseitigen Eroberungen und Belagerungen fremder Mächte litt, oder als Etappenort den verschiedenen Kriegsparteien diente, waren die normalen Quartierregeln außer Kraft gesetzt. Niemand hielt sich an einen „Schutzbrief“ eines fremden Armeeführers, wenn dieser außer Reichweite war. So gab es in Marburg in diesen Kriegszeiten auch keine generelle „Schonung für Schutzbürger“, (Stände, Räte, Professoren) obwohl beide Kriegsparteien darauf bedacht waren, deren Privilegien zu beachten. So ersuchte Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt, auf diplomatischen Wege, bei Königin Christina von Schweden (1626-1689) um Verschonung der Marburger Universität und ihrer Schutzpersonen vor Ein126 quartierungen und Kontributionen. Nach der Besetzung von Marburg im November 1645 durch Niederhessen sollte Amalie-Elisabeth von Hessen-Kassel ermahnt werden, „allen Schutz der einzigen, evangelischen Universität in Deutschland angedeihen zu lassen und sie, sampt der ihr dienenden Personen sowie deren Hab und Gut zu schonen“. Der Unmut der Bürgerschaft über ungleiche Behandlung und die Begünstigung der „Patrizier“, die zumindest in Zeiten des Waffenstillstandes über die Interessen der Kriegsparteien hinweg eingehalten wurde, war erheblich. Allein der ohnmächtige Zorn der Bürger verrauchte in tiefer Depression. In den zahllosen Märschen der gegnerischen Kriegsparteien durch das Hessenland kam es bis zum Jahre 1645 in Marburg zwar nicht zu unmittelbaren Kampfhandlungen. Jedoch die ständigen Kontributionszahlungen und Aufwendungen für die Einquartierungen aller „Fahnen“ war die Stadt längst der Armut anheim gefallen, als die Auseinandersetzung um das „Marburger Erbe“ ihrem Höhepunkt zustrebt. Die Häuser der privilegierten Stände waren am Ende ebenso zerstört oder beschädigt, als alle übrigen in der Stadt. Die erste Kaserne wurde in Marburg durch Preußen, nach der Annektierung von Kurhessen im Jahre 1866 errichtet. Anmerkungen 2 Bezeichnend für die Heeresstrukturen der kämpfenden Parteien im dreißigjährigen Krieg - für spätere, nationalstaatlich geprägte Generationen kaum nachvollziehbar - erweist sich in der kriegführenden Praxis dieser Zeit, dass die jeweiligen Heeresführer ihre Truppenverbände eigenständig und eigenverantwortlich für die jeweiligen Kriegsereignisse zusammen stellten. 127 Größere, ständig verfügbare stehende, nationale Heere waren im 17. Jh. in Europa in der Regel noch nicht üblich. Könige und andere Landessfürsten begnügten sich mit den ihnen unmittelbar und zum persönlichen Schutz unterstellten Garde - oder Leibregimentern. Für die kriegerischen Auseinandersetzungen bestellte man - gegen hohe Zahlungen - die dafür ausgewiesenen Heerführer, die ihrerseits die notwendigen Verbände, nebst den dazu benötigten Ausrüstungen, zur Verfügung stellten. So kämpften im dreißigjährigen Krieg die beühmten Heeresführer Johann von Tilly oder Albrecht von Wallenstein – mit den von ihnen selbst zusammengestellten Heeren auf eigene Rechnung gegen die protestantische Union. Dafür erhielten sie eine hohe Bezahlung durch den katholischen Kaiser. Dies hinderte diese „Kriegsunternehmer“ auch nicht daran, nach den Schlachten - für die man gemietet worden war -, die Fronten zu wechseln, wenn die Gegenseite mit entsprechender Entlohnung winkte. Die Entlohnung der Söldner bestand nicht zuletzt in der Erwartung der Bereicherung, die durch die Plünderungen nach den gewonnenen Schlachten erfolgten. So auch in Marburg im Jahre 1647. Plünderungen waren ein einkalkulierter Teil der Bezahlung für die Söldner. Die Aussicht auf reiche Beute war zugleich für zahllose Söldner ein Haupantrieb dafür, das gefährliche Soldatenhandwerk auszuüben. An die Heerführer wurden gelegentlich von der gegnerischen Partei hohe Zahlungen dafür geleistet, wenn ihr starkes Heer sich nicht an einer Kriegshandlung beteiligte und dadurch der Ausgang einer Schlacht beeinflusst wurde. Eine derartige Begebenheit ist im Zusammenhang mit der berühmten ersten großen Schlacht des 30jährigen Krieges zu erkennen. 128 In der „Schlacht am Weißen Berg“ (bei Prag) am 8. November 1620 unterlag das protestantische Böhmen gegen die katholische kaiserliche Liga. Der böhmische König Friedrich V. von der Pfalz (Winterkönig) hatte mit seinen 13.000 Söldnern nur geringe Chancen gegen das überlegene kaiserliche Heer, das aus etwa 40.000 Söldnern bestand. Kaum Beachtung fand indessen der Hinweis, dass der in dieser Zeit für die protestantische Union kämpfende Heerführer Ernst von Mansfeld sich mit seinem Heer nicht an der Schlacht am Weißen Berg beteiligte, weil er für seine Zurückhaltung vom Kaiser die stattliche Summe von 100.000 Reichstaler erhalten hatte. Mit seinem 20.000 Mann starken Heer hätte er die Niederlage der Protestanten durchaus abwenden können, zumal die Böhmischen auf dem Berg über die bessere strategische Lage verfügten. Der 30jährige Krieg hätte also durchaus einen völlig anderen Verlauf nehmen können. In der Geschichte des „hessischen Bruderkrieges“ rankt sich um den berühmten General Melander von Holzapfel eine ebenso zwiespältige Haltung. Holzapfel genoss den Ruf eines tüchtigen Heerführers, den er in zahlreichen Schlachten für die protestantische Union erworben hatte, ehe er im Jahr 1640 die „Fahnen wechselte“ und seither samt seinem Heeresverband an der kaiserlichen Seite gegen seine ehemaligen, evangelischen Verbündeten kämpfte. Die Heerführer des 30jährigen Krieges erweisen sich auf beiden Seiten im Prinzip als reine Kriegsunternehmer. Ihr Erfolg ist die klingende Münze, die sie daran verdienen. Erstaunlich - und nur aus der Denkweise der Zeit zu verstehen - ist die Tatsache, dass diese Kriegsunternehmer oftmals an vorderster Stelle ihrer Heerhaufen kämpften und dabei oft auch den Tod 129 auf dem Schlachtfeld fanden. (Johann von Tilly, Ernt von Mansfeld, Gustav Adolf von Schweden, Wilhem V. von Hessen-Kassel u.a.) Insoweit setzten diese Heeresführer Maßstäbe, die sie von den Kriegsherren in späteren Jahrhunderten deutlich heraus heben. Anmerkung 3 Die Geiselnahme und Lösegelderpressung ist keine Erfahrung aus den heutigen Zeiten. Im Zuge der kriegerschen Auseinandersetzungen war es offensichtlich zu allen Zeiten an der Tagesordnung, dass die Kriegsparteien Geiseln oder Kriegsgefangene mitführten, um sie gegen Lösegeld wieder frei zu geben. Dass die Praxis der Lösegelderhebungen offenbar als ein Teil der alltäglichen Begleiterscheinungen der Kriege eine große Bedeutung hatte, wird aus einem bemerkenswerten Hinweis in dem Testament des Dr. Johann Wolff des Jahres 1611 deutlich. Der begüterte Dr. Wolff hatte die Hälfte seines beträchtlichen Vermögens in eine mildtätige Stiftung eingebracht, die noch heute in Marburg-Ockershausen im Sinne des Stifters fortbesteht. Testamentarisch hatte er bis in alle Einzelheiten festgelegt, wie im Übrigen mit dem Erbe „für ewig und für alle Zeiten“ zu verfahren sei. Konkret hatte er bestimmt, wie das eingebrachte Vermögen zu vermehren sei und dass keinerlei andere, als die testamentarisch verfügte Verwendung des Erbvermögens gestattet sei. Diese Anweisung ist mit einer einzigen Ausnahme versehen: „Es sei denn, dass ein Verwandter des Erblassers in unverschuldete Not geraten ist und zur Rettung für Leib und Leben die Zahlung eines Lösegeldes unausweichlich wird.“ Offenbar rechnete Dr. Johann Wolff durchaus mit einem solchen Ereignis, das einem Familienmitglied hätte widerfahren können. 130 Teil III Marburg im siebenjährigen Krieg 1756 - 1763 131 Marburg im Siebenjährigen Krieg 1756-1763 Vorgeschichte Wie bereits im dreißigjährigen Krieg von 1618-1648 sollten auch im siebenjährigen Krieg das Schloss und die Stadt Marburg in Mitleidenschaft gezogen werden. In diesem dritten schlesischen Krieg kämpften die Hauptakteure Preußen und Österreich um Schlesien. Den Tod des römisch-deutschen (Habsburger) Kaisers Karl VI. im Jahr 1740 hatte der preußische König Friedrich II. zum Anlass genommen, die vermutete Schwächung Österreichs auszunutzen und Schlesien zu annektieren. Er marschierte ohne Kriegserklärung mit seinem Heer in das Land ein. Der erste schlesische Erbfolgekrieg hatte begonnen. Die österreichische Thronfolgerin Maria-Theresia war keineswegs bereit auf Schlesien zu verzichten. Nach dem verlorenen ersten schlesischen Krieg (1740-42), leitete Maria-Theresia Schritte für die Rückeroberung Schlesiens ein. Dazu verbündete sie sich mit England, Sachsen und den Niederlanden. Der von dieser neuen Allianz gegen Preußen geführte zweite schlesische Krieg (1744-45) endete in der Schlacht von Kesselsdorf am 15. Dezember 1745 mit einem Sieg der Preußen. Im Friedensschluss vom 25. Dezember 1745 wurde zwischen Österreich und Preußen vereinbart, dass Schlesien endgültig bei Preußen bleiben soll. Im Gegenzug erkannte der preußische König Friedrich II. an, dass der Gatte Maria-Theresias, Franz I. als Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches“ eingesetzt werden konnte. 132 Inzwischen hatte sich jedoch in der Mitte des 18. Jh. die politische „Großwetterlage“ Europas erheblich verändert. Im fernen Amerika bahnte sich ein Kolonialkonflikt zwischen Frankreich und England an, der zu einem erbittert geführten Krieg um die Vorherrschaft auf dem neuen Kontinent führte. Neue Machtkonstellationen und veränderte Allianzen entstanden nun auch im alten Europa. Für Maria-Theresia war indessen der Streitpunkt um Schlesien nach dem Sieg Preußens keineswegs beigelegt. Sie schmiedete nun neue Bündnisse, um den Kampf um Schlesien wieder aufzunehmen. Mit Frankreich, Russland, Schweden, Sachsen und den fernen Königreichen: Spanien, Parma und Neapel an ihrer Seite sah sie sich gut gewappnet für einen neuen Waffengang mit Preußen, König Georg II. von England (1683- 1760), in Hannover geboren, zugleich Kurfürst von Braunschweig - Lüneburg-Hannover, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, stellte sich bald an die Seite von Preußen. Im Verbunde mit dieser neuen Allianz traten auch das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, die Landgrafschaft Hessen-Kassel, Herzogtum Sachsen-Gotha und die Grafschaft Schaumburg-Lippe an die Seite von Preußen. Der „Wunschpartner“ König Friedrichs II. – Russland – verweigerte sich indessen dem Bündnis mit dem preußischen König. Das an großen Teilen seiner Landesgrenzen von feindlichen Parteien umgebene Königreich Preußen überschritt ohne Kriegserklärung am 29. August 1756 die sächsische Grenze. Der siebenjährige Krieg nahm seinen Anfang. 133 Die Landgrafschaft Hessen-Kassel allerdings, die bis zum Kriegsende von den Verbündeten Österreichs fast vollständig eingekreist war, konnte vom hessischen Landgrafen Friedrich II. nicht verteidigt werden. Denn, wie so oft in seiner Geschichte, diente die Streitmacht von Hessen-Kassel für „gutes Subsidiengeld“, im Dienste fremder Mächte, in fremden Ländern. Friedrich II. von Hessen-Kassel (1720-1785), seit 1760 Landgraf, verheiratet mit Prinzessin Maria, einer Tochter des englischen Königs Georg II. aus dem Hause Hannover, hatte gemeinsam mit Georg II. die Fronten gewechselt. Er trat nun an der Seite von Preußen in den Krieg ein. Dem preußischen König unterstellte der hessische Landgraf ein Heerscontingent von 8 - 10.000 Soldaten. An der Spitze seines Heeresverbandes kämpfte er selbst in Mähren und Schlesien für den preußischen König im Range eines preußischen Generalfeldmarshalls. Das von eigenen Truppen weitgehend entblößte Hessen-Kassel geriet indessen, fast während des gesamten Kriegsverlaufes, unter die Herrschaft feindlicher Truppen. Überwiegend unter französische Besetzung. Durch Hessen führten die Nachschubwege der Franzosen. In Marburg befand sich über mehrere Zeitabschnitte des siebenjährigen Krieges ein bedeutender Versorgungsstützpunkt der Franzosen. Am Kreuzungspunkt der großen Heeresstrassen von Hamburg-Basel und Köln–Leipzig, errichteten die Franzosen in Marburg mehrfach ein Hauptquartier. In den hier eingerichteten Magazinen wurden die Versorgungsgüter eingelagert, bevor sie an die im Kampf stehenen französischen Truppen weitergeleitet wurden. Die oftmals wechselnde Kriegslage führte allerdings im Marburger Raum zu ständigen Auseinander134 setzungen der Franzosen mit kleineren hessischen und hannoverschen Streitkräften. Diese setzten dem Feind in dessen Hinterland sehr zu. Zwar kam es in Marburg zunächst nicht zu bedeutenden militärischen Scharmützeln, jedoch durch diese ständigen Attacken konnten sich die französischen Besatzungen zu keinem Zeitpunkt in Sicherheit wähnen. In Marburg sah sich die französische Streitmacht deshalb während der gesamten Dauer des Krieges der ständigen Bedrohung des Feindes ausgesetzt. Oftmals blieb den Franzosen nur die Flucht, um jedoch wieder zurück zu kehren, sobald die preußischen Alliierten Marburg wieder verlassen hatten. Neun mal wechselte die Herrschaft über die Stadt Marburg zwischen den Franzosen und ihren Gegnern. Fünf mal mussten sich die jeweiligen Schlossbesatzungen der angreifenden Kriegsmacht beugen, kapitulieren, oder fliehen. Dies blieb keinesfalls ohne verheerende Folgen für die Stadt Marburg und für ihre Bürgerschaft. Sie litten am meisten unter dem ständigen Wechsel der Herrschaften und der Einquartierung der Soldaten in ihren Häusern. Über die Marburger Begebenheiten im siebenjährigen Krieg berichtet Dr. Willhelm Bücking ausführlich in dem Bericht: „Geschichtliche Bilder aus Marburgs Vergangenheit“ Seine Ausführungen bilden den Hintergrund zu dem nachfolgenden Beitrag. 135 Die wechselnden Eroberungen der Stadt und des Schlosses zu Marburg im siebenjährigen Krieg! Erste Eroberung von Schloss und Stadt: Am 15. Juli 1757 wurde der Marburger Bürgerschaft durch den Revisionsrat Dr. von Hamm mitgeteilt, dass französische Besatzung ins Land und auch nach Marburg käme. Ein jeder Bürger möge den einzuquartierenden Soldaten freundlich begegnen und ihnen keine Gelegenheit zu Verdrießlichkeiten geben. Am 21. Juli rückten die ersten 100 französischen Grenadiere des „Wattauischen“ Regiments in Marburg ein und besetzten das Schloss und die Stadttore. Tags darauf zogen die Bataillone des Regiments durch das Elisabethtor in Marburg ein. Um 5 Uhr morgens begrüßte der Magistrat die Ankommenden auf dem Marktplatz. Dort wurden den Soldaten die Quartiersbillete aushändigte. Der französische Graf von Vauban übernahm das Kommando in Marburg. Hier organisierte er den Ausbau des Hauptquartiers der Franzosen zur Vorbereitung der bevorstehenden Auseinandersetzungen gegen Preußen und dessen Verbündeten. Die Offiziere wurden in die Quartierhäuser eingewiesen. Auf die Stadt und die nahe Umgebung verteilt richtete die Armee ihre Versorgungsdepots ein. Der Renthof wurde zu einem Lazarett ausgebaut. Im Schützenpfuhlgarten hieben die Franzosen etliche Dutzend der schönsten Obstbäume ab und errichteten auf dem Gelände neben der Lahnfurt ein großes Gebäude, in das sie vier Backöfen setzten. Das auf dem Kämpfrasen eingerichtete Holz, Heu und Strohmagazin verlegten sie auf die Schwanwiese. Dort 136 sicherte man die Magazine mit Gräben und bewachten Schutzwällen gegen fremden Zugriff. In der Kugelkirche, im Ballhaus, in der Barfüßertor Kirche sowie im Kreuzgang des alten Barfüßerklosters wurden Frucht- und Mehlmagazine eingerichtet. In den großen Rathausaal verbrachte man Hafer, Reis und andere Lebensmittelvorräte. Im August 1756 rückte der 2. Heersverband des Mashalls Herzog von Richelieu mit etlichen 1000 Soldaten in Marburg und Umgebung ein. In den Quartieren sind nun jeweils 16 bis 20 Mann einlogiert. Die endlosen Belastungen für die Marburger Bürgerschaft nahmen einmal mehr ihren Anfang. Eine fürchterliche und verheerende Episode begleitet den Einzug des ersten großen französischen Truppenverbandes in Marburg. Unter den Soldaten die nicht in den Häusern einquartiert wurden, sondern die in den Kasematten der Schlossfestung und in Zelten im alten Lustgarten logierten, bricht eine Epidemie aus. Der Seuche fallen etwa 1.000 Soldaten zum Opfer. Zwischen dem Lazarett am Renthof und der Schlossmauer werden sie in Säcken bis 15 Leichnamen eingenäht und beerdigt. In den zugänglichen Archivberichten aus dieser Zeit finden sich jedocj keine näheren Hinweise zu diesem ungeheuerlichen Vorgang. siehe Anmerkung In bemerkenswerter Weise führt uns diese Ignoranz der Heeresberichterstatter vor Augen, dass das Leben und das Schicksal der gemeinen Soldaten in den Zeiten des Absolutismus keinen hohen Stellenwert besessen hatte und deshalb in ihren Kriegsberichten kaum Erwähnung gefunden hat. 137 Ganz anders reagierte man, wenn eine hochgestellte Persönlichkeit in den Kampfhandlungen zu Schaden kam oder ihr Leben verlor. Über den Vorgang des am 14. Februar 1761 im Kampf vor dem Elisabethtor gefallenen Generalleutnants von Breidenbach zu Breidenstein wird im Folgenden noch berichtet. Zweite Eroberung von Schloss und Stadt: Ab dem 19. März 1758 beginnen die Franzosen mit dem Abtransport ihrer in Marburg eingelagerten Versorgungsgüter. Ein langer Tross bewegt sich in nördlicher Richtung. Ziel sind die Aufmarschräume an der Weser, in denen sich die Gegner zu einem großen Schlagabtausch versammeln. Die Franzosen räumten deshalb Marburg am 26. März 1758 kampflos. Für die Marburger Bürgerschaft eröffnete sich die Gelegenheit, nun aus den zurück gelassenen Magazinbeständen soviel nach Hause zu tragen, als sie nur konnten. Vor allem suchte man das wertvolle Bettzeug zurück zubekommen, das man für die Einquartierten bereit zu stellen hatte. Aber auch die Vorräte an Hafer, Heu und Stroh fanden reichlich Abnehmer. Hessische Landmiliz rückte am 1. April in Marburg ein und besetzte die Stadttore. Ihr folgten am 21. April ein hessisches Dragonerregiment und zwei Kompanien Husaren. Weitere 100 hessisch-hannoversche Jäger erreichten die Stadt am 30. April. Im Mai rückte von Kassel her ein Grenadierregiment in Marburg ein. Im Juni 1758 errichteten sie ein Lager auf dem Glaskopf für zwei Regimenter Infanterie - und beim Schützenpfuhl ein Lager für ein Reiterregiment. Unter dem 138 Schutze seiner hessischen Truppen verweilte auch Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel zu einem Besuch auf dem Marburger Schloss. Dieses Ereignis wurde in Marburg begeistert gefeiert, mit Musik und „Tamm – Tamm“. Bürgerschaft und Studenten fanden sich zu Ehren des Landgrafen zu einem großen Umzug durch die Stadt zusammen. Dritte Eroberung von Schloss und Stadt: Nur etwa vier Wochen lang konnten sich die Marburger Bürger der hessischen Herrschaft in ihrer Stadt erfreuen. Am 14. Juli 1758 ertönte vom Schloss her ein Kanonenschuss als Signal für neues Unheil. Franzosen waren im Anzuge. In Ockershausen hatte bereits ein Scharmützel zwischen den französischen „Fischerschen“ Husaren und Hannoveranern stattgefunden. Bereits einen Tag später zogen sich die preußischen Alliierten, Hannoveraner und Hessen und die Reiterei des Prinzen von Isenburg von Marburg zurück. Isenburgs Reiterei deckte den Rückzug und stoppte den nachrückenden Feind auf der Schönstädter Höhe. Die „Fischerschen Husaren“ und etliche französische Regimenter rückten am 16. Juli in Marburg ein. Eilig wurden das Schloss und die Stadttore besetzt. Die Übergabe war kampflos vor sich gegangen, jedoch sah sich die Marburger Bevölkerung neuen Drangsalen ausgesetzt. Am 18. Juli nahm der französische Prinz Soubise mit großem Gefolge Quartier im „Weißen Ross“ Barfüßer Strasse 11. Auf der Deutschhauswiese am Pilgrimstein wurde am 19. Juli ein riesiger Kramladen durchgeführt. Marketender boten allerlei Waren, Branntwein und Bier zum Verkauf an. 139 Es wird berichtet, dass die Franzosen einen „Zweibrücker am ersten Baum beim Zollstock aufhängten“, weil er ein paar Schuhe gestohlen und verkauft haben soll. Im Umland von Marburg wurde die Feldernte von den Franzosen fast vollständig vereinnahmt. Der auf französischer Seite kämpfende Herzog von Württemberg rückte am 24. Juli mit 6.000 Soldaten und vielen Chaisen in der Gegend ein. Er bezog sein Lager im Cappeler Feld. Von Kassel her passierten 19 von den Franzosen erbeutete Kanonen die Stadt Marburg, auf ihrem Weg nach Straßburg. Unter diesen Kanonen befand sich der „Große Hund“. Diese größte Kanone ihrer Zeit musste von 30 Pferden gezogen werden. Der September 1758 brachte große Not über das Hessenland. Die Franzosen forderten den Großteil der gesamten Feldernte für ihre Armee. Obrist Fischer verlangte im Oktober 1758 8.000 Livres von der Marburger Bürgerschaft, als Ersatz für den Verzicht auf Plünderung durch die Armee. Am 18. Dezember 1758 wurde die Bürgerschaft zu Schanzarbeiten auf das Schloss beordert und eine neue Steuer in Höhe von zusätzlichen vier Monatsgeldern ward gefordert. Das Geld besorgte sich der Magistrat durch Kreditaufnahmen bei den wohlhabenden Kaufleuten in Marburg und in Frankfurt. Im Januar und Februar 1759 begannen die Franzosen mit erheblichen Befestigungsarbeiten an der Stadtmauer und auf dem Schloss. Dazu mussten, neben den Bürgern der Stadt, die Bauern der Umgebung mit Brandleitern erscheinen. Auch an den Sonntagen wurde an den Schanzen gebaut und die Palisaden erneuert. Um das Schloss zog man teilweise eine neue Mauer. Dazu holte man aus 140 dem ganzen Oberfürstentum die Maurer heran. Als ein Teil der neuen Mauer wieder einstürzte, hätte dies beinahe den zufällig anwesenden Kommandanten der Franzosen erschlagen. Im April 1758 rückten weitere 2.000 Franzosen in Marburg ein. Mit Böllerschüssen feierten die Franzosen am 14. April den Sieg des Herzogs von Broglie, der in Bergen nahe bei Hanau ein Heer der Hessen und der Hannoveraner geschlagen hatte. Vierte Eroberung der Stadt: Ab dem 16. April 1759 herrschte große Unruhe unter den Franzosen. Schwarze Husaren und Jäger der verbündeten Kasseler und Hannoveraner waren vor der Stadt aufgetaucht. Weitere Verbände der preußischen Verbündeten zogen um die Stadt herum. Bald schlossen die Alliierten die Festung Marburg ein. Das „Trimbachsche“ französische Bataillon hatte sich auf das Schloss zurückgezogen. Von dort schoss man mit Feuerkugeln herunter auf die Stadt. Die Bürgerschaft hatte Not, die ausbrechenden Brände in der Stadt zu bekämpfen. Zuvor schon hatte man vor den Häusern gefüllte Wasserbottiche zur Brandbekämpfung bereitgestellt. Fünfte Eroberung der Stadt: Die zwischenzeitliche Herrschaft der preußischen Alliierten währte nur wenige Tage. Am 18. April 1759 erreichte ein französischer Truppenverband Marburg. Die Alliierten zogen „Hals über Kopf“ wieder ab. Die Bürger der Stadt, die man der Gefolgschaft mit Abzie141 henden verdächtigte, wurden von den Franzosen gefangen gesetzt. 200 Bürger wurden erneut zu Schanzarbeiten heran gezogen. Alle Bäume am Schlossberg mussten von ihnen abgehauen werden, um so freies Sichtfeld für die Schlossbesatzung zu erhalten. Erneut richteten die Franzosen ihr Hauptquartier und ihre Magazine in Marburg ein: Im Schiff der Elisabethkirche wurde ein Kornspeicher eingerichtet. Der Rittersaal auf dem Schloss dient nun als Mehlsaal. Das Lazarett am Renthof wurde nochmals erweitert. Die ständig wechselnden und durchziehenden französischen Truppenverbände forderten den Marburgern alle nur denkbaren Versorgungsgüter ab. Eine erneute Geldforderung von 20.000 Livres vom 15. Mai 1759 konnte zunächst nicht erfüllt werden. Daraufhin wurde der gesamte Stadtrat im Rathaus festgesetzt. Wiederum wurde das Geld durch neue Kredite beschafft. Am 4. Juni besichtigte der französische Feldmarshall von Condates die Festung Marburg. Eine große französische Armee von 80.000 Soldaten zog am 6. Juni durch Marburg und über die Weinstrasse weiter, bis nach Wetter. Der Armee folgte die Bagage mit Tausenden Wagen. Die von den Franzosen in Marburg und Umgebung errichteten Backöfen wurden rund um die Uhr eingesetzt. Daneben wurden auch alle anderen Bäcker in Marburg und Umgebung zum Brotbacken für die Armee vollauf beschäftigt. Den geplagten Marburgern verlas der Stadtregistrator ein Schreiben, in dem die Stadt aufgefordert wurde, 20.000 Taler Brandschatzungsgeld zu zahlen. 142 Ob und wie sie diese Forderung erfüllten, ist nicht bekannt. Die Nachricht von der verlorenen Schlacht der Franzosen am 1. April 1759 bei Minden erreichte bald auch Marburg. Englische, Preußische, Hannoveraner und Hessen-Kasseler Heeresverbände hatten der französischen und der an ihrer Seite kämpfenden sächsischen Armee eine vernichtende Niederlage zugefügt. Darüber zeigten sich die hiesigen französischen Besatzer sehr bedrückt. Ein Marburger Gastwirt, der es gewagt hatte auf die Gesundheit des siegreichen Herzogs Ferdinand von Braunschweig anzustoßen, wurde sofort in Haft genommen. Gegen ein Lösegeld, das seine Verwandten beisteuerten, kam er wieder frei. In Marburg war es verboten, abfällig über den Krieg und über die Franzosen zu sprechen. Gegen Ende August 1759 versammelten sich erneut große Heeresverbände der Franzosen im Marburger Raum. Zwischen Wehrda und Cölbe befand sich das Lager des Herzogs von Broglie. Er schlug sei Hauptquartier in Wehrda auf. Das Quartier der Truppen des Herzogs von Armentiers befand sich in Goßfelden. Die große Candatische Armee logierte nahe bei Kirchhain. Offenbar erwarteten die Franzosen einen Angriff der preußischen Alliierten. Am 28. August fand ein heftiges Scharmützel bei Wetter statt. Hannoveraner hatten in der Nacht die Fischerschen Husaren angegriffen und übel zugerichtet. Zahlreiche Verwundete wurden im Lazarett des Renthofes versorgt. Unter den Franzosen in Marburg herrschte Aufbruchstimmung. Die Magazine wurden - einmal mehr - geleert und auf Wagen verladen. Ihre in der Stadt einquartierten Truppen zogen in Marschformation ab. Die 143 französische Schlossbesatzung wurde, allerdings um 350 Soldaten verstärkt, zurück gelassen. Die lädierten Soldaten des Obristen Fischer bildeten die Nachhut der abziehenden Franzosen. Vor ihrem Abzug am 1. September drangen sie nochmals in Weidenhausen ein und plünderten, soweit es noch etwas zu plündern gab. Auch die Siechenhöfe in Weidenhausen verschonten sie dabei nicht. Sechste Eroberung der Stadt, vierte Eroberung des Schlosses: In der Frühe des 5. September 1759 war die Stadt gefüllt mit hessischen Soldaten. Sie besetzten die Stadttore und belagerten das Schloss. Von dort feuerten die Franzosen mit Kanonen herab und warfen Feuerbomben. Am 10. September eröffneten die Alliierten ein heftiges Kanonenbombardement auf das Schloss und die Festungsanlagen. Vom Dammelsberg herüber feuerten die Batterien des Obristleutnants Huth auf die Schlossfestung. Auf der Kirchspitze hatte der Graf von Lippe-Bückeburg seine Batterien in Stellung gebracht. Der Widerstand der Belagerten brach rasch zusammen. Die Franzosen suchten zu erreichen, dass sie bei ihrem Abzuge Waffen und Bagage mitnehmen durften. Dies wurde ihnen verwehrt. Es setzte daraufhin am folgenden Tag erneut ein heftiges Bombardement auf das Schloss an. Die Besatzung des Schlosses kapitulierte nach zwei Stunden des Dauerbeschusses. Etwa 1000 Belagerte streckten die Waffen und zogen unter Bewachung ab, in eine unsichere Zukunft. Prinz Ferdinand von Braunschweig besichtigte am 14. September das Marburger Schloss. Bis zum Ende des 144 Jahres 1760 war nun Marburg Etappenstandort der Alliierten. Am 12. Januar 1760 feierte man auf dem Schloss den Geburtstag des Generalfeldmarshalls Herzog Ferdinand von Braunschweig. Der Herzog war ein Schwager des Preußenkönigs Friedrichs II. Marburger Studenten brachten dem Herzog zu seinem Geburtstag ein Ständchen. Die Herrschaft der Alliierten in Marburg sollte jedoch erneut nur von begrenzter Dauer sein. Siebte Eroberung der Stadt, fünfte Eroberung des Schlosses: Am Morgen des 1. März 1760 vernahm man in Marburg Kanonendonner. Das Barfüßer Tor wurde aufgehauen und französische Grenadiere drangen ein. Der geheime Regierungsrat von Haller und Prorektor Piederit wurden aus ihren Betten geholt und fort geschleppt. Vom Schloss herab schoss die alliierte Besatzung. Noch war man nicht über die Stärke des anrückenden Feindes informiert. Ein Erkundungstrupp alliierter Husaren nahm im Cappeler Feld 13 Franzosen gefangen und brachte diese auf das Schloss. Mit dem Großteil der hier versammelten Truppen zog Ferdinand von Braunschweig im April 1760 in Richtung Fritzlar ab. Allein eine alliierte Schlossbesatzung blieb isoliert zurück. Gegen Ende Juni 1760 gewahrte die Schlossbesatzung die Annäherung französischer Truppen. Vom Schloss wurden Signalschüsse abgefeuert und die Stadttore geschlossen. Die Alliierten eröffneten vom Schloss herab das Feuer auf die vor der Stadt lagernden Franzosen. Das Eindringen der Feinde in die Stadt konnten sie nicht verhindern. Erneut ging das Plündern 145 mit dem Einzug der Franzosen in Weidenhausen und in Marburg einher. Am Abend des 27. Juni rückten 1.200 Franzosen - mit Trommeln und klingendem Spiel - in die Stadt ein. Wenig später erreichte das französische Regiment Boullon Marburg. Es begann sofort ein heftiges Mörserfeuer auf das Schloss. Noch am gleichen Tag kapitulierten die 380 Soldaten der alliierten Schlossbesatzung. Die Franzosen genehmigten deren Abzug, unter Belassung ihrer militärischen Ehrenzeichen und der Waffen. Mit klingendem Spiel zogen die Geschlagenen am 1. Juli zum Elisabethtor hinaus. Dort streckten sie nun die zuvor unbrauchbar gemachten Gewehre. Während die Hauptstreitmacht der alliierten Armee unter der Führung des Herzogs Ferdinand von Braunschweig von Hessen aus den anderen Kriegsschauplätzen zu strebte, wurde in Hessen ein „Schindercorps“ zur Verteidigung der Heimat eingerichtet. Das Corps unter dem Kommando der Obristen von Bülow und von Peesen operierte im rückwärtigen Gebiet des Gegners. Diese sehr bewegliche Einheit, in der sich besonders die Hessischen Jäger bewährten, sorgte für Unruhe auf den Nachschubwegen der Franzosen. Sie fügte dem Gegner allerlei Schaden zu. So nutzten die „Schinder“ die Gelegenheit, als sich ein Großteil der französischen Garnison in Marburg zum Appell auf dem Schloss befand, um unbemerkt in die Stadt zu gelangen. Ohne einen Schuss abzufeuern wurden die Torwachen überwältigt. Den Angreifern fiel eine große Anzahl von Waffen und Montierstücken in die Hände. Das „Schindercorps“ verdiente sich redlich seinen Namen. Es plünderte bei seinem Kurzbesuch in der Stadt „Hohe und Niedere“, Bürger und Einquartierte, gleichermaßen. 146 Man zerstörte alle Backöfen der Franzosen vor und in der Stadt. Den französischen Kriegskommissar, nebst einigen Offizieren, nahmen die „Schinder“ als Geiseln mit sich fort. Im Eilmarsch suchte man das Weite, vor dem nachsetzenden Feind. Ein Kommando des französischen Grafen Stainville stellte Bülows „Schindercorps“ in der Nähe von Hallenberg. Bülow und das Schindercorps mussten unter Zurücklassung der Beute vor der feindlichen Übermacht fliehen. Die zuvor in Marburg übertölpelten Franzosen verschmerzten den ihnen entstandenen Verlust leicht. Fünfzig fernauische Dragoner hatten den Befehl erhalten, den erlittenen Verlust vollständig durch die Stadt Marburg ausgleichen zu lassen. Dies wurde in „altbewährter“ Weise durchgeführt. Man setzte einmal mehr den Magistrat der Stadt zur Durchsetzung der Repressalien so lange gefangen, bis die verlorene Beute nebst 1000 Karolinen Strafgeld an die Franzosen zurückerstattet war. Wiederum mussten dafür Kredite bei den Kauleuten aufgenommen werden. Das Jahr 1761 eröffnet einen weiteren Versuch der Alliierten, den Franzosen Schloss und Stadt Marburg zu entreißen. Anfangs Februar marschiert eine Abteilung ihrer Armee unter der Führung des Generalleutnants von Breidenbach zu Breidenstein über Korbach und Frankenberg nach Marburg. Der Anmarsch blieb bei den Franzosen nicht unbemerkt. Die französische Besatzung befand sich rund um Marburg in Alarmbereitschaft. Am 14. Februar 1761 erreichte von Breidenbach mit seinen Regimentern, von Wehrda und Cölbe heran kommend, den Stadtrand. Noch vor dem Elisabethtor, an der Barriere der alten Deutschhausmühle, kam es zu einem blutigen Gefecht, mit zahlreichen Toten und Verwundeten auf beiden 147 Seiten. Mit dem Degen in der Hand empfing Breidenbach einen tödlichen Schuss. Desgleichen fiel auch sein Adjutant bei diesem Gefecht. Dieser Vorgang hat wohl die unmittelbaren Kampfhandlungen zunächst beendet. Die Beisetzung des toten Generalleutnants von Breidenbach erfolgte am 16. Februar 1761 mit allen militärischen Ehrenbezeigungen der französischen Besatzung in der lutherischen Pfarrkirche in Marburg. Sieben Kanonen wurden dem Trauerzug vorangeführt. Der Sarg wurde von acht Unteroffizieren getragen. Die Zipfel des Leichentuches mit dem der Leichnam bedeckt war, wurden an den Enden von vier Stabsoffizieren gehalten. Alle den Leichenzug begleitenden Offiziere trugen brennende Kerzen. Dem Trauerzug folgten alliierte und französische Soldaten. Auf dem Pfarrkirchhof wurden zwei Gewehrsalven abgegeben. Danach erfolgte die Beisetzung. Zur Verrichtung der Begräbnisbräuche wurde der Superintendent Seip, ein Geistlicher des lutherischen Bekenntnisses beauftragt. Er hielt eine Rede „aus dem Stegreif“. Nach Beendigung der Zeremonien wurden dem Prediger als Dank für die Bemühung die Wachskerzenstümpfe übergeben. Im Chor der lutherischen Pfarrkirche findet sich noch immer Breidenbachs Grabdenkmal. Sein gefallener Adjutant ist auf dem Kirchhof der lutherischen Pfarrkrche beerdigt worden. Die zahlreichen im Gefecht am Elisabethtor gefallenen Soldaten hingegen lagen noch am Tage nach der Beerdigung des hohen Gefallenen an der Stelle, wo sie ihr Schicksal ereilt hatte. Erst danach fand man Zeit, sich ihrer anzunehmen und sie bei der St. Michelskapelle in Marburg, oberhalb der Elisabethkirche zu beerdigen. 148 Während sich die Alliierten Verbände nach dem Gefecht an der Deutschhausmühle in das Umland zurück gezogen hatten, begannen die Franzosen mit ungewohnten und aufwendigen Verteidigungsmaßnahmen. Sie ließen von den Bürgern große Löcher in die Fahrbahn der Brücken ausheben, die sie mit Pulver füllten. In geringen Abständen schichtete man rings um Weidenhausen und an den Brechen der Stadtmauern große Scheiterhaufen auf. Sie wurden ebenfalls mit Pulver versehen. Der Aufwand an Pulver und Brennmaterial war so erheblich, dass man für den Fall eines Einsatzes dieser Mittel bei einem Angriff der Alliierten den völligen Untergang der Stadt befürchten musste. An den Arbeiten zu diesen Verteidigungsmaßnahmen wurden neben den Bürgern auch die Räte der Stadt von den Franzosen herangezogen. Der Bürgermeister, der sich der Arbeit verweigert hatte, erhielt wegen seiner Weigerung 50 Stockschläge. Damit wurde er öffentlich auf dem Marktplatz bedacht. Ein Aufruf der Franzosen vom 19. Februar beorderte alle Männer der Stadt - bei Ankündigung des Hängens am Galgen bei ihrer Verweigerung - auf den Marktplatz. Dort wurden sie zu je 50 oder 100 Männer beauftragt, unter Bewachung in den nahen Wäldern Bäume zu fällen, Palisaden heran zu schaffen und Schanzarbeiten an der Stadtmauer vor zu nehmen. Auch die mehr als 100 Mägde der Stadt wurden genötigt, Wasser in Eimern oder in Ziegenfellen von der Lahn herauf zum Schloss zu schaffen. Alle Anzeichen deuteten daraufhin, dass die Franzosen nicht gewillt waren, Stadt und Schloss in die Hände der Gegner fallen zu lassen. 149 Im Angesicht größerer alliierter Truppenansammlungen im Marburger Umland war die Lage für die Franzosen in Marburg offenbar zu unsicher geworden. Sie trafen Vorbereitungen Marburg zu verlassen. Am Abend des 24. Februar steckten sie das Heu- und Hafermagazin am Schützenpfuhl in Brand, nachdem sie zuvor die bereitstehenden Bagagewagen für den Abzug voll beladen hatten. Die Hafer- und Mehlmagazine, die sie nicht verladen konnten, hatten sie ausgeschüttet. Der Fruchtspeicher an der Firmaneikapelle ging in Flammen auf. Der Speicher wurde nebst der nahen Kapelle total zerstört. Am Tage nach dem Abzug der Franzosen konnten sich die Bürger aus Marburg und dem nahen Ockershausen beim Schützenpfuhl und am Schwanhof mit den zurück gelassenen Versorgungsgütern versorgen, noch bevor die anrückenden Alliierten sich des verlassenen Warenlagers der Franzosen bemächtigten. Voll beladene Wagen mit Heu und Hafer, Mehl und Strohballen fanden den Weg zurück in die nahen Höfe von deren Besitzern man diese Güter zuvor abgepresst hatte. Ein seltener aber willkommener Ausgleich für die ständigen Lasten die von den Bürgern an die Kriegführenden abzugeben waren. Eine starke Besatzung der Franzosen war indessen auf dem Schloss verblieben. Achte Eroberung der Stadt: Um vier Uhr des Nachmittags vom 26. Februar 1761 besetzten die preußischen Alliierten - bestehend aus Hessischen, Hannoveranern, Braunschweigischen und Englischen Verbänden - die Stadttore. Die Besetzung der Stadt war indessen für die Alliierten erneut nur von kurzer Dauer. Die französische Schlossbesatzung 150 hatte man unbehelligt gelassen. Am 18. März verließen die Alliierten Marburg. Zu größeren Kampfhandlungen mit den nahenden Franzosen kam es in dieser Zeit nicht. Neunte Eroberung der Stadt: Am 19. März 1761 „wimmelte“ es in Marburg von französischen Husaren und roten Reitern. Sie forderten umgehend zu essen und zu trinken und von allem reichlich. Ihnen gesellten sich am 5. April fünf weitere Bataillone zu, die in den Quartierhäusern in Marburg untergebracht wurden. Auf dem Markplatz errichteten die Franzosen einen Galgen. Zur Abschreckung erhängten sie dort am 15. April drei ihrer Grenadiere, weil diese den Rauschenberger Müller ausgeraubt und ihn so übel geschlagen hätten, dass er gestorben sei. In den folgenden Monaten des Jahres 1761 kamen die Bewegungen der kämpfenden Parteien in Hessen weitgehend zum Erliegen. Man beschränkte sich darauf, das Terrain zu halten. Das Kampfgeschehen hatte sich zunächst wieder zu seinem Ausgangspunkt „Schlesien“ verlagert. Dorthin versammelten die Parteien ihre Kräfte, um doch noch zu einer Entscheidung zu gelangen. Auf Anordnung der Franzosen richtete der Magistrat in Marburg ein Schreiben an die Bürgerschaft, das von Stadtschreiber Ludwig Wierack allen bekannt gemacht wurde. Danach forderte der französische Stadtkommandant die Bürgerschaft auf: „Dass die Bürger alle Nachrichten in ihren Briefen an alle möglichen Leute bei den Alliierten zu unterlassen haben, die Hinweise über Zahl und Ausstattung der 151 französischen Besatzung in Marburg geben könnten. Alle Briefe sind nur allein mit der allgemeinen (von den Besatzern kontrollierten) Post zu versenden. Damit sollten die wildesten Gerüchte eingedämmt werden, die in den Kriegszeiten alltäglich für Unruhe bei Freund und Feind sorgen.“ Die ständigen Einquartierungen lasteten auf den Bürgern. Die Stadtkasse war nicht nur geleert, sondern auch hoch verschuldet. Zum Ende des Jahres 1761 forderte der französische Stadtkommandant zusätzliche 5.000 Rationen Hafer, Heu und Stroh. Hierzu sah sich die Stadt nicht im Stande. Man entsandte den „Ratsvierer“ Döterlein und Stadtrat Meyer als Deputierte in das Hauptquartier des französischen Heeres in Kassel. Bei Marshall Herzog von Broglie trug man die Bitte vor, Abstand von der hohen Forderung der Franzosen in Marburg zu nehmen. Sie erreichten immerhin, dass sie „nur Hafer und Stroh“ liefern sollten. Außerdem wurde den Marburger Deputierten zugestanden, dass ein Teil der an den Obristen Fischer und an andere Truppenführer der Franzosen gezahlten Repressalien in Höhe von 50.000 Reichstalern der Stadt Marburg wieder erstattet werden sollten. Diese Gelder führen zurück auf die außergewöhnlich hohen Kosten, die durch die vielen Einquartierungen der französischen Armee in Marburg entstanden waren. Ein Ausgleich dafür war in den bisherigen unruhigen Kriegszeiten nie erfolgt. Der Betrag von 50.000 Reichstalern der nun tatsächlich den Marburgern erstattet wurde, deckte allerdings den entstandenen Schaden und Aufwand, den die Marburger Bürger und die Stadtkasse aufzubringen hatten nur zum geringsten Teil. 152 Bis zum Frühjahr des Jahres 1762 blieb es in Marburg unter der französischen Besatzung ruhig. Nur etliche hundert Soldaten waren einquartiert, eine relativ geringe Anzahl, im Hinblick auf die vielen tausend Soldaten, die in den voran gegangenen Kriegsjahren in Marburg versorgt werden mussten. Die französische Besatzung bemühte sich, Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Den Kampf gegen Verbreitung von Gerüchten und unfreundliche Worte gegen die Besatzung nahm man weiterhin sehr ernst. So wurde am 15. März 1762 der Schenck“sche Gutsverwallter (offenbar der Verwalter des hombergkSchencklengsfeldschen Rittergutes in Ockershausen) mit 100 Stockhieben auf dem Marktplatz bedacht, weil er sich „mit üblen Worten gegen die Franzosen“ vergangen habe. Am Morgen des 25. Juli ertönte, vom Schloss her Kanonendonner. Es war ruchbar geworden, dass ein Trupp des „Schindercorps“ in der Nähe weilte und den Franzosen 25 Ochsen vom Feld, nebst der Bewachung entführt hatten. Da der Vorgang zum Zeitpunkt des Kirchengeläutes erfolgt war, wollten die Franzosen darin ein „geheimes Zeichen“ für den Feind erkannt haben. Daraufhin wurde es verboten, in der Stadt Marburg die Glocken zu läuten. Auch das Stundenblasen des Nachtwächters wurde untersagt. Die Franzosen vermuteten darin „heimliche Zeichen“ an die „Schinder“. Alliierte Truppenverbände des englischen Generals Heinrich Seymor Conway hatten sich gegen Ende August 1762 Marburg genähert. Weitere Kompanien unter dem Kommando des Oberwachtmeisters Prinz wurden aus der Umgebung nach Marburg beordert. Die Alliierten besetzten Stellungen auf dem Dammelsberg 153 und auf der Kirchspitze. Der erwartete Sturm auf Stadt und Schloss durch die Alliierten erfolgte nicht, obgleich die französische Besatzung in Stärke von 1000 Soldaten kaum zur Verteidigung im Stande gewesen wäre. Am 31. August wurde die Belagerung der Stadt durch die Alliierten wieder aufgegeben. Die Kriegsparteien rüsteten sich indessen zu ihrem letzten großen Schlagabtausch an anderer Stelle im Marburger Raum. An der Brücker Mühle unterhalb von Amöneburg, die von Herzog Ferdinand von Braunschweig besetzt war, griffen die Franzosen am 21. September 1762 mit einem unerwartet großen Aufgebot von Truppen und Kanonen an. Ihr Ziel war es, an dieser Stelle den Alliierten einen so heftigen Schlag zu versetzen, dass deren Position zu geschwächt war, um von hier aus das von den Franzosen gehaltene Kassel anzugreifen. Die ersten Verteidiger der Alliierten an der Brückenstellung, die Hannoveraner, hatten unter dem mörderischen Feuer von 30 schweren Kanonen der Franzosen am 21. September 1762 bald mehr als 300 Tote zu beklagen. Neben den Hannoveranern kämpften Engländer, in deren Reihen sich auch hessische Truppen befanden. Ebenfalls war ein englisches Regiment tapferer Bergschotten an der Verteidigung der kriegswichtigen Passage im Ohmbecken beteiligt. Das ungewöhnlich heftige Kanonenfeuer über viele Stunden hinweg wurde in der Nacht unterbrochen. Angreifer und Verteidiger gruben ihre Kanonen ein, um anderntags das Gefecht fortzusetzen. Allein dazu kam es nicht mehr. Beide Seiten hatten wohl genug, als man jeweils etwa 300 Gefallene und unzählige Verwundete zu beklagen hatte. Die Alliierten zogen sich zurück. 154 Wenige Monate später, am 14 November 1762 wurden in Fontainebleau bei Paris Waffenstillstand zwischen den kriegführenden Hauptparteien geschlossen. Am 19. Dezember 1762 verließen die letzten Franzosen Marburg. Trotz der ständigen Belagerung von Marburg und der andauernden Anwesenheit der verschiedensten Heere der Kriegsparteien während des gesamten siebenjährigen Krieges, waren die unmittelbaren Kampfhandlungen vor Ort eher glimpflich verlaufen. Das heftigste Gefecht hatte am 10. September 1759 stattgefunden, als die von den Alliierten eingekesselte Stadt und das Schloss, von mehreren Seiten her, durch heftigen Kanonenbeschuss unter Feuer genommen worden war. Nicht nur die Schlossfestung wurde durch den Beschuss einmal mehr zur Zielscheibe und dabei stark zerstört. Die Häuser der Altstadt hatten durch die Brandkugeln ebenfalls erhebliche Schäden davon getragen. Die Bürgerschaft der Stadt hatte sich in die tiefen Keller ihrer Häuser zurückgezogen und deshalb durch diese Kampfhandlungen indessen nur geringe Beschädigungen an Leib und Leben erfahren. Die Verteidiger in den Kasematten der Schlossfestung waren unmittelbar dem direkten Feuer ausgesetzt. Welche Folgen der Geschütz- und der Gefechtslärm auf die Soldaten hatte, die in den Katakomben dem Qualm und Pulverdampf sowie dem Geschützdonner der dort von ihnen selbst abgefeuerten Waffen ausgesetzt waren, kann man nur erahnen. Sie waren bald völlig orientierungslos und unfähig zu einer wirksamen Verteidigung. Auch dieser Sachverhalt dürfte am Ende die Kapitulation der belagerten Franzosen am 11. September 1759 beschleunigt haben. Alles in Allem, der siebenjährige Krieg war für die Stadt Marburg und ihre Bürgerschaft relativ glimpflich 155 verlaufen. Schlimmer hatte es Marburg im 30jährigen Krieg getroffen. Dessen Spuren waren auch nach über 100 Jahren beim Ausbruch des siebenjährigen Krieges in Marburg noch unübersehbar. Allerdings hatten die beiden großen Kriege des 17. und 18. Jh. für Marburg einen positiven Beiklang. Die Stadtmauern und die Bollwerke für die Batterien wurden nach dem siebenjährigen Krieg gesprengt. Die „Festung Marburg“ hatte ausgedient. Anmerkung: Eine auffallende Zurückhaltung umgibt die Heeresberichterstattung über das Schicksal von 1000 französischen Soldaten, die im August 1757 in Marburg den Tod gefunden haben und am Renthof beerdigt wurden. Lapidar heißt es, eine Epidemie habe sie dahin gerafft. In der Bevölkerung hielt sich indessen ein Gerücht: „Danach sei die Epidemie bei den Franzosen auf dem Schloss ausgebrochen, als man das Lahnwasser an der Pumpenstelle zuvor vorsätzlich verseucht habe. Durch das Ablassen von Jauche, unmittelbar an der Pumpstation der „Baldewein’schen Wasserkunst“ neben der Weidenhäuser Brücke sei das nächtlich verschmutzte Wasser hinauf auf das Schloss gepumpt worden. Zuvor hätten ortskundige Angehörige des „Schindercorps“ die Wasserspeicher auf dem Schloss und die Leitungen der Quellen vom Dammelsberg und von den Brunnenröhren aus der Marbach zerstört. Dadurch habe die französische Besatzung nur auf das verseuchte Wasser der Lahn zurückgreifen können. Diese ruchlose Tat sei aber so ungeheuerlich gewesen, 156 dass danach Niemand sich zu der ungeheuerlichen Tat bekannt habe und die eigentlichen Verursacher für immer aus der Gegend verschwunden seien“! So wird es mündlich von Generation zu Generation in einer hiesigen Familie weitergegeben. Der Vorgang erscheint durchaus plausibel, wenngleich ein Hinweis dazu in den Militärakten offenbar nicht vorliegt. Bezeichnend ist indessen die Gleichgültigkeit, mit der die Berichterstattung der Kriegsherren in der absolutistischen Zeit das Leben der einfachen Soldaten würdigt. Im krassen Gegensatz dazu begegnet uns die Anteilnahme, die dem gefallenen alliierten General von Breidenstein zuteil wurde. Selbst die Kampfhandlungen wurden eingestellt, als der adelige General, von Freund und Feind begleitet, mit allen Ehren beigesetzt wurde. Es soll sogar noch ein gemeinsames Mahl der feindlichen Kriegsherren gegeben haben, bevor man nach der Beisetzung des Herrn von Breidenstein die Kampfhandlungen unverdrossen wieder aufgenommen hatte. 157 Anlage 1 zu Teil III Die Beschießung des Schlosses am 11. September 1759 durch hannoversche Truppen. Prinz Carl von Bevern beschießt die Schlossfestung vom Dammelsberg her. Von der Kirchspitze feuert der Graf von Bückeburg mit Kanonen Festung und Schloss. Lageskizze: Staatsarchiv Marburg 158 Teil IV Der Marburger Aufstand vom 24. Juni 1809 159 Der „Marburger Aufstand“ von 1809 Zu den vielen Merkwürdigkeiten die dazu beitragen könnten, den heute noch oft zu hörenden Ausspruch zu erhärten „in Marburg sei alles anders“ gehört ganz gewiss der gesamte höchst denkwürdige Vorgang, der als „Marburger Aufstand“ des Jahres 1809 in die Geschichte einging, jedoch im Gedächtnis des überwiegenden Teils der Marburger Bürgerschaft bis heute keinen rechten Platz gefunden hat. Der bei der Oberhessischen Presse in Marburg volontierende Udo Muras erstellte im Jahre 1997 die bisher wohl umfassendste Schilderung der Vorgänge. Welches sind aber die Ursachen für den „kollektiven Gedächtnisschwund“ in Marburg, gegenüber einem Ereignis, dass vergleichsweise in anderen Orten noch immer Anlass für historische Erinnerungsveranstaltungen bietet? Immerhin fand das Ereignis in Marburg in einer spannungsgeladenen Zeit statt, in der es an vielen Brennpunkten in Deutschland und in Europa zur Rebellion gegenüber der französischen Besatzungsmacht kam. Markant sind hier zu nennen: • Der gescheiterte Aufstand der Südtiroler im Jahre 1809, unter ihrem Anführer Andreas Hofer gegen Frankreich und dessen verbündeten Bayern. • In Preußen kämpften seit dem Jahre 1808 Freicorps im Untergrund gegen übermächtige, französische Regimenter. 160 • In Hessen-Kassel scheiterte der zur gleichen Zeit der am 22. April 1809 begonnene „Dörnbergaufstand“ bei der „Knallhütte“, nahe Kassel. An einigen Orten, an denen in dieser Zeit Widerstand gegen Napoleon geleistet wurde, finden noch heute Gedenkveranstaltungen und gelegentlich farbenprächtige Historienspiele statt. Erinnert wird dabei, an die vergeblichen Versuche, die Fremdherrschaft im Lande zu beenden. Um nichts anderes, als um die „Befreiung vom französischen Joch“ ging es auch bei dem in „Marburg „vergessenen Kapitel aus der napoleonischen Zeit“. Die Vorgeschichte Französische Revolution (1789-1799) Die Ursachen die zu den Ereignissen des Jahres 1809 führen gehen zurück auf die turbulenten, politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen vor und nach der französischen Revolution. In Frankreich führte ein Volksaufstand, unter der Losung: „Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit“, zu dramatischen Umwälzungen. Der feudal-absolutistische Ständestaat wurde durch revolutionäre Umgestaltung durch das Volk abgelöst. Die Nachricht über die schrecklichen Begleiterscheinungen des dabei einher gehenden Terrors in Frankreich – vornehmlich gegen den Adel und die Stände – verbreiteten sich in Europa wie ein „Lauffeuer“. Die europäischen Fürstenhäuser gerieten in Panik und in Angst und Schrecken über die Vorstellung, dass auch in ihren Staaten das Volk aufbegehren und die Herrschaft an sich reisen könnte. 161 Man hatte dabei auch den Ausgang des in Amerika vom Volk erfolgreich geführten Unabhängigkeitskriegs (1776-1783) gegen die englische Kolonialmacht vor Augen. Man war sich in den Fürstenhäusern Europas durchaus bewusst, dass die Ursachen und Gründe die in Frankreich zum Sturz der Monarchie geführt hatten, auf alle absolutistisch geführten Staaten in Europa übertragbar waren. Die vom revolutionären Frankreich ausgehende Bedrohung der eigenen Macht führte zu Gegenmaßnahmen der europäischen Monarchien. Nach einer an die junge französische Republik gerichteten Drohung, dass man im Falle der Beseitigung der Monarchie in Frankreich militärisch eingreifen würde, erklärte nun das revolutionäre Frankreich seinerseits am 20. April 1792 Österreich den Krieg. Preußen stellte sich mit anderen verbündeten Staaten an die Seite Österreichs. Der erste „Koalitionskrieg“ (1792 -1797) hatte begonnen. Unter den preußischen Verbündeten befand sich auch ein großes Truppenkontingent aus Hessen-Kassel. Nur zögernd hatte Landgraf Wilhelm IX. sich dazu bereit gefunden, seine Truppen auf „eigene Rechnung“ in den Krieg gegen Frankreich zu führen. Bisher hatte er seine Regimenter stets nur für Geld an andere Mächte „verliehen“. Das „Kriegsglück“ war indessen der vereinten Koalitionsarmee, bestehend aus den Heeren von Österreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Großbritannien, Hessen-Kassel und anderen Kleinstaaten nicht hold. Am 20. September 1792 wurde der Vormarsch der Koalitionsarmee durch die legendäre „Kanonade von Valmy“ gestoppt. Die französische Revolutionsarmee erwies sich mehr und mehr den Gegnern überlegen. 162 Dieser „Volksarmee“ gelang es, alle fremden Mächte vom französischen Territorium zu vertreiben und weite Teile im „Feindesland“ zu besetzen. Das gesamte linksrheinische deutsche Reichsgebiet geriet unter französische Herrschaft. Die Ideen der französischen Revolution wurden in die besetzten Gebiete exportiert. Im Bereich des Erzbistums Mainz wurde nach französischem Vorbild und französischer Gesetzgebung, die erste Republik auf deutschem Boden gebildet, die „Mainzer Republik“ (1783-1795). Das in seinem Inneren politisch keineswegs gefestigte revolutionäre Frankreich erwies sich als unüberwindbar für die europäischen Mächte. Es sollte noch schlimmer kommen. Ein neuer „Komet“ am Himmel Frankreichs entpuppte sich bald zum Schrecken des europäischen Kontinents: Napoleon, ein fähiger Truppenführer der Revolutionsarmee. Er riss im Jahr 1799 die Führung in Frankreich an sich. Als „Erster Konsul“ baute er seine Machtposition aus, im Inneren wie im Äußeren. Sein unaufhaltsamer militärischer Siegeszug hielt die Welt in Atem. Napoleon zwang die besiegten Gegner im Friedensschluss vom 9. Februar 1801 in Luneville zur Abtretung des gesamten linksrheinischen Gebietes bis zum Rheinufer an Frankreich. Er legte den deutschen Fürsten nahe, ihren linksrheinisch erlittenen Flächenverlust durch „Säkularisierung“ auszugleichen. D. h. durch Aneignung des weltlichen Kirchenbesitzes durch den Staat, so wie dies nach der Revolution in Frankreich bereits vollzogen worden war. Im „Reichsdeputationshauptschluss“ der versammelten deutschen Fürsten vom 23. Februar 1803 wurde die Kirchenenteignung in Deutschland - die Säkularisierung - beschlossen. 163 Ein Großteil des weltlichen Besitzes der Kirchen, Klöster, Ordensgüter, Schlösser und Burgen nebst dazu gehörenden Ländereien, gelangten in den Besitz der weltlichen Staaten. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel war vom größten Flächenverlust betroffen. Sie hatte den gesamten links rheinischen Besitz und die Grafschaft Katzenellnbogen mit Schloss Rheinfels verloren. Als Entschädigung wurde dem bei der Landaufteilung zu kurz gekommenen hessischen Landgrafen von den deutschen Fürsten die lange ersehnte, aber inzwischen völlig wertlose, „Kurwürde“ verliehen. Er nannte sich nun „ Kurfürst Wilhelm I.“ von Hessen-Kassel. Napoleons Machthunger war indessen längst nicht gestillt. Im Jahre 1804 kürte er sich selbst zum „Kaiser der Franzosen“. Er veränderte von nun an nachhaltig die Landkarte Europas. Ein Staat nach dem anderen musste sich der „Grande Armee“ des Korsen geschlagen geben. Nacheinander besiegte er in blutigen Gefechten: Österreich 1805, Preußen 1806 und Russland 1807. Der „Rheinbund“ aus den süddeutschen Staaten: Bayern, Baden, Württemberg, Hessen-Darmstadt und einigen weiteren deutschen Kleinstaaten trat 1806 an die Seite Napoleons und beteiligte sich an dessen Eroberungskriegen. Zur „Belohnung“ wurden Napoleons deutsche Vasallen mit hohen Würden versehen. Bayern, Sachsen und Württemberg wurden zu „Königreichen“ erhoben. Aus der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt wurde das Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Das 1000 Jahre alte deutsche Kaiserreich, das seit dem Jahre 800 nur selten in Eintracht die Geschicke in der deutschen Vielstaaterei lenken konnte, zerbrach 164 im Jahre 1806. Der letzte „römische Kaiser deutscher Nation, der Habsburger Franz II. beschränkte sich ab 1804 mit dem Titel des Kaisers von Österreich. Was geschah nun mit Marburg und mit Hessen-Kassel ! Die Hessische Landgrafschaft Hessen-Kassel hatte mit der Niedergrafschaft Katzenellnbogen mit St. Goar und Hessen-Rheinfels und allen anderen linksrheinischen Gebieten den größten Flächenverlust hinzunehmen und dafür einen wertlosen „Kurhut“ geerbt. Als Landentschädigung wurden Hessen-Kassel lediglich einige mainzische Enklaven im hessischen Kernland zugestanden, darunter Fritzlar und Amöneburg nebst den umliegenden katholischen Dörfern. In der Mittellage von Deutschland war Hessen-Kassel indessen wehrlos den Ereignissen ausgeliefert. Das vom hessischen Kurfürsten mit Napoleon am 1. Oktober 1806 abgeschlossene Neutralitätsabkommen wurde schon am 30. Oktober 1806 unter einem Vorwand vom französischen Imperator gebrochen. Hessen-Kassel stand den Expansionsplänen Napoleons im Wege. Er brauchte Hessen als Aufmarschgebiet für seine weiteren Kriegsvorbereitungen. Außerdem galt ihm Hessen-Kassel als „zu preußisch“ gesinnt. Im Herbst 1806 besetzte die „Grande Armee“ HessenKassel. Kurfürst Willhelm I. löste seine kostspielige Armee kampflos auf. Er flüchtete unter Mitnahme des größten Teiles des Staatsschatzes nach Schleswig, an den Hof seines Bruders Karl. Später, ab 1808 über165 siedelte Wilhelm I. nach Prag, schmiedete konspirative Umsturzpläne für Hessen-Kassel und wartete dort auf das Ende Napoleons. Der erste Marburger Aufstand von 26. / 27. Dezember 1806 Nach der Okkupation und der Flucht des Kurfürsten war ein besetztes Land zurück geblieben. Die „kampffähigen“ Soldaten der alten hessischen Regimenter wurden per Dekret den napoleonischen Truppen zugeteilt. Längst nicht alle folgten dieser Aufforderung. Zahlreiche hessische Offiziere und Soldaten hatten kein Verständnis für die kampflose Preisgabe des Vaterlandes. Etliche enttäuschte hessische Soldaten nahmen sich aus Scham über die Schmach das Leben. In Marburg erschoss sich der hessische Major Lith aus Gram über die kampflose Preisgabe von Hessen-Kassel. Ein großer Teil der nun „arbeitslos“ gewordenen, vornehmlich älteren, hessischen Veteranen und etliche Bauernsöhne aus den nahen Dörfern mochten sich nicht kampflos mit der Besetzung des Landes durch fremde Herrschaft abfinden. Ende Dezember 1806 kam es zu Attacken gegen die französische Besatzung in Hessen. Etwa 100 kampferprobte kurhessische Veteranen stürmten das Marburger Schloss. Es kam an vielen Stellen in der Stadt zu Feuergefechten mit der französischen Besatzung und zu zahlreichen Toten auf beiden Seiten. 166 Die Marburger Bürgerschaft verhielt sich ruhig. Sie schloss sich der Rebellion nicht an, so wie dies von den Aufständischen erhofft worden war. Ein französischer Verband unter der Führung des Leutnants Talleyrand, einem Sohn des französischen Außenministers, schlug in Weidenhausen einen aufständischen Bauerntrupp. Die etwa 24 Stunden währenden Gefechte in Marburg endeten mit der Flucht der Aufständischen, die ohne Unterstützung gegen die Übermacht zweier französischer Bataillone keine Chance hatten. Einige von ihnen wurden in den folgenden Tagen festgenommen und kurze Zeit später jedoch frei gelassen. Offenbar hatte man auf französischer Seite den verzweifelten Kampf der Hessen als Reaktion auf die Besetzung ihres Landes angesehen und den Widerstand der Veteranen somit als legale Kriegshandlung eingestuft. Bemerkenswert bleibt jedoch der Hinweis, dass wir unter den Aufständischen des Dezember 1806 zahlreiche Namen finden, die auch 2 ½ Jahre später, beim Aufstand des 24. Juni 1809 in Marburg wieder in Erscheinung treten. Unter ihnen die Marburger Josbächer und Camerding, sowie die älteren Veteranen aus den Dörfern, die zum Teil schon das 40. und 50.Lebensjahr überschritten hatten: Wendel Günther und der „weiße“ Moog aus Sterzhausen, Daniel und Johannes Muth, Siegfried Vormschlag, Johann Meisel, Conrad Heuser aus Ockershausen und einige andere hatten bereits an der Rebellion der Dezembertage des Jahres 1806 teilgenommen. 167 Das Königreich Westphalen (1807-1813) Aus den Ereignissen des Jahres 1807 werden Napoleons Absichten, die er mit der Besetzung Hessen-Kassel’s verbunden hatte deutlich. Im geschlagenen Deutschland sollte ein Musterstaat nach französischem Vorbild entstehen. Der neue Staat im Zentrum des deutschen Reichsgebietes führte den Namen „ Königreich Westphalen“. An der Spitze des neuen Staates residierte König Hyronimus Napoleon, genannt Jerome, der jüngste Bruder des großen Korsen. Kassel wurde Landeshauptstadt. Das Staatsgebiet umfasste neben Hessen-Kassel große Teile des heutigen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und die preußischen Gebiete westlich der Elbe. Das Staatsgebiet umfasste in seiner größten Ausdehnung ca. 63 000 qkm. Ihm gehörten etwa 2,5 Millionen Einwohner an. Wie in Frankreich, gliederte sich der zentral ausgerichtete Staat in „Departements“. Marburg im südlichen Zipfel des Königreichs Westphalen wurde Hauptstadt des „Werra-Departements“. An der Spitze des Departements stand der Präfekt. Ihm waren alle Bürgermeister in den Städten und Gemeinden direkt unterstellt. Nach französischem Vorbild hießen sie nun „Maire“. Die Organisation und Gesetzgebung im Staat orientierten sich am französischen „Code Civil“. Das Gedankengut der Revolution, das „revolutionäre Recht“, fand nun auch Anwendung in einem deutschen Staat. Dies fand besonderen Ausdruck in den postulierten Grundsätzen der „Gleichheit Aller vor dem Gesetz“, dem „Schutz und der Freiheit des Individuums“, dem 168 „Schutz des Eigentums“ und der „strikten Trennung von Kirche und Staat“. Natürlich fand damit in Westphalen die in weiten Teilen in Deutschland noch geltende „Leibeigenschaft“ ihr Ende. Das alte Zunftwesen wurde beseitigt. Es galten zum ersten Mal Gewerbe- und Berufsfreiheit. Dies galt auch für die jüdischen Staatsbürger, denen zuvor nur sehr eingeschränkte Rechte in den deutschen Ländern zugebilligt worden waren. Napoleon war beherrscht von der Vorstellung, dass die „Untertanen“ in den übrigen feudalen deutschen Fürstentümern die bessere neue Staatsordnung erkennen könnten und dass sie sich schon bald am Vorbild des „Musterstaates Westphalen“, orientieren würden. Die Rechnung wäre wohl aufgegangen, hätte Napoleon nicht selber Hand daran angelegt, diesen Anspruch durch seine eigene, expansive Macht- und Kriegspolitik zu torpedieren. Um seine „Kriegsmaschine“ von Hunderttausenden Soldaten zu versorgen, betrieb er eine totale Ausbeutung aller wirtschaftlichen Ressourcen in seinem gesamten Macht- und Einflussbereich. Die Bürger seines Musterstaates Westphalen hatten Kriegslasten zu schultern, die um ein Vielfaches die Steuer- und Abgabenlasten an die früheren Fürsten im Lande übertrafen. Noch schwerer lastete der Druck auf den wehrfähigen Männern, die nun massenhaft den Regimentern der „Grande Armee“ zugeführt wurden. 40% aller Wehrfähigen im Alter von 20 bis 25 Jahren hatten mit ihrer Einberufung zum Militär zu rechnen. Bei den Landgrafen war der Anteil der eingezogenen Wehrfähigen „in besonderen Kriegszeiten“ zwischen 10 bis 20 %. Hier endete auch der Grundsatz der „Gleichheit“, denn das besitzende Bürgertum konnte die eigenen Söhne, 169 wie schon zuvor in Hessen-Kassel, vom ungeliebten Kriegsdienst freikaufen. Woran hätte der einfache, wenig gebildete Bürger erkennen sollen, dass nun eine bessere Zukunft für ihn im Königreich Westphalen begonnen hätte? Die Marburger Universität 1806 – 1809! Völlig anders stellte sich jedoch zunächst die neue Lage für das Bürgertum und den Sektor „Bildung und Wissenschaften“. Im Gegensatz zur Masse des noch immer überwiegend „analphabetischen“ einfachen Volkes, war der Großteil des Bildungsbürgertums sehr angetan von den Möglichkeiten der „geistigen Befreiung“, die mit der von Frankreich ausgehenden revolutionären Expansion einherging. Die Napoleon-Begeisterung war an den Universitäten und in den „aufgeklärten Zirkeln“ in Deutschland unübersehbar. Noch drängte diese Begeisterung die aufkommende patriotische Stimmung jener Kräfte in den Hintergrund, die auf eine eigene, einheitliche nationalstaatliche Zukunft in Deutschland setzten. In Marburg begann mit dem „Königreich Westphalen“ allerdings auch ein kritischer Zeitabschnitt. Der Fortbestand der Universität war gefährdet. In „Westpha170 len“ gab es fünf Universitäten: Göttingen, Halle, Marburg, Helmstedt und Rinteln. Bei einer Bevölkerung von etwa 2,5 Millionen waren fünf zu unterhaltende Universitäten für den neuen Staat einfach zu viel. Die Schließung von - mindestens zwei - der fünf Hochschulen, erschien als unvermeidbar. Ungefährdet wegen ihrer Größe und Bedeutung waren die Universitäten in Göttingen und Halle. Die Entscheidung über die dritte verbleibende Universität, erfolgte schließlich im Jahr 1809 zugunsten von Marburg. Die Universitäten in Helmstedt und Rinteln wurden aufgelöst. Daran hatten die Bemühungen der Marburger Professorenschaft und des Präfekten des „Werra-Departements“ in Marburg, Ludwig Freiherr von Berlepsch, erheblichen Anteil. In einem flammenden Brief vom 3. April 1809 an König Jerome richtete Berlepsch einen Appell zur Erhaltung der Universität in Marburg. Im letzen Satz dieses Schreibens wird die vorherrschende positive Einstellung zum neuen Staatsoberhaupt des Königreichs Westphalen deutlich: „Sire, Zerstreuen Sie die Ängste (der Marburger) indem Sie ihnen die tröstliche Versicherung geben, dass ein geehrtes Institut den Söhnen der Väter erhalten bleiben soll, die bereit sind, ihr Leben und ihr Glück für das Wohlergehen und den Ruhm des Königreichs und des besten aller Könige zu opfern“! Diesen Appell kann man durchaus als Zustimmung zur Heranziehung der hessischen Landeskinder in die Armee Napoleons interpretieren. Die kurze „westphälische Zeit“ wurde von den Universitätsangehörigen in Marburg als eine Blütezeit empfunden. Landgraf Willhelm IX. - seit 1803 Kurfürst Willhelm I.- galt nicht als ein ausgewiesener Förderer 171 der Wissenschaften. Sein besonderes Interesse galt dem Militärwesen. Dort brachte er es mit dem „Subsidienhandel“ (verkaufte hessische Soldaten) zu Wohlstand und Reichtum. Wilhelm I. erwies sich auch als erfolgreicher Mäzen des Kunstschaffens. Er baute die Residenzstadt Kassel, wie schon unter seinen Vorgängern begonnen, weiter zu einer europäischen Metropole der Künste aus. Bei den Zuwendungen an die Marburger Universtät verhielt er sich eher knauserig. Dies war seinem Ansehen bei den Universitätsangehörigen wenig förderlich. Als Patrioten ihres bisherigen Brotgebers traten sie bei dessen Absetzung durch Napoleon nicht in Erscheinung, mit einer Ausnahme, über die noch zu berichten ist. Kein Wunder also, dass die Universitätsangehörigen überwiegend dem neuen Staatswesen zugetan waren. Der Marburger Professor Ludwig Wachter – Theologe und Historiker – nahm als Mitglied der Stände des Königreichs beim Reichstag in Kassel teil. Professor Georg F. C: Robert, Dekan der juristischen Fakultät der Marburger Universität, ebenfalls Mitglied der Stände des Königreichs Westphalen, nahm als Deputierter der Universität Marburg bei der Ernennung Jerome’s zum König am 18. August 1807 in Paris teil. Die Wahrnehmung des neuen Staatswesens unterschied sich bei den „Bildungsbürgern“ und dem einfachen Volk deutlich. „Unten“ erfuhr man den Druck der neuen Staatsmacht als eine ständig wachsende Belastung, die nicht enden wollte. Von den neuen Errungenschaften, der bürgerlichen Freiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz, erfuhr man im Alltag wenig. Abgaben und Steuerlasten und Einberufungen zum ungeliebten Militär taten 172 ein Übriges, um den Unmut gegen das Königreich Westphalen, das in erster Linie als Besatzungsmacht wahrgenommenen wurde, zu nähren. Große Teile des Bildungsbürgertums, so man sich dort dem aufkommenden, national-patriotischen Geist in Deutschland noch entziehen konnte, begrüßten hingegen die neue, französisch orientierte revolutionäre Staatsform. Beim Marburger Bürgertum aus Beamten, Kaufleuten und Handwerkern stellte sich aber schon bald Ernüchterung ein, vor dem Hintergrund der ständigen, schon erwähnten erheblichen Abgabenlasten und Leistungen, die sie u. a. für die „kostenfreien Einquartierungen“ von französischen Truppen aufzubringen hatte Hyronimus Bonaparte König Jerome von Westphalen (1807-1813) In Kassel nannte man ihn „König Lustik“ Die Berichterstattung über das kurze Wirken Jeromes in Kassel die unmittelbar nach der Niederlage Napoleons im Befreiungskrieg bei Leipzig, (9.-13. Oktober 1813) einsetzte, zeichnet ein verzerrtes Bild des glücklosen Königs. Er war eindeutig besser, als es sein negativer Ruf zum Ausdruck brachte, den man ihm später angehängt hat. Jerome war nicht der „tumbe Depp“, als den ihn gehässige, deutsche patriotisch gesinnte Historiker der Nachwelt hinterlassen wollten. Als blutjunger Korvettenkapitän hatte er bereits ein Schiff befehligt, das im Koalitionskrieg gegen die englische Flotte kämpfte. Nach Ende des Seekriegs gegen England (Trafalgar) nahm er erfolgreich als Divisionskommandeur 1806/07 am Krieg gegen Preußen teil. Die Annahme, dass Napoleon eine so wichtige Aufgabe wie den Aufbau und die Führung eines großen 173 Musterstaates in der Mitte Deutschlands einem unfähigen „Luftikus“ anvertraut hätte, beantwortet sich damit von selbst. Jerome hat die ihm übertragene Aufgabe aus Westphalen einen Musterstaat zu gestalten, sehr ernst genommen. Die Fortschrittlichkeit seiner Regierung, seiner Erneuerung der staatlichen Verwaltungs- und Rechtsnormen, setzte völlig neue Impulse, die auch noch später, nicht nur in Hessen-Kassel, sondern weit darüber hinaus positive Nachwirkungen in Deutschland erzielten. Die Kasseler Bürgerschaft war dem neuen Geist der mit Jerome der Residenzstadt Einzug gehalten hatte, zunächst sehr zugetan. Welch ein Unterschied zu dem biederen, wenig volksnahen Kurfürsten. Seinen aufwendigen Lebensstil sah man dem lebenslustigen Jerome nach. Ein Großteil des althessischen Adels hatte sich in der „Königlichen Loge Hieronymus Napoleon zur Treue“ zusammengeschlossen. Die Frauen der „Kasseler Gesellschaft“ lagen dem jungen Monarchen „zu Füßen“. Die zahlreichen, von ihm initiierten Festlichkeiten in Kassel wurden als willkommene Bereicherung des vormals eher spröden Gesellschaftslebens vom gehobenen Bürgertum empfunden. Diesen Festivitäten verdankt Jerome den Spottnamen „König Lustik“ (wg. seiner Probleme mit der deutschen Sprache) „Heute wieder lustik“, diesen Satz soll er – wo auch immer – gesagt haben. Widerstand gegen Napoleon! Etwa bis zum Jahre 1808 hatte Napoleon seinen Machtbereich auf weite Teile in der Mitte Europas ausgedehnt. Er stand nun einem riesigen Imperium vor. Sein Drang noch mehr Macht und Einfluss zu gewinnen 174 war größer, als die gebotene Vernunft, das eroberte Terrain in seinem Inneren zu festigen. Im Dezember 1807 begann Napoleons „Spanienfeldzug“, der bis zum Jahre 1814 andauerte. Der verlorene Seekrieg Frankreichs gegen England führte zu einer weiteren verhängnisvollen Fehlentscheidung Napoleons, der Kontinentalsperre. Damit unterband er den zuvor florierenden Handel der deutschen Wirtschaft mit England. In allen Orten wurden englische Waren konfisziert und öffentlich verbrannt, so auch in Marburg am 11.12.1808. Der Unmut in den besetzten deutschen Ländern wurde zudem durch die immensen Abgaben und Lasten für die Unterhaltung der riesigen Armeen Napoleons immer größer. Immer bedrückender wurde auch die Sorge über die permanenten Rekrutierungen, die in allen Teilen Deutschlands Zehntausende junger Männer zum Kriegsdienst in Napoleons Armeen zwangen. Dies endete, wie sich erweisen sollte, überwiegend in Tod und Elend der davon Betroffenen. Auch Jerome hatte keine Chance, sein Land vor den permanenten Abgaben und Kriegslasten für Napoleons Armeen zu bewahren. Westphalen hatte ein Kontingent von 25 000 Soldaten zu stellen. Der weitaus größte Teil von ihnen wird im Spanienkrieg und im Russlandfeldzug Napoleons von 1812/13 das Leben verlieren. In den besetzten deutschen Ländern formierte sich der passive Widerstand gegen die französische Besetzung. Deutsche Patrioten forderten Nationalbewusstsein von allen deutschen Bürgerinnen und Bürgern ein. Gemeinsam sollte das französische Joch abgeschüttelt werden. 175 Die Anhänger eines „Vereinigten Deutschlands“ proklamierten ein modernes Staatssystem, jenseits der absolutistischen Monarchien. Reformer wie Freiherr vom und zum Stein und die preußischen Militärs Gneisenau, Scharnhorst und andere forderten den Widerstand des Volkes gegen fremde Herrschaft. Revolutionäre Dichter wie Ernst Moritz Arndt und Theodor Körner schürten als ausgewiesene und unversöhnliche Gegner Frankreichs und alles Französischen die Stimmung gegen Napoleon. Friedrich Ludwig Jahn und andere, forderten „Volksertüchtigung für alle Deutschen“, um daraus „eines Tages eine nationale Armee des ganzen Deutschen Volkes“ zu bilden. Davon versprach man sich nicht nur eine Steigerung der Kampfkraft sondern auch eine patriotische Einstellung des Volkes zu ihrem Staat. Als Vorbild diente durchaus die französische Revolutionsarmee, die sich als Armee des Volkes den Söldnerheeren der Könige und Fürsten durchaus als überlegen gezeigt hatte. Es war allein Napoleons unbändige Machtpolitik, die den Widerstand in den von ihm besetzten Ländern beförderte. Bald regte sich aktiver Widerstand in allen französisch besetzten Gebieten. Ehemalige preußische Heerführer stellten „Freicorps“ zusammen, die im Hinterland gegen die französische Besatzungsmacht sabotierten. Die „schwarzen Reiter“ des Ferdinand von Braunschweig setzten den Franzosen zu. Später operierte auch das berühmt gewordene „Lützow’sche Freicorps“ gegen die Franzosen. Gerade in diesen Freicorps fanden sich die Anhänger eines künftigen neuen, deutschen vereinigten Staatswesens zusammen. In Berlin verließ Major Ferdinand von Schill, gegen den Willen des preußischen Königs, aber mit Billigung der 176 preußischen Königin Luise, mit seinem Regiment die Garnison, um auf „eigene Faust“ gegen Napoleon bzw. gegen dessen Verbündeten Staaten des „Rheinbundes“ zu kämpfen. Am 31. Mai 1809 verlor Schill in Stralsund im Kampf gegen die westphälische Armee des Königs Jerome sein Leben. Konspirative Pläne, die die Befreiung Deutschlands vom französischen Joch zum Ziel hatten, kursierten zwischen den am Widerstand beteiligten Anführern des „deutschen Bundes“. Napoleon stand diesem Treiben nicht untätig gegenüber. Er weitete die in Frankreich sehr erfolgreich wirkende Geheimpolizei auf seinen gesamten Machtbereich aus. Abgefangene Briefe der Anführer der Konspiration - u.a. des Freiherrn vom Stein, von Scharnhorst, Wittgenstein, Gneisenau und anderen deutschen Reformern - informierten ihn über deren Maßnahmen. Ein Brief des Freiherrn vom Stein an Wittgenstein, erschütterte Napoleon indessen besonders. Er selbst hatte dem preußischen König diesen fähigen Reformer für „hohe Staatsaufgaben“ empfohlen. Dies zeigte nun Napoleon, dass die Verhältnisse in Deutschland für ihn bedrohlicher waren, als er es angenommen hatte. Der preußische Reformer Freiherr vom Stein entzog sich Napoleon durch Flucht nach Russland. Ein abgefangener Brief des Obersten Emmerich, den dieser am 15. Mai 1809 von Marburg aus an den preußischen Majos Ferdinand von Schill absenden wollte, sollte auch diesem alten Streiter gegen Frankreich noch zum Verhängnis werden. Dazu später mehr. 177 Der Dörnbergaufstand bei Kassel - April 1809! Die von Napoleon entmachteten deutschen Fürsten sahen das Treiben des Widerstands in ihren Ländern mit gemischten Gefühlen. Einerseits erkannten sie wohlwollend, dass ihr persönlicher, ohnmächtiger Zorn gegen Napoleon von weiten Teilen im Volk geteilt wurde. Andererseits fürchteten sie sehr wohl die Forderungen der Widerständler nach Errichtung eines deutschen Einheitsstaat und einer Armee des Volkes. Das Beispiel der französischen Revolution hatte ihnen „vor Augen“ geführt, welches „gefährliche Potential“ in einem „Aufstand des Volkes“ steckte. Nicht nur in den besetzten deutschen Ländern, sondern auch in den anderen von Napoleon eroberten Gebieten wuchs der Widerstand gegen Napoleon und seine Vasallen. In Südtirol hatte Andreas Hofer eine kampfstarke Rebelleneinheit zusammengestellt, die den französischen und den verbündeten bayrischen Einheiten sehr zusetzte. Im April und Mai des Jahres 1809 gab es eindrucksvolle Siege der Tiroler gegen bayrische, sächsische und französische Truppen. Im November 1809 brach ihr Aufstand zusammen. Am 20. Februar 1810 wurde Andreas Hofer als Rebell in Mantua standrechtlich erschossen. Auch für viele Hessen war im Jahre 1809 das Maß voll. Die neue Gesetzgebung unter der Maßgabe des „Code Civil“ und die Grundsätze von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ täuschten nicht darüber hinweg, dass zu viele junge Männer auf immer neuen Kriegsschauplätzen im Kriegsdienst für Napoleon ihr Leben lassen mussten. 178 Nach dem Sieg der Österreicher gegen Napoleon am 9. April 1809 bei Wagram fassten die Anhänger des deutschen „Tugendbund“ und der vereinten „Vaterlandsfreunde“ neuen Mut. Sie bereiteten sich darauf vor, ein englisch-deutsches Expeditionscorps – zusammen zu stellen, das gemeinsam mit den im Untergrund operierenden Freicorps Norddeutschland und Kurhessen befreien sollte. Der „zwischen den Fronten“ in Hessen operierende Wilhelm von Dörnberg, offiziell Regimentsführer in der westphälischen Armee, zugleich jedoch heimlicher Vorbereiter des Aufstandes in Kurhessen gegen Napoleon, sollte seine Position ausnutzen und die hessische Bevölkerung gegen die Fremdherrschaft mobilisieren. Mit ihm ergebenen hessischen Soldaten sollte König Jerome gefangen gesetzt werden. Dörnbergs Bemühungen waren jedoch gescheitert, als er von dem im Prager Exil weilenden, sehr vermögenden hessischen Kurfürsten Wilhelm finanzielle Unterstützung für die Aufstellung eines Expeditionscorps forderte. Kurfürst Wilhelm I. hatte die Bereitstellung eines entsprechenden Summe verweigert. Wilhelm I. setzte wenig Vertrauen in dieses Unternehmen. Vor allem war ihm jedoch der Gedanke einer Volksarmee zuwider. Wohin dies führen könnte, dies hatte er in Frankreich erfahren. Die in Norddeutschland geplante Aufstellung eines Expeditionscorps kam ebenfalls nicht zustande. Die dubiosen Nachrichten, die im Vorfeld der verzweifelten Befreiungsaktionen im Lande kursierten, hatten eine „Freund und Feind“ verwirrende Situation herbeigeführt und Chaos hervorgerufen. Wilhelm von Dörnberg kam nicht mehr dazu, die in Homberg/Efze versammelten Aufständischen rechtzeitig vom gescheiterten Plan zur Aufstellung des Ex179 peditionscorps zur Befreiung Kurhessens zu informieren. So begann am 22. April 1809 im Kasseler Raum übereilt die Rebellion gegen König Jerome. Friedensrichter Friedrich Martin aus Frielendorf, ein Anführer der aufständischen Nordhessen, hatte verfrüht, am Vorabend des 21. April 1809 in Homberg/Efze und in Wolfhagen die Sturmglocken läuten lassen. Dadurch waren Jeromes Getreue in Nordhessen gewarnt. Dörnberg’s Doppelrolle flog auf. An der Knallhütte bei Kassel kam es zu einem einseitigen Gefecht, in dem die völlig unzulänglich bewaffneten Aufständischen von den regulären westphälischen Truppen geschlagen wurden. Damit war der Aufstand beendet. Die Aktion blieb bis heute als der gescheiterter „Dörnbergaufstand“ in Erinnerung. Wilhelm von Dörnberg schloss sich mit zahlreichen Getreuen der „schwarzen Schar“, des Freicorps „Ferdinand von Braunschweig“ an. Er kämpfte gemeinsam mit dem Freicorps in Spanien und in Waterloo an der Seite Englands gegen Napoleon. Ernst Moritz Arndt dichtete später „Das Lied vom Dörnberg“ Der Aufstand in Marburg vom 24. Juni 1809 Die wilden Gerüchte über die bevorstehende Rebellion gegen die Fremdherrschaft machten seit Beginn des Jahres 1809 auch in Marburg die „Runde“. Keiner konnte erkennen, was nun wirklich geschehen würde. Die französische Besatzung und die Präfektur des Werra-Departements in Marburg verfolgten aufmerksam das Geschehen. 180 Das Bürgertum verhielt sich ruhig. In den Gastwirtschaften, besonders bei den Treffpunkten der einfachen Leute, ging es dagegen oft „hoch her“. Spekulationen kamen auf, dass der Kurfürst mit einem großen Heer im Anmarsch sei. Aus Ockershausen, Sterzhausen und Wetter wurden „ungenehmigte Schießübungen“ von den alten hessischen Veteranen und von Bauernjungen gemeldet. Für viele Marburger Bürger stand fest, der Aufstand würde beginnen, aber wann und mit welchem Ausgang? Später, bei der Verhandlung des Kriegsgerichts in Kassel gegen einen der Rädelsführer des Marburger Aufstandes, Oberst Andreas Emmerich, wird ein bei Emmerich gefundener Brief an den aufständischen preußischen Majors Schill vom Anfang Mai 1809, als Beweis für die weit gespannte „Insurrektion“ gegen die französische Besatzung angesehen. Emmerich sollte eine Schlüsselstellung bei den erwarteten Aufständen in Hessen einnehmen. Mit Wilhelm von Dörnberg hatte er seit Herbst 1808 den hessischen Aufstand verabredet. Die Abkommandierung Dörnbergs durch Jerome von Marburg nach Kassel zu Beginn des Jahres 1809 unterbrach die Kontakte der beiden für den bevorstehenden Aufstand vorgesehenen hessischen Truppenführer in einer entscheidenden Phase. Man hatte sich verständigt, dass Aufstände im April 1809 an mehreren Stellen gleichzeitig beginnen sollten. In Marburg wartete man allerdings vergebens auf ein Zeichen des gemeinsamen „Losschlagens“. Am 23. April 1809 startete der Aufstand bei Kassel, ohne die Marburger Rebellen darüber zu informieren. Als man 8 Wochen später, am 24. Juni 1809 in Mar181 burg los schlug, konnte inzwischen Emmerich sehr wohl wissen, dass der „Dörnbergaufstand“ im April bereits gescheitert war. Dennoch wurde von ihm in Marburg weiter die Werbetrommel für den Aufstand gerührt. Neben Oberst Emmerich war es der Professor der Medizin, Johann Heinrich Sternberg, der sich, als ein glühender Patriot für die Befreiung von Kurhesssen betätigte. Dieses ungleiche Paar an der Spitze der Marburger Rebellion setzte beharrlich die Vorbereitungen für einen Aufstand fort. Emmerich dürfte zum Zeitpunkt des Losschlagens in Marburg am 23. Juni 1809 auch kaum in Unkenntnis darüber gewesen sein, dass inzwischen auch der preußische Major Ferdinand Schill mit seinem Aufstand Ende Mai 1809 gescheitert war und Schill selbst dabei den Tod gefunden hatte. Darüber hatten schon die Zeitungen in Westphalen berichtet. Das Scheitern des „Dörnbergaufstands“ und die steckbriefliche Fahndung nach dem flüchtigen, Wilhelm von Dörnberg, waren d a s Tagesgespräch in den Strassen und in den Gastwirtschaften in Marburg und im ganzen Westphalen. Die Anführer der Rebellion in Marburg: Oberst Andreas Emmerich! Der inzwischen 73 Jahre alte Veteran, geboren am 10.11.1735 in Kiliansteten, tauchte im Jahre 1808 in Marburg auf. Ein bewegtes Soldatenleben lag hinter ihm. Er galt schon in jungen Jahren als ein fähiger Kommandoführer. Als Leutnant kämpfte er bereits in den Jahren 1756-60 in Amerika in englischen Diensten im „French-Indian-War“, dem Krieg der Franzosen und 182 der Indianer gegen England um die Vormacht in den nordamerikanischen Kolonialgebieten. Hat sich damals in Amerika Andreas Emmerich’s Abneigung gegen „alles Französische“ entwickelt? Hat sein abgrundtiefen Hass gegen Frankreich und Napoleon hier seinen Ursprung? Vieles deutet darauf hin. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1776 bis 1786) kämpfte Emmerich zunächst als Truppenführer einer englischen Einheit gegen die Franzosen. Ab 1789 befehligte er ein von ihm selbst in Waldau bei Kassel zusammengestelltes „Freicorps“ aus hessischen Söldnern. Als „Brigade Emmerich“ stand es ebenfalls im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in englischen Diensten. Später finden wir Emmerich als Truppenführer in preußischen und in hessischen Diensten. In Marburg traf Emmerich im Herbst 1808 auf Baron Caspar Wilhelm von Dörnberg. Dieser nutze schon zuvor hier seine Position als militärischer Ausbilder, um aus den Reihen der Marburger Jäger Mitverschwörer für einen Aufstand gegen die Fremdherrschaft zu gewinnen. Dass Emmerich und Dörnberg seit dem Herbst 1808 gemeinsam Verschwörungspläne schmiedeten, ist naheliegend. Dörnberg, der sich des besonderen Vertrauens König Jeromes erfreuen durfte, war von diesem jedoch nichts ahnend nach Kassel abberufen, um hier ein höheres Truppenkommando in der westphälischen Armee zu übernehmen. Dörnberg musste umdisponieren. Es kam zum überhasteten Aufstand, mit dem Ergebnis des schon erwähnten Scheiterns beim Gefecht an der Knallhütte im April 1809. Emmerich rührte indessen in Marburg weiter die „Trommel“ für einen „Befreiungsschlag“. 183 Johann Heinrich Sternberg! Professor der Medizin und Hofrat in Marburg seit dem 10. Oktober 1804, verstrickt in die verwirrenden Ereignisse des Jahres 1809, bleibt bis heute eine rätselhafte Persönlichkeit. Im Jahre 1774 in Goslar als Sohn des Stadphysikus Christoph Daniel Sternberg geboren, erfährt er eine universelle humanistische Bildung. In Göttingen studierte er Medizin. In Elbingrode und in Goslar wirkte er als Mediziner, bis ihn der Ruf an die Marburger Universität zum Lehrauftrag für Pathologie und Therapie erreicht. Mit Charlotte, der Tochter Dr. Johann Georg Siemens, dem Bürgermeister der „kaiserlich freien Reichsstadt“ Goslar war er verheiratet. An der „angestaubten“ Marburger Universität fiel er der Professorenkollegenschaft schon bald durch Neuerungen negativ auf. „Zu seinen Studenten pflege er ein zu vertrauliches Verhältnis und er behandele Patienten kostenlos“ dies wurde ihm vorgehalten. Seine fachlichen Qualitäten jedoch fanden trotz Neid und Missgunst seiner Fachkollegen hohe Anerkennung. Zu seinen Vertrauten in Marburg gehörten der Bäcker Christian Matthäi, der Töpfer Friedrich Keppler und der Schlosser Heinrich Josbächer. Drei Namen, die auch der „Insurrektion“ in Marburg zugerechnet werden. Sternberg korrespondierte über medizinische Fachthemen mit den Universitäten in Berlin und Wien. Der preußischen Königin Luise hatte er eine Abhandlung über die Behandlung von Kinderkrankheiten zugesandt, die von ihr anerkennend schriftlich beantwortet wurde. Aus seiner patriotischen Gesinnung machte Sternberg, anders als die Mehrzahl der Professorenkollegen in 184 Marburg, keinen Hehl. In Marburg war man besorgt, dass Sternberg’s Auftreten sich zum Nachteil für den Erhalt der Universität auswirken könnte. Der wachsende Unmut der Bevölkerung über die Verhältnisse im „Königreich Westphalen“ , so wie in allen Teilen Deutschlands hatte indessen längst Marburg erfasst, als Sternberg bei den konkreten Planungen des Aufstandes Einfluss zu gewinnen suchte. Er selbst brachte die Nachricht ins Spiel, dass er im Auftrage des Kurfürsten die getreuen Kurhessen, die Soldaten und die Bürgerschaft zur Teilnahme am Aufstand bewegen sollte. Insoweit deckten sich seine Ziele mit denen des „militärischen Kopfes“ des Marburger Aufstandes, des Oberst Andreas Emmerich. Eine unheilvolle Allianz nahm ihren Lauf. Verzweiflungsakt zweier „Hasardeure“? So könnte man den Aufstand des 24. Juni 1809 in Marburg bezeichnen. Zumindest Emmerich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass die bisherigen Unternehmungen des hessischen Aufstandes vom April, sowie jene des Majors Schill in Stralsund Ende Mai 1809 gescheitert waren. In Marburg hatte man zuvor Emmerich bereits mehrfach inhaftiert und zu den „Gerüchten über einen geplanten Aufstand“ verhört. Zuletzt noch einmal Mitte Mai 1809 und sogar noch wenige Stunden vor dem Ausbruch der Rebellion. Man hatte jedoch den 73 Jahre alten Veteranen Emmerich 185 als „harmlos und ungefährlich“ eingestuft und stets wieder entlassen. Wahrscheinlich hatte die Präfektur in Marburg die „Sache“ schon „abgehakt“, als die Spitzel des „französischen „Geheimdienstes“ über die „nicht enden wollenden Insurrektionsbemühungen“ Emmerich’s an die Präfektur berichteten. Immerhin ließ der Präfekt in Marburg, wegen der Unsicherheit, Truppenverstärkungen aus Mainz anfordern und die privaten Schusswaffen bei der Bevölkerung in Marburg und den Ortschaften einsammeln. Dennoch gelang es Emmerich weiterhin, auch nach seinen Inhaftierungen und den Verhören, mit martialischen Reden zahlreiche althessische Veteranen und Bauern aus der Marburger Umgebung für das Vorhaben zu begeistern. Als willkommene Hilfe dürften ihm dabei die allgemeine schlechte Stimmung unter der Bevölkerung über die Fremdherrschaft und die Bemühungen des Professors der Medizin, Johann Heinrich Sternberg gedient haben, der sich ebenfalls für die Befreiung des Landes vom „fremden Joch“ einsetzte. Sternberg’s Verbindungen zu den Teilnehmern am späteren Aufstand liefen über den ehemaligen kurfürstlichen Korporal Siegfried Vormschlag aus Ockershausen. Vormschlag diente Sternberg als Gärtner und Bote. Er brachte ihn mit den alten kurhessischen Veteranen in Ockershausen zusammen und er stellte im Vorfeld des Aufstandes die Verbindung zu den übrigen Aufständischen aus den Nachbarorten her. In der Gastwirtschaft Heuser in Ockershausen, Unterdorf 2, einem Treffpunkt der kurhessischen Veteranen aus Ockershausen und den nahen Dörfern hatte Sternberg einen Brief vorgelesen, der angeblich vom Kur186 fürsten Willhelm I. stammte. Danach seien „alle Hessen aufgefordert sich zur Befreiung des Vaterlandes bereit zu halten.“ Der Brief enthielt sogar die Androhung, dass bei Verweigerung zur Befreiung des Vaterlandes die ehemaligen kurfürstlichen Soldaten mit: „Konsequenzen für Eigentum, Leib und Leben“ zu rechnen hätten, denn sie seien noch immer durch ihren Eid dem Kurfürsten verpflichtet. Niemand hatte an der Echtheit dieses Briefes gezweifelt. Niemand sonst hatte ihn aber gelesen, oder sich über dessen Existenz vergewissert. Auch bei der späteren Durchsuchung von Sternberg’s Haus am Renthof in Marburg wurde ein Brief des Kurfürsten nicht gefunden. Die in der Gastwirtschaft Heuser versammelten ehemaligen älteren Soldaten der kurhessischen Regimenter „Kospoth und Kurfürst“ waren noch immer ergrimmt darüber, dass sie durch die Besetzung Kurhessens brotlos geworden waren. Napoleon hatte die vormaligen kurhessischen Regimenter nicht als geschlossene Kampfverbände in seine Armee eingegliedert. Er hatte alle „tauglichen“ hessischen Soldaten auf viele Truppenteile der „Grande Armee“ verteilt. Dadurch sollte die Gefahr des Widerstands geschlossener hessischer Kampfverbände ausgeschlossen werden. Auf die Verwendung der älteren über 40jährigen kurhessischen Soldaten hatte Napoleon ganz verzichtet. Dabei hatte man wohl nicht damit gerechnet, dass sich in der arbeitslosen „Söldnerschar“ dieser alten Veteranen ein aufrührerisches Potential angesammelt hatte. Auch einige junge Bauernburschen wurden von dem „rebellischen“ Gedankengut angesteckt. Sie nahmen begierig das monatelange, aufrührerische Gerede über 187 den geplanten Aufstand ernst und vertrauten auf Emmerich’s Plan, Marburg von der französischen Besatzung zu befreien. Damit sollte von hier aus das Fanal eines landesweiten Aufstandes ausgelöst werden. Der Ort Ockershausen, nur 2 km von Marburg entfernt, stand im Mittelpunkt der Vorbereitungen des Aufstandes vom Juni 1809 in Marburg! Foto: Gastwirtschaft Heuser. Am Abend des 24. Juni 1809 war es so weit. Siebzehn „Rebellen“ aus Ockershausen sowie fünf Veteranen aus den westlichen Nachbarorten: zwei Mann aus Cyriaxweimar, einer aus Hermershausen, einer aus Oberwalgern und einer aus Wenkbach, machten sich in der Nacht gegen 22.00 Uhr von der Gastwirtschaft Heuser aus auf den Weg nach Marburg. Ihre Anführer waren die ehemaligen Korporale Siegfried Vormschlag und Daniel Muth vom Regiment Kürfürst. Zeitgleich wollte man mit dem zweiten Trupp aus Sterzhausen und vom Görzhäuser Hof, angeführt vom ehemaligen Korporal Johannes Moog, gegen Mitternacht in Marburg eintreffen und die französische Besatzung in der Stadt 188 angreifen. Aber auch von Sterzhausen aus waren es weniger als zwanzig Mann, die den Korporal Moog nach Marburg begleiteten. Die geringe Anzahl der Teilnehmer des Aufstands war für die Rebellen ernüchternd. Anstatt der erhofften Anzahl von 150 – 200 hatten sich knapp 5o Mann in den beiden „Kolonnen“ aus Ockershausen und Sterzhausen eingefunden. Hinzu kamen etliche Veteranen aus Marburg, die unter Leitung des Leutnants Hesse von der „Ketzerbach“ herauf zur Altstadt gezogen waren. Die Bewaffnung der Rebellen war kläglich. Die zuvor wiederholten Aufforderungen der Präfektur, alle Waffen abzugeben, hatten Wirkung gezeigt. Es gab nur noch wenige Schusswaffen im privaten Besitz. Die Rebellen waren sowieso davon ausgegangen, die französische Besatzung in Marburg zu überrumpeln und sich in den Besitz von deren Waffen zu setzen. Es kam gegen 23 Uhr, verfrüht und unvorhergesehen, zu einem Schusswechsel in der Altstadt. Davon erst wurde der Stadtkommandant von Dalwigk geweckt. Er ahnte was geschehen war, und ließ seine Truppe, etwa 110 Soldaten, eiligst aus der Stadt in Richtung Elisabeth Tor abziehen. Eine Vorsichtsmaßnahme, da er eine Übermacht bei den Rebellen vermutete. Noch vor Wehrda machte die Truppe halt, um die Vorgänge in Marburg bis zum nächsten Morgen abzuwarten. Ein Bote brachte dem Stadtkommandanten von Dalwigk nach Mitternacht die Nachricht, dass nur weniger als fünfzig schwach bewaffnete Rebellen in die Stadt eingedrungen seien. Daraufhin führte er seine Soldaten in zwei Kolonnen aufgeteilt zurück nach Marburg. In der Altstadt kam es nach einigen kurzen Feuergefechten zu Verletzten und einigen Toten auf beiden Seiten. Die 189 Rebellion aber brach zusammen, noch ehe sie richtig begonnen hatte. Verurteilung ,Erschießung und Begnadigung! Etwa die Hälfte der Rebellen wurde bereits am frühen Morgen des 25. Juni 1809 in Marburg und in der näheren Umgebung gestellt, entwaffnet und festgenommen. Der Rest war noch in der Nacht in alle Richtungen geflohen. Doch nach und nach wurden fast alle am Aufstand Beteiligten gefasst und in das Gefängnis beim Marburger Schloss, dem „Hexenturm“, eingeliefert. Bereits Anfang Juli 1809, nur wenige Tage nach dem Aufstand, wurden alle inhaftierten Rebellen von Marburg nach Kassel abtransportiert. Dort bereitete ein eilig zusammengestelltes Kriegsgericht die ebenso eilige Verurteilung der Rebellen nach dem Kriegsrecht vor. Über die Ausgangslage bestand kein Zweifel. Wer mit der „Waffe in der Hand“ ergriffen worden war, der hatte mit dem Schlimmsten zu rechnen. Auf bewaffneten Aufruhr stand die Todesstrafe. Im Vordergrund der Untersuchungen des Kriegsgerichtes standen die Ermittlungen nach den Anstiftern der Rebellion und die Feststellung der Anführer bei den „Kampfhandlungen“. Nach eingehenden Verhören der gefangenen Rebellen stand das Ergebnis bald fest. Sternberg und Emmerich waren als die Anstifter der Rebellion überführt, obwohl beide nicht mit der „Waffe in der Hand“ festgenommen worden waren. Hier genügten dem Kriegsgericht die Indizien. Sternberg war am Aufstand selbst nicht beteiligt. Er lag krank zu Bett in seiner Wohnung am Renthof in Marburg. 190 Letzte Gewissheit über die Verstrickung von Prof. Sternberg bei den Vorbereitungen des Aufstandes ergab sich aus den ersten noch in Marburg durchgeführten Verhören der aufgegriffenen Rebellen. Nicht zuletzt durch die bereitwilligen Aussagen einiger der Aufständischen verschaffte sich das Kriegsgericht in Kassel Klarheit über alle Zusammenhänge der Revolte in Marburg. Die Verhöre in Kassel hatten für das Kriegsgericht letzte Gewissheit ergeben, dass Sternberg bei den Vorbereitungen des Aufstandes aktiv mitgewirkt hatte. Einige der gefangenen Aufständischen versuchten durch Denunziation, „ihre eigene Haut“ zu retten. Wie den Verhörprotokollen zu entnehmen ist, brachte Wendel Günther aus Sterzhausen durch belastende Aussagen andere Mitstreiter und Unbeteiligte in Gefahr. Daniel Muth „bezichtigte ohne Not“ einen Nachbarn aus Ockershausen der Mittäterschaft am Aufstand. Es sollte beide nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Die Urteilsverkündung und Vollstreckung erfolgte rasch. Um eine nötige „abschreckende Wirkung“ auf die in Unruhe versetzte Bevölkerung im Lande zu erzielen, wurden am 18. Juli 1809 Oberst Andreas Emmerich und Professor Johann Heinrich Sternberg als Rädelsführer des bewaffneten Aufstandes „zum Tode durch Erschießen“ verurteilt. Ebenfalls wurden die „mit der Waffe in der Hand“ aufgegriffenen: Daniel Muth, Friedrich Höhl, Daniel Haferkorn und Johannes Muth aus Ockershausen, Christian Matthäi und Friedrich Keppler aus Marburg, sowie Wendel Günther aus Sterzhausen zum „Tod durch Erschießen“ verurteilt. Am Morgen des 18. Juli 1809 wurde das Urteil an Andreas Emmerich im Kasseler Forst vollstreckt. 191 Die Vollstreckung des Urteils an Professor Sternberg, an Daniel Muth und Wendel Günther erfolgte am 19. Juli 1809. Die herzergreifenden Briefe, die Professor Sternberg aus der Todeszelle in Kassel an seine hochschwangere Ehefrau Charlotte richtete, geben Anhaltspunkte dafür, dass Sternberg im Vergleich zu Andreas Emmerich kein „blindwütiger Draufgänger“ gewesen sein kann. Seine Beweggründe lagen in dem Wunsch nach Beendigung des bedrückenden Zustands, der durch die Zeit der französischen Dauerbesatzung in Kurhessen eingetreten war. Zu spät hatte Sternberg erkannt, dass der alte 73jährige Veteran Andreas Emmerich um jeden Preis ein „letztes Gefecht“ gegen die ungeliebten Franzosen - ohne Rücksicht auf den unvermeidlichen Ausgang - führen wollte. Er erkannte, dass er selbst hierbei für Emmerich nur „Mittel zum Zweck“ bei der Vorbereitung des Marburger Aufstandes war. Nach der Erschießung der vier Verurteilten am 18. und 19. Juli 1809 war für König Jerome von Westphalen die gewünschte „abschreckende Wirkung“ erzielt und die Erwartung damit verbunden, „dass durch die Begnadigung der übrigen zum Tode Verurteilten, die Untertanen den schuldigen Gehorsam wahren und von weiteren strafbaren Eingebungen abgehalten werden“ Per „Decret“ vom 29. Juli 1809, unterzeichnet von Hyronimus Napoleon König von Westphalen, wurden die zum Tode verurteilten: Johannes Muth, Friedrich Höhl und Daniel Haferkorn aus Ockershausen sowie Christian Matthäi und Friedrich Keppler aus Marburg begnadigt. Ihnen wurden allerdings „hohe Verfahrenskosten“ der Militärgerichtsbarkeit auferlegt. 192 Die Befreiung vom französischen Joch wurde indessen nicht aufgegeben. Die Ereignisse, die den wahnsinnigen Krieg der „Grande Armee“ in Russland in den Jahren 1812/13 folgten, führten bald zum Untergang Napoleons. Die Völkerschlacht des Jahres 1813 bei Leipzig läutete das Ende des Korsen ein. In der letzten großen Kriegshandlung, der Schlacht bei Waterloo im Jahre 1815, wird die Niederlage Napoleons endgültig besiegelt. Fazit Wie ist es zu erklären, dass die Geschichte des „Marburger Aufstandes“ vom Juni 1809 bei den Marburgern fast gänzlich in Vergessenheit geraten konnte? Die Begleitumstände der französischen Besetzung hatten letztlich bewirkt, dass der größte Teil der Bevölkerung im Lande dieser Belastung überdrüssig war, so auch in Marburg. Westphalen konnte sich nicht als wirklich anerkannter Staat beim Volk etablieren. Die Ausnahme bilden hier einige Kreise des Bildungsbürgertums. Erfolglosen Widerstand gegen Napoleon gab es an zahlreichen Orten in seinem eroberten Imperium. Vielfach werden die „Helden“ als Martyrer noch heute gefeiert: wie Andreas Hofer in Tirol, die Gefallenen des „Dörnbergaufstandes bei Kassel“ und andere. Und in Marburg? Ein vergessener Gedenkstein, an einem vergessenen Platz. Nur wenige Marburger kennen den Gedenkstein nebst der Gedenktafel Tafel, die 100 Jahre nach den Ereignissen des Aufstandes von 1809 vom „Marburger Geschichtsverein“ „versteckt“ zwischen Dammelsberg und Schloss aufgestellt wurde. 193 Spekulationen über die „Verdrängung“ eines patriotischen Ereignisses in Marburg! 1. Universität, Studenten und Bildungsbürgertum! Sie standen in Marburg den Reformen, die mit dem französischen, revolutionär orientierten Staat Einzug gehalten hatten, überwiegend positiv gegenüber. Die in Deutschland aufkommende patriotisch gesinnte Stimmung mit dem Ziel der Errichtung eines Einheitsstaates fand hier zunächst kein Echo. Die „Vertreibung“ des Kurfürsten hatte man in Marburg unpatriotisch und unspektakulär ertragen. Gegenüber dem neuen Staat „Westphalen“ empfand man Dankbarkeit, wegen der Erhaltung der Universität Den einzigen Besuch Jerome’s in Marburg, im Dezember 1807 hatte man jubelnd gefeiert. Jubelnd begrüßte man auch die Rückkehr des Kurfürsten im Jahr 1813. Wie aber sollte man dem Kurfürsten die eigene, unpatriotische Haltung bei den Aufständen gegen Napoleon in Marburg erklären? Am Besten, wie geschehen: „tot schweigen“ 2. Die Marburger Bürgerschaft! Die Marburger Bürgerschaft teilte die zuletzt überwiegend antifranzösische Stimmung im Lande. In den Gaststätten wetterte man über die Belastungen, über die kostenlosen Einquartierungen der Franzosen zu Lasten der Bürger und die ständig steigenden Abgaben für Napoleons Armee. Offen wurden Gerüchte über bevorstehende Aufstände diskutiert. Als schließlich der 194 Aufstand in Marburg zur Unzeit startete, ging man – zum Glück für die Stadt Marburg - in „volle Deckung“. „Unter den Tisch seien sie gekrochen, vor Angst“, so wurde es später in den Gaststätten in Ockershausen hämisch kolportiert. Wie hätte die Bürgerschaft dem Kurfürsten die unpatriotische Haltung beim Aufstand erklären können? Er hat sie nicht danach gefragt. Gott sei Dank! 3) Warum stellte der Kurfürst keine Fragen an seine Untertanen in Marburg, wegen deren Desinteresses bei den Aktionen zur „Befreiung“ Kurhessens? Wie hätte er erklären sollen, dass er selbst dem Baron Wilhelm von Dörnberg die notwendige Unterstützung versagte, als dieser eindringlich die Aufstellung eines hessischen Expeditionsheeres forderte? Kurfürst Willhelm I. hatte nicht auf die „Volksbefreiung“ gesetzt, er hoffte, wie geschehen, auf die Allianz der „europäischen Mächte“ und auf die Restauration, die letztlich ab 1815 die alte Fürstenmacht weitgehend wieder herstellte. In der Marburger Bürgerschaft geriet das Ereignis zunächst total in Vergessenheit. Es sollte mehr als 50 Jahre dauern, bis letztendlich erste Versuche der historischen Aufarbeitung des Marburger Aufstandes erfolgten. In der aufkommenden patriotisch-nationalistischen Phase in Deutschland der Jahre nach 1870 erinnerten sich Marburger Historiker sehr wohl daran, dass die klägliche Rolle der Marburger Professorenschaft, der Bürgerschaft, und der Studentenschaft in 195 der kurfürstlichen Zeit nur sehr schwer als eine „patriotische Glanzleistung“ gelten konnte. Das Vergessen der Ereignisse des Jahres 1809 hatte jedoch auch positive Seiten. Nicht nur die Marburger Bürger haben den Aufstand in ihren Mauern gegen Napoleon verdrängt. Dieses „Vergessen“ verhinderte auch, dass im „tausendjährigen Nazireich“ die Marburger Nationalsozialisten das „patriotische“ Ereignis für ihre Zwecke missbrauchten. Sie wussten nichts davon. Ein Glück für Marburg! Dem ausführlichen Bericht von Udo Muras haben wir es zu verdanken, dass ein dunkles und vergessenes Kapitel der Marburger Geschichte ein wenig beleuchtet werden kann. 196 Anlage 1 zu Teil IV Der „Westphälische Moniteur“ die Regierungszeitung berichtet über den Aufstand von 1809 in Marburg. Es waten natürlich keine 500 Rebellen, sondern 50! 197 Aus Materialien des Staatsarchivs Marburg Anlage 2 zu Teil IV Ordnungsgemäß abgerechnet: Die Kosten der eingekerkerten zum Tode verurteilten Rebellen aus Marburg. Nicht alle Verurteilten wurden hingerichtet: Siehe Begnadigungshinweise von König Jerome. 198 Aus Materialien des Staatsarchivs Marburg Anlage 3 zu Teil IV Begnadigung durch König Jerome „Also befehlen wir die Vollstreckung unseres Urteile an Friedrich Höhl, Johannes Muth, Daniel Haferkorn aus Ockershausen, an Friedrich Kepler und Christian Matthäi wg. Aufruhrs angeklagt, amnestiert auszusetzen 1809.“ Acta Publikationen des königlichen Begnadigungsbriefes. Aus Materialien des Staatsarchivs Marburg Best. 265.3 199 Kirchliches Leben am Schlossberg! Im Mittelpunkt des gemeinschaftlichen Lebens stand auch am Schlossberg die Gemeinschaft der Menschen mit ihrer Kirche. In der unmittelbaren Nachbarschaft der Familien der Burgmänner befand sich seit dem ausgehenden Mittelalter die Pfarrkirche „Unserer lieben Frauen Marien“. Der Bau dieser Kirche erfolgt zeitgleich mit der Entstehung der Höfe der „Burgmannen“ in der Ritterstrasse. Die begüterten Familien unterstützten und förderten nicht nur den Kirchenbau, sondern wie die Kirchenbücher ausweisen, steuerten sie zu allen Zeiten ihr Schärflein zur Erhaltung der großen Stadtkirche bei. Die späteren Bewohner der Häuser in der Ritterstrasse, die nach und nach an die Stelle der Burgmannfamilien treten werden, gehören zu den Notabeln und den Patriziern die auch im kirchlichen Leben der Stadtbürgerschaft eine herausgehobene Stellung einnehmen. Das kirchliche Leben beschränkte sich jedoch nicht alleine auf die Stadtkirche. Auch in der Schlosskapelle fanden bei besonderen Anlässen kirchliche Veranstaltungen statt, an denen die Bürgerschaft teilnehmen konnte. Dem steigenden Bedarf an Gotteshäusern für die wachsende Gemeinde Rechnung tragend, entsteht gegen Ende des 15. Jh. die Kugelkirche. Auch im benachbarten Kerner finden Gottesdienste statt, bei Ausfall der Stadtkirche wg. Renovierungs- und Umbaumaßnahmen. Der Kirchenstreit in Marburg hat seine Spuren ebenfalls am Schlossberg hinterlassen, ohne das Fortbestehen der Kirche zu gefährden. 200 Marburger Heilig-Kreuzkapellen, Gotteshäuser und Kirchen im Mittelalter! Der Kilian Das eigenständige kirchliche Leben entwickelt sich in Marburg parallel zur Entfaltung des Ortes, von der dörflichen Ansiedlung am Burgberg zur Stadt. Zunächst gehört Marburg kirchlich zur Mutterkirche St. Martin in Oberweimar. Eine frühe Filiale entsteht um das Jahr 12oo in Marburg mit dem Bau der Marktkirche St. Kilian. Dort befindet sich auch der erste Totenhof der noch jungen Stadt. Im Jahre 1227 bestätigt Erzbischof Siegfried II. von Mainz die Trennung der Kirche zu Marburg von der Pfarrkirche zu Oberweimar. Nach der Entstehung weiterer, größerer Kirchen in Marburg verliert der Kilian seine kirchliche Bedeutung. Der Kirchenbau erfährt zahlreiche bauliche Veränderungen und dient verschiedenen wirtschaftlichen Zwecken im Stadtleben. Hierbei ist die langjährige Verwendung des Kilian als Zunfthaus der Marburger Schuhmacher zu erwähnen. Am Vorplatz des Kilian befindet sich die Stadtwaage. Der Kilian, erste Kirche in Marburg, erbaut um 1140! 201 Kirche „Unserer lieben Frauen St. Marien“ Die lutherische Pfarrkirche zu Marburg! Die Pfarrkirche am Schlossberg mit dem markanten schiefen Turm ist für viele Jahrhunderte die zentrale Stadtkirche. Sie entstand an der Stelle einer vormaligen Heiligkreuz oder Marienkapelle. Im Mai 1297 wurde die Kirche geweiht. Schon zuvor wurde der Totenhof am Kilian geschlossen und ein neuer Stadtfriedhof entstand vor der Pfarrkirche St. Marien. Dieser Totenhof befand sich auf dem schönsten Platz der Stadt. Auch dieser Friedhof war bald zu klein. Insbesondere war er der großen Anzahl der Toten die den vielen Pestepidemien zum Opfer fielen nicht mehr gewachsen. Die kaum verwesten Gebeine wurden bald wieder ausgegraben und im Beinhaus des nahen Kerners beigesetzt. Ab 1560 werden bis zum Jahr 1784 nur noch sehr begrenzt Beisetzungen auf dem Totenhof stattfinden. 202 Die Elisabethkirche Die Elisabethkirche ist neben dem Schloss das markanteste und ausdrucksvollste Bauobjekt in Marburg. Noch bedeutungsvoller ist für Marburg allerdings die Geschichte ihrer Entstehung, die sich um das kurze Leben der heiligen Elisabeth rankt. Ihr Wirken ist ursächlich und unverbrüchlich mit der Hessischen und der Geschichte Marburgs verbunden. Weit vor den Toren der Stadt hatte sich Elisabeth niedergelassen, um hier ihr Leben im Dienste für die Kranken und Armen zu beschließen. An der Stelle der von ihr errichteten Franziskuskappelle entsteht der markanteste und berühmteste Marburger Kirchenbau, an der Elisabeth ihre letzte Ruhe finden wird. Schon bald nach ihrem frühen Tode steht die Kirche im Zentrum des hier entstehenden mittelalterlichen Wall203 fahrtsortes, der zum Anziehungspunkt für unzählige Pilger wurde. Der Kirchenbau beginnt im Jahre 1235 mit der Grundsteinlegung. Am 1. Mai 1283 wird die Kirche geweiht. wie alle übrigen Kirchen in Marburg erlebte auch die Elisabethkirche in den Wirren der zahlreichen Kriege entwürdigende Verwendungen, als Fruchtspeicher, als Viehstall oder als Lazarett. All dies übersteht die Elisabethkirche ohne Schaden zu nehmen, um uns heute, inmitten einer neu gestalteten Umgebung, noch eindrucksvoller als je zuvor zu begegnen. Dominikaner Kloster Dominikanerkirche Gegen Ende des 13. Jh. nehmen der nach Dominikus benannte Mönchsorden der Dominikaner und der Orden der Franziskaner, in Marburg als Barfüßerorden genannt, innerhalb der Stadtmauern ihr Quartier. 204 Mit dem Bau des Dominikanerklosters an der süd-ost Ecke der Stadt entsteht um das Jahr 1290 die Kirche der Dominikaner. Die Klosteranlagen werden im Zuge der Reformation und der Gründung der ersten evangelischen Universität durch Landgraf Philipp von Hessen nach 1527 der neuen Hochschule als Heimstatt und Bildungsstätte zugewiesen. Nach den Zwistigkeiten, die in Marburg zwischen der lutherischen und calvinistischen Kirche im 17. Jh. ausgetragen wurden, dient die Dominikanerkirche, inzwischen Universitätskirche genannt. bis heute der „reformierten evangelischen Kirche“ in Marburg als Gotteshaus. Franziskaner (oder Barfüßer) Kirche im Bereich des Klosters der Barfüßer Mönche vor dem (Barfüßer) Stadttor - Baubeginn um 1290 Die Barfüßer Mönche des gleichnamigen Bettelordens leiten ihren Namen nach ihrer äußerlich schlichten Bekleidung ab. Sie waren im Prinzip Glieder des Ordens des hl. Franziskus (Franziskaner) links: ehemaliges Franziskanerkloster 205 Nach dem Verlassen des Klosters der Barfüßer Mönche im Zuge der Reformation in Hessen (1528) wurde die Klosteranlage der neuen Universität übergeben und diente zunächst der medizinischen und der philisophischen Fakultät als Wirkungsstätte. Die spätere Barfüßer Kapelle diente 1560 – 1865 als Totenkapelle für den dortigen Totenhof, der nach der Schließung des Friedhofes vor der lutherischen Pfarrkirche hier eingerichtet wurde. Nahe der alten Kapelle befindet sich heute die kleine Auferstehungskirche. Kugelkirche (Kirche St. Johannes Evangelist) Baubeginn 1492 - geweiht 1520 Die Kirche der Gemeinschaft der „Brüder vom gemeinsamen Leben“- genannt die Kugelherren - ist zugleich mit dem angrenzenden Kloster des Ordens am Burgberg zu Marburg das Domizil des dritten Mönchsorden innerhalb der Stadtmauern. Während die Mönche des Barfüßer Ordens und des Dominikaner Ordens Marburg nach der Reformation verlassen, verbleiben die Kugelherren in Marburg. Die Kugelkirche bleibt bis heute Gotteshaus und Zentrum der katholischen Kirchengemeinde in Marburg. 206 Der Kerner Der Kerner in der Ritterstrasse, in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Pfarrkirche, gehört wohl zu den geheimnisvollsten Gebäuden der Marburger Altstadt. Vielfältige Verwendungen und Nutzungen begleiten das massive Haus aus dem Mittelalter. Noch immer weisen die sakralen Bauelemente auf seine kirchliche Vergangenheit hin. Als Rathaus diente es für Marburg bis zum Jahre 1527. Der Kerner beherbergte das Beinhaus für die Stadt, um die Gebeine der Verstorbenen aufzunehmen, weil der nahe Totenhof die zahlreichen in den Epidemien Verstorbenen nicht mehr aufnehmen konnte. 207 Kirchen und Kapellen außerhalb der historischen Stadtmauern: Pilger- und Wallfahrtskappelle St. Michael Baubeginn 1272 (Michelchen) Pilger- und Siechenkapelle St. Jost Weidenhausen Baubeginn um 1310 Totenhof für Weidenhausen, heute: Andachten, Hochzeiten, Taufen Untergegangene Marienkapellen Kreuzkapellen -Wallfahrtskapellen Kreuzkapelle (Kerner) neben der Marienkirhe/luth. Pfarrkirche um 1261 Kreuzkapelle am unteren Barfüßer Tor – am Weg nach Ockershausen 13 Jh Kreuzkapelle vor der Weidenhäuser Lahnbrücke Kreuzkapelle am Elisabethbrunnen (Schröcker Brunnen) Waldbrüder - Eremiten - Klausner, Einsiedler und Wallfahrtskapellen um Marburg Einsiedelei am im Eselsgrund der Name ist abgeleitet von: Einsiedel – Esidelsgrond - Eselsgrund Einsiedlerhäuschen am Michelchen (vor Errichtung der dortigen Wallfahrts- Pilgerkapelle) 208 Einsiedelei im Lahnberg „Brudershäuschen“ Einsiedelei und Kreuzkapelle am Elisabethbrunnen bei Schröck Pfarrer Johannes Strack, der im „Kalandshaus“ (Ritterstrasse 9) wohnte. berichtet: „Der letzte Klausner (Einsiedler) der Kreuzkapelle am Elisabethbrunnen, die zugleich auch Wallfahrtskapelle gewesen ist, war der arme „Henche“ aus Mardorf“ Wallfahrtskapelle Wehrhausen geweiht 1339, später Marienkirche ab 1475 Nach Einführung der Reformation wurden die Heiligkreuzkapellen und Wallfahrtskapellen um Marburg aus dem kirchlichem Gebrauch genommen. Sie wurden nach und nach abgebrochen. Die katholischen Enklaven um Marburg nach der Reformation des Jahres 1527! Die Patronate der ehemaligen, Mainzischen, katholischen Ortschaften in der Nähe der von Marburg: Bauerbach, Schröck, Ginseldorf und Himmelsberg, wandten sich nach dem Jahre 1530 mit ihren Pfarrern, wie das übrige Marburger Umland, der Reformation zu. Die Rückorientierung der Orte Schröck, Bauerbach, Ginseldorf und Himmelsberg zum katholischen Glauben erfolgte über 80 Jahre später, nach Verhandlungen des Landgrafen Moritz von Hessen mit dem kurfürstlichen Mainz, im Rahmen eines vereinbarten Gebietsaustausches. 209 Danach wurden die Orte Schröck, Bauerbach, Ginseldorf und Himmelsberg im Jahre 1608 wieder katholisch, im Austausch gegen die vormals Mainzischen Orte: Eppstein, Nordenstadt und Oberliederbach, die nun ihrerseits vom katholischen zum evangelischen Glauben wechselten. 210 Marburger Stadttore und Pforten! Landgraf Philipp Tor 1 Kalbstor westlicher Ausgang der Burgstrasse (Ritterstrasse) 2 Barfüßer Tor neben dem Barfüßer Kloster, Hauptstadttor nach Westen keine Ansicht verfügbar 211 3 Lahntor östlicher Ausgang der Untergasse 4 Hundsturmpforte Torturm und Gefängnis in der Untergasse 5 Dominikanerpforte am Dominikaner Kloster, an der Mühltreppe 212 Keine Ansichten verfügbar Stadttore 6 - 14 6 Frohnhofpforte am Frohnhof zum Grind (Grün) 7 Grindpforte am süd-westlichen Ende des Grüns 8 Hildweinspforte 9 Kesselpforte am Ende Wettergasse und Anfang der Neustadt am unteren Ende der Neustadt (bei Haus . No 363) unterhalb des Renthofes zur Ketzerbach 10 Renthofpforte 11 Ketzerbachpforte 12 Schnellhartspforte 13 Bilchensteinpforte 14 Weidenhäuser Tor nord-westlicher Stadtausgang nach Marbach (bei Haus. No 470) unterhalb der St. Michaelskapelle – neben dem Deutschen Haus, Nordausgang vor dem Pilgrimstein (Hs. No 559) Torhaus und Wegegeldstation an der Weidenhäuser Brücke 15 Torturmhaus Burgfriede am Ortsende von Weidenhausen zur Zahlbach Haus No 703 u 704) 213 Quellen: Teil I Dr. Carl Knetsch Der Forsthof und die Ritterstrasse zu Marburg mit Zeichnungen von Otto Ubbelohde, Verlag von Adolf Ebel, früher: Ehrhardts Universitätsbuchhandlung Marburg 1921 Dr. Wilhelm Bücking Geschichtliche Bilder aus Marburgs Vergangenheit, Elwert’sche Verlagsbuchhandlung Marburg 1901 Wilhelm Kolbe Marburg im Mittelalter Elwert’sche Verlagsbuchhandlung Marburg 1878 Dr. Wilhem Bücking Geschichte und Beschreibung der lutherischen Pfarrkirche, der Pfarrkirche: „Unserer lieben Frauen St. Maria“ in Marburg Elwert’sche Verlagsbuchhandlung Marburg 1899 Reinhold Drusel 775 Jahre Ockershausen 1234-2009 Jubiläumsbuch, Druckhaus Marburg Wilhelm Scheffern - genannt Dillich - Hessische Chronika, zusammengetragen und zu Kassel gedruckt durch Wilhelm Wessel Anno 1605 Uwe Schultz Die Geschichte Hessens Konrad Theis Verlag Stuttgart 1983 Gerd Bauer u.a. Die Geschichte Hessens Eichborn Verlag Frankfurt/M 2002 214 Stadt Marburg Marburger Geschichte Rückblick auf die Stadtgeschichte in Einzelbeiträgen J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1980 Wilhelm Kessler Geschichte der Universitätsstadt Marburg in Daten und Stichworten ISBN3 923820-0 J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1984 Bildquellen/Skizzen/Zeichnungen: Otto Ubbelohde Ferdinand Justi Zeichnungen und Skizzen Zeichnungen und Skizzen Historische Fotografien aus Marburg Christian Hach Ludwig Bickel M. Paar Otto Damm Carl Dern G. Braun H. Unckel Digitale Fotografien R. Drusel Quellen: Teil II Dr. Wilhelm Bücking Geschichtliche Bilder aus Marburgs Vergangenheit Begebenheiten dreißigjährigen Krieg Elwert’sche Verlagsbuchhandlung Marburg 1901 215 Walter Kürschner Marburg im Jahre 1645 Elwert’sch Verlagsbuchhandlung Marburg 1909 Wilhelm Kolbe Marburg im Mittelalter Elwert’sche Verlagsbuchhandlung Marburg 1879 Caspar Preis Bauernleben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges Stausebacher Chronik Verlag Trauvetter u. Fischer Nachf. Marburg 1998 DAMALS Das Magazin für Geschichte und Kultur 1970 Heft 5 416 ff Bernhard Bachmann Der böhmische Aufstand 1972 Heft 9/ 803 ff “Tilly erobert Magdeburg” Bernhard Bachmann, Gustav Ferytag, Friedrich Schiller u.a. Peter Milger Kurt Beck Gerd Bauer . Gegen Land und Leute Der Dreißigjährige Krieg Bertelsmann Verlag München 1998 Die Geschichte Hessens S 95 ff Der Bruderzwist im Hause Hessen Konrad Theiss Verlag Stuttgart 1983 Die Geschichte Hessens S 159 ff Eichborn Verlag Frankfurt 2002 216 Stadt Marburg Marburger Geschichte Rückblick auf die Stadtgeschichte in Einzelbeiträgen Marburg 1980 J. A. Koch Druckerei und Verlag Wilhelm Kessler Geschichte der Universitätsstadt Marburg in Daten und Stichworten J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1984 Quellen Teil III Dr. Wilhelm Bücking Geschichtliche Bilder aus Marburgs Vergangenheit Begebenheiten aus dem siebenjährigen Krieg Elwert’scheVerlagsbuchhandlung Marburg 1901 Christoph von Rommel Die Geschichte von Hessen DAMALS Das Magazin für Geschichte und Kultur 1988 Heft 1 u. 2 Werner Hollfort Schlacht bei Minden 1759 Kurfürst Wilhelm I. „Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Lebenserinnerungen des Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen-Kassel Campus Verlag Frankfurt 1996 217 Gerd Bauer u. a. Die Geschichte Hessens S 209 ff Eichborn Verlag Frankfurt 2002 Stephan Schwanke Die gezähmte Bellona - Bürger und Soldaten in den hessischen Festungs- und Garnisonsstädten Marburg und Ziegenhain Tectum Verlag Marburg 2004 Magistrat der Stadt Marburg Marburger Geschichte Rückblick auf die Stadtgeschichte in Einzelbeiträgen J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1980 Wilhelm Kessler Geschichte der Universitätsstadt Marburg in Daten und Stichworten ISBN3 923820-0 J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1984 Weitere Quellen und Textvorlagen: Stadtarchiv Marburg Stadtschriften historische Pläne Staatsarchiv Marburg: Urkunden, historische Texte und Pläne Universitätsbibliothek Marburg ausgewählte Hinweise, Texte und Urkunden Magistrat der Stadt Marburg: ausgewählte Stadtschriften DAMALS historische Monatszeitschrift ausgewählte Beiträge 218 Quellen: Teil IV Udo Muras Ein vergessenes Kapitel der Marburger Gechichte aus napoleonischer Zeit Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur Bd. Reinhold Drusel 775 Jahre Ockershausen 1234 – 2009 Jubiläumsschrift S 111 ff Druckhaus Marburg 2009 DAMALS Das Magazin für Geschichte und Kultur 1972 Heft 9 Paul C. Ettighoffe Die Kanonade von Valmy 1992 Heft 1 Eckhard Klessmann Die Mainzer Republik 2003 Heft 11 S 58 ff Michael Fuhr Beutekunst in Napoleonischer Zeit 2009 Heft 6 S 24 ff Oster Die Koalitionskriege 1782 – 1815 Stadt Baunatal Der Dörnbersche Aufstand Chronik der Stadt Baunatal Band 3 W. Theopold Aufsatz: Prof. Dr. Johann Heinrich Sternberg von Dr. med. W. Theopold, Privatdozent Frankfurt 219 Kurfürst Wilhelm I. „Wir Wilhelm von Gottes Gnaden“ Lebenserinnerungen des Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen-Kassel, Campus Verlag Frankfurt 1996 Gerd Bauer u.a. Die Geschichte Hessens S 209 ff Eichborn Verlag Frankfurt 2002 ISBN 3-8318-1750-X Der Magistrat der Stadt Marburg Marburger Geschichte Rückblick auf die Stadtgeschichte in Einzelbeiträgen J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1980 Wilhelm Kessler Geschichte der Universitätsstadt Marburg in Daten und Stichworten ISBN3 923820-0 J. A. Koch Druckerei und Verlag Marburg 1984 220 Mediendateien – Biografien - Lebensdaten sonstige Quellen - Familienportraits Arnim, von Baumbach, von Brentano, von Berlepsch, von Bicken, von Blücher, von Carl , Landgraf Dörnberg, von Amalie-Elisabeth Landgräfin Georg II. Landgraf Goeddaeus Gerstenberger Gneisenau Grimm Hinrich I Landgraf Heinrich IIi. Landgraf Holzapfel Katte Günderrode Krafft, Adam Ludwig II Landgraf Thüringen Milchling Landkomtur Moritz Landgraf Philipp Landgraf Pappenheim Riedesel Savigny Scheuernschloss Sophie von Brabant Stauff Obrist Tilly Vultee Wilhelm II. III. IV. V. Landgrafen Todenwarth Reichsfreiherr u.a. 221 Ich danke einigen Freunden und Bekannten, die mir bei der Herstellung dieses Beitrages über die (fast) vergessenen Geschichten aus unserer schönen, alten Stadt Marburg hilfreich zur Seite standen. Insbeondere danke ich Erich Schneider, für die akribische Begleitung bei der Gestaltung des historischen Reportes. Reinhold Drusel 222 223