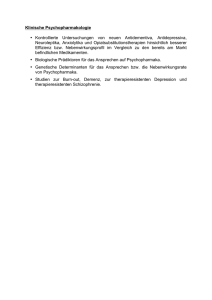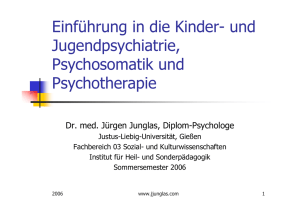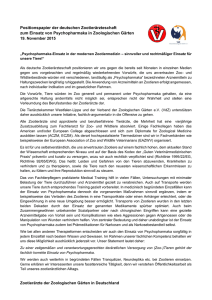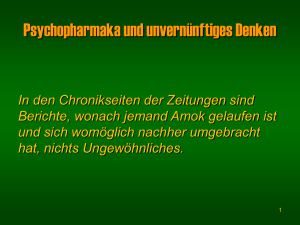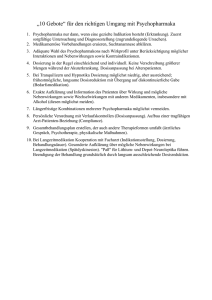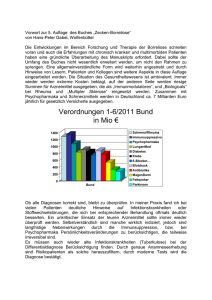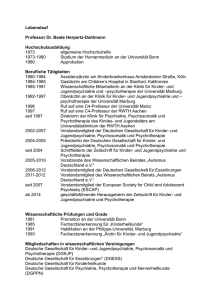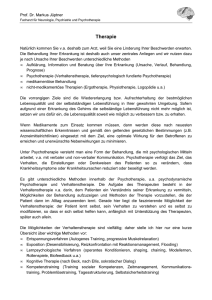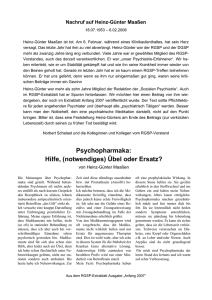Neuro-/ Psychopharmaka im Kindes
Werbung

M. Gerlach · C. Mehler-Wex · S. Walitza A. Warnke · C. Wewetzer Hrsg. Neuro-/ Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter Grundlagen und Therapie 3. Auflage Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter Manfred Gerlach Claudia Mehler-Wex Susanne Walitza Andreas Warnke Christoph Wewetzer (Hrsg.) Neuro-/ Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter Grundlagen und Therapie 3., aktualisierte Auflage Mit 40 Abbildungen und 128 Tabellen Herausgeber Manfred Gerlach Andreas Warnke Würzburg, Deutschland Claudia Mehler-Wex Bad Kissingen, Deutschland Susanne Walitza Zürich, Schweiz Christoph Wewetzer Köln, Deutschland ISBN 978-3-662-48623-8 ISBN 978-3-662-48624-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-662-48624-5 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, 2009, 2016 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikro­verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Umschlaggestaltung: deblik Berlin Fotonachweis Umschlag: © iStockphoto/Mayo5 Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer ist Teil von Springer Nature Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Berlin Heidelberg V Vorwort zur 3. Auflage Die 3. deutschsprachige Auflage folgt der 1. Auflage der 2014 erschienenen englischen Ausgabe dieses inzwischen somit auch international anerkannten Lehrbuches zu Theorie und Praxis der medikamentösen Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. War es zunächst ein Lehrbuch, geschaffen durch die Mitarbeiter einer Klinik, so ist es inzwischen das Gemeinschaftswerk führender Vertreter der deutschsprachigen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese verstärkte Einbeziehung von störungsspezifisch wissenschaftlich und klinisch ausgewiesenen Experten, die Berücksichtigung der aktuell verfügbaren S3-Leitlinien, die erneute Anpassung des klinischen und Grundlagenwissens an den aktuell publizierten Forschungsstand und die Beachtung der rückgemeldeten Praxiserfahrungen zu den Vorauflagen geben dieser 3. Auflage eine neue Qualität. Besonderer Wert wurde im dritten Teil auf das Beschreiben des ganz praktischen störungs- bzw. symptomspezifischen Vorgehens bei der Verordnung der Medikation im klinischen Alltag gelegt. Rasch kann der Arzt nachschlagen und ersehen, welches therapeutische Vorgehen sich bei einer klinischen Problemlage empfiehlt. Den Wirkstoffklassen und dem pharmakologischen Grundlagenwissen sind eigene Teile gewidmet. Beibehalten ist die bewährte Gliederung in Teil I: „Allgemeine Aspekte der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Psychopharmaka“, Teil II: „Spezielle Pharmakotherapie psychischer Erkrankungen“ und Teil III: „Symptomatische und symptomorientierte medikamentöse Therapie“. Bei der Verfassung der Kapitel in Teil III wurden die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin (englisch „evidence-based medicine“) berücksichtigt. Diese im angelsächsischen Sprachraum begründete Denk- und Arbeitsrichtung erhebt den Anspruch, in der Patientenversorgung bewusst und ausdrücklich die jeweils beste wissenschaftliche Evidenz auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit unter Integration klinischer Kenntnisse in die Entscheidung über die jeweilige Behandlung mit einzubeziehen (Sackett et al. 19961). Grundsätzlich kommen als Datenbasis Beobachtungsstudien (Fallbericht, Fallserie, Querschnittstudie, Registerstudie, Korrelationsstudie, Fall-Kontroll-Studie, Kohortenstudie), experimentelle Studien (randomisierte, kontrollierte Studie) und Metaanalysen experimenteller Studien in Betracht. Aufgrund der Einteilung in Evidenzklassen (nach dem Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin) ergibt sich eine Bewertung nach Empfehlungsgraden für bestimmte Therapieoptionen: Die höchste Aussagefähigkeit haben systematische Übersichten von randomisierten, kontrollierten klinischen Studien mit der Evidenzklasse Ia. Klasse I II Anforderung an die Studien Ia Evidenz aufgrund einer systematischen Übersichtsarbeit randomisierter, kontrollierter Studien (eventuell mit Metaanalyse) Ib Evidenz aufgrund mindestens einer hochqualitativen randomisierten, kontrollierten Studie IIa Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung IIb Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, quasi-experimentellen Studie III Evidenz aufgrund gut angelegter, nicht experimenteller, deskriptiver Studien IV Evidenz aufgrund von Berichten/Meinungen von Expertenkreisen, Konsensuskonferenzen und/ oder klinischer Erfahrungen anerkannter Autoritäten 1 Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS (1996) Evidence-based medicine: what it is and what it isn’t. Br Med J 312: 71–72. VI Vorwort zur 3. Auflage Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Erstellung von Leitlinien, d. h. systematisch entwickelte Aussagen zur Erleichterung klinischer Entscheidungen mit dem Ziel, die Behandlungsergebnisse beim einzelnen Patienten zu verbessern und seine Zufriedenheit zu erhöhen. Nach dem System der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) werden Leitlinien in 4 Entwicklungsstufen von S1 bis S3 entwickelt und klassifiziert, wobei „S3“ (für Stufe 3) die höchste Qualitätsstufe der Entwicklungsmethodik ist. Der Evidenzgrad „S3“ bedeutet u. a., dass die gesamte internationale wissenschaftliche Fachliteratur systematisch aufzuarbeiten und zu bewerten war und dass sich alle relevanten Gruppen in einem Konsensusverfahren auf die Empfehlung der Leitlinie einigen mussten. Wenn entsprechende Beobachtungsstudien, experimentelle Studien und Übersichtsarbeiten nicht vorliegen, sind die Therapieempfehlungen als Meinungen der jeweiligen Autoren nach deren Kenntnissen der Literatur und ihren klinischen Erfahrungen formuliert worden. Das Buch ist Ratgeber und praktischer Leitfaden für Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologen, Pädiater und Allgemeinärzte. Es ist aber auch Informationsquelle für Pflegekräfte, Apotheker, Neurowissenschaftlicher, die sich für psychische Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters interessieren, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten, andere therapeutische Berufsgruppen und für Erzieher, Lehrer und Sozialpädagogen, die im Bereich der Erziehungshilfe oder im Klassenverband für Kinder und Jugendliche mit psychischer Erkrankung Sorge tragen. Seit der 1. Auflage haben sich wesentliche gesellschaftliche, wissenschaftliche und auch rechtliche Veränderungen ergeben, die für die Psychopharmakotherapie überaus relevant sind. Mit dem großen Anstieg der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung sind, hat auch die psychopharmakologische Behandlung an Bedeutung gewonnen. Mehr denn je leben psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche in teil- und vollstationären Einrichtungen der Jugendhilfe, sodass die therapeutischen und pädagogischen, teilweise elternersetzenden und -ergänzenden Bezugspersonen Kenntnisse über die Einnahme, die Wirkung und die unerwünschten Wirkungen eines Medikaments haben müssen, wenn die ihnen ganztags anvertrauten Kinder eine Medikation erhalten. Oft ist die Indikation gegeben, Psychoedukation, Psychotherapie und Psychopharmakotherapie zu verbinden. Diese Beispiele verweisen auf die gewachsene Weiterbildungsaufgabe nicht nur für Ärzte, sondern auch für nichtmedizinische therapeutische und pädagogische Berufsgruppen. Seitens der Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist für die fachärztliche Weiterbildung ein spezielles Weiterbildungsseminar eingerichtet. Die Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie (AGNP e. V.) bietet im Rahmen der AGNP-Psychopharmakologie-Tage regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Themenkreis an (▶ http://www.agnp.de). Der zunehmenden klinischen Bedeutung der psychopharmakologischen Behandlung psychischer Störungen und psychischer Symptome im Kindes- und Jugendalter entsprechen verstärkte Forschungsbemühungen und rechtliche Verbesserungen auf nationaler und internationaler Ebene. Das Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) fördert mit 1,5 Mio. Euro die Pharmakovigilanz-Forschung im Kindes- und Jugendalter u. a. mit einer multizentrischen klinischen Studie zur (Off-Label-)Anwendung von Antidepressiva VII Vorwort zur 3. Auflage und Antipsychotika, mit der Daten zu Verordnungsverhalten, Therapieeffekten und unerwünschten Arzneimittelwirkungen dieser Wirkstoffklassen erhoben werden. Die EU-Verordnung über Kinderarzneimittel, die am 26. Januar 2007 in Kraft trat, hat die Grundlagen für gesetzliche Regelungen geschaffen, die eine verstärkte Arzneimittelprüfung bei Minderjährigen anregen, denn nach wie vor bestehen gravierende Forschungsdefizite mit der Folge, dass viele Neuro-/Psychopharmaka noch immer „off-label“, d. h. ohne Zulassung für eine Altersgruppe und/oder Indikation im Sinne des Arzneimittelrechts unter allein ärztlicher Verantwortung und sorgfältiger Aufklärung von Eltern und Kindern/Jugendlichen als Heilversuch verabreicht werden. Seit dieser Verordnung müssen in Europa alle Arzneimittel, für die eine Zulassung beantragt wird, nun auch in klinischen Studien an Kindern erprobt worden sein. Wir freuen uns über die ausgezeichnete Akzeptanz, die dieses Buch mit den bisherigen, rasch ausverkauften Auflagen gefunden hat. Wir sind allen Experten dankbar, die in überaus engagierter und kooperativer Weise als Autoren mit ihrer klinischen Erfahrung und der Aufarbeitung des aktuellen, publizierten Forschungsstandes zu der Vollendung dieser 3. Auflage beigetragen haben. Ein herzlicher Dank gilt Frau Mag. Renate Eichhorn vom Springer-Verlag Wien und Frau Annette Allée für die stets fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die sorgfältige herstellerische Betreuung. Wir hoffen, dass auch diese Auflage willkommene Annahme findet und dazu beiträgt, die Behandlung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Wir sind dankbar für Hinweise auf Irrtümer und würden uns über Vorschläge zur Verbesserung des Buches freuen. Manfred Gerlach Claudia Mehler-Wex Susanne Walitza Andreas Warnke Christoph Wewetzer Würzburg, Zürich, Köln, im September 2015 VIII Abkürzungen AACAP American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ABC Aberrant Behavior Checklist ACEAngiotensin-Converting-Enzym AChAcetylcholin ACTH adrenocorticotropes Hormon ADHSAufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung ADHS-RS-IV ADHS Rating Scale-IV ADS attention deficit disorder, Aufmerksamkeitsstörung ADPAdenosindiphosphat AGNP Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und und Pharmakopsychiatrie AIMS Abnormal Involuntary Movement Scale ALS amyotrophe Lateralsklerose ALTAlanin-Aminotransferase AMGArzneimittelgesetz AMNOGArzneimittelmarktneuordnungsgesetz AMPAdenosinmonophosphat AMPA α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4isoxazolepropionic acid ASTAspartat-Aminotransferase ATPAdenosintriphosphat AUC area under the curve AVT apparative Verhaltenstherapie BDNF brain-derived neurotrophic factor BDO1,4-Butandiol BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BGB Bürgerliches Gesetzbuch BMIBody-Mass-Index BtMVVBetäubungsmittelVerschreibungsverordnung cAMPAdenosin-3’,5’-monophosphat CBT cognitive behavioral therapy C-GAS Children‘s Global Assessment Scale CGI Clinical Global Impression CDRS-R Children’s Depression Rating ScaleRevised CREB cAMP response element binding protein CRHCorticoliberin cGMPCycloguanylat CKKCholezystokinin cmax maximale Arzneistoffkonzentration CoA Coenzym A COMTcatechol-O-methyltransferase, Katechol-O-Methyltransferase CPZChlorpromazin CTL-Familie cholin transporter-like family CYPCytochrom-P450 CY-BOCS Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale DATDopamin-Transporter DGBS Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen DGKJP Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie DGPPN Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde DMDD disruptive mood dysregulation disorder DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition EAAT excitatoric amino acid transporter, exzitatorischer AminosäurenTransporter EC50 effector concentration 50 %, halbmaximaler Effekt EDRF endothelium-derived relaxing factor EEGElektroenzephalogramm EKGElektrokardiogramm EKTElektrokrampftherapie EMA European Medicines Agency (ehemals EMEA – European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) EPA European Psychiatric Association EPS extrapyramidal side effects, extrapyramidal-motorische unerwünschte Arzneimittelwirkungen ESRS Extrapyramidal Symptom Rating Scale ESSTS European Society for the Study of Tourette Syndrome FDA Food and Drug Administration FI Fachinformationen über Arzneimittel FSH follikelstimulierendes Hormon GADGlutamat-Decarboxylase GABA γ-aminobutyric acid, γ-Aminobuttersäure GATGABA-Transporter GBA Gemeinsamer Bundesausschuss GBLγ-Butyrolacton GCP good clinical practice, Gute klinische Praxis GDHGonadoliberin γ-GTγ-Glutamyltransferase GHBγ-Hydroxybuttersäure G-ProteinGuanosintriphosphat-Protein GTPGuanosintriphosphat IX Abkürzungen HDL high density lipoprotein HPA-AchseHypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Achse ICCS International Children’s Continence Society ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICSD International Classification of Sleep Disorders IGF insulin-like growth factor i. m.intramuskulär INN international non-proprietary name, Freiname IP3Inositol-1,4,5-triphosphat IUPHAR International Union of Basic and Clinical Pharmacology Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification i. v.intravenös KGKörpergewicht KD Dissoziationskonstante (entspricht dem KM-Wert von Enzymen) K-SADS Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia KVT kognitive Verhaltenstherapie l-DOPA l-3,4-Dihydroxyphenylalanin LDL low density lipoprotein LDP long-term depression, Langzeitdepression LH luteinisierendes Hormon LTP long-term potentiation, Langzeitpotenzierung mACH-Rezeptor muscarinischer ACh-Rezeptor MAOMonoamin-Oxidase MAO-A, MAO-B Isoformen der Monoamin-Oxidase MAOS Modified Overt Aggression Scale MDD major depressive disorder MDMAMethylendioxy-N-methylamphetamin (Ecstasy) mGluR metabotroper Glutamat-Rezeptor MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency MPTP1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridin mRNAMessenger-Ribonukleinsäure MSHmelanozytenstimulierendes Hormon nACH-Rezeptor nikotinischer ACh-Rezeptor NATNoradrenalin-Transporter NICE National Institute for Health and Clinical Excellence NIMH National Institute of Mental Health NMDA N-Methyl-d-aspartat NNH number needed to harm NNT number needed to treat NSAR nichtsteroidales Antirheumatikum OCT OROS PANDAS organischer Kationentransporter orales osmotisches System pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections PANSS Positive and Negative Syndrome Scale PCPPhencyclidin PEGPolyethylenglykol PETPositronenemissionstomografie P-GPP-Glykoprotein PMATPlasmamembran-MonoaminTransporter p. o. per oral RRBlutdruck SADS-P Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children – Present episode version SAS Simpson Angus Rating Scale s. c.subkutan SEM standard error of the mean, Standardfehler des Mittelwerts SERTSerotonin-Transporter SLC solute carrier SMD severe mood dysregulation SPC Summary of Product Characteristics (Fachinformationen) SPECT single photon emission computed tomography, EinzelphotonenemissionsComputertomografie SRHSomatoliberin SRS Skala zur Sozialen Responsivität SSRIs selective serotonin reuptake inhibitors, selektive SerotoninWiederaufnahmehemmer T3Trijodthyronin T4Thyroxin TA trace amines, Spurenamine TDM therapeutisches Drug-Monitoring TENS transkutane Elektrostimulation tmax Zeitpunkt, zu dem maximale Arzneistoffkonzentration (cmax) im Blut erreicht wird Tph2 Tryptophan-Hydroxylase 2 TSH thyreoidstimulierendes Hormon t1/2 Halbwertszeit. Die Größe der Halbwertszeit hängt nicht nur von der Eliminationsleistung des Organismus, sondern auch von der Verteilung eines Pharmakons ab UAWs unerwünschte Arzneimittelwirkungen VGLUT vesikulärer Glutamat-Transporter VMAT vesikulärer Monoamin-MembranTransporter VTA ventral tegmental area, Area tegmentalis ventralis WEI Weinberger Adjustment Inventory X WHO Y-BOCS Abkürzungen World Health Organization Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale YMRS Young Mania Rating Scale YSR Youth Self Report ZNSZentralnervensystem 5-HIAA 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-Hydroxyindolessigsäure 5-HT 5-Hydroxytryptamin, Serotonin XI Inhaltsverzeichnis Autorenverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV I 1 Allgemeine Aspekte der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Psychopharmaka Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 M. Gerlach, C. Drepper 2 Entwicklungs­psycho­pharma­kologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 M. Gerlach, K. Egberts, R. Taurines, C. Mehler-Wex 3 Rechtliche und ethische Fragen im klinischen Alltag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 M. Kölch 4 Anmerkungen zur Pharmakotherapie in der fachärztlichen ambulanten Versorgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 G.-E. Trott, K.-U. Oehler II Spezielle Pharmakotherapie psychischer Erkrankungen 5Antidepressiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 R. Taurines, A. Warnke, M. Gerlach 6Antipsychotika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 C. Mehler-Wex, B. Schimmelmann, M. Gerlach 7 Anxiolytika und Sedativa/Hypnotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 S. Dang, T. Renner, A. Warnke, M. Gerlach 8 Psychostimulanzien und andere Arzneistoffe, die zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) angewendet werden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 S. Walitza, M. Romanos, T. Renner, M. Gerlach 9Stimmungsstabilisatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 M. Gerlach, L. Albantakis, A. Warnke XII Inhaltsverzeichnis III Symptomatische und symptom­ orientierte medikamentöse Therapie 10 Aggressives und autoaggressives Verhalten, Impulskontrollstörung, Störung des Sozialverhaltens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 C. Mehler-Wex, A. Warnke, M. Romanos 11 Angststörungen und Phobien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 S. Walitza, S. Melfsen, A. Warnke 12Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 S. Walitza, T. Renner, M. Romanos 13Autismus-Spektrum-Störungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Ch. M. Freitag, T. A. Jarczok 14 Depressive Störungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 R. Taurines, Ch. Wewetzer 15 Elektiver (selektiver) Mutismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 K. Egberts, A. Gensthaler 16Enkopresis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 A. von Gontard 17 Enuresis und funktionelle Harninkontinenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 A. von Gontard 18Essstörungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 B. Herpertz-Dahlmann, Ch. Wewetzer 19 Manische Episode und bipolare affektive Störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 M. Holtmann, Ch. Wewetzer 20 Notfalltherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 T. Renner, A. Warnke, M. Romanos 21Persönlichkeitsstörungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 K. Schmeck, M. Romanos 22 Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 F. Häßler, A. Warnke 23Schizophrenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 B. Schimmelmann, C. Mehler-Wex, Ch. Wewetzer XIII Inhaltsverzeichnis 24Schlafstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 L. Albantakis, Ch. Wewetzer, A. Warnke 25 Substanzbezogene Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 A. Claus, M. Gerlach, R. Stohler, G. A. Wiesbeck 26Tic-Störungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 V. Roessner, A. Rothenberger 27Zwangsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Ch. Wewetzer, S. Walitza Serviceteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 XIV Autorenverzeichnis Dr. med. Laura Albantakis Dr. med. Karin Egberts Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Dr. med. vet. Dr. med. Armin Claus Prof. Dr. med. Christine Freitag Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Kliniken der Stadt Köln gGmbH Florentine-Eichler-Straße 1 51067 Köln E-Mail: [email protected] Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Universitätsklinikum Frankfurt Deutschordenstraße 50 60528 Frankfurt E-Mail: [email protected] Dr. med. Su-Yin Dang Dr. med. Angelika Gensthaler Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Universitätsklinikum Frankfurt Deutschordenstraße 50 60528 Frankfurt E-Mail: [email protected] Dr. rer. nat. Carsten Drepper Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Prof. Dr. rer. nat. Manfred Gerlach Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Frank Häßler Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Universitätsmedizin Rostock Zentrum für Nervenheilkunde Gehlsheimer Straße 20 18147 Rostock E-Mail: [email protected] XV Autorenverzeichnis Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann Dr. med. Klaus-Ulrich Oehler Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Uniklinik RWTH Aachen Neuenhofer Weg 21 52074 Aachen E-Mail: [email protected] Gemeinschaftspraxis Klein Oehler Kreienkamp Wirsbergstraße 10 97079 Würzburg E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Martin Holtmann LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Bochum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Heithofer Allee 64 59071 Hamm E-Mail: [email protected] Dr. med. Tomasz Jarczok Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Universitätsklinikum Frankfurt Deutschordenstraße 50 60528 Frankfurt E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Michael Kölch Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie u. Psychotherapie Ruppiner Kliniken GmbH Hochschulklinikum der MBH Fehrbellinerstr. 38 16816 Neuruppin E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Tobias Renner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter Universitätsklinikum Tübingen Osianderstraße 14–16 72076 Tübingen [email protected] Prof. Dr. med. Veit Roessner Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Fetscherstraße 74 1307 Dresden E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Marcel Romanos Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-mail: [email protected] Prof. Dr. med. Aribert Rothenberger Prof. Dr. med. Claudia Mehler-Wex HEMERA Klinik Privatklinik für Seelische Gesundheit, Jugendliche und junge Erwachsene Schönbornstraße 16 97688 Bad Kissingen E-Mail: [email protected] Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universitätsmedizin Göttingen von-Siebold-Straße 5 37075 Göttingen E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Benno Schimmelmann Dr. phil. Siebke Melfsen Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie Universität Zürich Neumünsterallee 9 8032 Zürich, Schweiz E-Mail: [email protected] Praxis KJP-Hoheluft / Universität Bern Oberstraße 14b 20144 Hamburg E-Mail: [email protected] XVI Autorenverzeichnis Prof. Dr. med. Klaus Schmeck Prof. Dr. med. Andreas Warnke Kinder- und jugendpsychiatrische Klinik Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel Schanzenstrasse 13 4056 Basel, Schweiz E-Mail: [email protected] Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Priv.-Doz. Dr. med. Rudolf Stohler Privatpraxis für Psychiatrie und Psychotherapie Zweierstrasse 119 8003 Zürich, Schweiz E-Mail: [email protected] Priv.-Doz. Dr. med. Regina Taurines Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Würzburg, Zentrum für Psychische Gesundheit Füchsleinstraße 15 97080 Würzburg E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Götz-Erik Trott Praxis für Kinderpsychiatrie, Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Luitpoldstraße 2–4 63739 Aschaffenburg E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Alexander von Gontard Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum des Saarlandes Kirrberger Straße, Gebäude 90.2 66421 Homburg/Saar E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Susanne Walitza Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie Universität Zürich Neumünsterallee 9 8032 Zürich, Schweiz E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Christoph Wewetzer Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Kliniken der Stadt Köln gGmbH Florentine-Eichler-Straße 1 51067 Köln E-Mail: [email protected] Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen Universitäre Psychiatrische Kliniken Wilhelm-Klein-Strasse 27 4012 Basel, Schweiz E-Mail: [email protected] 1 Allgemeine Aspekte der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Psychopharmaka Kapitel 1 Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie – 3 M. Gerlach, C. Drepper Kapitel 2 Entwicklungs­psycho­pharma­kologie – 71 M. Gerlach, K. Egberts, R. Taurines, C. Mehler-Wex Kapitel 3 Rechtliche und ethische Fragen im klinischen Alltag – 81 M. Kölch Kapitel 4 Anmerkungen zur Pharmakotherapie in der fachärztlichen ambulanten Versorgung – 91 G.-E. Trott, K.-U. Oehler I 3 Grundlagen der Neuro-/ Psychopharmakologie M. Gerlach, C. Drepper 1.1 Grundbegriffe – 4 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Pharmakologie und Pharmaka – 4 Neuro-/Psychopharmakologie – 4 Entwicklungspsycho­ pharmakologie – 5 Pharmakokinetik und Pharmakodynamik – 6 Erwünschte und unerwünschte Arzneimittelwirkungen – 11 Arzneimittelwechselwirkungen – 13 1.2 Prinzipien der Neurotransmission – 13 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 Synapsen als Orte der Vermittlung von Informationen – 14 Definition eines Neurotransmitters – 15 Wichtige Neurotransmitter – 17 Einzelschritte der chemischen Synapsenübertragung – 19 Intrazelluläre Signaltransduktion – 22 Sekundäre und tertiäre Botenstoffe – 26 Divergenz und Konvergenz in der intrazellulären Signaltransduktion – 26 1.3 Wichtige Neurotransmittersysteme – 27 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Acetylcholin – 27 Katecholamine – 32 Serotonin (5-HT) – 42 Aminosäure-Neurotransmitter – 52 1.4 Molekulare Strukturen im Gehirn als Angriffspunkte von Neuro-/Psychopharmaka – 63 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Neurotransmitter abbauende Enzyme – 63 Neurotransmitter-Rezeptoren – 64 Transportproteine – 67 Spannungsabhängige Ionenkanäle – 68 Literatur – 68 M. Gerlach et al. (Hrsg.), Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter, DOI 10.1007/978-3-662-48624-5_1, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016 1 4 1 2 3 4 5 Kapitel 1 • Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie In diesem Kapitel werden zunächst wichtige Grundbegriffe der Neuro-/Psychopharmakologie erklärt und allgemeine Fragen der Arzneimittelwirkungen besprochen. Weiterhin werden Prinzipien der Neurotransmission, wichtige Neurotransmittersysteme sowie molekulare Strukturen im Gehirn als Angriffspunkte von Neuro-/Psychopharmaka beschrieben, um Wirkungen von zentral aktiven Arzneimitteln im Gesamtzusammenhang zu begreifen. 1.1Grundbegriffe 6 1.1.1 7 Die Pharmakologie ist die Wissenschaft von den 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pharmakologie und Pharmaka Wechselwirkungen zwischen Stoffen und Lebewesen (Starke 2005). Einen Stoff, insofern er mit Lebewesen wechselwirkt, nennt man Wirkstoff oder Pharmakon. Im Englischen bezeichnet man solche Stoffe meist mit „drugs“; diese Bezeichnung entspricht aber nicht dem deutschen Begriff Droge. Arzneistoffe und Gifte sind Pharmaka, die in entsprechender Dosierung den Menschen nützen bzw. schaden. Erstere dienen der Verhütung, Heilung, Linderung oder Erkennung von Krankheiten. Arzneistoff und Gift sind somit im Gegensatz zu Pharmakon wertende Begriffe. Im Folgenden wird der Begriff Pharmakon immer im Sinne eines Arzneistoffs verwendet. Als Arzneimittel bezeichnet man Arzneistoffe, die mithilfe der pharmazeutischen Technologie in eine zur Anwendung beim Menschen geeignete Arzneiform (z. B. Tabletten, Dragees, Injektionslösungen, Salben, Zäpfchen) gebracht werden. Das Fachgebiet dazu heißt Galenik. Benannt nach dem griechischen Arzt Galenos beschäftigt sich diese Wissenschaft damit, in welcher Darreichungsform ein Arzneimittel in den Körper gelangt. In Deutschland wird der Verkehr von Arzneimitteln durch das Arzneimittelgesetz (AMG) geregelt. Die heute fast nur noch verwendeten Fertigarzneimittel werden im Voraus hergestellt und in einer zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Verpackung in den Verkehr gebracht. Das Inverkehrbringen erfordert eine Zulassung durch zuständige Behörden. In Deutschland sind das entweder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder die europäische European Medicines Agency (EMA). Neben der pharmazeutischen Qualität des Arzneimittels (wie u. a. Reinheit und Haltbarkeit der Bestandteile, Dosierungsgenauigkeit, Herstellungs- und Prüfverfahren) sind die therapeutische Wirksamkeit und Unbedenklichkeit die Säulen der Zulassung. Die Wirksamkeit (englisch „efficacy“) muss in pharmakologischen Versuchen und durch geeignete klinische Prüfungen nachgewiesen werden. Diese misst sich am Indikationsanspruch bei einer oder mehreren Erkrankungen, wobei das Hauptkriterium die Reduktion von Mortalität und/oder Morbidität ist. Zur Beurteilung der Unbedenklichkeit (englisch „safety“) eines Arzneimittels muss das Risiko des Auftretens von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAWs, englisch „adverse drug reactions“) ermittelt werden, die während oder in zeitlicher Beziehung zu der Behandlung vorkommen. Davon wird in ▶ Abschn. 1.1.5 ausführlich die Rede sein. Chemisch definierte Arzneistoffe werden weltweit mit einem von der WHO (World Health Organisation) festgelegten Freinamen (englisch „generic name“ oder „international non-proprietary name“, INN) bezeichnet. Diese Freinamen werden generell bei allen wissenschaftlichen Erörterungen und weitgehend auch in diesem Buch benutzt. Die pharmazeutischen Unternehmen prägen oft gesetzlich geschützte Markennamen für zugelassene Fertigarzneimittel, die durch ein ® (für „registered“) gekennzeichnet sind. 1.1.2Neuro-/Psychopharmakologie Die Neuropharmakologie beschäftigt sich mit Arzneistoffen, die die Aktivität des Zentralnervensystems (ZNS) direkt und vorwiegend beeinflussen. Das Gehirn bildet zusammen mit dem Rückenmark das ZNS. Direkt bedeutet, dass die Wirkungen unmittelbar über das ZNS und nicht indirekt, z. B. über das Hormonsystem, vermittelt werden. Die Psychopharmakologie als ein Teilgebiet der Neuropharmakologie beschäftigt sich im engeren Sinne mit Arzneistoffen, die vorwiegend eine Wirkung auf das ZNS ausüben und direkt psychische Prozesse beeinflussen. Deren Zweckbestimmung ist die Beseitigung oder Milderung 5 1.1 • Grundbegriffe 1 .. Tab. 1.1 Entwurf für ein neues multiaxiales Klassifikationssystem von Neuro-/Psychopharmaka. (Nach Zohar et al. 2014) Achse 1 Klasse (primärer pharmakologischer Angriffspunkt) Relevante Wirkweise Achse 2 Familie (primär betroffene[s] Neurotransmittersytem[e] und Wirkung[en] an diesem[n] System[en]) Achse 3 Neurobiologische Aktivitäten Tier Mensch Neurotransmittereffekt Schaltkreise im Gehirn Physiologische Effekte Achse 4 Wirksamkeit und wichtigste unerwünschte Arzneimittelwirkungen Achse 5 Indikationen psychopathologischer Syndrome und psychischer Krankheiten. Man unterteilt Neuro-/Psychopharmaka nach ihrem primär therapeutisch angestrebten Effekt grob in Antidementiva (Synonym Nootroprika), Antidepressiva (älterer Begriff Thymoleptika), Antipsychotika (Synonym: Neuroleptika), Anxiolytika (Synonym Ataraktika), Hypnotika (Synonym Schlafmittel), Psychostimulanzien (Synonym Psychoanaleptika, Psychotonika), Stimmungsstabilisatoren (Synonym Phasenprophylaktika; englisch „mood stabilizers“) und Arzneimittel zur Behandlung von Abhängigkeit und Entzugssymptomen. ---- Die Einteilung der Psychopharmaka orientiert sich also an der Beeinflussung der psychopathologischen Symptome, unabhängig von den unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen, bei denen sie auftreten können. Diese Einteilung vernachlässigt aber das oft sehr breite therapeutische Wirkungsspektrum der einzelnen Neuro-/Psychopharmaka, was dazu führt, dass viele dieser Arzneistoffe in mehr als einer dieser Substanzklassen eingeordnet werden müssten. Beispielsweise werden Antidepressiva heute nicht nur wie ursprünglich vorwiegend bei Patienten mit depressiven Symptomen eingesetzt, sondern auch bei Zwangs-, generalisierten Angst-, Panik-, phobischen und Essstörungen, mutistischen Verhaltensweisen und der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Deshalb gibt es Bestrebungen, die Einteilung der Neuro-/Psychopharmaka nach ihrem primär therapeutisch angestrebten Effekt durch ein neues Klassifikationsschemata (. Tab. 1.1) zu ersetzen (Zohar et al. 2014). 1.1.3Entwicklungspsycho­ pharmakologie Diese umfasst alle Fragestellungen der Arzneimittelanwendung einschließlich der Arzneimittelsicherheit im Kindes- und Jugendalter und der Rahmenbedingungen bei einer medikamentösen Behandlung (▶ Kap. 2 und 3). Dabei werden die Einflüsse der alters- und geschlechtsabhängigen körperlichen und geistigen Reifung auf die Wirkung von Neuro-/Psychopharmaka berücksichtigt. Ein weiterer Aspekt ist die Zugrundelegung einer normalen Entwicklung für die therapeutische Wirksamkeit. Dies bedeutet limitierend, dass von der normalen Physiologie abweichende Reifungsvorgänge die Wirksamkeit verändern. Grundsätzlich ist die Wirkung eines Arzneimittels beim Säugling nicht die gleiche wie beim 17-jährigen Jugendlichen. Bei längerfristigen Therapien können außerdem Reifungsvorgänge oder nicht erfasste psychosoziale Faktoren für die beobachteten klinischen Veränderungen wichtiger sein als die Wirkung eines Neuro-/ Psychopharmakons. Das heißt, die Therapie steht in Bezug zum Alter sowie zum biologischen und 6 Kapitel 1 • Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. Abb. 1.1 Die Abbildung illustriert Beispiele von Barrieren, die sich einem Neuro-/Psychopharmakon auf dem Weg zur molekularen Zielstruktur im Gehirn in den Weg stellen. Nur ein kleiner Teil der verabreichten Dosis erreicht wie hier dargestellt die Rezeptoren. (Adaptiert nach Ernst u. Vögtli 2010, S. 3) psychosozialen Entwicklungsstand des Patienten. Die Einflüsse der alters- und geschlechtsabhängigen körperlichen und geistigen Reifung auf die Wirkung von Neuro-/Psychopharmaka werden ausführlich in ▶ Abschn. 2.1 besprochen. 1.1.4Pharmakokinetik und Pharmakodynamik Damit ein Pharmakon eine Wechselwirkung mit dem Lebewesen entfalten kann, muss es mit diesem in Kontakt treten, was als Applikation bezeichnet wird. Dies geschieht entweder durch das Gelangen auf die Körpergrenzflächen wie z. B. per oral beim Schlucken einer Tablette auf das Epithel des Magen-Darm-Traktes (. Abb. 1.1) oder durch direkte Verabreichung in das Blut (z. B. intravenös oder intraperitoneal). Nach der Applikation erfolgt ein komplexes Wechselspiel zwischen den Wirkungen des Pharmakons auf das Lebewesen (Pharmakodynamik) und den Wirkungen des Lebewesens auf das Pharmakon (Pharmakokinetik). Die Pharmakokinetik umfasst die Vorgänge der Resorption, Verteilung und Speicherung (Invasion) sowie der Ausscheidung durch Elimination und Biotransformation. Die Pharmakodynamik beinhaltet sowohl die Interaktionen des Arzneistoffes mit den molekularen Zielstrukturen im Organismus als auch die Pharmakonwirkung in Abhängigkeit von einer gegebenen Konzentration (Dosis-Wirkungs-Beziehung). . Abb. 1.2 illustriert wesentliche Prozesse nach oraler Applikation eines Arzneimittels und veranschaulicht die Wechselwirkungen zwischen einem Arzneistoff und einem Lebewesen. zz Wichtige pharmakokinetische Parameter Um einen pharmakologischen Effekt hervorzurufen, muss ein Arzneistoff den Wirkort in ausreichender Konzentration erreichen. Welche Menge den Wirkort erreicht, hängt vor allem von der Dosis des applizierten Arzneimittels, aber auch vielen weiteren, pharmakokinetischen Faktoren ab, die bestimmen, welche Mengen resorbiert werden und wie der Arzneistoff im Körper verteilt, abgebaut und ausgeschieden wird (▶ Abschn. 2.1). Die für die Praxis wichtigsten Parameter zur Beschreibung dieser Vorgänge, die aus den Konzentrations-ZeitVerläufen von Arzneistoffen und ggf. deren aktiven Metaboliten in der Körperflüssigkeit (Blut, Plasma, Serum) und dem Harn gewonnen werden, sind: Zeit zwischen Applikation und Erreichen (tmax) der maximalen Plasmakonzentration (cmax), AUC (englisch „area under the curve“), absolute Bioverfügbarkeit, -- 1 7 1.1 • Grundbegriffe -- terminale Eliminationshalbwertszeit (t1/2), Verteilungsvolumen, Clearance. Für die meisten Arzneistoffe besteht eine Beziehung zwischen ihrer Konzentration am Wirkort und ihrer Wirkung, jedoch auch zwischen ihrer Plasmakonzentration und ihrer Wirkung. Die Konzentration im Plasma ist daher eine wichtige pharmakokinetische „Zielgröße“. tmax ist eine wichtige Kenngröße für die Resorptionsgeschwindigkeit und gibt häufig einen Anhaltspunkt für den Eintritt einer klinischen Wirkung. AUC bedeutet Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve (meist Plasmaspiegelkurve) und ist ein Maß für die Menge des Pharmakons im Organismus. Unter Bioverfügbarkeit versteht man die Verfügbarkeit eines Arzneimittels für systemische, also den ganzen Körper betreffende Wirkungen. Die absolute Bioverfügbarkeit ist der Anteil eines Wirkstoffes, der nach peroraler Einnahme oder auch Anwendung einer anderen Applikationsart eines Arzneimittels das Blut erreicht. Nach dieser Definition ist in aller Regel ein Pharmakon bei intravenöser Gabe zu 100 % bioverfügbar. Wichtige Faktoren, welche die Bioverfügbarkeit bestimmen, sind die Geschwindigkeit und der Prozentsatz der Wirkstofffreisetzung aus der Arzneiform, die Resorptionsgeschwindigkeit und die Resorptionsquote des freigesetzten Arzneistoffes sowie das Ausmaß des hepatischen First-Pass-Effekts. Darunter versteht man die Metabolisierung bei der ersten Passage durch die Leber. Bei eingeschränkter Leberfunktion oder im Alter kann die Bioverfügbarkeit erhöht sein. t1/2 ist die Zeit, in der die Plasmakonzentration auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes abfällt. Diese wird durch das Verteilungsvolumen (ein Maß für die Verteilung der Plasmakonzentration und der im Organismus vorhandenen Gesamtmenge des Pharmakons) und die renale Clearance (Blutvolumen, das pro Zeiteinheit durch die Niere von dem betreffenden Stoff völlig befreit wird) bestimmt. t1/2 ist eine wichtige pharmakokinetische Kenngröße in der Therapie mit Neuro-/Psychopharmaka. Danach können diese in kurz-, mittellang- und langwirksame unterteilt werden. Sie liefert ferner die Grundlage für die Dosierungsberechnungen bei wiederholten Dosierungen von Arzneimitteln, also der Langzeittherapie, die für die Therapie mit Neuro-/ Pharmazeutische Phase Applikation Zerfall der Arzneiform Wirkstoff-Auflösung Pharmakokintische Phase Resorption Biotransformation Speicherung Verteilung Ausscheidung Pharmakodynamische Phase Wirkort Pharmakologischer Effekt Wirksamkeit (klinische Wirkung) Toxische Wirkung UAWs .. Abb. 1.2 Bei oraler Gabe eines Arzneimittels im Organismus ablaufende Vorgänge. UAWs unerwünschte Arzneimittelwirkungen. (Adaptiert nach Mutschler et al. 2008) Psychopharmaka die Regel ist. Die t1/2 erlaubt abzuschätzen, wann das Pharmakon den Organismus vollständig wieder verlassen hat, also nicht mehr mit erwünschten Wirkungen und UAWs zu rechnen ist. Außerdem kann man anhand dieser Kenngröße vorhersagen, wann nach Gabe eines Arzneimittels ein Fließgleichgewicht (englisch „steady state“) erreicht wird. In diesem Zustand ist die zugeführte Dosis gleich der ausgeschiedenen Menge, was dann zu stabilen Plasmakonzentrationen führt. In der Regel wird nach 4 t1/2 dieser Zustand erreicht. zz Ausscheidung Unter Ausscheidung versteht man alle Vorgänge, die zur Elimination eines Pharmakons bzw. seines Metaboliten aus dem Organismus beitragen. Sie erfolgt im Wesentlichen in Abhängigkeit von den physikalisch-chemischen Eigenschaften (wie Molekülmasse, Säurekonstante, Wasserlöslichkeit) des auszuscheidenden Pharmakons intestinal (mit dem Fäzes), hepatisch (mit dem Fäzes) oder renal (mit 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapitel 1 • Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie dem Urin). Bis auf wenige Ausnahmen, wie z. B. Lithiumsalze, Sulpirid oder Amisulprid (Antipsychotika), die im Wesentlichen unverändert über die Niere ausgeschieden werden, werden die meisten Neuro-/Psychopharmaka in der Leber chemisch mittels sog. Phase-I- und Phase-II-Reaktionen so verändert, dass sie über die Niere ausgeschieden werden können. Dafür sind sog. Fremdstoff oder Xenobiotika metabolisierende Enzyme verantwortlich. In den Phase-I-Reaktionen, die auch Funktionalisierungsreaktionen genannt werden, werden die meist lipophilen (unpolaren) Neuro-/Psychopharmaka in Metabolite umgewandelt, die Hydroxyl-, Amino-, Sulfhydryl- oder Carboxylgruppen enthalten. Die Phase-II-Reaktionen sind Konjugationsreaktionen, die durch Transferasen katalysiert werden, wobei funktionelle Gruppen (Hydroxyl-, Amino-, Sulfhydryl- oder Carboxylgruppen) mit sehr polaren, negativ geladenen endogenen Molekülen gekoppelt werden. Wichtige Phase-II-Reaktionen sind Glucuronidierung, Sulfatierung, Methylierung, Acetylierung sowie die Konjugation mit Aminosäuren und Glutathion. Von besonderer Bedeutung für die Biotransformation von Pharmaka mittels Phase-I-Reaktionen ist die Familie der Cytochrom-P450(CYP)-Enzyme. Diese Enzyme besitzen Monooxygenasen, die Hämproteine vom Typ des Cytochrom P450 enthalten. Es gibt eine Vielzahl solcher CYP-Enzyme, die sich hinsichtlich ihrer Aminosäuresequenzen, Substratspezifität, der am jeweiligen Expressionsort vorhandenen Menge sowie Induzierbarkeit unterscheiden. Die einzelnen Isoenzyme werden nicht entsprechend ihrer Funktion, sondern strukturbezogen nach der Aminosäuresequenz in CYP-Familien und -Unterfamilien zugeordnet. Isoenzyme mit einer Sequenzidentität von über 40 % werden in Familien mit arabischen Ziffern zusammengefasst, bei einer Sequenzidentität von über 55 % in Unterfamilien mit großen Buchstaben. . Abb. 1.3 fasst die Familie der humanen CYP-Isoenzyme mit den dazu gehörigen Substraten (= Neuro-/Psychopharmaka, die durch diese Isoenzyme metabolisiert werden) zusammen. Allerdings werden die meisten Neuro-/ Psychopharmaka von mehr als einem Isoenzym metabolisiert, denn CYP-Enzyme besitzen eine breite und überlappende Substratspezifität. Die Leber enthält 90–95 % der gesamten CYPEnzymmenge, aber auch in Lunge, Darmmukosa, Niere und sogar im Gehirn finden sich CYP-Isoenzyme. CYP3A4 ist das in der menschlichen Leber am stärksten exprimierte Isoenzym, das ca. 30 % des CYP-Enzymgehaltes ausmacht. Die Expression der einzelnen CYP-Isoenzyme kann inter- und intraindividuell stark schwanken. Dies hängt einerseits vom Genotyp des Patienten ab (s. unten), variiert aber auch in Abhängigkeit von Alter (▶ Abschn. 2.1.1), Lebensgewohnheiten, Erkrankung, Medikation oder anderen Faktoren. Raucher können beispielsweise eine höhere CYP1A2-Aktivität in der Leber besitzen als Nichtraucher. Untersuchungen der Aktivitäten der CYP-Enzyme zeigen, dass sich die Aktivitäten der Isoenzyme altersabhängig unterschiedlich entwickeln und die Aktivität einiger Enzyme erst im Kindes- und Jugendalter voll ausgeprägt ist (Kearns et al. 2003). zz Pharmakogenetik des Metabolismus Alle Enzyme, die an der Verstoffwechselung von Neuro-/Psychopharmaka oder anderen Fremdstoffen beteiligt sind, werden genetisch und epigenetisch reguliert. Kommen genetische Varianten in einer Häufigkeit von mindestens 1 % in der Population vor, so spricht man definitionsgemäß von einem genetischen Polymorphismus. Als klinisch relevant wird er für ein Arzneimittel dann angesehen, wenn mindestens 30 % der Dosis durch das betreffende Enzym metabolisiert werden (s. Hiemke et al. 2012). Genetische Polymorphismen führen zu unterschiedlichen Phänotypen von Metabolisierern (Kirchheiner u. Rodriguez-Antona 2009), die man in „poor metabolizers" (haben zwei Allele mit einer geringen oder keiner Enzymaktivität), „intermediate metabolizers" (sind heterozygote Träger eines inaktiven Allels oder zweier Allele mit einer reduzierten Aktivität) und „extensive metabolizers" (Träger von zwei aktiven Allelen) unterteilt. Für einige Enzyme wurden „ultra-rapid metabolizers" identifiziert, die eine sehr hohe Enzymaktivität aufweisen, die durch eine Gen-Duplikation verursacht wird. Der Begriff „extensive metabolizers" ist etwas irreführend, da er zwar impliziert, dass bei diesen Individuen ein umfassender Metabolismus stattfindet, dieser ist aber im Gegensatz zu den „poor metabolizers“ und „ultra-rapid metabolizers“, bei denen der Metabolismus 9 1.1 • Grundbegriffe 1 A1, A2, B1 2 A6, A7, A7PT, A7PC, A13, B6, B7P, C8, C9, C18, C19, D6, D7P, D7AP, D8BP, E1, F1, EF1P, G1, J, R1, S1 3 A4, A5, A5P1, A5P2, A7, A43 4 A11, B1, F2, F3, F8, F9P, F10P, F12, X1, Z1 5 A1 7 A1, B1 8 B1 11 A1, B1, B2 19-51 1 1A2-Substrate: Agomelatin, Amitriptylin, Arsenapin, Chlorpromazin, Clomipramin, Clozapin, Duloxetin, Östradiol, Fluvoxamin, Imipramin, Koffein, Melatonin, Olanzapin, Propranolol, Thioridazin, Zotepin 2B6-Substrate: Bupropion, Disulfiram, Methadon, Sertralin 2C9-Substrate: Fluoxetin, Cannabinol, Mephenytoin, Perazin, Phenytoin, Valproinsäure 2C19-Substrate: Amitriptylin, Clomipramin, Citalopram, Diazepam, Doxepin, Escitalopram, Fluoxetin, Moclobemid, Nordazepam, Omeprazol, Pantoprazol, Perazin, Sertralin, Trimipramin, Warfarin 2D6-Substrate: Amitriptylin, Chlorpromazin, Clomipramin, Clozapin, Desipramin, Donepezil, Fluoxetin, Fluvoxamin, Haloperidol, Imipramin, Mianserin, Mirtazapin, Nortriptylin, Paroxetin, Perphenazin, Risperidon, Sertindol, Tamoxifen, Thioridazin, Venlafaxin, Ziprasidon, Zuclopenthixol 2E1-Substrate: Ethanol, Disulfiram 3A4-Substrate: Alprazolam, Amitriptylin, Buspiron, Buprenorphin, Carbamazepin, Ciclosporin, Clomipramin, Clozapin, Diazepam, Östradiol, Fluoxetin, Haloperidol, Imipramin, Levomethadon, Mirtazapin, Nordazepam, Paroxetin, Perazin, Quetiapin, Reboxetin, Risperidon, Saquinavir, Sibutramin, Sildenafil, Tadalafil, Venlafaxin, Ziprasidon, Zolpidem, Zotepin 19, 21A1P, 21A2, 24, 26A1, 26B1, 39A1, 46 51, 51P2 .. Abb. 1.3 Die Familie der humanen Cytochrom-P450(CYP)-Enzyme mit den dazu gehörigen Neuro-/Psychopharmaka, die durch diese Isoenzyme metabolisiert werden. Die Isoenzyme CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 und CYP3A 4/5 sind für den Abbau vieler Neuro-/Psychopharmaka bedeutsam; für die Isoenzyme CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 und CYP2D6 sind genetische Varianten bekannt. (Nach Hiemke et al. 2012, S. 453) von Fremdstoffen stark reduziert bzw. stark erhöht ist, normal. Genetische Unterschiede sind daher eine Ursache für die hohe interindividuelle Variabilität, die sich für Plasmakonzentrationen verschiedener Patienten bei gleicher Dosis findet, und letztendlich auch ein Grund für die Unterschiede im Ansprechen auf beispielsweise Neuro-/Psychopharmaka. Im CYP-System wurden für alle Isoenzyme Polymorphismen gefunden, die für Neuro-/Psychopharmaka klinisch relevant sind (Kirchheiner u. Rodriguez-Antona 2009). Als funktionell bedeutend wurden genetische Polymorphismen für die Enzyme CYP1A2 (bezüglich der Induzierbarkeit), CYP2D6, CYP2C19 und CYP3A5 identifiziert (s. Hiemke et al. 2012). Die Häufigkeit dieser Polymorphismen ist jedoch unterschiedlich und es bestehen ausgeprägte ethnische Unterschiede. Beispielsweise werden 12–23 % homozygote Defektträger von CYP2C19 bei der asiatischen Bevölkerung gegenüber lediglich 2–5 % bei Europäern gefunden. Etwa 5–10 % der europäischen Bevölkerung sind Träger einer Genmutante, die kein intaktes CYP2D6-Enzym exprimiert („poor metabolizers“); Mutanten, die eine hohe Enzymaktivität aufweisen („ultra-rapid metabolizers“), werden dagegen in einer Häufigkeit von 1–10 % gefunden. zz Interaktionen von Neuro-/Psychopharmaka mit Zielstrukturen im Gehirn Neuro-/Psychopharmaka müssen die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die den unkontrollierten Übertritt von Blutbestandteilen oder im Blut gelösten Sub- 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapitel 1 • Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie stanzen verhindert, überwinden, um die zellulären und molekularen Angriffspunkte im ZNS zu erreichen (. Abb. 1.1). Dort beeinflussen sie die Informationsübertragung zwischen Neuronen oder von Neuronen mit anderen Zellen durch Einwirkung auf die Übertragungswege von sogenannten chemischen Botenstoffen (Neurotransmitter, ▶ Abschn. 1.2.2). Molekulare Strukturen als Angriffspunkte von Neuro-/ Psychopharmaka im ZNS sind vor allem Neurotransmitter abbauende Enzyme, NeurotransmitterRezeptoren, Transportproteine und spannungsabhängige Ionenkanäle (▶ Abschn. 1.4). Die Bindungseigenschaften der Neurotransmitter-Rezeptoren sind die Grundlage für die Wirkung und Spezifität der Wirkstoffe, die an diese Rezeptoren binden. Details dieser Vorgänge erfahren wir im ▶ Abschn. 1.4.2. Neurotransmitter-Rezeptoren sind membranständige Proteine, die aus einem Erkennungs- und Bindungsteil, der das Signal aufnimmt, und einem Effektorteil, der das extrazelluläre Signal in eine intrazelluläre Wirkung umsetzt, bestehen. Als Agonist bezeichnet man in der Pharmakologie einen Stoff, der die Wirkung eines Neurotransmitters am Rezeptor nachahmt oder dessen Wirkung verstärkt. Als Antagonist bezeichnet man einen Stoff, der einen Neurotransmitter oder Agonisten in seiner Wirkung hemmt, in dem er an seinen Rezeptor bindet und diesen blockiert, selbst aber keine Wirkung auslöst. Entsprechend der spezifischen Wirkung von selektiven Agonisten und Antagonisten teilt man pharmakologisch die Rezeptoren in entsprechende Klassen und Subtypen ein. Nähere Einzelheiten zur Nomenklatur und Klassifikation von Rezeptoren findet man auf der Homepage (▶ http://www.guidetopharmacology.org) der IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification). Da die Funktionsweise des Gehirns in vielen Bereichen nicht oder nur in Teilaspekten bekannt ist, kann die Wirkung vieler Neuro-/Psychopharmaka nur unzureichend auf zellulärer und molekularer Ebene erklärt werden. Hinzu kommt der schmale Erkenntnisstand hinsichtlich der Frage, wie psychi­ atrische Erkrankungen genau entstehen. Dennoch hat man durch Serendipität Psychopharmaka gefunden, die diese Erkrankungen oder schwerwiegende Teilsymptome wirkungsvoll behandeln können. Die Herkunft und ursprüngliche Bedeutung von Serendipität (englisch „serendipity“), ein in der modernen Psychopharmakologie häufig benutzter Begriff, ist schwierig zu klären. Wer die Entstehung dieses Begriffes nachlesen möchte, sei auf das Kapitel zur historischen Entwicklung von M. M. Weber (2012) im Handbuch der Psychopharmakotherapie verwiesen. Meist wird Serendipität im Deutschen als „Zufallsbefund“, „Entdeckung durch glückliche Umstände“ oder „nicht vorhersehbares Nebenprodukt“ umschrieben. Nach Weber (2012) verschleiert diese Begriffsdeutung aber, dass mit Serendipität das aktive Erkennen eines latent vorhandenen Lösungszusammenhangs gemeint war und keineswegs das passive Eintretenlassen eines unvorhersehbaren Ereignisses. Serendipität ereignet sich immer dann, wenn ein Wissenschaftler aufgrund seiner persönlichen Eignung in Verbindung mit den jeweiligen institutionellen, technischen und erkenntnistheoretischen Rahmenbedingungen die Möglichkeit wahrnimmt, die eine spezifische wissenschaftshistorische Entwicklungssituation seines Faches bietet (Weber 2012). Meilensteine in der Geschichte der Psychopharmakologie sind Reserpin, Iproniazid und Chlorpromazin. Reserpin ist ein Indolalkaloid, das in Pflanzen aus der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae) enthalten ist und hauptsächlich in der Indischen Schlangenwurzel (Rauvolfia serpentina) vorkommt. Es vermindert die Speicherung von Katecholaminen wie Do­pamin und Noradrenalin (▶ Abschn. 1.3.2) und wurde klinisch erstmals zur Behandlung des Bluthochdrucks eingesetzt. Dabei wurde beobachtet, dass Patienten unter der Langzeittherapie Symptome der Depression entwickelten (Freis 1954). Seit dieser Zeit wird die Hypothese vertreten, dass eine zentrale Reduktion von Monoaminen (▶ Abschn. 1.3.2) ursächlich an der Entstehung der Depression beteiligt ist (Baumeister et al. 2003). Konsequenterweise wurden daraus medikamentöse Behandlungsmethoden entwickelt, um den Mangel im Gehirn an Monoaminen wie vor allem Noradrenalin und Serotonin (5-Hydroxytryptamin, 5-HT) zu beseitigen. Iproniazid, ein irreversibler, nichtselektiver Hemmer der Monoamin-Oxidase (MAO, ▶ Abschn. 1.4.1), wurde ursprünglich als Mittel gegen die Tuberkulose verwendet und dann als Antidepressivum entwickelt, nachdem man feststellte, dass es eine stimmungsaufhellende Wirkung 11 1.1 • Grundbegriffe hatte (Crane 1957). Chlorpromazin wurde zunächst aufgrund seiner antihistaminergen und stark sedierenden Wirkung bei Operationen eingesetzt (Lopez-Munoz et al. 2005). Dabei wurde beobachtet, dass bei einigen Patienten nicht das Bewusstsein ausgeschaltet war; die Patienten wirkten sehr entspannt und es schien diese nicht zu interessieren, was um sie herum geschah. Dies führte dazu, den Wirkstoff bei psychiatrischen Patienten zu untersuchen, wobei schließlich eine gute antipsychotische Wirksamkeit nachgewiesen wurde. 1.1.5 Erwünschte und unerwünschte Arzneimittelwirkungen Arzneimittel wirken nicht bei allen Menschen gleich. Die klinische Wirkung ist das Ergebnis zahlreicher, meist komplexer Vorgänge im Organismus und resultiert aus dem Wechselspiel zwischen pharmazeutischen, pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Prozessen. . Abb. 1.2 veranschaulicht diese Vorgänge am Beispiel eines oral verabreichten Arzneimittels. zz Erwünschte klinische Wirksamkeit Unter klinischer Wirksamkeit versteht man allgemein die mit einem Arzneimittel zu erreichende Heilung, Besserung, Linderung oder Prophylaxe einer Erkrankung. Zur Beurteilung der Wirksamkeit von beispielsweise einem Antidepressivum wird entweder die absolute Veränderung des Schweregrades der Depression mittels der „Hamilton Depression Rating Scale“ vor und am Ende der Behandlung gemessen oder dichotome kategoriale Ergebnisse wie „Responder“ vs. „Non-Responder“ oder „remittierende“ vs. „nichtremittierende Depression“ herangezogen. Die Effektstärke (Synonym Effektgröße) ist das wichtigste Maß zur Bestimmung der Wirksamkeit einer Behandlung in randomisierten Kontrollgruppenstudien und beschreibt das Ausmaß der Wirkung einer Verum- gegenüber dem einer Placebo-Behandlung unter Idealbedingungen. Die Prüfung der Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen erfolgt dagegen in sogenannten Effektivitätsstudien (englisch „effectiveness“). Wirksamkeitsstudien zeichnen sich durch eine hohe interne Validität aus. Das heißt, die Absiche- 1 rung, dass die beobachteten Veränderungen tatsächlich auf die Intervention und nicht auf andere Effekte zurückzuführen sind, muss als optimal eingeschätzt werden. Allerdings leidet unter dieser Optimierung der internen Validität die externe Validität solcher Studien, d. h. die Generalisierbarkeit der gefundenen Ergebnisse auf die klinische Praxis ist deutlich eingeschränkt. So haben randomisierte Kontrollgruppenstudien üblicherweise hohe Ein- und Ausschlusskriterien, teilweise aus ethischen (z. B. Ausschluss von Patienten mit einer bekannten Unverträglichkeit gegenüber dem Arzneimittel), teilweise aus methodischen (Patienten mit komorbiden Störungen und Patienten, die vermutlich Schwierigkeiten haben, das Studienprotokoll einzuhalten) und teilweise aus zulassungsrechtlichen (Patienten mit gewissen organischen Risiken) Gründen. Die Effektstärke alleine dokumentiert zwar eine Wirksamkeit, damit aber nicht unbedingt für sich alleine einen klinischen Nutzen einer Behandlung in einem individuellen Fall. Entscheidend ist vielmehr, wie sich die Effektstärke von anderen bekannten Behandlungsverfahren unterscheidet, was tatsächlich gemessen wurde und dass die gemessene Wirkung tatsächlich eine Bedeutung für die Patienten hat. Bei einer Effektstärke von ≤ 0,2 wird nach Cohen (1988) von einem nichtsignifikanten Effekt, zwischen 0,3 und 0,7 von einem mittleren und > 0,8 von einem starken Effekt ausgegangen. Werden Vorzeichen verwendet, bestätigt eine positive Effektstärke die experimentell erwartete Hypothese, negative Vorzeichen widerlegen die Hypothese. Eine statistische Maßzahl in Effektivitätsstudien und ein wichtiger Parameter der klinischen Epidemiologie (Laupacis et al. 1988) ist die Anzahl der notwendigen Behandlungen (englisch „number needed to treat“, NNT). Diese gibt an, wie viele Patienten pro Zeiteinheit (z. B. 1 Jahr) mit einem Arzneimittel behandelt werden müssen, um das gewünschte Therapieziel bei einem Patienten zu erreichen bzw. um ein negatives Ereignis zu verhindern. Niedrige NNT-Werte sprechen in der Regel für die Anwendung eines Therapieverfahrens. Der NNT-Wert berechnet sich aus dem Reziprokwert der absoluten Risikoreduktion, d. h. die Differenz zwischen Ereignisrate in der Kontroll- und in der Verumgruppe. Eine größere NNT bedeutet folglich eine kleinere Risikoreduktion. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapitel 1 • Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie zz Nebenwirkungen/UAWs Die spezifische Beseitigung eines pathologischen Zustands durch ein Arzneimittel ohne eine gleichzeitige Beeinflussung anderer Köperfunktionen ist nur in wenigen Fällen möglich. Bei fast allen Arzneimitteln muss deshalb mit sogenannten Nebenwirkungen (englisch „side effects“) gerechnet werden, d. h. Wirkungen, die zusätzlich zu der die Indikation bestimmenden Hauptwirkung des Arzneimittels auftreten. Da dieser Begriff nicht eindeutig ist, verwendet man im allgemeinen Sprachgebrauch heute häufiger die Bezeichnung „Arzneimittelwirkung“ (UAWs). Beide Begriffe sind inhaltlich nicht deckungsgleich. Beispielsweise müssen Nebenwirkungen im eigentlichen Wortsinn nicht notwendigerweise unerwünscht sein: So zeigen bestimmte Antipsychotika neben ihrer antipsychotischen Hauptwirkung, die in klinischen Wirksamkeitsstudien nachgewiesen wird, auch eine sedierende Nebenwirkung, die im klinischen Alltag auch ausgenutzt wird (▶ Kap. 6). Als UAW definiert die WHO jede schädliche und unbeabsichtigte Reaktion, die ursächlich auf die Einnahme eines Arzneimittels zurückgeführt werden kann, welches in Dosierungen, die beim Menschen zur Prophylaxe, Diagnose, Therapie der zur Modifikation physiologischer Funktionen üblich sind, verabreicht wird. In Deutschland werden nach § 4 Absatz 13 des Arzneimittelgesetzes (AMG) auch Fehlgebrauch (Off-label), Überdosierung, Medikationsfehler oder Arzneimittelmissbrauch als UAWs bezeichnet. Der Gesetzgeber hat die pharmazeutischen Unternehmen dazu verpflichtet, alle bekannt gewordenen UAWs zu sammeln und auszuwerten sowie sämtliche UAWs im Beipackzettel anzugeben – und dies unabhängig von der Wahrscheinlichkeit des Auftretens. So sind die langen Listen von UAWs zu erklären, die viele Patienten gar nicht verstehen und daher ängstigen. Die Bedeutung der möglichen UAWs wird durch die Angaben der folgenden Häufigkeiten relativiert: Nicht bekannt: Bisher wurden offiziell keine UAWs gemeldet. Sehr selten: Die UAW tritt in weniger als 0,01 % der Fälle oder seltener als bei einem von 10.000 mit dem Arzneimittel behandelten Patienten auf. - - Selten: Die UAW tritt in mehr als 0,01 % und in weniger als 0,1 % der Fälle oder zwischen 1 und 10 von 10.000 mit dem Arzneimittel behandelten Patienten auf. Gelegentlich: Die UAW tritt in mehr als 0,1 % und in weniger als 1 % der Fälle auf, d. h. bei mehr als 1–10 von 1000 mit dem Arzneimittel behandelten Patienten. Häufig: Die UAW tritt in mehr als 1 % und in weniger als 10 % der Fälle oder bei mehr als einem und weniger als 10 von 100 mit dem Arzneimittel behandelten Patienten auf. Sehr häufig: Die UAW tritt in mehr als 10 % oder bei mehr als einem von 10 mit dem Arzneimittel behandelten Patienten auf. Um die Therapiesicherheit zu verbessern, besteht für die Angehörigen von Heilberufen außerdem eine gesetzliche Verpflichtung, UAWs zu melden. Für Ärzte und Apotheker ist die Meldepflicht in den jeweiligen Berufsordnungen verankert. Diese schreibt u. a. vor, alle schweren UAWs zu melden. Auf die Bedeutung der Pharmakovigilanz als Mittel für die systematische Überwachung der Sicherheit eines Arzneimittels mit dem Ziel, das Nutzen-Risiko-Verhältnis kontinuierlich zu evaluieren, UAWs zu entdecken und deren Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren, wird in ▶ Abschn. 2.2 ausführlich eingegangen. Die Bedeutung einer UAW kann auch durch die Differenzierung in nicht schwerwiegende und schwerwiegende UAWs relativiert werden. Nach § 3 des AMG ist jede UAW schwerwiegend, die tödlich oder lebensbedrohend ist, eine stationäre Behandlung oder deren Verlängerung erforderlich macht oder zu bleibender oder schwerwiegender Behinderung oder Invalidität führt oder eine kongenitale Anomalie oder einen Geburtsfehler zur Folge hat. Man unterscheidet arzneistoffspezifische, dosisabhängige UAWs, die über den Wirkungsmechanismus des Pharmakons erklärt werden und somit vorhersehbar sind, von allergischen Reaktionen, die weitgehend dosisunabhängig und nicht für den betreffenden Arzneistoff charakteristisch sind. Sofern entsprechend hoch dosiert – bzw. überdosiert – wird, treten die unerwünschten Effekte bei jedem Menschen auf. Da andererseits die individuelle Toleranz gegen ein Pharmakon stark variiert, besteht 13 1.2 • Prinzipien der Neurotransmission immer die Möglichkeit, dass auch durch eine für die meisten Patienten gut verträgliche Dosis bei einigen Kranken UAWs ausgelöst werden. 1.1.6Arzneimittelwechselwirkungen Der Begriff Arzneimittelwechselwirkungen (synonym Arzneimittelinteraktionen) ist eigentlich falsch gewählt. Denn darunter versteht man klinisch relevante Wechselwirkungen nicht nur zwischen Arzneimitteln, sondern auch mit anderen körperfremden Stoffen, wie vor allem den Genussmitteln Tabakrauch, Alkohol und Koffein, aber auch Lebensmitteln wie Brokkoli, Grapefruitsaft und Gegrilltem. Insofern ist die Bezeichnung Wirkstoff- oder Pharmakawechselwirkungen korrekter. Es kann dadurch entweder zur Wirkungsverstärkung, Änderung von UAWs oder aber auch zur Verringerung, eventuell sogar zur Aufhebung der erwünschten klinischen Wirkung kommen. Der Ausdruck Wechselwirkungen sagt somit zunächst nichts darüber aus, wie diese zu bewerten sind. Im heutigen Sprachgebrauch versteht man allerdings darunter nur noch UAWs. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Pharmakainteraktionen nimmt mit der Anzahl der gleichzeitig eingenommenen Wirkstoffe exponentiell zu. Arzneimittelwechselwirkungen werden in pharmazeutische, pharmakokinetische und pharmakodynamische Interaktionen eingeteilt. Pharmakodynamische Wechselwirkungen von Neuro-/ Psychopharmaka mit anderen Arzneimitteln sind dadurch charakterisiert, dass diese durch Interaktionen an zellulären und molekularen Angriffspunkten im ZNS ihre Wirkung verstärken oder abschwächen. Soweit die pharmakodynamischen Eigenschaften der Arzneimittel bekannt sind, können mögliche Interferenzen vorausgesagt werden. Sofern solche Wechselwirkungen günstig sind, lassen sich diese therapeutisch nutzen, oder, falls sie unerwünscht sind, vermeiden. Im Gegensatz zu den pharmakodynamischen Interaktionen ist die Voraussage pharmakokinetischer Wechselwirkungen schwieriger, da die pharmakokinetischen Vorgänge nur in Ausnahmefällen arzneistoffspezifisch sind. Diese Pharmakainteraktionen können jedoch durch therapeutisches Drug Monitoring (TDM, 1 ▶ Abschn. 2.1.1) entdeckt, verfolgt und überwacht werden. In den beiden nächsten Abschnitten werden kurz die Prinzipien der Neurotransmission, wichtige Neurotransmitter und -Rezeptoren sowie molekulare Strukturen als Angriffspunkte von Neuro-/ Psychopharmaka besprochen. Leser, die sich für allgemeine und spezielle Fragen der Arzneimittelwirkungen interessieren, werden auf die Lehrbücher der Pharmakologie und Toxikologie verwiesen (Aktories et al. 2013; Mutschler et al. 2012). 1.2Prinzipien der Neurotransmission Die Hirnforschung hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, insbesondere die Aufklärung jener Strukturen und Funktionen im Gehirn betreffend, die mit sogenannten geistigen Leistungen (wie Gedächtnis und Lernen) einschließlich des Bewusstseins zu tun haben, wodurch die molekularen Wirkungsorte einiger Neuro-/Psychopharmaka gut erklärt werden können. Die elementaren Bestandteile des Gehirns sind einzelne, voneinander getrennte spezialisierte Zellen wie Nerven- (Neuronen) und nichtneuronale Zellen (Gliazellen). Neueste Zählungen lassen bei einem durchschnittlichen männlichen Gehirn auf etwa 86 Milliarden Neuronen und eine etwa ähnlich große Zahl von Gliazellen schließen (Azevedo et al. 2009). Diese schier unvorstellbare Anzahl an funktionellen Zellen im ZNS liegt in etwa derselben Größenordnung wie die der Sterne in der Milchstraße, derzeit geschätzt auf 200–400 Milliarden, mit einer ungeheuren Vielfalt an unterschiedlichen Funktionen, Formen und molekularer Ausstattung. Obwohl Rudolf Virchow schon 1846 erkannte, dass das Nervensystem aus zwei grundsätzlich verschiedenen Zelltypen, den Nerven- und Gliazellen, besteht, weiß man heute über Gliazellen im Vergleich zu Neuronen relativ wenig. Dieser Informationsmangel hat zu einem Nervensystem-Konzept geführt, in dem die Neuronen deutlich dominieren und die Rolle der Gliazellen unterbewertet ist. Man unterteilt die Gliazellen der Vertebraten in Makroglia- und Mikrogliazellen. Makrogliazellen bezeichnet man auch als Neuroglia. Man unterteilt 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapitel 1 • Grundlagen der Neuro-/Psychopharmakologie sie u. a. in Astrozyten, Oligodendrozyten im ZNS und Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem. Genauso wie Neuronen sind Makrogliazellen ektodermalen Ursprungs. Des Weiteren existieren noch eine Vielzahl von spezialisierten Gliazelltypen, wie z. B. Radialglia, Satellitenzellen (Synonym: Mantelzellen) und Ependymzellen, die die BlutHirn-Schranke bilden und für die Zirkulation des Liquors sorgen. Mikrogliazellen sind keine „echten“ Gliazellen. Sie stammen aus dem mononukleärphagozytären System und vermitteln Immunantworten im Nervensystem. Mikrogliazellen entstammen dem mesodermalen Keimblatt. Im Unterschied zu den übrigen Zellen im Körper besitzen Neuronen – wahrscheinlich auch Astrozyten – die Fähigkeit, über große Entfernungen rasch und präzise miteinander Informationen auszutauschen. Jedes Neuron stellt gleichzeitig eine Empfangs- und eine Sendeeinheit dar. Die Dendriten und Zellkörper (Perikaryon) der Neuronen sind an ihrer Oberfläche mit speziellen Proteinen (Rezeptoren) ausgestattet, die von außen eintreffende Signale in erregende (exzitatorische) oder hemmende (inhibitorische) Membranpotenziale umwandeln. Die räumliche und zeitliche Integration dieser Signale entscheidet darüber, ob das Neuron ein Aktionspotenzial abfeuert. Nach diesem informationsverarbeitenden Prozess liegt die zu übertragende Information in kodierter Form als Folge von Aktionspotenzialen vor, die über die Axone weitergeleitet werden. Im Unterschied zu anderen Zelltypen besitzen Neuronen und wahrscheinlich auch bestimmte Gliazellen spezifische Kontakte zu vielen anderen Zielzellen. Hierbei kann es sich um andere Arten von Neuronen, Glia- sowie um Muskel- oder Drüsenzellen handeln. 1.2.1 Synapsen als Orte der Vermittlung von Informationen Der Ort, an dem die Informationen zwischen Neuronen vermittelt werden, wird als Synapse bezeichnet. Diese besteht aus drei wesentlichen Elementen: der präsynaptischen Nervenendigung, der postsynaptischen Empfängerzelle und einer Kontaktzone. Ein Neuron leitet über durchschnitt- lich 1000 synaptische Verbindungen Signale weiter und empfängt sogar noch bedeutend mehr. Daher besitzt das menschliche Gehirn, das wie erwähnt schätzungsweise 86 Milliarden Neuronen enthält, etwa 1014 Synapsen. Trotz dieser riesigen Anzahl liegen der synaptischen Übertragung im gesamten Nervensystem nur zwei wesentliche Mechanismen zugrunde: Die elektrische und die chemische synaptische Übertragung. Chemische und elektrische Synapsen sind morphologisch unterschiedlich aufgebaut. Bei chemischen Synapsen existiert keine zytoplasmatische Verbindung zwischen den Nervenzellen; stattdessen sind diese durch einen schmalen Bereich von 15–25 nm, den synaptischen Spalt, voneinander getrennt. Im Gegensatz dazu werden bei elektrischen Synapsen über spezielle porenbildende Proteinkomplexe (sogenannte Connexone) direkt Informationen zwischen dem Zytoplasma beider Zellen über Zell-Zell-Kanäle (englisch „Gap junctions“) ausgetauscht. Die elektrische Informationsvermittlung erfolgt naturgemäß rasch (ohne Zeitverzögerung) und stereotyp. Elektrische Synapsen dienen primär dazu, einfache depolarisierende Signale weiterzuleiten und Nervenzellgruppen zu synchronisieren; sie können nicht ohne Weiteres hemmend wirken oder lang anhaltende Effektivitätsveränderungen hervorrufen. Chemische Synapsen können dagegen, je nach freigesetztem Neurotransmitter, sowohl inhibitorische als auch exzitatorische Signale vermitteln. Sie sind damit flexibler und rufen deshalb im Allgemeinen komplexere Verhaltensreaktionen hervor als elektrische Synapsen. Da die Sensitivität chemischer Synapsen modulierbar ist, weisen Synapsen dieses Typs eine Plastizität auf, die eine Grundvoraussetzung für das Gedächtnis und andere höhere Gehirnfunktionen darstellt. Plastizität bedeutet, dass die chemischen Synapsen in Abhängigkeit von Häufigkeit, Stärke und Historie ihrer Aktivierung die Effizienz ihrer Signalweitergabe regulieren können. Chemische Synapsen können neuronale Signale verstärken, sodass auch eine kleine präsynaptische Nervenendigung das Potenzial einer großen postsynaptischen Zelle erheblich verändern kann, was bei elektrischen Synapsen unmöglich ist. Da durch chemische Synapsen Nervenimpulse nur in eine Richtung übertragen werden, sind sie für die 15 1.2 • Prinzipien der Neurotransmission Reizleitung Gleichrichter. Allerdings kostet die kontrollierte Freisetzung des Neurotransmitters von der signalgebenden Zelle, der Präsynapse, die Diffusion durch den synaptischen Spalt, die Bindung an Zielmoleküle (Rezeptoren) an der Postsynapse und das darauf folgende Auslösen einer Depolarisation oder Signalkaskaden über sogenannte sekundäre Botenstoffe Zeit. Daher arbeiten chemische Synapsen im Vergleich zu elektrischen Synapsen langsamer. Details dieser Vorgänge erfahren wir in ▶ Abschn. 1.2.4–1.2.6. Die Informationsübertragung zwischen Neuronen im ZNS erfolgt überwiegend an chemischen Synapsen. Die Mechanismen der chemischen synaptischen Übertragung sind Grundlage geistiger Leistungen des Gehirns wie Denken, Bewusstsein, Wahrnehmung, Empfinden, Bewegungssteuerung, Erinnerung und Lernen. 1.2.2Definition eines Neurotransmitters In chemischen Synapsen wird die Informationsübertragung zwischen den Neuronen durch niedermolekulare Botenstoffe, die (Neuro-)Transmitter, vermittelt. Ausgehend vom Dale‘schen Prinzip, wonach jedes Neuron nur einen Neurotransmitter synthetisiert, wird durch den Neurotransmitter, den ein Neuron zur Informationsübertragung verwendet, ein Neuron näher gekennzeichnet: Ein Neuron, das beispielsweise Do­pamin als Neurotransmitter verwendet, wird als Do­paminerges Neuron bezeichnet. Dieses Prinzip ist jedoch heute nicht mehr uneingeschränkt gültig. So können durchaus mehrere Neurotransmitter gemeinsam vorkommen, z. B. ein oder mehrere klassische Neurotransmitter und ein oder mehrere Neuropeptide. Kürzlich wurde ein besonders kurioser Fall entdeckt, wobei die gleichzeitige Freisetzung eines erregenden (Glutamat) und eines hemmenden (GABA) Neurotransmitters vom gleichen Axonterminal in Neuronen nachgewiesen wurde (Root et al. 2014). In solchen Fällen kann die klassische Einteilung in glutamaterge oder GABAerge Neuronen nicht mehr greifen. Der erstmalige Nachweis, dass eine chemische Verbindung in der Lage ist, einen elektrischen Impuls über den synaptischen Spalt weiterzuleiten, 1 gelang 1921 dem Grazer Pharmakologen und Physiologen Otto Loewi am Herzen, dessen Schlagfrequenz durch den Vagusnerv zentral gesteuert wird. Weitere 5 Jahre benötigte er, um zu zeigen, dass die chemische Substanz, die der Vagus als kardiale Hemmsubstanz freisetzt, mit dem Acetylcholin (ACh) identisch ist. Seit dieser Zeit hat man viele neue als Neurotransmitter wirkende Substanzen entdeckt, jedoch gelang es nie, analoge Ergebnisse in Gehirn- und Rückenmarksgewebe zu erzielen. Dies führte dazu, dass sich die Vorstellung von Neurotransmittern mit den neuesten Erkenntnissen zur Neurobiologie und Rezeptorpharmakologie stetig veränderte. Entsprechend dem Loewi‘schen Befund ist ein Neurotransmitter ein Stoffwechselprodukt, das von einer Synapse eines Neurons durch Stimulation freigesetzt wird und eine andere Zelle in einem Effektororgan in bestimmter Weise beeinflusst. Obwohl es theoretisch einfach erscheint, eine im Gehirn vorkommende chemische Substanz entsprechend dieser Definition als Neurotransmitter zu klassifizieren, ist dies im Experiment nur schwer zu verifizieren. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass es wegen der anatomischen Komplexität des ZNS experimentell sehr schwierig ist, selektiv einen einheitlichen Satz von Neuronen elektrisch zu stimulieren. Zum anderen sind die zur Verfügung stehenden Analysetechniken nicht empfindlich genug, um die lokale präsynaptische Freisetzung von potenziellen Neurotransmittern quantitativ zu erfassen. Moderne Analyseverfahren ermöglichen zwar die Bestimmung von Konzentrationen im femtomolaren Bereich, jedoch reicht diese Empfindlichkeit nicht dazu aus, den Gehalt eines präsynaptisch freigesetzten Neurotransmitters zu messen. Ein Femtomol eines Transmitters enthält etwa 600 Millionen Moleküle. Die Ankunft eines präsynaptischen Aktionspotenzials löst an jeder Nervenendigung aber nur die Ausschüttung von einigen hundert synaptischen Vesikeln (dies sind elektronenmikroskopisch sichtbare, bläschenförmige, membranumschlossene Strukturen) aus, von denen jedes Vesikel nur etwa 10.000 Transmittermoleküle enthält. Neben dem analytischen Problem kommt erschwerend hinzu, dass ein Neuron rund 1000 synaptische Verbindungen in unterschiedlichen Bereichen der Nervenzelle enthält und Teil eines komplexen Netzwerkes von