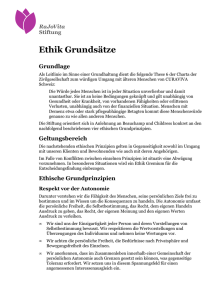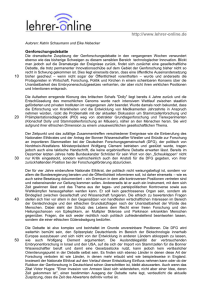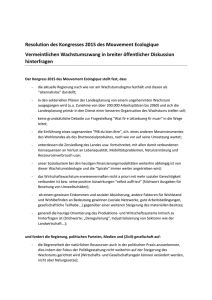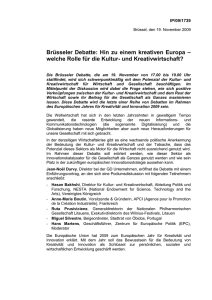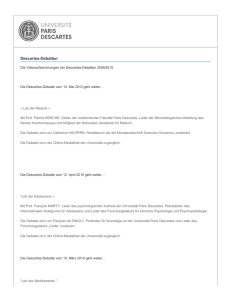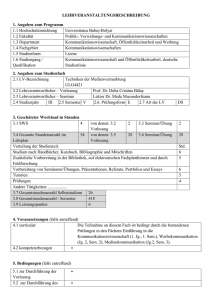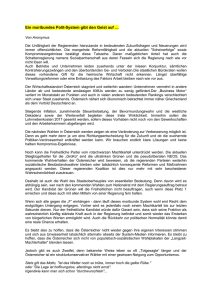Call Allemand
Werbung

Tagung am Centre Marc Bloch, Friederichstr. 191, 10117 Berlin Am 24. u. 25. September 2010 Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule. Demokratien zwischen Autonomie der Institutionen und Mehrheitsprinzip Organisatoren: Olivier Giraud, Centre Marc Bloch CNRS, Berlin [email protected] Carsten Herzberg, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Centre Marc Bloch CNRS, Berlin [email protected] Bruno Jobert, PACTE CNRS / Grenoble [email protected] Sabine Saurugger, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble [email protected] Tagungsziele: Die eifrige Umsetzung von Reformen in Frankreich durch den Präsidenten der Republik hat Kritik an dessen Führungsstil ausgelöst. Die umfassenden Reformen, welche in die Wege geleitet wurden, werfen jedoch eine viel grundlegendere Frage auf: die Frage nach der Legitimität der gewählten Mehrheit in einer Demokratie. In der Tat zielen viele der Reformen von Nicolas Sarkozy darauf ab, die Macht der regierenden Mehrheit in den politischen Institutionen zu stärken. Hauptargument der Befürworter dieser Reformen ist, dass die regierende Mehrheit mit den Mitteln ausgestattet werden muss, welche die Umsetzung ihrer Politik ermöglichen. Die regierende Mehrheit kann –legitimiert durch den Wahlsieg– die Leitung der politischen Institutionen übernehmen und dadurch ihre politischen Ideen umsetzen. So kann beispielsweise eine bestimmte Medienpolitik über die Ernennung eines neuen Fernsehdirektors geschehen, das Handeln der Staatsanwälte durch die Ausgestaltung des Strafrechtes beeinflusst werden oder Abläufe in der Wissenschaft über deren stärkere Anbindung an die politischen Institutionen gesteuert werden. Kritik an den laufenden Reformen wird aus dieser Perspektive umgehend als Infragestellen des Wahlergebnisses gewertet. Eine Regierung wurde nämlich aufgrund eines bestimmten politischen Programms gewählt. Wer sich dessen Umsetzung in den Weg stellt, wird als schlechter Demokrat hingestellt, der aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Minderheit Unrecht hat. Diese permanente Legitimierung politischen Handelns, welche sich aus dem Wahlergebnis der letzten Wahl ableitet, muss hinterfragt werden. Dies aus zwei Gründen: Erstens ist die Annahme problematisch, dass politische Parteien in der Lage sind, die zum Teil sehr unterschiedlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in politische Programme umzusetzen, welche zudem häufig in Konkurrenz zueinander stehen. Problematisch ist weiter das Bild vom Bürger als Person, welcher darauf reduziert wird, dass er in regelmäßigen Abständen bei Wahlen seinen Willen äußert und so geeignetes politisches Personal und klare politische Programme bestimmt. Auch das Bild der politischen Parteien in diesem Modell ist schwierig. Von ihnen wird erwartet, dass sie aus der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger die korrekten Handlungen ableiten können. Diese Annahme ist insbesondere vor dem Hintergrund problematisch, dass die sozialen Institutionen, welche den Parteien jahrzehntelang nahe standen, zunehmend an Bedeutung verlieren (Mair 2009, Mastropaolo 2009, Berger 2006). Politische Programme entstehen anscheinend nicht durch einen induktiven Prozess, in welchen die Erfahrung der Parteimitglieder und sozialen Partner einfließen. Vielmehr haben sie die Funktion eines symbolischen Auftrittes, der darauf abzielt, die Umfragewerte zu verbessern. Auch sind die politischen Programme häufig mehrdeutig und versuchen, die Erwartungen aller Wählerinnen und Wähler zu befriedigen, auch wenn diese widersprüchlich sind. Zweitens gibt es immer wieder Beispiele von Regierungen, der mitten in der Legislaturperiode ihr politisches Programm ändern müssen (Beispiel hierfür siehe Jobert/ Theret 1994). In diesem Fall reicht die Diskussion um politische Programme im Wahlkampf nicht aus, um das politische Handeln der regierenden Mehrheit zu legitimieren. Die Diskussion müsste in diesem Fall zur öffentlichen Debatte werden, in welcher über die möglichen Interpretationen des öffentlichen Interesses debatiert wird. Die Definition davon, was unter öffentlichem Interesse zu verstehen ist, kann nicht der regierenden Mehrheit überlassen werden sondern muss Resultat einer öffentlichen Debatte sein, an welcher auch die Oppositionsparteien teilnehmen. Die öffentliche Debatte soll hier nicht als rationelle Diskussion unter Gleichen (vgl. Walzer 2003) verstanden werden. Vielmehr sollen die Diskussionen und Kontroversen, welche den öffentlichen Diskurs ausmachen, als Ausdruck von Konflikten verstanden werden, die Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen sozialen Positionen austragen. Die Aufgabe der Politik ist nicht die Suche nach Wahrheit, wohl aber das Aufrechterhalten einer legitimen politischen Ordnung, welche vereinbar ist mit einer mehr oder weniger akzeptierten Hierarchie (Mouffe 2005). Die öffentliche Debatte ist nicht nur ein Ort, an welchem konkurrierende Interessen aufeinanderprallen. Vielmehr müssen die beteiligten sozialen Akteure hier ihre Forderungen so kommunizieren, dass das öffentliche Interesse ihres Anliegens deutlich wird. Die öffentliche Debatte hat zwei Funktionen. Einerseits legt sie die verschiedenen Möglichkeiten offen. Die zweite Funktion der öffentlichen Debatte besteht darin, durch Abwägen und Aushandeln eine der Möglichkeiten auszuwählen. Häufig wird die öffentliche Debatte mit dieser zweiten Funktion assoziiert. In dieser fortgeschrittenen Phase des Prozesses werden Entscheidungen in Form von Kompromissen getroffen, welche den politischen Handlungen zugrunde liegen. Häufig wird die erste Phase des Entscheidungsprozesses vernachlässigt, in welcher alle Möglichkeiten ausgelotet werden, in welcher die sozialen Cleavages, die verschiedenen Probleminterpretationen und Gerechtigkeitsprinzipien sichtbar werden. Die öffentliche Debatte muss in dieser frühen Phase die unterschiedlichen Meinungen der Bürgerinnen und Bürger und die Kontroversen zwischen den verschiedenen Parteien widerspiegeln. Die Leitung dieser wichtigen ersten Phase ist grundlegend für das weitere Vorgehen, welches einen Kompromiss zwischen den konkurrierenden Parteien zum Ziel hat. Auch wenn in dieser Phase der Abwägung insbesondere die Vorschläge der regierenden Mehrheit diskutiert werden (da deren Umsetzung wahrscheinlich ist), ist in dieser frühen Phase des Prozesses die Anhörung aller Meinungen und so die Abwägung und Zuspitzung der eigenen Position möglich. Die Autonomie der Foren, in welchen die öffentliche Debatte stattfindet, scheint in dieser ersten Phase des Prozesses sehr wichtig zu sein. Sie gewährleistet die Anhörung möglichst vieler Alternativen, was letztlich auch den Vorschlägen der regierenden Mehrheit zugute kommt. Die repräsentative Demokratie befindet sich in einem Dilemma. Einerseits müssen die mehrheitlich gewählten Volksvertreter die Mittel besitzen, die politischen Maßnahmen durchzuführen, für die sie gewählt wurden. Andererseits kann die Beherrschung eben dieser Ressourcen der regierenden Mehrheit einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Ausrichtung der öffentlichen Debatte und so auf zukünftige Wahlentscheidungen geben. Die Lösung dieses Dilemmas wurde traditionell nicht im Verzicht des Staates auf öffentliche Einflussnahme gesucht, wie das neoliberale Politiker gewünscht hätten, sondern in der Anerkennung der Autonomie der staatlichen Akteure, welche bei der Bewältigung öffentlicher Aufgaben mit der Mehrheit zusammenarbeiten. Diese Autonomie ist im Bereich der Justiz stark institutionalisiert worden, aber sie betrifft in unterschiedlichem Maße auch die wissenschaftlichen Institutionen, die Politikberater und Verwaltungsangestellten, die Foren der gesellschaftlichen Verständigung und ihre Teilnehmer, d.h. soziale Partner und Organisationen der Zivilgesellschaft. Wir wollen im Rahmen dieser Tagung untersuchen, inwiefern der Wandel des Staates dazu führt, dass die Grundlagen dieser institutionellen Autonomie im Namen der Effizienz in Frage gestellt werden. Es stehen dabei folgende Themen zur Debatte: 2 - Die Bürokratien und die öffentlichen Bediensteten Die wissenschaftlichen Foren und die Experten Die sozialen Akteure und die soziale Verständigung Die parlamentarischen Arenen und das Steuerungssystem durch Netzwerke 1. Die Bürokratisierung und Politisierung öffentlichen Handelns Das Vorhandensein einer starken Bürokratie wurde vielfach als notwendiges Gegengewicht zur Einmischung der Politik ins öffentliche Handeln wahrgenommen. Die Idee des „service public“ (Chevalier 2008) ist ein gutes Beispiel für diesen Vorschlag. Es wurde hier versucht, die Autonomie der Berufsstände und Bürokratien zu stärken. Die Wirkung dieser Institution auf demokratische Prozesse soll hier genauer untersucht werden. Haben die begrenzten Einflussmöglichkeiten der Politiker nicht bereits dazu geführt, dass vielmehr die Verwaltungsangestellten und nicht die Politiker selbst öffentliches Handeln gestalten? Diese Schwäche wurde insbesondere von Vertretern des New Public Management immer wieder offengelegt. Ihr Gegenvorschlag besteht darin, öffentliches Handeln in Agenturen zu organisieren. Mit der einhergehenden Strukturierung der Arbeit nach Zielvorgaben wird die Autonomie der Verwaltungsangestellten stark eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass die Planung und Ausarbeitung bestimmter Aufgaben in viel stärkerem Maße von deren Ausführung getrennt verläuft und zusätzlich durch regelmäßige Qualitätskontrollen beeinflusst wird (OECD 2005). In Anbetracht dessen muss der Einfluss dieser umfassenden Reform auf die demokratischen Prozesse untersucht werden. Hier stellt sich die Frage nach dem Einfluss der regierenden Mehrheit auf die Öffentlichkeit, welche durch die Beschränkung der Autonomie der Verwaltungsangestellten sowie die Schaffung von Agenturen möglich wird (Suleiman 2005 , Raadschelders/ Toonen/ Van der Meer 2007 ). Wäre es umgekehrt möglich, die Autonomie der Verwaltungsangestellten als Bedingung dafür zu sehen, damit ihnen im öffentlichen Handeln eine neue Rolle zugeschrieben werden kann? Müsste ihnen nicht anstelle der Rolle von Ausführenden vielmehr die Rolle von Vermittlern zwischen den Bürgern und den Politikern zuteil werden? Diese Vermittlerrolle müßte zwei Hauptaufgaben umfassen. Es geht einerseits darum, allgemeine Richtlinien des Staates in Praktiken des öffentlichen Handelns zu übersetzen. Diese Aufgabe erfordert unter anderem spezifische Kenntnisse der jeweiligen administrativen Prozesse, in welchen die Richtlinien umgesetzt werden müssen. Der zweite Aufgabenbereich betrifft die Vermittlung zwischen Politikern und Bürgern, welche in Zeiten des Rückgangs oder gar der Krise von politischer Repräsentation besonders wichtig erscheint. Ob den Verwaltungsangestellten diese Autonomie zugeschrieben werden kann, hängt entscheidend von ihrer Kommunikationsfähigkeit ab. Sind sie in der Lage, einem breiten Publikum öffentliches Handeln zu vermitteln? Diese hängt wiederum davon ab, welches Recht auf Information den Bürgerinnen und Bürgern zugestanden wird. Werden den Bürgern lediglich die politischen Entscheidungen mitgeteilt oder wird die Öffentlichkeit auch darüber informiert, welche Studien, Evaluationen und Absprachen dem Resultat öffentlichen Handelns zugrunde liegen? 2. Wissenschaftliche Foren und Experten Die Möglichkeit des Machtwechsels in einer Demokratie bedeutet, dass weder die regierende Mehrheit noch andere soziale Kräfte einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf das Urteil der Bürgerinnen und Bürger haben. Die „Demokratie des Publikums“ wie es Bernard Manin in seinem 1996 erschienen Werk nennt, ist nicht das irreversible Resultat einer politischen Entwicklung. Diese Demokratie wird dadurch bestimmt, dass „die Kanäle, über die die öffentliche politische Meinung gebildet wird, sich im Verhältnis zu den Cleavages der konkurrierenden Parteien relativ neutral verhalten.“ Unter Kanälen versteht Manin nicht nur die Medien sondern auch Expertenkreise und foren, welche den Medien ihre Ideen liefern. Es fällt nicht immer leicht zu unterscheiden, ob eine Regierung lediglich ihren legitimen Anspruch wahrnimmt, über staatliche Institutionen ihre politischen Ideen umzusetzen, oder ob sie der Versuchung unterliegt, die staatlichen Institutionen ausschließlich zu ihren Gunsten arbeiten zu lassen. Zwei Fragen, welche mit der Monopolisierung von Expertenwissen sowie der Beziehung der 3 regierenden Mehrheit mit wissenschaftlichen Foren in Verbindung, stehen soll hier nachgegangen werden: Kann die Monopolisierung von Expertenwissen durch die regierende Mehrheit begrenzt werden? Wäre es möglich, Platz zu schaffen für Experten, die von anderen Akteuren (Bsp. Oppositionsparteien oder sozialen Akteuren) bestimmt werden? Wie kann die Veröffentlichung von Expertisen, die von der regierenden Mehrheit in Auftrag gegeben worden sind, erfolgen? Ist durch diesen Vorgang des „Öffentlichmachens“ ein Ausgleich des Vorteils möglich, den die Regierung durch ihre politische Macht hat? Zweiter Fragenkomplex: Kann die vielzitierte Schnittmenge der Einflussbereiche von politischen Entscheidungsträgern und Wissenschaftlern die Suche und/ oder Veröffentlichung von wichtigen Fakten für die öffentliche Debatte behindern? Besteht die Problematik nicht auch in der Exklusion bzw. der Nicht-Beachtung bestimmter Thematiken in der Öffentlichkeit? 3. Die sozialen Akteure Das Risiko der Instrumentalisierung betrifft auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen und sozialen Partner, welche Teil des öffentlichen Handelns sind (Jobert, Kohler Koch 2009). Grund dafür ist, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen weder über eigene finanzielle Mittel noch über andere Unterstützung als die der Regierung verfügen, um den Aufgaben nachzugehen, welche sie sich zum Ziel gesetzt haben. Die traditionelle Autonomie der Institutionen, welche durch die globale Finanzierung von Verbänden gesichert werden soll, konnte nicht verhindern, dass sich die Interessen der jeweiligen politischen Mehrheit mit denen der staatlichen Institutionen verknüpft haben. Auch die Finanzierung von einzelnen Projekten (im Gegensatz zu einer fortlaufenden, projektunabhängigen Finazierung) kann beträchtlichen Einfluss auf den Handlungsspielraum dieser Institutionen haben. Dieses Risiko der Instrumentalisierung wird durch die neoliberale Tendenz in den meisten europäischen Ländern, den Haushalt von sozialstaatliche Institutionen zu kürzen, weiter verstärkt. Zivilgesellschaftliche Organisationen übernehmen zunehmend Aufgaben, die vormals der Sozialstaat geleistet hat. Trotzdem wird deren Rolle als Akteur in der öffentlichen Debatte wenig Wertschätzung entgegen gebracht. Auch der Trend der partizipativen Demokratie ändert nichts daran. Die neuen Instrumente der politischen Partizipation sind oft auf den einfachen Bürger zugeschnitten. Darüber hinaus entscheiden meist die Exekutive, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen an Prozessen der Partizipation teilnehmen dürfen. Auch muss der Einfluss der Teilnehmer an partizipativen Prozessen auf am Ende getroffene politische Entscheidungen kritisch hinterfragt werden (Gaudin 2007 et 2009). 4. Parlament und Netzwerk-Governance Die Entwicklung hin zu einem Governance auf mehreren Ebenen geht einher mit einer Marginalisierung der parlamentarischen Instanzen. Diese werden häufig erst am Ende von komplexen Verhandlungen in den Entscheidungsprozess einbezogen und können darüber hinaus nur noch bereits vorgefertigte Kompromisslösungen zustimmen (Papadopoulos 2008). Die Nachvollziehbarkeit der Arbeit der Exekutive durch die Parlamentsabgeordneten ist dadurch schwierig geworden. Die Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen kann von den Exekutiven somit immer an andere Akteure und Institutionen weitergeschoben werden. Die Suche nach Kompromissen und Konsens lähmt die Bestrebungen der Parlamentarier in ihrer Suche nach möglichen Alternativen. Folge davon sind Unstimmigkeiten zwischen den Insidern des Regierens auf mehreren Ebenen und den Parlamentariern. Letztere sind immer weniger Teil der eigentlichen politischen Entscheidungen und verlagern deshalb ihre Tätigkeit immer mehr auf die symbolische Dimension der Politik. Literatur : Berger, S. (2006): Representation in trouble; in: Culpeper(P), Hall (P) Changing France : the politics that markets make, Houndmills, Palgrave Macmillan, New York. Gaudin, J-P. (2007): La démocratie participative, 128 pA. Colin, Paris Gaudin, J-P (2008): Politiques publiques : dispositifs participatifs et démocratie; in Giraud, O./ Warin Ph.: Politiques publiques et démocratie, la Découverte, Paris. Giraud, O. (2009): De la démocratie de négociation à la démocratie délibérative – débats théoriques et trajectoires nationals; in: revue “Négociations”. 4 Jobert, B./ Theret, B. (1994): La consécration républicaine du néo-libéralisme; in: Jobert, B. (ed): Le tournant neo-libéral en Europe, l’Harmattan, Paris. Jobert , B./ Kohler Koch B. (2009): Changing images of civil society - from protest to governance, Routledge, London. Mair, P. (2009): Representative versus Responsible Government, MPIfG Working Paper 09/8. Manin, B. (1996): Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, Paris. Mastropaolo, A. (2009): A democracy bereft of parties; in: Jobert, B/ Kohler Koch, B.: Changing images of civil society - from protest to governance, Routledge, London, p.32-34. Mouffe, C. (2005): On the Political, Routledge, New York. Papadopoulos, Y. (2008): La gouvernance en réseaux : les conséquences pour la démocratie parlementaire; in: Giraud, O./ Warin, Ph.: Politiques publiques et démocratie, La Découverte, Paris. Fung and Erik Olin Wright [Hrsg.] (2003), Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, Verso Press, London, p.3-42. OCDE (2005): Moderniser l’Etat. La route à suivre, OCDE, Paris. Suleiman, E (2005): Le démantèlement de l’état démocratique, Seuil, Paris. Raadschelders, J./ Toonen, T./ Van der Meer, F. [Hrsg.] (2007): The civil service in the 21st century, Palgrave MacMillan, New York. Walzer, M. (2003): Raison et passion. Pour une critique du libéralisme, Circé, Paris. 5