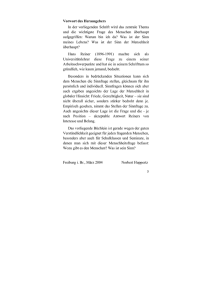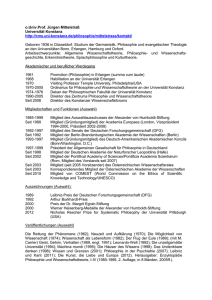Es wird möglicherweise den ein oder anderen unter Ihnen in ein
Werbung

1 Philosophie trifft Architektur Vortrag anlässlich des Zweiten Innenarchitektentags der AK NW 23.04.05, Haus der Architekten, Düsseldorf Dr. Andreas Mussenbrock Münster Philosophie trifft Architektur. Das Motto mag den Eindruck erwecken, als sei dieses Treffen ein Novum, etwas nie da Gewesenes, was sich am heutigen Innenarchitektentag gleichsam sensationeller Weise das erste Mal vollzieht. Dem ist nicht so. Philosophen haben sich immer schon zur Architektur geäußert und Architekten auch immer wieder zu philosophischen Themen. Ihre wechselseitige Verbundenheit liegt offensichtlich darin begründet, dass Architektur - und im Besonderen die Innenarchitektur - nicht nur Ausdruck einer erlernbaren technischen Fertigkeit ist, sondern ganz wesentlich eine künstlerische Begabung und ein ästhetisches Selbstverständnis voraussetzt. Bei der Reflexion des Selbstverständnisses befinden wir uns aber unmittelbar auf dem Gebiet der Philosophie, und so kann es kaum Wunder nehmen, dass Philosophie und Architektur auch eine gemeinsame Historie besitzen, in deren Verlauf sie sich gegenseitig beeinflusst haben. In der Antike äußert sich bereits Platon in verschiedenen Dialogen zur Baukunst, in denen er fordert, dass die Architektur die gebaute Widerspiegelung der besten Erkenntnis sein solle, die Menschen von der Struktur des Universums besitzen. Auf der Gegenseite legt der römische Baumeister und Architekturhistoriker Vitruv seine „Zehn Bücher über die Architektur“ vor, die von dem Streben nach umfassenden theoretischen und praktischen Kenntnissen, die u. a. die Philosophie mit einschließen, getragen sind. In neuerer Zeit steht neben dem kulturphilosophischen Werk „Ursprung und Gegenwart“ von Jean Gebser vor allem der Philosoph Martin Heidegger durch seinen bedeutenden Aufsatz „Bauen, Wohnen, Denken“ für die Begegnung der Philosophie mit der Architektur. Unter den Architekten der Moderne sei beispielhaft auf Sigfrid Giedions Werk „Space, Time and Architecture“ und auf verschiedene Äußerungen von Frank Lloyd Wright zu Raum und Zeit hingewiesen. Besondere Aufmerksamkeit verdient in der aktuellen Auseinandersetzung von Philosophie und Architektur dabei ganz sicher der Transarchitekt Marcos Novak, der mit seinem Essay „TransArchitecture: Transmitting the Space of Conciousness“ unseren bekannten dreidimensionalen Raum sowohl philosophisch wie architektonisch verlässt. „Philosophie trifft Architektur“ ist also kein Treffen, das dem bloßen Zufall geschuldet wäre, als ein punktuelles und einmaliges Ereignis, sondern dieses Treffen möge gesehen werden als eine Fortsetzung einer immer schon statthabenden Begegnung, in deren Kontext sich auch dieser heutige Vortrag verstanden wissen möchte. Architekten wie Philosophen sind Baumeister eigener Art. Während die einen real existierende Gebäude oder andere Baukörper und deren Interieur entwerfen, haben sich die Philosophen gleichsam auf die Konstruktion von Gedankengebäuden verlegt. Zu philosophieren ist dabei eine Tätigkeit, die sich fundamental von allen anderen menschlichen Tätigkeiten unterscheidet. Seit den ersten Atemzügen der abendländischen Philosophie im Griechenland des 7. vorchristlichen Jahrhunderts haben sich die Fragestellungen, die den Menschen umtreiben, nicht wesentlich verändert. Damals wie heute beschäftigen uns Fragen, die auf den Sinn unseres Daseins, auf die Wahrheit, auf den Ursprung von Welt und Mensch, auf das Glück und darauf zielen, was wir überhaupt wissen können. Schon Kant, später Heidegger, meinten all diese Fragen in einer einzigen dramatischen Frage zusammenfassen zu können, nämlich: Warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. 2 Alles Fragen nach der Wahrheit, dem Schönen und Guten, dem Sinn, dem Glück, dem Menschen und seinem Wissen sind letztlich immer auf das Sein als solchem und dessen etwas unheimlich anmutendem Begleiter, dem Nichts, gerichtet. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf die Antwort an, wie es in den konkreten Wissenschaften gefordert wird, sondern vielmehr darauf, dass der Mensch sich in seiner Grundbedürftigkeit immer als ein Fragender nach den ersten und letzten Dingen entdeckt. Denn immerhin: Diese Möglichkeit zur Selbstentzifferung ist die eigentliche Stärke des Menschen und mithin die Stärke der Philosophie. Was macht also den Menschen zu einem Fragenden nach den ersten und letzten Dingen? Offensichtlich dies, dass er irgendwann im Laufe seines Lebens auf ein Problem stößt, das geeignet ist, die scheinbar fraglose Selbstverständlichkeit seines Daseins zu erschüttern. Aristoteles bezeichnet diese Erschütterung, sofern sie den Menschen in ein existenzielles Staunen versetzt, als den Ausgangspunkt der Philosophie überhaupt. Und es scheint in der Tat ein unauslöschbares Bedürfnis des Menschen zu sein, das unmittelbar Gegebene mit immerwährender Verwunderung und Zweifel zu belegen und dabei nicht stehen zu bleiben, sondern darüber hinaus zu fragen. Neben diesem Grundbedürfnis nach Transzendenz gesellt sich ein noch weiteres elementares Bedürfnis, nämlich das nach Schutz und Geborgenheit. Werden die Fragen und Zweifel zu mächtig, so dass sie die Existenz im Ganzen bedrohen, wird er buchstäblich alles unternehmen, um diese Bedrohung abzuwehren. Es kann damit also nicht bei dem bloßen Fragen bleiben; sondern ab einem gewissen Punkt, da die Erschütterungen anfangen, drohende Abgründe aufzureißen, müssen Antworten gleich Fluchtburgen her. Kein Mensch erträgt auf Dauer ein endlos abgründiges Leben, er wird mittelfristig Sorge tragen, den von ihm selbst aufgerissenen Abgrund zu schließen, indem er ihn zu gründen trachtet. Die ersten systematischen Gründungsversuche der Philosophiegeschichte reflektieren denn auch exakt dieses Sicherheitsbedürfnis des Menschen. Platon als der erste große Philosoph des Altertums trägt diesem Bedürfnis Rechnung, indem er ein System entwirft, an dessen Spitze das absolute Sein thront, das als eine Art Urheimat des Menschen präsentiert wird. So sehr das Dasein des Menschen auch in der Ferne von diesem absoluten Sein angefochten sein mag, je näher wir diesem Sein mit Hilfe der Philosophie in der Rückerinnerung kommen, um so gesicherter ist unser Dasein, bis es schließlich in einem letzten Kontemplationsschritt endgültig aufgehoben und gesichert ist im Absoluten. In diesem Sinne dürfte die Philosophie Platons als Therapeutikum schlechthin gegen die Abgrundangst der völligen Grund- und Sinnlosigkeit gelten. Nietzsche wird gut 2500 Jahre später behaupten, dass solche Systeme, wie sie Platon und nach ihm viele andere ausklügelten, lediglich aus einer Schwäche des Menschen heraus entworfen wurden, weil die Menschen eben nicht in der Lage seien, den Grund ihres Daseins in sich selbst zu finden. Diese Unfähigkeit habe sie veranlasst, nach absoluten Gründen zu suchen, die Garantie dafür böten, die als grundlos empfundene und befürchtete Existenz mit daseinstragenden Fundamenten zu untermauern, die gegen alle Anfechtungen immun sind. Und tatsächlich lässt sich so etwas wie ein Grundstreben in der Geschichte der Philosophie ausmachen, das auf unterschiedlichste Weise auf die Klärung immer derselben Frage zielt: Wenn alles vergänglich erscheint, was können wir angesichts dessen als das Unvergängliche, zeitlos Währende ansetzen? Was ist es, das meinem und dem Dasein überhaupt Grund und Sinn verleiht? So kann Philosophie begriffen werden als eine Architekturgeschichte, und zwar als Gründungsakt von Seinsfundamenten, auf denen gegründet wird das Haus des Seins, in dem der verunsicherte Mensch Wohnung bezieht. Konzentrieren wir uns nun einen kurzen Moment auf dieses Doppelbedürfnis des Menschen - und zwar: nach Transzendenz einerseits und nach Gründung andererseits - so finden wir dessen Niederschlag nicht nur in der Konstruktion philosophischer Systeme, sondern 3 selbstverständlich auch in der Bau- und Architekturgeschichte. Schon die Grundbedeutung des Wortes Architektur macht diesen Zusammenhang deutlich: Aus dem Griechischen entlehnt bedeutet arche soviel wie der Anfang, die Ursache, der Grund, und tegos das Dach. Das zugrunde liegende Verbum von tego heißt stego und meint soviel wie decken, bedecken, verbergen, schützen; aber auch erzeugen, hervorbringen. Das Wort Architektur in seine Grundbedeutung zurückübersetzt heißt also das Erzeugen oder Hervorbringen eines Grundes als ein schützendes Dach. Die Architekturgeschichte ist mithin eine Geschichte der menschlichen Schutzburgen, mit denen sich der Mensch samt seinen ideellen und materiellen Werten einen sicheren Ort und Ausgangspunkt erschaffen hat. Dies dokumentiert anschaulich jede historische Epoche bei nahezu allen Völkern, egal ob wir dabei an die gigantesken Grabkammern des pyramidalen Monumentalbaus im alten Ägypten, an den Tempelbau der Antike, an die sakrale Kathedralarchitektur des Mittealters, an die profanen Burgen- und Palastbauten der Neuzeit oder an die Konsum- und Eventtempel der Postmoderne denken. Allen Architekturen liegt dieses Grundbedürfnis des Menschen zu Grunde, ein Dach über dem Kopf zu haben, um gegen die Unbilden der Natur den Zorn Götter oder nur vor seinesgleichen geschützt zu sein. Das Bedürfnis, ein Dach über dem Kopf zu haben, reflektiert aber nicht nur die Grundbedürftigkeit des Menschen nach Schutz und Geborgenheit, sondern auch seine Methode, wie er glaubt, diesen Schutz effektiv errichten und dauerhaft aufrechterhalten zu können. Zu Zeiten, als die unberechenbaren Naturgewalten noch als Ausdruck eines unbändigen Gottes verstanden wurden, trägt jede sakrale Bautätigkeit der Überlegung Rechnung, wie es möglich sein könnte, den Zorn der Götter irgendwie zu besänftigen. Altäre wurden errichtet, auf denen man Geschenke und Opfer darbrachte. Im Laufe der Zeiten wandelten sich die simplen steinernen Altäre in gigantische Bauwerke, die immer gewaltiger und immer höher in den erschreckenden und faszinierenden Himmel der Frühzeit hineinragten. Kein Opfer erschien als zu gering, je mehr die Kulturleistungen im Zuge zunehmender Sesshaftigkeit begannen, Fuß zu fassen. Architekturgeschichte jener Zeit kann auch gelesen werden, als ein architektonischer Beschwichtigungsversuch eines ewig zürnenden Himmels. Bauwerke wuchsen gleich monumentalen Ausrufezeichen gen Himmel als Dokument von Opferbereitschaft und Bußfertigkeit eines auf den Tod hin verängstigten Menschen. - Wir wissen, wie groß die Verzweiflung eines Menschen sein kann, wenn sein Opfer abgelehnt wird, darüber belehrt uns bereits anschaulich die alttestamentliche Geschichte des Bruderpaares Kain und Abel. Während nämlich die Rauchsäule des Abelschen Brandopfers von günstigen Winden befördert in den Himmel steigt, sieht Gott das Opfer seines Bruders Kain nicht an. Für Kain ist dies eine einzige Katastrophe, weiß er doch, dass das verschmähte Opfer einem Todesurteil gleichkommt. Ohne den Beistand Gottes ist er praktisch verloren. In Todesangst erschlägt er seinen Bruder Abel, um so in seiner Hilflosigkeit eine Urteilsrevision zu erzwingen. Um sich fortan nicht mehr auf unwägbare Winde verlassen zu müssen, sind himmelweisende Bauwerke entstanden - gleich in Stein erstarrten Rauchsäulen eines archaischen Brandopfers. Aus jedem dieser Bauwerke fleht der bedrohte Mensch seinen Gott um Wohlwollen und Gnade an, „schone mein Hab und Gut, meine Weiden und Äcker, meine Ernten und Herden, schone mein Weib und meine Kinder, einen Tempel werde ich dir, o Gott, bauen, größer und gewaltiger noch als alles zuvor Gebaute und dabei keine Mühe und keine Opfer scheuen. In diesem Tempel - nur deiner würdig - werde ich Dir darbringen von dem Wertvollsten meines Hab und Gutes“. So in etwa dürfen wir uns die Wortübersetzung flehentlich himmelwärts gerichteter Hände als deren architektonische Steinkomposition vorstellen. Himmelwärts gerichtete Bauwerke weisen aber nicht nur aus den Niederungen des menschlichen Daseins in die all erhabenen Höhen der Gottheit, sondern sie weisen auch vom Himmel auf die Erde zurück. Modern ausgedrückt, bedeutet dies die Etablierung von 4 Architektur in Form eines dialogischen Kommunikationsprinzips, und zwar so, dass Gebete und Opfer nicht monolinear in den Himmel geschickt wurden, in dem zu fürchten war, sie könnten ungehört verhallen; sondern mit dem Bauwerk sollte der Gottheit gleichzeitig ein würdiger Weg gewiesen werden, aus seinen himmlischen Gefilden auf die Erde hinab zu steigen. So verstehen sich Bauwerke gleichsam als dialogische Interaktion in Gestalt bidirektionaler Transportmedien, in denen sich die Gottheit in seiner Niederkunft manifestiert. Durch diese Manifestation war ein exorbitanter Machtzuwachs des Bauwerkes selbst garantiert. Indem der Gottheit eine Heimstatt geboten wurde, versicherte sich der Mensch seiner Nähe, in der er hoffen durfte, dass die göttliche Macht auf ihn selbst überspringen werde, um ihn fortan nicht nur vor jeglichem Ungemach zu bewahren, sondern auch als eine Art medialer Akku jene Kräfte zu infusionieren, die ihn befähigen sollten, sein Schicksal zu mindest teilweise selbst in die Hand zu nehmen, ohne dass ihm dabei – ob seiner vermeintlichen Anmaßung und Hybris - Strafe droht. Wir finden Spuren dieser Praxis heute beispielsweise in der Eucharistiefeier der katholischen Kirche, in der durch Opfer von Brot und Wein der Heilige Geist herab gerufen wird, um eine Wandlung des Opfers in Leib und Blut Christi zu bewirken, der dann in einer rituellen Zeremonie der Gläubigen einverleibt wird. Bauwerke mit Höhenrichtung sind architektonische Einladungsgesten, in denen die Hoffnung Stein geworden ist, das Numinose möge sich aus sonst unerreichbaren Gefilden zu den Sterblichen hinunterbeugen und Einzug halten in seine ihm errichtete Wohnstatt. Der Selbstbefestigungsversuch des Menschen findet hierin einen vorläufigen Höhepunkt, indem sein Gründungsversuch durch die unmittelbare Verbundenheit mit seinem Gott vorerst als gelungen betrachtet werden kann. So geborgen in der Nähe Gottes fühlt der schutzbedürftige Mensch einen Boden unter den Füßen und ein Dach über seinem Kopf, in dem er das Himmelszelt in Kuppeln und Wölbungen in greif- und sichtbarer Nähe über sich aufspannt und es auf mächtigen Säulen und Fundamenten sicher in den Gründen seiner Heimat ruhen lässt. „Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen“, dichtete 1529 der in große Bedrängnis geratene Martin Luther auf der Wartburg, wohin er als Junker Jörg vor den päpstlichen Häschern geflohen war. Kaum treffender wurde je in einer Liedzeile der Anspruch Gottes mit einem Bauwerk parallelisiert. Die Burg als der Garant der bergenden Geborgenheit, eine Festung, in der der bedrohte Mensch sich gleichsam selbst befestigt und so Halt finden kann, was ihm gleichzeitig die Mittel an die Hand gibt, sich gegen nahende Gefahren zur Wehr zu setzen und damit über sich hinaus schaffen zu können. Luther versetzte es bekanntermaßen in den Stand, mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche sein Lebenswerk vorzulegen. Seine Liedzeile ist auch deswegen so treffend, weil in ihr prägnant auf den Punkt gebracht wird, worum es neben allem Schutzcharakter von Bauwerken auch noch geht. Es reicht nämlich eben nicht über das Bauwerk bloß eine Verbindung in den Himmel herzustellen, um damit dem Sicherheitsbedürfnis Genüge zu tun, sondern das Bauwerk selbst ist aufgrund dieser machtzuwachsenden Verbundenheit gleichermaßen eine wirkungsvolle Waffe. Sie ebnet den gefährlichen Weg nach oben, dorthin, wo es etwas zu entdecken gibt. Alle himmelwärts strebenden Bauwerke sind immer auch Symbol des menschlichen Strebens, seine Augenhöhe im baulichen Schaffen gleichsam grenzenlos zu potenzieren. Höhe ist in diesem Sinne gleich Macht. Wer am höchsten bauen kann, der ist der Mächtigste weit und breit. Weil er wie kein anderer den Überblick hat, gottgleich thront er über seines Gleichen und kann alles und jeden sehen wie auch schon aus großer Entfernung abschreckend gesehen werden. Die babylonische Sprachverwirrung als göttliche Strafaktion gegen derlei Aufsässigkeit und Anmaßung konnte dem menschlichen Höhenstreben offensichtlich keine wirkungsvollen Grenzen setzen. Immer höher hinaus musste gebaut werden bis in unsere heutige Zeit hinein, in der eine wahre Gigantomachie unter den Menschen und Völkern um das höchste Gebäude geschlagen wird. 5 Damals wie heute handelt es sich bei dieser Form von höhengerichtetem Bauen um sakrale Anbetungsformen, in denen lediglich die Namen gewechselt haben. Während die Babylonier durch eine Oberpriesterin im obersten Stockwerk eines siebenstöckigen Tempelturmes die alljährliche „Heilige Hochzeit“ mit dem Gott Marduk feierten, priesen später die Griechen ihren Boss der Bosse im Zeustempel hoch oben in Olympia, der sodann von den Christen in heiliger Dreifaltigkeit als Gottvater, Sohn und heiliger Geist in himmelsstürmenden Kirchen angebetet wurde. Aus der heiligen Dreifaltigkeit, so könnte man meinen, ist heute die Trinitas von Kapital, Konsum und Konjunktur geworden, die in den Tempeln und heiligen Bezirken der Postmoderne sakralisiert wird. Ein Blick auf die Finanzdistrikte der Großstädte, die emphatisch als Weltstädte verheiligt und gefeiert werden, mag dies anschaulich verdeutlichen. In diesem Sinne ist die Reaktion der Vereinigten Staaten von Amerika auf den Anschlag vom 11. September psycho-philosophisch durchaus nachvollziehbar, ging es doch bei diesem Angriff um nichts geringeres als um eine terroristische Kastration des Allerheiligsten, eine Schändung des heiligen Bezirks zugleich, ein unverzeihlicher, nie da gewesener Tabubruch, der im Laufe der Menschheitsgeschichte stets mit dem Tod des Frevlers beantwortet wurde. Und es nimmt damit wenig Wunder, dass im folgenden Krieg aus luftigen Höhen getötet wurde, eben aus jener Dimension, aus der allein der Verlust an Höhenmacht und Machthöhe kompensiert werden konnte. Wie vergänglich und fragil die Insignien der Macht jedoch sind, das wissen wir übrigens nicht erst seit dem 11. September, sondern diese Tatsache zählt zum existenziellen Grundbestand menschlichen Wissens seit jeher. Und mit dem Einbruch der Zeit in den Raum verschärft sich dieses Wissen weiter bis zur Unerträglichkeit. Denn allein die Tatsache, dass wir uns in jedem Augenblick in einer fließenden Gegenwart befinden und dass der soeben verflossenen Moment für immer verloren ist, flößt uns einen ungeheuren Schrecken ein. Nihil pro aeternitate – nichts ist für die Ewigkeit, alles ist vergänglich und hat die Tendenz, jeden Augenblick in den Abgrund des Nichts zu kippen. Mit jedem Atemzug, den wir tun, sind wir einen Schritt näher an diesen Abgrund herangetreten, bis er uns schließlich verschlingen wird. Diese Abgrundangst, als horror vacui beschrieben, ist eine der mächtigsten Triebfedern menschlichen Handelns. „Exegi monumentum aere perennius – ich habe ein Monument errichtet dauerhafter als Erz“ ruft der lateinische Dichter Horaz in seinen Oden aus. Gemeint hat er selbstverständlich seine eigene Dichtung, mit der er glaubte, sich gleichsam ein Denkmal gesetzt zu haben, das den Zeitläufen dauerhaft trotzen werde. Exemplarisch spricht sich in diesen Zeilen aus, welches Mittel dem Menschen als probat erscheint, sich der Vergänglichkeit allen Seins entgegenzustemmen, nämlich kein geringeres Mittel als die Ewigkeit selbst. In jeder Dichtung, in jeder Philosophie, ja in jedem Bauwerk manifestiert sich der Protest des Menschen gegen das Nichts. Der Mensch ist nicht bereit, sich lediglich als Opfer jenes allgefräßigen Abgrundes zu verstehen, sein Denken und Handeln lässt ihn zum Täter werden, der etwas Endgültiges schaffen will. Ich will Sie keineswegs provozieren – aber: Wir erleben diesen Willen zum Absoluten nirgends so deutlich ausgeprägt wie in der Philosophie und der Architektur. Beide sind damit in gewisser Weise von derselben Tragödie betroffen, in die jedes Streben nach dem Endgültigen, Ewigen, Absoluten früher oder später immer geraten muss. Es bleibt uns nämlich in diesem Protest gegen die Vergänglichkeit die Erfahrung nicht erspart, dass alles Wissen, das wir dem Himmel in unserem Vorwärts- und Aufwärtsdrängen zu entreißen suchen, immer auch dazu führt, die Bodenhaftung zu verlieren. Immer höher, immer weiter wurde gebaut, gedacht und geforscht. Der Glaube war und ist vorherrschend, dass umso mehr ich um die letzten Geheimnisse weiß, die besten Chancen habe, der Ewigkeit teilhaftig zu werden und somit nicht sterben 6 muss. Jeder Fortschrittsgedanke, egal in welche Richtung das Fortschreiten dabei verläuft, zollt diesem Glauben Tribut. Die perhorreszierende Vergänglichkeitserfahrung im bloßen Hier und Jetzt lässt uns immer wieder unsere Gegenwart in alle Himmels- und Geistesrichtungen fliehen. Aber: Diese Flucht kommt dabei dem Versuch gleich, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Auf der Suche nach dem absoluten, ewigen Sein begeben wir uns zwangsläufig in eine Dynamik, die durch ihren virulenten Bewegungscharakter gerade dem widersprechen muss, was wir suchen. Denn wir geraten dabei in eine systemimmanente Verstrickungsspirale: Die Heimatlosigkeit des modernen Menschen darf heute geradezu als Konsequenz dieser über Jahrtausende betriebenen Widerspruchsdynamik verstanden werden. Anstatt das Sein, das Bleibende gefunden zu haben, machen wir die Erfahrung, dass wir, um Bleibendes zu finden, immer schon aufbrechen müssen, also gerade nicht bleiben können. Das Bleibende lässt sich im bloßen Bleiben offensichtlich gar nicht entdecken, und so machen wir uns trotzig auf den Weg, das Bleibende gerade im Nichtbleiben zu ergründen. Dieser Widerspruch setzt uns aber noch viel existenzieller der Grundlosigkeitserfahrung unseres Daseins aus, als sie im bloßen Verharren schon ohnedies über uns hereinbricht. Tragischerweise ist aber auch das bloße verharrende Bleiben keine mögliche Alternative. Denn auch so würde die Zeit in Form von Bewegung auf uns zugreifen. Es bleibt uns somit nur die Wahl zwischen rein passivem Erleiden von Bewegung oder uns aktiv in diese Bewegung hineinzubegeben, um uns an ihr gestalterisch zu beteiligen. Bauen und Denken als schöpferische Akte reflektieren beide die Angst des Menschen vor und dessen Revolte gegen die Leere und das Nichts. Bau- und Denktätigkeit beschreiben den Weg vom Chaos zum Kosmos. Die frühen Mythologien der Völker schildern uns in ihren Ursprungsvorstellungen immer wieder diesen Weg, wie aus dem schieren Nichts unvermittelt die Schöpfung als ein ordnungsstiftender Akt hervorbricht. In gewisser Weise sind wir diesem Mythologem nie entronnen, indem wir quasi mit jedem Bauen und Denken den primären Schöpfungsakt ableitend wiederholen. Der tragisch fundamentale Unterschied zwischen unserer Wiederholung und dem Original besteht indes darin, dass wir immer nur gegen das Nichts, niemals aber aus dem Nichts schöpfen können. Wir sind so gesehen in einer notwendig misslichen Lage. Der Kampf gegen das Chaos, das Wort bedeutet im Altgriechischen so viel wie die Leere, das schiere Nichts, erzeugt den Kosmos und mit ihm seine beiden Strukturkomponenten Raum und Zeit. Während von alters her die Auffassung galt, Raum und Zeit seien konstante, vom menschlichen Bewusstsein und Handeln unabhängige Größen, wissen wir spätestens seit Einstein um die Relativität von Raum und Zeit. Die Virtualität von Chatrooms und CyberSpaces demonstriert diese Relativität im Sinne des Raumes mehr oder weniger anschaulich. Im Sinne der Zeit dürfen wir uns von der Auffassung verabschieden, sie vollzöge sich als lineares, kontinuierliches Analogon, dem der Mensch in seiner Entwicklung dauerhaft und notwendig unterworfen ist. Moderne Biotechnologien werden mit ihren Klontechniken alsbald dafür sorgen, die als natürlich empfundenen Geschlechterfolgen umzukehren, so dass der Vater gegenüber dem Sohn nicht mehr notwendig der Frühere sein muss. Das weltbekannte Klonschaf Dolly war in dieser Hinsicht wirklich erst der Anfang. Im Zuge und im Sinne der Zeit mag dies als ein Ausdruck dafür gelten, dass unsere klassische Differenzierungskompetenz in scheinbar glasklaren Begriffen wie früher und später, gestern und morgen, Ursache und Wirkung, nicht länger hinreichend sein wird. Noch allerdings schlägt sich unser Drang vom Chaos zum Kosmos weiterhin in unserer kreativ-schöpferischen Mobilität nieder, die sich praktisch als Entfernung und Fülle der Objekte manifestiert. Je mehr sich jedoch dabei das Ding in der Dynamik seiner Schöpfung vom Schöpfer entfernt, umso tiefer gerät der Bruch zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Mensch und Ding. Es entsteht eine zusehends unüberbrückbare Disparität. Denn der Aufbruch des Raumes bei gleichzeitigem Einbruch der Zeit ist die unvermeidliche 7 Konsequenz der Individuation des menschlichen Subjekts in eine schmerzlich anwachsende Vereinzelungsgeschichte. Und schlimmer noch: Dieser Bruch markiert wesentlich die Spaltung von Mensch und Raum-Zeit. Die ständige Suche nach dem Nukleus hysterisiert die Teilung, die sodann Ausdruck eines völlig verausgabten Menschen ist, der im wegschreitenden Fortschritt sogar die Entselbstung in Kauf nehmen muss. Alles Innen gerinnt sodann entfremdet zu einem bloßen Außen, mit dem eine dauerhaft erfüllende Identifikation nicht gelingen kann. Dabei zeigt sich, dass bloße Dingfülle eben keine Seinsfülle ist, solange das Ding lediglich Resultat einer entfremdenden Entgrenzung ist. So scheitert die Selbstidentifikation über die Vorstellung, weil diese im zunehmenden Vor des Stellens in ein sinn- und seinentstellendes Wegstellen gerät. Das so Weggestellte aber versagt seinen Dienst als Medium einer Identifikation des Menschen mit sich selbst. (Mir ist klar, dass ich Sie auf eine harte Probe stelle, aber der Philosoph darf nicht nur Artigkeiten aufsagen, sondern muss den Befund schonungslos erheben.) Entgegenwärtigt und heimatlos, vertrieben im Zustand postpostmoderner Selbstlosigkeit haben wir das Haus des Seins längst verlassen und irren in gestellten Welten anachron als virtuelles Digital durch Netze, in denen es kein Halten gibt. Die Dynamik des spaltenden Wegstellens hat einen Zwangscharakter angenommen, die das je von uns Weggestellte in eine Autonomie entlässt, in der sich die blanke Diktatur der Dinge etabliert hat. Wie hypnotisiert verdingt sich der Mensch nun zu Diensten der Dinge. Dabei scheint die Gleichung nicht aufgegangen zu sein, dass ein Mehr an Wissen ein Mehr an Sicherheit bedeutet, weil schon lange nicht mehr gilt, dass Wissen Macht ist. Zumindest nicht im Sinne einer Ermächtigung des Subjekts. Die Machtproduktion durch Wissen hat zu einem disproportionalen Machtzuwachs der Dinge geführt. Wissen produziert heute vornehmlich die Autarkie der Dinge, die so ihrerseits die Enteignung des Menschen vorantreiben. Dies gipfelt im Bemühen, der prinzipiellen Bedingtheit seiner Existenz zu entfliehen; so hat der Mensch mit der Austreibung allen Bedingtseins begonnen, mit dem Ergebnis, sein jeweiliges Außen umfänglich erstickend zu bedingen. Diese Verschiebung der Selbstbedingung lässt allererst den Kosmos der Dinge als Spaltprodukt dieser Verschiebung entstehen. Tragischerweise erlöst sie den Menschen nicht von seinem Bedingtsein, sondern lässt ihn im Gegenteil in der Entäußerung auf die Dinge verwahrlosen. Außer Haus im bloßen Herrschaftsbereich der Dinge hat er gleichsam seine Hausmeisterschaft aufgegeben und sich dem Fremddiktat der Dinge unterworfen. Der Umgang aber mit den Dingen bestimmt den Reflex der Dinge auf uns selbst. Der Mensch verfällt dabei der Dynamik des geschöpften Dings und nimmt so selbst Dingcharakter an. Der Umgang mit den Dingen als produkt- und konsumqualifiziert verdingt uns selbst, so dass wir als Opfer unserer eigenen Verdinglichung selbst gezwungen sind, uns produzierend gleichzeitig zu konsumieren. Dies ist eine der wesentlichen Gründe für die Erschöpfung des Menschen am Anfang des dritten Jahrtausends. Es geht hier um das Resultat eines dauerhaften Überforderungsprozesses, der in seiner Selbstreferenz Vakua produziert die aufs Neue nach Sättigung verlangen und so notwendig den Negativdruck des Vakuums verstärken. Bloßes Anfüllen bedeutet so verausgabende Entleerung, in der nichts mehr gilt. Die ethischen Unsicherheiten und der Verlust stabiler Werte sind deutlicher Ausdruck gescheiterter Erfüllung. In diesem Sinne kann es kaum Wunder nehmen, dass heute in den westlichen Industrienationen Depressionen als Volkskrankheit die Hitliste der Erkrankungen anführen. Die Produktion von Antidepressiva hat sich allein in den letzten Jahren verzehnfacht. Die Gleichung ist einfach und erschreckend zugleich: Jedes Mehr an Produktion erzwingt ein Mehr an Konsum und umgekehrt: je mehr Konsum desto mehr Produktion. In dieser Dialektik verzehrt sich der Mensch selbst, der nun seinerseits von den Dingen produziert und konsumiert wird, sofern er sich in Produktion und Konsum verdinglicht hat. Die Auszehrung 8 mit begleitendem Verlust allen Sinns und aller Werte ist exakt das Krankheitsbild, was unter dem Begriff der Depression subsumiert wird. Die völlige Entgrenzung des Subjekts, die sich u. a. in so etwas wie der Globalisierung manifestiert, lässt auf Dauer jede abgrenzende Bestimmung zusammenbrechen, worin die Unfähigkeit des modernen Menschen begründet liegt, nicht nur den Wert und den Sinn seines Lebens zu definieren, sondern auch und gerade den Ort seines Daseins zu bestimmen. Die Zwangsentgrenzung des Daseins führt zum Verlust jedes Daseinsortes. Wo es keine Grenzen mehr gibt, wird der Begriff des Daseins sinnlos. Wenn wir allerdings nicht da zu sein verstehen, wenn wir überhaupt den Bezug zu dem jeweiligen Da unseres Seins verloren haben, indem wir immer schon auf die Dinge hin und deren Schatten weg sind, gehen wir gleichzeitig der Konkretionskompetenz in der Aktualität des Da verlustig. Was soll das heißen, die Konkretionskompetenz in der Aktualität des Da? Übersetzen wir dieses Begriffsungeheuer ganz einfach, nennen wir es „Wohnen“. Die verausgabende Entgrenzung des Menschen macht nämlich auch vor seinen Wohnungen nicht Halt. Seine Unfähigkeit, da zu sein, bedingt den Verlust an Wohnkompetenz. Um es zu radikalisieren: Wer den Ort seines Daseins nicht finden kann, wird im eigentlichen Sinne niemals Wohnung beziehen können. Das Wohnen selbst ist unter die Herrschaft der Dinge geraten, und somit in eine Funktionalität, die wesentlich und dies nicht nur im ökonomischen Sinne durch Produktion und Konsum bestimmt ist. Heute ist das Diktat des Erleben-Müssens in die Wohnungen eingezogen. Die Wohnung wird zum Erlebnisraum schlechthin stilisiert, in dem Leben als Event stattfinden soll und bewusst inszeniert wird – eine ganze Zeitschriftenbranche lebt beispielsweise davon. Die Küche ist nicht mehr einfach hin Herd und Hort, heute muss dort Erlebniskochen zelebriert werden. Wohnen zu Hause soll wie das Wohnen in der Welt zu einem Event werden. Ein Event, indem es stattfindet schon das nächste fordert. Ein auf Dauer zermürbendes Vital-seinmüssen als nicht enden wollender Erlebniskrieg gegen die Langeweile. Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal formulierte schon vor 350 Jahren treffend, dass alles Unglück des Menschen daher stamme, dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in einem Zimmer bleiben zu können. Wir Heutigen befinden uns in einer Ruhe- und Rastlosigkeit, die uns von einem Event zum nächsten peitscht. Das Wohnen selbst hat dabei den Charakter des Getriebenseins angenommen: „Wohnst du noch, oder lebst du schon.“ - Treffender ist die Botschaft kaum zu formulieren: Was noch ist, ist wertlos angesichts des Kommenden. Das Wörtchen „noch“ als Umschreibung eines Bleibenden, Verharrenden hat ausgespielt, wer noch irgendwo ist, der gehört da herausgerissen in die Plötzlichkeit des „schon“. Wer schon irgendwo ist, ist dem, der noch irgendwo ist, um entscheidende Längen voraus. Schon zu sein das ist das Leben, das über alles Noch-Seiende triumphiert. Der ewige Sprung vom Noch ins Schon ist dabei Ausdruck einer seelenlosen Athletik, deren monotones Glaubensbekenntnis sich in den Begriffen Mobilität, Flexibilität, Agilität und Vitalität ermüdend repetiert. Die Szene erinnert an die Geschichte vom Hasen und Igel, die zum Wettlauf angetreten sind: „Ach“, denkt sich der Hase, „ein Leichtes wird es mir sein, diesen lahmen Igel ohne jede Anstrengung um Längen zu schlagen“. Der Hase rennt also los zum vereinbarten Ziel und findet zu seinem Erstaunen den Igel dort bereits vor, der ihn mit den Worten empfängt: „Bin schon da.“ – „Nanu“, denkt der Hase, „da muss ich wohl in der nächsten Runde einen Gang zulegen“. – Rennt los, und wieder empfängt ihn der Igel frech und höhnisch: „Bin schon da.“ Das Ende vom Lied ist tragisch und komisch zugleich: Der Hase hetzt sich in der Unerträglichkeit des eigenen Noch getrieben von dem Schon des Igels zu Tode. Dass es gerade das Noch gewesen wäre, das ihn hätte retten könne, diese Erkenntnis muss unserem armen Hasen versagt bleiben. Der Igel aber und sein Kumpel sind noch immer am selben Ort und dürfen einen Hasen beobachten, der sich zu Tode hetzt. 9 „Wohnst du noch, oder lebst du schon?“ - Dieser Slogan, als wort gewordener Reflex der menschlichen Grundsituation unserer Zeit, erwartet von uns, dass wir immer wieder auf denselben Trick reinfallen. Allein sein offenbar durchschlagender Erfolg macht deutlich, wie sehr sich diese Erwartung erfüllt hat. Die suggerierte Überlegenheit des Schon gegenüber dem Noch drückt sich exemplarisch bekanntermaßen in immergleich strukturierten Phrasen aus: Hast oder bist du schon, oder etwa noch nicht? Noch immer die alte Küche, noch immer die alte Einrichtung, noch immer die alte Wohnung, noch immer in derselben Beziehung, noch immer dieselbe Wahrheit? Es gehört schon ein gerüttelt Maß an Selbstbewusstsein dazu, einfach hin antworten zu können: „Ja, immer noch.“ Eine Antwort, die sich der verheißungsmetaphysischen, wohnindustriellen Widerspruchssuggestion zwischen Wohnen und Leben nicht beugt. Was können wir also tun, um aus der mörderischen Hase-Igel-Dialektik auszusteigen? Sofern wir dies überhaupt wollen: Möglicherweise kann uns hier die Philosophie wenn auch nicht gleich die Lösung, so doch einen Wink geben. Gnothi seauton, Erkenne dich selbst – diese Forderung fand sich eingemeißelt über dem Eingangsportal des Apollontempels zu Delphi. Viele Architekten wissen dies. Sie gilt seither als eine der beständigsten Grundforderungen der Philosophie überhaupt. Dabei hielt man das Nachdenken über sich selbst für das geeignete Mittel, der Selbsterkenntnis teilhaftig zu werden. Wer sich selbst erkennen möchte, ist aufgefordert, über sich selbst nachzudenken. Warum aber sollte das Nachdenken über sich selbst mit dem Ziel der Selbsterkenntnis dazu angetan sein, die entgrenzenden Existenzdynamiken positiv zu boykottieren? Was hätten wir Heutigen angesichts unserer Ängste und Probleme davon, wenn wir über uns nachdächten? Und weiter, selbst wenn das Nachdenken über uns selbst irgendetwas zur Lösung moderner Herausforderungen beitrüge, fordert dieses Nachdenken nicht gerade etwas, was wir heute gerade nicht haben? Meine Vorliebe für das Altgriechische haben Sie schon kennen - und ich hoffe schätzen gelernt; deshalb gestatten sie mir noch einen kurzen begrifflichen Ausflug ins sonnige Hellas: Hesychia nannten es die alten Griechen, was wir mit „Muße“ übersetzen. Nachdenken über sich selbst fordert Muße, bedarf der Zeit. Und das, wo sich heute der Wert eines Menschen gerade darin zu bemessen scheint, wie wenig Zeit er hat. Denn es gilt doch: Je weniger Zeit jemand hat, umso wertvoller und wichtiger ist dieser Mensch. Und wer gar keine Zeit mehr hat, ist sowieso der wichtigste und wertvollste. Wer dagegen viel Zeit hat – heute sind das weitgehend die Arbeitslosen – sinkt in Wert und Wichtigkeit sogleich dramatisch, sowohl vor sich selbst, wie vor denen, die keine Zeit haben. - Beide allerdings tun im Grunde genommen dasselbe. Hier ist nur scheinbar ein Widerspruch: Beide schlagen ihre Zeit tot im wahrsten Wortsinn. Der eine im überfordernden Zuviel an Zeit, der andere in der entgrenzenden Abwesenheit von Zeit. Beide tun wesentlich nichts anderes, als die Zeit zu vertreiben, mit dem Resultat, ihre Gegenwart zu verlieren. Denn wer Zeit nur vertreibt, beraubt sich notwendig seiner Gegenwart und insofern seines Gegenwärtigseins. Mit einer letzten Frage möchte ich das Ende meines Vortrages einleiten: Was aber könnte uns die Selbsterkenntnis im Zuge des Nachdenkens über uns selbst bringen? Nun, vielleicht so etwas wie eine Gewärtigung. Eine Gewärtigung dessen, dass dies jetzt meine Zeit, dass dies hier mein Raum ist, in dem ich jetzt da bin. Nachdenken konstituiert exakt jenen Zeit-Raum, in dem ich bleibend anwesend sein kann. Dieses bleibende Anwesen als Erfahrung meiner eigenen Gegenwart ist gleichzeitig die Erfahrung von Bleiben-Können. Architektur und Innenarchitektur ist Nachdenken und schafft so eine Bleibe, die das Wohnen als Anwohnen allererst ermöglicht. In diesem Sinne heißt Nachdenken Anwohnen. Meine Botschaft ist: Wir haben heute das Wohnen in dem Maße verlernt, wie wir das Nachdenken verlernt haben - und zwar verlernt im entgegenwärtigenden Zeitvertreiben. 10 Selbsterkenntnis ist in diesem Sinne vor allem Selbstgewärtigung, die wahrheitsstiftend wirkt. Dabei wird es nicht mehr um Wahrheiten aus den Großhirnen irgendwelcher brillanter Vordenker zu tun sein, die unerreichbar in eisigen Höhen thronen; wahrheitsstiftende Selbstgewärtigung wird zunehmend so verstanden werden müssen, dass der Aspekt des Wahrenden der Wahrheit in den Vordergrund rückt. Schätze man diese Überlegung nicht gering und riskiere den zweiten Gedanken hierfür: Gewärtigung als Gegenwartserfahrung stiftet Wahrheit, insofern sie den Menschen wahrt, bewahrt, schützt und schont. Nachdenken als selbstgewärtigendes Wahrheitstiften begreift das Sein erst als Dasein. Erst in der Gewärtigung ereignet sich Gegenwart als Selbstverortung des Menschen, in der allein begriffen werden kann, dass das Dasein kein Ziel als solches hat, was allererst noch erreicht werden müsste. In sofern es kein Ziel als solches hat, kann es auch keine Richtung als solche haben, die dafür garantierte, dass das Dasein gelingt, wenn ich nur die vorgegebene Richtung strikt einhalte. Dasein kann nur gelingen, wenn wir es konkret verrichten, also gerade aus den suggerierten Imperativen vorgegebener Richtungen in der Verrichtung herausführen. Dasein konkret zu verrichten, bedeutet dann die bewusste und schonend-wahrende Kontaktaufnahme mit den begegnenden Menschen und Dingen meines Daseins, das so aus der entgrenzenden Verlorenheit ins Parlament der Dinge und Menschen restatuiert wird. Dass es uns nicht ergehe wie dem Hasen, der sich im Schon-da-sein des Igels nicht zu schonen wusste. Das Nachdenken könnte uns erschließen, dass wir schon da sind, dass eben nicht dieses Schon angesichts eines Noch-nicht allererst erreicht werden muss. Denn verfahren wir so weiter, hetzen wir uns zu Tode, mit allen vorgängigen Erfahrungen an Weltverlust, Sinnentleerung, Daseinsangst, Gewaltausbrüchen und Verzweiflungen. Sofern wir allerdings das Noch als ein komplementierendes Integral eines Immer-Schon begreifen, verstehen wir vielleicht auch, dass Wohnen wesentlich Wahren bedeutet. Gegen die drohende Verwahrlosung hilft das wahrende Wohnen in wahrnehmend-einsichtiger Umsicht des Menschen auf sich selbst, seine Mitmenschen und die Dinge. Wie ein solches Wohnen konkret werden kann, das – meine sehr verehrten Damen und Herren Innenarchitekten – bleibt Ihrer Kreativität anheim gestellt. Wenn mein Vortrag hierfür einige Impulse auslösen konnte, habe ich mehr erreicht, als ich hoffen durfte. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. 23.04.2005