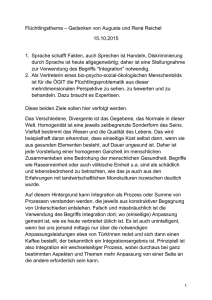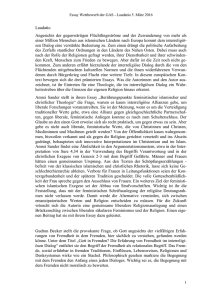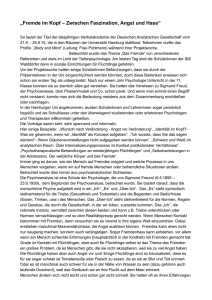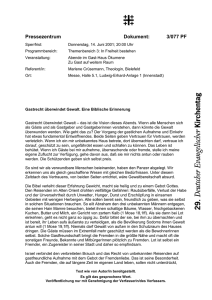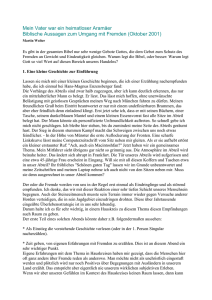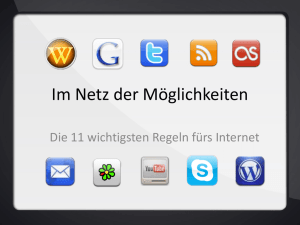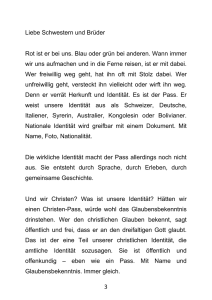Fremdheit aus theologischer (und philosophischer) Perspektive
Werbung

1 Fremdheit aus theologischer (und philosophischer) Perspektive: Eine Annäherung. 1. Einführung Fremdsein ist in den biblischen Erzählungen und in den theologischen Aussagen über das Fremdsein Israels, das Fremdsein Jesu und das Fremdsein der Christen im ersten Jahrhundert ein fundamentales Thema und Problem.1 Fremdheit und Flucht sind die dramatischen Grundkonstanten biblischer und christlicher, ja letztlich menschlicher Existenz. Die unterschiedlichen Fremdheitserfahrungen sind Rahmen und Hintergrund für die biblischen Gebote zum Umgang mit den Fremden und damit für das christliche Verständnis vom Fremden und von Fremdheit. Dabei gibt es sowohl eine spannungsreiche Ambivalenz im Umgang der Menschen mit Fremdheit und Fremden als auch eine wechselhafte Disposition Gottes in der Beziehung mit den fremden und vertrauten Menschen. 2. Erfahrungen von Fremdheit in der Bibel Bereits im Alten Testament gibt es unzählige Fremdheits- und Fluchterfahrungen, so wird z. B. in der Geschichte von der Flucht des Brudermörders Kain dieser auf der Flucht von Gott durch das Kainszeichen beschützt. Auch die Erzväter machen vielfältige Erfahrungen als Flüchtlinge in der Fremde. Zumeist sind sie Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen (Wirtschaftsflüchtlinge). Kriege und Hungersnöte waren in alttestamentlicher Zeit die beiden Hauptgründe, um ein Fremder zu werden. Als Fremde waren sie Menschen ohne Grundbesitz und ohne Verwandte in ihrer Nähe. Sie waren rechtlose Arme und brauchten daher besonderen Schutz. Das Volk Israel erlebte die Unterdrückung in Ägypten als ein Fremdsein und Ungewolltsein, eine für Israel zentrale und existentielle Erfahrung. Später waren u. a. die 1 Inhaltliche und strukturelle Grundlage zu meinen Ausführungen ist Michael Holze, Fremde, Fremdsein und Flüchtlinge in der Bibel (2015). 2 Leviten, die Propheten und selbst König David auf der Flucht und waren Fremde. Nach den Berichten im Neuen Testament gehörten auch Jesus, die Apostel und die Christen im ersten Jahrhundert zu den Fremden, Verfolgten und Flüchtlingen. 3. Die theologische Bedeutung des Fremdseins in der Bibel Eine zentrale theologische Grundannahme ist es, dass bei der Schöpfung alle Menschen vor Gott gleich sind. Nach biblischem Zeugnis hat Gott die ganze Welt und alle Menschen geschaffen. Daher gibt es vor Gott keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Völkern oder Kulturen der Menschheit. Alle Menschen sind Kinder Gottes und Abbild bzw. Ebenbild Gottes. Insofern wiederspricht die Bibel jeder Form von Rassismus und Unterdrückung anderer Völker und Kulturen. Daraus leitet sich die unverlierbare und unzerstörbare Würde des Menschen ab, ob als Fremder oder Vertrauter. Gott erwählte ein besonderes Volk, Israel, als Volk Gottes. Das bedeutete sowohl eine Auszeichnung und Würde, eine Rechtsübertragung, aber auch eine hohe Bürde, eine Pflichtübertragung, Beauftragung oder Sendung. Nach der Erwählung Israels als Volk Gottes wurden auch die fremden Völker von Gott gesegnet bzw. ihnen wurde in prophetischen Visionen der Segen Gottes verheißen. Zur Ambivalenz des Phänomens der Fremdheit in der Bibel gehört, dass die traumatischen Erfahrungen Israels in der Exilzeit das Volk Israel selbst zum Fremden, auch zum tragischen Fremden vor Gott machten. In den Evangelien im Neuen Testament wird immer wieder von Fremden und Nicht-Juden berichtet, die einen besonders starken Glauben hatten. Ihr Glaube wird von Jesus z. T. als besonders vorbildlich beschrieben. Zunächst gilt aber weiter der Unterschied zwischen dem Volk Israel als erwähltem Volk Gottes und den Heiden als den Fremden. Diese Grenze zwischen Juden und Heiden wurde oftmals, allerdings nicht ohne innere Spannungen und Konflikte, in den 3 christlichen Gemeinden aufgehoben, so dass die Heiden in religiöser Hinsicht nicht mehr Fremde waren. Jesus selber ist seiner Heimat durch seine Gottesbeziehung entfremdet: • Die Geburtsgeschichte in Lukas 2 zeigt, dass nicht Nazareth, sondern Bethlehem seine Heimatstadt ist. • Jesus ist seiner eigenen Familie entfremdet. Er negiert seine leiblichen Verwandten (Mk 3,33) und bezeichnet stattdessen im theologischen Sinne diejenigen als seine wahren Verwandten, die „den Willen Gottes tun“ (Mk 3,34f.) • Bei seinen Verwandten (Mk 3,21) und in Nazareth stieß er auf heftiges Unverständnis und Ablehnung (Mk 6,1-6a par). • Jesus beschrieb seine Heimatlosigkeit in einem Vergleich mit Füchsen, die Höhlen und mit Vögeln des Himmels, die Nester haben, während der Menschensohn nichts habe „wohin er den Kopf lege“ (Mt 8,20 par Lk 9,58). • Im Gleichnis von den bösen Weingärtnern (Mk 12,1-9) wird die Geschichte Israels theologisch gedeutet als Ablehnung Gottes, die darin gipfelt, dass der Sohn des Weinbergbesitzers gleichfalls abgelehnt und getötet wird. Im Johannesevangelium wird Jesu Fremdheit und die Ablehnung durch die Welt noch deutlicher theologisch gedeutet: • Im Johannesprolog heißt es, dass Jesus „in das Eigene kam und die Eigenen ihn aber nicht annahmen“ (Joh 1,11). • Die ‚Welt‘ erkannte Jesus nicht und hasste ihn (vgl. Joh 1,10; 7,7; 15,18). • Im Verhör vor Pilatus betont Jesus schließlich: „Mein Königtum ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18,36). 4 Es wird deutlich, dass der Jude Jesus von Nazareth einerseits zwar aus Israel stammte, sich andererseits dort fremd vorkam, weil seine Heimat bei Gott war. Umgekehrt war Jesus den eigenen Leuten im Volk Israel – aber auch der ganzen Welt – fremd, sofern man nicht an ihn glaubt und ihn nicht als den Sohn Gottes anerkennen kann. Jesus appellierte in seiner Ethik an das alttestamentliche Liebesgebot, aber er akzeptierte nicht die damals übliche Begrenzung des Liebesgebotes, wonach nur das Volk Israel als Nächster anerkannt war. So provozierte er mit der bekannten Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-37): Ein Samariter, d. h. ein Mensch, den das damalige Judentum als Abgefallenen des Jahwe-Glaubens ansah, wird hier Modellperson für die von Gott gewollte Nächstenliebe. Die Frage des Schriftgelehrten „Wer ist mein Nächster?“ (Lk 10,29) drehte Jesus um und fragte: „Wer ist der Nächste geworden dem unter die Räuber Gefallenen?“ (V. 36). Aus dieser Erzählung folgt die Grenzenlosigkeit der Verpflichtung zur Liebe, die ihr Ende nicht am Zumutbaren und Üblichen findet. Auch die Geschichte vom Weltgericht (Mt 25,31-46) betont, dass es für Jesus nur auf die Nächstenliebe ankommt. Sie ist dadurch zu einem zentralen biblischen Text zum Umgang mit den Fremden geworden. Hier identifizierte sich Jesus mit den „Geringsten“ seiner Brüder, indem er sagte: „fremd war ich, und ihr habt mich aufgenommen“ (V. 35) und: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ (V.40). Die Nachfolger Jesu werden dazu ermutigt und aufgefordert, auch den geringsten Menschen, d. h. auch den Fremden Gutes zu tun und somit jedem Menschen zu helfen, der in Not ist. In der Bergpredigt hat Jesus dieses Liebesgebot dann sogar auf die Liebe zu Feinden ausgedehnt (Mt 5,43-48 und Lk 6,27-36). Für Christen ergibt sich aus den Erfahrungen von Fremdheit des Volkes Gottes und der Tatsache, dass Jesus in dieser Welt ein Fremder war, eine immanente, 5 inhärente Fremdheit der christlichen Existenz. Der Christ ist in der Nachfolge Jesu immer auch ein Fremder, der zwar in der Welt lebt, aber nicht von der Welt ist. Die frühen Christen verstanden sich daher in theologischer Hinsicht als Bürger des Himmels und als Fremde in der Welt. Daraus leiteten sie und leiten Christen heute wichtige moralische, ethische, soziologische, politische und ökonomische Grundsätze ab. Diese Grundsätze sind Standards für die Anforderungen und Verhaltensnormen im Umgang mit Fremden und Fremdheit, mit Respekt und Toleranz, mit Verschiedenheit und Andersartigkeit. Im Alten Testament (Bundesbuch) findet sich bereits das Gebot, die Fremden nicht zu unterdrücken. Das wird u. a. damit begründet, dass das Volk Israel in Ägypten fremd gewesen ist. Der Schutz der Fremden und die soziale Fürsorge für sie werden in den Geboten mit der Liebe Gottes begründet, die sich auf alle Menschen bezieht. Neben der Nächstenliebe ist daher auch die Liebe zu den Fremden ausdrücklich geboten. Die Ethik Jesu befreit das Gebot der Nächstenliebe von allen Trennungen, Grenzen und Partikularismen. Jedem, der Hilfe braucht, soll geholfen werden. Da Jesus sich als Fremder mit den Fremden identifiziert, wird die Hilfe für Fremde obligatorisch im Sinne eines moralischen Imperativs. Daher wird im Neuen Testament immer wieder zur Gastfreundschaft gegenüber Fremden aufgerufen. Nicht zuletzt ist die Annäherung an den Fremden, die Fremdenhilfe und Fremdenliebe sowie die Gastfreundschaft (heils-) relevant für die individuelle und universale Heilsgeschichte, d. h. auch für das individuelle und universale Weltgericht am Ende der Zeiten. 6 4. Soziologische Grundlegung Nach einer alten Diktion von Georg Simmel2 ist der Fremde jemand, „der heute kommt und morgen bleibt.“ Damit unterscheidet sich der Fremde vom Gast, vom Wanderer, „der heute kommt und morgen geht“. Diese Differenzierung bleibt aktuell. Fremdheit bedeutet soziologisch eine Unbekanntheit, Unvertrautheit und Unsicherheit mit Menschen, Personengruppen, Ideen oder Dingen. Unwissenheit erhöht die Fremdheitswahrnehmung. Fremdheit stellt somit einen Erfahrungshorizont außerhalb des eigenen Wirklichkeits- und Wissensbereichs dar, d. h. der „Fremde“ wird außerhalb des eigenen Gesellschaftssystems und Sinnhorizontes verortet. Insofern irritiert der „Fremde“ die gegenwärtige Ordnung, die geglaubten Gewissheiten und stellt Normalitätsvorstellungen sowie Selbstverständlichkeiten in Frage. Dies führt zur Verunsicherung auf beiden Seiten, vor allem kann es zu Konflikten führen, die sich in fremdenfeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen äußern. Als „fremd“ wahrgenommen werden Menschen mit angenommenem und tatsächlichem Migrationshintergrund. Ihnen wird eine andere „Kultur“ zugeschrieben. Fremdheit ist daher das Ergebnis von Zuschreibungen kultureller, sozialer oder sachlicher bzw. rechtlicher Differenz auf Personen oder Gruppen; sie ist das Produkt sozialer Aushandlungsprozesse, d. h. sozialer Konstruktionsprozesse in spezifischen sozialen und kulturellen Kontexten. Sie kann auch Ergebnis einer selbstgewollten und selbstgewählten (besonders religiösen) Abgrenzung sein. Die Zuschreibung erfolgt jedoch zumeist nicht nur individuell, sondern insbesondere kollektiv. Jedoch verrät dieser Prozess mehr über die zuschreibenden Personen, als über die stigmatisierten „fremden“ Personen. Referenzpunkt für die Zuschreibung ist eine Kategorisierung im Rahmen einer vertrauten Ordnung. Fremdheit ist daher subjektiv und 2 Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Kapitel IX: Der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft. Exkurs über den Fremden, Berlin 1908, S. 509-512. 7 individuell. Es gibt es familienspezifische, milieuspezifische, kulturspezifische und religionsspezifische Merkmale, die die Erfahrung von Fremdheit beeinflussen können. Fremdheit lässt sich folglich auch nicht an objektiven Kriterien messen. D. h.: Es gibt „Fremdheit“ als solche nicht; sie steht vielmehr im Kontext einer Wertung und Bewertung im Sinne einer Fremddeklaration. Sie zeigt sich in der sozialen Interaktion von Inklusion und Exklusion von Fremden. Denn Individuen leben in ganz unterschiedlichen Kontexten, sie machen teils völlig verschiedene Erfahrungen. Somit werden sie mit unterschiedlichen Bezugsobjekten und Beziehungen konfrontiert und vielleicht auch vertraut gemacht. Das bedeutet, dass die Grenzen zwischen dem „Fremden“ und dem „Eigenen“ fließend sind. Was in einer Gesellschaft als „Normalität“ angesehen wird, gilt in der nächsten als „Abnormität“. Multikulturelle und polysubkulturelle Gesellschaften sind von einer Vielfalt an Fremdheit geprägt, zeigen aber weniger uniforme Muster von Fremdheitserfahrung, da alle Individuen kontextuell und wechselseitig Fremde sind. Fremdheit im Sinn einer Unvertrautheit hat insofern nicht nur mit anderen Kulturen, Nationen, Rassen etc. zu tun, sondern auch mit anderen Weltanschauungen, Sitten, Bräuchen, Dialekten, Werten, Ästhetiken etc. Die Fremden sind also nicht nur die Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, sondern auch die Inländer, d. h. die Einheimischen. Fremder kann also jeder sein, der unbekannt und unvertraut ist, bzw. der mit den Bezugsobjekten und Beziehungen nicht bekannt und vertraut ist. Damit schließt sich der Kreis: Ähnlich wie bei den biblischen Erfahrungen auch, zeigen sich hier im gesellschaftspolitischen, sozialpsychologischen Diskurs die besprochenen Phänomene existentieller, totalitärer Fremdheit des Menschen.3 3 Instruktiv dazu Bernd Schäfer u. Bernd Schlöder, Identität und Fremdheit. Sozialpsychologische Aspekte der Eingliederung und Ausgliederung des Fremden, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften (JCSW) 35 (1994) Flucht – Asyl - Migration, S. 69-87. 8 5. Philosophische Annäherung Im philosophischen Diskurs4 gibt es eine wichtige Unterscheidung zwischen (a) Fremdheit und Andersheit (Alterität) sowie zwischen (b) innerer, vertikaler Fremdheit und äußerer, horizontaler Fremdheit. Zu a): Der Andere ist nicht unbedingt „fremd“, doch der Fremde kann „anders“ sein. Der Andere ist „anders“ aufgrund anderer, aber bekannter und vertrauter, bzw. akzeptierter Muster und Unterscheidungen. Der Fremde ist „anders“, weil er aufgrund nicht akzeptierter Muster und Unterscheidungen nicht bekannt und unvertraut ist. Andersheit und Fremdheit besitzen also ähnliche Konzepte. Fremdheit impliziert Andersheit. Andersheit bedeutet jedoch nicht zwingend Fremdheit. Das Fremde, den Fremden kann man kennenlernen und sich vertraut machen, bzw. sich zu eigen machen, aneignen. Das Andere, den Anderen kann man sich nicht zu eigen machen. Der Andere bleibt nach dem Primat der Ethik von Emmanuel Levinas der radikal, absolut Andere, der Unendliche, dem man sich aber in unendlicher Verantwortung verpflichten und bedingungslos, radikal hinwenden müsse, dem man unbedingt begegnen müsse.5 Dieser philosophische Ansatz von Emmanuel Levinas versteht sich als eine Philosophie, die radikal vom Anderen her gedacht wird. Damit stellt sie nicht nur einen Gegenpol zur klassischen griechisch-abendländischen Philosophie dar, in der die Begriffe Ich, Selbst und Vernunft dominieren. Die Kategorie des Anderen wird auch notwendig, um der Endsolidarisierung und den zunehmenden Individualisierungsprozessen in der Gesellschaft konkurrierend und korrigierend gegenüberzutreten. 4 Dazu aus phänomenologischer Sicht Bernhard Waldenfels, Das Fremde denken, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 4 (2007), S. 361-368. 5 Vgl. u. a. Emmanuel Levinas, Die Spur des Anderen: Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Nikolaus Krewani. 4. Auflage. Freiburg im Breisgau; München 1999; ders., Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler, Hamburg 1989; ders, Zwischen Uns. Versuche über das Denken an den Anderen. Aus dem Französischen von Frank Miething. München; Wien 1995; ders., Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler. 3. Auflage. Hamburg 1995. 9 Zu b): Die vertikale, innere Fremdheit bezieht sich auf das Eigene, Innere, auf das, was in mir als Fremdes aufbricht, auftaucht, existiert (Unbewusstes, Traum, Wahn etc.). Die horizontale, äußere Fremdheit betrifft dagegen alles Äußere, was von außen in mich einbricht, eintaucht, eindringt (Feind, Fremder, Gast etc.).6 Die wichtige Frage heißt hier also: „Wie verhalte ich mich angesichts des Fremden? Wie werde ich ihm gerecht und bleibe mir dabei treu?“7 Die Konzepte der Fremdheit haben allerdings eine Schwierigkeit: Wo ist die Grenze zwischen Vertrautheit, Bekanntheit und Unvertrautheit, Unbekanntheit? Und: Wandelt sich an einem Ort, zu einer Zeit, in einer bestimmten Situation die Furcht vor dem Fremden in eine Furcht vor dem Bekannten und Vertrauten? Heute könnte man angesichts der populistischen Fremdenphobie und des nationalistischen Fremdenhasses mehr Angst haben vor dem „Vertrauten“, z. B. vor Deutschland und den Deutschen, als vor dem „Fremden“, z. B. den Flüchtlingen. Daher ist es vor allem wichtig, sich selbst zu verstehen, die Begrenztheit und Relativität der eigenen Deutungs- und Interpretationsmuster einzusehen, um andere zu verstehen. Pointiert gesagt: „Fremd“ meint „anders“ als bislang gekannt; aber: „anders“ ist nicht „schlecht“, sondern „anders“. 6. Fazit Was bedeutet das für Christen? Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Europa sind heute anders als im antiken Israel und Rom oder im mittelalterlichen Europa. Es gibt aber auch Parallelen. Relativ vertraut erscheinen uns die Fremden mit ähnlicher Kultur und mit der gleichen, z. B. christlichen Religion. Integration gelingt hier relativ leicht. Komplizierter ist für die Menschen die Gastfreundschaft und Fremdenliebe gegenüber Menschen 6 7 Konstruktiv dazu Yoshiro Nakamura, Xenosophie. Bausteine für eine Theorie der Fremdheit, Darmstadt 2000. Yoshiro Nakamura, Xenosophie, S. 244. 10 einer anderen Religion, anderer Kultur und aus anderen Ländern. Christen sind aber immer und überall auf der Welt fremd, weil sie ihre Heimat im Himmel haben. Christen können sich wie Jesus mit dem Fremdsein der Fremden, der Ausländer und Flüchtlinge identifizieren. Christen haben jedenfalls keinen Grund, Fremde abzulehnen oder sich nicht mit Fremden, d. h. auch mit NichtChristen vertraut und bekannt zu machen. Christen und die christlichen Kirchen haben den Auftrag Jesu, den Notleidenden zu helfen und sie zu unterstützen und zwar unabhängig von Volkszugehörigkeit, Kultur, Religion etc. Auf Grundlage der Philosophie von Emmanuel Levinas kann ein gesellschaftliches Bewusstsein entwickelt werden, das dem Anderen und Fremden Vorrang vor dem Eigenen und dem Selbst einräumt. Zudem werden Individuum und Gesellschaft verpflichtet, Verantwortung für den Anderen zu übernehmen, da dem Anderen und Fremden eine Erstbedeutung zukommt und gleichzeitig die Andersheit des Anderen oder Fremden, die unterschiedlichen Lebenswelten etc. bedingungslos akzeptiert werden. Dies spiegelt letztlich eine biblisch fundierte christliche Ethik und philosophisch-soziologisch geprägte Handlungsbzw. Verantwortungsmaxime wieder. Aber so können gegenseitige, wechselseitige Lern-, Assimilations- oder Integrations- und Inkulturationsprozesse gelingen. Dann können aus „Fremden“ einmal „Vertraute“ werden.