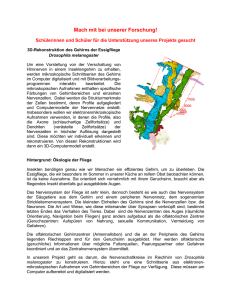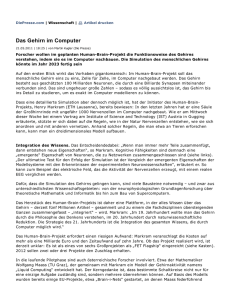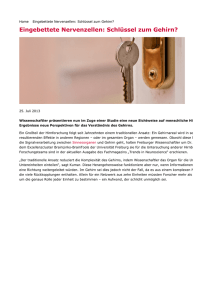Nur Text - Ruhr-Universität Bochum
Werbung
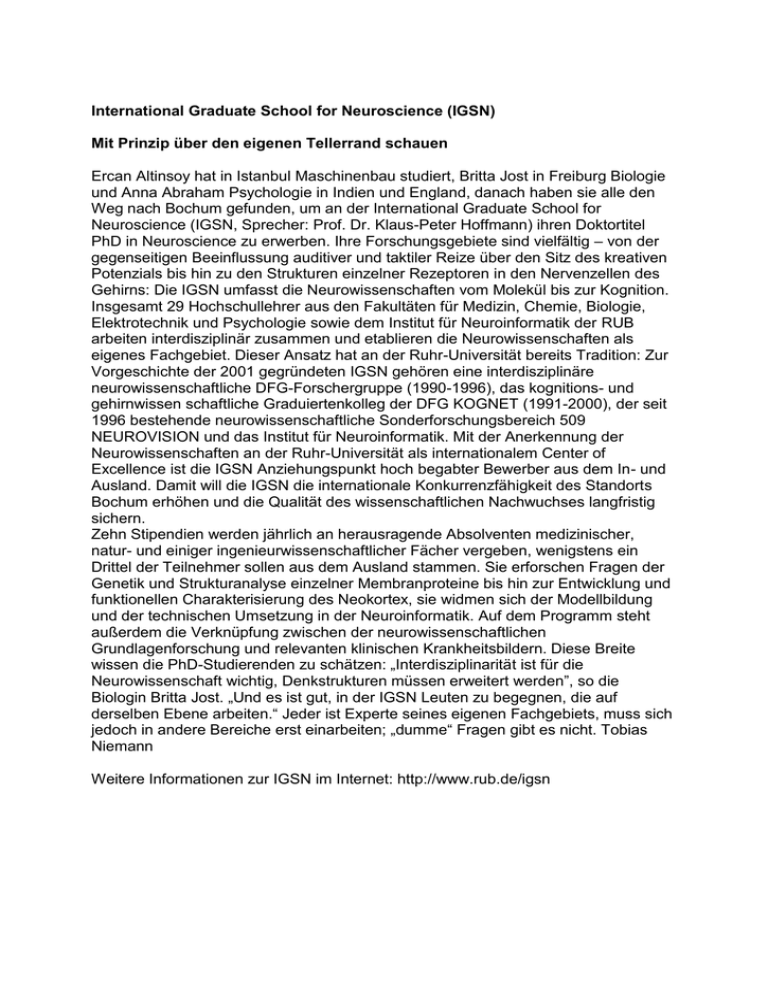
International Graduate School for Neuroscience (IGSN) Mit Prinzip über den eigenen Tellerrand schauen Ercan Altinsoy hat in Istanbul Maschinenbau studiert, Britta Jost in Freiburg Biologie und Anna Abraham Psychologie in Indien und England, danach haben sie alle den Weg nach Bochum gefunden, um an der International Graduate School for Neuroscience (IGSN, Sprecher: Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann) ihren Doktortitel PhD in Neuroscience zu erwerben. Ihre Forschungsgebiete sind vielfältig – von der gegenseitigen Beeinflussung auditiver und taktiler Reize über den Sitz des kreativen Potenzials bis hin zu den Strukturen einzelner Rezeptoren in den Nervenzellen des Gehirns: Die IGSN umfasst die Neurowissenschaften vom Molekül bis zur Kognition. Insgesamt 29 Hochschullehrer aus den Fakultäten für Medizin, Chemie, Biologie, Elektrotechnik und Psychologie sowie dem Institut für Neuroinformatik der RUB arbeiten interdisziplinär zusammen und etablieren die Neurowissenschaften als eigenes Fachgebiet. Dieser Ansatz hat an der Ruhr-Universität bereits Tradition: Zur Vorgeschichte der 2001 gegründeten IGSN gehören eine interdisziplinäre neurowissenschaftliche DFG-Forschergruppe (1990-1996), das kognitions- und gehirnwissen schaftliche Graduiertenkolleg der DFG KOGNET (1991-2000), der seit 1996 bestehende neurowissenschaftliche Sonderforschungsbereich 509 NEUROVISION und das Institut für Neuroinformatik. Mit der Anerkennung der Neurowissenschaften an der Ruhr-Universität als internationalem Center of Excellence ist die IGSN Anziehungspunkt hoch begabter Bewerber aus dem In- und Ausland. Damit will die IGSN die internationale Konkurrenzfähigkeit des Standorts Bochum erhöhen und die Qualität des wissenschaftlichen Nachwuchses langfristig sichern. Zehn Stipendien werden jährlich an herausragende Absolventen medizinischer, natur- und einiger ingenieurwissenschaftlicher Fächer vergeben, wenigstens ein Drittel der Teilnehmer sollen aus dem Ausland stammen. Sie erforschen Fragen der Genetik und Strukturanalyse einzelner Membranproteine bis hin zur Entwicklung und funktionellen Charakterisierung des Neokortex, sie widmen sich der Modellbildung und der technischen Umsetzung in der Neuroinformatik. Auf dem Programm steht außerdem die Verknüpfung zwischen der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung und relevanten klinischen Krankheitsbildern. Diese Breite wissen die PhD-Studierenden zu schätzen: „Interdisziplinarität ist für die Neurowissenschaft wichtig, Denkstrukturen müssen erweitert werden”, so die Biologin Britta Jost. „Und es ist gut, in der IGSN Leuten zu begegnen, die auf derselben Ebene arbeiten.“ Jeder ist Experte seines eigenen Fachgebiets, muss sich jedoch in andere Bereiche erst einarbeiten; „dumme“ Fragen gibt es nicht. Tobias Niemann Weitere Informationen zur IGSN im Internet: http://www.rub.de/igsn Sinneswahrnehmungen beeinflussen sich Die Hände hören mit Wenn wir mit geschlossenen Augen mit dem Finger über zwei unterschiedliche Sandpapierstücke streichen, können wir sofort sagen, welches rauer ist. Wir haben es mit der Fingerspitze ertastet – aber nicht nur: Wir haben auch das unterschiedliche Geräusch wahrgenommen, das der Finger auf dem Papier hervorgerufen hat. Nebensache? Informationen, die über verschiedene Wahrnehmungskanäle kommen, zu integrieren, ist eine grundlegende Funktion unseres Gehirns. „Wie genau das passiert und wie sich die Sinneswahrnehmungen gegenseitig beeinflussen, ist nicht hinreichend erforscht. Das liegt u.a. daran, dass es im Experiment bislang schwierig war, den einzelnen Sinnen voneinander unabhängige Reize zu präsentieren“, erklärt Ercan Altinsoy, der am Institut für Kommunikationsakustik die Interaktion von auditiver und taktiler Wahrnehmung erforscht. Er bedient sich für seine psychophysischen Studien virtueller Umgebungen. Dort entspringen die Reize nicht der physikalischen Realität, sondern können künstlich generiert und unabhängig voneinander verändert werden. Altinsoy nutzt ein Simulationssystem, mit dem man in physikalisch nicht existierende Umgebungen hineinhören kann. Er hat es um eine taktile Komponente erweitert, die Oberflächeninformationen, Ganzkörperschwingungen und das sog. force-feedback, das wir z. B. beim Klopfen oder Schlagen empfinden, simulieren kann. Durch Tests an Versuchspersonen hat er bereits herausgefunden, dass, auch wenn das System immer dasselbe force-feedback gibt, der Nutzer den Eindruck hat, kräftiger geschlagen zu haben, wenn er ein lauteres Geräusch dabei gehört hat. In anderen Experimenten hat Altinsoy die Verzögerungstoleranz zwischen einzelnen Reizen ermittelt: Wie lange dürfen Tastinformation und Geräusch auseinander liegen, damit das Gehirn sie als zusammengehörig interpretiert? Empfängt die Hand die Tastinformation nach dem Geräusch, dürfen nicht mehr als 26 Millisekunden dazwischen vergehen, kommt hingegen das Geräusch verzögert, toleriert das Gehirn bis zu 49 Millisekunden. Andere Schwellenwerte ergaben Experimente mit Geräuschen und Ganzkörperschwingungen: Kommt das Geräusch zuerst, dürfen bis zur Schwingung höchstens 35 Millisekunden vergehen, kommt die Schwingung zuerst, darf das Geräusch nicht mehr als 39 Millisekunden später erklingen. Weitere Tests sollen zeigen, welchen Einfluss die taktile Wahrnehmung auf die Lokalisation von Schallquellen hat. Die Experimente sollen helfen, ein besseres Verständnis der Integration von akustischer und taktiler Information zu gewinnen und virtuelle Umgebungen möglichst realistisch erfahrbar zu machen. md Trigeminus-Nerv aktiv: Life übertragen aus der Nervenbahn Chemische Sinne spielen eine entscheidende Rolle im täglichen Leben der Säugetiere und des Menschen. Dazu gehört neben Geruchs- und Geschmackssinn auch der „trigeminale Sinn“. Diese Sinnessysteme vermitteln z.B. woraus sich die Nahrung zusammen setzt. Schon vor der Aufnahme der Nahrung informieren vor allem der Geruchs- und der trigeminale Sinn über ihre Genießbarkeit. Zudem ist der Geruchssinn von besonderer Bedeutung bei der sozialen Kommunikation. Säugetiere erkennen potenzielle Geschlechtspartner oder Feinde an ihrem Körpergeruch. Der trigeminale Sinn schützt den Organismus vor schädlichen Substanzen, indem er Sinneseindrücke wie juckend, stechend, brennend oder beißend vermittelt. Dabei werden die chemischen Reize von freien Nervenendigungen des 5. Hirnnervs (Nervus trigeminus) in den Schleimhäuten von Mund und Nase und in den Geweben des Auges aufgenommen und in elektrische Signale umgewandelt. Diese werden dann entlang der Nervenfasern über das Ganglion trigeminale (Gasseri) in definierte Bereiche des Hirnstamms geleitet. Dort bestehen Verbindungen zu weiteren Nervenzellen, die für die Datenverarbeitung notwendig sind. Verschaltungen zwischen Nervenzellen im gesamten Nervensystem bilden die Basis dafür, dass Informationen aus der Umwelt geordnet weitergeleitet und verrechnet werden und schließlich zur bewussten Wahrnehmung führen können. Erst die Kenntnis der funktionalen Verbindungen der Nervenzellen untereinander lässt uns die Funktion einzelner Nervenzellen sowie die Arbeitsweise und Informationsverarbeitung komplexer Strukturen des Gehirns verstehen. Moderne Techniken ermöglichen es heute, die Aktivität von Nervenzellen unter natürlichen Bedingungen zu beobachten, z.B. den Zusammenhang von Umweltreizen und neuronalen Aktivitätsmustern einzelner Zellen und funktionaler Netzwerke. Nils Damann untersucht in seiner Doktorarbeit am Lehrstuhl für Zellphysiologie die Aktivität trigeminaler Nervenzellen und das funktionale Zusammenspiel von Nervenzellgruppen im Ganglion trigeminale von Mäusen. Indem er über genetisch veränderte Viren einen Calcium-empfindlichen Fluoreszenzfarbstoff in die Nervenzellen einschleust, macht er die neuronale Aktivität dieser Zellen sichtbar. Mit optischen (bildgebenden) Verfahren blickt er „life“ und in Echtzeit in den intakten Gewebeverband. Da sich das ausgewählte Virus innerhalb des Nervensystems spezifisch über aktivitätsgekoppelte Nervenzellen ausbreitet (Neurotropie), vermittelt sein Verbreitungsmuster im Gehirn die exakte Funktionskarte der an der Informationsverarbeitung beteiligten Strukturen (s. Abb). Mit immunhistochemischen und aktivitätsabbildenden Verfahren (Ca-Imaging) können die trigeminalen Sinnesreize erstmals auf ihrem Erregungs- und Verarbeitungspfad durch das Mäusegehirn verfolgt werden. Bausteine elektrischer Synapsen suchen: Methode im Griff Erst in den letzten Jahren machen sie von sich reden, die elektrischen Synapsen (Abb.1, A), auch Gap Junctions genannt: Es sind kleine Kanäle, die benachbarte Zellen miteinander verbinden und sich aus speziellen Proteinen (Connexinen) zusammensetzen. Elektrische Synapsen leiten Signale ohne Hilfe von Botenstoffen (wie die chemischen Synapsen) und damit extrem schnell von Nervenzelle zu Nervenzelle weiter. Sie verbinden Neurone untereinander zu ganzen Netzwerken. Wenn es um komplizierte Wahrnehmungen geht, die unser Gehirn aus vielen Detailinformationen aufbaut, scheinen sie eine wichtige Rolle zu spielen. Vermutlich sind elektrische Synapsen mitverantwortlich für schnelle rhythmische Entladungen, sog. Oszillationen, in der Hirnrinde und deren Weiterleitung über größere Distanzen hinweg zu übergeordneten Neuronen. Oszillationen kommen in unterschiedlichen Hirngebieten vor und werden mit höheren Hirnfunktionen wie Gedächtnisbildung und Wahrnehmung in Verbindung gebracht. Eine dieser Hirnregionen ist der Hippocampus, der an der Bildung des Langzeitgedächtnisses beteiligt ist. Svenja Weickert (Neuroanatomie und Molekulare Hirnforschung) ist den elektrischen Synapsen im Hippocampus auf der Spur, indem sie nach ihren Bausteinen, den Connexinen, sucht und diese analysiert. Bisher weiß man wenig über die Funktion, molekulare Vielfalt und Konzentration dieser Proteine in den verschiedenen Hirnarealen. Deshalb möchte die PhD-Studentin mit modernen molekularbiologischen Methoden auf RNA-Ebene klären, welche Proteine dieser Connexinfamilie an der elektrischen Kopplung im Hippocampus beteiligt sind und welcher Zusammenhang zwischen der Häufigkeit ihres Auftretens und ihrer Funktion besteht. Da bisherige Techniken, mit denen Connexine in spezifischen Zellgruppen untersucht wurden, zu widersprüchlichen Ergebnissen führten, setzt Svenja Weickert in ihrer Arbeitsgruppe als eine der ersten in Deutschland die Lasermikrodissektion (Laser Microbeam Microdissection, LMM) ein: Sie bringt dünne Gewebeschnitte auf folienbeschichtete Objektträger auf und färbt sie zur besseren Orientierung an. Mit einem Laser schneidet sie dann unter dem Mikroskop definierte Zellgruppen aus dem Gewebe aus. Da das Gewebe auf der Folie und nicht direkt am Objektträger haftet (s. Abb.1, B-E), können einzelne Schnitte gesammelt werden. Aus diesen Proben wird die RNA isoliert und dann mit speziellen Techniken (reverser Transkription, RT, und Polymerase Chain Reaction, PCR) in DNA umgesetzt und sehr spezifisch untersucht. So lässt die Real Time RT-PCR-Technik Aussagen zur Konzentration einer RNA in der Probe zu: ein Fluorenszenzfarbstoff macht den Reaktionsverlauf bei dieser äußerst empfindlichen quantitativen Analyse messbar – die RNA-Menge kann unmittelbar abgelesen werden. Svenja Weikert hat mit der LMM-Methode inzwischen viel Erfahrung sammeln können und bereits einige Vertreter der Connexinfamilie im Hippocampus nachgewiesen. Sie wird diese Ergebnisse nun mit anderen elektrisch gekoppelten Hirnregionen vergleichen. Schließlich will sie den Hippocampus zum Oszillieren bringen, um anhand der Konzentrationsveränderungen der Connexine ihrer Funktion auf die Spur zu kommen – die optimale Methode dafür hat sie schon im Griff! Plastizität des erwachsenen und alternden Gehirns: Zirkelspitzenpaare tasten „Was Hänschen nicht lernt Hans (n)immer mehr“ – nicht zum ersten Mal scheint hier wissenschaftliche Erkenntnis den Volksmund zu widerlegen: Wie aktuelle Ergebnisse zeigen, sind Leistungssteigerung und Plastizität des Gehirns bis ins hohe Alter möglich. Den Zusammenhang zwischen Verhaltensänderungen und deren Auswirkungen auf dafür zuständige Hirnbereiche untersucht Patrick Ragert (Institut für Neuroinformatik) in seiner Doktorarbeit an der IGSN. Indem er beobachtet, wie sich bei veränderter Tastwahrnehmung (Perzeption) zugleich Bereiche des Gehirns umstrukturieren, erfährt er mehr über die physiologischen Mechanismen des „perzeptuellen Lernens“. Seine Arbeiten konzentrieren sich auf zwei Bereiche. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen eines passiven künstlichen Trainings auf kortikaler und Verhaltensebene. Dies erfolgt mithilfe simultaner Reizmuster unter genau definierten Bedingungen und in drei Trainingsschritten: Zunächst lernen Testpersonen vorgegebene Tastreize zu unterscheiden, indem sie mit dem Finger acht Zirkelspitzenpaare auf einer sich drehenden Scheibe ertasten müssen („aktives Lernen“). Daran schließt sich das „künstliche Training“ an, bei dem die rezeptiven Felder für das Tasten der Zirkelspitzenpaare an den Fingerspitzen der Testpersonen mit genau definierten Reizen stimuliert werden. Im dritten Schritt wird das „aktive Lernen“ wiederholt. Dabei zeigte sich, dass der Tastsinn durch „künstliches Training“ verbessert werden kann - die Testpersonen ertasten wesentlich mehr Zirkelspitzenpaare als beim ersten „aktiven Lernen“. Patrick Ragert stellte außerdem einen linearen Zusammenhang zwischen verbessertem Tastsinn und Umstrukturierungen der dafür zuständigen Hirnareale fest (s. Abb., SI und SII). Neben den peripheren Reizen an den Fingerspitzen stimuliert er auch direkt die Hirnregionen, in denen die Reize der Fingerspitze verarbeitet werden. Er nutzt dafür die repetitive transcranielle Magnetstimulation (rTMS), bei der sich mithilfe eines Magnetfeldes die Aktivität in bestimmten Hirnregionen kurzzeitig verändern lässt. Die funktionellen Änderungen im Gehirn erfasst er kernspintomografisch und mit einer speziellen Hirnstrommessung (SEP-mapping). Im zweiten Teil seiner Arbeiten erforscht Ragert, wie sich aktives Training im Vergleich zu fehlendem Training auf das Alltagsleben und die Reorganisation des Gehirns auswirken. Für diese Untersuchungen wählt er drei repräsentative Personengruppen aus: Menschen mit künstlerischen Fähigkeiten (z.B. professionelle Musiker), Patienten mit pathologischen Symptomen (z.B. Schmerz) sowie ältere Menschen. Bei Musikern lässt sich aufgrund ihres enormen Trainings spezifischer musikalischer Fähigkeiten die kortikale Plastizität besonders gut studieren. Patienten mit pathologischen Symptomen wie etwa Schmerzen zeigen infolge fehlenden Trainings durch Nichtgebrauch der betroffenen Extremität häufig erhebliche Reorganisationen im Gehirn. Mithilfe bildgebender Verfahren wie der Kernspintomografie weist er nach, dass Alterungsprozesse deutliche funktionelle Veränderungen im menschlichen Gehirn verursachen. Er will nun herausfinden, ob diese Prozesse in einem Zusammenhang mit eingeschränkten motorischen, sensorischen sowie kognitiven Fähigkeiten stehen. Wo die Geistesblitze herkommen Maler, Werber, Musiker, Schriftsteller – sie alle leben von ihren guten Ideen: Ihr Kapital ist ihre Kreativität. Der präfrontale Kortex im vordersten Bereich des Gehirns hinter der Stirn ist wahrscheinlich Hauptsitz dieser schöpferischen Kraft. Welche kognitiven Vorgänge jedoch genau an den komplexen kreativen Prozessen beteiligt sind und wie sie in dieser Hirnregion auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet werden, ist bisher nicht bekannt. Um diese Fragen zu ergründen, vergleicht Anna Abraham (Biopsychologie) kreative Leistungen von gesunden Probanden mit denen von Patienten mit krankhaften Veränderungen des präfrontalen Kortex, wie sie etwa bei Schizophrenie auftreten. Durch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen hofft sie, auf Funktionen dieser Hirnregion rückschließen zu können. Ihre Hypothese: Die Patienten werden die Kontrollgruppe in einigen kreativen Denkprozessen übertreffen. Denn manche gesunden Abläufe in unserem Denken können bei kreativen Aufgaben eher hinderlich sein. So beziehen wir in die Verarbeitung neuer Informationen immer unsere Erfahrungen und Erwartungen mit ein (top-down processing). Bei schizophrenen Patienten deutet hingegen einiges darauf hin, dass diese Einbeziehung von Vorwissen in kognitive Prozesse bei ihnen vermindert ist – Aufgaben, bei denen es von Vorteil ist, frei von Erfahrungen und Erwartungen zu sein, müssten sie also besser lösen können als gesunde Testpersonen. Diesen Effekt soll ein Experiment belegen: Beide Gruppen sollen ein Tier zeichnen, das auf einem fernen Planeten vorkommen könnte, der vollkommen anders ist als die Erde – eine schwierige Aufgabe, wenn das irdische Vorwissen dabei im Weg steht. Eine solche Begriffserweiterung ist jedoch immer dann notwendig, wenn wir neue Ideen entwickeln. Vorangehende Untersuchungen an gesunden Probanden haben bereits gezeigt, dass Menschen mit stärkeren psychotischen Zügen besser in der Lage sind, ihre Begriffskonzepte zu erweitern (s. auch Bild links im Vergleich zu Bild, rechts oben) als Menschen mit schwächer ausgeprägten psychotischen Merkmalen. Md Vorkommen und Funktion klären: Rezeptor der „Extraklasse“ Einem noch wenig erforschten Rezeptor des zentralen Nervensystems ist Britta Jost (Entwicklungsneurobiologie) auf der Spur: Der sog. GABAC-Rezeptor ist einer von dreien, die für g-Aminobuttersäure (GABA) empfänglich sind. GABA ist der wichtigste hemmende Botenstoff im Nervensystem von Wirbeltieren. Durch das Zusammenspiel zwischen hemmenden und erregenden Botenstoffen wie z. B. Glutamat wird die Nervenzellaktivität im Gehirn reguliert: Trifft GABA auf einen für diesen Botenstoff empfänglichen Rezeptor, so öffnen sich Kanäle, die bestimmte Ionen in die Zelle hineinlassen und so das elektrische Potenzial im Zellinneren herabsetzen. Von diesem Potenzial hängt die Aktivität der Zelle und die Weiterleitung der neuronalen Signalen ab. Während die beiden Rezeptortypen GABAA und GABAB schon seit längerem bekannt sind, entdeckten Wissenschaftler GABAC erst vor einigen Jahren. Dieser Rezeptor unterscheidet sich in der Zusammensetzung seiner Untereinheiten und der daraus resultierenden Empfänglichkeit für verschiedene Botenstoffe so sehr von den anderen beiden GABA-Rezeptoren, dass die Forscher ihm eine eigene Rezeptorklasse zuwiesen. Wo GABAC genau vorkommt, in welchem Entwicklungsstadium eines Organismus er vorhanden (exprimiert) ist und welche Aufgaben er hat, untersucht Britta Jost in ihrer Dissertation. GABAC kommt gehäuft in der Netzhaut und in visuellen Arealen des Gehirns vor, z. B. im Colliculus superior, einer Hirnregion, die an den Koordinationsbewegungen der Augen beteiligt ist. Auch in der Sehrinde lässt sich der Rezeptor nachweisen. Man nimmt daher an, dass GABAC eine Rolle beim Sehprozess spielen könnte. Um herauszufinden, ob der Rezeptor von Geburt an im Gehirn vorhanden ist oder sich erst später etabliert, ob seine Entstehung womöglich durch das Sehen selbst beeinflusst wird, untersucht Britta Jost diverse Gewebeproben aus visuellen Hirnarealen. Mittels molekularbiologischer Techniken kann sie darin enthaltene Rezeptor-DNA für GABAC nachweisen, deren Gehalt in den einzelnen Proben ermitteln und so ein Entwicklungsprofil erstellen. Um zu testen, welche äußeren Faktoren die Entwicklung dieses Rezeptors beeinflussen, legt sie organotypische Zellkulturen von entsprechenden Hirnarealen an und fügt der Nährlösung, die sie versorgt, bestimmte Faktoren zu, die als potenziell einflussreiche Kandidaten infrage kommen. Dieses Kultursystem birgt den Vorteil, dass Neurone nicht einzeln, sondern in ihrem ursprünglichen Verband wachsen können, was eher dem natürlichen Zustand entspricht. Ob eine Zelle den GABAC-Rezeptor enthält, kann sie anhand elektrophysiologischer Messungen nachweisen: Sie stimuliert einzelne Neurone einer organotypischen Zellkultur mit GABA und leitet über eine sog. patch-clamp-Messung den Strom aus dem Zellinneren ab. Dieser durch GABA induzierte Strom setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Er kann von GABAA-, GABAB- und GABAC-Rezeptoren vermittelt werden. Um zu untersuchen ob GABAC-Rezeptoren beteiligt sind, werden spezifische Stoffe, welche die GABAA- und GABAB-Rezeptoren blockieren, verabreicht. Bleibt ein Reststrom, so handelt es sich um den GABAC-vermittelten Anteil, der durch Gabe eines GABAC-Antagonisten eliminiert werden kann. Außerdem versucht Britta Jost mit morphologischen Untersuchungen herauszufinden, wo genau sich die GABAC-Rezeptoren befinden. Die Forscher vermuten, dass sie auf sog. Interneuronen sitzen, d. h. Nervenzellen, die andere Nervenzellen miteinander verbinden. Mithilfe ihrer Daten soll eine Übersicht über das Vorkommen von GABAC entstehen. Außerdem versprechen ihre Ergebnisse genauere Einblicke in die Funktion dieser Rezeptoren im neuralen Netzwerk des Colliculus superior. md