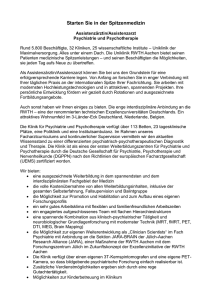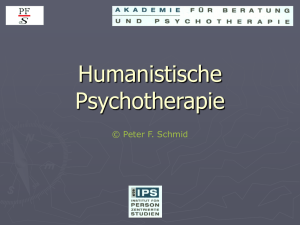Wha - Psychodrama
Werbung
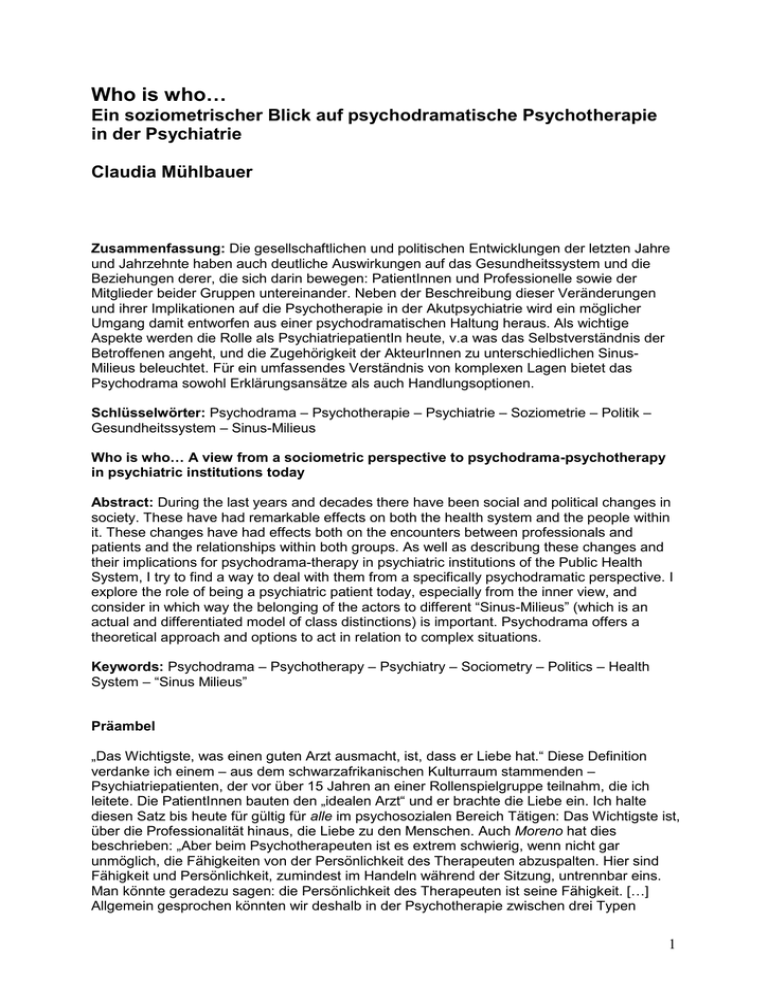
Who is who… Ein soziometrischer Blick auf psychodramatische Psychotherapie in der Psychiatrie Claudia Mühlbauer Zusammenfassung: Die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben auch deutliche Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und die Beziehungen derer, die sich darin bewegen: PatientInnen und Professionelle sowie der Mitglieder beider Gruppen untereinander. Neben der Beschreibung dieser Veränderungen und ihrer Implikationen auf die Psychotherapie in der Akutpsychiatrie wird ein möglicher Umgang damit entworfen aus einer psychodramatischen Haltung heraus. Als wichtige Aspekte werden die Rolle als PsychiatriepatientIn heute, v.a was das Selbstverständnis der Betroffenen angeht, und die Zugehörigkeit der AkteurInnen zu unterschiedlichen SinusMilieus beleuchtet. Für ein umfassendes Verständnis von komplexen Lagen bietet das Psychodrama sowohl Erklärungsansätze als auch Handlungsoptionen. Schlüsselwörter: Psychodrama – Psychotherapie – Psychiatrie – Soziometrie – Politik – Gesundheitssystem – Sinus-Milieus Who is who… A view from a sociometric perspective to psychodrama-psychotherapy in psychiatric institutions today Abstract: During the last years and decades there have been social and political changes in society. These have had remarkable effects on both the health system and the people within it. These changes have had effects both on the encounters between professionals and patients and the relationships within both groups. As well as describung these changes and their implications for psychodrama-therapy in psychiatric institutions of the Public Health System, I try to find a way to deal with them from a specifically psychodramatic perspective. I explore the role of being a psychiatric patient today, especially from the inner view, and consider in which way the belonging of the actors to different “Sinus-Milieus” (which is an actual and differentiated model of class distinctions) is important. Psychodrama offers a theoretical approach and options to act in relation to complex situations. Keywords: Psychodrama – Psychotherapy – Psychiatry – Sociometry – Politics – Health System – “Sinus Milieus” Präambel „Das Wichtigste, was einen guten Arzt ausmacht, ist, dass er Liebe hat.“ Diese Definition verdanke ich einem – aus dem schwarzafrikanischen Kulturraum stammenden – Psychiatriepatienten, der vor über 15 Jahren an einer Rollenspielgruppe teilnahm, die ich leitete. Die PatientInnen bauten den „idealen Arzt“ und er brachte die Liebe ein. Ich halte diesen Satz bis heute für gültig für alle im psychosozialen Bereich Tätigen: Das Wichtigste ist, über die Professionalität hinaus, die Liebe zu den Menschen. Auch Moreno hat dies beschrieben: „Aber beim Psychotherapeuten ist es extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die Fähigkeiten von der Persönlichkeit des Therapeuten abzuspalten. Hier sind Fähigkeit und Persönlichkeit, zumindest im Handeln während der Sitzung, untrennbar eins. Man könnte geradezu sagen: die Persönlichkeit des Therapeuten ist seine Fähigkeit. […] Allgemein gesprochen könnten wir deshalb in der Psychotherapie zwischen drei Typen 1 professioneller Darstellung unterscheiden: Fähigkeit ohne Liebe, Liebe ohne Fähigkeit und Fähigkeit plus Liebe.“ (Hutter 2009b, S. 451f). Allerdings scheint mir manchmal, dies würde heute für unwesentlicher gehalten als vor 15 oder 20 Jahren und die Liebe in den aktuellen Settings vielleicht auch schwerer zu verwirklichen sein. Die axiodramatische Ebene Ferdinand Buer pointiert in einem Artikel über psychodramatische Ethik, Psychotherapie (wieder) zu denken und zu realisieren als einen „Dienst am Menschen“ gehe über „die gesetzlich fixierte und versicherungsrechtlich abgesicherte Psychotherapie“ hinaus (vgl. Buer 2004, S. 38). Diesem Dienst am Menschen steht in der heutigen Situation das Risiko gegenüber, sich in Formalitäten und Dokumentationsrichtlinien zu verzetteln. Für therapeutisches Arbeiten, Begegnung und ein umfassendes Krankheitsverständnis ist die Berücksichtigung des gesellschaftlichen und politischen Kontexts unerlässlich. Dieser ist der Rahmen für Heilung i.S.v. Reduktion der psychopathologischen Symptomatik, aber auch für verbesserte Selbstakzeptanz des jeweils individuell Imperfekten. Dies wird aktuell von AutorInnen mit unterschiedlichen theoretischen, praktischen, professionellen und biographischen Hintergründen herausgearbeitet. Manfred Lütz (2011) stellt provokativ fest, dass wir in unseren Psychiatrien die Falschen behandeln. Juli Zeh greift das Thema des steigenden Anpassungsdrucks und der Sanktionierung von Eigenwilligkeit literarisch auf (2010 vgl. z.B. S. 186). Und Peter Kruckenberg, setzt sich unter der Überschrift „Perspektiven der Krankenhausbehandlung“ (2010, S. 426ff) mit der Frage auseinander, was das zukünftige Entgeltsystem aus den Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik machen wird. An den beiden ersten Stellen der Prozessqualität nennt er Beziehungsarbeit und Lebensweltbezogenheit (ebd.), was sich leicht in psychodramatische Sprache übersetzen lässt: Psychiatrie kann nur heilend und hilfreich wirken, wo Begegnungsräume geschaffen werden (können). Seiner Schlussfolgerung, dass dies durch die Erarbeitung von Operationen- und Prozedurenschlüsseln („OPS“) in 25-MinutenLeistungspaketen, die pflegerische und milieutherapeutische Behandlung vernachlässigen, kaum gelingen kann, ist nichts hinzuzufügen (vgl. ebd. S. 429-431).1 Letzteres beinhaltet auch das Risiko einer unnötigen Spaltung zwischen den Berufsgruppen, die jedoch im Stationsalltag darauf angewiesen sind, als Team zusammen zu arbeiten. Einige Professionen, v.a. die akademischen Berufe, die untereinander und jeweils in sich wiederum hierarchisch geordnet sind, werden als Leistungsträger aufgebaut. Andere Berufe hingegen (z.B. Pflegekräfte und nicht-psychologische TherapeutInnen) erfahren unter dem primär ökonomischen Blickwinkel weniger Wertschätzung, als ihrer realen Bedeutung im therapeutischen Geschehen entspricht. Dies ist keine Zwangsläufigkeit. Hutter (2010b, S. 218) arbeitet heraus, dass es sich dabei um eine von Interessen geleitete, berufspolitisch gewollte, historische Entwicklung handelt, während „therapeutische Wirksamkeit für Moreno nicht an professionellen Status gebunden ist (…). Wirksamkeit beruht für ihn auf Begegnungsfähigkeit und nicht auf akademischen Qualifikationen.“ Die soziodramatische (gesellschaftliche) Ebene Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine stärkere Statusorientierung soziometrische Implikationen auf das Rollenverständnis von Berufsgruppen und einzelnen Personen hat. An eher positiven Folgen sind eine klarere Aufgabenteilung und Verantwortungszuschreibung zu nennen. Die meines Erachtens aber überwiegenden, eher negativen Konsequenzen sind eine geringere Identifikation mit dem Gesamtzusammenhang und weniger Stolz auf die Teamleistung. Damit verbunden ist eine punktuell niedrigere Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme durch einzelne („dafür werde ich schließlich nicht bezahlt“). Wo dies z.B. zu einem Rückgang des Austauschs relevanter Informationen führt, ist der Nachteil für die PatientInnen direkt sichtbar. Die Relevanz der Beobachtungen des Pflegepersonals im Stationsalltag kann jedeR klinisch Tätige betätigen. 2 Die Analyse des Rollenverständnisses kann um milieuspezifische Aspekt erweitert werden. Dafür soll kurz das Modell der Sinus-Milieus® vorgestellt werden. Die zehn SinusMilieus® sind gruppiert nach den Kriterien „Soziale Lage“ und „Grundorientierung“ (vgl. Merkle & Wippermann 2008, S. 29). In der Dimension der sozialen Lage findet sich der klassische Begriff der „Schicht“ und es wird die Trennung zwischen Oberschicht/Obere Mittelschicht, Mittlere Mittelschicht und Untere Mittelschicht/Unterschicht abgebildet. Diese wird in der zweiten Dimension durch die Differenzierung der lebensweltlichen Orientierung der Menschen ergänzt. Hier unterscheidet die Sinusstudie Orientierungen an Traditionellen Werten (wie Pflichterfüllung und Ordnung), Modernisierung/Individualisierung (mit den Stichwörtern Individualisierung, Selbstverwirklichung und Genuss) und Neuorientierung (die umfasst Multi-Optionalität, Experimentierfreude und Leben in Paradoxien) voneinander. Die frühere „Oberschicht“ setzt sich hier vor allem zusammen aus Konservativen, Etablierten, Postmateriellen und Modernen Performern. Gemeinsam ist diesen Gruppen ein relativ hohes Einkommen und eine ebensolche Bildung. Daran schließen sich an die Milieus der DDRNostalgischen, der Bürgerlichen Mitte und der Experimentalisten, die in etwa der „Mittelschicht“ entsprechen würden. Die Traditionsverwurzelten erstrecken sich von der Unterschicht bis in die mittlere Mittelschicht. Und schließlich als Milieus mit niedrigen Einkommen und geringer formaler Bildung die Gruppen der Traditionsverwurzelten, der Konsummaterialisten und der Hedonisten. Außerdem werden einbezogen der familiäre und gesellschaftliche biographische Hintergrund, wie z.B. Migration oder DDR-Sozialisation. Innerhalb dieser Gruppen kann dann wieder eine Differenzierung der Milieus vorgenommen werden, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen lässt. Die Milieustudien von Sinus Sociovision verdeutlichen beispielsweise, dass Moderne Performer mit und ohne Migrationshintergrund mehr gemeinsam haben als Traditionsverwurzelte und Moderne Performer der gleichen Ethnie. Womit jede Aussage über „die Türken“ oder ähnliche Pauschalisierungen gänzlich unsinnig werden. Vor wenigen Jahrzehnten konnte bei PatientInnen und Beschäftigten von einer klaren Schichtzugehörigkeit und der Identifikation damit ausgegangen werden. Diese Eindeutigkeit ist heute aufgelöst – zugunsten einer höheren Komplexität im Sinne einer größeren Vielfalt an möglichen Lebensentwürfen, die sich nicht selten als überfordernde Überkomplexität erweist. In einer Aktualisierung der Studie 2010 (s. www.Sinus-Milieus) fällt auf, dass die ehemalige Dreiteilung einer faktischen Vierteilung der sozialen Lage weicht: ein prekäres Milieu, dem immerhin fast 9 Prozent der Deutschen zuzurechnen ist, markiert eine von gesellschaftlichen Prozessen abgehängte Unterschicht. Das Modell der Sinus-Milieus erhellt somit nicht nur eine Binnendifferenzierung in der Gesellschaft und damit einhergehend in der MitarbeiterInnenschaft und Klientel der Psychiatrie, sondern auch eine Abgrenzung, die bis hin zur Abschottung gehen kann. Die gemeinsame Werte- und Erfahrungsbasis von Menschen aus unterschiedlichen Milieus ist geringer als noch vor wenigen Jahrzehnten, weil es weniger Begegnungsmöglichkeiten und Begegnungsnotwendigkeiten gibt. Merkle & Wippermann (vgl. 2008, S. 50) nennen dies soziale „Demarkationsgräben“, die eine „stärker werdende räumliche und kulturelle Segregation“ zur Folge hätten, zu beobachten sei dies z.B. an der „erheblichen Entmischung von Stadtteilen“2. Diese – aus der Binnensicht der Milieus sinnvolle – Abgrenzung geschehe zum Teil massiv, zum Teil durch „subtile Signale der Distinktion“: die Folge sei jedoch in beiden Fällen „mit Blick auf soziale Integration und gesellschaftliche Solidarität (…) fatal: Wenn Kinder heute keinen Kontakt mehr zu Menschen unterer Schichten haben, (…) dann wird keine Empathie und kein Grund für Solidarität entwickelt. Solidarität wird zum Abstraktum“ (Merkle & Wippermann 2008 vgl. S. 51f). Bernd Ulrich (2011) schreibt von einem „Schweigekartell“, nämlich dem „Verdrängen der unmoralischen Seite unseres Lebens durch Geschäftigkeit“, zu dessen Erhalt es erforderlich oder wenigstens günstig sei, „dass sich die sozialen Klassen nicht allzu oft begegnen, und wenn doch, dass sie dann darüber nicht reden.“ Einige Sätze zum Genderbewusstsein der in der Psychiatrie Tätigen: dies scheint mir oft wenig vorhanden – von einem, aufgrund ihrer Unterrepräsentanz nachvollziehbaren, relativ unreflektierten Männerbonus einmal abgesehen. So werden Männer teilweise eher geschätzt und gefördert, weil sie wenige sind als wg. ihrer tatsächlichen Leistungen. In den 3 Führungspositionen allerdings gilt auch in der Psychiatrie wie in anderen Bereichen mit allen Implikationen der (Un-)Vereinbarkeit von Kindern und Karriere: es ist eine geringere Bereitschaft von Frauen zu konstatieren, sich in den vorhandenen Strukturen zu engagieren. Buer (2004) weist auch zu recht auf die Bedeutung hin, die die Einbeziehung der unbelebten Umwelt hat, was in der Psychotherapieliteratur heute eher selten der Fall ist. Diese Erkenntnis scheint in den 80-er Jahren unter dem Eindruck der „68-er Revolution“ mit der Marxschen These vom Sein, das das Bewusstsein bestimmt und der PsychiatrieEnquete bzw. den Radeberger Thesen selbstverständlicher gewesen zu sein als heute (vgl. z.B. Victor Chu (1988) mit „Psychotherapie nach Tschernobyl“3 und Dörner/Plog „Irren ist menschlich“ von 1984). Die Akzeptanz der Rolle als PsychiatriepatientIn ist sowohl von individuellen als auch von gesellschaftlichen Werten beeinflusst. Insofern hätte sie auch bereits im vorigen Abschnitt der axiomatischen Erwägungen reflektiert werden können. Gleichzeitig spiegelt sie einen soziometrischen Status, der nach wie vor denkbar gering ist. Ein Hinweis darauf ist die Praxis der privaten Krankenversicherungen, bei denen immer noch eine auch nur ambulante Psychotherapie vor mehreren Jahren ein Aufnahmehindernis darstellt. In der Umkehrung wird die Übernahme von Behandlungskosten von psychischen Krankheiten restriktiv gehandhabt oder ausgeschlossen. Wir erleben aktuell eine Reduktion und eine zunehmend restriktiven Handhabung, wenn Sozialleistungen gewährt werden. Gleichzeitig entwickelt sich der Arbeitsmarkt negativ. So sind bei einem offenen Umgang mit einer psychischen Erkrankung eher wieder höhere individuelle Kosten zu erwarten als es zwischenzeitlich einmal der Fall gewesen sein mag. Insofern könnte sogar der Begriff der Re-Stigmatisierung zutreffend sein. Die soziometrische Ebene4 Die soziometrischen Verwicklungen und Verwerfungen haben Auswirkungen auf das Team als Gruppe, welches – für die PatientInnen – modellhafte Beziehungen untereinander hat. Ein Faktor dabei, der in seiner Bedeutung nicht zu überschätzen ist, ist die Konfliktfähigkeit der Teammitglieder: „Wie der einzelne psychiatrisch Tätige durch seine Person wirkt, so das Team durch die Beziehungen seiner Mitglieder. Daher sollte das Team (…) auch nach (…) sozialer Schicht (…) unterschiedlich sein.“ schrieben Klaus Dörner und Ursula Plog 1984 (Dörner/Plog 1992, 7. Auflage, S. 279). Über den Umgang miteinander wird die Gesamtatmosphäre geschaffen und beeinflusst. Dies ist schwierig positiv zu gestalten in Phasen, in denen ein Team sehr mit sich beschäftigt ist. Die oben benannte Ausdifferenzierung der Milieus beinhaltet unsichere Beschäftigungsverhältnisse eines Teils der Angestellten und ist gleichzeitig mit bedingt durch diese. Wir erleben heute in der deutschen Nachkriegsgeschichte bisher nicht bekannte prekäre Arbeitsbedingungen auch für qualifiziertes Personal. Dies bewirkt größere ökonomische und damit teilweise auch emotionale Abstände zwischen hierarchisch u.U. sogar gleich gestellten Individuen in der kollegialen Rolle als noch vor einem Jahrzehnt. Das betrifft sowohl das Freizeit- und Konsumverhalten, als auch Werte(-hierarchien) und Weltund Selbstverständnis. In Verbindung mit der oben beschriebenen Reduktion der formalen und informellen Begegnungen der Milieus untereinander stellt dies eine Herausforderung dar: die Wertschätzung von Unterschiedlichkeit kann im beruflichen Feld alltäglich gelebt werden anstatt nur ein Lippenbekenntnis der Milieus, in deren Wertekanon sie passt, darzustellen. Die Gruppe der PatientInnen beschreibe ich nun an dritter Stelle: Spiegelt sich darin ein Stück des psychiatrischen Alltags oder ist es nur dem Aufbau des Artikels geschuldet? Die Beziehungen zwischen PatientInnen und MitarbeiterInnen sind heute egalitärer als früher, v.a. bei freiwilligen Klinikaufenthalten.5 Ebenso treffen wir heute teilweise auf gut oder halbwegs gut informierte PatientInnen, was neben Vorteilen auch Schwierigkeiten bedeuten kann. Ich erinnere mich z.B. lebhaft an die Diskussionen über Anti-Depressiva vor ca. 2 1/2 Jahren, als der Skandal um nicht publizierte Studien von den Medien auf das Schlagwort„Anti-Depressiva sind nicht wirksam“ verkürzt wurde. 4 Andererseits macht sich auch hier das Auseinanderklaffen der Milieus bemerkbar: immer häufiger begegnen uns PatientInnen, die als „DauerzeitarbeiterInnen“ trotz 3-SchichtSystem kein ausreichendes Gehalt erzielen oder sich mit der Rolle als „Hartzer“ abgefunden haben. Wenn noch deutlich unterschiedliche Wertvorstellungen und Sozialisationserfahrungen und vielleicht ein erheblicher Altersunterschied hinzukommen, braucht es viel Professionalität und Engagement für gelingende Kommunikation oder sogar Begegnung und um gemeinsame Therapieziele zu finden. Allerdings hat diese Betrachtung der veränderten Umstände auch ein entlastendes Moment, da die Interaktion mit fremden „Kulturen“ mehr Kompetenz erfordert und mehr Konfliktpotential enthält als in homogeneren Dyaden oder Gruppen. Sowohl die Fähigkeit als auch die Bereitschaft, auf andere Gruppen zuzugehen, sind eng verbunden mit der Kongruenz mit der eigenen Rolle und der sozialen Vernetzung innerhalb der eigenen Gruppe.) Um die eigene PatientInnen-Rolle akzeptieren zu können, ist eine Voraussetzung, die wenn auch schmerzhafte fortbestehende Stigmatisierung anzuerkennen. Nur von dieser realistischen Position ausgehend, lässt sich die (neue) Rolle angemessen gestalten und füllen, womit wieder die bereits oben beschriebene notwendige Einbeziehung des gesamtgesellschaftlichen Kontexts ins Spiel kommt. Psychodramatische Psychotherapie in der Psychiatrie heute Die Einbeziehung der verschiedenen Aspekte und Ebenen ist gewährleistet, wenn wir als psychodramatische Perspektive die szenische Diagnostik wählen (vgl. Hutter 2009b, S. 27ff). D.h. für Diagnostik und Behandlung relevante Faktoren sind: die somatische Ebene, also der Körper als direktes und indirektes Kommunikationsinstrument und evtl. Symptomträger. Alleine durch die Körperlichkeit der Beteiligten ist diese Ebene unmittelbar relevant und Teil des therapeutischen Geschehens. die soziodramatische (gesellschaftliche) Ebene mit den vielfältigen, uns beeinflussenden Umweltfaktoren. die soziometrische, konkrete Beziehungen betreffende Ebene. die psychodramatische Ebene, die biographische Erfahrungen enthält und uns als PsychodramatikerInnen wohl am vertrautesten ist. die axiodramatische Ebene, die ebenfalls immer mindestens implizit wirkt, da Psychodrama auch eine Haltung, nicht nur eine Methode ist. schließlich die Einzigartigkeit jeder Szene, Lage und Begegnung – über alle Verallgemeinerungen hinaus. Ein solch komplexes und umfassendes Modell anzuwenden ermöglicht ein Verständnis und Interventionsansätze über Psychopathologie und bloße Symptomorientierung hinaus. Allerdings sind die von Yalom 1980 (vgl. ‚Yalom 2000³) benannten, methodenübergreifenden zentralen Themen für Psychotherapie6 bei immer kürzeren Liegezeiten weniger in der Tiefe bearbeitbar. Stattdessen kann in aktuellen Konflikten Hilfestellung gegeben werden, versucht werden, Orientierung zu geben, zu einer längerfristigen, auch ambulanten Psychotherapie motiviert werden und Hoffnung gemacht werden auf eine Veränderung der Lage durch eigene Handlungsoptionen. Und – last not least – was Schacht (2009) über das Status-nascendi-Modell psychodramatisch begründet, reduziert eine Entscheidung zur Nicht-Veränderung die Hilflosigkeit im Unterschied zu einem passiven Verharren in der Situation. Dies ist nachvollziehbar bei Betrachtung des Prozesses: die Situation zu belassen, wie sie ist, erscheint dann als eine von mehreren Optionen und zwar als die, die schließlich gewählt wird. (Und dadurch besteht ebenso die Möglichkeit, dass sie eines Tages abgewählt wird.) Indem eine bewusste Wahl getroffen wurde, entsteht eine neue Lage. 5 Worin liegt das Potential des Psychodramas auch bei eher kurzen Therapiezeiten? An erster Stelle im Moment der Ermächtigung in der Katharsis und des sich Erlebens als GestaltendeR und HandelndeR. Dies betrifft sowohl die Kraft von Symbolarbeit als auch früher Erlebtes und aktuelle Konflikte durch szenisches Arbeiten sichtbar zu machen. Hierin sind beinhaltet Rollenerweiterung durch übendes Spiel und heilende Erfahrungen durch Wunscherfüllungen. Wenn schließlich in einer halboffenen Gruppe über mehrere Wochen hinweg eine ausreichende Gruppenkohäsion entsteht, werden neue reale Beziehungserfahrungen gemacht. Bestenfalls umfassen diese sowohl unterstützende Anteile als auch die Möglichkeit, im Schutz der Gruppe, mit therapeutischer Hilfe und psychodramatischen Techniken gelingende Konfliktlösung zu erleben. Wenn das Eis erst einmal gebrochen ist, ist immer wieder die Erfahrung zu machen, dass es oft der Wunsch der Patientinnen ist, bei den nächsten Gruppenterminen psychodramatisch zu arbeiten. Dies mag auch damit zu tun haben, dass eine verantwortungsvoll geleitete Psychodramatherapiegruppe durch ihre Struktur ausreichend Sicherheit bietet ohne rigide zu sein. Ebenso sind die psychodramatischen Sequenzen häufig das, was im Rückblick von den PatientInnen am intensivsten und auch am positivsten erinnert wird als zentrale Momente ihrer Therapie. Dies führe ich auf die multimodale Erfahrung im Handeln, die Erkenntnisintensität im Rollentausch und die kathartischen Momente des Psychodramas zurück. Für Therapie-Unerfahrene kann bereits eine Anfangssoziometrie weit über eine Anwärmübung hinaus eindrücklich sein: Zugehörigkeit wird hier leibhaftig sichtbar und spürbar gemacht. Häufig steht vor der Arbeit an weiter gehenden Therapiezielen die Akzeptanz der Rolle als PsychiatriepatientIn als Voraussetzung für therapeutische Erfolge und Heilung. (Oder vielleicht ist dies das weitest gehende Therapieziel? Erst wenn wir in der Lage sind, uns selbst in unserer aktuellen Situation zu akzeptieren, erleben wir unsere eigene Kraft und haben Zugang zu ihr, was vieles ermöglicht.) Deutlich wird immer wieder eine Hierarchisierung, die auch die Betroffenen als Mitglieder unserer Gesellschaft mittragen und reproduzieren: am leichtesten lässt sich zu einem „Burn-Out“ stehen, da dieser ja teilweise geradezu heroisiert wird: „nur die Besten brennen aus“ (vgl. Hutter 2010a). Auch „eine Depression haben“ ist noch einigermaßen akzeptabel, da diese inzwischen als „Volkskrankheit Nr. 1“ bekannt ist. Fast vergleichbar im (gesamtgesellschaftlichen und therapiegruppeninternen) Ranking liegen die Angsterkrankungen. Sogar den MitpatientInnen gegenüber werden jedoch Psychosen und v.a. auch Suchterkrankungen verschwiegen, mindestens am Anfang. Eine Sonderstellung nehmen Persönlichkeits- und auch Essstörungen ein, die individuell sehr unterschiedlich präsentiert werden: von sehr versteckt bis geradezu demonstrativ gibt es hier viele Variationen. Neben anderen Techniken ist zur Erforschung und Akzeptanz der eigenen Rolle als PatientIn soziometrisches Arbeiten besonders hilfreich. So können z.B. unter dem Kriterium Erkrankungsdauer einerseits Erfahrungen in diesem Zeitraum aus einer neuen Perspektive gesehen werden und andererseits auch die Inanspruchnahme von Hilfe positiv konnotiert werden. Ebenfalls sinnvoll ist die Arbeit mit dem Sozialen Atom. Hier wird die psychodramatische Haltung ebenso direkt vermittelt wie bei soziometrischer Arbeit: Die Vorgabe ist die Sicht auf den Menschen als zutiefst soziales Wesen, das Begegnung als Bedeutungserleben existentiell benötigt. Dies ist meine axiomatische Setzung als Psychodramatikerin, um die ich mit den PatientInnen ringe, z.B. wenn mir der unverwundbare „Lonesome Cowboy“ als positivstes aller Rollenmodelle präsentiert wird. Zu beachten ist, dass die Arbeit mit dem Sozialen Atom für PatientInnen häufig eine größere Herausforderung und ein weit konfrontativeres Verfahren darstellt als z.B. für AusbildungsteilnehmerInnen. Das soziale Netz der PatientInnen ist häufig ungenügend bzw. gerade durch kritische Lebensereignisse (Tod von Bezugspersonen, Trennung, Umzug) im unmittelbaren Vorfeld der psychischen Erkrankung dünn geworden. Ein ressourcenorientiertes Vorgehen ist also zu empfehlen, z.B. indem ausdrücklich aufgefordert wird, auch anderes Bedeutsames als Personen (so unterschiedliche Kategorien wie Gott, Hobbys und Tiere kommen hier in Frage) darzustellen. Alternativ kann auch versucht werden, das Soziale „Wunsch-Atom“ zu gestalten. In der Einzel- und Gruppentherapie kann in allen 6 Fällen daran weiter gearbeitet werden, wie sich gewünschte Veränderungen aktiv beeinflussen lassen. Psychodrama stellt darüber hinaus eine unmittelbare multimodale Erfahrung dar7, die die somatische Ebene, inkl. der neurologischen Vorgänge einschließt, und gleichzeitig eine soziale Erfahrung ermöglicht – im Kontakt mit einer Gruppe oder im Monodrama in der therapeutischen Beziehung. Im Rückbezug auf die PatientInnenrolle bietet die Methode Psychodrama im Format Psychotherapie im Setting psychiatrische Klinik wertvolle Angebote zur Erweiterung der vorhandenen Rollenanteile um aktive Momente: Es werden soziometrische Wahlen und andere Entscheidungen getroffen und Handlungen ausgeführt. Somit erhöht Psychodrama-Therapie wahlweise die Rollenflexibilität, Kreativität und Spontaneität oder steigert in verhaltentherapeutischer Terminologie die Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder verbessert in tiefenpsychologischer Sprache die Differenzierung der Ich-Struktur und Mentalisierungsfähigkeit. Die Einsicht, dass wir dafür wissenschaftliche Nachweise erbringen müssen, setzt sich bei immer mehr KollegInnen durch und es gibt mittlerweile auch einen internationalen Konsens, welche Messinstrumente und Forschungsdesigns sich dafür eignen. So ist zu hoffen, dass wir in einigen Jahren über eine solide Datenbasis zur Wirksamkeit von Psychodrama-Therapie verfügen, in der die Erfahrungen von praktisch Tätigen PsychodramatikerInnen repräsentiert sind. Die Schlussfolgerung aus diesen Darlegungen ist, dass Psychodrama auch unter heutigen Bedingungen eine geeignete Therapieform für den Einsatz in der Akutpsychiatrie ist. Und wir das bald durch Evaluation und Forschung weiter begründen können. 7 Literatur Buer, F. (2004). Morenos therapeutische Philosophie und psychodramatische Ethik. In: J. Fürst, K. Ottomeyer, H. Pruckner (Hrsg.), Psychodramatherapie (S. 30 – 58) Wien: facultas Chu, V. (1988) Psychotherapie nach Tschernobyl Frankfurt/M: Zweitausendeins Dörner, K. & Plog, U. (1992, 7. Auflage) Irren ist menschlich Bonn: Psychiatrie Verlag Hutter, Ch. (2009a). Das Kind, das ich war, spielt immer mit Vortrag vom 25.05.2009 Hutter, Ch. (2009b). J.L.Morenos Werk in Schlüsselbegriffen Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Hutter, Ch. (2010a). Burn-Out. Unveröffentlichte Arbeitsmaterialien, überlassen am 25.01.2010 Hutter, Ch. (2010b). Begegnung als Konzept. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie 2/2010 211 - 224 Kruckenberg, P. (2010). Perspektiven der Krankenhausbehandlung. Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis 2/2010, 426 – 431 Lütz, M. (2011). Irre! Wir behandeln die Falschen Goldmanns Taschenbücher Merkle, T. & Wippermann, C. (2008). Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung von Sinus Sociovision im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. In: Henry-Huthmacher, Ch. & Borchard, M., Eltern unter Druck Stuttgart: Lucius & Lucius Schacht, M. (2009). Das Ziel ist im Weg Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Sinus-Milieus. http://www.sinus-institut.de, 13.03.2011 Ulrich, B. (2011) Was ist gerecht? DIE ZEIT 17.02.2011 S.1 Yalom, I. (2000³). Existentielle Psychotherapie Köln: Edition Humanistische Psychotherapie Zeh, J. (2010). Corpus delicti btb Claudia Mühlbauer 1964, Dipl. Psychologin, Psychodrama-Therapeutin und Trainerin, Approbation als Psychologische Psychotherapeutin (Tiefenpsychologie), Anerkennung als Suchttherapeutin (VdR); Vorstandsmitglied des Psychodrama-Instituts für Europa, Landesverband Deutschland (PIfED e.V.); Mitglied im Psychodrama-Institut für Europa (PIfE e.V.); Mitarbeit in der Weiterbildungskommission des Deutschen Fachverbands für Psychodrama (DFP e.V.) und im Research Committee der Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO). Tätig als Psychotherapeutin in psychiatrischer Klinik (Tagesklinik und Ambulanz) und freiberuflich (Psychotherapie, Supervision und Psychodrama-Ausbildung) Berlin [email protected] oder [email protected] Schlüsselwörter: Psychodrama – Psychotherapie – Psychiatrie – Soziometrie – Politik – Gesundheitssystem – Sinus-Milieus – Rolle – Axiodrama – Szenische Diagnostik C. Mühlbauer Lenaustr. 12, D-12047 Berlin E-Mail: [email protected] 1 Die Möglichkeit eines Transfers dieses und der folgenden Problembereiche auf andere psychosoziale Arbeitsfelder (z.B. Jugend- und Suchthilfe) und andere Settings (z.B. Beratungsstellen und Reha-Kliniken) erscheint mir höchst plausibel und wahrscheinlich. Die detaillierte Beschreibung möchte ich den jeweils dort tätigen PsychodramatikerInnen überlassen. 8 2 So gibt es in Berlin bestimmte Viertel („Kieze“), aus denen die besser verdienenden und gebildeten Eltern wegziehen, sobald die Kinder das schulpflichtige Alter erreichen. Ohne Recherche von statistischen Zahlen lässt sich dies z.B. erleben an einem sonnigen Sonntagnachmittag in einer Eisdiele in Kreuzberg. 3 Mit erneut grauenhafter Aktualität während der Überarbeitung dieses Artikels Mitte März 2011… 4 In der Beschreibung der Beziehungen sind die dabei agierenden Rollen und Gegenrollen enthalten, auch wenn sie im Folgenden nicht an jeder Stelle explizit benannt sind. 5 Die Extremsituationen während des Nationalsozialismus, als Ärzte und PflegerInnen teilweise zu Mördern oder deren HandlangerInnen wurden, führe ich hier nicht weiter aus. Ebenso wenig die Bereiche, in denen während der DDR die Psychiatrie Teil des Repressionsapparates war. Dennoch gehe ich davon aus, dass diese historischen Schrecken bis heute Schatten werfen auf die deutsche Psychiatrie. (Vgl. dazu auch Hutter 2009a „Das Kind, das ich war, spielt immer mit“.) 6 In aller Kürze aufgeführt: existentielle Einsamkeit und dennoch bzw. deshalb die Notwendigkeit zu relevanten Beziehungen; die Pflicht zur Verantwortungsübernahme; die Aufgabe, individuell Sinn im Leben zu finden und die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, also dem Tod. 7 Es ist somit unmittelbar anschlussfähig sowohl an die Schematherapie als auch an die mentalisierungsbasierten Techniken. 9