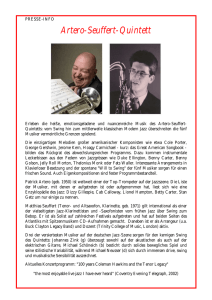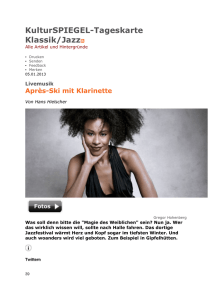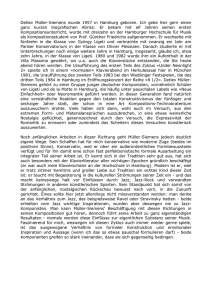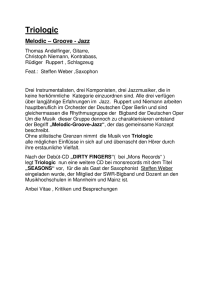Elemente des Jazz
Werbung

1 Schulfunk Bayern2Radio, 17. 09. – 20. 10. 2002 Hintergrund Elemente des Jazz “Das ist eines von den Dingen, die ich am Jazz liebe, my boy. Ich weiß nicht, was als Nächstes passiert. Weißt du das? Letzten Endes: Wer weiß das überhaupt?” Wenn das schon Bix Beiderbecke, der Kornettist und Pianist, der den Chicago-Style entwickelt hat, nicht wusste, dann sollten wir uns wohl mit Prognosen ebenfalls zurückhalten. Die nicht sehr mutige Voraussage, dass sich der Jazz weiterentwickeln wird, dass neue Stile und Schwerpunkte, ja sogar neue “Elemente” entstehen werden, hat sich längst schon bestätigt. Quincy Jones‘ Unternehmen, Jazz mit Hilfe afrikanischer griot-storytellers “Back On The Block” zu holen, hat zwischenzeitlich immerhin zum Entstehen eines neuen Stils geführt, den man etwa als “Hip-Hop-Jazz” (“Hip-Hop” in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, als Oberbegriff für die komplette Getto-Kultur in L.A. bzw. der Bronx) bezeichnen könnte. Aber wer sich mit aktueller Musik beschäftigt, muss immer das Verfallsdatum im Ohr behalten. Die rasante Stilentwicklung des Jazz (wie auch der modernen E-Musik, die sich in die “Stilbezeichnung” Neue Unübersichtlichkeit geflüchtet hat), war für die schreibende Zunft der Kritiker und Analysten schon immer ein Problem. Hundert Jahre Jazz in drei Stunden darzustellen ist also ein Versuch, der weniger vom Mut, als vom Zwang zur Lücke bestimmt ist. Im Rückblick auf dieses furiose Kapitel der Musikgeschichte muss man sich sogar fragen, ob ein Oberbegriff, dieses Wort “Jazz”, dessen Herkunft nie genau geklärt wurde, überhaupt geeignet ist, das Genre hinreichend zusammen zu fassen, geschweige denn zu definieren. Jazz ist vielmehr ein Konglomerat von Stilen und Genres das im Grunde schon seit Jahrzehnten spätestens seit dem Freejazz, der nicht zufällig ursprünglich als “New Thing” bezeichnet wurde - nicht mehr unter einem Oberbegriff subsumiert werden kann. Aber ein gewisser Mangel an Präzision haftet musikalischer Terminologie schon immer und in allen Bereichen an: Wer weiß auf Anhieb, wer oder was gemeint ist, wenn von “klassischer Musik” die Rede ist? Und schließlich: Jazz ist kein ausschließlich musikalisches Phänomen, er ist immer nur verständlich in einem gesellschaftlichen Kontext. Am deutlichsten wird dies bei der Rekonstruktion seiner Entstehungsgeschichte; aber auch seineStilentwicklung wird erst nachvollziehbar und begreiflich, wenn man den gesellschaftlichen Background in die Betrachtung einbezieht. Sicher, das gilt im Prinzip für jede Musik, aber selten sind diese Zusammenhänge so gravierend und letztlich auch offensichtlich, wie beim Jazz. Der Titel der Reihe “Elemente des Jazz” verdeutlicht das Konzept, seine hundertjährige Entwicklung nicht chronologisch darzustellen, sondern vielmehr seine wesentlichen Merkmale, seine typischen Phänomene querschnittartig zu untersuchen. Solche “Elemente”, die durch alle “Epochen” hindurch kostituierend wirken, sind die Rhythmik, der Sound, die Improvisation und der erwähnte soziologisch-historische Kontext. Auch im 5. Kapitel, wo die Stilentwicklung in Zeitraffer zusammengefasst ist, geht es weniger um eine komplette Stilgeschichte, als um die zeitlosen Bedingungen von Stilwandel. Der Blues, als der schwer zu definierende “Spirit” des Jazz bzw. die “Borderliners” zu E-Musik und Rock, rahmen diese Elementarstudien ein. Jazz wird, sobald man seine Mainstreams verlässt, sehr schnell zur Insidermusik, am deutlichsten wird dies wahrscheinlich beim Freejazz. Gerade deshalb, und weil auch der engagierte Hörer hier bedient werden soll, wurde diese interessante Ausprägung afroamerikanischer Musik hier nicht verschämt in den 2 Hintergrund gedrängt. “Easy-listening” erschließt wohl in kaum einem Musikgenre die gesamte Bandbreite des künstlerischen Ausdrucks. Trotzdem und gerade deshalb, sind wir sicher, dass diese Reihe dem interessierten Hörer neben zahlreichen Erkenntnissen auch viel Vergnügen bereiten wird. 1. Down and Out - Der Blues “Ich weiß von keinem einzigen überragenden Jazzmusiker (...) der nicht einen enormen Respekt und ein Gefühl für den Blues besessen hätte.” (Billy Taylor, Pianist) Die Beziehungen zwischen Blues und Jazz sind vielfältig - und es handelt sich beileibe nicht nur um musikalische Zusammenhänge. Schließlich beschreibt der Begriff “Blues” im Amerikanischen nicht nur eine bestimmte musikalische Gattung sondern eben auch eine Stimmung, ein Gefühl - wenn auch ein schwer zu beschreibendes. Billy Taylor spricht an anderer Stelle von “einem gewissen, nebulösen Blues-feeling”. Welche Rolle dieses Feeling für den Jazz spielt, ob es eine Spezialität schwarzer Musiker ist, oder ob auch der Weiße den Blues haben kann, bzw. - wie der Bluessänger Huddie Ledbetter es formuliert - ob der Blues auch “den weißen Mann haben kann” (was Ledbetter bestreitet), das soll in diesem ersten Kapitel untersucht werden. Natürlich geht es auch um die musikalischen Eigenschaften des Blues in denen sich ja die afrikanischen roots besonders eindrucksvolle Spuren hinterlassen haben. Aber Blues ist natürlich mehr als nur eine Vorform des Jazz, mehr als eine Art Vermittler zwischen den afrikanischen Musiktraditionen, die sich schwarze Sklaven in Nordamerika erhalten konnten und dem um 1900 herum entstandenen Jazz. Der Blues entwickelt sich neben dem Jazz auch als originäre Musikform weiter, zum Beispiel zum Rhythm & Blues (Musikbeispiel 1), aus dem dann der RocknRoll und schließlich die Rockmusik hervorgingen. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine Geschichte mit Happyend übrigens, wenn auch erst siebzig Jahre später, als sich Jazz und Rock in der Fusionmusic glücklich wieder fanden. Glücklich? Liebe auf den ersten Blick war es jedenfalls nicht. Aber davon später, im 6. Kapitel unserer Geschichte. 2. It Got That Swing - Die Rhythmik “If you don‘t feel it, you can‘t get it.” Louis Armstrong bezweifelte, dass die “wahre” Jazzrhythmik erlernbar sei, aber als überzeugter (und überzeugender) Autodidakt bezweifelte er auch, dass Musik überhaupt erlernbar sei. “Man-hat‘s-oder-man- hat‘s-nicht”. Diese Attitüde ist allerdings typisch für fast alle traditionellen Jazzmusiker. Erst in den Vierziger Jahren, im Modernjazz, setzte sich auch bei Jazzmusikern die Überzeugung durch, dass Jazz eine Kunstform ist, deren handwerkliche Seite man lernen kann und muss. Dabei ist es eigentlich kein Problem, die Rhythmik des Jazz zu erspüren, schließlich erlebt wohl jeder Zuhörer an sich selbst die “sensomotorischen Reaktionen” auf diese Musik - achten Sie mal auf Ihre Füße. Ein beliebter Fehler - so viel Theorie sei hier erlaubt - ist die Verwechslung des off-beats, der für swing verantwortlich ist, mit der Synkope. Diese zieht den Melodieton um exakt die Hälfte einer Zählzeit vor, sodass der Grundschlag “verschluckt” wird. Das kennt man vom Ragtime. Off-beat dagegen verschiebt die Zählzeiten nahezu “ternär”(triolisch). Aber eben nur annähernd, weshalb man ihn nicht exakt notieren kann. Ende der Theorie. 3 Ob swing tatsächlich ein konstituierendes Merkmal des Jazz ist, oder ob es auch Jazz gibt, der nicht swingt, das bleibt unter Fachleuten umstritten. Begonnen hat diese Diskussion zu Zeiten des Freejazz, meist kombiniert mit der Frage, ob “Free” überhaupt Jazz ist. Aber der Streit um Glaubensfragen führt bekanntlich selten zu befriedigenden Ergebnissen. Überraschend einig sind sich dagegen die Experten darin, dass swing erst in Amerika durch die Kombination europäischer und afrikanischer Rhythmik entstanden ist. Wer sich aber das Musikbeispiel der Ba-Benzélé-Pygmäen “Mbombokwe” genauer anhört, könnte auch da so seine Zweifel bekommen. Musikfreunde, die sich nicht nur für Jazz interessieren, wissen natürlich, dass unexaktes Spielen, jedenfalls solange es sich auf die Rhythmik beschränkt, auch anderweitig üblich, ja sogar erwünscht ist, auch wenn man das dann nicht als swing bezeichnen kann. Aber ein Chopinwalzer oder gar ein Wiener Walzer mit drei exakt gleich langen Vierteln – entsetzlich! Auch wenn das mancher amerikanische Gastdirigent nicht wahrhaben will. Aber wie sagte doch Louis Armstrong? 3. Body And Soul - Die Improvisation “Just tell your story - your own story.” Diese klassische Aufforderung zum Improvisieren - sie wird Miles Davis zugeschrieben - zielt auf den wesentlichen Aspekt der Improvisation: die persönliche Aussage. Genau genommen eine Binsenweisheit, denn dass Musiker so spielen, wie es ihrer Gemütslage, ihrer momentanen Stimmung und, nicht zu vernachlässigen, ihren spieltechnischen Fähigkeiten entspricht, ist eigentlich selbstverständlich. Beneidenswert, dass sie in einem Genre musizieren, wo dies nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich gefordert ist. Allerdings sollte man mit dem Begriff “spontan” im Zusammenhang mit Improvisation sehr vorsichtig sein. Spontanes Reagieren auf das Spiel der Mitmusiker findet, wenn überhaupt, nur im Freejazz statt. Mit ein Grund, warum diese Musik auch an den Hörer hohe Anforderungen stellt, weil dieser, wenn auch unbewusst, die “Regeln” der Improvisation durchaus mitverfolgt. Und wenn er keine Gesetzmäßigkeiten erkennt bzw. diese nicht nachvollziehen kann reagiert er mit Unlust. Dem hartnäckigen Hörer sei deshalb “Unit structures” von Cecil Taylor besonders ans Herz gelegt: Man kann diese Strukturen, das gegenseitige Reagieren der Musiker durchaus hören. Wie gesagt, für hartnäckige Hörer, eine elitäre Zielgruppe. In Traditional und Modernjazz dagegen beruhen die Ergebnisse von Improvisation hauptsächlich auf Erfahrung, auf Routine, ja sogar auf Repertoire. Die Interpretation eines Musikstückes wird durchaus im Laufe der Jahre “er-improvisiert”. Sie ist Ergebnis eines längeren Prozesses, Spontaneität spielt eine untergeordnete Rolle. Im Allgemeinen wird Improvisation als notwendige Bedingung für Jazz verstanden. Dies verlangt zwei Anmerkungen. Erstens gibt es auch in der im weitesten Sinne als klassisch bezeichneten Musik Improvisation, man denke nur an die Generalbasstechnik im Barock, an Bruckners Orgelwettkämpfe oder die Aleatorik im 20. Jahrhunderts. Zweitens ist im Bigband-Jazz die Improvisation zwangsläufig stark reduziert. Bis auf einzelne Solo-Improvisationen muss der Satz in der Bigband natürlich arrangiert werden. Daneben gab es in allen Epochen des Jazz das Head-Arrangement, also die mündliche Absprache über Abläufe, Changes und Strukturen. Man muss schließlich nicht spontan sein um seine Geschichte zu erzählen, auch und schon gar nicht wenn es die eigene ist. 4. Hot And Dirty - Der Sound 4 “Er sagte, er braucht mich und er mag meinen Stil. Ich hatte bald raus, dass ich meinen eigenen Sound auf dem Instrument finden musste. Das war sehr hart. Aber ich war 19 und spielte mit dem größten Altsaxophonisten der Musikgeschichte. Das war ein irres Gefühl.” So beschreibt Miles Davis seine erste Begegnung mit Charlie Parker. Das Ergebnis ist bekannt: Der Miles-Sound, den Gil Evans mit einer weißen Wolke verglich, während die kleine Tochter eines anderen Kollegen etwas prosaischer feststellte: “Es klingt wie ein kleiner Junge, den sie ausgesperrt haben und der wieder rein will.” Interessant an Miles Davis‘ Zitat ist, dass die Begriff “Stil” und “Sound nahezu dasselbe zu bedeuten scheinen. Dies gilt nicht nur für die “Epochenstile” des Jazz, sondern noch viel mehr für den Individualstil des einzelnen Musikers, dessen Bestreben es ist, an seinem Sound erkannt zu werden. Dies erklärt sich unter anderem aus der besonderen Funktion des Jazzmusikers im Unterschied zum “klassischen” Musiker. Der traditionelle “Nur-Interpret” versucht den standardisierten Klangidealen der jeweiligen Epoche nahe zu kommen; der Jazzmusiker versteht sich als “Mit-Komponist” und gibt dem Stück durch seinen besonderen Sound und Stil ein eigenes Gepräge. Die Popmusik, jedenfalls die kommerziell erfolgreiche, sucht hier einen Mittelweg: Die einzelenen Interpreten oder Gruppen suchen zwar nach einem mehr oder weniger eigenständigen, typischen Klang, orientieren sich dabei aber größtenteils an den jeweils gültigen, weil erfolgreichen, klanglichen Standards der Zeit und des Genres. In abgeschwächter Form findet sich diese Unterscheidung aber auch innerhalb der Jazzgeschichte: Die “weißen” Stile, insbesondere Swing und Chicago, drängen den individuellen Sound zurück, während in den “schwarzen” wie Bebop und Freejazz ein radikaler expressionistischer Klang im Zweifelsfall jedes standardisierte Schönheitsideal übertönt. So gehört ist der Sound also nicht nur ein stilbildendes Kriterium der verschiedenen Jazzstile, sondern ein konstituierendes Element des Jazz überhaupt. Jazz ist eben, wie Jimmy Giuffre feststellt “nicht was du tust, es liegt darin, wie du es tust.” 5. Mainstreams - Die Stile “To be or not to bop!” - Diese kurze Formel des Trompeters (und Präsidentschaftskandidaten) Dizzy Gillespie bringt etwas von der Unbedingtheit zum Ausdruck, mit der schwarze Musiker immer wieder den Jazz als “ihre” Musik in Besitz nehmen mussten. Das Mittel der Wahl war dabei meist ein mehr oder weniger radikaler Stilwandel, wie er zum Beispiel Anfang der vierziger Jahre, an der Wende vom Traditional zum Modernjazz stattgefunden hat. Dieser Wendepunkt markiert einerseits die Rückbesinnung auf afrikanische Traditionen und damit die Kreation eines wieder “typisch schwarzen” Jazzstils (ein Vorgang, der sich zwanzig Jahre später mit dem Freejazz wiederholte); in den Ohren schwarzer Musiker hatte der Jazz durch kommerzielle Interessen und den Einfluss der Weißen seine Identität verloren. Andererseits zeigt sich im Modernjazz auch eine Wandel im Selbstverständnis der Jazzmusiker, unabhängig von der Hautfarbe. Der Autodidakt, der häufig sogar mit seiner Unkenntnis in Sachen Musiktheorie und Harmonielehre kokettiert, wird abgelöst vom Künstler, der sich nicht nur im Jazz, sondern auch in der europäischen E-Musik auskennt, der nicht nur Bartok und Strawinsky studiert hat, sondern sogar bei namhaften Komponisten wie Darius Milhaud oder Aaron Copland in die Schule gegangen ist. John Lewis (Modernjazz Quartet) oder Dave Brubeck beispielsweise. 5 Diese beiden Gesichtspunkte, Black Conciousness und Beschäftigung mit europäischer Kunstmusik, widersprechen sich nur scheinbar. Gerade durch diese Polarität kann der Jazz in den vierziger Jahren und später seine afroamerikanische Identität behaupten - unabhängig von der Hautfarbe der Musiker, wie gesagt. Rückbesinnung auf die african roots ist nur eine, wenn auch vielleicht die wesentliche Triebfeder für den einen oder anderen Stilwandel in der Jazzgeschichte. Doch es gibt auch das genaue Gegenteil - die Adaption durch weiße Musiker bzw. - gravierender - durch die Mechanismen der von Weißen gesteuerten Musikindustrie. Die Rolle, die der Dixieland bis heute in der Jazzrezeption, vor allem in der europäischen, spielt, lässt sich nicht durch seine musikalische Bedeutung erklären, sondern allein durch die Tatsache, dass es eben in den zwanziger Jahren für weiße Bands einfacher war, Platten aufzunehmen. Mit Aufnahmen schwarzer Musiker – so genannten “race records” war eben kaum ein Geschäft zu machen. Daneben sollen natürlich die außermusikalischen Gründe für musikalischen Stilwandel nicht ignoriert werden. Ob es sich um nahezu triviale Auslöser handelt, wie bei der “Schließung” des Vergnügungsviertels Storyville in New Orleans während des 1. Weltkrieges - der Straßenzug wurde einfach abgefackelt. Auch politische Ereignisse, wie der Koreakrieg, oder umwälzende Neuerungen, wie die Erfindung der Wasserstoffbombe haben die Kunst und damit auch den Jazz beeinflusst. Genauso wie in der europäischen Musikgeschichte außermusikalische Ereignissen ihre Spuren hinterlassen haben. 6. Third Stream And Fusion - Grenzüberschreitungen “Manche werden es Prostitution nennen, ich nenne es nach wie vor Musik.” Trotzdem machte sich Miles Davis das zitierte Vorurteil ironisch zu Eigen und nannte eines seiner ersten Plattenalben mit dieser Art von Musik “Bitches Brew” – “Hurengebräu”. Worum es da geht? Nicht mehr und nicht weniger, als eine Fusion von Jazz und Rockmusik – ein Tabu-Bruch, den sich nur eine Musikerpersönlichkeit mit dem enormen Selbstbewusstsein eines Miles Davis leisten konnte. Zu groß waren die gegenseitigen Vorbehalte in den bis dahin getrennten Lagern. Dabei ist das einzig Verwunderliche an dieser Verbindung, dass sie so lange auf sich warten ließ. Denn als das Jazz-Rock-Tandem erst mal zusammengebastelt war, kam es sehr schnell in Fahrt und lässt sich bis heute nicht mehr bremsen. Auch andere Grenzüberschreitungen - die zur E-Musik - sind, wenn man die Ursprünge des Jazz bedenkt, eigentlich selbstverständlich. Ja es ist sogar etwas übertrieben, hier von Grenzüberschreitungen zu sprechen, weil ja die europäische E-Musik an der Entstehung des Jazz wesentlich beteiligt war. Und auch in der nachfolgenden Entwicklung reißen die Kontakte niemals vollständig ab. Woody Herman, Benny Goodman, Bix Beiderbecke, Igor Strawinsky, Darius Milhaud sind nur einige Protagonisten dieser Dauerbeziehung. Die gegenseitige Beeinflussung hat in der Ära des Modernjazz eher noch zugenommen. Das erscheint widersprüchlich, denn der Stilwandel zum Modernjazz war ja von einem starken emanzipatorischen Impuls ausgelöst worden. Über die Hintergründe war im vorigen Kapitel schon einiges zu erfahren. Die Bezeichnung “Third Stream”, hat eine Bedeutungserweiterung erfahren: ursprünglich stand sie für eine bestimmte kompositorische Bewegung der fünfziger und sechziger Jahre, für Kompositionen von Gunther Schuller (der den Namen prägte), Jimmy Giuffre, Lohn Lewis und des Modernjazz Quartets; Heute fasst man alle Versuche, E-Musik mit Jazz zu verbinden, darunter zusammen. Die musikalischen Ergebnisse dieser meist einseitigen Befruchtungen sind allerdings nicht immer 6 überzeugend, und die Einstellung der Jazzmusiker zu derartigen Versuchen ist ohnehin zwiespältig. Für die einen ist E-Musik die Musik des weißen Establishments, mit der sie nichts zu tun haben wollen; die anderen erleben es als Aufwertung des Jazz, wenn er – e-musikalisch “veredelt” - aus den Gettos in die Konzertsäle gelangt und Anerkennung beim intellektuellen Konzertpublikum findet. Der Musikwissenschaftler Winthrop Sargeant spricht in diesem Zusammenhang ironisch vom “Carnegie-Hall-Prestige”. Es wäre aber sicher ungerecht und falsch, den zahlreichen Komponisten, die sich ernsthaft um eine Verbindung dieser unterschiedlichen musikalischen Ausdrucksweisen bemühten, lediglich diese Motive zu unterstellen. Trotzdem: Die Skepsis bleibt. Peter Brötzmann, der Saxophonist des New Eternal Rhythm Orchestras, der an der Einspielung der “Actions” von Krzysztof Penderecki mitwirkte, kommentierte das Ergebnis vernichtend mit nur einem Wort - das wir hier lieber nicht wiedergeben. © Bayerischer Rundfunk 2002