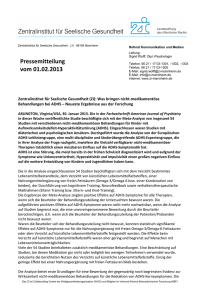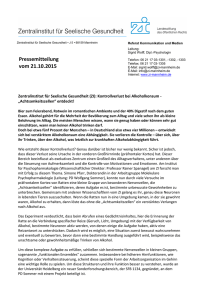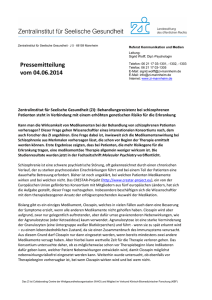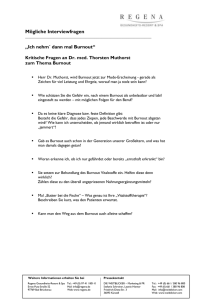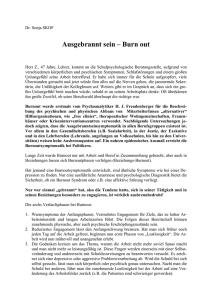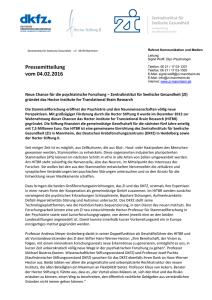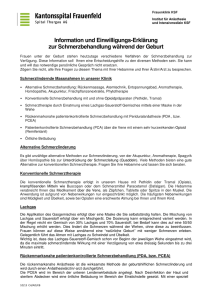ZI Aktuell 206.indd - Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
Werbung

INFORMATION Nummer 2 • Dezember 2006 29. Jahrgang Inhalt Neubesetzung im ZI-Vorstand Katrin Erk neue Kaufmännische Direktorin Seite 3 Neu am ZI Neuer Ärztlicher Direktor der KJP Seite 4 Macht Trinken dick und Rauchen dünn? Das klinische Suchtforschungslabor nimmt seine Arbeit auf Seite 4 Moderne psychiatrische Konzepte aus der Jugendstilvilla Die allgemeinpsychiatrische Tagesklinik des Zentralinstituts Seite 5 „Soziale Balance in einer Welt der Ungleichheit“ 18. Weltkonferenz der International Federation of Social Workers in München Seite 7 Neuroimaging am ZI Einblicke in Veränderungen des Gehirns bei psychiatrischen Erkrankungen Seite 8 Warum gibt es am ZI „depressive“ Ratten und Mäuse? Forschungsschwerpunkte der AG Verhaltenbiologie Affektiver Erkrankungen Seite 11 Wenn Schmerz nicht mehr weh tut Schmerzwahrnehmung bei Borderline Seite 15 Das Fibromyalgie-Syndrom Effekte und Indikationskriterien der operant- und der kognitive-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie Seite 17 „Aber Nachdenken hilft mir doch …!“ Warum Grübeln unserer Gesundheit schadet Neues aus der AG Verlaufs- und Interventionsforschung Seite 21 Absolventen der Gerontopsychiatrischen Weiterbildung verabschiedet Grußworte zur Zeugnisübergabe Seite 24 Das Burnout-Syndrom „Wenn die Lampe verlöscht....“ Seite 25 Autorenliste und Impressum Seite 28 Neubesetzung im ZI-Vorstand Katrin Erk neue Kaufmännische Direktorin Sie sind seit 1. September kaufmännische Direktorin am ZI. Wo waren Sie vorher tätig? Welches sind die wesentlichen Stationen Ihrer Laufbahn? Nach meinem Studienabschluss als Diplomwirtschaftsingenieurin hatte ich die ideale Möglichkeit, meine technischen und kaufmännischen Interessen bei der Firma Dräger Medizintechnik zu verbinden. Nach einigen Jahren, unter anderem als Vertriebsleiterin in BadenWürttemberg, fand ich Gefallen, auf die Katrin Erk Seite meiner Kunden ins Krankenhausmanagement zu wechseln. Auf erste Erfahrungen im Aufbau einer Stabstellenabteilung der Geschäftsführung des Klinikums Mittelbaden für u.a. Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement folgte parallel die operative Verantwortung für eine Akutklinik. Mit Gründung der Klinikum Mittelbaden gGmbH übernahm ich dann als Mitglied der Geschäftsleitung die Geschäftsbereichsleitung für drei Klinik- und Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 800 Betten. Die dort gesetzten Ziele - medizinische Leistungserweiterung, bauliche Weiterentwicklung und wirtschaftliche Gesundung - wurden in den letzten Jahren erreicht. Für mich der richtige Zeitpunkt, eine neue Herausforderung zu suchen. gen, die es gilt, zu gestalten. Im Zeitalter von Budgetkürzungen, verordnet durch die Gesundheitspolitik, sind neue Wege in der Gestaltung der Arbeitsabläufe und ein verbessertes Miteinander zu beschreiten. Die Überleitung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine gute Patientenversorgung sind Chancen, die es für das ZI noch intensiver zu nutzen gilt. Dabei ist es mir wichtig, die Selbständigkeit des ZI langfristig zu sichern. Aktuelle wichtige Projekte stehen an: Im Februar ist die Inbetriebnahme der Gerontopsychiatrie geplant, hier soll ein innovatives Konzept verwirklicht werden. Die Sanierung des Bettenbaus wird im Frühjahr 2007 abgeschlossen sein, dann gilt es, die Funktionsgeschosse planerisch neu zu gestalten. Die Weiterentwicklung des zukünftigen tagesklinischen Angebots steht genauso wie die Neuausrichtung der Räumlichkeiten für die Lehre auf der Tagesordnung. Die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für erfolgreiche Forscher gut zu gestalten, möchte ich ausdrücklich unterstreichen. Auf was legen Sie bei Ihrer Arbeit besonders Wert? Auf Offenheit, Transparenz und Zielorientierung. Was hat Sie bewogen, ans ZI zu wechseln? Was macht der Reiz des ZI aus? Die Verbindung zwischen Forschung und Lehre und Klinikbetrieb auf hohem internationalem Niveau verknüpft mit dem Standort Mannheim - eine für mich sehr erstrebenswerte Aufgabe. Wie sehen Sie die weiteren Entwicklungen in der Krankenhauslandschaft in Deutschland in den nächsten Jahren? Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung des ZI in den nächsten Jahren? Die Politik wird aus wirtschaftlichen Überlegungen vieles tun, um die Anzahl der Gesundheitsdienstleister zu reduzieren. Nur medizinisch innovative und wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen werden langfristig Bestand haben. Die Verweildauer wird in den nächsten Jahren auch in der Psychiatrie weiter sinken. Für unsere Patienten ist deshalb der Aufbau von regionalen sektorenübergreifenden Kompetenznetzwerken wichtig. Das ZI hat mit seiner Innovationskraft und seinen Potentialen alle Chancen, im zunehmenden Wettbewerb eine führende Rolle zu spielen. Flexible Strukturen werden dabei wichtig sein, um die Leistungsorientierung zu unterstützen. Was sind Ihre Pläne für das ZI? Welches sind die wichtigen Herausforderungen der nächsten Zeit? Wo werden die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sein? Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens stehen vor großen wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderun- Viele Pläne, viel Arbeit. Was macht Katrin Erk in ihrer knapp bemessenen Freizeit? Ein bisschen Kunst und Kultur, Freude am Pferdesport und gerne auch mal „Füße hochlegen“. red ZI Aktuell 2/06 3 Editorial Liebe Leserin, Lieber Leser, vor einem halben Jahr berichteten wir hier über Abschiede, in der Zwischenzeit sind zwei wichtige Positionen wieder besetzt. Im ZI-Vorstand hat Frau Katrin Erk am 01. September als Kaufmännische Direktorin ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie stellt sich auf dieser Seite im Interview vor. Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski trat am 01. November die Nachfolge als Ärztlicher Direktor in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an. Auf der nächsten Seite stellen wir ihn kurz vor, im nächsten Heft werden Sie einen Beitrag von ihm lesen können. An dieser Stelle soll heute statt meiner eine berühmte Stimme zu Wort kommen: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, baden-württemberg. Landesstiftung (seit 1975) des öffentl. Rechts (Sitz: Mannheim), die folgende Einrichtungen unterhält: Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, für Psychosomatik und psychotherapeut. Medizin sowie für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters; Forschungsinstitut mit Abteilungen für Biostatistik, Gemeindepsychiatrie, genet. Epidemiologie in der Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, klin. Psychologie, Molekularbiologie, Neuroradiologie sowie Psychopharmakologie. Zu ihren Aufgaben gehören: Erforschung, Vorbeugung und Behandlung ►seelischer Krankheiten sowie Lehre im Rahmen der Fakultät für Klin. Medizin Mannheim der Univ. Heidelberg, (►seelische Gesundheit) Aus: BROCKHAUS – ENZYKLOPÄDIE 2006, Band 30 WETZ – ZZ, S. 555. Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen. Besinnliche Weihnachtsfeiertage und alle guten Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2007. Ihre www.zi-mannheim.de Neu am ZI Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski neuer Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Professor Dr. med. Dr. rer. nat. Tobias Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski Banaschewski begann am 1. November als Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI. Er tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Dr. Martin Schmidt an, der im April diesen Jahres emeritiert wurde. Banaschewski erhält auch den Ruf auf die Professur für das Fach an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Der promovierte Mediziner und Psychologe kommt aus Göttingen, wo er an der Klinik von Prof. Dr. Aribert Rothenberger seit 1999 tätig war, seit 2002 als Leitender Oberarzt. (Prof. Rothenberger war bis zu seiner Berufung nach Göttingen 1993 leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am ZI). Seine wissenschaftlichen Schwer- punkte liegen auf der Erforschung der Psychopathologie, Psychophysiologie, Neuropsychologie und Psychopharmakologie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (kurz ADHS) und begleitender Störungen, vor allem Störungen des Sozialverhaltens, der Legasthenie und den Tic-Störungen. Banaschewski möchte die Klinik am ZI zunehmend in internationale Forschungsprojekte einbinden, deren Ziel es ist, die Entstehungswege von ADHS weiter zu entschlüsseln. Er ist Mitglied vieler nationaler und internationaler Fachgesellschaften und hat für seine Forschungsarbeiten mehrere Preise bekommen. red Macht Trinken dick und Rauchen dünn? Das klinische Suchtforschungslabor nimmt seine Arbeit auf Rauchen, Trinken und Übergewicht sind in den letzten Jahrzehnten zu den größten Gesundheitsrisiken westlicher Länder geworden. In Deutschland waren im Jahr 2005 etwa 1 700 000 Personen alkoholabhängig. Zusätzlich tranken ebenso viele „missbräuchlich“, was bedeutet dass ihr Alkoholkonsum bereits zum Eintritt einer Gesundheitsschädigung führte. Infolge von Alkoholkonsum und den dadurch bedingten Erkrankungen sterben jährlich etwa 73 700 Menschen vorzeitig. Der Anteil an alkoholbedingten Todesfällen an allen Todesfällen beträgt deshalb bei Männern zwischen dem 35. und 65. Lebensjahr 25% und bei Frauen 13%. Der Anteil der Raucher lag bei knapp 40% und geht in den letzten Jahren erfreulicherweise etwas zurück. Fast alle Raucher, nämlich 70-80% sind tatsächlich nikotinabhängig, weshalb sie nach Versuchen aufzuhören, häufig rückfällig werden. An tabakbedingten Gesundheitsschäden sterben in Deutschland jedes Jahr etwa 120 000 Menschen vorzeitig (siehe Abb.1). Sucht und Gewichtszunahme Viele Raucher bemerken, dass sie übermäßigen Appetit bekommen und Gewicht zunehmen, wenn sie das Rauchen aufgeben. Eine der Ursachen ist, dass Rauchen vorübergehend das Hungergefühl betäubt, weshalb Raucher im Durchschnitt ein etwas gerin- ZI Aktuell 2/06 geres Gewicht haben als Nichtraucher. Bei Alkohol führt regelmäßiger Konsum hingegen oft zu Übergewicht, zum Beispiel zu einem „Bierbauch“. Das liegt daran, dass alkoholische Getränke wegen ihres Alkoholgehalts sehr nahrhaft sind. Reiner Alkohol hat nämlich fast so viele Kalorien wie Salatöl. In einem halben Liter Bier steckt deshalb genau soviel Energie wie in derselben Menge Cola, nämlich 220 Kilokalorien, dies entspricht etwa 2 kleinen Brötchen. Trotzdem entwickeln auch Alkoholiker oft vorübergehend sogar vermehrten Appetit, wenn sie aufhören zu trinken. Biochemische Grundlagen Sucht und Appetitregulation scheinen somit zusammenzuhängen, was früher als „Suchtverschiebung“ gedeutet wurde: nämlich dass Suchtmittelkonsum einfach eine schlechte Angewohnheit sei, die durch übermäßigen Nahrungsmittelkonsum ersetzt würde. Diese Sichtweise ist nicht mehr haltbar, da wissenschaftlich einerseits klar nachgewiesen ist, dass Nikotin- und Alkoholabhängigkeit Krankheiten sind, die das Gehirn betreffen und durch ärztliche und verhaltenstherapeutische Hilfe unter Kontrolle gebracht werden können. Andererseits wurde in den letzten Jahren entdeckt, dass manche Suchtmittel gerade diejenigen Hormone stören, die für die Regulation 4 von Appetit und Nahrungsaufnahme zuständig sind. Dies betrifft die Peptide Insulin, Leptin und Ghrelin. Sie wirken im Gehirn auf das Hungerzentrum, erstaunlicherweise aber auch auf das Belohnungszentrum, wo sie das Empfinden von angenehmen Umweltreizen verändern können. Das klinische Suchtforschungslabor Diese Zusammenhänge sollen künftig in dem neu eingerichteten klinischen Suchtforschungslabor der Klink für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin eingehender erforscht werden. In diesem Labor wollen wir akute Wirkungen von Alkohol und Nikotin bei gesunden, freiwilligen Versuchsteilnehmern untersuchen. Da solche Versuche die Verabreichung von Alkohol oder Nikotin beinhalten, werden alle Teilnehmer vorher sorgfältig untersucht, um eine eventuelle Suchterkrankung oder andere Krankheiten auszuschließen. Sollte sich hierbei herausstellen, dass eine Alkoholabhängigkeit oder Suchtgefährdung besteht, werden keine Laboruntersuchungen durchgeführt, sondern eine Beratung durch die Suchtambulanz des ZI empfohlen. Der Autor konnte bereits früher nachweisen, dass die Gabe von reinem Alkohol vorübergehend das appetitstimulierende Hormon Ghrelin vermindert, wovon eine Vermin- www.zi-mannheim.de derung von Hunger zu erwarten wäre. Gleichzeitig wird aber auch das „Sättigungshormon“ Leptin gebremst, was das Gegenteil bewirkt. Welcher Effekt im Einzelfall überwiegt und wodurch dies bestimmt wird, soll künftig am ZI untersucht werden. Dazu trinken Versuchspersonen eine geringe Menge von reinem Alkohol in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit „Astronautenkost“, wonach die Auswirkungen auf das Hungergefühl und die verschiedenen an der Appetitregulation beteiligten Peptide untersucht werden. Im Gegensatz zu Gesunden sind gerade diese Hormone bei alkoholabhängigen Patienten dauerhaft verändert und normalisieren sich erst nach längerer Zeit wieder. Dabei scheint es Zusammenhänge mit dem Abstinenzerfolg zu geben: Prof. Kiefer fand beispielsweise heraus, dass stark ansteigende Leptinwerte nach Alkoholentzug mit stärkerem Trinkverlangen und höherem Rückfallrisiko verbunden sind. Die Wirkungen von Nikotin werden in ähnlicher Weise untersucht. Mittels funktioneller Kernspintomografie wird festgestellt, wie das Hungerzentrum im Gehirn reagiert, wenn Versuchspersonen Bilder von wohlschmeckenden Nahrungsmitteln betrachten. Diese Messung wird vor und nach Kalorienzufuhr durchgeführt und dabei verglichen, ob und wie das vorherige Kauen eines Nikotin-Kaugummis dabei die Gehirnaktivität im Hungerzentrum verändert. Suchtmedizin angeboten wird, werden wir künftig auch die Bedeutung von Gewichtveränderungen und appetitregulierenden Hormonen auf den Abstinenzerfolg untersuchen. Dazu werden Blutuntersuchungen im Verlauf der ersten Wochen nach Rauchstopp durchgeführt sowie Gewicht und Körperfettanteil gemessen (siehe auch unser Angebot „Nichtrauchen in 6 Wochen“ in ZI aktuell 1/06). Anmeldungen zu diesem Therapieprogramm werden weiterhin unter der Telefonnummer 0621/17033503 entgegen genommen. Die meisten Krankenkassen übernehmen hierbei mittlerweile den Hauptteil der Kursgebühr in Höhe von 95 Euro. „Of All the People in All the World“ Ausstellung im Rahmen des Kunstfestivals “Wunder der Prärie” Jedes Reiskorn stellt einen Menschen dar. Quelle: Zeitraum ex!t, Mannheim. Im Rahmen der qualifizierten Tabakentwöhnung, die ebenfalls an der Klinik für Abhängiges Verhalten und Ziel dieser verschiedenen Studien ist es, durch ein besseres Verständnis der zugrundeliegenden neurobiologischen Zusammenhänge auch die Behandlung von Suchterkrankungen gezielt zu verbessern, sowohl hinsichtlich der begleitenden Gewichtsveränderungen als auch der Rückfallgefährdung. Ulrich Zimmermann Moderne psychiatrische Konzepte aus der Jugendstilvilla Die allgemeinpsychiatrische Tagesklinik des Zentralinstituts Konzepte der Krankenversorgung am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit integrieren aktuelle Trends, die sich therapeutisch wie auch gesundheitsökonomisch als sehr sinnvoll erwiesen haben: Denn im Zuge einer Schwerpunktverlagerung von der vollstationären hin zur teilstationären Behandlung wird derzeit das Angebot tagesklinischer Behandlung ausgebaut. Es betreuen seit 1. Juni 2005 Mitarbeiter der suchtmedizinischen Tagesklinik - auf 20 Behandlungsplätzen - Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen. Pläne für eine psychosomatische Tagesklinik werden erarbeitet. Innerhalb der psychiatrischen Klinik ist die teilstationäre Behandlung seit Jahrzehnten etabliert. Gerontopsychiatrische Patienten erfahren in der Altentagesklinik eine aktivierende Behandlung im vertrauten Umfeld. Die älteste Tagesklinik des Instituts aber residiert auch im ältesten Gebäude, der Villa Hecht in Quadrat L10,1 (siehe Titelbild). Dort werden seit 1982 auf 20 Therapieplätzen Patienten mit affektiven und schizophrenen Psychosen behandelt. Nach ZI Aktuell 2/06 Institutsgründung 1975 war die psychiatrische Tagesklinik in Heidelberg zu Füßen des Schlosses unterbracht und zog im Jahr 1982 in die Mannheimer Innenstadt, bewusst in Bahnhofsnähe, um Patienten die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Angesichts des repräsentativen Gebäudes äußern immer wieder Patientinnen und Patienten eine Art dankbarer Überraschung, dass dieses schöne Haus für eine sonst ja durchaus oft diskriminierte und stigmatisierte Patientengruppe genutzt wird. Besonders ist außerdem eine Gedenktafel auf der Straßenseite, die an Helene Hecht, eine im Alter von 86 Jahren in den Kriegsjahren deportierte und getötete Jüdin, erinnert. Durch diese Tafel steht Mitarbeitern wie Patienten ein verantwortlicher Bezug zur deutschen Geschichte immer vor Augen. Unter einem historischen Bezug stand in diesem Jahr auch der Besuch von Frau Mira Raviv aus Rehovot. Die Kollegin leitet in Israel als „Head of Center for Occupational Rehabilitation“ eine Einrichtung mit 50 Therapieplätzen für schizophrene Patienten und besuchte 5 mehrere deutsche Einrichtungen und war an einem Austausch von Konzepten nteressiert. In dieser Übersicht soll nun eine aktuelle Standortbestimmung dieser allgemeinpsychiatrischen Tagesklinik unternommen werden, die eine krankenhausökonomische Perspektive mit Konzepten in Forschung und Therapie integriert. Kosten und Nutzen Große und prospektive Studien haben gezeigt, dass tagesklinische Behandlung keineswegs den relativ „gesunden“, prognostisch eher günstigen Patienten vorbehalten bleiben muss. Auch ausgeprägte affektive oder schizophrene Syndrome können zeit- und kosteneffizient tagesklinisch behandelt werden. Wenn zusätzlich - wie etwa in anderen Tageskliniken der Samstag zumindest teilweise einbezogen wird, eine Erreichbarkeit für die Patienten per Handy oder – wie im ZI gegeben – über den Hausnotdienst gewährleistet ist, ergeben sich nur wenige www.zi-mannheim.de Konstellation, die eine vollstationäre Therapie unausweichlich machen. Dazu zählen sicher eine ausgeprägte Antriebshemmung sowie Eigen- oder Fremdgefährdung. In den letzten drei Jahren hat sich der Nutzungsgrad auf sehr hohem Niveau etabliert. Sehr hohe Belegungsgrade von durchschnittlich 96 % bei einer Verweildauer von durchschnittlich 23 Tagen belegen gerade im Vergleich zu anderen Tageskliniken die Effizienz und Qualität der geleisteten Arbeit, der Güte der Zusammenarbeit mit den zuweisenden, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sowie Kliniken und die Zufriedenheit der Patienten. Ökonomisch bedeutsam sind auch pharmakologische Aspekte: Die Behandlung nützt zwar die neuesten und damit leider auch teuersten Medikamente, kann dennoch aber vergleichsweise niedrige Zuwächse im Arzneimittelbudget vorweisen. Dieser Aspekt ist nicht nur für die Finanzlage unseres Hauses, sondern gerade für die enge und gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen wichtig, die bei einer Entlassungsmedikation, die sehr teure Medikamente verwendet oder möglicherweise noch kombiniert, in Probleme ihres Praxisbudget geraten könnten. Bei Aufnahme und Entlassung wird das direkte Gespräch mit den vorbehandelnden Ärztinnen und Ärzten gesucht, um Kontinuität zu gewährleisten. Konzepte in Forschung und Therapie Im Bereich klinischer Forschung decken sich oftmals die aktuellen Grenzen therapeutischer Möglichkeiten, die die Patienten erfahren, mit den wissenschaftlichen Interessen. Neben Bemühungen um wirksamere Therapien geht es dabei sehr oft um Verbesserungen der Verträglichkeit durch Einsparungen an Dosis und Zurückdrängen von Nebenwirkungen. Ein Beispiel für eine derartige Koinzidenz können etwa Studien zum pharmakologischen Vorgehen bei therapierefraktären schizophrenen Psychosen sein. Wenn verschiedene Strategien keine ausreichende Remission der belastenden Symptome erreichten, und gar auch Clozapin, das Reservemedikament erster Wahl, keine volle Linderung ermöglichte, werden oft - und ohne klare Absicherung durch wissenschaftliche Daten - verschiedene Pharmaka kombiniert. Daraus ergeben ZI Aktuell 2/06 sich erhöhte Risiken von unerwünschten Effekten und deutlich erhöhte Kosten. Um in diesem Grenzbereich die Evidenzlage zu verbreitern, wurden von uns verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Sehr ermutigende Ergebnisse zur Clozapin-Augmentation mit Amisulprid, Ziprasidon, Risperidon und zur Olanzapin-Augmentation mit Amisulprid wurden veröffentlicht. Aktuell wird auch untersucht, inwieweit die Clozapin-Augmentation mit Aripiprazol das Nebenwirkungsprofil Gedenktafel an der Tagesklinik von Clozapin lindert und die Wirkung verbessert. Gerade Patienten mit Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis leiden oft auch an Depressionen. Die Dramatik dieser Doppelbelastung wird an der hohen Suizidrate bei schizophrenen Patienten deutlich. Deshalb sind innovative Strategien zur antidepressiven Therapie bei Psychosepatienten dringend erforderlich. Hierzu werden aktuell in der Tagesklinik Elemente der bifokalen Psychoedukation, der sozialen und beruflichen Rehabilitation mit pharmakologischen Interventionen kombiniert. Diesem Zweck dient eine Anwendungsbeobachtung des neu zugelassenen Antidepressivums Duloxetin bei Depressionen im Rahmen schizophrener Erkrankungen. Eine dritte Front klinischer Forschung stellt die Komorbidität von Zwangssymptomen und schizophrenen Psychosen dar. Durch diese Doppelbelastung werden einige Patienten sehr schwer belastet und in ihrer Lebensentfaltung extrem beeinträchtigt. Diese Patientengruppe bedarf dringend einer guten Charakterisierung, welche die am ZI verfügbaren Kompetenzen solider klinischer Arbeit, subtiler Neuropsychologie, präziser Neuropharmakologie und funktioneller Bildgebung verbindet. Da in den letzten Jahren ferner deutlich wurde, dass Zwangsphänomene bei bestimmten Antipsychoti- 6 ka möglicherweise gehäuft auftreten, arbeiten wir derzeit an Pilotprojekten, um Behandlungsstrategien für diese Situationen zu entwerfen. Die oben schon erwähnten bifokalen Psychoedukationsmodule wurden fest in den Ablauf der Therapiewoche eingefügt und ergänzen so die ergotherapeutischen und psychotherapeutischen Angebote. Diese Wissensvermittlung über Grundlagen, Therapie und Rückfallprophylaxe schizophrener Störungen werden mit Unterstützung einer Pharmafirma durchgeführt. Bei den betroffenen Patienten und Patientinnen erreichen wir mit dem „Alliance-Konzept“ in sechs wöchentlichen Sitzungen und vier Durchläufen pro Jahr eine stabile Wissensvermittlung, eine offenere therapeutische Interaktion und in Extrapolation der kontrollierten Daten etwa aus dem Forschungszentrum der TU München einen signifikanten Rückfallschutz. Mühsamer gestaltet sich die Motivation der Angehörigen zur Teilnahme an den zeitlich parallel stattfindenden Veranstaltungen für diesen Personenkreis. Aber auch hier konnte durch frühe Ankündigung der Termine und persönliche Ansprache durch alle Mitglieder des multiprofessionellen Teams eine deutliche Steigerung erreicht werden. Blick in die Zukunft Die therapeutischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten der psychiatrischen Tagesklinik sind erheblich und können im Einklang mit aktuellen Trends gemeindenaher Psychiatrie, die Hospitalisierung vermeidet und sehr auf soziale und berufliche Rehabilitation achtet, noch weiter ausgebaut und genutzt werden. Über die Grenzen der affektiven und schizophrenen Psychosen hinaus gilt dies sicher auch für die Gerontopsychiatrie sowie suchtmedizinische und psychosomatische Erkrankungen. Die multiprofessionelle Arbeit einer Tagesklinik ist zuweilen durchaus schwierig, da sie die Patienten in den Anforderungen des Wohn- und Beziehungsalltags belässt, andererseits aber gerade deshalb vor Artefakten geschützt und sehr befriedigend. Auf die Karte Tagesklinik zu setzen, steht dem ZI gerade in Zeiten des Umbruchs sicher weiter sehr gut an. Mathias Zink www.zi-mannheim.de „Soziale Balance in einer Welt der Ungleichheit“ 18. Weltkonferenz der International Federation of Social Workers in München Vom 30.07. bis 03.08.2006 fand in München die 18. Weltkonferenz der International Federation of Social Workers statt. Passend zum Motto der Veranstaltung „Soziale Balance in einer Welt der Ungleichheit“ wurde die Veranstaltung von einer artistischen Darbietung am Trapez eröffnet. Die Eröffnungsworte sprach Hille Gosejacob-Rolf, die Bundesvorsit- Die Weltkonferenz im ICM-Congress Center München zende des Deutschen Berufsverbandes für Sozialarbeiter und Heilpädagogen, als Gastgeberin der diesjährigen Weltkonferenz. Anschließend trat Imelda Dodds, die amtierende Präsidentin des IFSW, ans Rednerpult. Sie unterstrich in ihrer Rede die hohe Bedeutung sozialer Arbeit, die sich nicht zuletzt in der Zahl der inzwischen auf 84 Mitgliedsländer angestiegenen und den fast 500.000 in diesem Verband organisierten Sozialarbeitern weltweit ausdrückt. Ministerin Christa Stewens vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen begrüßte die Konferenzteilnehmer auch im Namen des Schirmherrn Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber. Sie würdigte das hohe Maß an Humanität und Solidarität der Sozialarbeiter die haupt- und ehrenamtlich qualifizierte Arbeit am Wohl der Gesellschaft leisten. Im Eröffnungsreferat fand Peter Heesen vom Beamtenbund und der Tarifunion deutliche Worte hinsichtlich der aktuellen Sparmaßnahmen. Bevor Tom Johannesen (Generalsekretär der IFSW) alle teilnehmenden Nationen aufrief, verlieh Dennis Corell vom International Council of Social Welfare (ICSW) seinem Wunsch nach einer ZuZI Aktuell 2/06 sammenarbeit aller Sozialer Organisationen Ausdruck und verwies auf die im Jahr 2010 stattfindende Weltkonferenz, die dann von beiden Vereinigungen gemeinsam getragen wird. Sehr beeindruckend war die Verleihung eines Preises an Irena Sendler, die durch ihren Einsatz und unerschütterlichen Willen beispielhaft für soziale Arbeit geehrt wurde. Ihr Wirken unter schwersten Bedingungen und dem ständige Kampf gegen die Ungerechtigkeit sind ein Symbol für die Ziele und Ideen, die der sozialen Arbeit zu Grunde liegen. Auf sie trifft das Motto der Klassenarbeit amerikanischer Schüler zu, durch die Irena Sendler überhaupt entdeckt wurde: „He who changes one person, changes the entire world.“ – „Der, der nur einen Menschen ändert, ändert die ganze Welt.“ Die Konferenz setze sich mit verschiedenen Hauptthemen auseinander: „Balance der Generationen: Jugend und Älter werden“: In Panel- und Diskussions-/Workshoprunden setzten sich die Teilnehmer mit fünf Mitgliedern des Netzwerkes „Social Work und Health Inequalities“ mit der Problematik der körperlichen, psychischen und geistigen Gesundheit auseinander. In einem weiteren Themenschwerpnkt „Zwischen Heimat und Fremde: Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge und entwurzelte Menschen“ setzten wir uns mit der Problematik von Integration, Assimilation und Flüchtlingshilfe auseinander. „Menschen und Bürgerrechte: Zwischen Globalisierung und Ausgrenzung“ lautete der Titel einer weiteren Keynote. Eine zweigeteilte Veranstaltung befasste sich mit den „Sozialsystemen zwischen allen Anforderungen: Grundbedürfnisse und Minimalstandards sozialer Sicherung“. Mit dem Schwerpunkt „Soziale Arbeit als Profession: 50 Jahre Erfolgsgeschichte und Visionen für die Zukunft“ schloss sich der Kreis der sechs Hauptthemen. Am Vorabend der Abschlussveranstaltung fand im Festsaal des Löwenbräukellers das große Kongress-Diner statt, das den entspannten Rahmen für einen intensiven Austausch der Eindrücke unter den Konferenzteilnehmern bot. Ein besonderes internationales Highlight war dabei die Jane-Hoey-Auktion, bei der Kulturstücke, Kunstgegenstände und Kuriositäten, die von den Teilnehmern aus aller Welt mitgebracht wurden, zu Gunsten von TeilnehmerInnen aus 3.Weltländern ersteigert werden konnten. Der Erlös aus der Versteigerung geht zu 7 100 Prozent an SozialarbeiterInnen oder Auszubildende aus armen Ländern, um ihnen die Teilnahme an der nächsten Weltkonferenz im Jahr 2008 zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Kongress-Diners auch der „Poster Award“ vergeben, eine Aktion der IFSW (siehe dazu auch www.ifsw.org). 25 Einsendungen, die vorher von einer Jury ausgewählt worden waren, wurden im Rahmen der Weltkonferenz im ICM ausgestellt und die drei besten ausgezeichnet. Die Abschlusszeremonie der 18. Weltkonferenz fand im festlichen Rahmen des berühmtesten Kulturzentrums der bayerischen Landeshauptstadt, der Philharmonie im Gasteig, statt. Die Schlussrede zum Thema „Soziale Balance weltweit“ wurde gehalten von Jakob von Uexküll, dem Begründer des Right Livelihood-Awards, bekannt auch als Alternativer Nobelpreis. Mit dem Ausblick auf die nächsten Schritte der International Federation of Social Workers und der Vorstellung der nächsten Orte der Weltkonferenzen (Brasilien 2008, Südafrika, Parma, und Hongkong) schloss die Weltkonferenz. Wie in der Ausschreibung zur Weltkonferenz angekündigt, luden verschiedene Landesverbände zu einem Postkonferenzprogramm in die jeweiligen Regionen ein. Für Baden-Württemberg fand dies in Mannheim/Heidelberg statt. Der Bezirksverband Rhein-Neckar lud sowohl die Mitglieder als auch internationale SozialarbeiterkollegInnen zu einem Fachgespräch ins ZI ein. KollegInnen aus allen Kliniken und der Abteilung Gemeindepsychiatrie stellten sowohl ihren Arbeitsbereich in Kurzreferaten vor, standen aber auch den vielen Fachfragen der Gäste zur Verfügung. Helga Waschkowski, ltd. Sozialarbeiterin der Abteilung Sozialarbeit moderierte in gewohnter Weise und übersetzte die verschiedenen Redebeiträge. Am Samstag endete dieses Nachtreffen mit einer Exkursion auf dem Rhein und Neckar. Hier konnten die Teilnehmer nicht nur die weitläufigen Hafenanlagen Mannheims, sondern auch die Arbeit des evangelischen Schifferseelsorgers hautnah erleben. Eine anstrengende Woche war zu Ende. Viele neue Erkenntnisse und gute fachliche und menschliche Begegnungen motivieren zur fachlichen Arbeit der Abteilung Sozialarbeit. Klaus W. Adam www.zi-mannheim.de Neuroimaging am ZI Einblicke in Veränderungen des Gehirns bei psychiatrischen Erkrankungen Als nicht invasive Forschungsmethoden haben bildgebende Verfahren in der letzten Dekade entscheidend dazu beigetragen, dass psychiatrische Erkrankungen zunehmend im Kontext funktioneller, biochemischer und feinstruktureller Veränderungen des Gehirns verstanden werden. Im Bereich der Psychiatrieforschung werden am ZI mit Hilfe der Kernspintomografie seit Mitte der neunziger Jahre neue Erkenntnisse über die neurobiologischen Grundlagen psychiatrischer Erkrankungen gewonnen. Die vorliegende Übersicht möchte einen Einblick in die aktuellen Methoden und Befunde geben. Historische Entwicklung Vor der Entwicklung bildgebender Verfahren war das lebende Gehirn eine „black box“, dessen normale Struktur und Abweichungen hiervon nur am toten Gehirn und mit Hilfe von Funk- Jahren in der analytischen Chemie. Dort wurden komplexe chemische Strukturen unlokalisiert in Probenröhrchen untersucht. Es folgten zwei Nobelpreise für die Anwendung in der Chemie für Richard Ernst (1991) und Kurth Wütherich (2002). Im Jahr 2003 erhielten Paul Lauterbur und Sir Peter Mansfield gemeinschaftlich den Nobelpreis für Medizin für ihre Beiträge zur räumlichen Kodierung, bzw. zur schnellen MR-Bildgebung. Durch diese methodischen Erweiterungen wurde die magnetische Kernresonanz zu einem wichtigen Diagnoseverfahren in der Medizin. Technische Grundlagen Die Kernspintomografie ist eine so genannte nicht invasive Methode, d. h. es sind keine Eingriffe in den menschlichen Körper nötig. Man kommt ohne Röntgenstrahlung und radioaktive Substanzen aus, es können vielmehr Abbildung 1: Mittels Kernspintomografie-basierter Morphometrie wurde bei der Analyse von zehn Aufnahmen depressiver Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen eine Reduktion der grauen Substanz beider Amygdalae in den depressiven Patienten gefunden. Die Bereiche signifikanter Veränderungen sind auf den Kernspinbildern farbig markiert. tionsausfällen nach umschriebenen Schädigungen erforscht werden konnte. Die Kernspintomografie öffnet ein Fenster zur Funktion, Mikrostruktur und Biochemie des lebenden Gehirns. Das physikalische Grundprinzip dieser Methode ist die magnetische Kernresonanz, ein Phänomen für dessen Entdeckung 1951 Felix Bloch und Edward Purcel den Nobelpreis für Physik erhielten. Praktische Anwendung fand diese Methode bereits in den fünfziger ZI Aktuell 2/06 natürliche körpereigene Kontrastmittel (z.B. Blut, Wasser) verwendet werden, was ein entscheidender Vorteil ist. Die wesentliche Einschränkung der Einsatzmöglichkeiten von Kernspintomografen liegt in dem Ausschlusskriterium für Personen mit magnetischen Implantaten wie Herzschrittmacher, Medikamentenpumpen und chirurgischen Fixationen. Die Lärmbelastung durch auftretende Klopfgeräusche des Gradientensystems können ein 8 subjektives Unwohlsein verursachen. Ebenso kann eine vorliegende Klaustrophobie ein weiteres Ausschlusskriterium sein. Moderne Kernspintomografen im Klinik- und Forschungsbetrieb haben eine Feldstärke von 1,5-3 Tesla. Im Vergleich dazu hat das Magnetfeld der Erde zirka 30 bis 60 Mikrotesla, d.h. das Feld im Tomografen ist in der Größenordnung etwa 100.000 mal stärker. Zur Bildgebung wird das Kernresonanzsignal der Wasserstoffkerne im Wassermolekül genutzt. Das Gehirn besteht fast zu 80% aus Wasser, und eignet sich somit ideal für die Kernspintomografie des Wasserstoffkerns. Anatomische Grundlagen Im Gehirn werden hoch zentralisiert Sinneseindrücke verarbeitet und komplexe Verhaltensweisen koordiniert. Es ist somit der Hauptintegrationsort für alle überlebenswichtigen Informationen, die in einem Organismus verarbeitet werden. Auf der zellulären Ebene besteht das Gehirn aus der grauen Substanz, den Ansammlungen von Zellkörpern (Neurone, Somata), auch als „graue Zellen“ bezeichnet und der weißen Substanz, welche die Leitungsbahnen (Nervenfasern, Fortsätze der Nervenzellen, Axone) beinhaltet. Eingebettet ist das Gehirn in den Liquor cerebrospinalis, das Gehirnwasser, das auch der Polsterung des Gehirns dient. Anatomisch werden vereinfacht vier Hauptbereiche des Gehirns unterschieden: Großhirn, Kleinhirn, Mittelhirn und Hirnstamm, wobei diese Bereiche noch einmal in einzelne funktionelle Regionen aufgeteilt werden. Bei der Verarbeitung von Sinneseindrücken arbeiten viele verschiedene Regionen des Gehirns auf komplexe Weise zusammen. Dennoch können durch eine Schädigung einer einzelnen Untereinheit des Gehirns bestimmte Hirnfunktionen vollständig verloren gehen. Ein Beispiel hierfür ist das beim Menschen bekannte UrbachWiethe-Syndrom, einer selektiven Verkalkung der Amygdalae mit einhergehendem Funktionsausfall. Diese auch als „Mandelkerne“ bezeichnete Region ist ein Kerngebiet des Gehirns im medialen Teil des Temporallappens www.zi-mannheim.de und ist unter anderem für die emotionale Bewertung von Sinneseindrücken /Situationen zuständig. Patienten mit Urbach-Wiethe- Syndrom können der Emotion Angst keine Bedeutung mehr zuordnen. Sie können weder beschreiben, wie ein ängstliches Gesicht aussieht, noch verspüren sie selbst Angst. Diese Beeinträchtigung hat starke Auswirkungen auf das soziale Leben. Es fällt den Patienten schwer, in kritischen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch Fehlfunktionen der Amygdalae können beim Menschen zu einer Vielzahl von Beeinträchtigungen führen, wie Gedächtnisstörungen, der Unfähigkeit der emotionalen Einschätzung von Situationen, Autismus, Depression, Narkolepsie, Posttraumatische Belastungsstörungen und Phobien. Psychiatrische Erkrankungen sind jedoch in der Regel nicht mit makroskopischen Veränderungen einzelner Hirnareale verknüpft. Es wird heute davon ausgegangen, dass die Veränderungen des Gehirns, die den Erkrankungen zugrunde liegen von mikrostruktureller Natur sind und daher erst mit verfeinerten bildgebenden Verfahren zur Abbildung funktioneller und metabolischer Eigenschaften des Gehirns erfasst werden können. MRT-Forschung am ZI Am Beispiel der Erkrankungen Depression und Schizophrenie wird im Folgenden ein Einblick in die Forschung mit der Kernspintomografie am ZI gegeben. Die Depression ist das psychiatrische Störungsbild mit der höchsten Erkrankungshäufigkeit. Etwa 10% der Bevölkerung suchen im Laufe ihres Lebens eine Behandlung wegen Depressionen auf. Die Dunkelziffer der unbehandelten Depressionen liegt mindestens doppelt so hoch. Bei Depressionen handelt es sich um eine komplexe emotionale Störung. Zu den Kernsymptomen der Schizophrenie gehören Wahn, Sinnestäuschungen und Denkstörungen sowie Beeinträchtigungen kognitiver, emotionaler und sozialer Funktionen. Die neuronale Entwicklungstheorie der Schizophrenie besagt, dass ursächliche und krankheitsauslösende Faktoren lange vor dem eigentlichen Krankheitsbeginn auftreten (wahrscheinlich schon während der Schwangerschaft). Diese Faktoren stören den Ablauf der normalen neuronalen Entwicklung und resultieren in pathologischen Ver- ZI Aktuell 2/06 änderungen spezifischer Neurone und deren Verbindungen und führen letztendlich zu Fehlfunktionen. Kernspintomografiebasierte Morphometrie Die digitale Morphometrie ist eine quantitative Beschreibung von Hirnstrukturen durch Größe, Intensität, Form- und Texturparameter. Diese Parameter können in statistischen Verfahren verwendet werden, um Unterschiede zwischen einer Gruppe von Patienten zu einer gesunden Vergleichsgruppe herauszufinden, die bei der Betrachtung einzelner individueller Aufnahmen nicht auszumachen sind. In depressiven Patienten ist die Verarbeitung emotionaler Reize gestört. Eine der wichtigsten Gehirnregionen für die Verarbeitung von Emotionen sind die Amygdalae. In einer Pilotstudie mit kernspintomografie-basierter Morphometrie am ZI wurde bei der Analyse von zehn Aufnahmen depressiver Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen eine Reduktion der grauen Substanz beider Amygda- Impulsen vermittelt. Einzelne Neurone lassen sich nicht direkt mit dem Kernspintomografen abbilden. Dennoch kann die funktionelle Kernspintomografie die Gehirnaktivität indirekt messen, und zwar anhand von Änderungen im Blutgefäßsystem, die als Folge neuronaler Aktivität durch den Verbrauch von Sauerstoff auftreten. Der verbrauchte Sauerstoff wird durch nachströmendes sauerstoffreiches Blut kompensiert. Dieses wiederum hat andere magnetische Eigenschaften als sauerstoffarmes Blut und verändert das gemessene Signal. In den aufgenommenen Bildserien verändern sich damit die Grauwerte und Signaländerungen werden so sichtbar. Blut dient somit als „natürliches Kontrastmittel“. Bei schizophrenen Patienten gibt es eine ganze Reihe funktioneller Kernspinstudien, die auf veränderte Gehirnfunktionen hinweisen. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass im Vergleich zu einer Gruppe von gesunden Kontrollprobanden bei der gleichzeitigen Präsentation unterschiedlicher Abbildung 2: Visuo-motorisches Netzwerk der Geschwindigkeitsdiskrimination: Im Vergleich zu den gesunden Probanden (1) zeigt die Patientengruppe (2) in den hierarchisch höheren Anteilen des dorsalen visuellen Verarbeitungspfad signifikante Aktivierungseinbußen. lae in den depressiven Patienten gefunden (Abbildung 1). Funktionelle Kernspintomografie Die Funktion des Gehirns basiert hauptsächlich auf dem Zusammenwirken von stark vernetzten Nervenzellen (Neurone). Die Kommunikation zwischen den Neuronen, den funktionellen Grundbausteinen des Gehirns, wird mit Hilfe von elektrischen 9 Reize (visuelle und akustische) der dorsolaterale präfrontale Kortex weniger aktiv ist. Dies passt gut zu der Filterstörungstheorie der Schizophrenie, die besagt, dass schizophrene Patienten Beeinträchtigungen bei der Bearbeitung simultan dargebotener Reize haben. In Laboruntersuchungen fanden sich bei schizophrenen Patienten selektive Beeinträchtigungen bei der Unterscheidung kleiner Geschwindigwww.zi-mannheim.de keitsdifferenzen. Um diese Annahme zu überprüfen, wurde am ZI eine funktionelle Kernspintomografie-Studie durchgeführt, um die Aktivierungsmuster von chronisch schizophrenen Patienten bei der Geschwindigkeitsunterscheidung im Kernspintomografen zu untersuchen. Dabei wurden die Studienteilnehmer vor die Aufgabe gestellt, den jeweils schnelleren Reiz aus einer Folge bewegter Schwarzweiss-Gitterpaare zu bestimmen. Es zeigte sich, dass zur Bearbeitung solcher Diskriminationsaufgaben der Einsatz eines umfassenden visuo-motorischen Gehirnnetzwerks nötig ist (Abbildung 2). Im Gruppenvergleich zeichneten sich die schizophrenen Patienten bei vergleichbarem Leistungsverhalten durch eine selektive Minderaktivierung posterior-parietaler und präfrontaler Hirnregionen aus. KernspinresonanzSpektroskopie Die Kernspinresonanz -Spektroskopie stellt eine einzigartige Methode dar, um Stoffwechselvorgänge am lebenden Gehirn, nicht-invasiv zu untersuchen. Sie erlaubt den Nachweis von zellulären Stoffwechelprodukten (Metaboliten) und deren Konzentrationsänderung im intakten Gewebe. Eine große Zahl niedermolekularer, frei beweglicher zellulärer Metaboliten oder zugeführter Pharmaka sind über ihr 1H-, 13C-, 19F- oder 31P-Kernspinresonanzsignal nachweisbar. Die methodische Weiterentwicklung der Kernspinresonanz-Spektroskopie am Ganzkörpertomografen und ihr potentieller Einsatz in der Nervenheilkunde werden seit Mitte der achtziger Jahre verfolgt. Mit der Kernresonanz-Spektroskopischen-Bildgebung lässt sich die anatomische Information der Kernspinresonanz -Bildgebung zusammen mit der biochemischen Information der Spektroskopie im gleichen Messvorgang erfassen. Mit diesem Verfahren haben sich Fragestellungen für die Kernspinresonanz-Spektroskopie eröffnet, die bisher der Nuklearmedizin, insbesondere der Positronen-EmissionsTomographie, vorbehalten waren. Der Wasserstoffkern nimmt auch hier eine Sonderstellung ein, da er im lebenden Gewebe am häufigsten vorkommt und die größte Sensitivität aller für die Kernspinresonanz zugänglichen Kerne besitzt. Da die Konzentration der detektierbaren Stoffe im Gehirn mehr als tausendfach geringer ZI Aktuell 2/06 ist als die des Wassers und der Lipide (Fette), bleibt zum einen die räumliche und zeitliche Auflösung der Kernspinresonanz-Spektroskopie hinter der Kernspinresonanz-Bildgebung zurück und zum anderen müssen geeignete Maßnahmen zur Unterdrückung der starken Wasser- und Lipid-Signale im Spektrum getroffen werden. Die Wasserstoff-KernspinresonanzSpektroskopie wird weltweit in vielen Zentren als wertvolle, zusätzliche diagnostische Methode zur Lokalisie- der Qualität der Phosphorspektren erlaubt. Ein Teilprojekt des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereichs 636: „Lernen, Gedächtnis und Plastizität des Gehirns: Implikationen für die Psychopathologie“ untersucht bei depressiven Patienten die Unterschiede des Phosphormetabolismus im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen sowie mögliche Veränderungen unter erfolgreicher Therapie. Wichtige Anforderung an alle Kern- Abbildung 3: Vergleich zweier Kernspinspektren aus dem Hippocampus einer gesunden Kontrollperson (links) und eines Patienten (rechts) mit Schizophrenie rung von Temporallappenepilepsie angewandt. Eine Vielzahl internationaler Studien zeigen potentielle Anwendungen der KernspinresonanzSpektroskopie in der Psychiatrie. Wasserstoff-Kernspinresonanz-Spektroskopie-Studien aus dem ZI konnten bei schizophrenen Patienten gegenüber gesunden Kontrollpersonen in mehreren Gehirnarealen eine Verminderung des Metaboliten N-Acetylaspartat-Signals aufzeigen. Abbildung 3 zeigt Beispielspektren aus dem Hippocampus. N-Acetylaspartat ist die zweithäufigste Aminosäure im Gehirn und wird als neuronaler Funktionsmarker angesehen. spinresonanz-Methoden ist, dass die Untersuchungsdauer dem Patienten zumutbar sein muss. Insbesondere bei psychiatrischen Patienten ist die Ausfallrate hoch, da aufgrund der Psychopathologie die Toleranz gegenüber langen Kernspinuntersuchungen gering ist. Speziell Mehrfachuntersuchungen zur Therapieverlaufskontrolle dürfen daher die Kooperationsbereitschaft des Patienten nicht überfordern. Die fortlaufenden Kernspintomografie-Studien an psychiatrischen Patienten dienen der Überprüfung von Hypothesen moderner Theorien der psychiatrischen Erkrankungen an Patienten. Am ZI werden darüber hinaus spektroskopische Messungen phosphorhaltiger Verbindungen im Gehirn durchgeführt. Dazu verfügt das Institut über eine spezielle Hardware-Ausstattung, die die Anwendung so genannter Doppelresonanzmethoden zur Erhöhung Ziel der Abteilung Neuroimaging am ZI ist es, Beiträge zur neurobiologischen Grundlagenforschung psychischer Erkrankungen sowie für ein individuelles Therapie-Monitoring zu leisten. 10 Gabriele Ende www.zi-mannheim.de Warum gibt es am ZI „depressive“ Ratten und Mäuse? Forschungsschwerpunkte der AG Verhaltenbiologie Affektiver Erkrankungen Die Depression ist eine häufige Er- krankung. In Industrienationen erkrankt statistisch jeder fünfte im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen Depression. Die Betroffenen leiden schwer unter dieser Erkrankung. Häufige Symptome sind gedrückte Stimmung bis zu dem Punkt, keinerlei Freude mehr empfinden zu können, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Angst und Schuldgefühle, aber auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Gewichtsabnahme und Libidoverlust. Antriebsstörungen und bleierne Müdigkeit führen dazu, dass Depressive ihre täglichen Aufgaben nicht mehr bewältigen können, oft sind Schwierigkeiten bei der Arbeit oder in Partnerschaft und Familie die Folge der Erkrankung. Zur Behandlung der Depression stehen uns eine Vielzahl von Medikamenten, aber auch verschiedene psychotherapeutische Verfahren zur Verfügung. Moderne Antidepressiva haben weniger Nebenwirkungen und werden in der Regel von den Patienten gut vertragen. Jedoch vergehen vom Beginn der Behandlung bis die Depression abklingt in der Regel mindestens einige Wochen; eine Zeit, die für die Patienten oft unerträglich ist. Überdies erweisen sich Medikamente etwa bei einem Drittel aller Patienten als unwirksam. Daher werden weltweit große Anstrengungen unternommen, um neue, besser und schneller wirksame Medikamente zu finden. Die Entwicklung solcher Medikamente setzt jedoch voraus, dass wir wissen, welche neurobiologischen Veränderungen der Depression zugrunde liegen Neurobiologie der Depression Aus epidemiologischen Untersuchungen ist gesichert, dass die Depression eine erbliche Komponente hat. Wir gehen davon aus, dass verschiedene (größtenteils noch unbekannte) Gene zu etwa 30% bestimmen, wie empfindlich (prädisponiert) ein Individuum ist, an einer Depression zu erkranken. Ob die Erkrankung ausbricht, hängt jedoch neben diesen Genen auch von Umweltbedingungen ab: frühkindliche Traumen, belastende frühere und akZI Aktuell 2/06 tuelle Lebensereignisse, chronischer Stress, aber auch Krankheiten oder bestimmte Medikamente können Depressionen auslösen. Vermutlich können manche Menschen Stress gut verarbeiten, während bei anderen Menschen (oder bei sehr starkem Stress) negative Auswirkungen in Form von Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen auftreten. Über die Mechanismen, wie Stress im Gehirn verarbeitet wird und wie er zu Depressionen führt, wissen wir derzeit jedoch noch zu wenig. Viele unserer Fragen können wir am Menschen untersuchen, so wissen wir z.B. dass eine Form des Gens, das für den Serotonin-Transporter kodiert, 5HTTPR, zu vermehrter Ängstlichkeit und zu häufigerem Auftreten von Depressionen unter Stress führt. Kürzlich wurde mit einer sehr eleganten funktionellen Kernspin (fMRI) Untersuchung gezeigt, dass diese Genvariante zu einer schlechteren Zusammenarbeit von Gyrus cinguli und der Amygdala führt, Gehirnregionen, die an der Verarbeitung von Stress und Emotionen beteiligt sind. Dabei bleiben jedoch viele Fragen offen, da bildgebende Untersuchungen wie fMRI, Magnetresonanz-Spektroskopie und auch oder auch PositronenEmissions-Tomographie (PET) nämlich nicht direkt die Funktion einzelner Neurone messen, sondern nur indirekte Hinweise auf die Aktivität größerer Hirnregionen geben. So misst das fMRI z.B. den Blutfluss im Gehirn, und man nimmt an, dass die Durchblutung von Hirnregionen von deren Aktivität abhängt, dass also die Durchblutung steigt, wenn die Region aktiviert wird und umgekehrt. Abkürzungen: ACTH: adrenokortikotropes Hormon, wird in der Hypophyse gebildet und bewirkt die Ausschüttung von Kortison in der Nebenniere. BDNF: brain derived neurotrophic factor, ein Wachstumsfaktor, der u. a. die Bildung neuer Neurone und die Heilung verletzter Neurone fördert. CRH: Kortikotropin-Releasing-Hormon, wird im Hypothalamus gebildet und bewirkt in der Hypophyse die Ausschüttung von ACTH. fMRI: funktionelles Kernspin, misst den Blutfluss in Hirnregionen und lässt Rückschluss auf die Aktivität dieser Hirnregionen zu. GR: Glukokortikoidrezeptor, Bindungsstelle für Kortison. GR-heterozygote (Mäuse) haben nur ein Gen (statt zwei) für den Glukokortikoidrezeptor. HHN-System: Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-System zur Regulation des Stresshormons Kortison. PET: Positronen-Emissions-Tomographie 5HTTPR: Promotor für den Serotonin-Transporter. Gen, das in zwei Varianten vorkommt, wobei eine Variante das Risiko erhöht, an einer Depression zu erkranken. Tiermodelle der Depression Solche Annahmen müssen aber an Versuchstieren überprüft werden, wo die Funktion der Neurone direkt gemessen werden 11 www.zi-mannheim.de kann. Am Tier kann außerdem untersucht werden, welche der verschiedenen Neurone ihre Aktivität ändern, wie sie verschaltet sind und welche Transmitter dabei beteiligt sind. In der Arbeitsgruppe „Verhaltensbiologie Affektiver Erkrankungen“ untersuchen wir diese Fragen an Mäusen und Ratten, die ein depressionsähnliches Verhalten zeigen. Natürlich ist der Ausdruck der Depression beim Tier ganz anders als beim Menschen: wir können die Tiere nicht nach ihrer Stimmung fragen, Symptome wie Insuffizienz- oder Schuldgefühle hängen von der Sprache und von der Selbstreflektion des Menschen ab. Für eine Vielzahl auch von depressiven Kernsymptomen lässt sich jedoch beim Tier ein Verhaltenskorrelat finden. Überzeugung führen, dass das eigene Handeln niemals Auswirkungen auf die Folgen haben wird (Hilflosigkeit) und in Passivität, Lethargie und Traurigkeit münden. Bei Ratten und Mäusen verwenden wir unkontrollierbaren Stress, um Erlernte Hilflosigkeit zu induzieren. Die Hilflosigkeit wird in einem so ge- Ein gutes Tiermodell ist dabei der menschlichen Krankheit in der Entstehung (z.B. durch Stress), in der Symptomatik (z.B. Anhedonie) und in der Behandelbarkeit (durch Medikamente) möglichst ähnlich. In diesem Artikel stellen wir solche Tiermodelle für die Depression vor und beschreiben, wie sich das Verhalten der Tiere untersuchen lässt und welche Erkenntnisse dabei gewonnen werden können. Konzept der Erlernten Hilflosigkeit Ausgehend von der Beobachtung, dass Stress beim Menschen Depressionen auslösen kann, wird in den meisten Tiermodellen Stress verwendet, um depressionsähnliches Verhalten auszulösen. Zwei Tiermodelle zeigen eine besonders gute Validität, d.h. sind besonders geeignet die neuronalen Mechanismen zu untersuchen, die einer Depression zugrunde liegen: die „Erlernte Hilflosigkeit“ und das Modell „Chronisch milder Stress“. Das Konzept der Erlernten Hilflosigkeit wurde von Martin Seligman ursprünglich zur Beschreibung von Tierverhalten formuliert, wenig später jedoch auch auf den Menschen übertragen. Nach Seligman kann das Syndrom der Erlernten Hilflosigkeit durch unkontrollierbare Ereignisse, die einen Stress für das Individuum bedeuten, hervorgerufen werden. Das intensive Erleben einer solchen Ohnmacht kann bei Menschen (und analog bei Tieren) zu der ZI Aktuell 2/06 Abbildung 1: Das Messen der Anhedonie bei Nagern: das Tier kann sich zwischen zwei unterschiedlich konzentrierten Zuckerlösungen entscheiden. Chronisch gestresste Tiere trinken deutlich weniger Zuckerlösung als ungestresste, was als verminderte Freudfähigkeit interpretiert wird. Zeichung: Dusan Bartsch. nannten „Escape-Test“ gemessen: dabei misst man, wie schnell die Tiere lernen, einen aversiven Stressor zu vermeiden, indem sie diesen mit einem Hebel abschalten oder durch ein Fluchttor passieren. Nicht depressive Tiere machen bei einem solchen Test praktisch keine Fehler und entkommen regelmäßig dem Stressor. Tiere mit Erlernter Hilflosigkeit machen dagegen gar keinen Versuch, dem Stressor zu 12 entkommen, sie ertragen ihn passiv und zeigen dabei zahlreiche Ähnlichkeiten zu depressiven Patienten. Modell “Chronisch milder Stress“ Das Modell “Chronisch milder Stress“ wurde von Richard Katz eingeführt und von Paul Willner verbessert. Dabei werden die Tiere über mehrere Wochen verschiedenen, einzeln harmlosen Stressoren (z.B. neue Käfigpartner, nasses Einstreu, etc.) ausgesetzt, die jedoch kumuliert chronische Stressreaktionen aktivieren. Die Tiere zeigen danach eine Anhedonie, die als Analogon menschlicher Freudlosigkeit während der Depression gilt. Anhedonie kann bei Nagern mit süßen Lösungen gemessen werden, die Nager normalerweise gerne trinken. Wenn man Mäusen und Ratten in ihrem Heimkäfig gleichzeitig eine Flasche mit Zuckerlösung und eine mit Wasser anbietet, trinken sie normalerweise zu mehr als 75% Zuckerlösung. Chronisch gestresste Tiere trinken dagegen deutlich weniger Zuckerlösung als ungestresste, sprechen also weniger auf den angenehmen Stimulus an, was als Zeichen der Anhedonie interpretiert wird (siehe Abbildung 1). Weitere Testverfahren Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Testverfahren, mit denen man typische depressive Verhaltenskorrelate bei Tieren messen kann. Im Porsolt Schwimmtest oder im TailSuspension Test zeigen depressive Individuen ebenfalls Immobilität als Korrelat für sogenanntes „despair“ oder „giving up“ Verhalten, während nicht depressive (stressresistente) Individuen aktive Coping-Strategien anwenden, um dieser unangenehmen Situation zu entkommen. Auch Ängstlichkeit, ein typisches Symptom eines depressiven Syndroms, kann bei Nagern experimentell sehr gut evaluiert werden. Dazu werden Tierversuchsarenen benutzt, die teils angstbesetzte (d.h. helle oder offene) Areale aufweisen und teils geschützte (dunkle, mit Wänden versehene). Je mehr Zeit die Tiere in den dunklen, geschützten Arealen verbringen, desto ängstlicher sind sie. Als Korrelat für Antriebsverlust dient verminderte Lokomotion und vermindertes Explorationsverhal- www.zi-mannheim.de ten. Stressbedingte Änderungen des Fressverhaltens und Gewichtsverlust können durch einfaches Wiegen (des Futters und des Versuchstieres) bestimmt werden, depressionstypische Veränderungen des Schlafverhaltens können auch bei Mäusen wie beim Menschen durch ein EEG elektrophysiologisch abgeleitet werden. Depressive Pseudodemenz lässt sich durch Lerntests überprüfen. Wir sind also in der Lage, durch akuten (erlernte Hilflosigkeit) oder chronischen Stress (chronischer milder Stress) depressive Syndrome bei Ratten und Mäusen hervorzurufen, welche durch die oben vorgestellte Verhaltenstestbatterie abgebildet werden können. Außerdem können wir - ähnlich wie beim depressiven Patienten - die Dauer des depressiven Syndroms durch antidepressive Psychopharmaka verkürzen. Diese in vivo Modellsysteme kann man nun dazu benutzen, um neurobiologische Mechanismen zu analysieren, die bei der Entstehung (Pathogenese), bei der Aufrechterhaltung oder bei der Therapie depressiver Störungen eine Rolle spielen. Im wesentlichen Unterschied zum depressiven Patienten können bei Mäusen und Ratten zu jedem Zeitpunkt eines Versuchs die Gehirne entnommen und einer molekularen, biochemischen oder elektrophysiologischen Analyse unterzogen werden. Dabei hat sich herausgestellt, dass trotz des enormen evolutionären Unterschieds zwischen Menschen und Nagern der Hirnstoffwechsel so ähnlich ist, dass viele molekulare und neurochemische Mechanismen aus dem Tierversuch direkt auf den Menschen übertragen werden können. Im Folgenden soll nun an einigen typischen Beispielen erläutert werden, wie unsere Arbeitsgruppe mithilfe von unseren Tiermodellen biologische Veränderungen identifiziert hat, die zusammen mit depressiven Verhaltensveränderungen auftreten. Veränderung neuroendokrinologischer Stresssysteme Ein seit langem bekannter Befund beim Menschen ist die Tatsache, dass es bei vielen Patienten mit einer schweren depressiven Episode zu einer Veränderung neuroendokrinologischer (hormoneller) Stresssysteme kommt, die letztendlich zu einer Erhöhung der ZI Aktuell 2/06 Kortisol-Spiegel führen. Sowohl im Ratten- als auch im Mausmodell der erlernten Hilflosigkeit konnten wir zeigen, dass es dort ebenfalls zu einer Fehlregulation der Kortikosteron- (entspricht dem Kortisol des Menschen) Ausschüttung kommt. Dies beruht keineswegs auf einer Störung der Nebenniere, wo dieses Hormon gebildet wird, sondern auf einer komplexen Fehlregulation, die im Hypothalamus Ursache und welche Wirkung ist. Daher verwendeten wir genetisch veränderte („transgene“) Mäuse, die eine um 50% verminderte Expression des Glukokortikoidrezeptors aufweisen, so genannte GR-heterozygote Mäuse, und konnten nachweisen, dass die Verminderung des Glukokortikoidrezeptors ursächlich für die depressiven Verhaltensveränderungen ist. Dieser gezielt verursachte genetische Defekt Abbildung 2: Im Hippokampus werden nicht nur bei Tieren, sondern auch beim Menschen lebenslang neue Nervenzellen gebildet. Dieser Vorgang heißt Neurogenese. Im Bild sieht man rot markiert die Zellkerne der neuen Neurone am Rand der Körnerzellschicht (lila) im Gyrus Dentatus. ihren Ausgang nimmt. Dort kommt es zu einer vermehrten Bildung des Hormons Kortikotropin-ReleasingHormon (CRH), was nachfolgend zu einer vermehrten Synthese von adrenokorticotropem Hormon (ACTH) in der Hypophyse führt, welches wiederum für die Bildung und Ausschüttung von Kortisol/ Korticosteron in der Nebennierenrinde verantwortlich ist. Mithilfe unserer Tiermodelle konnten wir zeigen, dass Glukokortikoidrezeptoren, also diejenigen Steuermoleküle, an die Kortisol/Korticosteron bindet und dadurch seine Wirkung entfaltet, bei dieser Überaktivierung des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems (HHN-Sytems) eine wichtige Rolle spielen. Aus früheren Untersuchungen an unserem Rattenmodell der erlernten Hilflosigkeit wussten wir, dass es bei hilflosen Tieren zu einer Verminderung des Glukokortikoidrezeptors im Gehirn der Versuchstiere kommt. Diese Veränderung lässt sich durch Gabe von antidepressiven Psychopharmaka erfolgreich behandeln. Allerdings kann man mit solchen korrelativen Untersuchungen nicht zeigen, welche Veränderung 13 wirkt sich zunächst unter regulären Tierhaltungsbedingungen überhaupt nicht aus. Die Versuchstiere sind nicht von Geschwistertieren zu unterscheiden, welche den genetischen Defekt nicht aufweisen. Allerdings zeigen GR-heterozygote Mäuse ganz ähnliche Veränderungen des HHN-Systems wie depressive Patienten. Daher wollten wir als nächstes wissen, ob diese Tiere auch depressive Verhaltensveränderungen aufweisen. In der Tat zeigen GR-heterozygote Mäuse im Modell der erlernten Hilflosigkeit eine signifikant stärkere Ausprägung von depressiven Verhaltensweisen als ihre Kontroll-Geschwistermäuse. Dieser experimentelle Ansatz zeigt also, dass eine (hier experimentell verursachte) Verminderung der Expression des Glukokortikoidrezeptors zu einer Zunahme depressiver Verhaltensymptome führt. Diesen Zusammenhang konnten wir mithilfe eines weiteren transgenen Mausmodells noch einmal untermauern. Wenn man nämlich transgene Tiere untersucht, die molekular genau das Gegenteil von GR-heterozygoten www.zi-mannheim.de Mäusen darstellen, weil sie den Glukokortikoidrezeptor etwa zweifach überexprimieren, finden sich auch auf der neuroendokrinologischen und auf der Verhaltensebene gegenteilige Befunde wie bei GR-heterozygoten Mäusen. der Depression, die postuliert, dass depressive Verhaltensveränderungen mit einer verminderten Synthese von BDNF einhergehen. So geht z. B. mit der Erlernten Hilflosigkeit eine Fehlregulation der BDNF-Expression einher. Abbildung 3: Während antidepressive Medikamente die Aktivität in Hypothalamus und Hirnstamm ändern und dadurch die Aktivität im Limbischen System normalisieren, bewirkt kognitive Verhaltenstherapie Veränderungen in Präfrontalen Regionen, die ebenfalls Auswirkungen auf das Limbische System haben. Im Limbischen System werden Emotionen verarbeitet. GR-überexprimierende Mäuse sind stressresistent, was sich sowohl durch verminderte Korticosteron-Spiegel als auch durch ein verbessertes Coping-Verhalten im Modell der erlernten Hilflosigkeit zeigt. Diese Mausmodelle können künftig dazu benutzt werden, weitere biologische Veränderungen zu identifizieren, die mit der Entwicklung depressiver Verhaltensweisen oder umgekehrt mit einer Stressresistenz einhergehen. Als erstes Beispiel für ein weiteres mögliches Korrelat der genannten Verhaltensveränderungen haben wir den Wachstumsfaktor BDNF (brain derived neurotrophic factor) identifiziert. BDNF ist im Hippokampus einer Nervenzellpopulation des sogenannten limbischen Systems, welches für emotionales Verhalten wichtig ist von GR-heterozygoten Mäusen vermindert, hingegen im Hippokampus von GR-überexprimierenden Mäusen erhöht. Plastische Veränderungen Diese Befunde passen sehr gut zur sogenannten Neurotrophinhypothese ZI Aktuell 2/06 Gesunde Tiere zeigen nämlich unter Stress eine Verminderung des BDNF, während Ratten, die für Hilflosigkeit gezüchtet wurden, sich nicht an Stress anpassen können, weder auf biochemischer Ebene durch Regulation des BDNF, noch auf der Verhaltensebene. Wie hier deutlich wird, ist BDNF ein wichtiges Steuerungssignal im Rahmen der Neuroplastizität, d. h. der Anpassung an veränderte Umweltbedingungen. BDNF beeinflusst und steuert die synaptische Plastizität, aber auch das Wachstum von neuen Nervenzellen. Es hat in den letzten Jahren für große Aufregung gesorgt, als sich herausstellte, dass im Gehirn von allen Säugetieren (auch dem Menschen) lebenslang neue, funktionstüchtige Neurone gebildet werden können. Dieser Vorgang heißt Neurogenese und es verbindet sich damit die Hoffnung, Gehirnkrankheiten, die auf den Untergang von Neuronen zurückzuführen sind, in Zukunft besser behandeln zu können (siehe Abbildung 2). Die Depression wurde mit der Neurogenese in Verbindung gebracht, weil die Neurogenese durch Stress vermindert und durch 14 antidepressive Behandlung stimuliert wird. Allerdings sprechen unsere Befunde im Tiermodell gegen einen unmittelbaren Zusammenhang von depressivem Verhalten und Neurogenese. Es scheint sich vielmehr um unspezifische Stresseffekte zu handeln, die auf die Neurogenese Einfluss nehmen und nicht unbedingt zu Depressionen führen. Bezug zum Menschen Helen Mayberg hat mit PET-Untersuchungen von depressiven Patienten gezeigt, dass sich bei der Genesung von einer Depression die Aktivität in vielen verschiedenen Hirnregionen ändert. Antidepressive Medikamente normalisieren die Funktion im limbischen System und in Hirnregionen, die für Hormone und Stressverarbeitung wichtig sind, wie dem Hypothalamus und dem Hirnstamm. Dagegen verbessert sich unter kognitiver Verhaltenstherapie die Funktion von Arealen im Präfrontalen Kortex, die für die Bewertung und Beurteilung von Situationen wichtig sind, und dadurch normalisiert sich auch die Funktion von untergeordneten Zentren der Emotions- und Stressverarbeitung. Psychologen wissen schon lange, dass Stress sich viel schädlicher auswirkt, wenn er mit einer negativen Bewertung einhergeht. Im Tierexperiment konnte wiederum das elektrophysiologische Korrelat dieser Beobachtung gezeigt werden, über welche Neurone nämlich der Präfrontale Kortex günstige Gedanken denkt (z. B. „es ist alles unter Kontrolle“ oder „mir droht keine Gefahr“) und damit Stress verarbeitende Zentren im Hirnstamm hemmen und positiv beeinflussen kann. Zusammenfassend wollen wir noch einmal unterstreichen, welche wichtige Rolle Tiermodelle für die Erforschung der neurobiologischen Grundlagen depressiver Störungen spielen. Dabei ist wichtig, dass im Verhalten der Versuchstiere möglichst genau Übereinstimmungen zum Menschen gesucht werden, damit der Komplexität depressiver Störungen Rechnung getragen wird und molekulare Veränderungen gefunden werden, die verändertem Verhalten zugrunde liegen. Barbara Vollmayr Peter Gass www.zi-mannheim.de Wenn Schmerz nicht mehr weh tut Schmerzwahrnehmung bei Borderline Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine schwere psychische Erkrankung, die durch affektive Instabilität, erhöhte Impulsivität und häufig auch durch selbstverletzendes Verhalten gekennzeichnet ist. Nach der aktuellen Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals für Psychische Störungen (DSM-IV-TR) wird diese Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, wenn mindestens fünf der folgenden neun Kriterien erfüllt sind: ► ein verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu verhindern ► instabile, aber eine intensive zwischenmenschliche Beziehungen ► Identitätsstörungen (d. h. hohe Instabilität bezüglich Selbstbild oder -wahrnehmung) ► wiederkehrende Impulshandlungen mit selbstschädigendem Charakter ► Suizidhandlungen und -drohungen oder selbstverletzendes Verhalten ► ausgeprägte affektive Instabilität ► ein chronisches Gefühl von Leere ► die Schwierigkeit, Wut und Ärger zu kontrollieren ► vorübergehende, durch Belastung ausgelöste paranoide Wahnzustände oder schwere dissoziative Symptome Im Wesentlichen handelt es sich also um eine tief greifende Störung der Affektregulation, die mit einem hohen Erregungs- und Anspannungsniveau verbunden ist. Die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung beträgt etwa 1,3%, wobei der überwiegende Anteil der Patienten weiblich ist. Die auffallenden Zusammenhänge mit traumatischen Erfahrungen in der Vorgeschichte der Patienten sowie eine hohe Komorbidität mit der Posttraumatischen Belas- ZI Aktuell 2/06 tungsstörung (PTBS) lassen auf eine entscheidende Rolle von chronischem Stress bei der Entstehung dieses Syndroms schließen. Etwa 70-80% aller Borderline-Patienten fallen durch selbstverletzendes Verhalten wie selbst zugefügte Schnitte, Verbrennungen etc. auf. Während dieser Episoden der Selbstverletzung berichten viele Patienten, dass sie die mit den Verletzungen verbundenen Schmerzen gar nicht oder nur in abgeschwächter Form wahrnehmen. Diese Berichte geben Anlass, den Zusammenhang zwischen Schmerz und Borderline genauer zu untersuchen. In der Forschungsabteilung der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am ZI wird das Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung intensiv erforscht; ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Schmerzwahrnehmung. Ist die Schmerzwahrnehmung bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung verändert? Diese Frage ist nach dem aktuellen Forschungsstand mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Wiederholt wurde eine geringere Empfindlichkeit für experimentelle Schmerzreize bei diesen Patienten festgestellt, was mit den klinischen Beobachtungen im Einklang steht. In einer Arbeit unserer eigenen Gruppe konnte nachgewiesen werden, dass nicht nur bereits unter normalen Umständen bei diesen Patienten eine reduzierte Schmerzempfindlichkeit vorliegt. Im Zustand starker Anspannung, der bei Borderline häufig auftritt, sinkt die Schmerzempfindlichkeit nochmals ab. Dies wurde bei einem Vergleich von 12 unmedizierten Borderline-Patientinnen mit 19 gesunden Kontrollprobandinnen ermittelt, wobei die Borderline-Patienten einmal während subjektiv hoher Anspannung, einmal unter normalen Bedingungen untersucht wurden. In zwei verschiedenen Tests der Schmerzwahrnehmung („Cold Pressure Test“ und „Tourniquet Pain Test“) wurden vergleichbare Ergebnisse erhalten; der Effekt ist also nicht von der gewählten Methode der Schmerzreizung abhängig. Außerdem gibt es bei Borderline-Patienten Zusammenhänge zwischen der Schmerzempfindlichkeit einerseits und 15 Dissoziation sowie aversiver innerer Anspannung andererseits, wie eine Studie unserer Gruppe belegt, bei der mit elektrischer Schmerzstimulation gearbeitet wurde. 12 Borderline-Patientinnen wurden dabei mit 12 gesunden Kontrollprobandinnen verglichen. Auch in dieser Studie zeigten sich bei den Patienten deutlich erhöhte Schmerzschwellen. Nur in der Patientengruppe korrelierten außerdem die Schmerzschwellen positiv mit dissoziativen Zuständen und negativer Anspannung. Je stärker diese – für das BorderlineSyndrom typischen – Zustände ausgeprägt waren, desto unempfindlicher waren die Patienten also gegenüber der schmerzhaften Reizung. Aber wie kommt es dazu, dass Schmerz von Borderline-Patienten anders wahrgenommen wird als von gesunden Personen? Diese Frage ist noch nicht eindeutig zu beantworten. Um einer Antwort näher zu kommen, muss man sich mit den Grundlagen der Schmerzwahrnehmung auseinandersetzen. Was beeinflusst die Schmerzwahrnehmung? Schmerz ist mehr als eine bloße sensorische Empfindung. Gedanken und Gefühle haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir Schmerz wahrnehmen. Sensorische, affektive und kognitive Schmerzanteile werden in einem Netzwerk von Hirnregionen verarbeitet, die zwar zu trennen sind, aber stark interagieren. Die sensorischen Aspekte der Schmerzempfindung – also z. B. wo wir den Schmerz wahrnehmen, ob er brennend, dumpf oder stechend erscheint und wie intensiv die Empfindung ist – werden in somatosensorischen Hirnarealen verarbeitet: im primären und sekundären somatosensorischen Kortex (SI und SII). Für die affektive, also gefühlsmäßige Wirkung des Schmerzes sind vor allem der anteriore cinguläre Kortex (ACC) und der insuläre Kortex von Bedeutung. Auch die Amygdala, die für die Verarbeitung insbesondere negativer Emotionen wie Angst eine Rolle spielt, ist hier involviert. Die kognitive Schmerzkomponente ist weniger klar zu lokalisieren. Vermutlich sind ebenfalls Bereiche des anterioren Cingulum beteiligt, ebenso wie präfrontale Bereiche, hier vor allem der dorsolaterale präfrontale Kortex (DLPFC). www.zi-mannheim.de Was ist bei Borderline-Patienten anders? Wenn man die Schmerzwahrnehmung experimentell untersucht, kann man durch verschiedene Methoden die unterschiedlichen Komponenten der Schmerzwahrnehmung gezielt beeinflussen und damit trennen. In einer Studie aus unserer Arbeitsgruppe wurde überprüft, ob die sensorische Schmerzkomponente bei BorderlinePatienten im Vergleich zu gesunden Probanden verändert ist. Dazu wurden zehn unmedizierte Borderline-Patientinnen mit 14 gesunden Kontrollprobandinnen verglichen. Mit Hilfe von Laserreizen verschiedener Intensitäten wurden Detektions- und Schmerzschwellen der Probandinnen bestimmt, während gleichzeitig Laserevozierte Potenziale (LEP) abgeleitet wurden. Der Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen wurde durch die Vorgabe mentaler Rechenaufgaben (Ablenkung) oder einer räumlichen Diskriminationsaufgabe (Fokussierung) untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass die sensorische Schmerzverarbeitung bei BorderlinePatienten intakt ist. Zwar war auch hier die subjektive Schmerzempfindung der Patienten im Vergleich zu den gesunden Probanden deutlich reduziert; die LEP-Antwort war jedoch mindestens ebenso stark ausgeprägt wie bei den Gesunden. Beide Gruppen unterschieden sich auch nicht hinsichtlich der Auswirkungen der Rechenaufgabe oder der Leistung in der räumlichen Diskriminationsaufgabe. Die reduzierte Schmerzwahrnehmung bei diesen Patienten hängt also wahrscheinlich auch nicht mit einer reduzierten schmerzbezogenen Aufmerksamkeit zusammen. Wahrscheinlicher ist eine Veränderung der affektiven und/oder kognitiven Verarbeitung von Schmerz. In einer weiteren Studie unserer Arbeitsgruppe, in der mit Hitzeschmerzreizung und funktioneller Magnetresonanztomografie gearbeitet wurde, zeigten sich Auffälligkeiten im Hinblick auf die zerebrale Verarbeitung von Schmerz bei Borderline-Patienten. Das charakteristische Muster bestand in einer starken Aktivierung des DLPFC, verbunden mit einer Deaktivierung des perigenualen ACC und der Amygdala. Möglicherweise ist in dieser Überaktivierung des DLPFC ein kognitiver Hemmmechanismus zu erkennen, der die Aktivität der affektiven Schmerzareale, wie des ACC und der Amygdala, reduziert (Abbildung 1). ZI Aktuell 2/06 Welche Richtung nimmt die weitere Forschung? Zurzeit laufen mehrere Studien in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, die das Phänomen der reduzierten Schmerzwahrnehmung bei Borderline-Patienten näher untersuchen. So interessiert zum Beispiel die Frage, inwieweit genetische Faktoren für diese Beziehung eine Rolle spielen. Auch die Bedeutung komorbider posttraumatischer Belastungsstörungen soll untersucht werden. Dazu werden Borderline-Patientinnen mit und ohne komorbide tung von Schmerz wird in einer weiteren laufenden Studie untersucht. Dabei soll vor allem überprüft werden, ob man die subjektive Schmerzempfindung durch affektive und/oder kognitive Faktoren beeinflussen kann und, falls ja, ob sich für diese Zusammenhänge zerebrale Korrelate identifizieren lassen. Weiterhin wird untersucht, ob es in dieser Hinsicht zwischen Borderline-Patienten und gesunden Probanden Unterschiede gibt. Mit Hitzeschmerzreizung und funktioneller Kernspintomografie werden psychophysiologische und neuronale Korrelate der Schmerzwahrnehmung Abbildung 1: Unterschiede in der zerebralen Aktivierung bei schmerzhafter Reizung: bei Borderline-Patientinnen fand sich im Vergleich zu gesunden Probandinnen eine stärkere Aktivierung des linken DLPFC (a, orange markiert) und eine Deaktivierung des perigenualen ACC (b, blau markiert) (Fixed Effects-Analyse, α = 0,05). Die Darstellung ist spiegelverkehrt. Aus: Schmahl et al. (2006), Archives of General Psychiatry, 63(6):659-67. PTBS hinsichtlich ihrer Hitzeschmerzschwellen und der zerebralen Korrelate der Schmerzwahrnehmung verglichen. Durch diesen Vergleich soll herausgefunden werden, ob die oben beschriebenen Auffälligkeiten in der Schmerzverarbeitung möglicherweise bei Patienten mit beiden Störungen in verstärktem Ausmaß auftreten. In einer weiteren Studie, die in Zusammenarbeit mit der Universität Mainz durchgeführt wird, werden Charakteristika der Schmerzwahrnehmung bei Borderline-Patientinnen mit unterschiedlichem Schweregrad der Erkrankung untersucht. Hier interessiert vor allem der Vergleich zwischen Patienten, die aktuell selbstverletzendes Verhalten berichten, und Patienten, die sich seit mindestens einem halben Jahr nicht selbst verletzt haben. Untersucht werden auch hier Schmerzschwellen und zerebrale Korrelate der Schmerzwahrnehmung in Form Laserevozierter Potentiale. Der Einfluss affektiver und kognitiver Variablen auf die Schmerzschwellen und die zerebrale Verarbei- 16 erhoben, wobei einerseits die Erwartung von Schmerz variiert, andererseits über affektive Bilder der emotionale Zustand der Probanden beeinflusst wird. Die Untersuchung dieser verschiedenen Fragestellungen in parallel laufenden Studien könnte dazu beitragen, die Grundlagen der veränderten Schmerzwahrnehmung bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung besser verständlich zu machen. Die Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen, zum Beispiel an den Universitäten Mainz und Utrecht, hilft uns, das Problem in einem größeren Kontext zu sehen und auch den Vergleich mit anderen Störungsbildern zu ziehen, bei denen ebenfalls eine veränderte Schmerzverarbeitung zu beobachten ist, wie z. B. Fibromyalgie und Posttraumatische Belastungsstörung. Diese vergleichende Forschung erweitert nicht nur das Wissen über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern auch über die Grundlagen der Schmerzwahrnehmung im Allgemeinen. Iris Klossika www.zi-mannheim.de Das Fibromyalgie-Syndrom Effekte und Indikationskriterien der operant- und der kognitive-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie Definition Nach den Klassifikationskriterien des American College of Rheumatology (ACR) von 1990 lässt sich das Fibromyalgie-Syndrom (FMS) definieren als „...Muskelschmerzen der oberen und unteren Extremitäten und der rechten und linken Körperhälfte, der Wirbelsäule und der vorderen Thoraxwand für mindestens drei Monate, wobei mindestens 11 von 18 Druckpunkten vierfach erhöhtes Risiko für FMS-Patientinnen an einem Mamma-Karzinom zu erkranken (McBeth, Silman, & Macfarlane, 2003). Es geht mit einem zweifach erhöhtem Mortalitätsrisiko am Mamma-Karzinom zu versterben einher (McBeth et al., 2003). Ursachen Die Ätiologie und Pathogenese des FMS sind unklar. Das international weitgehend anerkannte Modell in der Abbildung 1: Schmerzverhalten vor (T1), 6 Monate (T2) und 12 Monate nach (T4) operanter Schmerztherapie (OT), kognitiv-behavioraler Schmerztherapie (KVT) und sozialer Diskussionsgruppe (SDG) bei digitaler Palpation schmerzhaft sind ...“ (Wolfe et al., 1990). Die häufigsten zusätzlichen Symptome sind chronische Erschöpfung (81%), verminderte Belastbarkeit (77,0%), Morgensteifigkeit (67%), Kopfschmerzen (53%), Depression (32%), Schlafstörungen, die mit einem pathologisch veränderten Schlafmuster, im Sinne eines nichterholsamen Schlafes (75%), Insomnie (56%), sowie Konzentrationsstörungen einhergehen (Smythe & Moldovsky, 1977; White, Speechley, Harth, & Ostbye, 1995; Wolfe et al., 1990). Das FMS ist von vielfältigen vegetativen und funktionellen Störungen begleitet, wie z. B. Colon irritabile, Migräne oder auch Tachykardien. Bei mehr als 40% der FMS-Patienten tritt ein primäres Sjögren-Syndrom als entzündlich-rheumatische Erkrankung auf (Dohrenbusch, Gruterich, & Genth, 1996). Eine andere Studie berichtet im Vergleich zur Normalbevölkerung ein ZI Aktuell 2/06 Pathogenese des FMS ist das biopsychosoziale Modell, das davon ausgeht, dass genetische und lernabhängige Faktoren ebenso wie Stressereignisse relevant sind, die biologische und psychologische Reaktionen hervorrufen, die von peripher-physiologischen, endokrinen, zentralnervösen und psychosozialen Konsequenzen gefolgt sind. Letztendlich führen diese verschiedenartigen Veränderungen zu einer multikausalen Störung der zentralnervösen Schmerzverarbeitung. Der entstandene circulus viciosus führt zu einer Chronifizierung des FMS (Maixner, 2004). Therapieformen Für Patienten mit FMS wurden sowohl pharmakologische als auch nichtpharmakologische Behandlungsstrategien entwickelt. Eine Meta-Analyse (Rossy et al., 1999) von 49 FMS-Be- 17 handlungsstudien untersuchte die Effizienz von pharmakologischen im Vergleich zu nicht-pharmakologischen Therapieformen (kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie und Physiotherapie) hinsichtlich 4 Kriterien: physischer Status, subjektiv geschilderte FMS-Symptome, psychologischer Status und Funktionsfähigkeit in alltäglichen Belastungssituationen. Dabei fanden sich bei den kontrollierten Studien mit Antidepressiva, die Responderraten von 30-50% in einem Zeitraum von 4-9 Wochen aufwiesen, signifikante Verbesserungen hinsichtlich des körperlichen Zustandes und der subjektiv geschilderten FMS-Symptome. Alle Studien zur kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie, die Responderraten von mehr als 45% in einem Zeitraum von 6-18 Monaten zeigten, wiesen signifikante Verbesserungen in allen vier Kriterien auf, im Unterschied zur Physiotherapie (primär krankengymnastischen Übungen), die keine signifikanten Verbesserungen der Funktionsfähigkeit erreichte. Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie scheint daher bezüglich der Verbesserung der subjektiv geschilderten FMS-Symptome effektiver zu sein als pharmakologische Therapien. Ein ähnlicher Trend fand sich in Bezug auf die Funktionsfähigkeit. Auch hier zeigte sich die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie den pharmakologischen Therapieformen überlegen. Diese Meta-Analyse legt nahe, dass eine optimale Therapie für FMS den Schwerpunkt auf die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerztherapie legen sollte. Zusätzlich zur psychologischen Schmerztherapie sollte die medikamentöse Behandlung zur Beeinflussung der Schlafsymptomatik einbezogen werden (Rossy et al., 1999). In einer neueren Studie, die im ambulanten Setting die Effekte der 15 Sitzungen umfassenden operanten und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung gegen eine soziale Diskussionsgruppe, die kein strukturiertes Manual zur Grundlage www.zi-mannheim.de hatte, bei 120 FMS-Patienten verglich, konnten deutliche Veränderungen im Schmerz, in psychologischen und physiologischen Variablen beobachtet werden, die 12 Monate nach Therapie stabil blieben (Thieme, Flor, & Turk, 2006a) sowie erste Indikationskriterien für die operante und die kognitivverhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung gefunden werden. Effekte der Operanten- und kognitive-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie Die strukturierten psychologischen Schmerztherapieprogramme, wie kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung und operantverhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung wiesen 12 Monate nach Therapie signifikante Verbesserungen in der physischen Funktionalität, Schmerz, und emotionalen Verstimmung auf, im Vergleich zur sozialen Diskussionsgruppe. Die letztere zeigte signifikante Verschlechterungen in Folge der Behandlung. Obwohl keine statistisch signifikanten Unterschiede gefunden wurden, die die kognitivverhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung oder die operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung generell favorisierten, zeigten die Berechnungen für jede Gruppe über die Zeit, dass die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung keine Therapieeffekte in der physischen Funktionalität erreichen konnte, während die operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung weniger Effekte in der affektiven Verstimmung erzielte. Die Analyse der klinischen Signifikanz zeigte, dass die kognitivverhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung eine relativ größere Effektstärke in der Reduktion der affektiven Verstimmung und die operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung eine relativ größere Effektstärke in der Erhöhung der physischen Funktion aufwies. Eine deutliche Überlegenheit wurde für die aktiven psychologischen Interventionen im Vergleich zur sozialen Diskussionsgruppe gefunden. Tatsächlich erhöhten sich die Therapieeffekte über den Zeitraum der 6 und 12 Monatskatamnese und bemerkenswert war, dass die demonstrierten Effekte ohne ein strukturiertes Physiotherapieprogramm oder zusätzliche antidepressive Medikation erreicht wurden. Diese Ergebnisse haben be- ZI Aktuell 2/06 deutsame Auswirkungen auf die Physiotherapie und medikamentöse Therapie, die häufig als wichtige Methoden innerhalb des Behandlungsschemas bei FMS empfohlen werden (Burckhardt et al., 2005). Zukünftige Studien sollten direkt diese sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an die FMS-Therapie untersuchen und auch eine Responderanalyse durchführen, um zu prüfen, für welche Patienten welche Therapie optimal ist. Keine signifikanten Unterschiede zwischen lich Schmerz, kognitiven und affektiven Variablen gefunden. Positive Kognitionen wurden erfolgreich aufgebaut und die Patienten lernten, den Gebrauch von Krankheitsverarbeitungsstrategien zu verbessern und diese zu nutzen, um katastrophisierendes Denken abzubauen mit der Konsequenz der Reduktion der affektiven Verstimmung. Diese Ergebnisse sind mit früheren Forschungsergebnissen konsistent (Nielson et al., 1992; Turk et al., 1998). Die Resultate waren über 12 Monate Abbildung 2: Anzahl der Arztbesuche vor (T1), 6 Monate (T2) und 12 Monate nach (T4) operanter Schmerztherapie (OT), kognitiv-behavioraler Schmerztherapie (KVT) und sozialer Diskussionsgruppe (SDG) kognitiv-verhaltenstherapeutischer Schmerzbehandlung und operantverhaltenstherapeutischer Schmerzbehandlung wurden in den kognitiven Variablen beobachtet. Eine Erklärung, die plausibel erscheint, ist, dass bei Patienten, die mit operant-verhaltenstherapeutischer Schmerzbehandlung therapiert wurden, Veränderungen in der aktiven Verarbeitung und hinsichtlich des Katastrophisierens provoziert wurden, obwohl es nicht die eigentlichen Ziele der Therapie waren. Bereits Bandura (1977) hat darauf hingewiesen, dass Verhaltensveränderungen die Selbstwirksamkeitserwartungen am besten verändern. Offensichtlich, sind die veränderten Einstellungen des Patienten Schlüsselaspekte der Behandlung, ungeachtet dessen, ob diese direkt angezielt oder von der Beobachtung des eigenen Verhaltens stammen (Jensen et al., 1994). Signifikante Verbesserungen für die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung wurden bezüg- 18 stabil und klinisch signifikant. Trotz der Tatsache, dass die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung nicht direkt auf die Veränderung des Schmerzverhaltens ausgerichtet war, zeigen die Ergebnisse einen mittleren Behandlungseffekt auf das Schmerzverhalten (ES=0,57). Signifikante Veränderungen für die operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung wurden hinsichtlich Schmerz, physischen und Verhaltensvariablen gefunden. In Übereinstimmung mit früheren Studien (Nicassio et al., 1997; Thieme et al., 2003), wurde das gesunde Verhalten erfolgreich aufgebaut und das Schmerzverhalten abgebaut (siehe Abb.1). Die ambulante operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung erreichte größere Effektstärken hinsichtlich der Reduktion des zuwendenden Partnerverhaltens, die im Vergleich zur stationären operant-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung www.zi-mannheim.de (Thieme et al., 2003) mit 0,69 fast doppelt so groß waren (ES=1,13). Diese Beobachtung verlangt eine Replikation, insbesondere was die Rolle der Bezugsperson im Behandlungsprozess betrifft und auch die Auswirkungen der Behandlung im Alltag. Die operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung erreichte vor allem eine statistisch signifikante Reduktion hinsichtlich der Arztbesuche (50%), was im direkten Kontrast zur sozialen Diskussionsgruppe steht, die fast die doppelte Anzahl an Arztbesuchen aufwies (siehe Abb.2). Unterstützung ohne ein strukturiertes, modellgeleitetes Vorgehen von Nachteil sind. Zusammenfassend ist zu sagen, dass ein strukturiertes, modellgeleitetes Therapieprogramm unstrukturierten Gesprächen hinsichtlich psychologischen, schmerzbezogenen und physischen Effekten weit überlegen ist. Es ist anzunehmen, dass die weitere Aufklärung physiologischer Therapieeffekte nach psychologischer Schmerztherapie neue Erkenntnisse erbringen kann, die für die Pathogenese und Therapie des FibromyalgieSyndroms relevant sind. Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung erzielte jedoch nur eine geringe, statistisch nicht signifikante Reduktion der ärztlichen Konsultationen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung nicht nur klinische Vorteile, sondern auch signifikante Verbesserungen hinsichtlich der Nutzung des Gesundheitssystems, die kosteneinsparende Auswirkung haben dürften, erbringt. Peripherphysiologische Effekte der Therapie Um zu prüfen, ob die standardisierten Therapieformen im Vergleich zur sozialen Diskussionsgruppe eine Veränderung der für das FMS häufig beschriebenen reduzierten Muskelanspannung, wie nach isometrischen Spannungsübungen (z.B. Svebak et al., 1993; Vestergaard-Poulsen et al., 1995) oder nach Injektion von Kochsalzlösung in den antagonistischen Muskel (Graven-Nielsen et al., 1997; Sorenson et al., 1998), wurde ein psychophysiologisches Experiment, das mentalen Stress, wie Kopfrechnen und sozialen Stress, wie eine Partnerdiskussion, zur Erfassung der Stressreaktivität nutzten (Thieme & Turk, 2005; Thieme et al., 2006) - unmittelbar danach sowie 6 und 12 Monate nach Therapie durchgeführt. 12 Monate nach Therapie zeigten OVT-Patienten eine Steigerung der ursprünglich verminderten Muskelspannung, die jedoch nicht das Niveau der Gesunden erreichte. Die Erklärung für diese beiden Ergebnisse ist derzeit noch offen, da die Pathophysiologie des verminderten EMG bei FMS-Patienten noch nicht vollständig geklärt ist. MRT-Studien und Muskelbiopsien lassen Abnormitäten in den Muskeln der FMS-Patienten vermuten, die mit einer geringen Sauerstoffaufnahmekapazität, einer reduzierten Anzahl und veränderten Grösse der Mitochondrien einhergehen (Jubrias et al., 1994; Sprott et al. 2004). Die geringere Degradation von Acetylcholin (Neeck, 2000), die in die Produktion von Kortikosteroiden und Wachstumshormonen eingebunden ist (Crofford et al., 2004, Neeck, 2000) und ein bedeutsamer Regulator des Muskelaufbaus und der Muskelkraft (Sheffield-Moore & Urban, Unerwarteterweise zeigte die soziale Diskussionsgruppe signifikante Verschlechterungen während der Studie, verbunden mit einer Verschlechterung der Symptome in allen Messungen. Dies konnte die hohe Abbruchquote (50%) bei den Patienten der sozialen Diskussionsgruppe erklären. Unstrukturierte Diskussionen über Probleme, die für die Verarbeitung von chronischem Schmerz bedeutsam sind, führten eher zu erhöhtem Schmerz, geringerer physischer Funktion, höherer emotionaler Verstimmung und Schmerzverhalten (Thieme et al., 2006a). Dies könnte aufgrund einer Krankheitsorientiertheit und dem übermäßig zuwendendem Verhalten der Gruppenmitglieder verursacht sein, mit der Konsequenz der Verstärkung von Schmerz und Schmerzverhalten. Die Verschlechterung der sozialen Diskussionsgruppe war nicht auf den Prä-Post-Vergleich beschränkt, sondern persistierte über 12 Monate nach Ende der Behandlung. Die lang andauernde Verschlechterung der sozialen Diskussionsgruppe war unerwartet und bedarf einer Erklärung. Wenn es sich erneut bestätigen lässt, würden diese Ergebnisse zeigen, dass zumindest für einen Teil der Patienten soziale Diskussionen und mögliche informelle ZI Aktuell 2/06 19 2004) darstellt, lässt vermuten, dass die herabgesetzte Muskelaktivität des FMS nicht ausschließlich das Ergebnis von fehlender physischer Kondition zu sein scheint, sondern dass ultrastrukturelle Muskelveränderungen involviert zu sein scheinen (Jubrias et al., 1994; Sprott et al. 2004), die ein Unvermögen einer adaptiven Stress- und Entspannungsreaktion nach sich ziehen. Weitere Untersuchungen werden notwendig sein, die Interaktionen zwischen Muskel, dem Endokrinum, insbesondere dem ACTH als EMGPrädiktor (Neeck, 2000; Thieme, 2005) und zentralem Nervensystem zu untersuchen (Zidar et al., 1990). Der Therapieeffekt bzgl. der angewachsenen Muskelanspannung nach operanter Therapie könnte daher nicht direkt über die vermehrte physische Aktivität erklärt werden, sondern eher über die mit der vermehrten Aktivität einhergehenden Reduktion der ACTHProduktion (Bobbert et al., 2005; Thieme, 2005), die Konsequenzen für Muskelaufbau und Leistungsfähigkeit des Muskels haben könnte (SheffieldMoore & Urban, 2004). Indikationskriterien für die Schmerztherapie Um der Individualität des Patienten gerecht zu werden, bedarf es der Identifikation von therapiespezifischen Indikationskriterien. In der eigenen oben beschriebenen Therapiestudie (Thieme et al., 2006d) wurden die Responderraten für jede Therapiemethode ermittelt. Dabei wurden sowohl Responder mit klinisch signifikanter Verbesserung als auch mit klinisch signifikanter Verschlechterung, die sog. Negativ-Responder, ermittelt. Das Ziel bestand darin, die Responder im Vergleich mit Non-Respondern in ihren Werten, die sie vor der Therapie hatten, näher zu charakterisieren, um Hinweise auf Indikationskriterien zu erhalten. Die Prüfung der Responderrate ergab, dass 45% der mit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Schmerzbehandlung behandelten Patienten eine klinisch signifikante Reduktion der Schmerzintensität demonstrierten, die über 12 Monate nach Therapie aufrechterhalten werden konnte. Die Responderrate war vergleichbar mit der Studie von Turk et al. (1998). In Übereinstimmung mit früheren Stu- www.zi-mannheim.de dien (Turk et al., 1998, Thieme et al., 2003, Thieme et al., 2006c), berichten erfolgreich behandelte Patienten eine reduzierte Schmerzintensität, weniger affektive Verstimmung, ein höheres Niveau an aktiver Verarbeitung und weniger Katastrophisierung. Responder der operant-verhaltenstherapeutischen Intervention (54%) wiesen eine reduzierte physische Beeinträchtigung, eine geringere Anzahl von Arztbesuchen sowie ein reduziertes Schmerzverhalten auf. Diese Ergebnisse stimmen mit denen anderer Studien mit FMS-Patienten, die mit psychologisch-orientierten Verfahren behandelt wurden, überein (Nicassio et al., 1997; Nielson et al., 1992; Thieme et al., 2003). Die klinisch signifikante Reduktion der physischen Beeinträchtigung zeigte grössere Unterschiede bei den Patienten, die an der kognitiv- und an der operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung teilnahmen, verglichen mit den Patienten der sozialen Diskussionsgruppe. Im Unterschied zu 7,5% der Patienten der soziale Diskussionsgruppe, reduzierten 58% der Patienten, die mit operant-verhaltenstherapeutischer Schmerzbehandlung und 38% der Patienten, die mit kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung therapiert wurden, signifikant ihre physische Beeinträchtigung. Die klinisch signifikante Verschlechterung von 60% der Patienten der sozialen Diskussionsgruppe war mit extrem hohem Schmerzverhalten und hoher physischer Beeinträchtigung vor der Therapie verbunden. Das Schmerzverhalten und die physische Beeinträchtigung der NegativResponder der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung mit 6,9% und operant-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung mit 14,3% war nicht signifikant verschieden von den Negativ-Respondern der sozialen Diskussionsgruppe. Dabei zeigten die Responder der kognitiv-verhaltenstherapeutischen und operant-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung signifikant weniger Schmerzverhalten und physische Beeinträchtigung als die Negativ-Responder. Alle NegativResponder zeigten ein übermässig erhöhtes Schmerzverhalten and eine äußerst starke physische Beeinträchtigung vor Therapie. Dies bedeutet, ZI Aktuell 2/06 dass Patienten mit extremen Werten in physischer Beeinträchtigung und Schmerzverhalten sich nach psychologischer Schmerztherapie verschlechtern. Diese Ergebnisse könnten für die Prüfung der Ausschlusskriterien wichtig sein. Im Unterschied dazu dürften die Prädiktoren für Responder mit Verbesserungen relevante Einschlusskriterien sein, die in zukünftigen Studien getestet werden könnten. Grenzen der Studie Die große Anzahl von Therapieabbrüchen in der sozialen Diskussionsgruppe ist hinsichtlich der Effektstärkenberechnung problematisch, da so die Effektstärken in der operant- und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie überschätzt werden würden. Deshalb bezogen wir gemäss der intent-to-treat-method in die Berechnung der Effektstärken auch die Prä-Daten der Abbrecher mit ein. Die Effektstärken erwiesen sich noch immer als mittel- bis hoch, was für einen zuverlässigen und repräsentativen Effekt der verhaltenstherapeutischen Therapiemethoden spricht. Unterstützung findet dieses Ergebnis, wenn man die klinisch signifikanten Verbesserungen von Patienten der operant-verhaltenstherapeutischen und kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbehandlung betrachtet. Es ergibt sich hier eine mit 58% bzw. 38% klinisch bedeutsame Verbesserungen der physischen Funktionalität, die über das strenge Maß des „reliability of change index“ (Jacobson et al., 1984) ermittelt wurden. Trotz aller methodischen Einschränkungen unterstützen die Ergebnisse dieser Studie die Annahme, dass FMS-Patienten - auch hinsichtlich der Respondercharakteristika - keine homogene Gruppe sind (Turk et al., 1996a; Turk, 1990; Walen, Cronan, Kerbver, Goessl, & Oliver, 2003). Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Responder der beiden Therapiemethoden in jenen charakteristischen Variablen unterscheiden, die relevant für die jeweilige Behandlungsmethode zu sein scheinen. Zugleich weisen die Daten dieser Studie darauf hin, dass die Ergebnisse von Psychotherapie durch indikative Behandlungsgruppen in Abhängigkeit von den Patientencharakteristika, wie ursprünglich von Turk and Flor betont (1989), verbessert werden könnten. Eine Erklärung für 20 die Inkonsistenz der Ergebnisse der kognitiv- und der operant-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung, wie sie in der Literatur beschrieben wurde, ist, dass möglicherweise in unterschiedlichem Maße einige Patienten mit einer Therapiemethode behandelt wurden, die inkompatibel mit jenen individuellen Charakteristiken der Patienten war, die vor der Therapie vorhanden waren. Die fehlende indikative Zuweisung dürfte somit zu variablen Ergebnissen geführt haben. Einige Studien haben von den potentiellen Vorteilen von Therapiegruppen mit indikativer Zuweisung berichtet (Flor & Birbaumer, 1994; Thieme et al., 2003; Turk et al., 1998; Turk & Flor, 1989), aber nicht alle (Walen et al., 2003). Jedoch existiert im Unterschied zum chronischem Rückenschmerz (Flor & Birbaumer, 1994) derzeit keine Studie, die versucht hat, FMS-Patienten der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung und operant-verhaltenstherapeutischen Schmerzbehandlung in Abhängigkeit von ihrer Patientencharakteristika zuzuweisen, die prädiktiv für den Therapieerfolg zu sein scheint. Daher sind prospektive Studien notwendig, um ein besseres Verständnis des Potentials der indikativen Behandlungszuweisung für FMS-Patienten zu erlangen. Ausblick In einer aktuellen Multicenter-Studie wird der Einfluss von Cannabis auf das Schmerzgedächtnis bei Patienten, die eine 12-wöchige operante Schmerztherapie erhalten, mit subjektiv-psychologischen, endokrinen und genetischen Variablen, dem quantitativen sensorischen Testen und MRT, geprüft. In einer anderen Studie sollen FMS-Patienten mit indikativer Zuweisung zur operanten Schmerztherapie gegen Patienten mit zufälliger Zuweisung in ihren psychologischen, endokrinen, peripher- und zentral-physiologischen Veränderungen getestet werden. (Literatur bei den Autoren) Kati Thieme Martin Diers www.zi-mannheim.de „Aber Nachdenken hilft mir doch …!“ Warum Grübeln unserer Gesundheit schadet Neues aus der AG Verlaufs- und Interventionsforschung Die Arbeitsgruppe „Verlaufs- und In- terventionsforschung“ (Leitung Priv.Doz. Dr. Christine Kühner) wurde zum 01.01.2006 eingerichtet. Unsere Forschungsschwerpunkte liegen in der Untersuchung von Risikofaktoren der Entstehung und des Verlaufs depressiver Störungen, in der Entwicklung und Evaluation von Gruppenprogrammen zur Primär- und Rückfallprophylaxe, in Studien zur Lebensqualität bei Patienten mit psychischen Erkrankungen und in der Entwicklung psychodiagnostischer Verfahren. Darüber hinaus führen wir in Kooperation mit anderen Arbeitsgruppen am ZI Untersuchungen zur Neuroplastizität bei Depression (SFB 636), zur Depression bei körperlichen Erkrankungen und zu Verbreitung und Auswirkungen von Stalking in der Bevölkerung durch. Im Rahmen verschiedener Studien, u.a. von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, untersuchen wir den Einfluss selbstfokussierenden Grübelns (Rumination) auf den Verlauf depressiver bzw. dysphorischer Episoden bei depressiven Patienten und Gesunden. Der nachfolgende Beitrag beschreibt die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung, die im Rahmen dieses Forschungsschwerpunkts durchgeführt wurde. Begriffsdefinition Jeder Mensch kennt depressive Verstimmungen oder Gefühle der Niedergeschlagenheit. Manchmal treten solche Gefühle unbegründet auf, manchmal sind klare Auslöser vorhanden. Nach der Response Styles Theorie (Nolen-Hoeksema, 1991) zeichnen sich Menschen durch unterschiedliche Copingstile im Umgang mit depressiven Gefühlen aus, die als Rumination und Distraktion bezeichnet werden. Rumination als Sonderform selbstfokussierter Aufmerksamkeit beinhaltet das wiederholte und anhaltende Nachdenken oder Grübeln über die eigenen negativen Gefühle und über deren Ursachen und Konsequenzen. So grübelt eine Person beispielsweise darüber, weshalb sie im Vergleich zu anderen immer depressiv wird oder dass sie ZI Aktuell 2/06 ihre täglichen Aufgaben in diesem Zustand nicht bewältigen kann. Distraktion bezeichnet dagegen einen Coping-Stil, der durch gedankliche und verhaltensmäßige Ablenkung von der depressiven Stimmung gekennzeichnet ist. Ablenkende Gedanken beziehen sich beispielsweise darauf, etwas Schönes zu unternehmen oder zu überlegen, was an einer Situation positiv war. Ablenkende Verhaltensweisen umfassen zum Beispiel Sport treiben, Freunde treffen oder das Aufsuchen von Orten, an denen man sich gerne aufhält. Bisherige Ergebnisse Bisherige Forschung, die vor allem im englischsprachigen Raum durchgeführt wurde, konnte zeigen, dass Personen mit einem ausgeprägten ruminativen Copingstil längere Phasen dysphorischer Verstimmung aufwiesen als Personen mit einem eher distraktiven Copingstil. Befunde aus Hochrisikostudien weisen außerdem darauf hin, dass Personen mit hohen Werten auf Ruminationsskalen im weiteren Verlauf eher depressive Episoden entwickeln. Eine Studie unserer Arbeitsgruppe zeigte erstmals, dass eine ausgeprägte Ruminationstendenz – unabhängig von der ursprünglichen Depressionsschwere – sich bei behandlungsbedürftigen depressiven Patienten ungünstig auf den nachstationären Krankheitsverlauf auswirkte (Kuehner & Weber, 1999). Auch psychische und soziale Komponenten der Lebensqualität depressiver Patienten stehen mit der Ausprägung symptombezogener Copingstile im Zusammen- 21 hang (Kuehner & Buerger, 2005). Gegenüber den bislang zitierten Beobachtungsstudien haben experimentelle Arbeiten zur Response Styles Theorie den Anspruch, Kausalzusammenhänge zu untersuchen, indem sie die Wirkung von Rumination und Distraktion, im Experiment induziert, auf verschiedene abhängige Variablen wie Stimmung, Gedächtnis oder Problemlösen überprüfen. Rumination und Distraktion werden somit über zwei Zugänge erforscht. Zum einen werden sie als habituelle Copingstile, d.h. überdauernde Personenmerkmale, untersucht. Zum anderen werden die Effekte eher kurzfristig wirksamer experimenteller Induktion von Rumination und Distraktion untersucht. Aktuelle Studie Im Rahmen einer aktuellen Studie interessierten uns u.a. Zusammenhänge zwischen Rumination und Distraktion und basaler endokriner Stressaktivität. Als endokriner Stressmarker hat Corwww.zi-mannheim.de tisol eine entscheidende Bedeutung. Während ein dauerhaft erhöhtes oder erniedrigtes Cortisol-Tagesprofil eine Reaktion des Körpers auf chronische Belastungen darstellt, ist eine kurzfristige Erhöhung der Cortisolaktivität als Folge einer spontan auftretenden Anforderung an den Organismus zunächst nicht pathologisch, sondern adaptiv. So gewinnt z.B. die Cortisol-Aufwachreaktion (CAR, typischer Cortisolanstieg mit Peak bei 30-45 Minuten nach dem Aufwachen) als dynamischer Indikator der Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA) zunehmend an Bedeutung. Eine abgeschwächte CAR geht beispielsweise einher mit Burnout, Posttraumatischer Belastungsstörung oder depressiven Verstimmungen. In unserer Studie untersuchten wir folgende Aspekte: ► Auswirkung von induzierter Rumination und Distraktion auf negativen und positiven Affekt und autobiographisches Gedächtnis bei dysphorischen Probanden ► Einflüsse der habituellen Copingstile auf die Stimmungsveränderung durch Ruminations- bzw. Distraktionsinduktion ► Zusammenhänge zwischen der Aufwachreaktion des Stresshormons Cortisol (CAR) und Stimmungsveränderungen durch Ruminations- und Distraktionsinduktion ► Zusammenhänge zwischen CAR und habituellen Copingstilen. „Club der toten Dichter“, wobei die Probanden gebeten wurden, sich in die Situation des Hauptdarstellers hinein zu versetzen. Anschließend wurden die Probanden per Zufall den Induktionsbedingungen Rumination oder Distraktion zugewiesen. Die Induktion erfolgte über je 28 Karteikarten, die entweder ruminative (z.B. „Denken Sie an die Art und Weise, wie Sie sich innerlich fühlen“, „Denken Sie an die möglichen Folgen Ihrer momentanen psychischen Verfassung“) oder distraktive (z.B. „Denken Sie an Wolken, die sich am Himmel formen“, „Stellen Sie sich das Brandenburger Tor in Berlin vor“) Selbstaussagen enthielten, auf die sich die Probanden für acht Minuten konzentrieren sollten (Paradigma nach Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1993). Jeweils vor und nach der Stimmungsinduktion sowie nach der Ruminationsbzw. Distraktionsinduktion wurde die Stimmung mit der Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Krohne, Egloff, Kohlmann, & Tausch, 1996) erfasst. Mit Hilfe von je zehn positiven und negativen Adjektiven misst die PANAS die gegenwärtige Stimmung. Habituelle Copingstile wurden mit dem 23 Items umfassenden Response Style Questionnaire (RSQ; Buerger & Kuehner, 2006) erhoben, der sich in die Subskalen selbstbezogene Rumination, symptombezogene Rumination und Distraktion gliedert. Zur Erfassung des autobiographischen Gedächtnisses wurden die Probanden aufgefordert, sich für die Zeitdauer von fünf Minuten ben. Die Probanden gaben vier Proben ab: die erste sofort morgens nach dem Erwachen, aber vor dem Aufstehen, die zweite 30 Minuten nach dem Erwachen, die dritte acht und die vierte 14 Stunden nach dem Erwachen. Die Differenz zwischen zweiter und erster Probe kennzeichnet die Höhe der CAR. Ausgewählte Ergebnisse Stimmungsveränderung (PANAS) Nach dem zehnminütigen Filmausschnitt (negative Stimmungsinduktion) zeigte die Probandenstichprobe eine signifikante Erhöhung des negativen Affekts und eine signifikante Reduktion des positiven Affekts im Vergleich zum Ausgangsniveau. Die anschließende Induktion von Rumination bzw. Distraktion führte in der Ruminationsgruppe zu einer Beibehaltung der negativen Stimmung (gleich bleibender negativer und positiver Affekt), in der Distraktionsgruppe jedoch zu einer signifikanten Verbesserung der Stimmung (Abnahme des negativen Affekts, Zunahme des positiven Affekts). Die Veränderung der Stimmung ist in Abbildung 2 veranschaulicht. Bewertung der autobiographischen Gedächtnisinhalte Probanden der Ruminationsgruppe bewerteten ihre autobiographischen Erinnerungen signifikant negativer als die Probanden der Distraktionsgruppe. Hinsichtlich der positiven Bewertung zeigten sich keine signifikanten Unter- Abbildung 1: Studiendesign Methode 42 Studenten der Universität Mannheim (Durchschnittsalter 22,3 Jahre; 22 Frauen) nahmen an der Untersuchung teil. Bei allen Probanden wurde zunächst eine negative Stimmung induziert. Dies erfolgte mit Hilfe eines 10minütigen Ausschnitts aus dem Film ZI Aktuell 2/06 an spezifische Erfahrungen und Ereignisse aus ihrem Leben zu erinnern, diese aufzulisten und anschließend zu bewerten. Das Studiendesign ist in Abbildung 1 graphisch dargestellt. Das Speichel-Cortisol wurde an einem unabhängigen Tag (mindestens drei Tage Abstand zum Experiment) erho- 22 schiede (siehe Abbildung 3). Einflüsse der habituellen Copingstile auf die Stimmungsveränderung Es zeigte sich ein signifikanter Einfluss von habitueller selbstbezogener Rumination auf die durch Distraktion hervorgerufene Stimmungsveränderung. Probanden in der Distraktionsgruppe, www.zi-mannheim.de die höher ausgeprägte selbstbezogene Ruminations-Werte aufwiesen, erreichten eine geringere Verbesserung des positiven Affekts als Probanden mit niedrigeren selbstbezogenen Ru- phorischer Verstimmung, hingegen reagierten Personen nach Induktion von Distraktion mit einer Stimmungsverbesserung. Rumination führte außerdem zu einer negativeren Bewertung von auto- Abbildung 2: Stimmungsveränderung im Verlauf des Experiments minations-Werten. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Personen mit höherer selbstbezogener Grübelneigung schlechter auf die positiven Effekte einer Ablenkungsinduktion ansprechen. Zusammenhänge mit der CortisolAufwachreaktion (CAR) Wir fanden einen signifikanten Einfluss der CAR auf die durch Distraktion ausgelöste Stimmungsverbesserung. Dieser Einfluss war dadurch gekennzeichnet, dass Personen mit flachem Cortisol-Morgenanstieg weniger Stimmungsverbesserung durch die Distraktionsinduktion zeigten. Dieser Einfluss blieb auch signifikant, wenn mögliche Störvariablen wie Aufwachzeit, Wochentag, Alter, Geschlecht kontrolliert wurden. Darüber hinaus korrelierte die CAR signifikant negativ mit habitueller selbstbezogener Rumination, auch nach statistischer Kontrolle der aktuellen Depressionswerte (r = -.48). Probanden mit flachem Morgenanstieg des Cortisols wiesen demnach höhere Ausprägungen im selbstbezogenen Grübeln auf. Resumé Die experimentelle Induktion von Rumination oder Distraktion über die Manipulation der Aufmerksamkeitsfokussierung führte in einer gesunden Stichprobe zu signifikanten Unterschieden in der Stimmungsveränderung und in der Bewertung autobiographischer Erinnerungen. Nach Induktion von Rumination zeigten Personen eine Verlängerung von dys- ZI Aktuell 2/06 biographischen Erinnerungen. Darüber hinaus konnte unsere Studie zeigen, dass der positive Einfluss von Distraktion auf die Stimmung abgeschwächt wurde, wenn Personen hohe Werte auf einer Skala zur Messung habitueller selbstbezogener Rumination aufwiesen. Unsere Studie identifizierte darüber hi- tieren die Befunde dahingehend, dass ein niedriger Cortisolanstieg am Morgen (CAR) mit einer gesteigerten Neigung zu selbstbezogener aufgabenirrelevanter emotionaler Verarbeitung und einer verminderten Hemmbarkeit dieser Neigung durch Ablenkung assoziiert ist. Die vorliegende experimentelle Studie hat uns wertvolle Informationen gebracht. Es wurde deutlich, dass ruminative sowie distraktive Selbstaussagen und Gedanken unmittelbar die Stimmung und das autobiographische Gedächtnis beeinflussen, was therapeutische Relevanz besitzt. Auch konnten wir feststellen, dass in nichtklinischen Stichproben in erster Linie die selbstbezogene Rumination, also das Grübeln über Aspekte der eigenen Person, stimmungsrelevante negative Effekte hat. Aus unseren Ergebnissen zu den Cortisoldaten ergeben sich schließlich weitere Hinweise für eine adaptive Rolle der CAR, die einherzugehen scheint mit der Fähigkeit des Organismus, sich auf Umweltreize und äußere Anforderungen einzustellen. Gleichzeitig haben wir erstmals Zusammenhänge aufgezeigt zwischen Rumination als kognitivem Vulnerabilitätsmerkmal der Depression und einem biologischen Marker endokriner Stressaktivität. Abbildung 3: Negative und positive autobiographische Gedächtnisinhalte naus klare Zusammenhänge zwischen niedrigem Morgencortisolanstieg, habituellem selbstbezogenem Grübeln (Rumination) und verminderter Stimmungsverbesserung durch induzierte Ablenkung (Distraktion). Wir interpre- 23 (Literatur bei den Verfasserinnen) Silke Huffziger Susanne Holzhauer Christine Kühner www.zi-mannheim.de Absolventen der Gerontopsychiatrischen Weiterbildung verabschiedet Grußworte zur Zeugnisübergabe Liebe Gäste, Liebe Weiterbildungs-Teilnehmer, Frau Schrön und ich dürfen sie heute zu unserer feierlichen Zeugnisübergabe begrüßen und willkommen heißen. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, um die gerontopsychiatrische Fachweiterbildung in Kürze punktuell en Revue passieren zu lassen und den verdienten Erfolg zu feiern. Das Ausbildungsjahr war für alle Beteiligten mit großer Anstrengung verbunden und mit Sicherheit kein Spaziergang. Wir als Leiterinnen der Weiterbildung für Pflegepersonal haben zu dem bereits bestehenden zweijährigen Weiterbildungskurs mit dem Gerontofachkurs sozusagen ein zweites Kind bekommen. Es war ein Wunschkind einerseits und andererseits bedeutete es für uns eine zusätzliche Anstrengung und Herausforderung. Alles in allem war dies nicht nebenbei zu bewerkstelligen. Den Weiterbildungs-Teilnehmern wurde in kurzer Zeit sehr viel abverlangt: schriftliche Klausuren in Psychologie, Krankheitslehre, Psychiatrische Pflege, die Projektarbeit, eine Facharbeit und schließlich das Kolloquium. Vieles musste zusätzlich zur Arbeit und Schule geleistet werden. Für die beteiligten Einrichtungen war das Freistellen der Weiterbildungs-Kandidaten ein zusätzlicher Kraftakt, was sicherlich schwer zu kompensieren war. Die Gerontopsychiatrische Fach-Weiterbildung ist ein beruflicher und persönlicher Prozess. Die Prozessphasen könnte man folgendermaßen beschreiben: ► sich in die Ausbildung einlassen ► sich damit beruflich und persönlich auseinandersetzen ► Transfer des Gelernten in die Praxis schaffen ► den eigenen Stil suchen und finden ► die Realität bzw. das Machbare einschätzen ► Prioritäten setzen Für die Weiterbildungs-Teilnehmer war es keinesfalls einfach, das Gelernte umzusetzen, schließlich werden nicht immer offene Türen eingerannt - zumal sich für die Daheimgebliebenen die Welt nicht geändert hat. Zum Üben des Gelernten sind manchmal die zeitlichen und personellen Ressourcen nicht vorhanden. Trotz der keineswegs einfachen Situationen sind wir der Meinung, dass alle an der Ausbildung Beteiligten ihr Bestmögliches gegeben haben und wir alle vielleicht auch gerade deshalb ZI Aktuell 2/06 beruflich wie persönlich gelernt haben. Unser Anliegen ist es, den gerontopsychiatrischen Menschen nicht nur in seiner Bedürftigkeit zu sehen, sondern als Person mit seiner unverwechselbaren Lebensgeschichte. Die Kenntnis der Biografie ist ein wesentliches Element, um die Persönlichkeit, als auch das aktuelle Zustandsbild des alten und psychisch kranken Menschen zu begreifen bzw. erfassen zu können. Nur in der Biografie werden wir die persönlichen Ressourcen finden, die von besonderer Bedeutung sind. Diese persönlichen Ressourcen sind selten offenkundig, sondern wollen herausgearbeitet werden. Bei dem beispielsweise aggressiven Patienten bzw. Bewohner sind wir geneigt, nur auf die Aggression zu reagieren. Das Verhalten ist für uns nicht nachvollziehbar, wir fühlen uns hilflos. Das Wissen um die Biografie ist so etwas wie eine Landkarte, mit der wir uns in der Welt des alten, psychiatrisch kranken Menschen orientieren können. Ohne diese Orientierung geraten wir allzu schnell in eine Sackgasse, in der eine Verständigung aufgrund der verschiedenen Welten nicht mehr möglich scheint. Fachkenntnis bedeutet u.a., hinter das zunächst nicht nachvollziehbare Verhaltensmuster zu schauen, das individuelle Verständnis zu suchen und zu finden, so einen sinngebenden Zugang zum Patienten zu erreichen. Mit Hilfe dieser biografischen Ortskenntnis sollten wir in der Lage sein, den Patienten und Bewohner in seinen individuellen Bedürfnissen zu unterstützen, ihm mit unseren kreativen Möglichkeiten akzeptierend und wertschätzend zu begegnen. Durch eine fachlich fundierte Ausbildung und die Vermittlung eines Menschenbildes, welches den Menschen in seiner Einmaligkeit zeichnet, helfen wir die Zukunft des alten Menschen mitzugestalten und nicht zuletzt auch unsere eigene. Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Lust und das Interesse am Menschen und dem, was ihn in seiner Individualität ausmacht, nicht verlieren. Sie mögen wiederum vielen Menschen begegnen, die Ihnen die Anerkennung und Wertschätzung geben können, die Sie brauchen, um gute und sinnvolle Arbeit leisten zu können. Im Weiteren wünschen wir Ihnen besondere Achtsamkeit in der Balance Ihrer eigenen Kräfte. Hier beginnt auch Ihre Eigenverantwortung für sich selbst zu sorgen, um das eigene seelische Gleichgewicht zu suchen und zu finden. Auf Ihrem weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir Ihnen Kreativität, eine gesunde Frustrationsto- 24 leranz, gute Ideen, hilfreiche und wohlwollende Wegbegleiter. Weiterbildungskurs 2006 Schlussendlich gilt unser besonderer Dank den beteiligten Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und Stationsleitungen, die mit Rat und Tat sowie dienstplanmäßiger Organisation die Projektarbeit unterstützt haben. Dank der Klinikleitung und allen Personen im ZI, die uns bei unserer Arbeit unterstützt und es uns ermöglicht haben, unsere Ideen zu verwirklichen. Nicht zuletzt gilt ein besonderer Dank unseren Dozenten, die mit sehr viel Engagement den Unterricht gestaltet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Christl Wagner-Stramke Der nächste Kurs zur Qualifizierung in Gerontopsychiatrischer Pflege beginnt im Februar 2007. Informationen und Anmeldung bei der Weiterbildungsstätte unter: Telefon 0621/1703-1421 oder per E-Mail an: [email protected] Die staatliche anerkannte Weiterbildungsstätte für Krankenpflegepersonal am Zentralinstitut besteht seit 1963. Neben der Weiterbildung in Gerontopsychiatrischer Pflege bietet sie einen zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildungskurs für Psychiatrische Pflege an. Ärztlicher Leiter ist Prof. Dr. Harald Dreßing, Die pflegerischen Leiterinnen sind Christel Wagner-Stramke und Anita Schrön. www.zi-mannheim.de Das Burnout-Syndrom Unter Burnout-Syndrom versteht man: „Wenn die Lampe verlöscht....“ Es gibt keine einheitlichen Definitionen oder Theorien über das Burnout Syndrom. Deshalb möchte ich nachfolgend unterschiedliche Begriffserklärungen anbringen, die das Phänomen Burnout verdeutlichen sollen. Wie unterschiedlich die einzelnen Beschreibungen auch sein mögen, kennzeichnen alle Definitionen das Burnout-Syndrom mit dem Gefühl des Ausgebranntseins, das Fehlen des eigenen Antriebs und nicht mehr aufzuladende persönliche Akkus. Erforschung des Phänomens Der Begriff „Burnout“ wurde schon 1974 in Amerika von dem deutschstämmigen Psychoanalytiker Herbert J. Freudenberger geprägt. Freudenberger beobachtete damals, dass aufopferungsvolle, engagierte Mitarbeiter immer erschöpfter, reizbarer und starrköpfiger wurden. Andere Wissenschaftler untersuchten das Phänomen Burnout anfänglich vorrangig in helfenden, sozialen Berufen (Ärzte, Pflegekräfte). Später kamen andere Berufsgruppen hinzu, wie Führungskräfte und berufstätige Frauen. Burnout ist in vielen Berufsgruppen wiederzufinden, so auch zum Beispiel in Call-Centern. Personen, die auf sehr engen Raum zusammenarbeiten, gelten als besonders gefährdet. Hauptproblem bei der Erforschung des Burnout-Syndroms ist, dass alles, was mit Erschöpfung und Motivationsverlust zu tun hat, gleich mit diesem Schlagwort in Zusammenhang gebracht wird. Enzmann und Kleiber (1987) beschäftigen sich mit dem Burnout-Syndrom wissenschaftlich. In Deutschland machte sich Burisch (1989) mit verschiedenen Erklärungsansätzen zu diesem Thema einen Namen. Persönlichkeitsmerkmale und Umweltfaktoren Burnout-Betroffene gelten anfangs als sehr ehrgeizig, aktiv, ideenreich und leisten freiwillig übermäßig Mehrarbeit. Sie stellen gegebenenfalls irreale persönliche Erwartungen an sich und an ihre Umwelt, da sie sich vor negativen Konsequenzen, wie dem Verlust von Zuwendung, Unterstützung und Anerkennung, fürchten. Menschen mit großem Verantwortungsgefühl wie Führungskräfte, Selbstständige, Frauen und Männer, die zwischen Beruf und Familie stehen, sind besonders anfällig, ein Burnout-Syndrom zu entwickeln. Personen, die bis an das Ende ihrer persönlichen Kräfte und Kapazitäten arbeiten, da sie der Meinung sind, dass sich ohne sie kein Rad mehr dreht bzw. die Firmenwelt ohne die per- ZI Aktuell 2/06 sönliche Anwesenheit zu Grunde geht, lodern meist innerlich aus. Auch schlechte demotivierende Arbeitsumgebungen, wie unzureichende Unterstützung durch Führungskräfte, zu hohe Arbeitsbelastungen, Zeitmangel und -druck, schlechtes Betriebsklima sowie Intra- und InterRollenkonflikte können ihren Beitrag zur inneren Kündigung leisten. Gerade in pflegerischen Berufen ist die Spanne zwischen theoretischem Wissen und die Möglichkeit der praktischen Umsetzung erheblich. Die beiden Säulen klaffen wie eine Schere auseinander und deuten auf ein Ungleichgewicht, dass es durch die Pflegekräfte auszugleichen gilt. Auch diese Diskrepanz ist kräfteraubend und je nach Persönlichkeitsstruktur der Pflegekraft, Auslöser, um den Prozess des Burnout Syndrom in Gang zu setzen. “Der Mitarbeiter brennt häufig dann aus, wenn er fachlich am besten ist und somit den Kunden und der Firma den größten Nutzen bietet.” (aus A. Koch, S. Kühn: Ausgepowert? Gabel Verlag). Anzeichen eines Burnout-Syndroms Pines et al. (1989) nennen folgende drei Erkennungsmerkmale: 1. Körperliche Erschöpfung Energiemangel; chronische Ermüdung, das Bedürfnis, nur noch schlafen zu wollen; Schwäche; erhöhte Anfälligkeiten für Krankheiten, hohes Unfallrisiko; häufige Kopfschmerzen; Übelkeit; Verspannungen der Hals und Schultermuskulatur; Rückenschmerzen; Veränderungen der Essgewohnheiten und des Körpergewichts; verschiedene psychosomatische Leiden; Schlafstörungen; Missbrauch von Alkohol, Zigaretten, Barbiturate etc. 2. Emotionale Erschöpfung Gefühl von Überdruss, alles ist zu viel; Niedergeschlagenheit; depressive Verstimmung; Hilf- und Hoffnungslosigkeit; Gefühl der Ausweglosigkeit; manchmal unbeherrschtes Weinen; Gefühl von innerer Leere; vielfach besteht das Gefühl, die verbleibende emotionale Energie für die täglichen Verrichtungen des Lebens zu brauchen. Familie und Freunde bedeuten im Vergleich zu früher keine Kraftquellen mehr, sondern nur noch weitere Anforderungen. Man will lieber alleine sein bzw. in Ruhe gelassen werden, Reizbarkeit und Nervosität 3. Geistige Erschöpfung Negative Einstellungen zum Selbst und zur Arbeit: Arbeit wird z.B. nicht mehr als 25 ► einen chronischen Erschöpfungszustand mit Krankheitsgefühl, der über sechs Monate andauert - siehe www.omeda.de ► ein Krankheitsbild, das Personen aufgrund spezifischer Beanspruchung entwickeln können und das mit dem Gefühl verbunden ist, sich verausgabt zu haben, ausgelaugt und erschöpft zu sein (sich ausgebrannt fühlen). Es kommt zu einer Minderung des Wohlbefindens, der sozialen Funktionsfähigkeit sowie der Arbeits- und Leistungsfähigkeit - Brockhaus, 2006 ► ein Ausbrennen, das dem Verlöschen einer Lampe entspricht, wenn das Öl verbraucht ist - CDRom “Pflege heute”, 2. Auflage, Urban & Fischer ► Burnout, engl. = ausbrennen, Brennschluss, Zeitpunkt in dem das Triebwerk einer Rakete abgeschaltet wird und der antrieblose Flug beginnt - Brockhaus unter „Burnout/Raketentechnik“ befriedigend angesehen, man fühlt sich unzulänglich, minderwertig, den Aufgaben nicht mehr gewachsen. Negative Einstellungen anderen gegenüber: Angehörige helfender Berufe entwickeln z.B. dehumanisierende Einstellungen gegenüber den Menschen, denen sie helfen sollen. Einfühlung gelingt nicht mehr. Patienten werden nur noch als Träger von Problemen gesehen. Kontakte werden vermieden. Man begegnet Personen, mit denen man von Berufs wegen zu tun hat, mit Intoleranz und Zynismus. Negative Einstellungen gegenüber Kollegen, Freunden und Familienangehörigen: Es kommt z.B. ihnen gegenüber zu übertrieben und ungerechtfertigten Anforderungen. Burnout ist letzten Endes eine Folge von Langzeitstress. Nach Selys (in i Nitsch in 1981) ist Stress die physikalische Reaktion des Körpers auf eine Anforderungs- bzw. Bedrohungssituation. Jeder Mensch zeigt zeitweilig das eine oder andere Symptom aus den oben genannten drei Bereichen. Es sind normale Reaktionen des Körpers und der Psyche www.zi-mannheim.de auf belastende Lebenssituationen. Allerdings sollte bei Erholung und Entspannung die gewohnte Lebensgrundhaltung (Stimmung) wieder einkehren. Phasen des Burnout-Prozesses Das Phänomen Burnout tritt nicht schlagartig auf, sondern ist ein schleichender Prozess. Die Burnout-fördernden Lebensumstände wirken nicht ständig mit vollster Intensität auf eine Person. Durch längere Erholungsphasen wie Urlaub, erholt man sich davon. Je fortgeschrittener der Prozess ist, um so mehr Aufwand und Zeit benötigt man, um diesen wieder umzukehren. Die nachfolgenden verschiedenen Phasen des Burnout beschreiben Koch und Kühn in Anlehnung an Burisch (1989) folgendermaßen: Phase 1: Warnsymptome der Anfangphase Vermehrtes Engagement für Ziele: Gefühl der Unentbehrlichkeit; Gefühl, nie Zeit zu haben; Verleugnung eigener Bedürfnisse; Hyperaktivität; gleichzeitig Gefühle von Erschöpfung (Müdigkeit, Energiemangel, Unausgeschlafenheit) Phase 2: Reduziertes Engagement / Rückzug Unfähigkeit oder Widerwille zu geben, Verlust des Einfühlungsvermögens; Zynismus. Verlust positiver Einstellungen gegenüber den Menschen, denen meist der größte Teil der eigenen Arbeit gewidmet ist, Distanz bzw. Meiden von Kontakten; Gefühl der Ernüchterung. Negative Einstellung zur Arbeit, Widerwille; Überdruss; Arbeitspausen werden überzogen; Fehlzeiten, Verlagerung des Schwergewichts auf die Freizeit. Verlust von Idealismus, Konzentration auf eigene Ansprüche, Gefühl mangelnder Anerkennung, private Probleme nehmen zu (z.B. Probleme mit Kindern oder dem Partner). Phase 3: Emotionale Reaktionen / Schuldzuweisung Selbstmitleid, Humorlosigkeit; unbestimmte Angst; abrupte Stimmungsschwankungen, verringerte emotionale Belastbarkeit, Gefühl der Abstumpfung bzw. von innerer Leere, Apathie, Schuldgefühle, Schuldzuweisung bzw. Vorwurfe an andere, Reizbarkeit, häufige Konflikte mit anderen, Ärger, Intoleranz, Launenhaftigkeit, Negativismus. Phase 4: Abbau Geistige Leistungsfähigkeit: Konzentrations- und Leistungsschwäche, Ungenauigkeit, Desorganisation; Motivation: verringerte Initiative, Dienst nach Vorschrift; ZI Aktuell 2/06 Kreativität: verringerte Fantasie, Flexibilität; Wahrnehmung: undifferenziert, Schwarz-Weiß-Denken. Phase 5: Verflachung Emotionales Leben: Gleichgültigkeit. Soziales Leben: Beschäftigung mit sich selbst, Gespräche über eigene Arbeit werden vermieden, Privatkontakte werden vermieden, Einsamkeit. Geistiges Leben: Desinteresse, Langeweile, Hobbys werden aufgegeben. Phase 6: Psychosomatische Reaktionen Schlafstörung, Herzklopfen, Engegefühl in der Brust, Muskelverspannungen, Störungen des Immunsystems, Rückenund Kopfschmerzen, Übelkeit, Verdauungsstörungen, veränderte Essgewohnheiten, Missbrauch von Alkohol, Kaffee, Tabak, Drogen; Sexualprobleme. Phase 7: Verzweiflung Negative Einstellung zum Leben, Hoffnungslosigkeit, Gefühl der Sinnlosigkeit, existenzielle Verzweiflung, Selbstmordgedanken. Die Dauer und der Verlauf der Prozesse sind individuell verschieden. Eine Richtlinie besagt, dass schon nach einigen Monaten und spätestens nach drei Jahren ein Burnout ersichtlich wird. Messen lässt sich dies an der Fluktuationsrate in den jeweiligen Firmen. Häufig merken die Betroffenen nicht, wie sie in den Prozess eintauchen. Viele verbleiben in Phase 2 bis zur Rente. Dann spricht man von einem kompensierten Burnout. Die Betroffenen verbergen dann den inneren Ausstieg aus dem Beruf. Sie leisten Dienst nach Vorschrift und versuchen, ihr mangelndes Engagement unauffällig zu halten. Sie verstecken sich hinter eigenen Erkrankungen, Eheproblemen, pflegebedürftigen Angehörigen usw. Für das restliche Team besteht durch übermäßige Rücksichtnahme oder durch das Hinnehmen von Ausreden des Betroffenen die Gefahr, die Burnout Entwicklung zu fördern oder sich sozusagen “anzustecken”. Als Auswirkung verlieren weniger ausgebrannte Teammitglieder, die die Arbeit mitleisten bis sie selbst nicht mehr können, ihre Leistungsbereitschaft. Es ist nicht sehr effektiv bzw. ratsam, eine vom Burnout betroffene Person zu schützen und durch den Rest der Teammitglieder die fehlende Arbeitsleistung kompensieren zu wollen. Rücksichtnahme und Verständnis führen nicht zur Beendigung des Burnout-Prozesses. Die betroffene Person besteht eher darauf, dass ihre Leistungsschwä- 26 che von anderen ausgeglichen wird, versteckt sich hinter fadenscheinigen Ausreden und der Burnout Prozess setzt sich weiter fort. Das erzeugt bei den restlichen Teammitgliedern Wut und vor allem das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Von guter Teamarbeit kann dann keine Rede mehr sein. Ursachen 1. Verleugnung und Verdrängung von Stress und Überdrusssignalen Ein Alarmsignal und die erste Ursache sind ein auffälliger Energieverlust, den der Betroffene nicht zur Kenntnis nimmt. Nach Freudenberger (1992) ist Burnout ein Energieverschleiß, geprägt von Erschöpfung. Überforderung durch Arbeit, Freunde, Wertsysteme oder die Gesellschaft können einer Person Energie, Bewältigungsmechanismen und innere Kraft rauben. Menschen die ständig unter solchem permanenten Stress stehen, entwickeln einen ausgeprägten Verleugnungs- und Verdrängungsmechanismus, hinter denen bestimmte Einstellungen und Werte stehen. Als Reaktion auf die erkennbaren Symptome, strengen sie sich noch mehr an, verschließen die Augen vor der Realität und reagieren auf die Anzeichen wie auf Feinde, mit Abwehr. Die Botschaft des Körpers, der sich nach Ruhe sehnt, verleugnen sie, greifen evtl. zu Aufputschmitteln und rutschen immer tiefer in den Prozess. Das Verdrängen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse verursacht dann irgendwann, dass die Batterie leer ist. Warnsignale sind: erhöhte Reizbarkeit, Verdauungs- und Magenprobleme, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Herzklopfen, Herzstiche, Engegefühl in der Brust, innere Unruhe, Nervosität, Verspannung im Nacken- und Schulter-Rückenbereich, Gefühl der Überforderung, Unzufriedenheit, Wunsch auszuspannen, zu schlafen, nach Ruhe, Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit, Fehler häufen sich. Eine Orientierungshilfe, um Warnsignale zu erkennen, ist der Vergleich zu einer Zeit aus dem Leben, in der man das Gefühl hatte, sich körperlich und psychisch ausgeglichen und wohl gefühlt zu haben. 2. die Unfähigkeit, sich schwach zu zeigen und die Abhängigkeit vom Lob Anderer Die zweite Burnout Ursache ist die Unfähigkeit, sich schwach zu zeigen und das Gefühl vom Lob Anderer abhängig zu sein. Vorherrschend sind diese Ursachen in pflegenden Berufen bei Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern und Psychologen zu finden. Schmidbauer benannte diese Ursache 1977 mit dem „Helfersyndrom“. www.zi-mannheim.de Professionelle Helfer sind häufig nicht in der Lage eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. Nach außen sind sie allmächtig und unangreifbar. Helferpersönlichkeiten haben meist ein starkes Bedürfnis nach Lob und Anerkennung. Jede kleinste Kritik wird als stark kränkend empfunden. Sie sind stets freundlich, gehorsam und hungrig nach dankbaren Blicken und anerkennenden Worten ihrer Klienten. 3. Emotionale Schwerstarbeit Eine weitere Burnout Ursache ist die emotionale Schwerstarbeit. Auch hiervon sind besonders Berufsgruppen betroffen, die sich langfristig und intensiv mit dem Einsatz für andere Menschen beschäftigen. Das Resultat ständiger negativer emotionaler Belastung ist auch hier das Ausbrennen. Ein Merkmal ist, dass die Betroffenen keinen Bedarf mehr verspüren, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Für die Betroffenen ist es eine schmerzliche Erkenntnis, Menschen nicht mehr helfen zu können. 4. Die Störung eigener Motive und Ziele Diese Ursache tritt auf, wenn meine eigenen Ziele und Bedürfnisse hinten angestellt werden müssen, um die im Moment anstehenden Situationen zu realisieren. Anstrengungen werden immer verzweifelter und Kraftreserven schwinden. Misserfolge bedeuten Stress, da sie die Grenzen des persönlichen Einflussbereiches deutlich machen und Ärger, Trauer und Frust nach sich ziehen. Bei einer Arbeitsplatzanalyse in einem Krankenhaus wurde festgestellt (Thorwest 1993) 3 , dass im Schnitt täglich 27 3) Arbeitsunterbrechungen durch Telefonanrufe, kurzfristige Besprechungen, unangemeldeten Besuch usw. stattfinden. Das bedeutet cirka alle 21 Minuten eine Arbeitsunterbrechung, oftmals noch häufiger. Das stresst, macht nervös, spannt an und ist sehr frustrierend. Burnout Prädestinierte neigen laut Burisch (1989,S. 91 ) dazu: sich zu hochgesteckte Ziele zu setzen, unterschätzen den Aufwand und Zeitbedarf, übersehen Nebenwirkungen, überschätzen Erfolgsaussichten und setzen das eigene Anspruchsniveau zu hoch. 5. Organisationsstrukturen sorgen für Stress Hier stehen die Strukturierungen von Firmen bzw. Institutionen im Vordergrund. Die ungenaue Klärung von Rechten und Pflichten oder der Aufgabenverteilungen sowie der Rollen führen laut Cherniss zu Stress. Das Gefühl von der eigentlichen Machtlosigkeit über das Mitbestimmungsrecht in Firmen trägt außerdem dazu bei. Durch die Vielzahl der Erwartungen, nicht abgegrenzter Arbeitsver- ZI Aktuell 2/06 teilungen sowie der übermäßigen Anforderungen die an eine einzige Person gestellt werden, kommt es zur ständigen Überforderung und überhöhtem Arbeitseinsatz. Häufig fehlt es an Lob oder der Rückmeldung über die geleistete Arbeit. Cheriss bemerkt weiterhin, dass die Hierarchie und Machtstrukturen eines Unternehmen dazu beitragen, sich von der Arbeit zu entfernen, da sich der Einzelne ohne Einflusschancen sieht. Im pflegerischen Bereich kommt es häufig zu Rollenkonflikten, da an Pflegepersonen eine Vielzahl von Anforderungen gerichtet werden. Eine typische Erwartung von Patienten an Ärzte ist, einen “Halbgott in Weiß” zu symbolisieren, wie sie ihn von Fernsehserien kennen, geprägt von übermäßig viel Kompetenz und Allmächtigkeit. Eine weitere Anforderung an das gesamte Personal ist es, eine hohe Verantwortung für Patienten/ Bewohner zu tragen, bei gleichzeitigem Zeitmangel. Doch trotzdem immer noch so engagiert und selbstlos zu sein, wie Schwester Stefanie, aus der gleichnamigen Serie. Aber diesem Ideal hinterher zu jagen, ist wohl die pure Zeitverschwendung. Schwester Stefanie liegt zwar voll im Trend, jedoch ist sie auch klar im Vorteil. Ihre Dienstzeit beschränkt sich auf eine Stunde am Tag und dann hat sie noch sehr lange Sommerpause. in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind unterschiedliche Belastungsfelder vorzufinden. In Pflegeheimen trägt eine ausgebildete Fachkraft die Verantwortung für eine Vielzahl von Bewohnern. Sie muss häufig eigenständig adäquate Entscheidungen treffen, Situationen, Symptome richtig einschätzen können, ohne die Meinung einer weiteren Fachkraft oder eines Arztes hinzu ziehen zu können. Auch das Fehlen von ausgebildeten Personal gehört zur Ursache Organisationsstrukturen. Die Fluktuationsrate aus Pflegeberufen und das Entwickeln von Burnout Symptomen liegen durchschnittlich bei drei Jahren. Ein Faktor der nicht schön zu reden ist und die Ursachen dafür liegen nicht immer vorrangig in den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen der Pflegekräfte. Maßnahmen zur Prophylaxe In der Berufsrolle: ► Sich beobachten und Warnsignale erkennen und ernst nehmen ► Einstellungen, die zum Burnout führen, ändern ► Ursachen für Stress erkennen und abbauen ► Erkennen, was hinter der eigenen Fassade steckt ► Offene Wünsche und Gefühle aussprechen ► Schwächen zulassen 27 ► Es gibt keine falschen oder richtigen Gefühle ► Ich-Botschaften senden, von eigenen Erfahrungen reden, aus eigener Anonymität heraustreten ► Eigene realistische Maßstäbe setzen und deren Umsetzung verfolgen ► Energie gewinnen ► Schauen, wie andere es machen ► Den Blick für die richtigen Bewältigungsstrategien schärfen ► Supervision ► Stabilisierung der beruflichen Rolle ► Professionelle Haltung und diese auch einfordern In der Freizeit: ► Entwicklung von Strategien, um Berufsrolle loslassen zu können ► Balance durch individuelle Erholung finden ► Autogenes Training, Yoga, Progressives Muskeltraining ► körperlich entspannende Aktivitäten durchführen ► Gesunde Ernährung ► Hobbys pflegen ► Kontakte zu Freunden und Nachbarn erhalten Fazit Es gibt 1000 Gründe, um in der Berufsgruppe der Altenpflegerin ein BurnoutSyndrom zu entwickeln. Aber auch eben so viele um dies nicht zu tun. Burnout ist ein Thema, das mit sehr vielen negativen Gefühlen und Äußerungen belastet ist. Mir ist das eine oder andere Burnout-Symptom durch persönliche Erfahrungen bekannt. Jedoch ist es mir in zwölf Jahren gelungen, mir meine Freude an meinem Beruf Altenpflegerin nicht nehmen zu lassen. Trotz der teils schwierigen Arbeitsumstände in Alten- und Pflegeheimen konnte ich mir bis jetzt immer wieder meine Kraft und mein inneres Gleichgewicht und vor allem meine Zuwendung zu dem nicht immer einfachen Klientel bewahren. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Menschen in den Mittelpunkt meiner Arbeit stelle. Ich weiß, dass sie auf Hilfe angewiesen sind, aber nicht nur ausschließlich auf meine. Ich versuche zu beachten, dass Menschen so sind wie sie sind und nicht wie sie sein sollen. Menschen eben. Und dieses Recht behalte ich mir auch vor, indem ich nur das geben kann, was körperlich, geistig und emotional in mir ist. Vor allem ist es mir wichtig zu wissen, dass ich mich nicht für alle Situationen verantwortlich machen kann. Ich habe das Recht, auch nur ein Mensch zu sein. (Literatur bei der Verfasserin) Liane Kolbe www.zi-mannheim.de Autorinnen und Autoren Adam, Klaus, Dipl.-Sozialarbeiter E-Mail: [email protected] Ende, Gabriele, Priv.-Doz. Dr. rer. nat Kommissarische Leiterin der Abteilung Neuroimaging E-Mail: [email protected] Erk, Katrin, Dipl. Wirt.-Ing. Kaufmännische Direktorin, Mitglied des Vorstands E-Mail: [email protected] Diers, Martin, Dr. Dipl.-Psych. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie E-Mail: [email protected] Gass, Peter, Prof. Dr. med. Leiter der Arbeitsgruppe Verhaltensbiologie affektiver Erkrankungen E-Mail: [email protected] Holzhauer, Susanne, cand. Psych. Diplomandin der Arbeitsgruppe Verlaufs- und Interventionsforschung Klossika, Iris, Dipl. Psych. Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin E-Mail: [email protected] Kolbe, Liane Altenpflegerin, Absolventin der Fachweiterbildung Gerontopsychiatrische Pflege Kühner, Christine, Priv.-Doz. Dr. sc. hum. Leiterin der Arbeitsgruppe Verlaufs- und Interventionsforschung E-Mail: [email protected] Marina Martini, Dr. med., M.Sc. Leiterin des Referats Öffentlichkeitsarbeit, E-Mail: [email protected] Thieme, Kati, Priv.-Doz. Dr. phil. Dipl.-Psych. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie E-Mail: [email protected] Vollmayr, Barbara, Priv.-Doz. Dr. med. Co-Leiterin der Arbeitsgruppe Verhaltensbiologie affektiver Erkrankungen E-Mail: [email protected] Wagner-Stramke, Christl Fachkrankenschwester für Psychiatrie, Pflegerische Leiterin der Weiterbildungsstätte für Pflegepersonal E-Mail: [email protected] Zimmermann, Ulrich, Priv.-Doz. Dr. med. Leiter des Klinischen Suchtforschungslabors E-Mail: [email protected] Zink, Mathias, Priv.-Doz. Dr. med. Oberarzt der Tageklinik der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie E-Mail: [email protected] Impressum Herausgeber: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 68159 Mannheim, J 5 Redaktion: Dr. Marina Martini Layout und Entwurf: Mike Nowak, Referat Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0621/17 03-1301, -1302 Telefax: 06 21/17 03-1305 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.zi-mannheim.de Titelbild: Tagesklinik, L10,1 Nachdruck nur mit Genehmigung. Hinweis: Auch wenn in den folgenden Texten auf die weibliche Form bei der Benennung von Personen verzichtet wird, sind selbstverständlich immer Frauen und Männer gemeint. INFORMATION Huffziger, Silke, Dipl.-Psych. Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Verlaufs- und Interventionsforschung E-Mail: [email protected]