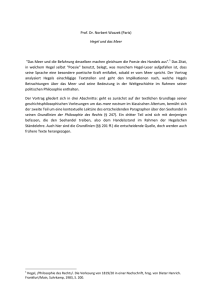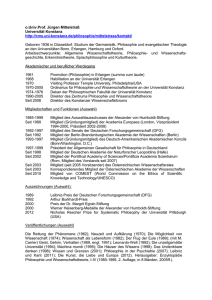In: Widerspruch Nr. 18 Restauration der Philosophie nach 1945
Werbung

In: Widerspruch Nr. 18 Restauration der Philosophie nach 1945
(1990), S. 126-133
Neuerscheinungen
Rezensionen
Besprechungen
Neuerscheinungen
Jacques Derrida
Husserls Weg in die Geschichte
am Leitfaden der Geometrie
München 1987 (Fink-Verlag), 233 S.,
geb, 48.-DM
Dieses Buch - besser gesagt seine
deutsche Audgabe - müßte so recht
nach dem Geschmack seines Verfassers sein. Denn eigentlich ist dieses
1962 im „Original“ als erstes Druckerzeugnis Derridas erschienene
Werk nur als Einleitung zu einem 30seitigen und von ihm selbst übersetzten Husserlaufsatz mit dem Titel
„Der Ursprung der Geometrie“ erschienen. Jedoch umfaßt diese „Einleitung“ 170 Seiten und besitzt natürlich auch noch eine eigene Einleitung,
was naheliegenderweise als Kennzeichen dafür zu sehen ist, wie erst hier
der später als Dekonstruktivist berühmtgewordene Philosoph seine Sache nahm. Daß ihn in diesem Ernst
seine deutschen Herausgeber 25 Jahre
später noch weit übertreffen, muß
darum bestimmt im Sinne des Verfas-
sers liegen. Denn nicht nur, daß in der
deutschen Ausgabe, bevor diese ganze Einleiterei beginnt, a) eine Bemerkung über die Verlagsreihe „Übergänge“, b) ein Vorwort zur deutschen
Ausgabe und c) eine Vorbemerkung
zur deutschen Übersetzung zu lesen
ist; nein, die Herausgeber haben - und
dafür möchte ich ihnen wirklich
Dank aussprechen - an perfekt plazierter Stelle, nämlich vor dem abschließenden
Personenregister,
selbstverständlich auch noch Husserls
Aufsatz „Der Ursprung der Geometrie“ veröffentlicht; natürlich folgerichtig als „Anhang“ betitelt und natürlich
noch folgerichtiger nicht als Rückübersetzung von Derridas Übersetzung, sondern im „Original“ (wobei
dieses „Original“ logischerweise nicht
der Erstveröffentlichung entspricht).
Es fragt sich nun: Ist dieser potenzierte Ernst bezüglich Derridas Erstlingsschrift angebracht? Muß man z.B. in
einem „Vorwort zur deutschen Ausgabe“ von einem „Vorleser“ darauf
hingewiesen werden, welche Vorteile
man als heutiger Leser dieses Werks
gegenüber einem früheren Leser hat?
Ich will diese Fragen offenlassen und
stattdessen jetzt meine überlange Einleitung beenden und mich endlich der
zentralen Frage, nämlich dem Inhalt,
widmen.
Inhaltlich nämlich beschäftigt sich
Derrida in akribischer Auseinandersetzung mit Husserls Geschichtsdenken, das der Begründer der Phänomenologie bekanntlich erst gegen
Ende seines Lebens überhaupt in
Angriff nahm. Dabei kann man nach
Derrida u.a. sehr genau erkennen, daß
Husserls Frage nach einem ursprünglichen Sinn darauf verweist, wie einem
zunächst belanglosem Faktum erst
nachträglich Bedeutung bzw. Bedeutungen zukommen, und dieser Prozeß der Interpretation nie endet. Damit ist man genau bei einem Punkt
angekommen, der tief in Derridas eigenes Konzept führt. So ist es auch
nicht verwunderlich, daß man hier
liest, wie der Ursprung als Differenz,
als Aufschub und analog zu Telekommunikation bzw. Postkartensendungen funktionierend anzusehen ist.
Auch äußert Derrida schon sehr deutlich Zweifel an einer univokativen
Sprachauffassung und einer Unterdrückung der Schrift zugunsten der
gesprochenen Sprache. Aber trotz
dieser Zweifel folgt er Husserl hier
noch darin, daß er das Konzept einer
Transzendentalphilosophie nicht verläßt.
Jedoch! Es dauert nicht mehr lange,
und er beschreibt insbesondere Husserls Transzendentalphilosophie als
„modernste, kritischste und scharfsichtigste Form der abendländischen
Metaphysik“
(1.“Positionen“Interview), die als solche den Schriftcharakter der Sprache unterdrückt,
bzw. in der so Logozentrismus und
Phonozentrismus praktiziert wird.
Denn 1967 ist es bekanntlich so weit,
daß er in einer geballten Ladung nicht
nur seine „Grammatologie“ und „Die
Schrift und die Differenz“ publiziert,
sondern mit „Die Stimme und das
Phänomen“ eine radikale Dekonstruktion von Husserls Phänomenologie vornimmt.
Das bedeutet hinsichtlich der hier
vorgestellten Erstlingsschrift: da für
diese spätere Dekonstruktion in einer
Nachinterpretation des „ursprünglichen Sinns“ dieser bestimmt nicht belanglosen Einleitung viele Gründe zu
entnehmen sind: und da jeder Leser
dazu im Anhang noch Husserls „Der
Ursprung der Geometrie“ bzw. ein
Beispiel für die „modernste, kritischste und scharfsichtigste Form der Metaphysik“ lesen kann, ist dieses so
ernst aufgemachte Buch auch für
Leute interessant, die sich mit „Einleitungen“ nicht begnügen.
Georg Kastenbauer
Paul Ricoeur
Zeit und Erzählung, Bd.1: Zeit
und historische
Neuerscheinungen
Erzählung, München 1988, 357 S.,
geb., 88.- DM; Bd.2: Zeit und literarische Erzählung, München 1989
(Fink-Verlag), 282 S., geb., 80.- DM.
Seit 1983 unterhält der Münchner
Fink-Verlag die Reihe „Übergänge“,
in der bislang ca. 20 Bände erschienen
sind und die
sich vom Anspruch der Herausgeber
Grathoff und Waldenfels her in einem Zwischenbereich bewegt, „in
dem philosophische Überlegung und
sozialwissenschaftliche
Forschung
aufeinanderstoßen und sich verschränken“. Durch die Aufnahme
und Fortführung der phänomenologischen Lebenswelt-Studien sollen vor
allem die hierzulande eher vernachläßigte französische Phänomenologie
(veröffentlicht wurden Werke von
Merleau-Ponty und dem frühen Derrida) sowie ältere deutsche Arbeiten
aus der Zeit vor 1933 zugänglich gemacht werden.
Darunter ist auch das 1986 erschienene Buch von Paul Ricoeur „Die lebendige Metapher“ (frz. 1975), in
dem er im Ausgang von Aristoteles
und unter Berücksichtigung der modernen Linguistik und Semiotik eine
philosophische Theorie der Metapher
vorstellt, die deren semantisches Innovationspotential hervorhebt und
die Referenzfunktion der Metapher
neu formuliert. In engem konzeptionellen Zusammenhang damit steht
das dreibändige Werk „Zeit und Erzählung“ (frz., 1983-85), von dem
bisher zwei Bände in deutscher Übersetzung vorliegen. Erzeugt die Meta-
pher durch eine „impertinente“ Prädikation eine neue semantische Pertinenz, so begreift Ricoeur die
Komposition der erzählerischen Fabel als eine „Synthesis des Heterogenen“, durch die „Ziele, Ursachen und
Zufälle zur zeitlichen Einheit einer
vollständigen und
umfassenden Handlung versammelt“
werden (Bd.1, 7). In beiden Fällen
kommt Neues, noch Ungesagtes, Unerhörtes zur Sprache.
In seiner Untersuchung inszeniert der
Autor einen Dialog zwischen verschiedenen Ansätzen zu einer Phänomenologie der Zeitlichkeit (Augustinus, Husserl, Heidegger) und einschlägigen Theorien des historischen
und fiktionalen Erzählens. Seine
Grundthese, die er zunächst anhand
des 11.Buchs von Augustins „Confessiones“ expliziert, lautet: Jede Phänomenologie der Zeit führt unweigerlich zu Aporien, die zwar theoretisch
nicht mehr zu bewältigen sind, jedoch
in der Erzählung darstellerisch aufgelöst werden können. Die so entstehende „Dialektik zwischen einer Aporetik und einer Poetik der Zeitlichkeit“ (Bd.1, 114) führt Ricoeur vom
„Phänomenologen“ Augustinus zum
„Erzähltheoretiker“ Aristoteles und
dessen „Poetik“. Wie vor ihm bereits
Luk cs, der in seiner späten Ästhetik
zentrale Kategorien von Aristoteles'
Tragödientheorie auf den gesamten
Bereich der Dichtung ausdehnte,
nimmt auch Ricoeur die aristotelische
Bestimmung des dramatischen „mythos“ als „mimesis praxeos“ in seine
Definition der Erzählung als „disso-
nante Konsonanz“ (concordance discordante) auf und macht damit - ähnlich wie die strukturale Erzähltheorie das Drama zu einem Spezialfall der
Erzählung. So trifft ein Aristoteliker
den anderen!
Die „mimesis praxeos“ wird vom Autor zu drei mimetischen Funktionen
ausdifferenziert: die erzählerische
Konfiguration
der Handlungen in der Zeit (mimesis
II) bezieht sich auf ein Vorverständnis (Präfiguration) von der (zeitlichen)
Ordnung einer Handlung (mimesis I)
und bewirkt deren Umgestaltung
(Refiguration) in der menschlichen
Erfahrung (mimesis III). Dabei fungiert die Konfiguration der mimesis II
(der aristotelische „mythos“) als Vermittlung zwischen mimesis I und III,
die beide dem Bereich der „praxis“
angehören. Die Leistung des
„mythos“ besteht darin, die individuellen Ereignisse der Handlungsordnung, die ihm als paradigmatisches
Erzählreservoir
dienen, zum Ganzen einer syntagmatischen Geschichte zu synthetisieren.
Den zweiten Teil des ersten Bandes
und den gesamten zweiten Band seiner Arbeit nutzt der Autor zu einer
kritischen Diskussion theoretischer
Ansätze zum Verhältnis von Zeit und
Erzählung in der Historik und der literaturwissenschaftlichen Narrativik.
In beiden Disziplinen gab (und gibt)
es Versuche von seiten analytischer
Philosophen wie Hempel und Frankel, des französischen Strukturalismus, aber auch der französischen
„Annales“-Schule um Braudel und
Bloch, Modelle zu entwickeln, die die
Zeit als „Tiefenkategorie“ eliminieren
und
sie
einer
abgeleiteten
„Oberflächenstruktur“
der
historischen und fiktionalen Darstellung zuzuweisen. In Opposition dazu
gelingt es Ricoeur nachzuweisen, daß
das
narrative
Verstehen
ein
fundamental zeitliches ist und von
jeder rein logischen Erzählgrammatik
immer schon vorausgesetzt wird. So
ergibt sich als grundlegendes
Verhältnis von Zeit und Erzählung,
„daß die Zeit in dem Maße zur
menschlichen wird, in dem sie sich
nach einem Modus des Narrativen
gestaltet, und daß die Erzählung ihren
vollen Sinn erlangt, wenn sie eine
Bedingung der zeitlichen Existenz
wird“ (Bd.1, 87). Allerdings muß Ricoeur der Geschichtswissenschaft
konzedieren, daß in ihrem Feld ein
„epistemologischer Einschnitt“ stattgefunden hat, der die historische Erklärung, die mit gesetzesförmigen
Verallgemeinerungen ausgerüstet ist,
vom bloßen narrativen Verstehen
entfernt. In der historischen Intentionalität bleibt jedoch der Zusammenhang von historischem Erklären und
narrativem Verstehen erhalten; Ricoeur spricht hier von Quasi-Fabel,
Quasi-Figuren und Quasi-Ereignis.
Was in den ersten beiden Bänden in
Klammern gesetzt wurde, soll im abschließenden dritten Band unter dem
Titel „Die erzählte Zeit“ thematisiert
werden: die Referenzfunktion von literarischer und historischer Erzählung. Im Übergang von der mimesis
II zur mimesis III, d.h. im Rezepti-
Neuerscheinungen
onsprozeß, wird die Wahrheitsfrage
bei beiden Erzählgattungen aktualisiert. Denn nicht nur die Geschichtserzählung hat für Ricoeur einen Anspruch als „wahre Erzählung“, sondern auch die Fiktionserzählung
bringt im Übergang von der Welt des
Werks zur Lebenswelt des Rezipienten eine „metaphorische Referenz“
ins Spiel. Damit bildet sich die zentrale These des dritten Bandes und des
gesamten Werkes heraus: die Annahme einer „überkreuzten Referenz“
zwischen Geschichtsschreibung und
Fiktionserzählung in der Zeitlichkeit
der menschlichen Handlung. Doch
die Diskussion dieser These sei auf
das Erscheinen der deutschen Ausgabe des dritten Bandes verschoben.
Günter Butzer
Ram Adhar Mall / Heinz Hülsmann
Die drei Geburtsorte der Philosophie - China, Indien, Europa
Bonn 1989 (Bouvier-Verlag), 230 S.,
geb., 38.Die Arbeit setzt sich vornehmlich mit
dem Topos auseinander, „der
Ursprungsort der Philosophie sei
Griechenland, genauer Athen“ (11).
Sie richtet sich gegen eine Philosophiegeschichtsschreibung oder eine
hermeneutische Sicht, die zu einer eurozentrischen Darstellung von Kulturgeschichte neigt, bzw. gegen hermeneutische Engführungen überhaupt (vgl. die Gadamer-Kritik im
Kapitel „Hermeneutik und Weltphilosophie“, 84ff). Aber es ist nicht bloß
die Erweiterung einer Geographie der
'Anfänge von Philosophie' vorgesehen, die ja bereits seit Herders „Ideen
zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit“ eine Tradition hat. Interessanter ist die Frage des Standortes,
von dem etwa eine vergleichende Historie ausgehen könnte. Letztere bliebe
eher apologetisch (in China und Indien gab es 'auch Philosophie'), solange nicht ein leitendes Philosophieverständnis selber entregionalisierte Züge
aufweisen könnte. Die beiden Verfasser, der eine Asiate, der andere Europäer, wenden sich gegen einen „eineindeutigen Philosophiebegriff“ und
heben hervor, so „ein Skandalon“ zu
liefern (10). Mit der Absage an hermeneutische Festlegungen erhält der
Anspruch ein starkes Gewicht, daß
die Darstellung von 'Philosophien'
nicht ausschließend einem der verglichenen Teile den Maßstab entnimmt.
So soll ein dem Verglichenen eigenes
'Philosophisches' den Vergleich leiten
und in ihm zum Ausdruck kommen.
Welche Darstellungsmittel sollen einen solchen methodischen Zirkel gewährleisten, begründbar und nachvollziehbar machen? Und wie ist das
Philosophieverständnis der Verfasser
in seiner hervorgehobenen Unbestimmtheit selbst näher bestimmbar?
Die methodischen Leitvorstellungen
sind die einer „offenen Hermeneutik“
und eines „metonymischen Austauschs“ in einer „technologisch formierten“ (Welt-)Gesellschaft (vgl. den
ersten, grundlegenden Teil). Mit einer
offenen ('analogischen') Hermeneutik
sollen die jeweiligen Verstehensvoraussetzungen und die hermeneutischen Zirkel dadurch nicht verallgemeinert werden, daß sie - in Anlehnung
an
Jaspers
als
„Überlappungen“ in der Artikulation
ein und desselben, einer „philosophia
perennis“, gewichtet werden (79). Die
Verwendung von Theorie-Sprache
wird als „metonymisch“ aufgefaßt, als
„Ereignis eines Symboltransfers, der
die sprachliche Immanenz zerbricht“,
als „Austausch von Namen“ in 'unabgeschlossenen Benennungen' (121).
Dem Wort 'Philosophie' ist - metonymisch verwendet - ein terminologischer Status abgesprochen: 'Name
statt Begriff'. Es ist dies als Leseanweisung für den zweiten Teil des Buches zu verstehen, in dem es um Philosophie in China, Indien und Europa
geht. Der Prozeß der Darstellung und
eine Sozialität des Austauschens stehen im Vordergrund (vgl. das Vorwort). Damit sei der modale Sinn des
Buches hervorgehoben und das Plädoyer in ihm, das an Schelers Auffassung vom „Weltalter“ angelehnt ist
(bes. 98ff).
Die Vorstellung eines an Sprachgrenzen nur andeutbaren 'Philosophischen', des 'einen Wahren in den verschiedenen Gewändern', bleibt ein
metaphysisches 'Anraten', das nicht
ohne Beliebigkeit ist, denn die
Sprachmetaphysik der Verfasser
selbst erfährt keine Begründung. Der
Leser hat so die Schwierigkeit, Darstellungsanspruch und Darstellungsweise aufeinander zu beziehen. Her-
meneutische Engführungen und
Zentrismen, die der Text mit seiner
Terminologie, seiner Diktion der europäischen Tradition, aufweist, sollen
zu dem gehören, was im Text und mit
Hilfe des Textes verlassen werde.
„Philosophie“ sei „der Versuch, den
Mythos durch den Logos zu ersetzen“ (60), schreiben die Verfasser.
Die europäische Philosophie wird
vom Mythos her verstanden (235ff),
und ein Mythos/Logos-Verhältnis in
seiner Dialektik gibt den Leitfaden
der Historie ab. Das ist auch der Fall
in den Kapiteln über China (141ff)
und Indien (191ff). Vom MetonymieKonzept her kann der Leitfaden der
Darstellung - ein Leitfaden der europäischen Tradition - als Angebot verstanden werden, in einen austauschenden Diskurs zu gelangen. Jedoch sind dadurch nicht die
Konnotationen der verwendeten
Ausdrücke (auch eine Prädikation
von 'Philosophie' gehört dazu) aus der
Sprache des Vergleichs, nicht aus der
Vorstellungswelt der Leser. Auch 'das
Metonymische', die Übertragung aus
der klassischen Rhetorik, sollte ja
konsequenterweise metonymisch gelesen werden, so daß der Leser sich
semantisch auf eine Metametaebene
des Textes verwiesen sieht. Und gerade die ist der Darstellung nicht ansehbar und entnehmbar. Die Grenzen und die unvermeidbaren Engführungen der Sprache der Darstellung
müssen erwähnt werden angesichts
der Vorstellung, ein allgemein 'Philosophisches' („philosophia perennis“)
leite den Austausch und sei ihm zu
entnehmen. Es gerät aus dem Blick,
Neuerscheinungen
daß es keinen Vergleich gibt außerhalb der Sprache, in der er geführt
wird, auch wenn er nicht nur innerhalb seiner Sprache stattfindet.
Letztlich wird einem mehr und mehr
technologisch bestimmten Diskurs in
einer kulturell übergreifend durch
moderne Technologien geprägten
Weltgesellschaft die Überwindung
hermeneutischer Engführungen zugetraut. Ein systemisches Analogiedenken in kybernetischer Diktion
(vor allem im Kapitel „Algorithmus
und Anamnesis“, 267ff) soll Historie
zur strukturalen Selbstabbildung der
Menschheit werden lassen, zu einer
Autopoiesis („Das Prinzip der Autopoiesis reicht von Aristoteles bis E.
Jantsch“, 271). In welcher Sprache?
In der einer Schriftkultur? Leider
kann hier nicht eine Auseinandersetzung mit dem Ansatz des Schlußteils
der Arbeit geführt werden. Sie hätte
der Frage nachzugehen, wie die Verfasser unter anderem systemtheoretische Entwürfe und KI-Forschung
einarbeiten und zum Gegenstand ihrer Betrachtungen machen. Nur eines
sei hervorgehoben: „Die technologische Formation“ sei „die wirklich gewordene Philosophie“ (273). Welche
Philosophie? Eine systemische Sichtweise könnte - hier etwa in der Frage
nach Dominanz und Austausch im
Verhältnis verschiedener Kulturkreise
- Herrschaftsbegriffe durch Funktionsbegriffe ersetzen. Die Gegenstände sind dann aber auch noch Phänomene wie Technologieexporte, Exporte von Rüstungstechnologien und
-gütern und die Währungspolitik.
Diese wiederum sind Teile einer
„technologischen Formierung“. Die
Frage, was die Verfasser unter „der
wirklich gewordenen Philosophie“
verstehen, hat zwei Seiten. Einmal
geht es um eine Arbeit, in der die
Auseinandersetzung mit Eurozentrismen in der Kulturgeschichtsschreibung im Vordergrund steht. Zum anderen wird dasjenige, von dessen
Verwirklichung die Rede ist, nicht bestimmt. Oder läßt der Metonymiegedanke zu, den Satz als Affirmation
und als Polemik zu lesen, als Anstoß
sozusagen, 'der Philosophie ins wahre
Gesicht zu schauen'? Wie auch immer
müßte dem 'Namen Philosophie' ein
Sinn zugesprochen werden.
Ignaz Knips
F.W.J.Schelling
Einleitung in die Philosophie
(Hrsg. Walther E. Ehrhardt), Stuttgart-Bad Cannstatt 1989 (FrommannHolzboog), geb., 153 S., 84.Das Buch, der erste Band einer Reihe
zur Schelling-Forschung, enthält die
Nachschrift bislang unveröffentlichter
Vorlesungen, die Schelling 1830 vor
einem ausgewählten Zuhörerkreis in
München gehalten hat. Diese Vorlesungen haben zeitgeschichtliche Bedeutung, weil Schelling sich zu der
Zeit offenbar gezwungen sah, nach
Jahren der Konzentration auf die Mythologien und die dunklen Spekulationen seiner „Weltalter“-Philosophie
wieder zu einer rationellen Grundlegung seines eigenen philosophischen
Standpunkts zurückzukehren. Diese
Rückkehr dürfte umso dringlicher
gewesen sein, als Hegel in Berlin zu
dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner
Wirksamkeit stand, die auch in München ihre Spuren hinterließ. Viele seiner Ausführungen werden daher auf
dem Hintergrund dieses spannungsreichen Verhältnisses Schelling-Hegel
zu lesen sein.
Schellings „Einleitung in die Philosophie“ ist die Einleitung in seine Philosophie, die er als Resultat der neuzeitlichen philosophischen Bemühungen
darzustellen unternimmt. Er wählt
den Einstieg mit der bekannten Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie, die auch im folgenden den Leitfaden bildet. Während
die negative Philosophie die Welt als
ein in sich notwendiges System darstelle, begreife die positive die Welt
als ein frei geschaffenes, ein gewolltes
System. Freiheit und Notwendigkeit
sind für Schelling demnach die
zentralen Begriffe.
Daß dieses Gegensatzpaar nicht willkürlich gewählt ist, wird an den beiden großen Systemen der Neuzeit,
dem System Spinozas und dem Fichtes, verdeutlicht: Spinoza habe die
Welt als einen strikt kausalen Zusammenhang begriffen und die Philosophie demnach als mathematischnotwendiges Denken; Fichte hingegen habe die Welt als ein System der
durch das freie Ich als Prinzip gesetzten Bestimmungen verstanden. Bei-
des reicht Schelling nicht hin: Spinozas Kausalität bleibt blind und unbegreiflich, Fichtes freies Setzen verliert
sich schließlich in Willkürlichkeiten.
Schelling sieht nun die Leistung seines
frühen Identitätssystems darin, die
beiden Prinzipien, die Welt als Objekt
und als Subjekt, im Begriff des Subjekt-Objekt vereinigt zu haben. Die
Welt sei als Einheit von Realem und
Idealem ein dynamischer - heute
würden wir sagen: sich selbstorganisierender - Prozeß, dessen eines Extrem das bloß Materielle, dessen anderes das rein Geistig-Ideelle ist.
Hegel nun - und diese Kritik dürfte
einen ganz wesentlichen Aspekt der
„Einleitung“ ausmachen - habe an
dieses Identitätssystem angeknüpft und es gründlich mißverstanden. Er
habe den Grundgedanken der Welt
als Prozeß aufgenommen, ihn aber
aus einem realen in einen bloß logisch-dialektischen umgewandelt. Hegel beginne seine Philosophie „voraussetzungslos“, spule dialektisch aus
reinem Denken das System seiner
Logik und komme an deren Ende dazu, - man weiß weder wie noch warum - daß das Logische ins NichtLogische, in die Natur „abfalle“; dies
sei „Mystizismus“. Als Ursache des
vermeintlichen Irrtums von Hegel,
den realen in einen logischen verwandelt zu haben, nennt Schelling nicht
ohne billige Polemik, Hegel habe damals auf den Rat einiger Freunde hin
angefangen, „ein nicht zu ausgedehntes Fach“, die Logik, zu lesen (61).
Neuerscheinungen
Schelling geht nun auf das ein, worauf
die Philosophie sich zu konzentrieren
habe. Auch dann, wenn man die Welt
nicht als einen bloß logischen, sondern realen Prozeß begreift, bleibe
man im 'Reich der Notwendigkeit',
und damit in einer bloß negativen
Philosophie, stecken. Die Philosophie
müsse letztlich - und hier greift er implizit auf seine „Freiheitsschrift“ zurück - die Welt als freie Schöpfung
erweisen, sodaß Freiheit das Urprinzip der Welt ist. Dies aber bringt es
mit sich, das Verhältnis von Freiheit
und Notwendigkeit erneut zu erörtern, wenn man nicht einem heillosen
Mystizismus verfallen oder im trockenen Rationalismus steckenbleiben
will.
Schelling skizziert hier das, was er
später ausführlicher darstellen wird: es
bedürfe neben den drei schon angeführten Prinzipien des Subjekts, des
Objekts und des Subjekt-Objekts
noch eines „Vierten“, durch das die
Welt nicht nur als rationales System
gedacht wird, sondern durch das sie
tatsächlich ist. Dieses Prinzip ist für
sich nichts anderes als reine Aktualität, freie Ursache - Gott. Die Aufgabe, die sich der 'wahren' positiven
Philosophie stelle, sei, dieses Verhältnis von Gott und Welt nicht nur als
ein bloß logisches, sondern als ein tatsächliches und damit als ein geschichtliches Handeln darzustellen.
Schellings Schüler, der spätere König
Max II. von Bayern, nannte diese
Vorlesungen die „Basis“ von Schellings gesamter Philosophie. Und in
der Tat formulieren sie gerafft - aber
an vielen Stellen auch schwer nachvollziehbar - das Programm seiner
Spätphilosophie. Auch wenn die sich
aufdrängende Frage allzu berechtigt
bleibt, was mit dieser Art des Denkens zwischen Theologie, Natur- und
Freiheitsphilosophie heute 'anzufangen' ist, so erlaubt die Veröffentlichung dieser Vorlesungen, wie der
Herausgeber W.E. Ehrhardt hervorhebt, einen Einblick in die weitgehend noch unbekannte „innere
Werkstätte“ (X) Schellings zu einem
Zeitpunkt, wo er die folgenreiche
Auseinandersetzung mit Hegel und
seiner Schule aufnehmen sollte.
Alexander von Pechmann