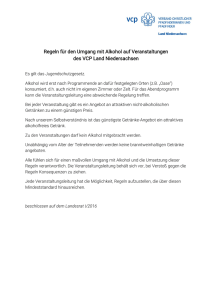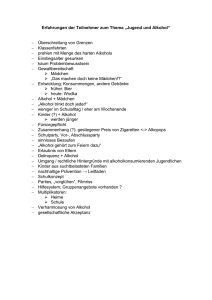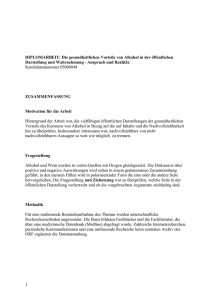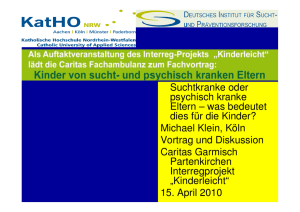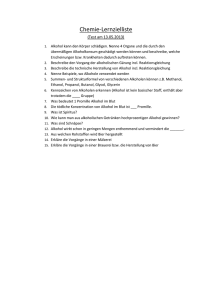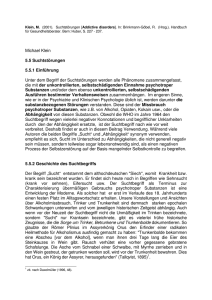Weiterbildung Psychotherapie, RHAP Krefeld
Werbung

Weiterbildung Psychotherapie, RHAP Krefeld Michael Klein Suchtgefahren und Suchtstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Grundlagen, Prävention und Behandlung (17.‐18. März 2017) 1 Suchtgefahren und Suchtstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Grundlagen, Prävention und Behandlung 1. Grundlagen zu Sucht – Was ist das Süchtige an der Sucht? 2. Verhaltenssucht – am Beispiel der Internetsucht 3. Cannabismissbrauch und –abhängigkeit 4. Suchttherapie – Haltung, Strategie, Methoden 5. Im Hintergrund: Familiale Transmission von Suchtstörungen 1. Grundlagen zu Sucht – Was ist das Süchtige an der Sucht? Dynamisches Bedingungsgefüge der Abhängigkeitsentstehung („Ätiologie“) Psychische Funktionen Umfeld Biologische Funktionen Substanz 4 Der Schlüssel zum Verständnis und zur Therapie von Suchtstörungen sind die Motive für den Substanzkonsum Motive zum Substanzkonsum: Genuss Steigerung des Wohlbefindens Verringerung von Ängsten und Missempfindungen Eskapismus/Flucht aus der Realität Bewusstseinsveränderung Leistungssteigerung Stressreduktion Persönlichkeitsveränderung Sedierung Selbstmedikation Bei der Entstehung („Ätiologie“) von Alkohol- und anderen Substanzkonsumproblemen spielen folgende Faktoren eine wichtige, bisweilen entscheidende Rolle: (1) Konsummotive, insbesondere Motive der Stressreduktion und der Flucht aus dem Alltag („Eskapismus“). Der Eskapismus gilt als relevanter Risikofaktor in der Entstehung von Suchtproblemen und ist als stärker zu gewichten als reiner Hedonismus. (2) Bedürfnis nach Steigerung der Laune und Euphorie, insbesondere in sozialer Gemeinschaft („positive Verstärkung“) (3) Mittel zur Bekämpfung negativer Emotionen, ohne dass eine psychische Störung vorliegt. Insbesondere zum Umgang mit Selbstwertproblemen, Ängsten, depressiven Verstimmungen (4) Psychische Probleme und Störungen als Ausgangslage, die durch die sedierende, anregende und insgesamt bewusstseinsverändernde Wirkung verändert werden („negative Verstärkung“) (5) Genetisch erhöhtes Risiko durch erniedrigte Alkoholreagibilität und größeren Stressdämpfungseffekt unter Alkohol, insbesondere bekannt bei Söhnen alkoholabhängiger Väter (Schuckit, 1994; Schuckit & Smith, 1997). (6) Besonders im Jugendalter haben trinkende Peers („peer-pressure“, Konformität) einen starken Einfluss auf das Konsumverhalten ihres Umfeldes. Merkmale der Sucht 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zwang, Verlangen, Impulsivität Regelmäßigkeit, Häufigkeit, Frequenz, Stil Kontrollverlust, Exzessivität, Grenzüberschreitung Dosissteigerung (Toleranz) Positive Funktionalität des Konsums und der Konsumwirkung Negative langfristige Konsequenzen Tretter & Müller, 2001, S. 66 Fremdmotivierung bei problematischem Substanzkonsum und Suchtstörungen Alkohol- und Drogenmissbrauch wirkt sich langfristig negativ auf die acht „F“s aus: Familie Firma Finanzen Führerschein Fitness (Gesundheit) Freizeit Freunde Freiheit (bei Drogen; aber auch als Autonomie) ABHÄNGIGKEITSSYNDROM (ICD-10) 1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren. (Craving) 2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums (Kontrollverlust) 3. Ein körperliches Entzugsyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums (Körperliche Abhängigkeit) 4. Nachweis einer Substanztoleranz (Toleranzentwicklung) 5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen (Psychische Abhängigkeit I) 6. Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen (Psychische Abhängigkeit II) Kriterien der Alkoholkonsumstörung nach DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2015, 675 - 676): (1) Alkohol wird häufig in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt konsumiert. (2) Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Alkoholkonsum zu verringern. (3) Hoher Zeitaufwand, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von seiner Wirkung zu erholen. (4) Craving oder ein starkes Verlangen, Alkohol zu konsumieren. (5) Wiederholter Alkoholkonsum, der zu einem Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt. (6) Fortgesetzter Konsum trotz ständiger oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die Auswirkungen von Alkohol verursacht oder verstärkt werden. (7) Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Alkoholkonsums aufgegeben oder eingeschränkt. (8) Wiederholter Alkoholkonsum in Situationen, in denen der Konsum zu einer körperlichen Gefährdung führt. (9) Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das wahrscheinlich durch Alkohol verursacht wurde oder verstärkt wird. (10) Toleranzentwicklung, definiert durch eines der folgenden Kriterien: a. Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung, um einen Intoxikationszustand oder einen erwünschten Effekt herbeizuführen. b. Deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetztem Konsum derselben Menge an Alkohol. (11) Entzugssymptome, die sich durch eines der folgenden Kriterien äußern: a. Charakteristisches Entzugssyndrom in Bezug auf Alkohol. b. Alkohol (oder eine sehr ähnliche Substanz, wie etwa Benzodiazepine) wird konsumiert, um Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden. Die Alkoholkonsumstörung („Sucht“) wird in drei Schweregraden diagnostiziert: F10.10 Leicht: 2 bis 3 Symptomkriterien sind erfüllt. F10.20 Mittel: 4 bis 5 Symptomkriterien sind erfüllt. F10.30 Schwer: 6 oder mehr Symptomkriterien sind erfüllt. Klassifikation psychotroper Substanzen Analog einer Klassifikation der WHO wird im ICD-10 zwischen psychischen und verhaltensbezogene Störungen durch folgende Substanzen unterschieden: F10 Störungen durch Alkohol F11 Störungen durch Opioide F12 Störungen durch Cannabinoide F13 Störungen durch Sedative oder Hypnotika F14 Störungen durch Kokain F15 Störungen durch andere Stimulanzien, einschl. Koffein F16 Störungen durch Halluzinogene F17 Störungen durch Tabak F18 Störungen durch flüchtige Lösungsmittel F19 Störungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen Das DSM-IV berücksichtigt zusätzlich noch Phencyclidin, das insbesondere im Zusammenhang mit Gewaltdelikten bekannt geworden ist. 13 Das deutsche Suchthilfesystem: Sozial‐ und gesundheitsrechtliche Grundlagen der Suchtbehandlung 2. Verhaltenssüchte – am Beispiel der Internetsucht Wölfling, 2015 Problematisches Spielverhalten äußert sich (in schleichenden) Veränderungen im Verhalten und dem Gefühlserleben der Betroffen. Die wichtigsten Hinweise auf ein problematisches Spielverhalten sind: Der Betroffene/ die Betroffene ... (1) hört auf, anderen Aktivitäten (außer Computerspielen) nachzugehen, die ihm/ ihr zuvor Spaß gemacht habe (2) vernachlässigt persönliche, berufliche und familiäre Verpflichtungen (z.B. Fehlen/ Zuspätkommen bei der Arbeit/ Schule) (3) verändert seine Schlaf‐, Ess‐ oder sexuellen Gewohnheiten (4) vernachlässigt sein äußeres Erscheinungsbild (5) ist ständig gedanklich mit dem Computerspiel beschäftigt (auch wenn er/sie gerade nicht spielt) (6) verschließt sich/ zieht sich von Familie und Freunden zurück (7) wirkt abwesend oder hat Schwierigkeiten sich zu konzentrieren (8) hat Stimmungsschwankungen oder plötzliche Wutausbrüche (v.a. wenn das Spiel unterbrochen wird) (9) leidet unter Langeweile oder Unruhe (10) scheint depressiv, besorgt oder ängstlich https://ag‐spielsucht.charite.de/computerspiel/merkmale_der_computerspielsucht/ Selbsttest Exzessives Computerspielen Wenn Sie sich fragen, ob Sie ihr Computerspielverhalten noch unter Kontrolle haben oder ob Sie gefährdet sind eine problematische Computerspielnutzung zu entwickeln, machen Sie den folgenden Test: Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen mit "Ja" oder "Nein" und zählen Sie die von Ihnen mit "Ja" beantworteten Fragen. 1. Müssen Sie immer länger Computerspiele oder Online‐Spiele spielen, um den gewünschten Kick zu erreichen oder ausreichend befriedigt zu sein? 2. Sind Sie ständig gedanklich mit Computerspielen oder Online‐Spielen beschäftigt (Denken an das Spiel auch wenn gerade nicht gespielt wird, Planung der nächsten Spielvorhaben)? 3. Fühlen Sie sich unruhig oder reizbar, wenn Sie versuchen ihr Computer‐ oder Online‐Spielen einzuschränken oder darauf zu verzichten? 4. Haben Sie Freunde oder Familienangehörige über das Ausmaß ihres Computer‐ oder Online‐Spielverhaltens angelogen oder versucht es vor diesen zu verheimlichen? 5. Haben Sie schon häufiger erfolglos versucht ihr Computer‐ oder Online‐Spielen unter Kontrolle zu bekommen, einzuschränken oder es ganz aufzugeben? 6. Nutzen Sie Computer‐ oder Online‐Spiele als einen Weg, um vor Problemen zu fliehen oder negativen Gefühlen wie Hilflosigkeit, Schuld, Angst oder Niedergeschlagenheit abzulenken? 7. Haben Sie Freundschaften oder ihre Partnerschaft aufgrund ihres Computer‐ oder Online‐Spielverhaltens gefährdet oder verloren? 8. Haben Sie ihren Arbeitsplatz, ihre (Schul‐)ausbildung oder Karrieremöglichkeiten aufgrund ihres Computer‐ oder Online‐Spielens gefährdet? 9. Haben Sie das Gefühl, Sie könnten ein Problem mit Computer‐ oder Online‐Spielen haben? 10. Haben Sie Familienangehörige oder Freunde hinsichtlich ihres Computer‐ oder Online‐Spielverhaltens kritisiert oder sich Sorgen gemacht, dass Sie zu viel spielen? https://ag‐spielsucht.charite.de/computerspiel/selbsttest/ Aus: Rumpf (2013, S. 4) Internet Addiction Test (IAT) Internet Addiction Test (IAT) Internet Addiction Test (IAT) CIUS Compulsive Internet Use Scale (Meerkerk) CIUS Compulsive Internet Use Scale (Meerkerk) Fallbeispiel „Robert“, 16 Jahre Bitte lesen Sie die Kasuistik „Robert“ (auf Beiblatt). Zunächst alleine und dann in Triadenarbeit. Diskutieren und lösen Sie die Aufgabenstellung. Führen Sie sodann ein Rollenspiel mit „Robert“ durch, das die Kontaktaufnahme und den Beziehungsaufbau (im Erstgespräch) oder die weitergehende Motivierung (im zweiten Gespräch) zum Inhalt hat. 3. Cannabismissbrauch und – abhängigkeit im Jugendalter Konsummuster 1.) Probier- oder Experimentierkonsum aus Neugierde oder angeregt durch den Konsum von Vorbildern in spezifischen sozialen Netzwerken 2.) Gelegenheitskonsum, der mit bestimmten Gelegenheiten wie z.B. Partys verbunden ist und dessen Hauptmotive Lustgewinn oder Steigerung des persönlichen Wohlbefindens ist 3.) Gewohnheitskonsum, der eine feste Funktion im Alltag hat wie z.B. die Stabilisierung des psychischen Wohlbefindens, Vermeiden negativer Gefühle oder Überwindung sozialer Hemmungen (Kleiber & Söllner, 1998) http://www.ift.de/index.php?id=222 19. März 2017 Epidemiologie von Suchtstörungen 32 Kandel et al., 2002 Einstieg in den Cannabiskonsum (Köln, 2009) Erste Erfahrungen mit Cannabis werden früh gemacht! (Prozentwerte in Bezug auf alle Konsumerfahrenen) Alter beim Erstkonsum von Cannabis Prozentanteil 12 Jahre oder jünger 10% 13 Jahre 19% 14 Jahre 29% 15 Jahre oder älter 42% 4. Therapie bei Suchtstörungen – Haltungen, Behandlungsplanung, Methoden Therapieprozess bei Suchtstörungen (1) (Fremdmotivationaler) Überweisungskontext (2) Beziehungsaufnahme und –aufbau, offenes Sprechen über Konsum (3) Umgang mit „Abwehr“ und „Widerstand“ (4) Motivationsförderung (pro und contra Veränderung, Ambivalenz) (5) Diagnostik, Anamnese, Therapieplanung (6) Vertiefung der therapeutischen Beziehung und „skillful confrontation“ (7) Psychoedukation und Selbstreflexion (8) Training und neue Gewohnheitsbildungen (9) Schwierige Situationen (zB Abbruch, Angehörigenverhalten) (10) Rückfälligkeit, Rückfallprävention (11) Therapiebeendigung, Nachhaltigkeit der Therapieergebnisse, Nachsorge, Wiederholungstherapien 40 Therapie mit Suchtkranken Traditionelles Modell Modernes Modell Abstinenzgebot Reduktionsziele; Zieloffenheit und Abstinenz –flexibilität, häufiges Endziel zieloffene Suchttherapie Suchtmittel ist Suchtmittel das „Wichtigste“ besitzt („primäre Funktionalität Abhängigkeit“) Integrationsmodell Parallelbehandlung von Sucht und Komorbidität 41 Therapie mit Suchtkranken Traditionelles Modell Modernes Modell Integrationsmodell Motivation ist Voraussetzung Motivation ist ambivalent und prozessual Rückfall wird tabuisiert Umgang mit Rückfall trainiert Motivational Interviewing, auch in der Entwöhnung und PT Rückfallprävenon, Rückfallintervention (STAR) 42 Therapie mit Suchtkranken Traditionelles Modell Modernes Modell Integrationsmod ell Vermeidung von Exposition Exposition als Differentielle Therapiestandard Indikation (Lindenmeyer, 2002) Nur Gruppentherapie systemische und Netzwerkarbeit Kombination und Wechsel (ET, GT) 43 Therapie mit Suchtkranken Traditionelles Modernes Modell Integrationsmodell Modell Keine Psychopharmaka für Suchtkranke Psychopharmaka bei psychischer Komorbidität und zur Rückfallprophylaxe Differentielle Therapieindikation der Medikalisierung nach Schweregrad, Attributionsmuster und Motivation Bottom-downModell; erst Leidensdruck, dann Therapie Frühintervention, Motivationsförderung indizierte Prävention und Frühintervention und PT 44 Zieloffene Suchttherapie Körkel, 2014, 168 45 Stufen des Veränderungsprozesses (nach Prochaska & DiClemente, 1988) 46 Ambivalenzkonflikt („A‐ Waage“) 47 Einübung von MI-Prinzipien Ziel: Evokation authentischer selbstbezogener Äußerungen (1) (2) (3) (4) (5) Offene Fragen Aktives Zuhören Würdigung Förderung von „Change Talk“ Umgang mit Widerstand „dancing vs. wrestlich“ (6) Förderung von „Confidence Talk“ (7) Zusammenfassungen 5. Im Hintergrund und trotzdem relevant: Transmission von Suchtstörungen in Familien Claudia Black,, ab ca. 1969 Kinderzeichnungen (Claudia Black, 1969 – 2015): Alkoholkranke Väter Typische Lebenserfahrungen von Kindern alkoholkranker Eltern (N= 115) • 1. Nicht zu Freunden gehen, um nicht in die Zwangslage zu geraten, diese zu sich nach Hause einladen zu müssen, wo die Eltern sich beschämend verhalten könnten. • 2. In der Schule mit den Gedanken zu Hause sein, was dort gerade Schlimmes passiert oder bald passieren wird. • 3. Andere Kinder beneiden oder eifersüchtig auf diese sein, wenn sie Spaß und Leichtigkeit mit ihren Eltern erleben. • 4. Sich als Kind unter Gleichaltrigen isoliert, abgewertet und einsam fühlen. • 5. Sich von den Eltern vernachlässigt, bisweilen als ungewolltes Kind fühlen. Cork, M. (1969). The forgotten children. Typische Lebenserfahrungen von Kindern alkoholkranker Eltern (Cork, 1969) • 6. Für die Eltern sorgen, sich um sie ängstigen, insbesondere wenn die Mutter süchtig trinkt. • 7. Sich um Trennungsabsichten oder vollzogene Trennungen der Eltern unablässig Sorgen machen. • 8. Als Jugendlicher die Eltern nicht im Stich lassen wollen (z. B. nicht von zu Hause ausziehen können). • 9. Die Eltern für ihr Fehlverhalten entschuldigen. Lieber andere Menschen oder sich selbst beschuldigen. • 10. Vielfache Trennungen und Versöhnungen der Eltern erleben und sich nicht auf einen stabilen, dauerhaften Zustand verlassen können. • 11. Wenn der trinkende Elternteil schließlich mit dem Alkoholmissbrauch aufhört, weiterhin selbst Probleme haben oder solche suchen. Nina, 12 Jahre, beide Elternteile alkoholabhängig (Kinderseminare FK Thommener Höhe) Ausgangslage und Fakten In Deutschland leben: 2.65 Millionen Kinder, bei denen ein Elternteil eine alkoholbezogene Störung (Missbrauch oder Abhängigkeit) aufweist (Lachner & Wittchen, 1997; Klein, 2005) ca. 50.000 Kinder mit einem drogenabhängigen Elternteil d.h.: es geht insgesamt nicht um eine gesellschaftliche kleine Randgruppe, sondern um eine substantielle Gruppe von Kindern, die ein deutlich erhöhtes negatives Entwicklungsrisiko aufweisen. Die gesunde Entwicklung von Kindern suchtkranker Eltern ist ein prioritäres Public‐Health‐Thema. Prävalenzen Jedes 7. Kind lebt zeitweise (etwa jedes 12. dauerhaft) in einer Familie mit einem Elternteil, der eine alkoholbezogene Störung (Abhängigkeit oder Missbrauch) aufweist (Deutschland; Lachner & Wittchen, 1997) Jedes 3. Kind in einer alkoholbelasteten Familie erfährt regelmäßig physische Gewalt (als Opfer und/oder Zeuge) [Klein & Zobel, 2001] Suchtkranke Familien weisen gehäuft eine „family density“ für Sucht‐ und andere psychische Störungen auf Prävalenzen Von den Kindern alkoholabhängiger Eltern entwickeln ca. 33% bis 40% selbst eine substanzbezogene Abhängigkeitserkrankung (Sher, 1991; Windle & Searles, 1990; Klein, 2005; Zobel, 2006) Ein Drittel (teilweise überlappend mit dem erstgenannten Drittel) zeigt psychische Störungen (z.B. Ängste, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen) Bindungsmuster bei psychisch kranken Müttern (Cicchetti et al., 1995) Erkrankung der Mut- Anteil unsicherer Binter dung bei Kindern schwere Depression 47% leichte Depression 24% bipolare Depression 79% Schwere Angster- 80% krankungen Alkoholmissbrauch 52% (davon 35% ambivalent) Drogenmissbrauch 85% (davon 75% ambivalent) In einer suchtbelasteten Familie oder Partnerschaft zu leben, bedeutet vor allem psychischen Stress: Alltags‐ und Dauerstress. Es entstehen oft dysfunktionale Copingmuster. Formen des Familienstresses (Schneewind, 1991, 2006): (I) dysfunktional (1) Duldungsstress („Ich kann dem Druck und Stress nicht ausweichen, halte ihn aber nicht aus“) (2) Katastrophenstress („Ich weiß nie, was passieren wird. Das macht mir so viel Angst, dass ich andauernd daran denken muss“) (II) funktional (3) Bewältigungsstress („Auch wenn es schwer ist, ich werde es schaffen und überleben“) Haupterfahrungen der Kinder suchtkranker Eltern: Stress und Volatilität des Elternverhaltens •Instabilität •Unberechenbarkeit •Unkontrollierbarkeit •Gewalt (Zeuge u/o Opfer) •Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung •Verlusterlebnisse, Diskontinuitäten Maria (5), aus Helsinki Hauptsymptome alkoholbelasteter Partnerschaften und Familien: Stress und Volatilität Im Einzelnen: • Stabilität der Instabilität • Unberechenbares Verhalten des Suchtkranken wird durch übermäßige Verantwortungsübernahme der Partnerin kompensiert. In der Summe herrscht meist lange Homöostase • Kontrollzwang, Kontrolleskalation, Kontrollverlust • Übermäßige Frequenz emotionaler, physischer und sexueller Gewalt • Chronisch belastete Atmosphäre („schleichendes Gift“) • Verlusterlebnisse, Diskontinuitäten, Brüche Hauptproblem suchtkranker Eltern aus der Kindesperspektive: Verhaltensvolatilität Das Hauptproblem suchtkranker Eltern im Erleben ihrer Kinder ist ihre Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit, bisweilen auch ihre Impulsivität, Aggressivität oder Depressivität. Je stabiler und funktionaler ihr Verhalten wird, desto besser ist dies für ihre Kinder. Resilienzen für Kinder von Suchtkranken I (nach Wolin & Wolin, 1995) • Ahnung, Wissen, Einsicht, z.B. dass mit der drogenabhängigen Mutter etwas nicht stimmt • Unabhängigkeit, z.B. sich von den Stimmungen in der Familie nicht mehr beeinflussen zu lassen • Beziehungsfähigkeit, z.B. in eigener Initiative Bindungen zu psychisch gesunden und stabilen Menschen aufzubauen • Initiative, z.B. in Form von sportlichen und sozialen Aktivitäten Resilienzen für Kinder von Suchtkranken II • Kreativität, z.B. in Form von künstlerischem Ausdruck •Humor, z.B. in Form von Ironie und selbstbezogenem Witz als Methode der Distanzierung •Moral, z.B. in Form eines von den Eltern unabhängigen stabilen Wertesystems. Merke: Neben der Individualresilienz (z.B. von Kindern) ist die Familienresilienz zu fördern. Diese betrifft die Stressresistenz des ganzen Lebenssystems (z.B. durch Förderung gesunder und heilsamer Rituale). Konzeption Modular aufgebautes ambulantes Gruppenangebot • Alter der Kinder von 8 bis 12 Jahren • Eine Person als Kursleiter/‐in • Angestrebte Gruppengröße: 6‐8 Kinder • Wöchentliche Treffen für eine Zeitdauer von etwa 9 Wochen • Umfasst 10 Module á 90 Minuten: • 9 Gruppentreffen für die Kinder • 1 Elternmodul, aufgeteilt auf zwei Abende Trampolin: Modulinhalte 9. Positives Abschiednehmen 10. Eltern sensibilisieren und stärken (Teil 1) 8. Hilfe und Unterstützung einholen 7. Verhaltensstrategien in der Familie erlernen 6. Probleme lösen und Selbstwirksamkeit erhöhen 5. Mit schwierigen Emotionen umgehen 4. Wissen über Sucht und Süchtige vergrößern 3. Über Sucht in der Familie reden 2. Selbstwert/positives Selbstkonzept stärken 1. Vertrauensvolle Gruppenatmosphäre schaffen 10. Eltern sensibilisieren und stärken (Teil 2) Hilfreiche Internetadressen (1) Internetsucht https://www.youtube.com/watch?v=e0lAGtfXcPc (NANO Internetsucht, 5 Min.) https://www.dak.de/dak/gesundheit/Internetsucht‐1713176.html (DAK zu Internetsucht) https://www.dak.de/dak/gesundheit/Selbsttest_Bin_ich_internetsuechtig‐1704800.html?/1704798/0 (Selbsttest: internetsüchtig?) Fachverband Mediensucht: http://www.fv‐medienabhaengigkeit.de/ http://www.fv‐medienabhaengigkeit.de (Fachverband Medienabhängigkeit) www.computersucht‐berlin.de (Lost in Space) www.escapade‐projekt.de (Intervention bei problematischem Internetkonsum; Drogenhilfe Köln) (2) Cannabisabhängigkeit www.quit‐the‐shit.net (Cannabis) www.realize‐it.org (Cannabis) (3) Motivational Interviewing https://www.youtube.com/watch?v=s3MCJZ7OGRk (Motivational Interviewing) Adresse Referent: Prof. Dr. Michael Klein Katholische Hochschule Nordrhein‐Westfalen (KatHO NRW) Deutsches Institut für Sucht‐ und Präventionsforschung Wörthstraße 10 D‐50668 Köln Email: Mikle@katho‐nrw.de 69