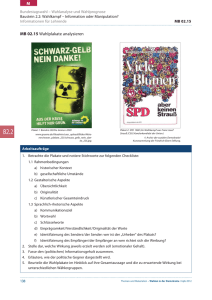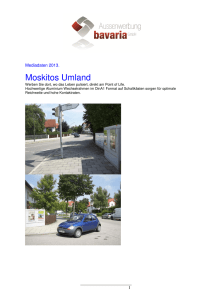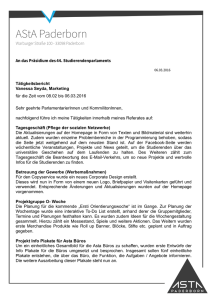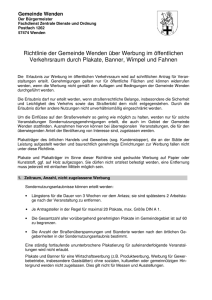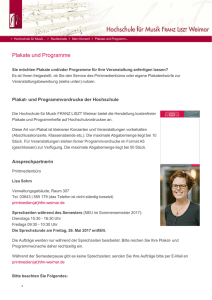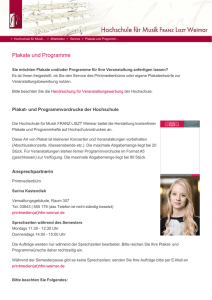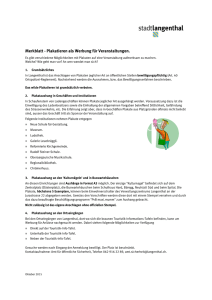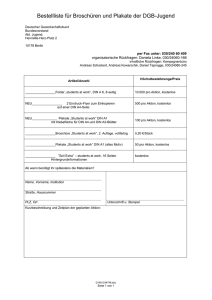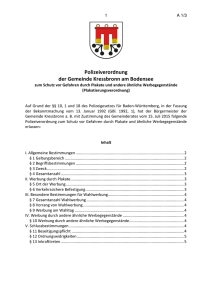SZ-Archiv: SZ vom 6.August 2013 Seite 2 München (GSID=1797795)
Werbung

2 THEMA DES TAGES HBG Dienstag, 6. August 2013, Nr. 180 DEFGH Wahlplakate, wer braucht die noch? Mit gewaltigem Aufwand an Geld und Personal überziehen die Parteien mal wieder das Land mit ihren bunten Plakaten für den Stimmenfang bei der Bundestagswahl. Allein: Ist das Plakat am Laternenpfahl nicht ein Anachronismus im Online-Zeitalter? Umfragen zeigen, dass die Wähler eher genervt sind – mit gutem Grund, wie ein Blick auf manche Motive zeigt Die Botschaft hör’ ich wohl Anders als viele Wähler glauben die Parteien immer noch, dass sie ohne traditionelle Wahlwerbung nicht auskommen VON JAN HEIDTMANN, ROBERT ROSSMANN UND RONEN STEINKE H ermann Gröhe ist kein Mensch von Traurigkeit. In diesen Tagen scheint der Wahlkampf-Chef der CDU aber noch frohgemuter zu sein als sonst. Seine Union liegt in den Umfragen stabil bei 40 Prozent, vor allem dank der Kanzlerin. Angela Merkel ist beliebt wie kaum ein anderer Regierungschef in Europa. Für die CDU läuft der Wahlkampf bisher ziemlich gut, obwohl sie noch gar nicht richtig zu kämpfen begonnen hat. Nun kommt aber auch die Union nicht ganz an der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner vorbei. Und so hat der CDUGeneralsekretär am Montag ins AdenauerHaus geladen, um die Plakate vorzustellen, mit denen die Union in den nächsten Wochen reüssieren will. Seit einem halben Jahrhundert gibt es Fernsehen, auch das Internet hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber die Parteien setzen immer noch auf Abertausende Plakate. Ist das noch zeitgemäß? Zumindest Gröhe lässt da keine Zweifel zu. Die Plakate seien eine Ansage an die eigenen Leute, findet er: „Alle Mann an Deck, die Wahl rückt näher, jetzt gilt es.“ Außerdem könne man damit ziemlich gut „Kernbotschaften“ an die Bürger vermitteln. Plakate seien deshalb zwar einer der ältesten Bausteine von Kampagnen, aber noch immer ziemlich wichtig. 8700 Wesselmänner will die CDU deshalb aufstellen lassen. „Wesselmänner“, das sind die Großplakate, die man an Ausfallstraßen und Plätzen sieht. Ihren Namen haben sie von einer Bochumer Werbeagentur. 2,90 mal 3,70 Meter sind die Ständer groß, die Botschaften sind also kaum zu übersehen. Und so werden die Deutschen in den kommenden Wochen vier Slogans der CDU nicht entkommen: „Gute Arbeit und neue Ideen, so bleibt Deutschland stark“, „Solide Finanzen sind wichtig, weil wir an morgen denken“, „Wachstum braucht Weitblick und einen stabilen Euro“ sowie „Jede Familie ist anders, und uns besonders wichtig“. Zusätzlich soll es 300 000 kleinere Plakate mit noch allgemeineren Kurzbotschaften geben. Garniert werden die Bilder mit persönlichen Botschaften der Kanzlerin Die CDU-Slogans könnten fast alle Parteien unterschreiben. Kein Wunder also, dass Gröhe gefragt wird, welches der Plakate die SPD denn nicht übernehmen könnte. Ach, Wahlplakate seien halt nun mal „keine Wandzeitungen, sondern Kurzbotschaften, die einladen, sich mit unserem Programm zu beschäftigen“, sagt Gröhe. Die CDU will die Bürger erst anwärmen. Ende August soll es neue Motive geben, kurz vor der Wahl dann auch noch eine dritte Runde. Dann will die Union auch stärker personalisieren. Auf den vier aktuellen Großplakaten kommt Merkel gar nicht vor. Auch die SPD setzt im Wahlkampf auf diese klassische Dramaturgie: Erst kommen die Themen, dann der Kandidat. Erst geht es um Mindestlohn, Renten, Kitas und Mieten. Vom 23. August an wollen die Sozialdemokraten dann ihren Spitzenkandidaten ins Zentrum der Plakatkampagne rücken. Ein bisschen tut das die CDU sicherheitshalber jetzt schon. Die Partei hat mehr als eine Million Flyer drucken lassen, die eher wie ein Fotoalbum von Angela Merkel aussehen. Garniert werden die Bilder mit persönlichen Botschaften der Parteichefin. Stellt sich die Frage, ob die Wähler die Plakate genauso wichtig finden wie die Parteien. In Umfragen reagieren die Bürger ziemlich genervt: Mehr als zwei Drittel der Deutschen sagen, dass sie Wahlplakate für überflüssig halten. Was soll das dann also? Politische Plakate haben in Deutschland eine lange Tradition, die mit der Revolution von 1848 begann und sich in der Weimarer Republik mit Grafikern und Malern wie John Heartfield regelrecht zu einer Kunstform entwickelte. Der Erfolg der Nationalsozialisten war dann auch deshalb möglich, weil sie die Instrumente der Propaganda, darunter auch Wahlplakate, sehr gut einzusetzen wussten. In den ersten Jahren der Bundesrepublik verstand sich die CDU deutlich besser auf die Wirkung von Wahlplakaten, aggressiv schürte die Partei Angst vor Moskau und Sozialismus. Die SPD hingegen versuchte – auch aus der Erfahrung der Nazi-Diktatur – eher pädagogisch zu wirken; erst mit Willy Brandt bekamen die Plakate dann einen moderneren Zuschnitt. Erst mit Willy Brandt bekamen SPD-Plakate einen moderneren Zuschnitt Der Politologe und Werber Frank Stauss hat zahlreiche Wahlkämpfe für die SPD bestritten, 2005 den für Gerhard Schröder, 2011 den für Klaus Wowereit. Er sagt, Parteiplakate seien immer noch „die größte werbliche Klammer“ einer Kampagne. „Jeder Bürger verlässt irgendwann einmal das Haus, an den Plakaten kann er nicht vorbei.“ Anders als man vielleicht vermuten würde, kommt dem klassischen Mittel der Wahlwerbung damit gerade in Zeiten des Internets und einer Vielzahl anderer Medien eine besondere Bedeutung zu. Vor etlichen Jahren gab es lediglich die Zeitung, das Radio und drei Fernsehprogramme, früher oder später wurde man mit den Botschaften der Parteien konfrontiert. „Heute haben wir wie nie zuvor die Möglichkeit, uns aus dem politischen Prozess rauszuschalten“, sagt Stauss. Die Wahlplakate seien da das Signal, dass überhaupt gewählt werde; außerdem fungierten sie als „Visitenkarte“ einer Kampagne. Denn in keinem anderen Medium muss die Botschaft der Partei auf so wenige Worte verdichtet werden. Die Plakatkampagnen verlaufen in der Regel in drei Wellen. Das hat vor allem mit dem Arbeitsrhythmus der Aufsteller zu tun, die etwa zehn Tage brauchen, um alle Plakate umzukleben. In der ersten Phase soll Spannung aufgebaut werden, am besten über ein konkretes Thema. In Phase zwei wird der Spitzenkandidat eingeführt, am besten im Dialog mit den Bürgern. Die dritte Phase dann muss der Kandidat allein bestreiten – in Kanzlerpose. Die vierte Phase beschäftigt die Parteien dann offenbar weniger, als sie es sollte: die Zeit nach der Wahl. Binnen einer Woche müssen die Plakate verschwunden sein, doch die Parteien lassen sich oft mehr Zeit. Wie andere Kommunen auch, verlangen einige Bezirke in Berlin von den Parteien nun eine Kaution, um die Plakate notfalls selbst entsorgen zu können. Damit habe man bei anderen Veranstaltungen gute Erfahrungen gemacht, heißt es im Bezirk Spandau: bei Zirkusaufführungen. Merkel, wuschelig Um die Ecke gedacht Trittin, erneuerbar Die Kanzlerin ist ein wenig mangelhaft gekämmt. Weil Angela Merkel aber nichts dem Zufall überlässt, darf man annehmen, dass gerade die leichte Wuscheligkeit des Deckhaars über der Stirn dem Betrachter auffallen soll. Sie gibt dem Auftritt etwas Spontanes, Improvisiertes – eben etwas Unfrisiertes. Die Kanzlerin ist ja inzwischen so beliebt, weil sie den Leuten das Gefühl gibt, sie sei ganz normal: sympathisch, zugänglich, manchmal umständlich und nicht fehlerfrei. „Gemeinsam erfolgreich“ ist eine Variante des 2009er-Slogans „Wir haben die Kraft“, nur statischer, weniger Versprechen, eher politische Bilanz. Diese Bilanz frisiert Merkel übrigens manchmal besser als sich selbst. Hä? Schon wieder Merkel? Dies ist eher ein Plakat für Tempo-30-Zonen, anderenfalls übersieht der potenzielle SPDSympathisant im Vorbeifahren womöglich noch das Fragezeichen. Überhaupt ziemlich viel Text für ein Wahlplakat: Das Parteiemblem, das so ins Bild lappt, als reiche es schon die Hand für eine große Koalition; der Slogan „Das Wir entscheidet“; die Ironisierung von Merkels Botschaft, die schwarz-gelbe sei die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Und unten dran noch irgendwas. Kanzlerkandidat Peer Steinbrück beklagt seit einiger Zeit, Merkel unterfordere die Deutschen. Das kann man von diesem Wahlplakat seiner Partei sicher nicht behaupten. Das mag jetzt etwas unpolitisch sein, aber sieht Jürgen Trittins Wange nicht so weich aus wie ein Trog Feuchtigskeitscreme? Die charmanten Augen, die niedlichen Lachfältchen, die feingliedrige Hand – nichts am grünen Spitzenkandidaten erinnert noch an den arroganten Raubauz aus den Fernsehtalkshows, der auch mal den erhobenen Zeigefinger einsetzt. Die bevorzugte Energieform der Grünen ist erneuerbar, Trittins Image soll es offenkundig auch sein. Früher warben die Grünen mit Szenarien des Untergangs: Waldsterben, Super-GAU, Atomkrieg, Außenminister Westerwelle. Heute ist es umgekehrt: Sie wollen den Deutschen die Angst nehmen, die Angst vor Jürgen Trittin. Nicht bewegen! Was sonst Und die Antwort? Rainer Brüderle hat schon Politik gemacht, als viele seiner heutigen politischen Gegner noch im Froschteich darauf warteten, dass der Klapperstorch sie holt. Und um ehrlich zu sein: So sieht er auf seinem Plakat auch aus. Brüderle wirkt freundlich, aber irgendwie starr – man muss freilich annehmen, dass darin auch die Botschaft liegen soll: bloß nichts verändern. Brüderle guckt so, als verstehe er die modernistische Farbgebung um ihn herum selbst nicht: grelle Blautöne und ein sphärisch-wolkiges Weiß. Besonders bemerkenswert ist aber die Krawatte, die aussieht, als sei sie aus Zement, und bei deren Anblick selbst ein Kanarienvogel vor Schreck schreiend davonfliegen würde. Knallig, flott, schwarz auf weiß: Die Linke wirbt nicht um ihre Wähler, sie brüllt sie an. Sie zeigt vorerst keine Politiker, vermutlich weil die Politiker erst mal die anderen sein sollen, die nur labern, aber nichts tun. „Alles die gleiche Soße“, nennt Spitzenkandidat Gregor Gysi das gerne. Die Linke grenzt sich ab, indem sie nur das plakatiert, was man Inhalte nennt, was sie offenbar unterscheiden soll von den Gleiche-Soße-Parteien, die Konterfeis mit gefühligen Botschaften zeigen. Die Ankündigungen der Linken sind konkret: 10 Euro Mindestlohn, 1050 Euro Mindestrente, Millionärssteuer. Und zugleich sind sie Utopie, weil es keine andere Partei gibt, die sie mit der Linken verwirklichen mag. Das Erstaunlichste an den Plakaten der Piraten ist, dass es sie überhaupt gibt. Nicht die Piraten, sondern die Plakate. Straßenwahlkampf ist ja eigentlich eine ziemlich analoge Kommunikationsform, ein echter Nerd kommt an so einem Ding vermutlich nur vorbei, wenn er sich an der Tanke gegenüber ein Sixpack Mate-Tee holt. „Stell dir vor, du wirst gefragt“, erscheint dabei wie ein Slogan, der gemischte Gefühle weckt, offenbar selbst bei der jungen Frau, die ihn anbietet. „Für mehr Mitbestimmung und Teilhabe der Bürger an politischen Entscheidungen“, ist so klein geschrieben, dass man es kaum noch lesen kann. Hat sich ja auch in der Partei selbst schon als ziemlich schwierig erwiesen. TEXTE: NICO FRIED AUSSENANSICHT D ie Politik lässt sich nicht lumpen. Sie fördert Ehen und Familien mit 200 Milliarden Euro pro Jahr. Doch was kommt dabei heraus? Deutschland gehört mit einer Geburtenrate von etwa 1,4 Kindern je Frau zu den geburtenschwächsten Ländern der Welt. Die Wunschkinderzahl junger Paare liegt deutlich höher. Gleichzeitig rangiert Deutschland bei dem Umfang der Erwerbsbeteiligung der Frauen in der OECD ganz hinten. Ein Grund ist, dass sich Familie und Beruf für Frauen entgegen ihren Wünschen nur unzureichend vereinbaren lassen. Schuld daran ist auch die Ehe- und Familienpolitik. Die Politik fördert Ehen und Familien nach dem Gießkannenprinzip durch konzeptionslose und widersprüchliche Maßnahmen, statt gezielt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzuwirken. Das wird nicht nur den gesellschaftlichen Veränderungen und Wünschen junger Paare, sondern auch dem Grundgesetz nicht gerecht. Dass der Staat Ehen und Familien fördert, ist Ausdruck seiner verfassungsrechtlichen Pflicht. Der Grund dafür sind die gemeinwohlsichernden Leistungen, die Eheleute – ebenso wie eingetragene Lebenspartner – erbringen, weil sie wechselseitig Verantwortung füreinander übernehmen, und Eltern, weil sie Kinder pflegen und erziehen. Bei der Entscheidung über Art und Umfang der Förderung steht dem Staat ein weiter Spielraum zu. Doch darf er einzelne Weg mit dem Ehegattensplitting Der Staat gibt Milliarden für Familienförderung aus – doch ein Konzept fehlt. Und manches ist sogar verfassungswidrig. Von Frauke Brosius-Gersdorf Ehe- und Familienmodelle grundsätzlich nicht gegenüber anderen privilegieren. Eine solche Privilegierung ist nur erlaubt und geboten, wenn einer Ehe- oder Familienform strukturelle Hindernisse entgegenstehen. Solche Hindernisse bestehen wegen der unzureichenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Doppelverdienerfamilie. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf durch gleichstellungsorientierte Maßnahmen abzubauen. Die Politik hat mit dem zum 1. August eingeführten Anspruch auf einen Kitaplatz vom ersten Lebensjahr an einen richtigen Schritt hin zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf unternommen. Damit Frauen tatsächlich gleiche Chancen im Beruf haben und sich für Kinder entscheiden, muss der Anspruch auf eine Ganztagsschule folgen. Finanzielle Negativanreize für die Verbindung von Familie und Beruf setzt die Regierung, indem sie an dem Ehegattensplitting und der beitragsfreien Mitversicherung für nicht oder geringfügig erwerbstä- DIZdigital: Alle Alle Rechte Rechte vorbehalten vorbehalten –- Süddeutsche Süddeutsche Zeitung Zeitung GmbH, GmbH, München München DIZdigital: Jegliche Veröffentlichung Veröffentlichung und und nicht-private nicht-privateNutzung Nutzungexklusiv exklusivüber überwww.sz-content.de www.sz-content.de Jegliche tige Ehegatten in der Pflege- und Krankenversicherung festhält. Das Ehegattensplitting lässt sie sich 20 Milliarden Euro, die Ehegattenmitversicherung 13 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Beide Maßnahmen begünstigen Alleinverdiener und benachteiligen doppelt erwerbstätige Ehepartner. Beim Ehegattensplitting werden die Einkünfte der Partner erst zusammengerechnet, dann halbiert und je hälftig versteuert. Es wird also nicht ein hohes Einkommen, Dass Alleinverdiener privilegiert werden, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sondern es werden zwei (fiktive) niedrige Einkommen versteuert. Weil die Besteuerung progressiv ist, profitieren die Eheleute doppelt von geringeren Steuersätzen im unteren Einkommensbereich. Je größer die Einkommensunterschiede sind, desto höher ist der finanzielle Vorteil. Bei Doppelverdienern ohne Einkommensdifferenz entfällt der Effekt des Splittings. Diese Privilegierung ist nicht zu rechtfertigen. Alleinverdiener sorgen nicht besser füreinander als Doppelverdiener. Der Verzicht auf ein Einkommen ist kein unfreiwilliges, strukturelles Hindernis für Alleinverdienerehen, welches der Staat durch steuerliche Vorteile beseitigen dürfte. Mit dem gleichen Argument müsste auch ein freiwillig gewählter doppelter Einkommensverlust ausgeglichen werden. Das Ehegattensplitting und die Mitversicherung entfalten zugleich Negativanreize für die Erwerbstätigkeit der Frauen. Sie wirken wie Einkommensersatzleistungen, die den Berufsausstieg von Frauen fördern. Im Fall einer Scheidung stehen Frauen seit der Unterhaltsrechtsreform oft unversorgt da. Überspitzt formuliert, lässt sich die Ehe- und Familienpolitik als „Anstiftung zur Altersarmut“ sehen. Der Staat fördert nicht die Erwerbskarriere, sondern die „Hartz-IV-Karriere“ von Frauen. Verfassungswidrig und sozialpolitisch verheerend ist auch das zum 1. August eingeführte Betreuungsgeld. Seine Beschränkung auf Eltern, die ihr Kind nicht in einer öffentlich geförderten Einrichtung betreuen lassen, ist nicht zu rechtfertigen. Eltern, die ihr Kind selbst betreuen oder in einer privat-gewerblichen Einrichtung, von Großeltern oder Freunden betreuen lassen, haben nicht durchgängig größere kindbezogene Lasten und erbringen nicht mehr oder bessere Pflege- und Erziehungsleistungen als Eltern, die eine öffentlich geförderte Betreuungseinrichtung in Anspruch nehmen. Zudem fördert die Regierung auch mit dem Betreuungsgeld die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. Obwohl das Betreuungsgeld mit nun 100 Euro und von 1. August 2014 an mit 150 Euro pro Monat eher gering ausfällt und auch Eltern zugutekommt, die berufstätig sind, wirkt es für Mütter mit niedrigem Einkommen wie eine Einkommensersatzleistung, die den Berufsausstieg fördert. Eine den gesellschaftlichen Veränderungen und dem Grundgesetz angemessene Ehe- und Familienpolitik erfordert nicht mehr Geld, sondern dass es anders eingesetzt wird. An die Stelle der aktuellen Förderpolitik muss eine Politik treten, in deren Mittelpunkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht, sodass alle Ehen und Familien echte Wahlfreiheit bei der Verwirklichung ihrer Lebensentwürfe haben. Hierfür muss die Politik erstens einen Anspruch auf Ganztagsschule einführen. Zweitens muss sie die negativen Anreize für die Verbindung von Familie und Beruf beseitigen. Das Ehegattensplitting, die Mit- versicherung und das Betreuungsgeld müssen aufgehoben und durch diskriminierungsfreie, gleichstellungsorientierte Maßnahmen ersetzt werden. Drittens sollte der Staat auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinwirken – etwa durch steuer- und sozialversicherungsrechtliche Maßnahmen, die die doppelte Erwerbstätigkeit fördern. Bleibt der Staat seiner bisherigen Linie treu, wird Deutschland – trotz der milliardenschweren Ehe- und Familienförderung – wohl auch in Zukunft zu den kinderärmsten Ländern gehören und bei der Frauenerwerbstätigkeit einen Verliererplatz einnehmen. Dass dies nicht nur die Rechte und Chancen der betroffenen Paare und Frauen beschneidet, sondern angesichts des demografischen Wandels auch verheerende Konsequenzen für das Arbeitskräfteangebot, die Wirtschaft und die Sozialversicherungssysteme hat, liegt auf der Hand. Frauke Brosius-Gersdorf, 42, ist Professorin für Öffentliches Recht in Hannover. In ihrer Habilitation untersuchte sie den Zusammenhang von Geburtenrate und Familienförderung. FOTO: OH asiegle SZ20130806S1797795