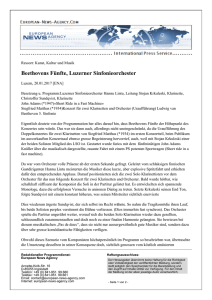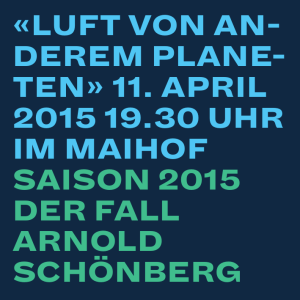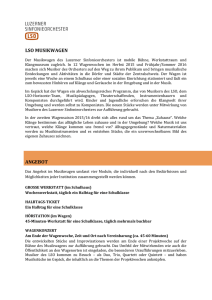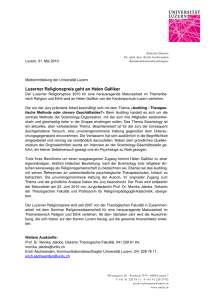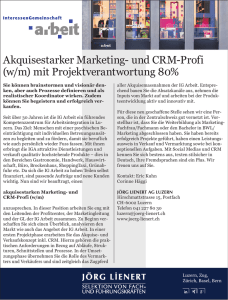Magazin 2 - Luzerner Sinfonieorchester
Werbung

Ein- und Ausblicke rund um das LSO – Oktober 2015 MAGAZIN 2 | 15 Die Renaissance der Klavierimprovisation | Im Fokus: Das Violoncello | Busoni im Schweizer Exil | Der jüdischen Seele abgelauscht Liebe Leserinnen und Leser Liebe Freunde des Luzerner Sinfonieorchesters Das Thema könnte aktueller nicht sein: die Schweiz als Gastland. Richard Wagner fand hier – in Zürich, später in Luzern – eine neue Heimat, und hier hat er vielseitig gewirkt, als Komponist, Dirigent und Erneuerer der Konzertszene. Mit Wagners «Ring ohne Worte» eröffnen wir die Konzertsaison des Luzerner Sinfonieorchesters. Auch Ferruccio Busoni verbrachte wichtige Jahre im Schweizer Exil. Ihm widmen wir einen besonderen programmatischen Schwerpunkt, wobei als Höhepunkt sein monumentales Klavierkonzert mit Männerchor zur Aufführung gelangen wird. Zurück in die Zeiten des biblischen Königs Salomo führt uns der Meistercellist Gautier Capuçon mit Ernest Blochs «Schelomo», einer hebräischen Rhapsodie, die auf traditionellen jüdischen Gesängen und orientalischem Melos fusst. Ebenfalls auf Salomo griff der Italiener Ottorino Respighi in seinem aufwendigen Ballett «Belkis» zurück, das die Begegnung mit der sagenhaften Königin von Saba thematisiert. Überhaupt nimmt das Violoncello als Soloinstrument in dieser Saison einen besonderen Platz ein: Neben Gautier Capuçon werden Sie Christian Poltéra, Steven Isserlis, Antonio Meneses und Truls Mørk erleben. Passend zu diesem Reigen von Ausnahmecellisten fügt es sich, dass der diesjährige Arthur Waser Preis an den jungen französischen Cellisten Edgar Moreau vergeben wurde. Im Dezember wird er mit Schumanns Cellokonzert sein Debüt mit dem Luzerner Sinfonieorchester geben. Die Rückbesinnung auf die historischen Begebenheiten im Musikleben früherer Jahrhunderte hat nicht zuletzt gezeigt, dass die Improvisationskunst damals eine tragende Rolle spielte. Umso erfreulicher ist es, dass man sich heute wieder auf diese Kunst besinnt. Im zweiten Neujahrskonzert improvisiert die venezolanische Pianistin Gabriela Montero über Themen, die Sie als Konzertbesucher vorgeben können. Ganz am Puls der heutigen Zeit, setzt das Luzerner Sinfonieorchester sein Engagement für die zeitgenössische Musik mit Uraufführungen der Schweizerin Katharina Rosenberger und des jungen Deutschen Jan Esra Kuhl fort. Mit grosser Freude blicken wir unseren Konzertauftritten in Luzern entgegen wie auch unserem Gastspiel in Amsterdam, wo wir im Januar 2016 zum zweiten Mal im Königlichen Concertgebouw auftreten werden. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf schöne Begegnungen mit Ihnen. Ihr Numa Bischof Ullmann Intendant Luzerner Sinfonieorchester LSO Magazin 2 |15 – Oktober 2015 – 10. Ausgabe Impressum Herausgeber: Luzerner Sinfonieorchester LSO | Pilatusstrasse 18 | 6003 Luzern | [email protected] | www.sinfonieorchester.ch Redaktion: Diana Lehnert | Konzeption & Marketing: Diana Lehnert, Norman Ziswiler Bildnachweise: Titelbild: Christian Flierl | S. 2 privat | S. 3 Richard-Wagner Museum Luzern | S. 5 Shelly Mosman | S. 6 J.-P. Echard, Musée de la musique Paris | S. 8 Michael Schwarzkopf | S. 11 Edward Poynter 1836 – 1919, Art Gallery of New South Wales | S. 12 Katharina Rosenberger | Jan Esra Kuhl S. 13 Hagia Sophia via Wikimedia Commons | S. 14 Diana Lehnert Gestaltung: WOMM | Druck: Multicolor Print AG | Auflage: 2500 Ex. Redaktionsschluss: 1.9.2015 | Änderungen vorbehalten | 2015 Luzerner Sinfonieorchester 2 «Mit dem Blick auf die erhabenen, goldbekränzten Berge» Richard Wagner hat in seinem Schweizer Exil nicht nur Texte geschrieben und komponiert, sondern auch mit aller Kraft versucht, das Konzertleben aufzufrischen. | MICHELLE ZIEGLER Als Vertriebener suchte Richard Wagner zweimal in seinem Leben in der Schweiz Zuflucht. Nach Zürich floh er 1848, weil er sich in Dresden an der Revolution beteiligt hatte und steckbrieflich gesucht wurde. In Luzern installierte er sich 1866 aufgrund der Aufruhr, die sein aussereheliches Verhältnis zu Cosima von Bülow am Hof seines Mäzens, des Königs Ludwig II. in München ausgelöst hatte. Dass er zwangsmässig seiner Heimat fernbleiben musste, betrübte Wagner gerade in den Zürcher Jahren. Seine Äusserungen lassen allerdings auch darauf schliessen, dass er sich in diesen Jahren nicht nur in der Schweiz verliebte – in Zürich begegnete er Mathilde Wesendonck und sah auch Franz Liszts Tochter Cosima zum ersten Mal –, sondern auch in die Schweiz. Zeugnisse belegen, dass die Schweiz für ihn eine Quelle der Inspiration war. Oft unternahm er anspruchsvolle Gebirgswanderungen, die seine Phantasie anregten. Auf einer Italienreise schrieb er in sein Tagebuch: «Lasst mich noch die Werke schaffen, die ich dort empfing, im ruhigen, herrlichen Schweizerlande, dort mit dem Blick auf die erhabenen, goldbekränzten Berge: es sind Wunderwerke, und nirgends sonst hätte ich sie empfangen können.» Wie aber fügte sich Wagner in das hiesige Musikleben ein? Über das dürftige Angebot der Kleinstadt Zürich, wo Wagner mit «Aussicht auf die schneebedeckten Alpengebirge» lebte, äusserte sich der Komponist mehrmals abwertend. Doch womöglich weckte gerade diese Not seinen Unternehmergeist. Jedenfalls brachte er immer wieder engagiert Vorschläge zur Verbesserung des Musiklebens ein. Wagner führte Innovationen wie im Voraus gedruckte Programmnotizen für das Publikum ein und begründete die neue Form des Sinfoniekonzertes mit Ouvertüre, Konzert und Sinfonie. Hier träumte er zum ersten Mal von einem «dramatischen Musikfest»: Er wollte auf einer Wiese «von Brett und Balken» ein «rohes Theater» aufstellen lassen, auf dem in einer Woche drei Aufführungen stattfinden sollten – die Idee der Bayreuther Festspiele war geboren! Wie seine Anwesenheit sich auf das Orchester der Allgemeinen Musikgesellschaft auswirkte, lässt sich an den Zahlen ablesen: 1849 zählte es fünf Geigen, eine Bratsche, ein Cello, einen Kontrabass und 13 Holzbläser, fünf Jahre später gleich doppelt so viele. Wagners Debüt mit Ludwig van Beethovens Siebter Sinfonie war so erfolgreich, dass er in der Folge wählen konnte, was er wann dirigieren wollte. Unbestrittener Höhepunkt seines Wirkens als Dirigent in Zürich waren indessen die drei Konzerte im Mai 1853 mit Auszügen aus seinen Opern «Rienzi», «Der fliegende Holländer», «Tannhäuser» und «Lohengrin». Wagner liess zur Verstärkung des Orchesters etliche Musiker aus näheren und ferneren Städten anreisen. Das Resultat: Das Publikum trug ihn «auf den Händen». 1866 fand Wagner in Tribschen bei Luzern eine neue Bleibe, nachdem sein Verhältnis mit der verheirateten Cosima von Bülow am Hof in München zunächst zu Einwänden, nach einer Rücktrittsdrohung des Kabinetts gar zu einer Regierungskrise geführt hatte. Nachdem sich Cosima und Hans von Bülow getrennt hatten, war der Weg für einen idyllischen Lebensalltag in Tribschen geebnet. Bis zur Abreise im Jahr 1872 arbeitete Wagner hier in einem geordneten Arbeitsalltag. Hier hatte er es sich gemütlich gemacht. Hier lebte er mit seiner Familie mitsamt Haustieren, darunter der Neufundländer Russ und Cosimas beiden Pfauen Wotan und Fricka – eine glückliche, inspirierende Zeit. Saisoneröffnung – Der «Ring» ohne Worte Mittwoch, 14. und Donnerstag, 15. Oktober 2015 | 19.30 Uhr KKL Luzern, Konzertsaal Luzerner Sinfonieorchester LSO James Gaffigan, Chefdirigent | Nelson Freire, Klavier Sergej Rachmaninoff (1873 – 1943) Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 g-Moll op. 40 Richard Wagner (1813 – 1883) Der «Ring» ohne Worte (arr. von Lorin Maazel) Michelle Ziegler arbeitet als Musikwissenschaftlerin und freischaffende Musikpublizistin u.a. für die «Neue Zürcher Zeitung» und ist als Kuratorin in verschiedene Projekte involviert. LSO MAGAZIN 2 | 2015 3 Renaissance und Magie der Klavierimprovisation Was der Preussenkönig einst von Bach verlangte, ist heute wieder angesagt: ausgehend von einem Thema frei zu improvisieren. Die Improvisationskunst in der Klassik ist zurück. Neben Instrumenten wie Orgel und Cembalo, einst die Pfeiler im Generalbasszeitalter, bringt sich neuerdings der Konzertflügel in Position. | CORINNE HOLTZ Nichts ist vor ihr sicher. Ein deutscher Schlager oder der Anfang aus Schumanns Rheinischer Sinfonie, die Aria aus Bachs Goldberg-Variationen oder ein Chanson von Piaf – das Publikum mag die Themen noch so ungefähr wiedergeben, Gabriela Montero entziffert deren Kern und legt nach einer Konzentrationspause los. Aus Bachs berühmter Aria, der Wurzel der Goldberg-Variationen, entspinnt sich zunächst eine am französischen Impressionismus angelehnte Introduktion. Dann tastet sich die Musik in eine verrauchte Bar der 1920er Jahre vor und landet schliesslich im gepflegten Easy Listening. Was geht hier vor? Die Pianistin spielt aus dem Stegreif ohne Noten und schöpft während des Improvisierens aus einer unsichtbaren Quelle. Scheinbar unvorbereitet, wie die Herkunft des Wortes aus dem Lateinischen («ex improviso») irrtümlicherweise glauben macht. Eine konsistente Improvisation setzt im Gegenteil sehr viel voraus. So greifen Improvisierende meist auf bestimmte stilistische Formeln zurück, die sie im Zuge jahrelangen Umgangs mit Musik unterschiedlicher Epochen verinnerlicht haben und abrufen können. Sie spielen sich entlang spezifischer Ausformungen von Harmonik, Melodik und Rhythmus und entfernen sich unterschiedlich weit vom Ausgangspunkt. Das eingeweihte Publikum freut sich, wenn es «nach Bach» klingt und sich ein kontrapunktisches Geflecht im Stil der Fuge entfaltet. Soll Mozart ins Spiel kommen, darf der sogenannte Alberti-Bass in der Begleitung nicht fehlen, wie er etwa den Beginn der populären Sonata facile prägt. Die Töne der Akkorde werden nacheinander gespielt, eingebürgert hat sich dabei Domenico Albertis Schema der Reihenfolge «tiefster, höchster, mittlerer, höchster» Ton. Improvisieren war selbstverständlich Das Improvisieren war im 17. und 18. Jahrhundert Teil jeder gründlichen musikalischen Ausbildung. Wer ein Tasteninstrument spielte, musste die improvisatorische Technik des Generalbasses beherrschen. Notiert war lediglich eine Bassstimme, beziffert mit Zahlen, die das jeweilige Intervall bezeichneten, das vom Basston aus zusätzlich zu greifen war. Daraus ergaben sich Akkorde, deren Oberstimme, Dichte und Verzierungen nicht ge- 4 nau festgelegt waren und von der Persönlichkeit des Spielers geprägt wurden. Wie zentral diese Funktion im Zusammenspiel mit den anderen Instrumenten war, illustriert der Begriff «Generalbasszeitalter», das die Epoche zwischen 1600 und 1750 umreisst und gleichzeitig die Blütezeit der Improvisation war. Komponisten wie Jan Pieterszoon Sweelinck, Girolamo Frescobaldi, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach waren auch hervorragende Improvisatoren. Der Abstieg in den Salon Im 19. Jahrhundert wuchs der Widerstand gegen den Interpreten, der sich gegenüber der Partitur improvisatorische Freiheiten herausnahm. Instrumentale und vokale Kadenzen wurden immer seltener improvisiert, der Komponist trat stattdessen auf den Plan und unterwarf auch die Solokadenz der Kontrolle durch den Autor. Die Improvisation, von Klaviervirtuosen wie Clara Wieck und Franz Liszt noch einmal zur Blüte gebracht, verlagerte sich schliesslich in die Salons. Dort war es üblich, mit einem improvisierten Präludium einzusteigen und erst dann komponierte Stücke zum Besten zu geben. Mit dem Niedergang des Salons als gesellschaftlicher Ort starb auch die öffentliche Improvisation. Improvisation als Provokation Der Jazz und seine Pioniere brachten die Praxis ins 20. Jahrhundert zurück. Mit ihr die Wertschätzung einer Kompetenz, die im Klassikbetrieb keinen Platz hatte. Der Pianist Friedrich Gulda galt als Provokateur, weil er sich auch als Jazzmusiker und Improvisator verstand. 1972 sorgte er mitten im Festspielglamour Salzburgs für Aufruhr. Unweit des Festspielhauses, im Hof des Bürgerspitals, inszenierte er zusammen mit Paul und Limpe Fuchs ein Gegenprogramm: die «totale Improvisation». Statt «Geräusche aus der Seele» zu produzieren (so Gulda über Mozart), praktizierte das Trio Anima ungehörige Klänge, laut und sperrig, stundenlang. «Zwei Ignoranten und ein Wahnsinniger!» kommentierte ein Festspielbesucher das «Strassentheater», während ein Ehepaar im Trachtenlook fragte: «Ist das noch die Probe oder schon die Aufführung?» Gabriela Montero Zurück im Konzertsaal Inzwischen hat sich die Improvisation im Konzertsaal zurückgemeldet. Das Terrain haben Ensembles aus dem Crossover-Bereich bereitet, darunter etwa die Pionierin und Lautenistin Christina Pluhar, die im Projekt L’Arpeggiata seit 2000 hervorragende Interpreten und Interpretinnen versammelt. Diese sind mehrheitlich in der klassischen Musik gross geworden, verfügen über eine makellose Technik und spielen sich in den wirkungsmächtigen Arrangements jeweils regelrecht in Trance. Auch das Klavier holt auf. Die Spitzenplätze belegen Fazil Say und Gabriela Montero, die mit ihrem Markenzeichen weltweit Erfolge feiern und es ausserdem wagen, mit unzeitgemässen Kompositionen an die Öffentlichkeit zu treten. Am Anfang steht meist eine Lehrperson, die ein Kind zum Improvisieren ermutigt, sagt Fazil Say. Statt ausschliesslich Einspielübungen oder Etüden zu absolvieren, lasse man sich von den Eindrücken und Beobachtungen aus dem Alltag inspirieren. Gabriela Montero musste sich das Improvisieren regelrecht erkämpfen. Gegen den Willen ihrer Lehrmeisterinnen pflegte die Venezolanerin ihre Leidenschaft im Geheimen, schliesslich geriet sie in eine Sinnkrise und schöpfte im Rahmen einer «Berufs- und Lebensberatung» bei Martha Argerich Kraft, als Pianistin neu anzufangen. «Improvisieren macht einen grossen Teil meiner selbst aus. Es ist der natürlichste und spontanste Weg, mich auszudrücken.» Seit 2011 wird dieser Überzeugung auch in ihren Auftritten Rechnung getragen. Am Ende eines konventionellen Programms folgt, worauf manche im Publikum warten. Die Musikerin kreiert aus einem vorgegebenen Thema Musik und Form, die aus dem Augenblick heraus entsteht. Das erzeugt eine Unmittelbarkeit, die im Zeitalter digitaler Datenströme eine Magie eigenen Zuschnitts entfaltet und das Publikum in den Bann zieht. Improvisationen zum Neuen Jahr – Neujahrskonzert Samstag, 2. Januar 2016 | 11.00 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Luzerner Sinfonieorchester LSO | James Gaffigan, Chefdirigent Gabriela Montero, Klavier Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Ballettmusik aus der Oper «Idomeneo» Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Klavier und Orchester Nr. 20 d-Moll KV 466 Improvisationen mit Gabriela Montero, dem Luzerner Sinfonieorchester und dem Publikum Corinne Holtz, Dr. phil., ist Musikerin und Musikpublizistin und lebt in Zürich, www.corinneholtz.ch. LSO MAGAZIN 2 | 2015 5 L’Ecole française de violoncelle Das Violoncello nimmt in der Saison 2015/16 einen besonderen Platz ein. Sechs aussergewöhnliche Cellisten sind zu Gast beim Luzerner Sinfonieorchester, darunter der Gewinner des diesjährigen Arthur Waser Preises, Edgar Moreau. Wie haben sich das Cellospiel und insbesondere die französische Celloschule entwickelt? | WALTER GRIMMER … und wenn es die Geiger gewesen wären, die den Terminus der «Schulen» und deren Unterschiede in die Welt gesetzt hätten? Noch immer reden sie vom russischen und vom franko-belgischen Bogengriff. Seit dem eminenten Geigenlehrer Ivan Galamian werden heute auch Mischformen angewandt, um die beiden Techniken zur Klangerzeugung zu vereinen. Es geht dabei eindeutig um die Einordnung des unterschiedlichen Klangcharakters und dessen Erzeugungsmechanismus. Scheinbar analoge Klassifizierungen haben sich irgendwann auch in der Cellistenwelt etabliert. Man fing an, von einer russischen, einer deutschen, ungarischen, belgischen oder französischen Schule zu sprechen, wahrscheinlich um damit die Überlegenheit der einen über die andere aufgrund ihrer virtuosen Protagonisten auszudrücken. Die ersten Spieler eines neuartigen Instrumentes, zuerst Violoncino genannt, also kleiner Bass – noch Mozart bezeichnete das Cello als das «Bass’l» – ,findet man natürlich im Land und in der Zeit dieser Erfindung, also in Italien der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Zur Blütezeit von Antonio Stradivari lebte der glorreiche Francesco Alborea, von Scarlatti als «Francischiello der Engelhafte» bezeichnet. Ihm schreibt man die Anwendung des Daumenaufsatzes zu, ohne die gewisse Passagen in Vivaldis Cellokonzerten nicht ausführbar wären. Viele Namen tauchen auf bis zum genialen Luigi Boccherini, geboren 1743. Ohne diesen überragenden Cellomeister wäre die Geschichte des Cellospiels anders und langsamer verlaufen. Weder die Gebrüder Duport hätten auf seiner technischen Errungenschaft, lange Passagen in einer festen Daumenlage spielen zu lassen, aufbauen, noch hätte später Bernhard Romberg den phänomenalen Mechanismus seiner linken Hand perfektionieren können. «Le violoncelle est un instrument chantant, n’est-ce pas!» Pierre Fournier 6 Porträt Jean-Louis Duport, le Cadet genannt, von Rémi-Furcy Descarsin. Sammlung des Musée de la musique, Paris. Foto : J.-P. Echard Als eigentlicher Begründer der französischen Celloschule gilt Martin Berteau, ein ehemaliger Gambenvirtuose. Nach intensivem Studium bei dem berühmten Francischiello wurde er ein hervorragender Cellolehrer. In seiner Klasse am Conservatoire in Paris finden wir bereits die klingenden Namen von Cupis, Janson, Tillière, Bréval. Doch erst mit seinem hervorragenden Schüler Jean-Pierre Duport (1741 – 1818) wurde die prägende Figur geschaffen. Dieser unterrichtete seinen ebenfalls hochbegabten jüngeren Bruder Jean-Louis (1749 – 1819); ihnen beiden oblag es später, die vielen letztlich untauglichen Methoden, die bis dahin im deutschen und im französischen Sprachraum erschienen waren, durch ein neues und systematisiertes Fingersatz-Konzept auf dem Cello zu ersetzen. Vor allem auch die Lehre der rationellen Bogenführung wurde in vollkommener Kenntnis der physiologischen Gegebenheiten verfasst. Frankreich, das als letztes Land Europas die Viola da Gamba verabschiedete, um dem Violoncello die Tür zu öffnen, lieferte gleich als Erstes die intelligente, allen anderen überlegene «Methode», die bis heute ihren überragenden pädagogischen Wert behalten hat. Bescheidenerweise erschien das epochale Werk Jean-Louis Duports 1804 unter dem Titel «Essai sur le doigté du violoncelle et sur la conduite de l’archet, dédié aux professeurs de violoncelle». Er erwähnt im Vorwort, dass es kein Detail in diesem Werk gebe, das er nicht seinem älteren Bruder «und ewigen Lehrer» zur Begutachtung vorgelegt habe. In den beiden Kapiteln «De l’égalité du son, de ses nuances et de l’expression» und «Considérations sur l’égalité du son et sur la voix que l’on tire de l’instrument» liefert Duport nicht nur die technischen Grundgedanken zur Vervollkommnung des gesanglichen Spiels, sondern evoziert überhaupt das französische Verständnis des Cellospiels, das bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts diese ihm eigene Qualität bewahren konnte. Bei allen der bedeutendsten Nachfolger Duports kann man die melodische Eleganz ihrer Spielweise aufgrund ihrer Cello-Kompositionen nachweisen. Als Pars pro Toto sei hier nur das Œuvre von Auguste-Joseph Franchomme, dem Widmungsträger der Cellosonate von Chopin, erwähnt. Noch Pierre Fournier plädierte in einem Lehrfilm ausdrücklich für ein singendes Cello: «Le violoncelle est un instrument chantant, n’est-ce pas!» Jules Loeb, ein passionierter Arrangeur, Louis R. Feuillard, der in seinen «Exercices Journaliers» noch lange weiterleben wird, und Paul Bazelaire, ein unermüdlicher Pädagoge, waren alle in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wichtige Professoren und grosse Persönlichkeiten. Ihnen verdanken Maurice Maréchal, Reine Flachot, Etienne Pasquier und Guy Fallot ihr Können und ihre Entwicklung. Eine ganz aussergewöhnliche Konstellation von vier Hochbegabten wuchs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts heran. Sie kamen alle aus der Talentschmiede des Pariser Conservatoire. Zwischen 1906 und 1920 geboren, waren es Pierre Fournier, André Navarra, Paul Tortelier und Maurice Gendron. Einmalig war ihre starke künstlerische Unabhängigkeit, die sich trotz ähnlicher Herkunft und gleicher Ausbildung in völlig verschiedenen Auffassungen und Wiedergaben äusserte, ein eigentlicher Triumph der französischen nationalen Ausbildungstradition! Alle vier lehrten zeitweilig an der Schule, der sie ihre eigene Ausbildung verdanken. Ihre Prominenz ist immer noch ungebrochen, und dank der Tonträger kann man sich jederzeit der eleganten Schönheit ihres Spiels hingeben. Da in Frankreich bis heute eine weitgehende Hegemonie an den Konservatorien herrscht, ist das Lehrkonzept bis vor Kurzem kaum je wesentlich angetastet worden. Die kurze Lehrtätigkeit von Bernhard Romberg und die längere von Sebastian Lee haben rückblickend nur einen episodischen Charakter; die Überlegenheit und die Logik von Duports Vermächtnis, dem auch heute noch alle Eleven verpflichtet sind, erweist sich als unabdingbares kulturelles Erbe. Der so typisch «französische», schlackenfreie, und in jedem Moment auf jedem Bogenabschnitt dynamisch lenkbare Ton ist ein direktes Resultat des von Duport beschriebenen traditionellen Bogengriffs. Wie Gérard Hekking, der Lehrer meines eigenen Meisters Maurice Gendron, zu sagen pflegte: «Man kann vielleicht von verschiedenen Schulen sprechen, doch für mich gibt es nur zwei, la bonne et la mauvaise»! Das traditionelle französische Lehrkonzept ist erst vor wenigen Jahrzehnten aufgebrochen worden, doch immer noch sind namhafte und passionierte Lehrer Garanten für eine umfassende Ausbildung. Aber die soziologischen Gegebenheiten haben sich geändert: Die unzähligen Angebote von Meisterkursen, die ansehnlichen Stipendienmöglichkeiten, Leihgaben von interessanten Instrumenten und sehr viele Wettbewerbe helfen zwar mit, den steinigen Weg der Jungen zu erleichtern. Doch: behindern sie nicht vielleicht damit die Selbstfindung? Seit der Verabschiedung der eher autoritären Musikerziehung ist es fast überall auf der Welt Mode geworden, den Studenten einen Selfservice anzubieten: X machte dies, Y machte das, hier noch ein Beispiel von Z – à toi de décider! Diese Entwicklung führt natürlicherweise weit weg von der Eindeutigkeit einer «Schule». Doch stets definieren letztlich die Begabung, die Intelligenz, der anerzogene Stil und der Charakter die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit des Musikers. Konzerte mit grossen Cellisten und dem LSO im KKL Luzern Das schlaue Füchslein – Arthur Waser Preis Mittwoch, 2. und Donnerstag, 3. Dezember 2015 | 19.30 Uhr Edgar Moreau spielt Robert Schumann (1810 – 1856) Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 Königin von Saba & Schelomo Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. Januar 2016 | 19.30 Uhr Gautier Capuçon spielt Ernest Bloch (1880 – 1959), «Schelomo», hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester Zwischen Exil und Emigration Mittwoch, 27. Januar 2016 | 19.30 Uhr Christian Poltéra spielt Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957), Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur op. 37 Lieux retrouvés Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. März 2016 | 19.30 Uhr Steven Isserlis spielt Thomas Adès (*1971), «Lieux retrouvés» für Violoncello und Orchester, Uraufführung der orchesterbegleiteten Fassung – ein Kompositionsauftrag des Luzerner Sinfonieorchesters, der Los Angeles Philharmonic und der Britten Sinfonia Gabriel Fauré (1845 – 1924), Elegie op. 24 für Violoncello und Orchester Doppelkonzert Mittwoch, 20. und Donnerstag, 21. April 2016 | 19.30 Uhr Truls Mørk spielt Johannes Brahms (1833 – 1897) Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102 Beethoven im Dialog – Rezital Freitag, 10. Juni 2016 | 19.30 Uhr Antonio Meneses spielt Werke von Ludwig van Beethoven und Manuel de Falla, zusammen mit Maria João Pires, Klavier Walter Grimmer, ausgebildet von Maurice Gendron, Herausgeber seines künstlerischen Testamentes «L’Art du Violoncelle» (Schott), war Gründungsmitglied der Camerata Bern, Solocellist des Berner Sinfonieorchesters, Mitglied des Berner Streichquartetts und des Arion Trios. Er unterrichtete während 35 Jahren an den Hochschulen von Bern und Zürich. LSO MAGAZIN 2 | 2015 7 Ferruccio Busoni mit seinem Hund Giotto. Ferruccio Busoni im Schweizer Exil Die Werke Ferruccio Busonis bilden einen Schwerpunkt im Saisonprogramm 2015/16. Vor 100 Jahren lebte der Komponist im Schweizer Exil in Zürich, eine Zeit, die von Resignation und Unsicherheit, aber auch von kompositorischem Reichtum und starken Freundschaften geprägt war. | LAURETO RODONI Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges befand sich Ferruccio Busoni in Berlin, wo er sich bereits seit 1894 aufhielt. Von Angst und Unsicherheit geplagt, entschloss er sich in den darauffolgenden Monaten zu einer Tournee in die Vereinigten Staaten. Diese Tournee hatte er bereits seit geraumer Zeit ins Auge gefasst, auch um Zeit zu finden, seine delikate Lage zu überdenken, als Mensch zwischen zwei Nationen, die sich nunmehr feindlich gegenüberstanden, und zwar Italien, wo er geboren und erzogen worden war, und Deutschland, seine Wahlheimat. Zu Beginn des neuen Jahres bestieg er das Schiff, das ihn nach Amerika brachte. Der leidvolle Aufenthalt in den Vereinigen Staaten und, paradoxerweise der Krieg, liessen ihn bewusst wer- 8 den, wie innig seine Bindung zu Europa war und welch grosses kulturelles Erbe er diesem Kontinent verdankte. Im Sommer entschloss er sich daher zurückzukehren, aber in jenem tragischen Augenblick, in dem er sich für die eine oder andere Seite entscheiden sollte, wusste er nicht wohin, auch deshalb nicht, weil er als persona non grata galt, sowohl in Deutschland als auch in Italien. Daher entschied er sich traurigen Herzens, die Schweiz um politisches Asyl anzusuchen. Anfang Oktober traf er in Zürich ein, wo er eine Wohnung in der Scheuchzerstrasse 36 bezog. Die Anwesenheit Volkmar Andreaes, eines hervorragenden Musikers und dynamischen Kulturschaffenden, den der grosse Pianist nur oberflächlich kannte und mit dem er seit 1907 aus Arbeitsgründen in Kontakt stand, war von nicht geringem Einfluss auf seine Entscheidung gewesen. Gebildet und weitblickend, wurde Andreae sofort ein unverzichtbarer Bezugspunkt in künstlerischer, beruflicher und menschlicher Hinsicht. Er verstand, welch wichtige kulturelle Aufgabe Busoni in Zürich wahrnehmen konnte und setzte sich dafür ein, dass der Exilant in das musikalische Leben der Stadt integriert würde. Die ersten Monate im Exil waren für Busoni eine arge psychische Belastung. Mit Entschiedenheit kämpfte er gegen Einsamkeit und Isolation. Busoni plante mit unerschütterlicher Entschlossenheit seine Konzerttätigkeit für das nächste Frühjahr, nahm die philologischen und kompositorischen Arbeiten wieder auf, stellte Nachforschungen über den Faust-Mythos an, revidierte seine musikalische Ästhetik, betrieb sein Studium am Klavier und wirkte auch als Klavierlehrer. Er war fest entschlossen, seinen künstlerischen Weg mit Ausdauer weiterzugehen, den er mit der stilistischen Wende des Jahres 1907 eingeschlagen hatte. Nach der Fertigstellung einer kurzen, aber dichten sinfonischen Arbeit auf der Grundlage eines indianischen Themas aus Amerika, dem «Gesang vom Reigen der Geister», nahm er die Komposition des szenischen Capriccios «Arlecchino» in Angriff. Seine Kräfte konzentrierte der Komponist jedoch vor allem auf «Doktor Faust». In der Schweiz hätte er seine Konzerttätigkeit reduzieren können, aber die prekäre wirtschaftliche Situation, besonders vom Sommer 1916 an, erlaubte es nicht. Die Leidenschaft für ausgefallene Bücher, von denen er Hunderte in Zürich erwarb, der Wunsch, eine Aufführung des «Doktor Faust» zu finanzieren, der Erwerb von Bildern und einer Glasharmonika, der hohe Lebensstandard, das chronische Unvermögen, mit Geld (das er verachtete) sinnvoll umzugehen, einige verfehlte Geldgeschäfte seines Berliner Wirtschaftsmanagers, die ihm angeborene Grosszügigkeit sind nur einige der Gründe für seine wirtschaftlichen Probleme, die nicht selten gelöst wurden durch die Weitherzigkeit und Bereitschaft des Bankiers Albert Biolley. Da er in Zürich ohne Sekretärin und Konzertagent lebte, war Busoni anfangs sein eigener Impresario. Vom Herbst 1916 an übernahm Biolley diese Aufgabe unaufdringlich, aber wirksam und ohne Gegenleistung. Er organisierte die Konzerte für Busoni in den Schweizer Städten, vor allem in den französischen Kantonen. Die gewaltsame Entfernung von seiner heimatlichen Umgebung, die Unmöglichkeit, die Grenzen der Schweiz zu verlassen, wurde von Busoni erlebt als ein Bruch in seinem Leben, was eine schmerzliche Verwundung seines Inneren hervorrief. An Hans Huber schrieb er: «Zwei Jahre sah ich nicht mein Haus, meine Bücher, meine Freunde, meine Gewohnheiten. Die gerade Linie ist unterbrochen. Der gastlichen Schweiz meine volle Dankbarkeit, aber heisst das Leben? Und in den Nebel der Ungewissheit hinein weiter, mit bald 51 Jahren?» Die Folgen dieser Entwurzelung auf sein psychisches Gleichgewicht, seine Identität und seine Weltanschauung waren schwerwiegend: Der Kosmopolit Busoni erkannte plötzlich, dass er keine Heimat hatte, in der er sich wiedererkannte und nach der er sich in jenem tragischen Lebensabschnitt so sehr sehnte. Zürich war ihm zu klein, zu provinziell, überschaubar, «von Langeweile umflort» und die ganze Schweiz empfand er als «eine Art Sanatorium». Bereits 1917 vertraute er Da Motta an, dass Zürich ihm nichts mehr zu bieten habe. Ein Mittel, dessen sich Busoni bediente, um die Auswirkungen des Exils etwas zu mildern, bestand darin, dass er um sich einen engen Freundeskreis scharte, der aus Schweizern und Ausländern im Exil bestand. Seine Wohnung in der Scheuchzerstrasse 36 wurde von den ersten Monaten an ein Sammelpunkt für hervorragende Musiker und Intellektuelle, unter ihnen die Schriftsteller Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, Jakob Wassermann, Franz Werfel, die Komponisten Ermanno Wolf-Ferrari, Othmar Schoeck, die Maler Hans Richter, Max Oppenheimer, Ettore Cosomati, die Dirigenten Otto Klemperer und Oskar Fried, der Verleger Paul Cassirer und der Philosoph Ernst Bloch. Wichtig war auch der Kontakt mit Freunden, die beschlossen hatten, in ihrer Heimat zu bleiben und mit denen er ständig in Briefverkehr stand. Seinem persönlichen Zeugnis zufolge schrieb er in Zürich über 5000 Briefe, etwa drei am Tag. Busoni verliess seine Wohnung am 9. September 1920 mit der Auszeichnung eines Ehrendoktors der philosophischen Fakultät, die ihm die Universität Zürich im August 1919 verlieh. Vor seiner Abreise schrieb er an Biolley: «On ne se sépare pas facilement du lieu, de la personne ou même de la chose auxquels on etait lié pendant un lustre! Mais c’est irrévocable. Et il faut bien se résigner. La résignation est l’effort plus heroïque et douloureux, dont l’âme humaine soit capable.» Sinfoniekonzerte mit Werken von Ferruccio Busoni im KKL Luzern Reigen der Geister Mittwoch, 18. und Donnerstag, 19. November 2015 | 19.30 Uhr Luzerner Sinfonieorchester LSO | James Gaffigan, Chefdirigent Vadim Gluzman, Violine Ferruccio Busoni (1866 – 1924) «Gesang vom Reigen der Geister» op. 47 und Werke von Bohuslav Martinů und Johannes Brahms Busonis Klaviermonument Mittwoch, 17. und Donnerstag, 18. Februar 2016 | 19.30 Uhr Luzerner Sinfonieorchester LSO | Ensemble Corund | Stephen Smith, Choreinstudierung | James Gaffigan, Chefdirigent | Kun Woo Paik, Klavier Franz Schubert (1797 – 1828) Messe Nr. 2 G-Dur D 167 Ferruccio Busoni (1866 – 1924) Konzert für Klavier und Orchester mit Männerchor op. 39 Reformation Mittwoch, 2. und Donnerstag, 3. März 2016 | 19.30 Uhr Luzerner Sinfonieorchester LSO | James Gaffigan, Chefdirigent Alina Ibragimova, Violine Ferruccio Busoni (1866 – 1924) Nocturne symphonique op. 43 und Werke von R. Schumann, J.E. Kuhl und F. Mendelssohn Bartholdy Lieux retrouvés Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. März 2016, 19.30 Uhr Luzerner Sinfonieorchester LSO | Thomas Adès, Leitung Steven Isserlis, Violoncello Ferruccio Busoni (1866 – 1924) Berceuse élégiaque op. 42 und Werke von Th. Adès, G. Fauré und C. Franck Laureto Rodoni ist freischaffender Musikjournalist und Busoni-Experte. Der Text ist eine gekürzte und übersetzte Fassung seines Artikels «Die gerade Linie ist unterbrochen. L’esilio di Busoni a Zurigo, 1915 – 1920». LSO MAGAZIN 2 | 2015 9 Der jüdischen Seele abgelauscht Den beiden Werken gemeinsam ist der biblische Stoff um König Salomon. In der musikalischen Übertragung aber beschreiten Ernest Blochs Hebräische Rhapsodie und Ottorino Respighis Ballettmusik ganz unterschiedliche Wege. Das liegt auch an der individuellen Verinnerlichung des jüdischen Tons. | DAVID KOCH Eine zentrale Rolle im Schaffen von Ernest Bloch (1880 – 1959) nehmen die Orchesterstücke ein, die Mitte der 1910er-Jahre noch vor der Auswanderung des Komponisten nach Amerika entstanden sind und gemeinhin als «jüdischer Zyklus» – oder zumindest als Teil davon – zusammengefasst werden: die «Trois poèmes juifs», die Sinfonie «Israel» und die Hebräische Rhapsodie «Schelomo». Mit ihnen versuchte der in Genf geborene Sohn eines jüdischen Uhrenhändlers eine national-jüdische Musik zu schreiben, die ganz aus dem alttestamentarischen Geist erfunden ist. Viel zitiert sind Blochs Äusserungen dazu: «Die jüdische Seele interessiert mich, die rätselhafte, glühende, bewegte Seele, die ich durch die Bibel hindurch schwingen fühle […].» Er habe nur «einer inneren Stimme gelauscht», fährt er fort, «tief, geheim, drängend, brennend, einem Instinkt viel mehr als einer kalten und trockenen Vernunft, einer Stimme, die von sehr weit zu kommen schien». Ernest Bloch trug Entscheidendes zur Emanzipation der jüdischen Kunstmusik in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bei. Er tat dies nun losgelöst von der nationalen Schule der jüdischen Musik in Russland, worin deren Entwicklung bzw. Wiederbelebung mehrheitlich gründet. Das Einbeziehen individueller stilistischer Elemente rückte bei Bloch an die Stelle von rein äusserlichen Traditionseinflüssen, von «mehr oder weniger authentischen Melodien», so die Worte des Komponisten. Dabei gehe es ihm weder um eine Rehabilitierung der historischen jüdischen Musik noch um eine «archäologische» Erneuerung mit Hilfe «orientalischer Formeln». Gleichwohl bezeichnet ihn die angelsächsische Literatur gern als «a Hebrew prophet», wie überhaupt seinem Wirken musikgeschichtliche Bedeutung attestiert wird. Exemplarisch für Blochs «Werke jüdischen Charakters», wie sie der deutsch-israelische Musikwissenschaftler Peter Gradenwitz umschreibt, steht die Hebräische Rhapsodie «Schelomo» für Violoncello und Orchester, die im Konzert des Luzerner Sinfo- 10 nieorchesters mit dem Solisten Gautier Capuçon zur Aufführung gelangen wird. Beispielhaft ist das Anfang 1916 vollendete Stück deshalb, weil Bloch darin das hebräische Wort unmittelbar auf die Musik übertrug. Zunächst hatte er beabsichtigt, verschiedene Teile des dem König Salomo zugeschriebenen Buches «Kohelet» (Prediger) für Singstimme und Orchester zu setzen. Möglicherweise hätte diese Übertragung eine schlüssigere Lösung abgegeben, da er aber der hebräischen Sprache nicht genug mächtig war und eine deutsche, französische oder englische Übersetzung dem musikalischen Ausdruck nicht gerecht geworden wäre, liess er die Idee einer vokalen Fassung fallen. Auf Anregung des damals nach Genf übersiedelten Cellisten Alexandre Barjansky entschied sich Bloch schliesslich für eine instrumentale Vertonung, die auf die Dramaturgie und Suggestionskraft, aber insbesondere auch auf die musikalische Diktion der alttestamentarischen Vorgabe baute. Besonders deutlich tritt der Textbezug im wiederkehrenden Monolog des Soloinstruments als Stimme Salomos hervor: Es sind die weisen Gedanken des Königs, meist wehmütig, gar resignierend, und nur selten hoffnungsfroh und in Freude über das eigene Dasein, die in kreisförmiger Wiederkehr die dreiteilige Anlage des Stückes durchlaufen. Der Prediger steht im Dialog mit dem gross besetzten Orchester als Abbild der Aussenwelt. Eine klangfarbenreiche Instrumentation prägen seine Faktur bis hin zur Andeutung des Schofarrufes, des Widderhorns, das an bestimmten jüdischen Festtagen geblasen wurde. Eher vordergründig wird der jüdische Ton in den archaisierenden Quintfolgen und in der Melodik, im häufigen Gebrauch von Halbton und übermässiger Sekunde, manifest. Aber reicht dieses charakteristische Kolorit für die Erkennbarkeit von jüdischer Musik bereits aus oder sind es vielmehr die programmatischen Erläuterungen des Komponisten im Werktitel, welche wiederum ihrerseits assoziieren, jüdische Musik zu hören? Doch: Über was definiert sich jüdische Musik? Der kleinste ge- «The Visit of the Queen of Sheba to King Solomon», Edward Poynter meinsame Nenner für die Beantwortung dieser Frage bestehe in der Ausprägung eines «nationalen Idioms», durch das die Musik identifizierbar wäre, sagt die deutsche Musikwissenschaftlerin Beate Schröder-Nauenburg. Genährt werde ein solches, so die Autorin, vor allem durch musikalische Primärquellen, nämlich durch sakrale Musik und Folkloristik. Wobei gerade in der Provenienz und Bedeutung dieser Gebrauchsmusik die vage Unterscheidung der hebräischen von der jüdischen Musik diskutiert wird. So beruft sich Bloch im Mittelteil seiner Hebräischen Rhapsodie konkret auf ein liturgisches Motiv, das ihm sein Vater einst auf Hebräisch vorgesungen hatte. Auch Ottorino Respighi (1879 – 1836) bedient sich in seiner 1931 entstandenen Ballettmusik «Belkis, regina di Saba», die in Auszügen ebenfalls im Konzert zu hören sein wird, eines biblischen Stoffes. Das Werk schildert den Besuch der morgenländischen Königin am Hofe Salomos in Jerusalem – es ist ein Sujet, auf das bereits Georg Friedrich Händel in seinem Oratorium «Solomon» zurückgegriffen hatte. Im Gegensatz zu Blochs subjektiver Herangehensweise an die alttestamentarische Thematik vollzieht sich bei Respighi der Zugang gänzlich von aussen: Zum einen liess er sich zur Vertonung durch eine die Handlung bereits adaptierende Librettovorgabe anregen, zum anderen legte er sich dafür einen Fundus an hebräischen und orientalischen Motiven und Melodien an, um einer tradierten und durchaus als archaisch empfundenen Musiksprache gerecht zu werden. Ähnlich ist er in den Werken aus den Jahren zuvor mit der Gregorianik verfahren, indem er diese aus ihrer liturgischen Bindung zu entheben und das Melos in einen neuen klanglichen Kontext einzubetten beabsichtigt hatte. Das Resultat ist ein abendfüllendes Ballett mit grossem szenischem Aufwand und einer riesigen Orchesterbesetzung, angereichert mit exotischem Schlagwerk, Chor und Sprecher. Hier wird mit der Ankunft der Königin Belkis eine ungehemmte Intensität an Lebenslust zelebriert bis hin zum orgiastischen Finale. Geschätzte tausend Aufführende sollen an der Uraufführung des Stücks im Januar 1932 in der Mailänder Scala mitgewirkt haben. Was für ein Gegenstück zu Salomos schierer Verzweiflung in Blochs Hebräischer Rhapsodie! Königin von Saba & Schelomo Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. Januar 2016 | 19.30 Uhr KKL Luzern, Konzertsaal Luzerner Sinfonieorchester LSO | Andrey Boreyko, Leitung Gautier Capuçon, Violoncello Ottorino Respighi (1879 – 1936) «Belkis, Regina di Saba», Auszüge aus der Ballettmusik Ernest Bloch (1880 – 1959) «Schelomo», Hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester Antonín Dvořák (1841 – 1904) Sinfonie Nr. 7 d-Moll op. 70 Gastspiel: Concertgebouw Amsterdam – Niederlande Sonntag, 17. Januar 2016 | 11.00 Uhr David Koch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bibliothek und am Institut für Forschung & Entwicklung der Hochschule Luzern – Musik. LSO MAGAZIN 2 | 2015 11 Reisen und Hymnen Das Luzerner Sinfonieorchester setzt sein Engagement für die zeitgenössische Musik fort, demnächst mit Uraufführungen der Schweizerin Katharina Rosenberger und des jungen Deutschen Jan Esra Kuhl. | THOMAS MEYER Katharina Rosenberger Jan Esra Kuhl «Zwischen Exil und Emigration» lautet der Titel des Sinfoniekonzerts, in dem Werke von Erich Wolfgang Korngold und Béla Bartók erklingen. Beide gingen einst auf der Flucht vor den Nazis ins amerikanische Exil, Korngold konnte dabei an seine erfolgreichen Hollywood-Filmmusiken anknüpfen, für Bartók war die Situation weitaus beschwerlicher; 1945 starb er in New York an Leukämie. Auch die Schweizer Komponistin Katharina Rosenberger lebt seit Längerem in den USA, aber natürlich sei ihre Situation, wie sie sagt, in keiner Weise mit jener Korngolds und Bartóks vergleichbar. Nicht aus Not wählte sie den Weg über den Atlantik, sondern erst einmal, um bei Tristan Murail in New York zu studieren – und danach fand sie 2008 in San Diego jene Universitätsstelle als Kompositionsprofessorin, die sie noch heute innehat. So unterschiedlich also die Schicksale sind, so ist Rosenberger doch mit dem Thema Migration vertraut. Mit ihren Studenten in Kalifornien diskutiert sie immer wieder darüber, denn eigentlich stammt ja jeder Amerikaner von irgendwo anders. Aber auch ihre eigene Familiengeschichte ist davon geprägt. Ein Käser namens Rosenberger aus Tuggen wanderte einst im 19. Jahrhundert nach Ostpreussen aus, um dort sein Glück zu versuchen – und er blieb, seine Söhne auch, alles Käser, bis der Grossvater der Komponistin schliesslich mit seiner Familie im Weltkrieg vor den russischen Truppen fliehen musste. Aus dem kleinen Städtchen Ragnit (heute Neman) an der Memel gelangte er über weite und gefährliche Wege schliesslich zurück in die Schweiz. Daran erinnert sich Katharina Rosenberger in ihrem neuen Orchesterstück. Zwischen den weit gezogenen Klangwällen, die sich wogenartig aufbauen und vergehen, hört man disparatere Klänge: Sie transferieren die Geräusche des Kofferpackens und Kistenschiebens, des Atmens und Gehens, die Rosenberger aus ihrem eigenen Leben zwischen Amerika und Europa kennt, in den Orchesterklang hinüber, sie zeugen so vom Reisen, vom Unterwegssein, vom Verlassen heimatlicher Orte und vom Auffinden eines neuen Zuhause. Das Werk erzählt so von Bewegungen, von Räumen und Klangräumen. Wir als Hörende werden mitten hineingenommen. Das Reisen und Sich-Bewegen in Klangräumen ist ohnehin ein zentrales Thema in Rosenbergers Schaffen. In ihren Installationen wie kürzlich in Berlin mit «Viva Voce» verbindet sie die Körperlichkeit der menschlichen Stimme mit der Befindlichkeit im Raum, fügt Video- und Theaterelemente bei, gestaltet die Elektronik interaktiv, so dass auch das Publikum teilhaben kann – und sie flicht auch da ihre eigene Biografie mit hinein. «Mit der Einbringung des Autobiografischen möchte ich einerseits die Kluft zwischen dem Publikum und der Künstlerin auf der Bühne entmystifizieren und so die Besucher näher an das kreative Denken und Handeln heranführen, andererseits gerade den Mut zum Künstlerdasein unterstreichen», sagt sie dazu. Das mag zumindest teilweise auch für ihr neues Orchesterstück gelten. Es ist übrigens eines jener «Œuvres Suisses», die in diesen Saisons bei mehreren Orchestern erklingen, und damit Teil jener Initiative der Pro Helvetia und des Verbands Schweizerischer Berufsorchester, durch die die neue Schweizer Orchestermusik gefördert werden soll. Vergangene Saison hat das LSO in diesem Rahmen bereits Michael Jarrells «Spuren», ein Konzert für Streichquartett und Orchester, uraufgeführt. Der zweite Kompositionsauftrag kam durch eine Auszeichnung der Art Mentor Foundation Lucerne zustande. Die Luzerner Stiftung vergibt in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Sinfonieorchester alle zwei Jahre einen «Award for Young Composers». Im März 2014 war im KKL das Werk der Italienerin Francesca Verunelli zu hören. Heuer erhielt der deutsche Komponist Jan Esra Kuhl den Zuschlag. Der 1988 in Trier geborene Musiker ist auch 12 ausgebildeter Organist und Kirchenmusiker und beendet demnächst sein Masterstudium Komposition in Köln. Allerdings bringt er schon ein rechtes Portfolio an Stücken mit, das ihn als originellen Kopf ausweist. Sein ehemaliger Lehrer Jörg Widmann, seinerseits als Composer in Residence des Lucerne Festival bestens bekannt, meinte einmal über eine Komposition seines Schülers: «Das ist etwas Eigenes. Das habe ich so noch nicht gehört.» Tatsächlich sucht Kuhl das Unerhörte. In seinem Stück «Wendeltreppe» für Orgel und Elektronik zum Beispiel verwendet er die abwärtslaufende und ständig verschoben wiederkehrende, dabei jedoch gegenläufig harmonisierte «ewige Tonleiter» aus Bachs Orgelphantasie g-Moll. Sie erklingt auf der Orgel und wird mit ihrem elektronischen Spiegelbild konfrontiert. Treppauf und treppab geht’s und auf Spiralgängen in die Mikrotonalität hinein – mit durchaus schwindelerregendem Effekt. Kuhl hegt, wie er sagt, eine Faszination für die Quintfallsequenz, einer traditionellen, vor allem im Barock viel verwendeten harmonischen Formel. Sie werde auch in seiner neuen Orchesterkomposition für Luzern eine wesentliche Rolle spielen. Er liebt es, solche vertrauten Elemente aus der Musikgeschichte aufzugreifen und ihnen in seinen Stücken eine neue Identität zu geben. In dieser Weise möchte Kuhl auch mit dem Orchesterapparat arbeiten: Wenn er schon diesen grossartigen Klangkörper zur Verfügung habe, wolle er ihn, so wie er sei und mit allem, was er transportiere und ausstrahle, auch nutzen, ihn aber trotzdem in eine eigene Richtung lenken. Zur Besetzung hinzu, die sich an Mendelssohns Reformationssinfonie im selben Konzert anlehnt, kommt ein Synthesizer, der auch Klangelemente aus der Popmusik beisteuern wird. Das Stück, so viel freilich war klar, werde etwas Hymnisches und Feierliches haben – «ein Pathos, vor dem ich mich nicht scheue, sondern das ich sogar suche. Das Orchester darf sich hier ruhig feiern.» Zwischen Exil und Emigration Mittwoch, 27. Januar 2016 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Luzerner Sinfonieorchester LSO Junge Philharmonie Zentralschweiz, Orchester der Hochschule Luzern Steven Sloane, Leitung | Christian Poltéra, Violoncello Katharina Rosenberger (*1971) Ein neues Orchesterwerk, Uraufführung im Rahmen von «Œuvres Suisses», einem gemeinsamen Projekt von Pro Helvetia und dem Verband Schweizerischer Berufsorchester Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957) Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur op. 37 Béla Bartók (1881 – 1945) Konzert für Orchester Reformation Mittwoch, 2. und Donnerstag, 3. März 2016 | 19.30 Uhr KKL Luzern, Konzertsaal Luzerner Sinfonieorchester LSO | James Gaffigan, Chefdirigent Alina Ibragimova, Violine Ferruccio Busoni (1866 – 1924) Nocturne symphonique op. 43 Robert Schumann (1810 – 1856) Konzert für Violine und Orchester d-Moll Jan Esra Kuhl (*1988) Uraufführung einer neuen Komposition des Gewinners des ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE AWARD FOR YOUNG COMPOSERS 2015 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107 «Reformation» Orchester und Freunde LSO reisen nach Istanbul Am 22. April 2016 gibt das LSO sein Debüt in der türkischen Metropole Istanbul. Die Freunde LSO haben die Möglichkeit, das Orchester, James Gaffigan und die wunderbaren Solisten Vilde Frang und Truls Mørk zu begleiten. Nebst dem Konzert im berühmtesten Kulturzentrum der Türkei, der İş Sanat Concert Hall in Istanbul, bleibt Zeit, die eindrucksvolle Stadt zu erleben, in der Orient und Okzident verschmelzen. In der heimlichen Hauptstadt der Türkei am Bosporus, in der eine aufregende Mischung zwischen jahrhundertalten Sehenswürdigkeiten und farbenfrohem Strassentreiben herrscht, werden wir Ihnen ein interessantes Rahmenprogramm zusammenstellen. Erleben Sie auf dieser Reise in eine der ältesten noch bestehenden Städte der Welt die unvergleichliche Atmosphäre an der Grenze von Asien und Europa. Die Reise rund um den 22. April 2016 wird zirka 4 Tage dauern. Reservieren Sie sich den Termin bereits jetzt. Das definitive Programm wird allen Freunde-LSO-Mitgliedern rechtzeitig zugestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter T 041 226 05 29. | MADELEINE SCHINDLER-CHUARD, PRÄSIDENTIN FREUNDE LSO Konzert Freitag, 22. April 2016 | 19.30 Uhr | İŞ Sanat Concert Hall, Istanbul Luzerner Sinfonieorchester LSO | James Gaffigan, Chefdirigent Vilde Frang, Violine | Truls Mørk, Violoncello Johannes Brahms (1833 – 1897) Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102 Antonín Dvořák (1841 – 1904) Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88 Thomas Meyer ist als freischaffender Musikjournalist und -publizist tätig, u.a. für Radio SRF 2 Kultur und verschiedene Musikzeitschriften. LSO MAGAZIN 2 | 2015 13 PULT AN PULT Dieses Mal im Gespräch: das Klarinetten-Team Stojan Krkuleski (Solo-Klarinette), Regula Schneider (stv. Solo-Klarinette/Es-Klarinette) und Vincent Hering (Klarinette/Bassklarinette). | DIANA LEHNERT Stojan Krkuleski, Regula Schneider, Vincent Hering (v.l.n.r.) Wie seid ihr zur Klarinette gekommen? Stojan Krkuleski (SK): Mein Grossvater schlug mir vor, Querflöte zu lernen, weil man damit auch Bach und Händel spielen könne (Anm. d. Red.: Zur Barockzeit gab es die Klarinette in der heutigen Form noch nicht). Ich konnte mir das auch vorstellen. Dann habe ich im Fernsehen die «Benny Goodman Story» gesehen und war total begeistert. Und in Serbien gibt es einen bekannten Klarinettisten, Boki Milošević, der Volksmusik spielt, und ich dachte, mit der Querflöte geht das so nicht. Also habe ich die Klarinette gewählt. Vincent Hering (VH): Bei mir hat es auch mit Swing und Benny Goodman zu tun. Ich finde die Klangfarben der Klarinette im Orchester auch heute noch die interessantesten. Mit der Klarinette kann man fast alles spielen, Volksmusik, Klassik, Jazz … Regula Schneider (RS): Bei mir war es absoluter Zufall. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, die ganze Familie hat in einer Blasmusik gespielt. Ich habe mit Freuden Blockflöte gespielt, später Geige, Klavier. Plötzlich brauchten sie dringend eine Klarinette in der Blasmusik. So habe ich mir das Klarinettenspiel selbst beigebracht und hatte auch erst ein Jahr vor meinem Studium professionellen Unterricht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. VH: Frankreich hat eine gewisse Schule. Viele Stücke wie die Sonaten von Poulenc oder Debussy wurden für das Conservatoire National Superieur de Paris komponiert, und die Art, wie man sie spielen soll, ist immer noch sehr von der Tradition beeinflusst. SK: Fast alle Professoren in Serbien haben in Paris oder München studiert. Ich habe in der Schweiz studiert, mein Lehrer François Benda zum Beispiel in Wien und Graz. Ich mag das wienerische Klangideal und versuche, das einfliessen zu lassen. RS: Vor 30 Jahren war es verpönt, die Systeme und Klangvorstellungen zu vermischen, entweder französisches oder deutschösterreichisches System. Das Klarinetten-Team ist international, ihr kommt aus Frankreich, Serbien und der Schweiz. Beeinflusst eure Herkunft und Ausbildung die Art und Weise des Spiels? RS: Ich höre meine Kollegen nur im Orchester und da bemerke ich keine Unterschiede. Beide haben auch an Schweizer Hochschulen studiert. Dazu kommt, dass wir alle französisches Klarinettensystem spielen. Eure Herzen schlagen ja alle auch für andere Musikrichtungen… RS: Ich war immer sehr breitbandig unterwegs in Sachen Musik. Als ich bereits fünf Jahre hier im Orchester war, habe ich mit 31 Jahren ein Sabbatical genommen und am Berklee College of Music in Boston Jazz-Gesang studiert. Ich sage immer: Ich verdiene das Geld mit Klassik und gebe es beim Jazz wieder aus. VH: Ich spiele viel Neue Musik. Während meiner Studienzeit ha- 14 Stojan, hast du noch einen Bezug zur serbischen Volksmusik? SK: Als ich im Gymnasium war, im Alter von 15 bis 19 Jahren, habe ich in einer Volksmusikgruppe gespielt. Dort habe ich viele serbische, mazedonische und montenegrinische Lieder gelernt, sogenannte Choros, Tanzstücke. Dann habe ich mich für klassische Musik entschieden und es wurde zu viel. Manchmal fragt mich jemand, kannst du ein bisschen für mich spielen, und das mache ich dann auch und denke «uff, das muss man echt üben», weil das sehr virtuos ist! be ich immer bei Lehrern studiert, die viel Interesse für Neue Musik gehabt haben. Viele Komponisten haben ihnen Stücke gewidmet. Ich finde, es macht Spass mit «lebenden» Komponisten zu arbeiten. Die ständige Entwicklung von neuen Effekten oder die Benutzung von Live Electronic ist für mich sehr spannend und motivierend. RS: Warst du nicht sogar der Erste, der ein Solistendiplom mit der Bassklarinette machen konnte? VH: Ja, in Bern, bei Ernesto Molinari. Er ist ein Wegbereiter in der zeitgenössischen Musik. Vincent und Stojan, ihr seid erst seit Kurzem im Luzerner Sinfonieorchester und habt das sogenannte Probejahr erfolgreich bestanden. Auf was wird in dieser Probezeit geachtet? RS: Es gibt ja wenige Berufe, bei denen man so eng «aufeinandersitzt». Das heisst, es muss vor allem in menschlicher Hinsicht stimmen. Was sonst vor allem geprüft wird: Ob das Zusammenspiel funktioniert, ob die Intonation stimmt – ich war da ziemlich streng, glaube ich (lacht). Aber am Ende entscheiden alle Holzbläser gemeinsam. Für mich war es eine sehr spezielle Situation. Fast 25 Jahre sass ich mit denselben Leuten am Pult und plötzlich kommen innerhalb von zwei Jahren zwei neue Leute, die meine Söhne sein könnten. Aber sie haben es mir einfach gemacht! SK: Vincent und ich waren beide Praktikanten im Berner Sinfonieorchester. Und der Berner Solo-Klarinettist meinte: Die, die wir nicht bei uns behalten können, schicken wir nach Luzern! (Lacht.) Jedenfalls mache ich jetzt nichts anderes als im Probejahr – gut vorbereitet sein und pünktlich erscheinen. Im Gegensatz zur Oboe hat die Klarinette ein einfaches Rohrblatt. Baut ihr das selbst wie die Oboisten? RS: Nein, wir kaufen nur! Es gibt schon noch wenige, die selbst bauen. Wir nehmen, was kommt! SK: Wenn ein Klarinettist eine Schachtel Blätter öffnet, liegen zehn Blätter auf dem Tisch, von denen zwei oder drei gut funktionieren und von den dreien sind sicher nicht alle gleich gut geeignet fürs Konzert. Ich kann maximal zwei Monate damit spielen. VH: Die Bassklarinette ist ein teures Feld! (Lacht.) Man bekommt nur fünf Blätter zum Preis von zehn für die Klarinette! Aber zum Glück arbeitet man jetzt an der Entwicklung von künstlichen Blättern, die länger halten! Hat man das Instrument ein Leben lang? RS: Ich möchte mir seit Jahren neue Instrumente kaufen, vor allem eine neue A-Klarinette. Sie ist 33 Jahre alt und die B-Klarinette 25 Jahre. Aber das ist natürlich ein Prozess … VH: Eigentlich ist es gut, alle zehn Jahre zu wechseln. RS: Mir fällt auf, dass Stojan immer neue Mundstücke und Birnen (Klarinettenteil unterhalb des Mundstückes) ausprobiert. SK: Als ich jünger war, dachte ich immer, es liegt an mir, wenn etwas nicht so funktionierte, wie ich wollte. Jetzt probiere ich viel mehr aus. Man spürt sofort, ob ein neues Mundstück passt oder nicht. Eine ganz neue Klarinette habe ich zum ersten Mal gekauft, als ich hier beim LSO anfing, vorher hatte ich OccasionModelle. Im ersten Konzert der neuen Saison steht Wagners «Ring» ohne Worte auf dem Programm. Wagner setzt gerne viele Klarinetten ein, vor allem auch die Bassklarinette. VH: Das stimmt, ich habe ein paar schöne Soli. Ich freue mich darauf! SK: Er schreibt für die B-Klarinette oft ziemlich hohe Passagen bis zum viergestrichenen C. RS: Ich glaube, Wagner hatte keinen guten Es-Klarinettisten (Lacht). Danke für das Gespräch! Gewinnspiel – 2 x 2 Konzertkarten Für das Sinfoniekonzert «Reformation» verlosen wir unter den richtigen Einsendungen 2 x 2 Karten! F. Mendelssohn Bartholdy zitiert im Finalsatz seiner Sinfonie Nr. 5 ein Kirchenlied Martin Luthers. Welches? A) Aus tiefer Not schrei ich zu dir B) Ein feste Burg ist unser Gott C) Nun freut euch, lieben Christen g’mein Senden Sie Ihre Antwort bis zum 30. November 2015 an: Luzerner Sinfonieorchester, Gewinnspiel, Pilatusstrasse 18, 6003 Luzern oder [email protected]. Viel Glück! Auflösung des letzten Rätsels: Die richtige Antwort war C. Sinfoniekonzert «Reformation» Mittwoch, 2. März 2016 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Luzerner Sinfonieorchester LSO | James Gaffigan, Chefdirigent Alina Ibragimova, Violine Ferruccio Busoni (1866 – 1924) Nocturne symphonique op. 43 Robert Schumann (1810 – 1856) Konzert für Violine und Orchester d-Moll Jan Esra Kuhl (*1988) Gewinner des ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE AWARD FOR YOUNG COMPOSERS 2015, Uraufführung eines neuen Werkes Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107 «Reformation» Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Barauszahlungen und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 30. November 2015. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. LSO MAGAZIN 2 | 2015 15 Die nächsten Veranstaltungen Mittwoch, 14. & Donnerstag, 15. Oktober 2015 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Sinfoniekonzert: Der «Ring» ohne Worte Luzerner Sinfonieorchester LSO/Gaffigan/Freire – Rachmaninoff/Wagner Sonntag, 25. Oktober 2015 | 11.00 Uhr | Südpol, Grosse Halle AHOI 1: Gwunderplunder – Familienkonzert mit Schlagzeug-Ensemble Bucher/Erni/Jenny/Kurmann Sonntag, 1. November 2015 | 11.00 Uhr | Foyer Luzerner Theater Kammermusik-Matinee 1 Blättler/Rüdishüli/Kühne/Conte/Boppart/Röhn – Bach/Mozart/Prokofjeff/Mahler/Seiber/Monti/Fucík/Kreisler/Noack Freitag, 6. November 2015 | 11.30 -13.30 Uhr | KKL Luzern, Probesaal/Konzertsaal Ensemble D – Konzertangebot für demenzkranke Menschen Einstimmung und Lunchkonzert – Schubert-Lieder Freitag, 6. November 2015 | 12.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Lunchkonzert 1 – Schubert-Lieder Peter/Deutsch – Schubert Mittwoch, 18. & Donnerstag, 19. November 2015 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Sinfoniekonzert: Der Reigen der Geister Luzerner Sinfonieorchester LSO/Gaffigan/Gluzman – Busoni/ Martinů/Brahms Mittwoch, 2. & Donnerstag, 3. Dezember 2015 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Sinfoniekonzert: Das schlaue Füchslein Luzerner Sinfonieorchester LSO/Slobodeniouk/Moreau – Janáček/Schumann/Brahms Donnerstag, 10. Dezember 2015 | 12.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Lunchkonzert 2 – Klänge von Brahms und Schumann Laloum/Sévère/Julien-Laferrière – Schumann/Brahms Mittwoch, 16. Dezember 2015 | 18.00 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Weihnachtssingen – Wunschzettel Luzerner Sinfonieorchester LSO/Luzerner Kantorei/Konzertchor KIangwerk Luzern/Kammerchor Luzern Jugendliche des VorAlpentheaters/Schüler der Musikschule Luzern – Geschichte und Weihnachtslieder zum Mitsingen Mittwoch, 16. Dezember 2015 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal Traditionelles Weihnachtssingen – Cherubini zu Weihnachten Luzerner Sinfonieorchester LSO/Luzerner Kantorei/Konzertchor KIangwerk Luzern/Kammerchor Luzern Labbate/Rex/Kalmbach/Corbo/Clerc – Cherubini/Weihnachtslieder zum Mitsingen Der schnellste Weg zu Ihren Tickets Buchen Sie ganz einfach online: www.sinfonieorchester.ch Rufen Sie uns an (LSO-Ticket-Line): 041 226 05 15 Oder senden Sie uns eine E-Mail: [email protected]