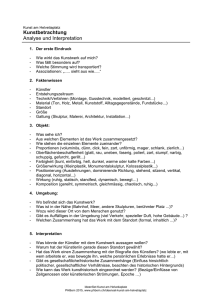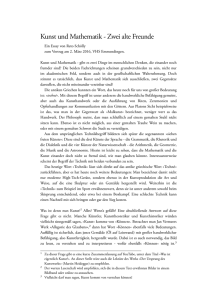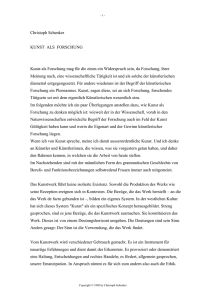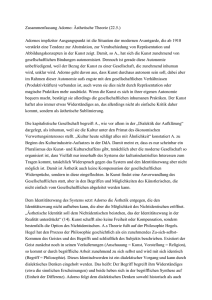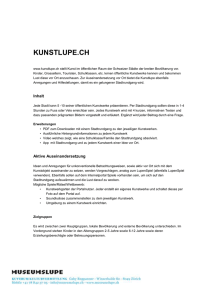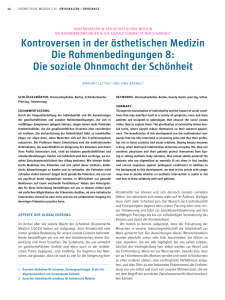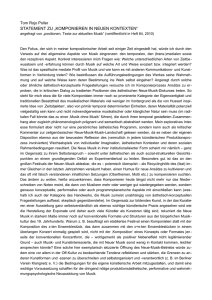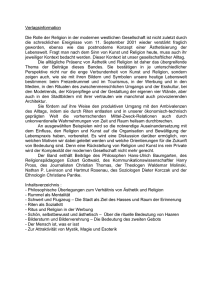Formatvorlagen Format 7
Werbung
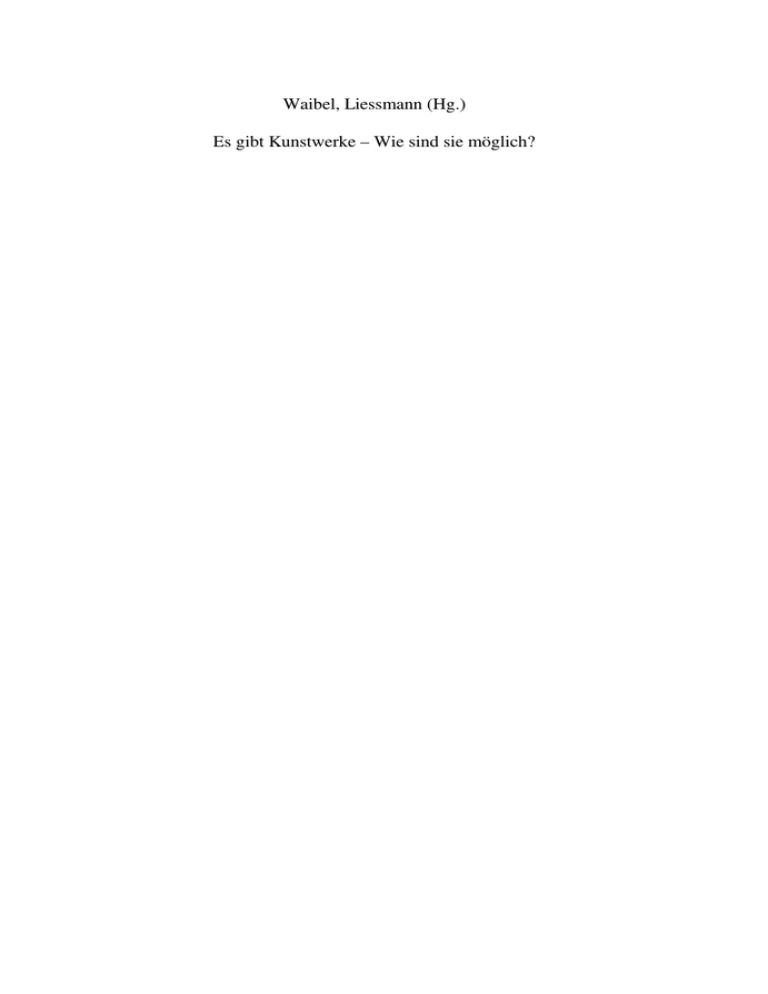
Waibel, Liessmann (Hg.) Es gibt Kunstwerke – Wie sind sie möglich? Violetta L. Waibel, Konrad Paul Liessmann (Hg.) Es gibt Kunstwerke – Wie sind sie möglich? Wilhelm Fink Gedruckt mit Unterstützung der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien und der Kulturabteilung der Stadt Wien – Wissenschafts- und Forschungsförderung Umschlagabbildung: Black wall background © Sergey Nivens – Fotolia.com Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten. © 2014 Wilhelm Fink, Paderborn (Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.fink.de Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München Printed in Germany Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 978-3-7705-5780-6 INHALTSVERZEICHNIS VIOLETTA L. WAIBEL Einleitung 7 THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES ÄSTHETISCHEN KONRAD PAUL LIESSMANN Kunstworte 23 BIRGIT RECKI Raffael ohne Hände? Kant, Lessing, Valéry und andere über Bedingungen der Möglichkeit von Kunst 33 DIETER MERSCH Kritik der Kunstphilosophie. Kleine Epistemologie künstlerischer Praxis 55 GÜNTER ZÖLLER „Die eigentlich metaphysische Thätigkeit des Menschen.“ Nietzsche über die ästhetische Rechtfertigung des Daseins der Welt 83 BILD UND SKULPTUR GERNOT BÖHME Die Landschaft im Blick 101 STEFAN MAJETSCHAK Metaphorische Bilder. Zur semantischen Struktur von Werken der Bildenden Kunst 113 ELISABETH VON SAMSONOW Die Plastizität des Realen. Geschichte und Gegenwart der Plastik/Skulptur 131 SCHAUSPIEL UND PERFORMANZ SUSANNE VALERIE GRANZER Ästhetik als Ethik. Schauspieler hautnah 151 ARNO BÖHLER Korporale Performanz 169 6 INHALTSVERZEICHNIS KONZEPTE DER SYNÄSTHESIE UND DES GESAMTKUNSTWERKS MĂDĂLINA DIACONU Synästhesie – ein ästhetisches Phänomen? 189 VIOLETTA L. WAIBEL Klang, Farbe, Emotion. Pierrot lunaire und die Synästhesie 209 GÜNTHER PÖLTNER Wagners Idee des Gesamtkunstwerks 241 WITTGENSTEIN UND DIE KUNST VOLKER GERHARDT Ethik und Ästhetik bei Wittgenstein 259 SABETH BUCHMANN Art after Wittgenstein. Über den Topos des ‚Unsagbaren‘ in der zeitgenössischen Kunst 275 HERBERT HRACHOVEC Der Stoff, aus dem die Räume sind. Kurt Kren filmt 291 LITERATUR KONRAD PAUL LIESSMANN Androgyn und überspannt. Stichworte zur geistigen Situation um 1900 303 HANS FEGER Darstellung des Denkens. Zum Problem der Genauigkeit im Essayismus von Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften 317 DANIELA STRIGL Parforceritt in die Moderne. Hugo von Hofmannsthals Reitergeschichte 333 VIOLETTA L. WAIBEL Scheitern des Tragischen? Anmerkungen zu Hölderlins Empedokles 353 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 381 AUTORINNEN- UND AUTORENVERZEICHNIS 385 VIOLETTA L. WAIBEL, UNIVERSITÄT WIEN Einleitung Dieser Band ist das Resultat einer Ringvorlesung über Ästhetik und Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, die in den Sommersemestern 2010 und 2011 gemeinsam von Konrad P. Liessmann und Violetta L. Waibel am Institut für Philosophie der Universität Wien durch geführt wurde. Im Sommersemester 2010 waren die Gäste aus dem Inland und dem Ausland dazu eingeladen, Beiträge zu dem Themenkomplex Bildtheorien – Kreativität – Synästhesiekonzepte beizusteuern. Das Sommersemester 2011 stand unter dem Motto Wiener Moderne – Wien Heute. Die beiden Vorlesungsreihen waren von der Neugier getragen, unterschiedliche aktuelle Zugänge zur ästhetischen Reflexion in der Philosophie durch renommierte Forscherinnen und Forscher1 zur Ästhetik zur Darstellung zu bringen und gemeinsam mit den Studierenden zu diskutieren. Es sollten verschiedenste philosophische Methoden und Richtungen zu Wort kommen, so die Wahrnehmungstheorie, Negativitätsästhetik, Dekonstruktion, Hermeneutik, Phänomenologie, Semiotik, Strukturalismus und Poststrukturalismus, Analytische Philosophie, sowie verschiedenste künstlerische Ausdrucksformen in den Blick gebracht werden, also Literatur, Bildende Kunst, Musik, Malerei, Installation, Tanz, Film, Alltagsästhetik. Im zweiten Teil der Ringvorlesung sollte ein besonderes Augenmerk auf die Kunst und deren ästhetische Reflexion in Wien gerichtet werden. Es galt, sich der Beeinflussung der Ästhetik durch Freud, durch Wittgenstein zuzuwenden und Künstler wie Musil, Hofmannsthal, Schönberg aber auch Philosophen wie Adorno in die Kunstbetrachtungen einzubeziehen. Der Titel der Ringvorlesung und des vorliegenden Bandes verdankt sich dem mittlerweile vergessenen ungarischen Philosophen Georg Lukács, der vor seiner Wendung zum Marxismus als bedeutender Essayist und Ästhetiker Aufmerksamkeit auf sich zog. Er hatte den frühen Entwurf einer Philosophie der Kunst mit folgender Frage eingeleitet: „Es gibt Kunstwerke – wie sind sie möglich?“ Eine Ästhetik, die, so Lukács, ohne „illegitime Voraussetzungen“ 1 In diesem Band sind alle Personenbezeichnungen, sofern nicht ohnehin die weibliche und männliche Form gewählt wurde, geschlechtsneutral zu verstehen. 8 VIOLETTA L. WAIBEL arbeiten will, also das „Faktum der Kunst“ in seiner Eigenart begreifen will, muss das Kunstwerk als ein Gebilde betrachten, das „rein durch sich“, unabhängig vom Prozess seiner Entstehung, begriffen werden muss. Das Kunstwerk ist durch seine reine Immanenz bestimmt, es ist ein in sich Abgeschlossenes, das keinen Bezug zur Wirklichkeit außerhalb seiner selbst hat. Aus der Perspektive des Kunstwerks erscheint diese Wirklichkeit als Nichtsein. Das Kunstwerk selbst aber ist aus keinen psychologischen oder sozialen Tatsachen ableitbar, es konstituiert sich, wie Lukács in einem späteren ästhetischen Entwurf ausführte, durch eine „ästhetische Setzung“. Wie immer Lukács versucht hat, diese Setzung zu entfalten: Es ist damit ein Problem angesprochen, das jede Ästhetik betrifft, die Kunst nicht als ein abgeleitetes, sondern als ein Phänomen sui generis zu fassen sucht. Oder, mit anderen und einfacheren Worten: Wodurch wird ein optischer oder akustischer Reizauslöser zu einem Kunstwerk? Wer setzt diese Setzung durch? Einige Antworten haben wir in diesem Band versammelt. Für den Band haben wir uns zu einer Anordnung der Beiträge entschlossen, die von der der Ringvorlesungen abweicht. Die historische Gliederung mit ihren jeweiligen Themenschwerpunkten wurde durch eine systematische abgelöst, die zunächst die „Theoretischen Perspektiven des Ästhetischen“ beleuchtet. Daran schließen sich Kapitel zu Kunstgattungen und zu Themenkomplexen an, so zu „Bild und Skulptur“, zu „Schauspiel und Performanz“, zu „Konzepten der Synästhesie und des Gesamtkunstwerks“, zu „Wittgenstein und die Kunst“ und schließlich zur „Literatur“. Theoretische Perspektiven des Ästhetischen Kunstworte nennt Konrad Paul Liessmann seinen Beitrag, mit dem der Reigen der in diesem Band versammelten Beiträge eröffnet wird. Er stimmt das Thema an, das der Ringvorlesung und diesem Band den Namen gab. „Es gibt Kunstwerke – wie sind sie möglich?“ fragt Liessmann mit Lukács. Feststeht für Lukács, Kunstwerke sind Setzungen, und sie sind nur durch Setzungen, Setzungen der unterschiedlichsten Formen. So stellt sich die Frage, ob Kunstwerke Setzungen sind, die für sich sprechen, die selbsterklärlich sind, oder ob es der Worte, der Kunstworte bedarf, die Kunstwerke allererst zum Sprechen bringen, diese kommentieren. Illegitime und legitime Kommentare gebe es, solche also, die über entfernte Kontexte der Kunst sprechen, und solche, die das Kunstwerk als solches kommentieren. Moderne Kunst zeichne sich für Arnold Gehlen wie für Theodor W. Adorno dadurch aus, dass sie mit zunehmender Entfernung von einer Gegenstandsdarstellung auch zunehmend sprachloser werden. Das aber mache ihre Kommentierungsbedürftigkeit aus. EINLEITUNG 9 Mit Arnold Gehlen werden daher drei Typen von Kunstkommentaren unterschieden, denen Liessmann noch einen vierten hinzufügt. Solche nämlich, die ein empfindsames Sprechen über Kunst sind, da sie die Empfindungen des Betrachters beim Anblick von Kunstwerken artikulieren. Davon ist ein urteilendes Sprechen über Kunst zu unterscheiden, wie es paradigmatisch mit Kants Theorie des Schönen und Erhabenen gegeben ist. Dieses Sprechen ist ein Begründen dessen, was sich im Betrachter als interesseloses Wohlgefallen manifestiert. Schließlich gibt es ein deutendes Sprechen über Kunstwerke, das über den dargestellten Gegenstand hinaus Mythen, Symbole, Allegorien oder Rätsel in den Blick bringt. Hegels Ästhetik repräsentiert diesen Typus des Sprechens über Kunst, dem das Kunstwerk ein Scheinen der Idee ist, die es in Sprache zu fassen gilt. Von diesen Typen, die alle voraussetzen, dass es sich bei dem, wovon die Rede ist, um Kunstwerke handelt, unterscheidet Liessmann eine weitere Form des Sprechens. Diese ist dann gegeben, wenn ein Ding, ein Alltagsgegenstand durch den Sprechakt allererst als Kunstwerk konstituiert wird, wie dies Marcel Duchamp und nach ihm viele andere realisiert haben. Liessmann nennt diesen Sprechakt, der allererst das Kunstwerk als dieses konstituiert, eine Beschwörung. Die Moderne begab und begibt sich in eine zunehmende Abhängigkeit von der Theorie. Der Kunstdiskurs sollte sich freilich, so Liessmann, nicht in eine Unmündigkeit des Beurteilens begeben, indem er sich aufwirft, jede Beliebigkeit zu rechtfertigen und zur Kunst zu erklären. Der Beitrag von Birgit Recki, Raffael ohne Hände? Kant, Lessing, Valéry und andere über Bedingungen der Möglichkeit von Kunst, untersucht die Frage der Leibvergessenheit in der Kunst, die seit Lessings prägnanten Worten vom Raffael ohne Hände in seiner Emilia Galotti zu einem vieldiskutierten Topos der Ästhetik wurde. Wenn das Geistige das Wesentliche der Kunst ausmacht, dann scheint es, als könne auf die sinnliche Ausführung des Kunstwerks verzichtet werden. Raffael wäre auch ohne Hände der größte Maler gewesen. Mit dem Hinweis darauf, dass auch moderne Konzeptkunst, die vorgibt, sich allein durch die Idee des Kunstwerks zu definieren und zu autorisieren, auf sinnliche Produktionsorgane angewiesen ist, die das Werk zur Ausführung bringen, sei es durch Künstlerwerkstätten, sei es durch externe Handwerker, verneint Recki die Möglichkeit eines rein geistigen Kunstwerks. Selbst von Kants Begriff des Geistigen in der Kunst lässt sich, so Recki, zeigen, dass dieser die Einheit von Sinnlichkeit und Geistigkeit impliziert. Kant war es, der als erster die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis gestellt hat und so auch die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Kunst nahelegte. Erkenntnis, Freiheit, künstlerische Produktion durch das Genie und ihre Rezeption fordern die Einheit von Natur und Kunst, von Sinnlichkeit und ästhetischer Idee im Geist. Geist ist ein von Kant eher selten gebrauchter Terminus, der, wie Recki herausarbeitet, diese Einheit repräsentiert. 10 VIOLETTA L. WAIBEL Dieter Mersch liefert mit seinem Beitrag eine Kritik der Kunstphilosophie mit der er eine Kleine Epistemologie künstlerischer Praxis vorlegt. Die Kunst der Moderne wendet sich mit einigen ihrer wichtigen Vertreter gegen eine Kunstauffassung, die sich von einer Philosophie der Kunst vereinnahmen lässt und aus metatheoretischer Perspektive Deutungshoheit über die Kunst beansprucht. Die Emanzipation der Kunst von Kunstkritik und Metatheorie verortet Mersch bereits bei Hegel, für den die Kunst neben Religion und Philosophie eine Wahrheit per se ist, auch wenn letztlich die Kunst durch die Philosophie aufgehoben wird. Damit tritt auch bei Hegel die alte Hierarchie wieder in Kraft, nach der das Wort und die Vernunft das Medium der Reflexion schlechthin darstellen. Immerhin räume Hegel der Phantasie und Einbildungskraft eine originäre Kraft der Produktivität ein. Einen entscheidenden Schritt sei Heidegger weitergegangen, indem er der Kunst eine neue epistemische Kraft zuschreibt, die sich vom Disegno der Renaissancekunst und ihrem Vorrang des Lineaments, der Form und der Figur deutlich absetzt. Insbesondere in Heideggers Schrift vom Ursprung des Kunstwerks ist es die poiesis, die die Episteme des Kunstwerks trägt. Form und Materialität, Grund und Figur, Aisthesis und Symbolisierung erhalten in Heideggers Kunstmetaphysik einen neuen Stellenwert, so Mersch. Kunst ist nach Heidegger Durchdringung, Verdichtung, Gründung von neuen Anfängen und ist so Stiftung von Wahrheit, Geschichtlichkeit, Zeitlichkeit. Durch den Vorzug des Sprachkunstwerks vor allen übrigen bleibe auch Heidegger in der Geringschätzung alles Sinnlichen diesseits der Sprache verhaftet, so dass er dem Visuellen, dem Klanglichen, dem Aisthetischen als solchem nicht die angemessene Aufmerksamkeit zu schenken vermag. Kunst als genuine Form der Erkenntnis werde erst mit Projekten wie der ’Pataphysik Al Jarrys in ihr eigentliches Recht gesetzt, indem das Wissenschaftsparadigma ad absurdum geführt wird. Die Kunst, die aus diesem Geist entsteht, schenkt dem Singulären, Fragilen, Vorübergehenden, Nebensächlichen seine Aufmerksamkeit. Sie ist Kunst, die sich und nur sich aussagt, die selbst auf das Paradigmatische verzichtet, das der Kunst und ihrer symbolischen Kraft zugeschrieben wird. Denn dem Paradigma als dem Einzelnen wohnt noch ein Überstieg zum Allgemeinen inne, das somit eine Vielzahl des Ungesagten mitsagt, was es zu überwinden gelte. Entgegen den empirischen Wissenschaften, die auf Verallgemeinerung zielen, gilt es für die moderne Kunst eine empeiría als Er-fahrung, als Wider-fahrnis zu gewinnen, die nichts als künstlerische Praxis „singulärer Paradigmata“ ist, wie Mersch es trefflich mit einem Oxymoron auf den Punkt bringt. Günter Zöller sichtet für seinen Beitrag „Die eigentlich metaphysische Thätigkeit des Menschen.“ Nietzsche über die ästhetische Rechtfertigung des Daseins der Welt Nietzsches gesamtes überliefertes Textkorpus, das im Zuge der Auseinandersetzung mit den Alten Griechen entstanden ist. Zöller zeigt die Vorstufen von Nietzsches Aufwertung der Kunst in den ästhetischen Spielarten des Deutschen Idealismus auf, die den Weg von einer marginalisierten Betrachtung der (handwerklichen) Künste in der Philosophie seit Platon bis hin EINLEITUNG 11 zur Aufwertung und Singularisierung der Kunst als eines ganzheitlichen Phänomens bahnten. Kunst wird bereits um 1800 zu einer Deutungsinstanz menschlicher Selbstverständigung, die durch die philosophische Ästhetik als genuine Leistung der Hochkultur anerkannt wird. Nietzsche entdeckt die therapeutische Kraft der Kunst gegen eine Wissenschaftswelt, die sich vom Leben abgekoppelt und verselbständigt hat. Die Gründe für diese kulturkritische Diagnose findet Nietzsche, wie bekannt, in Auseinandersetzung mit dem sokratischen Denken. Nietzsche verschreibt sich nicht einem Zurück zu den Ursprüngen, sondern sucht, so Zöller, nach einer Verträglichkeit von moderner Wissenschaft und einer Achtung für die genuinen Bedürfnisse des Lebens im emphatischen Sinne. Antike und Moderne werden einer parallelen Untersuchung unterzogen, um ein Remedium für die Gegenwartskultur zu gewinnen. Während der Lehrer Schopenhauer sich einem Nihilismus zuwendet, der Quietismus ist, gilt es für Nietzsche, eine aktive Bejahung des Lebens durch die Verwandlung von Leben in Kunst zu gestalten und zu rechtfertigen, im Zuge derer die Kunst die Rolle der Metaphysik übernimmt. Pate dafür steht wiederum Sokrates, der in Nietzsches Lesart angesichts der Verurteilung zum Tode seine vorige „Wissensgier“, die für das moderne Leben überhaupt leitend wurde, zurückgestellt und sich zuletzt mit Musik statt mit Dialektik beschäftigt habe. In Gottfried Benn sieht Zöller einen modernen Dichter, der nun seinerseits mit Nietzsche den Nihilismus durch Ästhetisierung zu überwinden suche. Bild und Skulptur Die Landschaft im Blick lautet der Titel des Beitrags von Gernot Böhme. Landschaft, so die These von Böhme, ist nicht, sie wird geschaffen durch den wahrnehmenden Blick, der sich mit Aufmerksamkeit einer Umgebung, einer Landschaft zuwendet und diese als ein Ganzes zu erfassen sucht. Durch den Blick der Kamera wird das stille Bild der Landschaft im Foto festgehalten, durch den Blick der Filmkamera entsteht bewegte Landschaft. Caspar David Friedrichs Rückenfiguren evozieren den Blick auf die Landschaft, die er als Maler zeigt, vielleicht auch auf das Bild von der Landschaft, das wir als Betrachter in den Blick nehmen. Nicht nur die Kamera, jedes andere Fahrzeug, der Zug, das Auto, das Motorrad erschaffen eine andere Art des Bildes von der Landschaft. Das Bild ist ein anderes beim passiven und beim aktiven Fahren. Die Spiegel, Rückspiegel, Seitenspiegel, der Blick durch die Frontscheibe eines Autos und die damit erzeugte Umrahmung kreieren für den Fahrer Multiperspektivität auf die Umgebung, die durchfahren wird. Minutiös untersucht Böhme die verschiedensten Blickerfahrungen, die Landschaft als stilles Bild, als bewegtes Bild erzeugen. Durch den flow perception, eine schnelle Bewe- 12 VIOLETTA L. WAIBEL gung durch den Raum, dynamisiert sich schließlich der Raum selbst. Der Vordergrund ist nicht mehr verschwommen, er wird abgeblendet, der schnelle Wechsel der Bilder erzeugt eine eigene Wirklichkeit. Stefan Majetschak weist in seinem Beitrag Metaphorische Bilder. Zur semantischen Struktur von Werken der Bildenden Kunst darauf hin, dass Kunstwerke immer (auch) Konstrukte sind, die nach bestimmten semantischen Mustern als Kunstwerke interpretiert werden. Was Kunstwerke sind, lässt sich nicht in allgemeiner Weise aussagen, da ihnen kein für alle gültiges Prädikat zugeschrieben werden kann, wie an klassischen Beispielen der Kunst des 20. oder 21. Jahrhunderts leicht zu demonstrieren ist. Ready mades, Gegenstände aus der Massenproduktion sind nicht per se Kunstwerke, sondern sie werden es durch eine Setzung des Künstlers und die interpretierende Wahrnehmung des Betrachters in einem Umfeld, das den Status eines Gegenstandes als Kunstwerk nahelegt. Dabei werden mehr oder weniger reflektierte semantische Regeln verfolgt wie Majetschak mit Danto zeigt. Überdies betont nun Majetschak über Danto hinaus, dass Kunstwerke als metaphorische Bilder gedeutet werden. Am Beispiel bildnerischer Werke wird genauer entwickelt, inwiefern die Struktur des Kunstwerks der Struktur der Metapher folgt; dadurch nämlich, dass das Kunstwerk etwas als etwas repräsentiert. Hat man sich entschlossen, einen Gegenstand als Kunstwerk zu interpretieren, so ist das Sehen ein anderes, ein genaueres Sehen, das sich auf Differenzierungen, Details und Deutungen einlässt, und das einem Alltagsgegenstand nicht entgegengebracht wird. Elisabeth von Samsonow legt mit ihrem Beitrag Die Plastizität des Realen. Geschichte und Gegenwart der Plastik/Skulptur vor. Sie legt die Funktion der Machtsicherung und des Machtmissbrauchs der traditionellen Skulptur als Bedingungen frei, die beinahe zum Untergang dieser alten Kunstgattung geführt hätten. Eine Reihe von Künstlern reflektiert dies. Sie antworten mit neuen Formen plastischer Arbeiten, die ihre Möglichkeiten bis an die Grenzen zum Umschlag in andere Darstellungsformen ausloten. Mike Kelley kuratierte 2004 eine Ausstellung „The Uncanny“, das Unheimliche, mit der er die überraschende Wiederkehr der anthropomorphen Plastik in unheimlichen Formen des Zweitkörpers herausarbeitete. Mit und gegen Kelley verteidigt Samsonow die These, dass das Unheimliche nur dann hervortritt, wenn die Gruselplastik oder Horrorstatue nicht einen unsterblichen Zweitkörper (Totenkulte) darstellt, sondern Individualität und Sterblichkeit anzeigt. Die Horrorplastik ist überdies, so der Beitrag, ein Ergebnis gesellschaftlich erzwungener Verschleierungen sexueller Interessen besonders an der Skulptur des Weiblichen. Die Brechung der Ähnlichkeit mit dem menschlichen Leib, der Ausschluss des Prinzips der Geburtlichkeit, so die These, mache die Skulptur zum Gegen-Stand, zum gemachten Ding. Sie finde ihre Fortsetzung in den modernen Fertilisations-, Selektions- und Gestationstechnologien. Das Prinzip des Machens und Fabrizierens hat die nachbildende Darstellung abgelöst und ist in zahlreiche Formen der Multimedialität aufgebrochen worden. Durchgesetzt hat sich die EINLEITUNG 13 Form der Installation, das Reale habe in den jüngeren Entwicklungen eine Aufwertung gegenüber dem Symbolischen erfahren. Der menschliche Leib ist selbst zum Labor des Plastischen, der Operation im buchstäblichen Sinn geworden. Schauspiel und Performanz Susanne Valerie Granzer vermittelt in ihrem Beitrag das spannende Verhältnis einer Ästhetik als Ethik. Schauspieler hautnah. Um sich dem Thema anzunähern, erinnert Granzer an den Mythos von der Büchse der Pandora, meist als Quell des Unglücks in der Welt in der Version Hesiods präsent. Die Theorie wird Praxis: Sie beschreibt das Spiel einer Szene aus Wedekinds Lulu. Die Büchse der Pandora zweier junger Schauspieler im Kontext ihres Vortrags für die Ringvorlesung. Sie stellt erinnernd die Szene, den Auftritt dar, reflektiert das hautnahe Tun der Schauspieler in ungewohnter Situation, nämlich im Vorlesungssaal, sie beschreibt die Verwandlung, die sich in den Spielern und mit dem Auditorium zum (Theater)Publikum vollzieht. Am Ort der Reflexion, dem universitären Studium arbeitet Granzer die verdrängte Leiblichkeit im Denken heraus. Der Schauspieler, der denkt, der denkend kontrollieren will, der sich nicht auf die Situation der unentrinnbaren Ausgesetztheit im Spiel einlässt, so betont Granzer, wird nicht geglückt spielen können. Das Schauspiel fordert, die bewusste, Ich-gesteuerte Kontrolle außer Kraft zu setzen, um mit seiner ganzen Leiblichkeit, mit seiner leiblichen Präsenz zu agieren. Das verlangt, alle Vermögen zur Reife zu bringen, um im Augenblick des Spiels aus seinen Möglichkeiten heraus es spielen, es sich ereignen zu lassen. Das Schauspiel ist überdies nicht nur Spiel mit sich, es ist ein Spiel, ein sich Ereignen mit anderen. Die eigentliche Originalität des Schauspiels ereigne sich weder in dem einen, noch in dem anderen Individuum, sondern in der Beziehung der Personen in geglückten Augen-Blicken, im Eros des Spiels. Subjekte sind im Spiel nie nur Macht, sondern sind sub-jectum, Zugrundeliegende, die sich wechselseitig durchlässig sind, sich in dieser Weise durchdringen und nahe sind, und so ein Zwischen erzeugen, in dem Ästhetik ohne Ethik nicht möglich ist. Denn das Zwischen fordert eine Zone der wertschätzenden Zuwendung zum Anderen, um gemeinsam das performative Ausgesetztsein glückend sich ereignen zu lassen. Arno Böhler wendet sich mit seinem Beitrag Korporale Performanz der Kraft der Bilder zu, die Körper, Leiber im Raum aussagen. Nach der Möglichkeit von Kunstwerken gefragt, ist ihm Erinnern, im Gedächtnis Behalten, ist ihm die Mnemosyne, die das Kunstwerk ist, weniger Vergangenheitsarbeit als vielmehr eine Schau in die Zukunft, mit Nietzsche eine „promesse de bonheur“, ein Versprechen, das sich nicht selbst erklärt, das sich unlesbar gibt und 14 VIOLETTA L. WAIBEL dennoch nach einer Deutung verlangt. Kunst ist nicht bloß Denken und Verstehen, sie sucht den Reiz, die Berührung, den Affekt, sie bringt, nochmals mit Nietzsche gesprochen, jede Tätigkeit zu einem Tanzen. Am Beispiel der Tanzperformance fault lines mit Philipp Gehmacher, Meg Stuart und Vladimir Miller analysiert und deutet Böhler minutiös das für unvorbereitete Beobachter unverständlich minimalistische Geschehen von drei Gestalten auf der Bühne, von denen meist nur zwei mit wenigen, umso bedeutungsvolleren Bewegungen interagieren und durch Blicke und Gesten Beziehungen zueinander schaffen und wieder aufheben, ein Ablauf, der sich mehrmals wiederholt. Schließlich wird der reale Bühnenraum, der durch die Bewegungen, Blicke und Berührungen als Nähe und Distanz erfahren wird, medial in einen virtuellen Raum erweitert, indem die Live-Akteure mit Videoaufzeichnungen ihrer eigenen Bewegungen konfrontiert werden. Fault lines, Bruchlinien, erzeugt Verstörung, betörende, schöne Verstörung, wie Böhler abschließend konstatiert, Gefühle, die zum Denken drängen, zum Nachdenken, die ein Versprechen verheißen. Schließlich ist Postmoderne, mit Lyotard, das „Paradox der Vorzukunft“. Konzepte der Synästhesie und des Gesamtkunstwerks Synästhesie – ein ästhetisches Phänomen? Diese Frage legt sich Mădălina Diaconu zur Untersuchung vor. Synästhesie gibt es, avant la lettre, schon seit alters her. Erst im 19. Jahrhundert bezeichnet es abnormale Wahrnehmungsprozesse bei Ausnahmepersonen. Die Augen-Orgel, das Farbklavier gewinnt in der Kunst an Bedeutung. Synästhesie wird in der Romantik zum Kunstprinzip erhoben. Doch Diaconu betont, dass es echte idiopathische, stabile und überprüfbare Synästhesie selbst unter Künstlern, die sich als Synästheten verstehen, nur selten gibt, wie sich an einigen Persönlichkeiten anhand der Forschung ausweisen lässt. Echte Synästhesie ist auch nicht Kunst, sie ist von psychologischem Interesse und ist eher eine idiosynkratische Privatsprache. Die Kunst nennt Sinnesverknüpfungen Synästhesie, die in Wahrheit auf Metaphern und Assoziationen beruhen. Sah man lange eine qualitative Differenz zwischen normalen Sinnesverknüpfungen und der echten Synästhesie, so vermutet die neuere Forschung einen bloß quantitativen Unterschied der beiden synästhetischen Erscheinungen. Violetta L. Waibel untersucht in ihrem Beitrag Klang, Farbe, Emotion. ‚Pierrot lunaire‘ und die Synästhesie das epochemachende Werk Arnold Schönbergs als ein solches, das den Geist der Wiener Kulturtradition ebenso anzeigt, wie es unter dem Eindruck der neuen Erfahrungen des Komponisten in Berlin steht. Die Faszination Schönbergs an Wassily Kandinskys synästhetischen kunsttheoretischen Betrachtungen dürfte sich in dessen kurzer Phase EINLEITUNG 15 eines expressionistischen Komponierens auch im Pierrot lunaire niedergeschlagen haben. Dafür wird eine Reihe von Indizien angeführt. Synästhesie heißt hier eine künstlerische Ausdrucksform, die eine Verschmelzung von verschiedenen sinnlichen Artikulationen zu erzielen versucht. Vor dieser Folie wird die Textur der deutschen Fassung der Dichtung untersucht, von der sich Schönberg, wie er selbst betont, in einem bewusst unbewussten Prozess zur Komposition inspirieren ließ. Am Leitfaden einer Rezension, die Theodor W. Adorno zum Pierrot lunaire verfasst hat, wird überdies das dreiteilige Textkorpus in seiner Binnenstruktur und seinen emotionalen Valeurs und Ausdrucksformen näherhin betrachtet. Günther Pöltner beschäftigt sich in seinem Beitrag mit Wagners Idee des Gesamtkunstwerks. Er arbeitet zunächst heraus, dass Wagners Konzept, das allen geläufigen Urteilen zufolge als gescheitert angesehen werden muss, als ein Unternehmen zu verstehen ist, die traditionell der Religion zukommende Rolle, eine universale Gemeinschaft zu bilden, in die Idee des Gesamtkunstwerks überzuführen. Nicht nur galt es, alle Künste in diese Kunstreligion aufzunehmen, sondern einen neuen künstlerisch-religiösen Ausdruck für die tiefsten menschlichen Anliegen zu finden. Der Mensch soll aus der Entzweiung, in die ihn die Moderne gestürzt hat, befreit werden. Dies sollte eine neue Mythologie leisten, die mit Feuerbach im göttlichen Wesen das Wesen des Menschen frei von seiner Endlichkeit zeigt. In Orientierung an Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik und Schopenhauers Mitleidsethik entwickelt Wagner seine Kunstrevolution, die ein neues Verhältnis von Dichtung und Musik zur Grundlage hat. In knappen Zügen durchmisst Pöltner die drei Teile von Wagners Oper und Drama. Zuerst wird die Tradition der Oper kritisch beleuchtet, dann die Rolle des Schauspiels untersucht, um dann mit dem dritten Teil die entscheidenden Weichenstellungen von Wagners Kunstwerks der Zukunft aufzuzeigen. Um eine innere Einheit von Dichtung und Musik zu verwirklichen gilt es für Wagner, die verwandten Elemente im jeweils anderen Medium zu erkennen. Nicht nur die Musik ist Gefühlsausdruck, sondern auch die Sprache in ihren Wortwurzeln, so dass sich Musik und Dichtung einander mitteilen können. Nicht nur die Sprache ist Ausdruck des ordnenden Verstandes, sondern auch die Musik des Orchesters, das die Rolle des antiken Chores übernimmt. Weder Dichtung allein noch absolute Musik können den Menschen als einen ganzen in seinem Wesen unmittelbar ansprechen, sondern nur das Gesamtkunstwerk, dem die Rolle zukommt, die kulturell bedingte Entfremdung von der Ursprünglichkeit der Natur wieder aufzuheben. Abschließend lässt Pöltner die kritischen Stimmen Nietzsches und Heideggers gegen Wagners Kunstwerk der Zukunft zu Wort kommen. 16 VIOLETTA L. WAIBEL Wittgenstein und die Kunst Volker Gerhardt untersucht in seinem Beitrag die Rolle von Ethik und Ästhetik bei Wittgenstein, die im Tractatus logico-philosophicus beide als transzendentale Disziplinen neben die Logik gestellt sind. Gerhardt zeigt zunächst, warum man im Hinblick auf Wittgenstein mit der Betrachtung der Ästhetik auch die Ethik in den Blick nehmen muss. Mit der Transzendentalität der Logik wird das Wissen von den Tatsachen der Welt gegründet, mithin der logische Raum markiert, in dem objektives Wissen möglich ist. Ethik und Ästhetik, schließlich auch Religion sind sich, so sehr sie einerseits unterschieden sind, anderseits darin verwandt, dass sie anderen Gesetzen gehorchen, als denen, die für die Tatsachen der Welt gelten. Sie zählen zu einem Geltungsraum außerhalb der wissenschaftlich eindeutig beschreibbaren Welt. Gerhardt fokussiert den zweiten Teil seiner Überlegungen auf den berühmten Schlusssatz des Tractatus, der ein Schweigen gebietet über das, wovon man nicht sprechen könne. Er arbeitet mehrere systematische und historisch bedingte Gründe heraus, die Wittgenstein veranlasst haben konnten, sich in Fragen der Ethik ebenso wie in denen der Ästhetik ein Schweigen aufzuerlegen. Moralische wie ästhetische Fragen lassen sich nur als höchst individuelle Handlungen realisieren, wo es vor allem auf das gekonnte Handeln ankommt, das sich einer Verallgemeinerung und daher einem Sagen von Tatsachen der Welt entzieht. Wo jedoch Könner- und Kennerschaft erzielt ist, da dürfe, so Gerhardt, schließlich auch über richtig und falsch geurteilt werden. Art after Wittgenstein. Über den Topos des ‚Unsagbaren‘ in der zeitgenössischen Kunst, betitelt Sabeth Buchmann ihren Beitrag über die Konzeptkunst, die zwei Traditionslinien kennt. Die ikonoklastische realisiert Wittgensteins These, wonach der „Satz […] ein Bild der Wirklichkeit“ ist (Tractatus, 4.021), die andere folgt dem späten Wittgenstein, wonach „die Bedeutung des Wortes […] sein Gebrauch“ ist. Die Konzeptkunst hat das Unsagbare und Undarstellbare zu ihrem konstituierenden Moment, ja zu ihrem kultischen Objekt gemacht. Kunst hat mit Wittgenstein die Tautologie, das Sagen, das nichts sagt, als Sprache, als Schriftzug, als Bild, als Ready made entdeckt. Beschwor Hegel das Ende der Kunst im Zeichen einer Philosophie des absoluten Wissens, so gilt für Joseph Kosuth die Entdeckung der Art after Philosophy. Kunst ist sich selbst Wirklichkeit, die nicht über sich hinaus auf andere Bedeutung verweist. Damit wird auch Kunstgeschichte, wenigstens tendenziell, abgelöst von einer Kunstwissenschaft, die sich dem verobjektivierten Kunstgegenstand zuwendet, ein Blickwechsel, den Marcel Duchamp irreversibel eingeleitet habe. Es geht seither weniger um eine angemessene Beschreibung und Deutung ästhetischer Phänomene, als vielmehr um die Erfassung der richtigen philosophischen Anschauung und ihrer theoretischen Grundlagen. Mit der Theoretisierung der Kunst hat diese die frühere Funktion der Kunstgeschichte selbst übernommen. Buchmann arbeitet heraus, dass der kultische Topos der Tauto- EINLEITUNG 17 logie des Unsagbaren in Wahrheit Spiegel einer komplexen Mischung von Medialität, Materialität, Kontextualität, Ideologie sei. Der Beitrag Der Stoff, aus dem die Räume sind. Kurt Kren filmt von Herbert Hrachovec untersucht den experimentellen Film der Wiener Avantgardisten der 60er Jahre, der das Medium Film in ganz neuer Weise entdeckt, weil er die Bedingungen seiner selbst offenzulegen sucht. Hrachovec zieht eine Parallele zur vorsokratischen Philosophie des Seins des Parmenides. Wie hier das Sein und das Nichts als Bedingungen alles Daseins reflektiert werden, so reflektieren die experimentellen Filmemacher auf die Seinsbedingungen des Films dadurch, dass bloßes Licht und Dunkel, Sein und Nichtsein selbst zum Gegenstand des Filmes werden. Überdies werden sich wiederholende Motive wie Mauer und Landschaft als mathematisch musikalische Rhythmen in einer Partitur festgelegt und zu einer Bildabfolge geschnitten. Ferner erkennt Hrachovec bei aller Divergenz eine Parallele zwischen Krens Kadern, den positiven (Licht) und negativen (Dunkel) Bildelementen des Films, aus denen die Bildräume geschaffen werden, und den Elementarsätzen in Wittgensteins Tractatus, aus denen eine komplexe Welt wahrer und falscher Sätze zusammengebaut ist. Wenn Kren im Film mit Mauern arbeitet, einer verstellten Welt ohne Perspektive, so verknüpft er auch hier mit der Mauer das Negativ, den Weg. Der geometrisierte Raum öffnet und schließt sich und integriert damit eine Erfahrung von Zeitlichkeit in das Filmgeschehen. Literatur Der Beitrag Androgyn und überspannt. Stichworte zur geistigen Situation um 1900 von Konrad Paul Liessmann porträtiert die Ästhetiktheorien der Jahrhundertwende. „Androgyn und überspannt“ sind die Prädikate, die den Jugendstil bezeichnen, der mit Adorno „die in Permanenz erklärte Pubertät“ sei. Damit ist die Folie eines Jugendbildes kreiert, das sich in Fragwürdigkeit und Zerbrechlichkeit, in Müdigkeit und Schwäche gefällt; oder wie Ernst Mach es ausdrückt: „Das Ich ist unrettbar.“ An diesem Jugendbild der Nervosität, der „Mystik der Nerven“, der Flucht aus dem Leben arbeitete Hermann Bahr ebenso wie Hugo von Hofmannsthal oder Robert Musil. Nietzsche wird, wie Liessmann pointiert feststellt, dieser Epoche den prägenden Titel „Décadence“ verleihen. Mit dem Übergang zur Ästhetik von Adolf Loos wendet sich Liessmann dem Gegenpol zu, einer Ästhetik, die sich vom Schnörkel der Décadence, der Lust an der Todessehnsucht verabschiedet, um einen „schmucklosen Reifezustand“ der Humanität zu propagieren, der erklärtermaßen das Infantile ebenso hinter sich lassen will wie jede Form unmittelbarer Kreativität. 18 VIOLETTA L. WAIBEL Liessmann verweist im Weiteren auf die einflussreiche Ästhetik des Wiener Privatgelehrten Rudolf Kassner, dem die Differenz der allegorischen Kunst des Literarischen und der Symbolik der Musik, die allein das Wesentliche des Menschseins zu artikulieren vermag, zum tragenden Moment seiner Theorie wurde. Schließlich lässt Liessmann drei ungarische Ästhetiker Revue passieren, die in den Diskurs der Zeit eingriffen, darunter der wirkungsmächtigste von ihnen, Georg Lukács, der Kassners Problem von Form und Leben aufgriff. Die Form, in der er einen „Träger der geheimsten Seelenregungen“ erkennt, ist ihm der Essay, den er quasi zu einer Kunstgattung hochstilisiert. Inspiriert von Hegels geschichtsphilosophischer Kunsttheorie ist ihm der Roman das Kunstwerk der Moderne, in dem sich die „transzendentale Obdachlosigkeit“ des modernen Ich ausdrücke. Mit einer Skizze zu Leó Popper, der im Kitsch die Kunst zum reinen Genuss verkommen sieht, und Bela Balázs, der in der Gattung des Stummfilms das Heraufziehen eines neuen Humanismus wähnt, klingen die Betrachtungen zur Kunsttheorie der Jahrhundertwende um 1900 mit einem Hinweis auf Sigmund Freud aus. Dessen Psychoanalyse identifiziert den Künstler mit dem Neurotiker und bringt das Kunstschaffen auf die Formel der Wunscherfüllung durch Materialisierung der Imagination. Hans Feger befasst sich in seinem Beitrag Darstellung des Denkens. Zum Problem der Genauigkeit im Essayismus von Robert Musils Roman ‚Der Mann ohne Eigenschaften‘ mit einer Philosophie, die sich in der literarischen Form des Romans artikuliert. Feger diskutiert, inwieweit Musils Roman verdient, der Postmoderne zugerechnet zu werden, und inwieweit dies nicht zutrifft. Im Mann ohne Eigenschaften komme eine Wahrnehmungsweise in einer Welt zum Vorschein, die keine Ordnung des Ganzen mehr kenne, sondern nur noch anonyme Funktionsabläufe, die eine neue Weise des Erlebens und Stiftens von Sinn und Bedeutung fordere – eine Forderung, auf die Musil reagiere. Feger analysiert zunächst den Anfang des Romans, an dem sich zeigen lasse, dass der Versuch, eine epische Realität zu fixieren, scheitere. An die Stelle eines Erzählkontinuums setze Musil ein kompliziertes Gefüge von Beziehungen und Ereignissen, an die Stelle stabiler Lebensentwürfe eine Pluralität von Lebensentwürfen. Die Suche nach einer Deutung bleibe für den Leser in der Schwebe, dieser werde vielmehr in eine Selbstständigkeit entlassen, das Offene selbst zu deuten. Der Protagonist Ulrich sei nicht aktiv Handelnder, sondern er begleite reflektierend das Geschehen, in dem die Dualität von Denken und Handeln experimentell aufgehoben sei. Die „Reflektorfiguren“ des Romans entspringen nicht einem Subjekt, sondern sie bilden ein fiktives Subjekt. In einem zweiten Teil wird die essayistische Erkenntnisform dieses Romans untersucht, die sich als dynamische Form der Vernunft versteht, welche die Balance zwischen wissenschaftlicher Gelehrsamkeit und einer spielerischen Neukonstruktion der Welt durch einen literarischen Subjektivismus sucht. Der Essayismus untersuche die Unterscheidung zwischen einer Wahrnehmung des Tatsächlichen und einer Wahrnehmung des Möglichen in einer neuen Bedeutung. Möglichkeit ist nicht Freiheit, sondern gänzlicher Freiheitsmangel, ist EINLEITUNG 19 nicht Bemächtigung der Welt, sondern der schwebende Zustand ästhetischer Findung und Erfindung. Daniela Strigl beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit einem Parforceritt in die Moderne. Hugo von Hofmannsthals ‚Reitergeschichte‘. Die Reitergeschichte gilt als Schlüsseltext des Aufbruchs in die Moderne, wohl ein Grund, so Strigl, weshalb Hofmannsthal sie nicht wirklich schätzte. Ihr Held ist kein Künstler, sondern ein Soldat, dessen Handeln mit mitleidslos kühler Geste erzählt wird. Eine Vermischung von personaler und auktorialer Perspektive führe „eine Zersplitterung des Bewusstseins“ und „extreme Subjektivität“ vor, die maßstabsetzend für zahlreiche weitere Novellen werden sollte. Die Geschichte von 1898 erschien nahezu zeitgleich mit Freuds Traumdeutung, die das Erscheinungsjahr 1900 trägt, aber schon 1899 verfügbar war. Vorarbeiten Freuds musste Hofmannsthal gekannt haben. Strigl arbeitet entlang des Textes und der Erzählstruktur die Momente der Modernität heraus, die Rolle des Mysteriösen, des Rätselhaften, des Traumes. Nicht nur Traumhaftes, auch Spiegelungen, Farben, Sexualisierungen bestimmen den Erzählgestus. Strigl fragt nach den Vorbildern Hofmannsthals für diese Reitergeschichte ebenso, wie sie auf diejenigen verweist, die dieser Erzählung folgen. Schließlich werden Motive der Erzählung mit dem berühmten Chandos-Brief von 1902 verknüpft, der meist als Dokument der Sprachkrise um die Jahrhundertwende gelesen wird, aber ebenso „eine schwere Ich- und Identitätskrise“ zum Thema mache. Bis ins einzelne Bild sei in der Reitergeschichte präfiguriert, was Hofmannsthal im Chandos-Brief thematisiere. Der Beitrag Scheitern des Tragischen? Anmerkung zu Hölderlins ‚Empedokles‘ von Violetta L. Waibel wendet sich einmal mehr Friedrich Hölderlins Tragödienkonzept zu, das dieser nach dem Vorbild von Sophokles auszuführen versprach. Die Untersuchung zeigt zum einen, wie das Konzept Der Tod des Empedokles in nachweislichen Spuren mit Hölderlins früherem Plan zu einer Tragödie Der Tod des Sokrates in Zusammenhang steht. In der Mittelstrophe des Gedichts Andenken ist, wie der Beitrag zeigt, ein Niederschlag dieses nie als Tragödie verwirklichten Planes zu finden. Zum anderen wird mit diesem Beitrag erstmals im Detail aufgezeigt, wo das Vorbild des Todes des Empedokles bei Sophokles zu suchen ist, nämlich nicht in einer der beiden Tragödien, die weithin als die vorbildlichsten Tragödien des Sophokles gelten und die Hölderlin beide übersetzt hat, also nicht in der Antigone und nicht im König Ödipus, sondern in Sophokles’ letzter Tragödie, dem Ödipus auf Kolonos. Die Untersuchung zeigt anhand von zentralen Details, dass der Tod des Empedokles dieser geradezu untypisch zu nennenden Tragödie des Sophokles folgt. Hölderlins grundlegende Schwierigkeiten mit der Ausarbeitung der philosophischen Begründung und der dichterischen Umsetzung des Tragischen, mit dem er dieser letzten Tragödie Sophokles’ folgt, mag dem Umstand geschuldet sein, dass er die Spannungen im Begriff des Tragischen in dessen verschiedenen tragischen Dichtungen nicht genügend untersucht und so auch nicht das eigene Anliegen im Tod des Empedokles sowie die eigene Umset- 20 VIOLETTA L. WAIBEL zung in die Neuzeit begrifflich bewältigt hat. Zudem fehlte Hölderlin das, was er an Shakespeare bewunderte, die Lebensnähe des großen Menschenkenners. Diesen Mangel spürt er, kann ihm aber erst in seiner großen lyrischen Spätdichtung begegnen. Unseren MitarbeiterInnen Gabriele Geml und Philipp Schaller sei herzlich gedankt für ihre sorgfältige Mühe, die sie für die Redaktion der Beiträge aufgebracht haben. Peter Gaitsch hat sich sehr verdient gemacht, indem er der Vielheit der Erscheinungen ein einheitliches Bild und ein einheitliches Format verliehen hat. Max Brinnich hat schließlich dank seiner hervorragenden Anwenderkenntnisse das Layout des gesamten Textkorpus hergestellt und die Abbildungen integriert. Philipp Schaller sei zudem für seinen begeisterten und begeisternden Einsatz als Tutor der beiden Ringvorlesungen in den Sommern 2010 und 2011 gedankt. Er vertiefte sich in die Theorieansätze der eingeladenen Gäste, um die Vielfalt des Gebotenen für die Studierenden leichter zugänglich zu machen. Schließlich sei auch der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien gedankt, die den finanziellen Rahmen bereitstellte, damit die Ringvorlesung durchgeführt und der Band zum Druck gebracht werden konnte. Dem Wilhelm Fink Verlag sei herzlich gedankt, dass er diesen Band in sein Verlagsprogramm aufgenommen hat. Zudem haben die Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, sowie die Stadt Wien die Drucklegung des Bandes mit einer finanziellen Förderung unterstützt, wofür die HerausgeberInnen zu herzlichem Dank verpflichtet sind. Violetta L. Waibel und Konrad Paul Liessmann, Wien im März 2014 THEORETISCHE PERSPEKTIVEN DES ÄSTHETISCHEN KONRAD PAUL LIESSMANN, UNIVERSITÄT WIEN Kunstworte Der ungarische Philosoph Georg Lukács hatte in jungen Jahren den Entwurf einer Philosophie der Kunst mit folgender Frage eingeleitet: „Es gibt Kunstwerke – wie sind sie möglich?“1 Eine Ästhetik, die, so Lukács, ohne „illegitime Voraussetzungen“ arbeiten will, also das „Faktum der Kunst“ in seiner Eigenart begreifen will, muss das Kunstwerk als ein Gebilde betrachten, das „rein durch sich“, unabhängig vom Prozess seiner Entstehung, begriffen werden muss. Das Kunstwerk ist durch seine reine Immanenz bestimmt, es ist ein in sich Abgeschlossenes, das keinen Bezug zur Wirklichkeit außerhalb seiner selbst hat. Aus der Perspektive des Kunstwerks erscheint diese Wirklichkeit als Nichtsein. Das Kunstwerk selbst aber ist aus keinen psychologischen oder sozialen Tatsachen ableitbar, es konstituiert sich, wie Lukács in einem späteren ästhetischen Entwurf ausführte, durch eine „ästhetische Setzung“.2 Wie immer Lukács dann diese Setzung versuchen wird zu entfalten: Es ist damit ein Problem angesprochen, das jede Ästhetik betrifft, die Kunst nicht als ein abgeleitetes, sondern als ein Phänomen sui generis zu fassen sucht. Oder, mit anderen und einfacheren Worten: Wodurch wird ein optischer oder akustischer Reizauslöser zu einem Kunstwerk? Wer setzt diese Setzung durch? Und verschärft sich das Problem nicht, wenn Gegenstände zu einem Kunstwerk erklärt werden, die in einem ganz anderen Kontext entstanden sind – Schneeschaufeln zum Beispiel, oder Klomuscheln? Der Verdacht liegt nahe, dass in diesen – und vielleicht auch in anderen Fällen – die Setzung weniger durch einen künstlerisch-kreativen Akt als vielmehr durch einen begleitenden Kommentar, durch eine Interpretation erfolgt. Es gibt Kunstwerke, die dadurch gesetzt sind, dass irgendein je schon vorhandenes Objekt einfach zu einem Kunstwerk erklärt wird. Was aber heißt es überhaupt, über Kunst zu sprechen, sie zu interpretieren und kommentieren, und welche Varianten sind dabei möglich? Der Verdacht, dass vor allem moderne Kunst unter einer besonderen Kommentarbedürftig1 2 Georg Lukács, Heidelberger Philosophie der Kunst (1912–1914), Darmstadt/Neuwied, 1974, S. 9. Georg Lukács, Heidelberger Ästhetik (1916–1918), Darmstadt/Neuwied, 1975, S. 12. 24 KONRAD P. LIESSMANN keit leide, die dem Diskurs über Kunst eine problematische Dominanz über die sinnliche Präsenz von Kunst zubilligt, stammt von dem nicht unumstrittenen Philosophen Arnold Gehlen. Um die Frage nach möglichen Sprechweisen über Kunst zu präzisieren, sei eine kurze Erinnerung an die Problementfaltung, wie sie Gehlen in seinem 1960 erstmals erschienenen, 1972 überarbeiteten Buch Zeit-Bilder vorgenommen hatte, gestattet. Gehlen geht in seinen Reflexionen nicht von den sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen der Kunst, nicht von der visuellen Evidenz der Bilder aus, sondern von dem, was er die „Leitidee der Bildrationalität“ nennt.3 Jede Kunstepoche, so Gehlens These, hat so etwas wie eine eigene Idee der Bildrationalität, das heißt der Organisation, des Aufbaus, der inneren Struktur und der Beziehung dieses Bildes zur Außenwelt. Arnold Gehlen skizziert für die Entwicklung der abendländischen Kunst drei solcher Ideen der Bildrationalität – man könnte auch Paradigmen sagen –, die gleichzeitig die großen Stil-Epochen markieren. Das erste Paradigma nennt er „Die ideelle Kunst der Vergegenwärtigung“. Diese Kunst stützt sich stets auf etwas außer ihr Liegendes, „sekundäre Motive“, die sie malerisch aktualisiert: Mythen, Ideen, historische Ereignisse, Legenden – Kunst also, die ein identifizierbares inhaltliches Programm hat. Es ist damit nach Gehlen die abendländische Malerei bis ins frühe 19. Jahrhundert erfasst. Das zweite Paradigma ist die „realistische Kunst“. Realistische Kunst im Gehlen’schen Sinn ergibt sich dann, wenn man von sekundären Motiven absieht und nichts übrigbleibt als das primäre Motiv des bloßen Gegenstandes und das Wiedererkennen desselben allein die Bildrationalität trägt. Es ist die Kunst der reinen Gegenständlichkeit, naturalistisch, die Kunst der emporstrebenden bürgerlichen Gesellschaft, die den Stuhl, das Schuhwerk, das Kornfeld, die Stadt, ein Interieur um seiner selbst willen malt, ohne damit eine Geschichte, einen Mythos, eine Allegorie oder eine Idee zu verbinden. Die dritte zentrale Leitidee malerischer Rationalität ist dann schlicht und einfach die „abstrakte Malerei“. Auch das primäre Motiv wird gestrichen, Form im engeren Sinn bleibt allein übrig, die Malerei bezieht sich auf die „steigende Wortunfähigkeit der Seelen“ und verschreibt sich „der Tyche, der abendlichen Göttin des Zufalls und des Experiments“. Das Resultat davon ist nicht zuletzt die Kommentarbedürftigkeit der Moderne. Die Analysen eines abstrakten Bildes unterscheiden sich dann auch von ikonologischen Studien, denn der Kommentator eines abstrakten Bildes steht vor völlig anderen Aufgaben, er kann nicht wiedererkennen, er kann nicht dechiffrieren, sondern er muss das, was ist, und was nichts bedeutet, trotz allem deuten. Gehlen beschreibt diese Entwicklung von der ideellen Vergegenständlichung über die realistische Kunst bis zur abstrakten Malerei als einen „Reduktionsprozeß des Bildgehaltes“. Auf der einen Seite bedeutet dies notwendig 3 Dieses und die folgenden Zitate: Arnold Gehlen, Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei, Frankfurt am Main, 3. Auflage 1986, S. 14 ff. KUNSTWORTE 25 Verarmung und Abbau, auf der jeweils verengten Basis jedoch ergibt sich ein Zuwachs von Eindrücken und ein Gewinn an Bewegungsfreiheit: „Die Auseinandersetzung des Menschen mit der Wirklichkeit, die Kultur heißt, nimmt an Totalität und innerer Fülle ab, an Breite jedoch und in der Selbständigkeit der Auseinandersetzungswege, ihrer Unabhängigkeit voneinander, nimmt sie zu, eben deshalb steigt der kulturelle Stellenwert der Persönlichkeit, steigt ihre Selbstbetonung.“ Was erhöht wird, ist in Summe die „Souveränität des Ästhetischen“ und die Bedeutung des Subjekts. Gerade die abstrakte Kunst ist deshalb in hohem Maße subjektive Kunst, weil jedes objektive Korrelat fehlt. Deshalb benötigt diese Kunst nach Gehlen nicht nur den Kommentar, sondern auch die subjektive Reflexion des Künstlers, die zur Bildrationalität gleichsam dazugehört. Ein abstraktes Bild ist, für sich genommen, „ästhetisch“ nicht lebensfähig: Es drängt aus sich heraus, es drängt in einen ästhetischen Diskurs hinein bzw. provoziert diesen beim Künstler selbst und beim Betrachter. Alle moderne Kunst, so Arnold Gehlen, ist, sofern sie sich diesem Paradigma der Abstraktion verpflichtet fühlt, deshalb Reflexionskunst, Konzeptkunst, peinture conceptuelle – eingebettet in Theorie. Eine entscheidende Konsequenz dieser Bedeutungsreduktion durch Abstraktion ist für Gehlen die Suspension der Realität selbst, die bis zu einer Suspension des eigenen künstlerischen Daseins gehen kann: „Bei verschärfter Bewußtheit wird ein letztes Sichnichternstnehmen unvermeidlich“ – eine „unheimliche Verwandlung“, von der Gehlen weiß, dass sie schon im Prinzip der romantischen Ironie angelegt war.4 Diese Bewegung der Suspension führt in der Moderne dazu, dass eine ganze Reihe verbürgter Differenzierungen ins Schwanken gerät: Die Unterschiede von echt und unecht, von Erwachsenem und Kind, von normal und verrückt verschwimmen. Das Spiel mit diesen suspendierten Unterschieden und ihre Suspension im ästhetischen Spiel werden damit aber auch zu einer entscheidenden Verfahrensweise der modernen Kunst. Eine weitere, vielleicht die bedeutsamste Konsequenz dieser Entwicklung zur Abstraktion liegt für Gehlen in der zunehmenden Wortunfähigkeit dieser Kunst, in der Sprachlosigkeit ihrer Bilder. Das mag auf den ersten Blick erstaunlich wirken, wird aber plausibel, wenn man Gehlens Gedankengang folgt. Er schreibt: „Betritt man einen Saal mit Werken früherer Jahrhunderte, so wird fühlbar, wie gesprächig jedes Bild realistischer Stilart einfach als solches ist, denn unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit ist sprachmäßig. Zu der pantomimischen Symphonie in dem Saale liefert unser Bewußtsein, von allen Seiten angeregt, das Stimmengewirr und noch die farbig knallenden, deformierten Sujets der Expressionisten erinnern an die angestrengte Ausdrucksbemühung der Taubstummen. Je mehr sich aber die Kunst vom Gegenstand entfernt, umso stiller wird sie, sogar schon die bloße Stilisierung lässt dies bemerken. In der gesamten modernen Kunst steigt doch der Gehalt an 4 Gehlen, Zeit-Bilder, S. 181 f. 26 KONRAD P. LIESSMANN Schweigsamkeit, überall, bei Seurat, bei Cézanne, bei Juan Gris, bei Matisse diese sonderbare Verhaltenheit und Stille.“5 Dass die moderne Kunst sich zurücknimmt, verstummt, abschließt, in Schweigen übergeht – diese Überlegungen waren etwa für Adornos Ästhetische Theorie bedeutsam –, wird auch von Gehlen, wenn auch mit anderer Akzentuierung, konstatiert. Das abstrakte Bild fungiert wie das Wasser des Narziss – es spiegelt immer seinen Betrachter in vollkommener Stille; es selbst schweigt, sagt nichts. Die Moderne hört auf, Ausdruckskunst zu sein, sie ist die Kunst der Selbstbespiegelung und ihrer ironischen Aufhebung. Soweit also die Erinnerung an Arnold Gehlen. Wie wäre es nun, so ließe sich fragen, wenn man diese pikanten Thesen in den Kontext einer allgemeine Theorie des Sprechens über Kunst stellte, in der die Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst nur ein – vielleicht durchaus problematischer – Sonderfall wäre? Dazu nun einige Überlegungen. Etwas rigide könnte man im Anschluss an Georg Lukács prinzipiell zwischen „legitimen“ und „illegitimen“ ästhetischen Diskursen unterscheiden. Unter legitimen Diskursen könnte man Redeweisen verstehen, die sich auf Kunstwerke unter der Bedingung beziehen, dass der Kunst im Sinne Lukács’ ein eigener ontologischer Status zuerkannt wird und ihre Autonomie akzeptiert wird. Über Kunst sprechen hieße dann, ihre Gesetztheit und Eigengesetzlichkeit vorauszusetzen. Unter illegitimen ästhetischen Diskursen könnte man hingegen Redeweisen verstehen, die der Kunst diesen Status entweder absprechen oder Kunst so betrachten, als handle es sich um etwas anderes, zum Beispiel um Geldanlagen, um Symptome psychischer Irritationen, um biographische oder historische Dokumente oder um politische bzw. moralische Behauptungen oder Stellungnahmen. „Illegitim“ bedeutet nicht, dass so nicht über Kunst gesprochen werden darf, sondern verweist nur darauf, dass, indem so über Kunst gesprochen wird, das Kunstwerk als Kunstwerk nicht Gegenstand des Diskurses ist. Natürlich kann man über Picasso einen ganzen Abend lang sprechen und dabei nur über Preise, Auktionen, Wertsteigerungen und Versicherungssummen reden. Und natürlich kann man einen ganzen Abend über Picasso sprechen und dabei ausschließlich sein Verhältnis zu Frauen oder zur Kommunistischen Partei thematisieren. Und natürlich kann man einen ganzen Abend über Picasso sprechen und sich ausschließlich darüber unterhalten, ob sein erotisches Spätwerk den Tatbestand sexistischer Pornographie erfüllt oder nicht. In all diesen Fällen wurde zwar über Picasso, aber nicht über die Kunst Picassos gesprochen. Es handelte sich um der Kunst unangemessene und deshalb illegitime ästhetische Diskurse der Ökonomie, der Biographie, der Politik und der Moral. Wenden wir uns nun den legitimen ästhetischen Diskursen zu, die das ästhetische Phänomen tatsächlich als ästhetisches Phänomen zur Sprache bringen. Beginnen wir mit dem einfachsten. Ein Reiz trifft mich und löst eine angenehme oder unangenehme Empfindung in mir aus. Ich äußere dies. Nennen 5 Gehlen, Zeit-Bilder, S. 187. KUNSTWORTE 27 wir die Gattung dieser Äußerungen das empfindsame Sprechen. Hierbei handelt es sich um alle Äußerungen, durch die wir kundtun, welche Empfindungen die Wahrnehmungen ästhetischer Objekte bei uns auslösen: Langeweile, Spannung, Heiterkeit, Trauer, große oder kleine Gefühle. Alle diese Empfindungen lassen sich auf zwei Grundbefindlichkeiten zurückführen: Lust und Unlust. Als angenehm und befriedigend empfinden wir ästhetische Reize, die in uns Gefühle der Lust auslösen, als unangenehm und störend empfinden wir solche, auf die wir mit Unlust reagieren. Alle Äußerungen, die nun diese Lustoder Unlustgefühle, diese Befindlichkeiten des Angenehmen oder Unangenehmen artikulieren und kommunizieren, fallen unter das empfindsame Sprechen über Kunst. Sehr oft beziehen sich diese Äußerungen auch auf Atmosphären, die durch ästhetische Objekte ausgelöst werden, etwa durch die Einrichtung einer Wohnung, eines Restaurants, überhaupt durch Architektur. Wir sagen dann, dass wir uns wohl oder unwohl, behaglich oder unbehaglich fühlen. Davon zu unterscheiden sind allerdings Äußerungen, die sich nicht auf die durch Kunst ausgelösten Empfindungen, sondern auf unsere reflektierte und begründete Einschätzung eines Kunstwerkes beziehen. Dies könnte man das urteilende Sprechen über Kunst nennen. Im urteilenden Sprechen machen wir den Schritt von der Artikulation eines Gefühls zur Aussage über ein ästhetisches Objekt. Plakativ formuliert: Der Satz „Das fühlt sich gut an“ transformiert sich zuerst in den Satz „Das gefällt mir“ und dann in den Satz „Das ist schön“. Immanuel Kant nannte dies die Leistung der ästhetischen Urteilskraft, und er beschrieb sie als „eine Vorstellungsart, die für sich selbst zweckmäßig ist, und, obgleich ohne Zweck, dennoch die Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung befördert. Die allgemeine Mitteilbarkeit einer Lust führt es schon in ihrem Begriffe mit sich, daß diese nicht eine Lust des Genusses, aus bloßer Empfindung, sondern der Reflexion sein müsse; und so ist ästhetische Kunst, als schöne Kunst, eine solche, die die reflektierende Urteilskraft und nicht die Sinnenempfindung zum Richtmaße hat.“6 Im Gefallen liegt schon der Anspruch, dieses auch begründen zu können. Während gegen Empfindungen prinzipiell nicht argumentiert werden kann, erscheinen uns Äußerungen wie „Das gefällt mir“ und noch mehr Sätze wie „Das ist schön“, „Das ist gelungen“ als begründungspflichtig, da sie nicht Ausdruck einer subjektiven Befindlichkeit, sondern Behauptung über die ästhetische Qualität eines Gegenstandes sind. Kant hat in der Kritik der Urteilskraft allerdings schon gezeigt, dass diese Begründungen nicht im strengen Sinn aufgefasst werden können, da ihre Basis immer der subjektive Geschmack sein wird, der aber nicht mit dem Schema Lust/Unlust verwechselt werden darf. Es kann sehr wohl sein, dass ein ästhetisches Objekt in einer bestimmten Situation zwar Unlust auslöst, uns aber sehr wohl gefallen und von uns als gelungen oder schön beurteilt werden kann. Bei einem fröhlichen Es6 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, in: Werkausgabe, Bd. X, hg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main, 1977, S. 240. 28 KONRAD P. LIESSMANN sen mag es sehr unangenehm sein, wenn aus den Lautsprechern plötzlich Ennio Morricones „Spiel mir das Lied vom Tod“ ertönt, obwohl man diese Komposition als Meilenstein der Filmmusik durchaus wertschätzen kann. Der urteilende Diskurs versucht also, das, was uns gefällt, was, wie Kant es formulierte, bei uns ein interesseloses Wohlgefallen auslöst, in einer begründenden Redeweise zu formulieren. In zugespitzter Form erscheint diese Redeweise als akklamierende oder vernichtende Kritik. Die Begriffe, mit denen diese Urteile formuliert werden, ändern sich zwar rasch, die Struktur dieser Redeweise ist aber immer die gleiche: Ein ästhetisches Objekt wird beurteilt. Ob man dieses Urteil dann zwischen den Polen schön/hässlich, gelungen/misslungen, interessant/uninteressant, reaktionär/progressiv, epigonal/innovativ oder provinziell/international ansiedelt, bleibt sich gleich, man sieht an solchen Begriffswandlungen allerdings, wie sich die Kriterien und die ideologische Stoßrichtung dieser Urteile verändern. Vom urteilenden Sprechen klar zu unterscheiden ist das deutende Sprechen. Bei diesem geht es nicht darum, die ästhetische Qualität eines Werkes festzustellen und zu formulieren, sondern seine Bedeutung, seinen Gehalt zu erfassen. Diese Art des Sprechens setzt voraus, dass ein Kunstwerk mehr bedeutet als eine sinnliche Präsenz, die wir in ihrer Erscheinungsweise als angenehm oder unangenehm empfinden und in Hinblick auf ihre sinnlich-intellektuelle Akzeptanz beurteilen können. Wer ein Kunstwerk deutet und interpretiert, sieht in ihm schon eine Chiffre, ein Zeichen, ein Symbol, eine Allegorie, ein Rätsel – also etwas, das in einer Weise über sich hinausweist, die erst erschlossen werden muss. Die einfachste und gleichzeitig radikalste Form des deutenden Sprechens ist die, die Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik vorgeführt hat: Das Kunstwerk ist das „sinnliche Scheinen der Idee“, und „die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschiene“.7 Wenn das Kunstwerk in seiner sinnlichen Präsenz über sich hinausweist und auf etwas anderes – die Wahrheit – verweist, dann muss dieses andere durch die deutende und interpretierende Rede erst eingeholt werden. Interpretationen, so können wir sagen, liefern Deutungen eines Kunstwerkes, weil dieses selbst in seiner Erscheinungsform darüber nichts oder nur wenig aussagt, aber gleichzeitig einen Spielraum möglicher Verweise umreißt oder andeutet. In der Ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos wurde dieses Vexierspiel von Schweigen und Deuten auf eine bislang uneingeholte Spitze getrieben: „Die Werke sprechen wie Feen im Märchen: du willst das Unbedingte, es soll dir werden, doch unkenntlich.“8 Was immer sich in einem Kunstwerk ausdrückt, kann anders nicht gesagt werden. Könnte es anders gesagt werden, erübrigte sich das Kunstwerk. Wann immer die Kunstwerke durch den Hinweis auf ihren Wahr7 8 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I, in: Werke in 20 Bänden, Bd. 13, auf der Grundlage der Werke von 1832–1945 neu edierte Ausgabe unter der Redaktion von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main, 1970, S. 151 u. S. 21. Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, in: Gesammelte Schriften, Bd. 7, hg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main, 1971, S. 191. KUNSTWORTE 29 heitsgehalt legitimiert werden sollen, darf diese Wahrheit nicht die begrifflicher, rationaler, diskursiver Erkenntnis sein, noch dürfen die Kunstwerke bloßes Abbild, Illustration einer These, Unterstützung einer außerästhetischen, philosophischen, religiösen oder politischen Wahrheit sein: Sie machten sich sonst überflüssig. Natürlich beginnt das deutende Sprechen über Kunst dort, wo einfache Verweisungszusammenhänge entdeckt werden und die Bedeutung von mythologischen Figuren, Gesten und Gegenständen erfasst und in einen neuen Zusammenhang gebracht werden können. Entscheidend für das deutende Sprechen ist allerdings die stillschweigende Voraussetzung, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, das etwas bedeuten muss. Der amerikanische Philosoph Arthur C. Danto hat in dieser Deutungsmöglichkeit überhaupt das Wesensmerkmal der Kunst erblickt. Bei Gegenständen des Alltags fragen wir: Was kann ich damit tun? Bei Kunstwerken fragen wir: Was können sie bedeuten? Ein Bild als Kunstwerk zu identifizieren, heißt dann einen Vorschlag machen, was es bedeuten könnte. Ein Kunstwerk zu interpretieren heißt für Danto, „eine Theorie anzubieten, worüber das Werk ist und was sein Sujet ist.“9 Alle bisherigen Redeweisen über ästhetische Objekte setzten die Existenz dieser ästhetischen Objekte fraglos voraus. Was aber bedeutet es, wenn wir mit Objekten konfrontiert sind, von denen wir gar nicht wissen, ob sie ästhetische Objekte sind, über die wir in den bisher angeführten Redeweisen sprechen können? An dieser Stelle – und dies ist auch ein zentraler Punkt in Dantos Philosophie der Kunst – ist es das Sprechen selbst, das darüber entscheidet, ob ein Kunstwerk vorhanden ist oder nicht. Danto nannte dieses Sprechen einen Akt der Identifikation. Ein Gegenstand, zum Beispiel eine ganz gewöhnliche Schneeschaufel, kann unter bestimmten Bedingungen und durch einen bestimmten Diskurs als Kunstwerk identifiziert werden. Dann hat sich diese Schneeschaufel in ein Readymade Marcel Duchamps verwandelt, und wir können nun sagen, ob sie uns sinnliche Lust bereitet, uns gefällt, und was sie bedeutet. Man könnte noch einen Schritt weitergehen und dieses Sprechen, das überhaupt erst ein Kunstwerk identifiziert, das konstituierende Sprechen nennen. Denn dieses Sprechen spricht nicht über einen ästhetischen Gegenstand, sondern durch dieses Sprechen wird aus einem beliebigen Gegenstand überhaupt erst ein ästhetischer Gegenstand konstituiert. Das konstituierende Sprechen antwortet nicht auf die Frage „Was empfinde ich angesichts eines ästhetischen Reizes?“, auch nicht auf die Frage „Wie sehr gefällt mir dieses ästhetische Objekt und wie gelungen finde ich es?“, auch nicht auf die Frage „Was bedeutet dieses ästhetische Objekt und welche Wahrheit verbirgt es?“, sondern einzig auf die Frage „Ist das ein Kunstwerk?“ Das konstituierende Sprechen ist deshalb ein ausgezeichneter Fall einer ästhetischen Setzung! 9 Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst. Frankfurt am Main, 1984, S. 184 f. 30 KONRAD P. LIESSMANN Das konstituierende Sprechen stellt deshalb auch den interessantesten Fall eines ästhetischen Diskurses dar, weil durch dieses Sprechen das ästhetische Objekt als von der Wirklichkeit getrennte, eigengesetzliche Seinsform überhaupt erst erzeugt wird. Damit dies geschehen kann, müssen allerdings drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens: Es muss unklar oder zumindest bestreitbar sein, ob ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Reizkonstellation überhaupt als Kunstwerk aufgefasst werden kann. Zweitens: Es muss etwas vorhanden sein, das sinnlich soweit erfahrbar ist, dass es überhaupt im konstituierenden Diskurs als Kunstwerk erzeugt werden kann. Und drittens: Der konstituierende Diskurs muss so mächtig sein, dass er im extremsten Fall aus einer sinnlichen Nichtigkeit ein Kunstwerk machen kann. Fassen wir diese Bedingungen in andere Worte, so können wir auch sagen: Der Reduktionismus in der modernen Kunst, der dem Kunstwerk seine Selbstverständlichkeit entzog – zum Beispiel durch Abstraktion – , und die Erweiterung des Kunstbegriffs, durch die die Grenze zwischen Kunst und Alltagsgegenständen bewusst aufgehoben werden sollte – zum Beispiel im Aktionismus –, ermöglichten und erforderten gleichermaßen einen konstituierenden Diskurs. Dieser ermächtigte sich zu dieser Konstitutionsleistung durch die Entwicklung eines Theorieinventars, das diese Identifikationsleistungen plausibel erscheinen lässt. Die Kontextualisierung etwa stellt solch ein theoretisches Konzept dar, die historisierende Genealogie ein anderes. Je umfangreicher, elaborierter, begriffsgesättigter diese Texte erscheinen, je prominenter sie platziert werden können, desto größer ist die Chance, dadurch eine ästhetische Konstitution, eine „Setzung“ zu bewirken. Das für unsere Fragestellung Interessante am konstituierenden Diskurs ist nun die Frage, ob dies eine legitime oder illegitime Redeweise über Kunst ist. Die Antwort ist: Weder noch. Sie ist nicht illegitim, weil sie dem Kunstwerk gegenüber keine ökonomische, politische oder moralische Außenperspektive einnimmt. Und sie ist nicht legitim, weil sie sich auf kein verbürgtes Kunstwerk bezieht, sondern dieses erst erzeugt. Sie ist aber selbst kein künstlerischer Akt, weil sie sich im Medium des Begriffs und nicht in der Sphäre der ästhetischen Präsenz bewegt. Diese Zwitterstellung macht den konstituierenden Diskurs und die durch ihn konstituierten Werke auch so anfällig für Kritik und Empörung. Denn auch die Werke spüren diesen Mangel. In einem allgemeinen Verständnis fraglos vorausgesetzte Kunstwerke können uns missfallen, wir können sie vielleicht nicht angemessen verstehen, meistens verzichten wir auch auf komplexe Deutungen; aber dass es Kunstwerke sind, scheint uns evident. Durch den konstituierenden Diskurs konstituierte Werke allerdings existieren ohne diesen Diskurs überhaupt nicht. Eine Madonna Raffaels kann auch einem Agnostiker gefallen, sogar dann, wenn er sie mangels religiöser Bildung mit einem Bauernmädchen verwechselt. Kein Mensch aber käme auf die Idee, eine industriell gefertigte Schneeschaufel aus dem Baumarkt ohne Theorie für ein Kunstwerk zu halten. Mit der richtigen Theorie allerdings kann die Schneeschaufel ein hinreißendes Kunstwerk sein. Es ist die mit Nachdruck