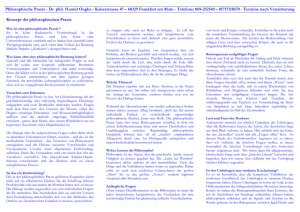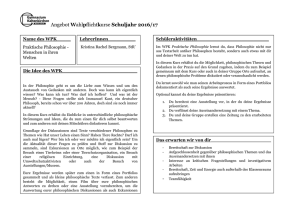Worum geht`s da eigentlich? - forum allgemeinbildung schweiz
Werbung

Worum geht’s da eigentlich? Philosophisches zum So-tun-als-ob in der Schule Abstract Praktizierende Philosophen müssen sich per definitionem mit Bildung beschäftigen. Ihre Art zu fragen unterscheidet sich aber von derjenigen der Pädagogen, Bildungspolitiker und Ökonomen. Zudem arbeiten sie oft auch als Lehrer. In den Bereichen der Bildung und Ausbildung besteht nun ein wachsendes Bedürfnis nach gedanklich klar fundierter, mit allen Beteiligten erarbeiteter Orientierung. Bildung ist teuer und rückt deshalb vermehrt in den Blickwinkel der Sparapostel. Dabei obsiegen oft kurzfristige Argumente. Philosophen in der Schulpraxis (und anderswo) müssen auf humanistischen Argumentationen mit demokratischer Legitimation bestehen. Ziele, Begriffe und Menschenbilder der aktuellen bildungspolitischen Debatte verlangen nach kritischer Überprüfung. Im folgenden, grundsätzlichen Text geht es in erster Linie darum. Zusätzlich werden in einem engen Zusammenhang damit fünf methodische Schritte praktisch-philosophischen Coachings beschrieben. Bildung ist „in“. Zumindest als Thema. In der Öffentlichkeit wird gestritten, was Bildung denn ausmache, wer sie wie organisieren soll und wer sie zu finanzieren habe. Bildungspolitik wird aktiv wie selten, ja geradezu rastlos betrieben. Wer die Argumentationslinien der Bildungspolitiker verfolgt, bekommt unweigerlich einen Eindruck davon, wie die Bereiche „Schule“ und „Weiterbildung“ gesellschaftliche Auseinandersetzungen spiegeln. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine neue Bildungsinitiative gestartet wird, kaum ein Parteitag geht ohne bildungspolitische Kernaussagen über die Bühne und wer als Industrieführer etwas auf sich hält, gibt selbstverständlich regelmässig Bildungsratschläge zum besten. Die gesellschaftspolitischen Kämpfe werden auf dem Spielfeld der Bildung ebenso ausgetragen wie in Parlamenten, Verwaltungsräten und betrieblichen Chefetagen. Bildung erscheint so als äußerst zentrales Thema der Wissens- und Konkurrenzgesellschaft. Der Begriff „Bildung“, wie wir ihn brauchen, hat sich 2 | MARKUS WALDVOGEL indes erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchgesetzt. In der griechischen Antike bedeutete Paideia die Einführung des Menschen in seine Lebenswelt. Paideia hatte sowohl eine sachliche, moralische, „politische“ und eine philosophische Ausrichtung. Letztere stand für die höchste Form menschlicher Praxis. Mit dem Höhlengleichnis und im Anschluss daran kritisiert Platon den Erziehungsbegriff der „Sophisten“, die meinten, man könne den Lernenden Wissen einpflanzen. „… dann müssen wir zu der Überzeugung kommen, dass die Erziehung nicht so ist, wie sie manche (=die Sophisten, der Verf.) in ihren Ankündigungen beschreiben. Sie sagen, das Wissen, das nicht Seele ist, das pflanzten sie ein, wie wenn sie blinden Augen die Sehkraft einsetzten.“1 Dem stellt Platon eine völlig andere „Sicht“ entgegen. Die „geistige Kraft in der Seele“ des Einzelnen muss auf „das Hellste des Seienden“ ausgerichtet werden; „… dies Hellste aber ist, wie wir sagen, das Gute“. Diese Neuausrichtung, diese „Umwendung“, ist das eigentliche Ziel der Erziehungskunst. Die geistige Kraft der Seele muss dem Idealen zugewendet werden. Dies geschieht, körperlichen Übungen verwandt, „durch Gewöhnung und Übung“. Platon hebt nun die „Fähigkeit des Denkens“ hervor, die „etwas Göttliches in sich“ habe und durch die Umdrehung „brauchbar und nützlich“ werde. Ohne die Ausrichtung auf das Gute aber ist das bloße Denken wie ein scharfes Schwert, das wahllos alles vernichten kann, geführt von „armen Seelen“. „Oder hast du (Glaukon) noch nicht die schlechten, verschmitzten, aber sehr klugen (Ergänzung nach dem Kommentar von Karl Vretska) Leute beobachtet? Wie scharf schaut ihre arme Seele und zergliedert genau die Dinge, denen sie sich zuwendet, da ja ihre Sehkraft …gezwungen ist, der Schlechtigkeit zu dienen; je schärfer sie daher blickt, um so größeres Unheil verursacht sie.“2 Platon lehnt ein nur faktisches Wissen ab, und er glaubt auch nicht, dass die Haltung eines Menschen von seinem Wissensstand abhänge. Dieser ist aber, als (moralische) Einsicht, Voraussetzung, um im Gemeinwesen wirken zu können. Methodenschritt 1: Demokratische Vernetzung Wir praktizierenden Philosophen vergleichen die moderne Ansicht von Erziehung und Unterricht durchaus mit antiken Auseinandersetzungen um die Paideia. Als wichtigste Differenz zu ihr fällt die Instrumentalisierung und Institutionalisierung ins Gewicht. Bildung wurde an Fachleute und staatliche Einrichtungen „übergeben“. Sie erhielt dadurch erst ihren eigentlichen „Dienstleistungscharakter“. Sie wurde handhabbar, lenkbar und leichter an die öffentlichen Bedürfnisse anpassbar. Die darauf bauende Lernschule wurde immer zielgerichteter, bezahlte aber den Preis, ihre umfassende geistige und lebensweltliche Orientierung einer utilitären Verkürzung hintanstellen zu 1 2 Platon (2000), S. 332 Platon (2000), S. 333 WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 3 müssen. Das Ausmaß dieser Verkürzung macht den strittigen Punkt in der neuzeitlichen pädagogischen Diskussion aus. Im philosophischen Gespräch mit Lehrpersonen - das können immer auch Behördenmitglieder, Eltern oder Schülerratsvertreter sein; der Einfachheit halber reduziere ich das in der Folge mit dem Kürzel LP- geht es um die Gewissheit, dass die demokratisch legitimierten Bildungsziele (Zweckartikel in Bildungsgesetzen, verfassungsmäßige Aussagen) in vielen Fällen jene LPs stärken können, die sich von der „pragmatischen Wende“ gleichsam überflutet fühlen. Das Beschaffen von Unterlagen zur Bildungsphilosophie der Gemeinschaft ist ein aufklärerischer Akt, der Ressentiments („Irgendwie ist es doch so, dass…“) und Ungenauigkeiten beseitigt und auch aufzeigen kann, wo eine zu technokratische oder alltagspolitische Ausrichtung des schulischen Geschehens sich nicht mit den einmal vereinbarten politischen Positionen verträgt. Es lohnt sich, Bildungsziele genau zu kennen, um die eigene Argumentation zu schärfen und demokratisch schlechter untermauerte „Selbstverständlichkeiten des Alltags“ in Frage zu stellen. Das philosophische Coaching übt mit LPs Fragen für Konferenzen, Arbeitsgruppen, allgemeine Sitzungen, Elterngespräche etc. ein. Wichtig ist dabei, dass diese Fragen nicht rechthaberischen Charakter haben dürfen, sondern voll auf die Sache zielen. Der Einwand: „In Art. 17 steht aber doch…und Sie gehen darauf gar nicht ein…“, sollte ersetzt werden durch die Frage: „Welche Gedanken von Art. 17 haben Sie in Ihrer Darstellung berücksichtigt…?“ Das philosophische Ziel kann nur sein, gleichsam die demokratische Vernetzung einzelner, oft isolierter „Maßnahmen“ der Bildungsbürokratie und durchaus auch konkreter „Vorgesetzter“, ja sogar Kolleg/innen einzufordern. Dadurch wird bestehendes Unbehagen auf eine Ebene der gemeinsamen Vernunft gebracht. In Anlehnung an Kant und Habermas schimmert „Öffentlichkeit“ in die Konferenzräume und Schulstuben mit dem Effekt eines gewissen Schutzes vor Willkür durch Bildungsbeamte und isolierte Entscheidungsträger. In den Augen vieler Reformpädagogen sollte sich Bildung ebenfalls nicht auf ein stetes Mehr an Wissen und Fertigkeiten beschränken, weil Effizienz, Klugheit oder auch Sachverstand allein keine Werte „an sich“ darstellten und auch nicht „einfach so“ zu solchen führen, wie das Bildungspolitiker/innen oft suggerieren. Moderne Pädagogen wiesen und weisen mit allem Nachdruck darauf hin, wie wichtig etwa das Unterlassen unerwünschter Handlungen sei. Nicht bei allem mitzumachen, ist in der Tat ein wesentliches Bildungsziel. In einer Angebots- und Verführungsgesellschaft, wird die Fähigkeit, nein sagen zu können, grundlegend. Bis vor kurzem wurde das mit dem ungeliebten Begriff „Disziplin“ umschrieben. Heute spricht man unter anderem von präventiven Fähigkeiten oder von Zivilcourage. Gerade weil sich die Bildungsinstitutionen und ihre Vertreter damit in einem Widerspruch zur allgemeinen 4 | MARKUS WALDVOGEL gesellschaftlichen Praxis mit ihrem Trend zum „homo consumens“ befinden, ist die Forderung, Bildungseinrichtungen müssten sich dem zu direkten Zugriff gesellschaftlicher Entwicklungen widersetzen können, nachvollziehbar. Die Nichteinmischung des Staates in staatliche Einrichtungen ist indes eine schwer zu erfüllende Forderung. Der philosophische Praktiker tut aber gut daran, deutlich zu machen, dass die Aufgabe, ein kritisches Selbstbewusstsein bei den Schüler/innen zu fördern, immer noch „lehrplanrelevant“ ist und die entsprechend weit formulierte Lehrfreiheit in keiner Weise angetastet werden soll. Es scheint zur Zeit tatsächlich so, als ob die staatliche, öffentliche Bildung sich an Werten orientieren würde, die ihrerseits im politisch-öffentlichen Raum bereits umgewertet wurden oder im täglichen Kampf um Marktanteile gerade bezüglich erzieherisch höchst fragwürdiger Produkte kaum mehr eine Rolle spielen. Dem und der utilitären Verkürzung von Bildung steht der wertkonservative Bildungsbegriff (z.B. mit Inhalten wie der Bewahrung der Schöpfung) diametral entgegen. Die philosophische Praxis in der Schule aber steht genau in diesem Spannungsfeld. Methodenschritt 2: Widerstandsverortung In der Arbeit mit Lehrpersonen gilt es, Werte im Unterricht, im Schulentwicklungsprozess (z.B. durch die Arbeit an Leitbildern) und in bildungspolitischen Auseinandersetzungen präzise zu thematisieren und das erwähnte Spannungsfeld als Bezugsgröße sichtbar zu machen. Entscheidend ist dabei, dass Lehrkräfte entdecken, wo sie “ihre Philosophie“ (Berufsethik) verorten resp. wirksam machen können. Dabei geht es in entscheidendem Masse um realistische Gestaltungsräume mit einer bewusst bildungs-ethischen Ausrichtung. Die Burnoutforschung hat diesbezüglich wiederholt festgestellt, dass die große Lähmung (Frustration) einerseits Resultat überhöhter Ansprüche (Perfektionismus) und andererseits nicht anpackbarer Konflikte (z.B. Sparpolitik auf dem Buckel der Schulen) ist. Auszuloten, wann Widerspruch im Schulalltag angemessen sei und wann er klüger auf das (politische) Leben außerhalb der Schule fokussiert werden müsste, ist deshalb eine genuin philosophische Frage. Im philosophischen Coaching mit LPs steht zunächst einmal der Freiheitsbegriff im Vordergrund: In Anlehnung an Sartres „Ist der Existenzialismus ein Humanismus?“3 (Warum nicht diese Schrift gemeinsam lesen?) soll geklärt werden, dass keine LP in sich den „authentischen Zustand“, der sie zum Handeln drängt, suchen kann noch von einer pädagogischen Moral „die Begriffe erwarten kann“, die ihr zu handeln erlauben. Es ist vielmehr so, dass Lehrpersonen ein Gefühl für Handlungsspielräume entwickeln müssen, die zu ihrer vorgefundenen Situation passen. Fehlt diese Passung, wächst die Gefahr einer (depressiven) Michael-Kohlhaas-Haltung; in Abgrenzung zu Sartre geht es nicht um „die Freiheit“ sondern um Freiheiten gleichsam in homöopathischen 3 Sartre (1994 ) WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 5 Dosen. Anhand von Einzelfallanalysen kann der philosophische Praktiker im Dialog mit der LP gewissermaßen das Terrain („die Spielwiese“) abstecken, auf der – solange innerhalb einer Institution gewirkt wird - Varianten und überraschende Spielzüge entwickelt werden können. Die komplexere Frage nach der „Erweiterung der Kampfzone“ erfordert politisch-philosophisches Gespür. Nüchternheit im Umgang mit der Profession „Lehre“ ist da wohl angebrachter als ein noch bis vor kurzer Zeit überbordender Idealismus, dem vor allem junge LPs ins offene Messer rannten. Die idealistische Gefahr im Lehrberuf dokumentieren auf sehr eindrückliche Weise Schulfilme wie Der junge Törless, Der Klub der toten Dichter, Entre les murs, Etre et avoir, Die Welle etc., in denen LPs entweder unter- oder überschätzt werden. Gerade aber Botschaften in Richtung „Gelingender Unterricht ist immer möglich, wenn man es nur richtig macht!“, sind eigentliche „killing phrases“, die entmutigen und die einer detaillierten „Aufbereitung“ bedürfen. Die Analyse des Scheiterns in der Lehre birgt oft eine relativierende und ironisierende Kraft. „Kann ich meine Anteile bei bestimmten Schwierigkeiten klar benennen?“, ist eine ebenso wichtige Frage wie die nach den Beiträgen, die Schüler/innen, Familien oder Schulen zu leisten haben. Entscheidend für die Analyse des Scheiterns (wie auch für diejenige des Erfolgs) sind zwei Dinge: Die Begriffe „Scheitern“ und „Erfolg“ müssen ihrer Selbstverständlichkeit beraubt und in Relation zur „begrifflichen Sozialisation“ der LPs und zu einer allgemeinen Terminologie gesetzt werden. Nur so entsteht die kritische Distanz zu den Phänomenen in einem Berufsfeld, die Ausgangspunkt für Burnouts und andere Formen von Berufsverdrossenheit sind. Mindmaps zu „Scheitern“ und „Erfolg“, Collagen und philosophische Standbilder sind günstige methodische Ansätze, weil sie sowohl die Analyse als auch Beobachtung konkreter „Vorfälle“ erlauben. „Der Mensch kann als Sklave in einer heidnischen Gesellschaft oder als Feudalherr oder als Proletarier geboren werden. Was nicht variiert, ist die Notwendigkeit, in der Welt zu sein, in ihr zu arbeiten, inmitten anderer und sterblich zu sein. Die Grenzen sind weder subjektiv noch objektiv, oder besser, sie haben eine objektive und eine subjektive Seite“, sagt Sartre4. Das Ausloten „der beiden Seiten“ hilft dann auch für die Klärung, woher die persönliche Störung einer LP kommt. Überwiegt der objektive Anteil, kommt Politik ins Spiel. Wer als LP weiß, wo sie ihren Widerstand verorten kann, also welche „Spielwiese“ für welche Aktivität vonnöten ist, lebt, das zeigen alle diesbezüglichen Umfragen, besser, gerade auch in professioneller Hinsicht. Das vorkritische, systematische Verwechseln aber beispielsweise einer Lehrerversammlung mit einer Gewerkschaftssitzung kann zu erheblichen Problemen führen. Philosophisches Coaching ist da auch eine Arbeit an der Kultur der Öffentlichkeit. 4 Sartre (1994), S. 125 6 | MARKUS WALDVOGEL Da die bildungspolitische Diskussion zudem die Sprachregelungen festlegt, mit denen gefochten werden soll oder darf (political correctness), liefert sie auch die Trends der Diskussion. Sachverstand ist dabei weniger im Vordergrund als ideologische Akzeptanz. Die Bildungsdebatte soll sich dem medial ausgerichteten Reden unterziehen. Sie soll eine Leitlinie verpasst kriegen, an der sich Parteigänger, Regierungsmitglieder und Selbständige ebenso orientieren müssen wie Vertreter/innen von NGOs (nicht staatliche Organisationen) oder NPOs (nicht profitorientierte Organisationen). Methodenschritt 3: Philosophische Begriffsarbeit Philosophische Praktiker resp. ihre „Kunden“ kommen nicht umhin, hier mitzureden und vorgegebene Begriffe (oft „Plastikwörter“ im Sinne Uwe Pörksens) wie Evaluation, Minimal- /Maximalstandards, Prozessorientierung, Harmonisierung, System, Eigenverantwortung, Effizienz etc. nicht sang- und klanglos „passieren“ zu lassen. Dabei geht’s im philosophischen Coaching von LPs um eine zielgerichtete Arbeit einerseits an der eigenen Sprachsensibilität („Warum fielen mir diese Begriffe bisher nicht besonders auf?“/ „Was genau nehme ich wahr, wenn ich „Minimalstandard“ höre?“ / „Wie kann ich feststellen, dass ich selber mit Worthülsen, Fremdwörtern etc. arbeite und was genau bezwecke („meine“) ich mit solchen Begriffen?“) und an den Sprechakten anderer, die in ihrer Intention ja auch benennbare Ziele (z.B. Erreichen von mehr kommunikativer Autorität) verfolgen. Am Beispiel von pädagogischen Fachtexten (s. unten im Lauftext), dominanten Begriffen und Argumentationsmustern kann konkret und präzise deutlich gemacht werden, wie ein bestimmter Umgang mit Wörtern Einfluss auf die tägliche Arbeit nimmt und oft den Blick aufs Konkrete, Vielfältige verstellt. Im Coaching soll das Gefühl für die Herrschaft der Abstraktionen wachsen, so wie das Pörksen beschrieb: „Die Kritik an Korns „Sprache in der verwalteten Welt“, den Typus der Verwaltungssprache habe es schon immer gegeben, trifft nicht. Ihn beschäftigte deren Wucherung über den Rahmen ihrer ursprünglichen Verwendung hinaus. Die wissenschaftliche Literatur der Pädagogik z.B. hat sich, seit „Bildung“ zur großen Ressource erklärt wurde und ihre wissenschaftlichen Produktionsplätze in die Höhe schnellten, enorm verwissenschaftlicht, proportional multipliziert und die unvermeidlichen Kennzeichen einer Massenware angenommen, und ihre Sprache ist seltsamerweise oft nicht mehr von der einer Verwaltungsvorschrift zu unterscheiden. Die Übertragung wird einem kaum mehr bewusst und wirkt deshalb umso selbstverständlicher. Die Chance der praktischen Kolonisation unserer Welt beruht nicht zuletzt darauf, dass ihr eine metaphorische vorausgeht. Das stereotypische Besteck steht zur Verfügung. Die Übertragung aber erschließt nicht nur, wie gesagt, sie entstellt und WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 7 entfremdet auch. Die metaphorische Kolonisation bedeutet, sprachlich wie sachlich, eine Entstellung der sozialen Welt.“5 Methodische Untersuchungen etwa von Komposita wie „Minimalstandards“ oder „Ausdruckskompetenz“ erhellen, was der Wortgebrauch verstellt. Was heißt denn „minimal“? Ist damit eine „conditio sine qua non“ gemeint oder ein Anzustrebendes, neben dem sehr Vieles (Wichtigeres?) Platz hat oder zielt der Begriff Richtung einer zähneknirschend akzeptierten Lehr- und Lernsituation, bei der mit Sicherheit noch „die Schraube anzuziehen wäre“? „Minimal“ hat als Wort durchaus auch euphemistischen Charakter, denn dahinter steckt m.E. eine differentielle Absicht und die Drohung der Exkommunikation resp. Listenplatzbrandmarkung für jene, die das „Minime“ nicht erreichen. In Verbindung mit Standards wird „minimal“ gewissermaßen kristallisiert. Standards huldigen einer Praxis der schriftlichen Evaluation. Wer von Standards spricht, meint Vergleichbarkeit und zwar im statistischen, „harten“ Sinne des Wortes. Angesichts der Tatsache, dass es bezüglich der Sprache eigentlich um „Ausdruck“, um Energie, Mitteilungsbedürfnisse etc. geht, ist eine Standardisierung schlicht sachfremd. Im philosophischen Coaching mit LPs kann durchaus Michael Tomasellos Untersuchung „Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation“ beigezogen werden. Die Kapitel „Konventionalisierung von Sprachkonstruktionen“ und „Sprache als geteilte Intentionalität“ lassen den Abstraktionsapparat, mit dem Kinder und Jugendliche bezüglich ihrer „Sprache“ eingeordnet werden, als vollends absurd erscheinen. Wie im Methodenschritt 2 schon angedeutet, kann es aber nur darum gehen, einerseits die eigene Arbeit mit „Worthülsen“ zu bedenken und persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen und andererseits einen professionelleren Umgang mit Termini in der täglichen Arbeit einzufordern. Der pädagogische Schonraum, den man auch im 20. Jahrhundert durchwegs noch als Voraussetzung für gelingendes Lehren und Lernen bezeichnete, gerät nämlich zunehmend unter Beschuss. Bildung soll rasch auf das reagieren, was „in der Welt“ geschieht. Bildung wird gewissermassen in die Konflikte hineingezogen. Sie verliert dabei, entgegen allen anders lautenden Erklärungen, einen Teil ihrer eigentlichen Qualität, nämlich Zeit und Rhythmisierungshoheit innerhalb eines Gesamtrahmens. Bildung soll verstärkt „an die Leine genommen werden“. Dabei wird unterstellt, dass die Evaluation schon von kleinsten Bildungschritten gleichsam automatisch zu mehr Qualität führe. Bildungsoffensiven seien vonnöten, die Resultate einschlägiger internationaler Studien (PISA etc.) hätten es deutlich gemacht, man stehe vor einem eigentlichen Debakel, was den Rohstoff Bildung betreffe. Nicht angemerkt wird, dass die schulischen Einrichtungen seit Jahrzehnten mit neuen Themen eingedeckt werden, dass „Individualisierung“, „Globalisierung“, „Integration“, „Ökologie“, 5 Pörksen (1988), S. 93 10 | MARKUS WALDVOGEL Privatisierern wünschen sie sich Schulen, die in erster Linie den unterschiedlichen Begabungsprofilen Rechnung tragen. Für die oft aus besseren Kreisen stammenden Kinder ist nur das gut genug, was deren persönliches Wachstum fördert. Schliesslich bezahlt man ja viele Steuern und will eine entsprechende Gegenleistung. Diese bildungsbürgerliche Position vertreten heute sozialdemokratisierte, grünliberale Bürger/innen. Das Bildungsbürgertum ist gewissermassen nach links gerutscht, das Wirtschaftsbürgertum orientiert sich dagegen an effizienten, abgespeckten Lernschulen, die über ein hohes Mass an Standardisierung verfügen. Die philosophische Praxis entwickelt entsprechende Fragen: Ist „Individualisierung“ per se ein Wert? Welches Verhältnis zur öffentlichen Schule wollen und müssen wir einnehmen? Wie kann die Gemeinschaft der „Citoyens“ (Staatsbürger/innen, Republikaner/innen) der mit zunehmenden Schwierigkeiten kämpfenden Volksschule (und dem öffentlichen Bildungswesen überhaupt) „helfen“? Inwiefern sind es die Bedingungen der Möglichkeit des Aufwachsens (nicht zuletzt in grösseren Ballungsräumen), die den Lehrberuf per definitionem „schmälern“? Müsste nicht die „Holy Family“ (resp. was von ihr übrig blieb) zum Gegenstand der Diskussion werden? Gibt es Möglichkeiten, bestimmte krank machende, unwürdige Unterrichtssituationen zu verweigern? Welches sind die „Eckpfeiler“ des Unterrichtens und wo wird Schule zu einer Reparaturwerkstatt zerfallender sozialer Einheiten? Worum geht es eigentlich? „Wollen wir, “ sagt Hartmut von Hentig, „dass Kinder Wissen erwerben, müssen erst wir, dann sie zwischen Wichtigem, potentiell Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden; wir müssen dann dafür sorgen, dass sie Fragen haben, diese richtig formulieren lernen und am Ende die Beschaffer – Bücher, Computer, Filme, Auskunftspersonal - bemühen. … Die hier wichtigsten Tätigkeiten sind: wahrnehmen, denken, prüfen, verstehen.“ Diese vier Tätigkeiten können nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Sie bedürfen der Sorgfalt, der Pflege und einer gewissen Bedächtigkeit. Bildungsmarkt und Ausbildungswissen verkommen rasch zu einem „Edutainment“, wenn wir an den kulturtechnischen Voraussetzungen sparen oder sie zu einem blossen Spiel des Wissenserwerbs reduzieren. „Für den großen Haufen tritt überall an ihre (der Bildung, d. Verf.) Stelle eine Art Abrichtung: sie wird bewerkstelligt durch Beispiel, Gewohnheit und sehr frühzeitiges, festes Einprägen gewisser Begriffe, ehe irgend Erfahrung, Verstand und Urtheilskraft dawären, das Werk zu stören. So werden Gedanken eingeimpft, die nachher so fest und durch keine Belehrung zu erschüttern haften, als wären sie angeboren, wofür sie auch oft, selbst von Philosophen, angesehn worden sind.“7 Wenn Bildung sich auf die Widergabe eingeimpfter und evaluierbarer Gedanken konzentriert, verpasst sie ihre eigentliche Aufgabe, Standards so weit 7 Schopenhauer (1999), S. 24448 WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 11 wie angebracht zu fassen und nachdrücklich sowohl musische, soziale, politische als auch Artikulationskompetenzen zu formulieren. Wenn sie das nun unter der Flagge der Entschlackung oder Schlankheit nicht tut, entlarvt sie sich als Ideologie der Abrichtung, die alles andere will als wirkliche Reformen. Auch hier setzt die praktische Arbeit des Philosophen an. Er fragt beispielsweise nach der Differenz zwischen „bewährten“ schulischen Konzepten und den andauernden Neuerungen im „Bildungssystem“. Aus der Klärung muss hervorgehen, wodurch „Reformen“ motiviert werden. Fragen wie die folgenden gehören zum Setting philosophischer Arbeit im Bildungsbereich: • Sind die Ziele von Reformen klar umrissen? einer philosophischen (Lebens-)Prüfung • Halten die pädagogischen Begriffe 8 stand? (Elenchos, gr. = „Prüfung" .) Beispiel 1: „Didaktik ist also die nach bestimmten Prinzipien durchgeführte und auf allgemeine Intentionen bezogene Transformation von Inhalten zu Unterrichtsgegenständen.“ 9 Beispiel 2: „Neben dem Hinweis auf den autofunktionalen Charakter von Bildung gegen ein utilitaristisches Brauchbarkeitskonzept, dessen wesentliches Merkmal eine ökonomisch ausgerichtete Funktionalität darstellt, gilt es schließlich, in einer pädagogischen Handlungstheorie System und Subjekt nicht autopoetisch emergieren zu lassen, sondern mittels Selbstreflexivität zu gestalten.“10 (Raithel u.a.: Einführung Pädagogik; eines der meistgekauften Lehrbücher!!!). Was bedeutet „Didaktik“ genau, wie hat sie beispielsweise Comenius definiert und was blieb davon übrig? Welche Ziele verfolgt sie? Welchen Gewinn erbringt die unter Beispiel 1 zitierte Definition? Was sind „bestimmte Prinzipien“? Gibt es unbestimmte Prinzipien? Wenn ja, was bedeutete das? Wie transferiert man „Inhalte zu Unterrichtsgegenständen“? Was suggeriert diese Formel? Wie ist ein Unterrichtsgegenstand zu definieren? Soll ein Pädagogikschüler diese Definition „lernen“? Wenn nein, wie soll er mit diesem Lehrbuch umgehen? Wenn ja, was hieße das? Warum wird Beispiel 2 nicht verständlich formuliert, steckte in ihm m.E. doch eine der wichtigsten bildungstheoretischen Aussagen? Warum ist gerade die theoretische Pädagogik oft immun gegenüber sprachlicher Präzision? Was soll dieser Jargon? Warum werden Verständlichkeit und Schlichtheit nicht zu einem verbindlichen Bildungsziel erhoben? Abgeleitet vom Verb elenchein, „prüfen", „beweisen", „widerlegen". Kaiser/Kaiser (2001), S. 217 10 Raithel (2007), S. 217 8 9 12 | MARKUS WALDVOGEL Dazu eine Hilfestellung von Pestalozzi in Anlehnung an Kant, die für sich selbst spricht und ein Argument im öffentlichen Streit abgibt: „I. Anschauung ohne Sprache macht Menschen, wie wir die große Masse der Landbauer vor Augen sehen, Menschen, die sich, wenn sie auch noch so lebendige Anschauungserkenntnisse im ganzen Kreise ihres Seins und ihres Tuns in sich selbst tragen, sich dennoch in keinem Falle über diese Erkenntnisse bestimmt ausdrücken und verständlich machen können, deshalb auch den ganzen Vorteil entbehren müssen, am Faden ihres bestimmten Wissens durch die Sprache weiter schreiten zu können, daher denn auch sehr leicht erklärlich ist, warum die große Masse dieser Menschen so wenig Reiz und so wenig Willen in sich selbst findet, über irgend etwas, das sie nicht Nutzens oder Schadens halber individualiter nahe berührt, sich viel zu bekümmern, und allmählich dahin kommen, über den ganzen Kreis der menschlichen Einsichten und Kenntnisse, und selbst über Wahrheit und Recht, insofern auch diese Fundamente unserer Glückseligkeit auf Kenntnissen und Einsichten ruhen, gleichgültig zu werden. II. Sprache ohne Anschauung Diese bildet kopflose Redhänser (= Redehänse), die es sich zur Fertigkeit gemacht haben, von Sachen, die ihr Auge nicht gesehen, ihr Ohr nicht gehört, und die noch viel weniger in ihren Herzen aufgestiegen sind, also zu reden, als ob sie selbige mit ihren Augen gesehen, mit ihren Ohren gehört und sogar, wie eine Mutter ihr Kind, unter dem Herzen getragen hätten. Sie bildet Menschen, die von den grundlosen Anmaßungen eines solchen leeren Wortwissens geblendet, in sich selbst allen Reiz verlieren, sich Kopfs und Herzens halber weiter in einen Gegenstand hineinzuarbeiten, über den sie sich nun einmal durch eine solche Maularbeit mit sich selbst ins reine gesetzt haben.“11 • Sind schulische Stoffe entwicklungspsychologisch „abgesichert“ oder wird auf der Lehrplanebene das „So-tun-als-ob-Spiel“ gespielt? Werden also schulische Selbstverständlichkeiten postuliert, wo weit und breit keine zu finden sind? Halten Lehrpläne der Idee der sokratischen Lebensprüfung stand? Dazu meint Hartmut von Hentig in seiner Schrift „Bewährung“: „Die großen Reformer haben eh und je der Pädagogik (also der Anleitung der jungen Menschen zum Leben in der Gesellschaft) den Bruch mit der Tradition zugetraut: Platon im aporetischen Gespräch des Sokrates mit der Jugend, das dem eigensinnigen Aufklärer sogar das Leben gekostet hat; Jean-Jacques Rousseau mit dem kühnsten Gedankenexperiment, das sich mit dem Namen »Pädagogik « bekleidet hat – der Darstellung davon, wie sein Emile zu einem freien Menschen erzogen wird, der den Contrat Social eingehen kann; 11 Pestalozzi (1899-1902), S. 99f. WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 13 John Dewey, der die gesamte »education« (Erziehung-und-Bildung) als ein notwendiges permanentes Experiment der Gesellschaft mit neuen Lebens- und Denkformen aufgrund gehabter Erfahrung verstanden wissen wollte; die Männer und Frauen der Jugendbewegung – und die sich ihnen verdankende Reformpädagogik –, die zum offenen Ausbruch aus der Schulmeisterei und verhockten Moral der Erwachsenen aufriefen; Friedrich Nietzsche, der seine eigene hohe Bildung und Sprache gegen das Philistertum der Bürger und Gelehrten einsetzte; … Ivan Illich, der den jungen lateinamerikanischen Nationen den Weg in die Schulsklaverei ersparen wollte und dabei ganz selbstverständlich auf Bildung setzte: auf freie gegenseitige Wahl des Lehrmeisters und der Schüler, auf Bibliotheken und Internet, auf entinstitutionalisiertes selbständiges Forschen und Lernen; und nicht zuletzt die große Margaret Mead mit ihrem Modell der »cofigurativen« Kultur, in der alle von allen lernen, und ihrer Vorhersage der »präfigurativen« Kultur, in der die Personen »vor« den erst zu gewinnenden Deutungen (»Sinnfiguren«) da sind, in der die Jungen verstanden und akzeptiert haben, dass sie von den Alten nicht lernen können, welchen Schritt sie als nächsten tun müssen, und in der die Alten wissen: »Wir haben keine Nachfahren, unsere Kinder haben keine Vorfahren mehr«12. Damit müsse man zu leben lernen. Auch diese eher Revolutionäre als Reformer haben die Schule nicht verdrängen oder auch nur zurückdrängen können. Ihnen ist allenfalls eine Beunruhigung des Systems gelungen. Dieses hat sie und ihre gefährlichen Lehren verdaut – es hat sich weder dem platonischen Auftrag gewachsen gezeigt noch dem pragmatischen Experimentieren gestellt. Nach wie vor hat sich die Schule als die eine zuständige Einrichtung behauptet, die die jungen Menschen zwischen ihrem sechsten und sechzehnten oder zwanzigsten Lebensjahr bindet, beschäftigt, belehrt, beaufsichtigt, bewahrt, beschwichtigt (»auskühlt«) und in die beruflichen und sozialen Fächer sortiert, die die Gesellschaft bereithält.“13 • Wird die Frage nach „Bildung“ und „Ausbildung“ in der schulpädagogischen Diskussion überhaupt gestellt? Können sich die Lehrkräfte in staatlichen Schulen in Zeiten der Verwöhnung und Hyperkonsumation noch mit pädagogisch-philosophischen Anliegen durchsetzen? Hat „der Staat“ ein Problem mit seinen Familien? Gibt es eine Pflicht, Kinder zur Unterrichtsfähigkeit zu erziehen? Ist diese Frage zulässig? Wenn nein, warum nicht und inwiefern wird den Lehrpersonen geholfen? • Warum wird der Begriff „Effizienz“ in der bildungspolitischen Diskussion so sehr in den Vordergrund geschoben? Was bedeutet „Wirksamkeit“, was „Wirtschaftlichkeit“? Wird hier bewusst eine Annäherung von Pädagogik und Ökonomie betrieben? Argumentationshilfe leistet diesmal John Dewey in „Demokratie und Erziehung“: 12 13 Mead (1971), S. 78 v. Hentig (2007), S. 75f. 14 | MARKUS WALDVOGEL „Es ist jedenfalls wichtiger, die geistige Schaffens- und Schöpferkraft des Schülers lebendig zu erhalten, als die äußere Vollkommenheit der Arbeitsergebnisse sicherzustellen, indem dem Schüler eine bis in alle Einzelheiten geregelte Stückarbeit zugewiesen wird. Peinliche Genauigkeit und Vollkommenheit im Einzelnen können insoweit gefördert werden, als sie im Bereich der Fähigkeiten des Schülers liegen. Das unbewußte Misstrauen gegenüber der eigenen Erfahrung des Schülers, wie es in der Übertreibung der äußeren Überwachung hervortritt, zeigt sich nicht nur in dem Arbeitsstoff, den die Schule auswählt, sondern ebenso sehr in den Weisungen, die der Lehrer gibt. Die Furcht vor dem „Rohstoff" tritt ebenso sehr im naturkundlichen Arbeitsraum, wie in der Werkstatt, im Fröbelschen Kindergarten wie in MontessoriKlassen zutage. Überall werden Stoffe verwendet, die der vervollkommnenden Arbeit des Geistes bereits unterworfen worden sind: ein Verfahren, das in der Werkstatt ebenso deutlich ist wie beim theoretischen Lernen aus Büchern. Dass ein so vorbereiteter Arbeitsstoff Fehlgriffe des Schülers verhütet, ist richtig. Falsch dagegen ist die Auffassung, dass der Schüler, der so vorbereitetes Material verwendet, die geistige Leistung, die in dieser Vorbereitung steckt, irgendwie in sich aufnehmen wird. Nur wenn wir mit dem Rohstoff beginnen und ihn zweckentsprechender Behandlung unterwerfen, erwerben wir die geistige Fähigkeit, die sich im vollendeten Gegenstand verkörpert.... Eine andere Form, in der uns der gleiche Grundsatz entgegentritt, ist die Forderung, dass die tätige Beschäftigung stets auf ein Ganzes gerichtet sein soll. „Ganz" im pädagogischen Sinne sind jedoch niemals rein äußere Angelegenheiten, Dinge und Vorgänge. Geistig gesehen beruht das Vorhandensein einer Ganzheit auf einem Erfaßtsein, einem Interesse: es ist nicht dem Umfange, sondern der Art nach bestimmt, ist die Allseitigkeit, mit der uns eine gegebene Sachlage anspricht. Übertreibungen in der Entwicklung von Fertigkeiten unabhängig vom jeweiligen Zwecke wirken sich darin aus, dass Übungen lediglich um der Übung willen angestellt werden, nicht im Dienste irgendeiner sachlichen Aufgabe...“ 13 • Alle diese Fragen orientieren sich an der Leitfrage „Worum geht es da eigentlich?“ Mit welchen Zielen, Begriffen und Menschenbildern wird “unterm Strich“ gearbeitet? Aus Erfahrung weiß ich, dass diese Frage, immer wieder gestellt, nach Argumentationen verlangt, wo Ideologie zu dominieren droht. Es ist klar, dass die oben erwähnte „überfrachtete“ Schule ebenso wie die oft unter Sonderbedingungen arbeitenden Privatschulen bereits Resultat einer bestimmten Ideologie sein können. Der in der Schule oder mit Lehrpersonen (und Eltern) arbeitende Philosoph hat deshalb die klassische Verantwortung, über Ideologien, blinde Flecken und (neue)Tabus zu reden, gerade auch mit seinen Gesinnungsgenoss/innen, die ansonsten allzu leicht einem destruktiven, „gut gemeinten“ Reformeifer anheim fallen könnten. Grundsätzlich gilt diesbezüglich, dass keine Reform 14 Dewey (1949), S.227ff. WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 15 angezettelt werden können sollte, die nicht über einen klar ausgewiesenen „Mehrwert“ verfügt. „Im Zweifelsfalle nicht!“, bedeutet hier, als durchaus günstige Aussage, „Hände weg von Reformen, die unserer Leitfrage Worum geht es hier eigentlich? nicht standhalten können“. • Hans Vaihinger (1852-1933), Philosophieprofessor in Halle, hat vor 132 Jahren an der Universität Straßburg eine Habilitationsschrift eingereicht, die später unter dem Titel „Die Philosophie des Als-Ob" bekannt wurde. Vaihinger unterscheidet darin die objektive Gültigkeit von Erkenntnis und deren Wert für die Lebenspraxis. Was der Mensch vermöge seiner Erkenntnisfähigkeit bilden könne, seien Vorstellungen und Fiktionen; diese ließen sich nur rechtfertigen durch den Erfolg des Handelns, das sich auf sie stützt. Vaihingers Fiktionalismus gleicht damit dem amerikanischen Pragmatismus (z.B. James, 1907; Dewey, 1929). Vaihinger problematisiert die Rolle der Fiktionen, welche gewissermaßen als vorkritische Konstrukte einer Prüfung bedürften, weil sie sonst Gefahr liefen, als „Wirklichkeit“ verkannt zu werden. Deshalb sind sie als Lebenshilfen und vor allem auch Orientierungsgrößen hoch problematisch versagen leicht. („So ist Wahrheit eben auch nur der zweckmäßigste Grad des Irrtums und Irrtum der zweckmäßigste Grad der Vorstellung, der Fiktion. Unsere Vorstellungswelt heißen wir dann wahr, wenn sie uns erlaubt, am besten die Objektivität zu berechnen und in ihr zu handeln; denn die so genannte Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ist doch endlich als Kriterium aufzugeben.“)15 Wenn nun die Bildungspolitik mit ihren Auswirkungen in die schulische Lebenswelt von der Fiktion des „homo oeconomicus“ ausgeht, haben wir es mit einem (philosophischen) Reduktionismus zu tun, der in keiner Weise die Hürden der Demokratie genommen hat. Er wurde vielmehr über raffiniert eingeleitete Umwege („geleitete Schulen“ / “Bildungsstandards“ / “Schulen als Betriebe“ / “Schüler/innen als Kund/innen“ etc.) „scheibchenweise“ institutionalisiert, zu oft und durchaus mit Hilfe der „Lieben und Netten“, die Reformen fast a priorisch als positiv einstuften. 15 Vaihinger (1922), S. 115 16 | MARKUS WALDVOGEL Das muss entlarvt und revidiert werden, damit größeres Unheil verhindert werden kann. Denn philosophische Fragen wurden auf dem Weg zur sich anbahnenden McKinsey-Bildung bisher in auffälliger Weise keine gestellt. Sie können aber noch gestellt werden, denn mittlerweile regt sich auf der Umsetzungsebene Widerstand: Richard Münch beispielsweise macht mit seinem sehr lesenswerten Buch „Globale Eliten, lokale Autoritäten“ deutlich, wo die Interessen der Verökonomisierung aller Schulen liegen und wo die Interessenvertreter ansetzen. Auf alle Fälle kann mit einer hybriden Modernisierung der Schule kein humanistisches Bildungsideal mehr erreicht werden und wir tun gut daran, nicht so zu tun als ob es heute weltweit bildungspolitisch noch um echte Verbesserungen ginge. Dazu noch einmal Hartmut von Hentig: „Einstweilen bescheiden wir uns mit der Erkenntnis, dass »bessere Bildung« nicht nur heißen muss, was die OECD vorschreibt und ermitteln kann. Wenn sehr viele Absolventen unserer Schulen nicht lesen und nur unsicher schreiben können, wenn sie Schwierigkeiten haben, elementare Erkenntnismittel zu benutzen – die Zahlensysteme, die tabellarische und grafische Veranschaulichung von Verhältnissen, die Computer, die Nachschlagewerke; wenn ihnen grundlegende Tatbestände der Naturwissenschaften unbekannt sind; wenn sie in der lingua franca unserer Zeit nicht mitreden können, dann ist ihre Bildung unzweifelhaft nicht gut genug. An der Beseitigung dieser Schwäche wird gearbeitet. Wie jedoch arbeitet man an der Beseitigung von Mängeln, die nicht mit der gleichen Deutlichkeit und Einmütigkeit erkannt, geschweige denn durch empirische Untersuchungen belegt sind? Wenn es zum Beispiel an Zuversicht und Selbstvertrauen fehlt, an Gemeinsinn und Verantwortungsgefühl, an Verlässlichkeit und Ausdauer, an physischer Belastbarkeit und psychischer Selbstkontrolle, an Toleranz für andere Lebensformen und Rücksicht auf Schwächere, an praktischem Geschick und nicht zuletzt an der wichtigen Wahrnehmung, nützlich sein zu können, ja, gebraucht zu werden?“16 Wer gebraucht wird, den empfängt man üblicherweise mit einem „Welcome!“ Warum tun wir das heute mit vielen Jugendlichen nicht? Warum fehlen eigentliche Initiationsrituale in die Gesellschaft? In diesen Bereichen können erreichbare Zielvorgaben mit einer philosophischen Untermauerung formuliert werden. Martin Buber, Erich Fromm und Alfred Adler sind nur ein paar mögliche „Philosophen mit pädagogischem Einschlag“, aus deren Werk Zitate gewonnen werden können, die durchaus das Motto für ein Quartal, ein Semester oder eine Arbeitswoche abgeben können. Dies im Sinne einer Strukturierung, Untermauerung und Ausrichtung („Kompass“) der pädagogischen Arbeit. 16 v. Hentig (2006), S. 102f. WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 17 Methodenschritt 5: Klären und Stärken Entscheidend fürs philosophische Coaching ist das Klären von Sachverhalten, das Bewusstmachen des Unterschieds von persönlichen und „politischen“ Problemen und letztlich die Stärkung von Persönlichkeiten (v.a. Lehrpersonen) auch in spiritueller Hinsicht. Kognitive Fitness allein reicht nicht aus, um „über den Berg“ zu kommen. Das Klären von Sachverhalten meint in der philosophischen Praxis ein Verhältnis: Es ist wichtig, dass LP sich klar machen können, was ihnen gut tut, was sie stärkt und wo sie Mängel beheben möchten, um entspannter, freier und zielgerichteter „Lehre“ zu betreiben. Methodisch bedeutete das eine Hinführung zur Mündigkeit, zur Autonomie. Das geht nicht, ohne dass dabei auch das Kostbarste, Innerste angesprochen wird. Mentale Fitness ist zwar ein schöner Begriff, letztlich geht’s aber nicht um Fitness sondern um den aufrechten Gang, und zwar sowohl ganz konkret wie metaphorisch. Wie eine LP hinsteht, atmet, formuliert, „tönt“, schreibt, musiziert, zeichnet, bastelt, verhandelt, nachdenkt oder liest, verkörpert eigentlich nur die Spitze des Eisbergs; hinter diesen Handlungen stecken Lebenseinstellungen und Vorstellungen von den letzten Dingen, von dem, was wirklich entscheidend ist. Im philosophischen Gespräch sollen Nah- und Fernziele gestalterisch dargestellt (durchaus auf Packpapier…), Herausforderungen genau beschrieben, Wünsche ausgedeutscht, ästhetische Vorstellungen aufgegriffen und spirituelle Überlegungen angestellt werden. Das rationalistische Verbrämen der Grenzgebiete zwischen Philosophie, Theologie und Kunst weicht in der philosophischen Arbeit mit LPs einem gestalterischen Umgang: Das Hören von Musik, das Zeichnen, Malen, Schreiben aber auch die Entwicklung von Ritualen zur Lebensfreude haben einen festen Platz bei allen Problemlösungen, die diesem aufrechten Gang verpflichtet sind. Davon spricht der nächste Abschnitt. Über Francesco Petrarca wird erzählt, wie er in einem Brief an einen Freund die Besteigung des Mont Ventoux am 24. April 1336 kommentierte. Er erlebte die wilde Natur auf dem Aufstieg als beglückend. Er war ergriffen. Auf dem Gipfel schließlich übermannte ihn die Aussicht von den Alpen bis hin zur Rhonemündung. Ihm bot sich ein überwältigendes Bild. Wenig später wandte er sich der Lektüre von Augustinus’ Bekenntnissen zu. Wahllos schlug er das Buch auf und las: “Und es gehen die Menschen zu bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die weit dahinfliessenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne und haben nicht acht ihrer selbst.“17 17 Augustinus (1982), X/S. 8 18 | MARKUS WALDVOGEL Beeindruckt wandte sich Petrarca von der spektakulären Natur ab, um sich dem Selbststudium, der Einkehr bei sich selbst, zu widmen. Das Wissen über die Natur schien ihm angesichts der brennenderen Fragen nach der eigenen Identität, nach dem eigenen Weg, zweitrangig. Petrarca entschied sich, nach einem „modernen“, neuzeitlichen Blick in die Welt, für den inneren Weg. Er wollte seine Wahrheit mit meditativ-kontemplativen Mitteln finden. Er hätte auch anders entscheiden können. Die Welt lag ihm in ihrem Reichtum und ihrer Gewalt, buchstäblich zu Füssen. Der „Pilger ohne Ende“, wie er sich selbst nannte, suchte sich zeitlebens zu orientieren zwischen der vita solitaria und der vita activa. Glücklich wurde er dabei nicht. Orientierungslos aber auch nicht. Er konnte sich ein Bild davon machen, wie ihm geschah. Er identifizierte seine Zerrissenheit. Er konnte sich selber „über die Schultern blicken“, Selbstbewusstsein „im Scheitern“ aufbauen. Petrarca litt an seiner seelischen Gespaltenheit, die auch Ausdruck der Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit war. Das formulierte Leiden wurde aber zum Ausdruck einer Freiheit, die stumpfe Abhängigkeit hinter sich lässt. Petrarca machte sich ein Bild seiner selbst und seiner Zeit. Petrarca war gebildet. Er war jederzeit fähig, sich einzumischen. Er besaß Visionen und Orientierung. Kant schreibt am Schluss seines Essays „Über Pädagogik“: „In unserer Seele ist etwas, dass wir Interesse nehmen 1) an unserem Selbst, 2) an andern, mit denen wir aufgewachsen sind, und dann muss 3) noch ein Interesse am Weltbesten Statt finden. Man muss Kinder mit diesem Interesse bekannt machen, damit sie ihre Seelen daran erwärmen mögen.“ 18 Kants Vorstellung von einem guten Leben weicht von Petrarcas Leidensweg entscheidend ab. Doch die Überführung eines latent vorhandenen Interesses (u.a. an sich selbst) in ein bewusst gelebtes erinnert an Petrarcas Reaktion auf Augustinus’ „…und haben nicht acht ihrer selbst.“ Das mitteilbare Interesse ist Voraussetzung für alles Reden über Orientierung. Wie man sich zwischen den Dingen bewegt, wie man sich positioniert, wohin man blickt, was Aufmerksamkeit erregt, was man übersieht, nicht wahrhaben will, was man sammeln möchte, begehrt, verachtet, was einen schreckt, beruhigt, verstört und wovon man träumt, das alles macht „Interesse“ aus und wird, in seiner bewussten Formulierung, zur eigenen Spur, die man bisher gelegt hat, resp. zur Ahnung und Vorstellung vom zukünftigen Weg, den man begehen möchte, von seinen Unwägbarkeiten und von all den Dingen, die hinter dem Netz aller erdenklichen Wege sich befinden mögen. Die „Geworfenheit“ in eine Welt, in der es unendlich viel zu entdecken, zu sehen gibt, in der man sich aber auch positionieren muss, in der es auf die eigene Haltung, auf Entscheide ankommt, ist eine Befindlichkeit, die man mit andern 18 Kant (1983), S. 761 WORUM GEHT’S DA EIGENTLICH? | 19 teilen kann, der man täglich wieder ausgesetzt ist und die uns zu einer eigenen Identität, einer eigenen Blickrichtung, zu einer persönlichen Art, „Welt“ zu sehen und zu qualifizieren, zwingt. Die Auseinandersetzung darüber, auf allen erdenklichen Niveaus, zeichnet Bildung aus. Sie anzustoßen ist der Job des praktizierenden Philosophen; in der Schule, in der politischen Debatte, in seiner Praxis. Trotz aller Gefahr, die auch Sokrates drohte. 20 | MARKUS WALDVOGEL Literatur Augustinus (1982), Bekenntnisse, Zürich/München Böhme, Gernot (1991) Philosophie als Arbeit, Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik, Heft 13 Dewey, John (1949) Demokratie und Erziehung, Braunschweig von Hentig, Hartmut (2007) Bewährung – Von der nützlichen Erfahrung nützlich zu sein, Weinheim und Basel Illich, Ivan (1972) Entschulung der Gesellschaft, München James, William (1890) Principles of psychology, New York Kant, Immanuel (1983) Über Pädagogik, Darmstadt Kaiser, Arnim und Ruth (2001), Studienbuch Pädagogik, Berlin Mead, Margret (1971), Konflikt der Generationen, Freiburg Münch, Richard (2009), Globale Eliten – lokale Autoritäten, Frankfurt Pestalozzi, Johann Heinrich (1899-1902), Über den Sinn des Gehörs, in Hinsicht auf Menschenbildung durch Ton und Sprache, Liegnitz Platon, Theaitetos (1940), Sämtliche Werke. Band 2, Berlin Platon, Politeia (2000), Stuttgart Pörksen, Uwe (1988) Plastikwörter - Die Sprache einer Internationalen Diktatur, Stuttgart Raithel u.a. (2007), Einführung in die Pädagogik – Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen, Wiesbaden Schopenhauer, Arthur (1999), Die Welt als Wille und Vorstellung, DB SchülerBibliothek: Philosophie, (vgl. Schopenhauer-ZA Bd. 3, S. 84), Berlin Sartre, Jean-Paul (1994), Der Existenzialismus ist ein Humanismus, Hamburg Sautet, Marc (1997), Ein Café für Sokrates, Düsseldorf; Zürich Tomasello, Michael (2009), Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation, Frankfurt Vaihinger, Hans (1923) Philosophie des Als-Ob, Leipzig Waldvogel, Markus (2006) Bilder der Bildung – Zehn Bilder – ein Essay, Biel Waldvogel, Markus (1993), Schule zwischen Stoff, Stress und fehlenden Visionen, München