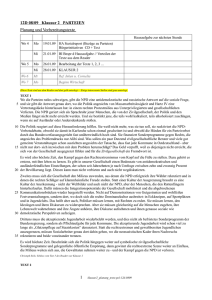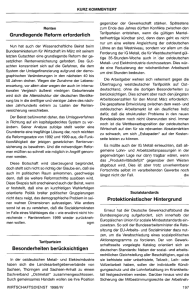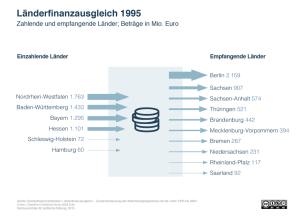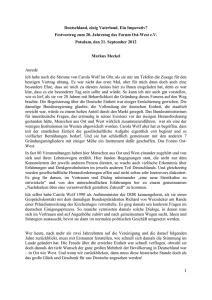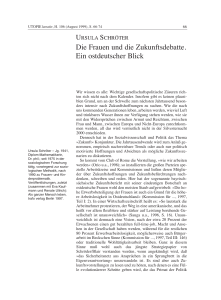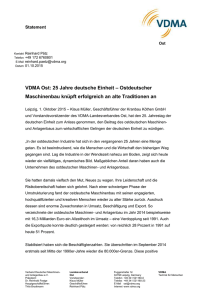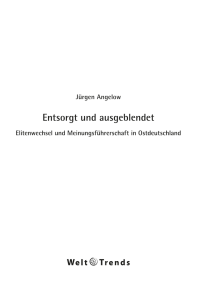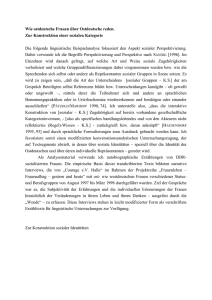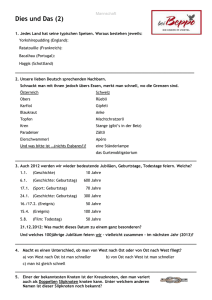Zehn Jahre deutsche Währungsunion - Was
Werbung
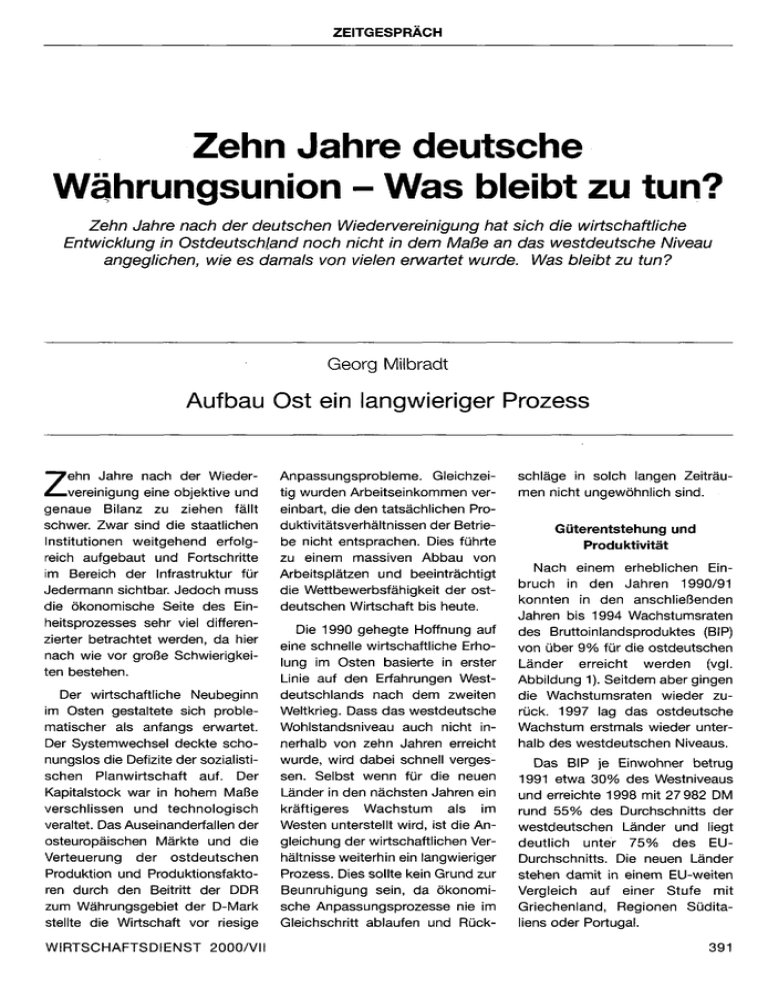
ZEITGESPRACH
Zehn Jahre deutsche
Währungsunion - Was bleibt zu tun?
Zehn Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung hat sich die wirtschaftliche
Entwicklung in Ostdeutschland noch nicht in dem Maße an das westdeutsche Niveau
angeglichen, wie es damals von vielen erwartet wurde. Was bleibt zu tun?
Georg Milbradt
Aufbau Ost ein langwieriger Prozess
Z
ehn Jahre nach der Wiedervereinigung eine objektive und
genaue Bilanz zu ziehen fällt
schwer. Zwar sind die staatlichen
Institutionen weitgehend erfolgreich aufgebaut und Fortschritte
im Bereich der Infrastruktur für
Jedermann sichtbar. Jedoch muss
die ökonomische Seite des Einheitsprozesses sehr viel differenzierter betrachtet werden, da hier
nach wie vor große Schwierigkeiten bestehen.
Der wirtschaftliche Neubeginn
im Osten gestaltete sich problematischer als anfangs erwartet.
Der Systemwechsel deckte schonungslos die Defizite der sozialistischen Planwirtschaft auf. Der
Kapitalstock war in hohem Maße
verschlissen und technologisch
veraltet. Das Auseinanderfallen der
osteuropäischen Märkte und die
Verteuerung der ostdeutschen
Produktion und Produktionsfaktoren durch den Beitritt der DDR
zum Währungsgebiet der D-Mark
stellte die Wirtschaft vor riesige
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
Anpassungsprobleme. Gleichzeitig wurden Arbeitseinkommen vereinbart, die den tatsächlichen Produktivitätsverhältnissen der Betriebe nicht entsprachen. Dies führte
zu einem massiven Abbau von
Arbeitsplätzen und beeinträchtigt
die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft bis heute.
Die 1990 gehegte Hoffnung auf
eine schnelle wirtschaftliche Erholung im Osten basierte in erster
Linie auf den Erfahrungen Westdeutschlands nach dem zweiten
Weltkrieg. Dass das westdeutsche
Wohlstandsniveau auch nicht innerhalb von zehn Jahren erreicht
wurde, wird dabei schnell vergessen. Selbst wenn für die neuen
Länder in den nächsten Jahren ein
kräftigeres Wachstum als im
Westen unterstellt wird, ist die Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse weiterhin ein langwieriger
Prozess. Dies sollte kein Grund zur
Beunruhigung sein, da ökonomische Anpassungsprozesse nie im
Gleichschritt ablaufen und Rück-
schläge in solch langen Zeiträumen nicht ungewöhnlich sind.
Güterentstehung und
Produktivität
Nach einem erheblichen Einbruch in den Jahren 1990/91
konnten in den anschließenden
Jahren bis 1994 Wachstumsraten
des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
von über 9% für die ostdeutschen
Länder erreicht werden (vgl.
Abbildung 1). Seitdem aber gingen
die Wachstumsraten wieder zurück. 1997 lag das ostdeutsche
Wachstum erstmals wieder unterhalb des westdeutschen Niveaus.
Das BIP je Einwohner betrug
1991 etwa 30% des Westniveaus
und erreichte 1998 mit 27 982 DM
rund 55% des Durchschnitts der
westdeutschen Länder und liegt
deutlich unter 75% des EUDurchschnitts. Die neuen Länder
stehen damit in einem EU-weiten
Vergleich auf einer Stufe mit
Griechenland, Regionen Süditaliens oder Portugal.
391
ZEITGESPRACH
Abbildung 1
Wachstumsraten Ost/West
eine aus Markterschließungsgründen häufig notwendige Niedrigpreisstrategie und vor allem eine
noch geringe Vernetzung zwischen
großen und kleinen Unternehmen
sowie mit leistungsfähigen mittelständischen Zulieferfirmen bzw.
Dienstleistungsbetrieben vor Ort
erschweren einen weiteren Produktivitätsanstieg.
Westdeutschland
Ostdeutschland
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Q u e l l e : Statistisches Bundesamt; Graphik: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen;
Werte für 2000: IWH-Prognose.
Betrachtet man die Entwicklung
differenziert nach Sektoren oder
Branchen, so ergibt sich jedoch
ein extrem uneinheitliches Bild.
Während das Verarbeitende Gewerbe (bei allen Unterschieden
zwischen den Branchen) insgesamt als Wachstumsmotor angesehen werden kann, sind im anteilig immer noch gewichtigen Baugewerbe deutliche Schrumpfungsprozesse zu verzeichnen. Der
Rückgang des gesamtwirtschaftlichen Wachstums seit der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre ist zu
einem Gutteil auf diese letztlich
unvermeidlichen Rückgänge in der
Baubranche zurückzuführen. Der
alleinige Blick auf das BIP verdüstert somit die ökonomische
Bilanz des Einheitsprozesses und
verschleiert durchaus bestehende
positive Entwicklungen der Produktion in vielen anderen Zweigen.
Eine wesentliche Ursache der
gesamtwirtschaftlichen Probleme
liegt in der nach wie vor zu geringen Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft. Die Arbeitsproduktivität (pro Kopf) konnte zwar
im Vergleich zum Westen von 31 %
(1991) auf 59,4% (1998) gesteigert
werden, liegt damit aber weiterhin
deutlich unter den westdeutschen
Werten (vgl. Abbildung 2). Die
gesamtwirtschaftliche Ost-West-
392
Produktivitätslücke lässt sich im
Wesentlichen durch die besondere
Struktur der ostdeutschen Wirtschaft erklären. Sie exportiert trotz
hoher Zuwachsraten nach wie vor
zu wenig ins Ausland. Die Exportquote lag 1998 in den ostdeutschen Ländern bei lediglich 17,9%,
während die westdeutschen Länder einen Wert von 34,3% aufwiesen. Ein wichtiger Grund hierfür
besteht wiederum in der großen
quantitativen Bedeutung der binnenmarktorientierten
Bauwirtschaft. Der niedrige Kapitalstock,
Die Autoren
unseres Zeitgesprächs:
Prof. Dr. Georg Milbradt, 55,
ist Sächsischer Staatsminister der Finanzen.
Prof. Dr. Rüdiger Pohl, 55, ist
Präsident des Instituts für
Wirtschaftsforschung in Halle
und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg.
Prof. Dr. Karl-Heinz Paque,
43, ist Inhaber des Lehrstuhls
für Volkswirtschaftslehre, insbesondere für Internationale
Wirtschaft an der Ottovon-Guericke-Universität in
Magdeburg.
Während die Produktivität pro
Kopf der ostdeutschen Betriebe
1998 erst knapp 60% des Westniveaus erreichte, lagen die Lohnkosten pro Kopf mit 73,8% des
Westniveaus - relativ betrachtet erheblich höher. Die Lohnproduktivitätslücke betrug 1998 24,1%.
Sie bildet auch für die kommenden
Jahre die Achillesferse des Aufbaus Ost, weil die ostdeutschen
Betriebe dadurch einen erheblichen Nachteil gegenüber den nationalen und internationalen Wettbewerbern erfahren.
Hohe Arbeitslosigkeit
Der
Transformationsprozess
wurde von einem erheblichen Personalabbau begleitet. Seit 1989
sind in Ostdeutschland netto rund
zwei Fünftel aller Arbeitsplätze
verloren gegangen. Gleichzeitig
wies der Arbeitsmarkt nach der
Wende eine sehr große Dynamik
auf, der sich die Ostdeutschen gestellt haben. Heute arbeiten rund
drei Viertel der Beschäftigten in einem anderen Beruf oder auf einem
anderen Arbeitsplatz als vor der
Wende.
Die hohe Arbeitslosigkeit resultiert jedoch nicht allein aus einem
geringen Angebot von Arbeitsplätzen, sondern vor allem aus der
hohen Nachfrage durch Arbeitsuchende, also einer höheren Erwerbsneigung. Nur wenige Menschen wissen, dass die Ausstattung mit Arbeitsplätzen in Sachsen
mit 417 Arbeitsplätzen pro 1000
Einwohnern überdurchschnittlich
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
ZEITGESPRACH
Abbildung 2
Lohnkosten und Produktivität Ost
(in% des Westniveaus)
80 -i
72.5
73.6
74,4
73,8
59,4
60-
40-
20-
24,1
1991
1992
Lohnkosten pro Kopf
1993
A
1994
1995
Lohn-Produktivitäts-Lücke
.SJö
1997
1998
—• • Produktivität pro Kopf
Q u e l l e : Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen; Graphik: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
gut ist (vgl. Abbildung 3). Unter
den Flächenländern in Deutschland wird dieser Wert nur von drei
Ländern übertroffen: Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen.
Dennoch können und dürfen diese
Zahlen nicht von der gesellschaftlichen Brisanz des Problems der
Arbeitslosigkeit ablenken.
Solidarpakt I
Trotz einiger Fehlentwicklungen
und des nach wie vor bestehenden
Anpassungsbedarfs hat der Aufbau Ost mittlerweile einen sehr beachtlichen Stand erreicht. Die positiven Entwicklungen sind unübersehbar. Die Telekommunikationsstruktur ist die modernste der
Welt, die Qualität von Eisenbahnen
und Fernstraßen nähert sich westdeutschem Niveau. Schulen und
Universitäten sind reformiert, wobei letztere zunehmend auch von
westdeutschen Studenten besucht werden. Die medizinische
Versorgung ist gut ausgebaut und
die zuvor unverantwortlichen Umweltbelastungen sind dramatisch
reduziert worden.
Wesentlich zu dieser Entwicklung haben die finanziellen Unterstützungen im Rahmen des Solidarpakts und durch die Europäische Union beigetragen.
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
Schwerpunkt des Solidarpakts
war das Föderale Konsolidierungsprogramm (FKP), das im
Wesentlichen aus der Neuordnung
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs unter Einbeziehung der
neuen Länder sowie der Schaffung
des Sondervermögens „Erblastentilgungsfonds" bestand. Im Ergebnis dieser Verhandlungen wurde
für zehn Jahre ein jährliches Transfervolumen von 56,8 Mrd. DM für
den Osten (einschließlich Gesamtberlins) zwischen Bund und Ländern beschlossen. Dafür entfielen
mit der Umsetzung des Solidarpaktes im Jahr 1995 die Leistungen aus dem Fonds „Deutsche
Einheit" in Höhe von 33,6 Mrd. DM
und die Berlin-Hilfe in Höhe von
6,2 Mrd. DM.
Neben der Integration der neuen Länder in den bundesdeutschen Finanzausgleich werden
den neuen Ländern, zunächst befristet bis zum Jahr 2004, Mittel
zur Finanzierung von Sonderbelastungen und des infrastrukturellen Nachholbedarfs gewährt.
Trotz der erheblichen Mehreinnahmen für die ostdeutschen Länder infolge des Solidarpaktes blieb
der Umfang der Leistungen hinter
den Erwartungen zurück. Begrün-
det ist dies durch Verschiebungen
der Steuerkraftentwicklung zwischen den Ländern sowie durch
bundesweite
Steuermindereinnahmen seit 1995. Denn mit Ausnahme der gesetzlich festgesetzten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und der IfGMittel hängen die Transferleistungen von der Entwicklung der Steuereinnahmen in West und Ost ab.
Solidarpakt II
Mit dem Auslaufen des Solidarpaktes im Jahr 2004 ist der Aufbaüprozess in den neuen Ländern
aber keineswegs abgeschlossen.
Wichtige
finanzwirtschaftliche
Kennziffern fallen nach wie vor zu
Ungunsten der neuen Länder aus:
D Die
Finanzkraftunterschiede
zwischen west- und ostdeutschen
Gebietskörperschaften
konnten noch nicht hinreichend
abgebaut werden, die originären
Steuern der neuen Länder weisen
vor jeder Umverteilung nur knapp
ein Drittel des westdeutschen
Wertes auf.
D Die Steuereinnahmen decken
auch unter Einrechnung der Umsatzsteuerverteilung bislang erst
gut 50% der Ausgaben. Die Steuerdeckungsquote der alten Länder
liegt im Vergleich dazu bei durchschnittlich 75%.
Deshalb besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass nach
dem Auslaufen des Solidarpaktes I
eine Anschlussregelung erforderlich ist. Dies wurde auch Ende Mai
bei einem Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit
dem Bundeskanzler deutlich. Die
inhaltliche Ausgestaltung ist aber
noch unklar, und die neuen Länder
stehen mit ihrer Forderung nach
einer Anschlussregelung in einer
umfassenden Begründungspflicht.
Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben hierzu eine Be-
393
ZEITGESPRACH
Abbildung 3
Arbeitsplatzdichte der Flächenländer (1999)
bOU -i 444
400 -
; s
i I
300 *200 - ! '{
439
!
!
t
•1
•'
! -1
i
• •I
100 •
! ;
i- :
425
403
]'
s
•i
398
398
396
386
391
•
1
-
!
j
i
379
367
•
t 'i
\- -j
. I t
i
384
• j
,
I I
j
Q u e l l e : Sächsisches Staatsministerium der Finanzen.
Standsaufnahme des Aufbaus Ost
vorgelegt, die folgende, über das
Jahr 2004 hinaus fortdauernde
Sonderlasten beschreibt:
D Infrastruktureller Nachholbedarf.
Die Institute messen dem Abbau
des teilungsbedingten Nachholbedarfs eine Schlüsselrolle für die
weitere Entwicklung Ostdeutschlands bei. Nach den Untersuchungen beläuft sich die Infrastrukturlücke auf rund 300 Mrd. DM. Defizite bestehen nach wie vor im Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruktur und hier insbesondere bei
der Verkehrsinfrastruktur abseits
der großen Magistralen.
D Unterproportionale kommunale
Steuerkraft. Die kommunale Steuerkraft in den ostdeutschen Flächenländern betrug 1999 knapp
40% des Westniveaus. Wie die
jüngsten Steuerschätzungen zeigen, dürften die ostdeutschen
Kommunen auch 2005 noch deutlich unter 50% des Westniveaus
bleiben.
D Wirtschaftsförderung. Trotz der
kräftigen Investitionstätigkeit ist
die Ausstattung der Arbeitsplätze
mit Sachkapital noch unbefriedigend. So betrug die Ausrüstungsausstattung je Erwerbsfähigen in
Ostdeutschland 36 700 DM, in
Westdeutschland hingegen durch-
394
schnittlich 61 300 DM. Auch die
Förderung von Forschungs- und
Entwicklüngsaktivitäten und die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zur Markterschließung
bedürfen in Zukunft weiterer
Unterstützung.
Künftiger Handlungsbedarf
Der weitere Aufbau in den neuen Ländern bedarf auch über 2004
hinaus der gesamtstaatlichen Unterstützung. Bei allen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten Ostdeutschlands wäre es
jedoch für die Generationenaufgabe des Einigungsprozesses
in jeder Hinsicht fatal, unter Verweis auf die schwierigen Ausgangsbedingungen in eine Art
passiver Nehmermentalität zu verfallen und die Abhängigkeit vom
Westen zu kultivieren. Vor allem
bekäme der Ost-West-Gegensatz
eine verschärfte politisch-psychologische Komponente, was nicht
im Sinne des föderalen Systems
und nicht im Sinne Ostdeutschlands sein kann.
Daher sieht sich der Freistaat
Sachsen auch weiterhin in der
Pflicht, ergänzend zu den Hilfen
seinen eigenen Beitrag zu mehr
Wachstum und Konsolidierung zu
leisten, um die Abhängigkeit von
den Transferleistungen zu mindern.
Konkret heißt das beispielsweise,
dass der sächsische Haushalt versucht, alle laufenden Ausgaben
mit laufenden Einnahmen zu finanzieren. Zusätzlich zur Verfügung
stehende Finanzmittel werden
konsequent für den Aufbau eingesetzt. Der Haushalt des Freistaats
Sachsen weist im Vergleich zu den
übrigen ostdeutschen Ländern eine deutlich höhere Investitionsquote auf. Sie liegt bei rund 27%,
während der Wert in den anderen
neuen Ländern durchschnittlich
um ca. 6 Prozentpunkte niedriger
ausfällt. Langfristig wird sich dies
als großer Vorteil darstellen.
Dennoch muss man sich bereits
heute auf weiter sinkende Einnahmen vorbereiten. Da Sachsen zur
Realisierung erforderlicher Ausgabeneinschnitte nicht bereit ist,
auf zukunftsorientierte Investitionen zu verzichten, muss konsequent bei den laufenden Ausgaben
insbesondere für das Personal angesetzt werden. Zudem soll die
Verschuldung Sachsens moderat
bleiben, um nicht von der Zinsseite
her unter Druck zu geraten. Während Sparen üblicherweise bedeutet, dass man vorhandenes Geld
für die Zukunft zurücklegt, heißt
Sparen für die sächsische Staatsregierung, Geld, das man nicht
hat, nicht auszugeben.
Zusätzlich zum Stellenabbau ist
vor allem eine umfassende Strukturreform der staatlichen Verwaltung erforderlich. Gerade angesichts rückläufiger Bevölkerungszahlen sind hier Einschnitte angezeigt, die sicherlich auch schmerzlich sind. Sachsen geht bereits
diesen Weg und wird ihn künftig
verstärkt verfolgen - nicht aus purer Freude am Sparen, sondern zur
Stabilisierung und Entwicklung
des Landes und damit zur Verstetigung des deutschen Einigungsprozesses.
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
ZEITGESPRÄCH
Rüdiger Pohl
Zehn Jahre nach der Währungsunion:
drei Thesen über die ostdeutsche Wirtschaft
A lach wie vor bestimmen harte
\ VKontraste das Bild der ostdeutschen Wirklichkeit. Sie verhindern ein einheitliches Urteil über
die Transformation (These 1).
Von Anfang an war die ostdeutsche Transformation von positiven
und negativen Bewertungen begleitet: Gewinner stehen gegen
Verlierer, Erfolg steht neben Misserfolg. Zehn Jahre nach Einführung der D-Mark hat sich an den
harten Kontrasten nichts geändert.
Die Auflistung düsterer Daten ist
leicht möglich. Die Arbeitslosigkeit
ist hoch. Der Wohnungsleerstand
erreicht ein dramatisches Ausmaß.
In einigen Wirtschaftszweigen
schrumpft die Produktion immer
noch erheblich. Manche Regionen
sind von massiven Abwanderungen betroffen. Der anhaltende
Lohnrückstand gegenüber Westdeutschland löst Unzufriedenheit
aus („Bürger zweiter Klasse"). Die
gesamtwirtschaftliche Produktivität liegt erst bei zwei Dritteln
des westdeutschen Niveaus. Ostdeutschland ist auf hohe Transferzahlungen aus Westdeutschland
angewiesen.
Ebenso leicht lässt sich eine Erfolgsgeschichte erzählen. Die Bevölkerung realisiert heute einen
Lebensstandard, der in der sozialistischen Mangelwirtschaft der
DDR nicht vorstellbar gewesen
war. An die Stelle zusammengebrochener Produktionsstrukturen
sind Unternehmen gerückt, die
sich im Wettbewerb an den Weltmärkten bewähren müssen. Das
* Der Beitrag basiert auf Rüdiger P o h l :
Die unvollendete Transformation. Ostdeutschlands Wirtschaft zehn Jahre nach
Einführung der D-Mark in der DDR, in: IWH,
Wirtschaft im Wandel, Heft 8/2000.
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
gewerbliche Bruttoanlagevermögen ist weitgehend modernisiert.
Dem Substanzverfall von Wohnraum und Infrastruktur, den die
DDR nicht mehr aufhalten konnte,
ist Einhalt geboten, die Erneuerung mit großem Aufwand vorgenommen worden. Die ökologische
Lebensgrundlage, in der DDR unverantwortlich beeinträchtigt, wird
wiederhergestellt. Die marktwirtschaftlichen Institutionen sind in
Ostdeutschland etabliert und inzwischen eingeübt.
Es bleibt der persönlichen Bewertung jedes einzelnen überlassen, wie er die Gesamtbilanz sieht.
Kontroversen darüber werden bestehen bleiben. Kontrovers wird
auch bleiben, ob andere Weichenstellungen besser gewesen
wären (eine Währungsunion nach,
nicht vor Reformen in der DDR; eine an der Leistungskraft orientierte, statt sie anfangs überfordernde
Lohnentwicklung; gar ein „dritter
Weg" zwischen Sozialismus und
Marktwirtschaft). Doch „Was-wäre-gewesen-wenn"-Debatten sind
nicht zukunftweisend. Fest steht,
dass die DDR-Wirtschaft nicht
durch die Wende kollabiert ist,
sondern bereits vorher ausgehöhlt
war. Daran gemessen ist in den
zehn Jahren außerordentlich viel
geschafft worden.
Dynamische Wirtschaft mit
Beschäftigungslücke
Ostdeutschland wird einen stabilen und international wettbewerbsfähigen
Wirtschaftssektor
haben, doch der wird auf absehbare Zeit zu klein bleiben, um die
heute vorhandenen
Beschäftigungs- und Einkommenswünsche
zu erfüllen (These 2).
In Ostdeutschland entwickelt
sich ein Wirtschaftssektor, der sich
im internationalen Wettbewerb behaupten kann. Die ostdeutsche
Industrie steht an den Weltmärkten
keineswegs mehr auf verlorenem
Posten. Die Industrie kann ihre
Produktion seit 1994 beachtlich
steigern, um mehr als 8% jährlich.
Außerordentlich kräftig sind die
Auslandsimpulse. Die Aufträge aus
dem Ausland expandieren jährlich
um mehr als 20%. Besonders dynamisch entwickeln sich Industriebereiche, die gemeinhin mit Innovationen in Verbindung gebracht
werden: Büromaschinen, Datenverarbeitung, Medizintechnik, Optik. Die Produktionsausweitung
der letzten Jahre ist von großen
Produktivitätsfortschritten begleitet gewesen. Die Industrie ist in
weiten Teilen bereits schon heute
und wird immer mehr zum international wettbewerbsfähigen Wirtschaftssektor in Ostdeutschland.
Soweit die gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht: dieser
wettbewerbsfähige Wirtschaftssektor wird auf absehbare Zeit zu
schmal bleiben, um die Beschäftigungs- und Einkommenswünsche
der Bevölkerung voll befriedigen
zu können. Die Industrie als Kern
des wettbewerbsfähigen Sektors
beschäftigt heute 1 Million von
5,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Selbst
wenn die Industrie ihre Beschäftigung um zehn oder zwanzig
Prozent ausweiten könnte, wäre
das angesichts der heute vorhandenen Beschäftigungslücke von
schätzungsweise 1,5 Millionen Arbeitsplätzen keine Lösung für die
Arbeitslosigkeit.
Das Gesamtbild der ostdeutschen Wirtschaft wird eben nicht
395
ZEITGESPRÄCH
nur von der dynamischen Industrie
bestimmt, sondern selbst zehn
Jahre nach der Einführung der DMark immer noch auch von aufgestautem Strukturwandel. Die Bauwirtschaft hat, nachdem der Nachholbedarf bei Wohnungen und gewerblichen Bauten gedeckt ist,
Überkapazitäten, deren Abbau
sich weiterhin in schrumpfender
Produktion und abnehmender Beschäftigung niederschlägt. Auch
innerhalb der Industrie sind nicht
alle Branchen auf Wachstumskurs.
Manche wie die Schmuckindustrie
schrumpfen immer weiter. Der
Dienstleistungssektor hat nach
Jahren überaus starken Wachstums jetzt zu „normalem" Wachstum gefunden, eine besondere Beschäftigungsdynamik ist dort nicht
mehr angelegt. Ebenso wird der
Staat weiterhin Arbeitsplätze abbauen müssen, weil der vergleichsweise hohe Personalbestand angesichts knapper Kassen
nicht zu halten ist. Nüchtern ist
festzustellen: die Etablierung eines
wettbewerbsfähigen Wirtschaftssektors bedeutet auf absehbare
Zeit nicht, dass es zu einer deutlichen Ausweitung der Gesamtbeschäftigung kommen wird.
Rentable Arbeitsplätze
Allerdings sollte nicht nur nach
dem Gesamtvolumen an Beschäftigung gefragt werden. Nicht minder wichtig ist, wie viel der vorhandenen Beschäftigung bereits rentabel ist und wie viel immer noch
von Subventionen abhängt. Auf
die Dauer zählt nur rentable Beschäftigung, subventionierte Beschäftigung bleibt latent gefährdet.
Als „rentabel" können Arbeitsplätze in Unternehmen gewertet werden, die mit den realisierten Ab-satzpreisen die Durchschnittskosten der Produktion decken und
eine angemessene Verzinsung des
eingesetzten Kapitals erzielen. Das
Problem ist die quantitative Abschätzung. Die Statistik liefert kei-
396
ne Daten darüber, wie viel Arbeitsplätze im definierten Sinne rentabel sind. Es gibt aber gute Gründe
für die Einschätzung, dass die Anzahl rentabler Arbeitsplätze in den
letzten Jahren zugenommen hat.
In den dynamischen Branchen der
ostdeutschen Wirtschaft wachsen
immer mehr Unternehmen in die
Gewinnzone und behaupten sich
aus eigener Kraft am Markt. Sie
werden rentabel und mit ihnen ihre
Arbeitsplätze.
Vor diesem Hintergrund ist am
ostdeutschen Arbeitsmarkt eine
paradox anmutende Entwicklung
im Gange: die Lage wird zugleich
schlechter und besser. Schlechter
wird sie mit Blick auf die Gesamtbeschäftigung, die noch weiter sinken könnte (jedenfalls nicht
stark steigen wird), weil unrentable
Arbeitsplätze dauerhaft nicht zu
halten sind und aufgegeben werden müssen. Besser wird sie mit
Blick auf die rentable Beschäftigung, die weiter ansteigen wird.
Eine Reihe von Unternehmen ist
wettbewerbsfähig, andere werden
es. Sie sorgen für die Ausweitung
rentabler Arbeitsplätze.
Volle Lohnangleichung?
Mit einem zwar wettbewerbsfähigen, aber schmalen Wirtschaftssektor werden sich Einkommenswünsche, die sich am westdeutschen Niveau orientieren, in der
Summe nicht realisieren lassen.
Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt die Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigenstunde
(Produktivität) in Ostdeutschland
immerhin schon bei 60% des
westdeutschen Wertes, aber eben
weit ab von 100%. Der Rückstand
reflektiert das unterschiedliche
„Mischungsverhältnis" neuer und
etablierter Unternehmen in Ost
und West. Neu gegründete („junge") Unternehmen realisieren normalerweise in den ersten Jahren
nicht den gleichen Markterfolg,
den etablierte Unternehmen über
viele Jahrzehnte auf- und ausgebaut haben, zumal in den traditionellen Branchen nicht. Dies ist im
Osten nicht anders als im Westen.
Der Unterschied liegt darin, dass
in Ostdeutschland neu gegründete
Unternehmen dominieren und, im
Vergleich zu Westdeutschland,
etablierte Unternehmen weitgehend fehlen.
Neu gegründete Unternehmen
werden, bei gutem Management,
allmählich etablierte Unternehmen, dies wird in Ostdeutschland
nicht anders sein. Doch dieser
Prozess braucht noch viel Zeit.
Solange der Prozess nicht abgeschlossen ist, fehlt für eine volle
Lohnangleichung an westdeutsches Niveau die wirtschaftliche
Basis. Eine dennoch vorgenommene rasche Lohnangleichung
würde unvermeidlich zu weiter anschwellender Arbeitslosigkeit führen. Auch wenn in manchen Tarifkonflikten lautstark die „volle
Lohnangleichung" gefordert wird,
bleibt doch auf das Faktum zu verweisen, dass die nachhängende
Leistungskraft der ostdeutschen
Wirtschaft in den meisten Wirtschaftsbereichen sehr wohl in
deutlich niedrigeren Löhnen als im
Westen ihren Niederschlag findet.
Die Lohnfrage ist aber nicht nur
ein West-Ost-Problem. In Ostdeutschland selbst geht es um
Lohndifferenzierung. Boomende
Branchen, gefestigte Unternehmen können hohe Löhne zahlen; in
hinterherhinkenden, gar schrumpfenden Branchen ist das nicht
möglich. Für mobile Arbeitnehmer,
die ihren Job auch in Westdeutschland fänden, müssen westdeutsche Löhne gezahlt werden,
für andere geht das nicht. Die ostdeutsche Bevölkerung hat geprägt
durch die gleichmacherische Lohnpolitik der DDR nach wie vor eher
wenig Verständnis für die Notwendigkeit einer Ausdifferenzierung der
Löhne. Die Lohnfrage, genauer:
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
ZEITGESPRACH
die notwendige Ausdifferenzierung,
bleibt Quelle für Spannungen.
Staatliche Förderpolitik
Die Vollendung der Transformation wird immer weniger von staatlicher Förderpolitik und immer
mehr von Marktprozessen getragen. Transferzahlungen zugunsten
von Ostdeutschland bleiben gleichwohl erforderlich (These 3).
Zehn Jahre nach Einführung der
D-Mark stellt die Verbreiterung der
wettbewerbsfähigen wirtschaftlichen Basis die wichtigste wirtschaftliche Herausforderung Ostdeutschlands dar. Die Basiserweiterung wird vor allem durch die
schon bestehenden Unternehmen
geleistet werden und sich im
Erfolgsfalle in fortgesetzter Expansion der Unternehmen niederschlagen. Neugründungen und
Ansiedlungen auswärtiger Investoren sind eine weitere Quelle für
wirtschaftliches Wachstum. Der
Staat wird wie bisher eine maßgebliche Rolle spielen. Das heißt
aber gerade nicht, die staatliche
Förderpolitik der neunziger Jahre
unbesehen fortzuschreiben. Die
Rolle des Staates ändert sich, weil
sich die Problemlage geändert hat.
Nach der Wende musste der
Staat dazu beitragen, dass sich
am Standort
Ostdeutschland
überhaupt eine eigenständige
Wirtschaft etablieren konnte. Denn
wirklich benötigt wurde die ostdeutsche Güterproduktion angesichts der überall in der Welt
mobilisierbaren Produktionskapazitäten nicht. Die staatliche Förderpolitik mit ihrem Kern, der Subventionierung von Investitionen,
hat im Sinne einer Initialzündung
Produktion in Ostdeutschland gegen die Marktkräfte mit Erfolg
„durchgesetzt".
Das ist heute nicht mehr erforderlich. Immer weniger wird die
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
Fortführung der Transformation
von staatlicher Wirtschaftsförderung, immer mehr von Marktprozessen bestimmt. Dies zeigt sich
eindrucksvoll in der strukturellen
Erneuerung Ostdeutschlands. Dass
die strukturelle Erneuerung noch in
vollem Gange ist, wird durch die
auch zehn Jahre nach Beginn der
Transformation weiterhin hochgradig divergente Branchenentwicklung der ostdeutschen Industrie belegt. Die Spannweite der
Wachstums7Schrumpfungsraten
der Produktion reicht (1999) von
+41 % (Büromaschinen) bis -36%
(Schmuckherstellung).
Diese Divergenzen spiegeln die
nunmehr hinzugewonnene Marktorientierung des Entwicklungsprozesses wider. Es wirken Marktkräfte, wenn sich einige Branchen
im internationalen Wettbewerb
durchsetzen und Marktanteile zugewinnen, während gleichzeitig
andere Branchen durch den Wettbewerbsdruck
zurückgedrängt
werden. Zugleich wird mit den
Divergenzen deutlich, dass staatliche Wirtschaftsförderung keine
hinreichende Bedingung für Markterfolg ist.
Fördermaßnahmen wie Investitionszulagen standen allen Wirtschaftszweigen zur Verfügung.
Dennoch ist es in einigen Branchen
nicht gelungen, die Schrumpfung
der Produktion aufzuhalten. Die
Konsequenz daraus ist, dass sich
der Staat, nachdem er die Initialzündung eingeleitet hat, aus der
direkten Subventionierung unternehmerischer Aktivität zurückziehen kann. Dies trifft vor allem für
die Investitionszulagen zu, auf die
Investoren einen Rechtsanspruch
haben, ohne dass geprüft würde,
ob der Investor diese Subvention
überhaupt benötigt und ob das
Investitionsprojekt tragfähig ist.
Die Investitionszulagen sollten
2004 wie vorgesehen auslaufen.
Rückzug des Staates?
Trotzdem geht es nicht um den
vollständigen Rückzug des Staates aus der Förderung der Transformation. Der Staat behält unverändert die Verantwortung für seine
wirtschaftspolitischen Kompetenzbereiche, insbesondere Infrastruktur, Regionalpolitik, Existenzgründungsförderung. Mit hoher Priorität ist vor allem der Ausbau der
Infrastruktur fortzusetzen. Ostdeutschland weist trotz beachtlicher Aufbauanstrengungen einen
erheblichen Rückstand an zeitgemäßer Infrastruktur auf (nicht
mehr im Kommunikationssektor,
doch in Bereichen wie dem kommunalen Straßenbau, der Wasserwirtschaft, hier vor allem dem
Trinkwassernetz, den Aufbereitungsanlagen, dem Abwassernetz).
Infrastrukturausbau, der als Vorleistung für wirtschaftliche Aktivitäten oder zur Sicherung ökologischer Standards notwendig ist,
kann nur aufgeschoben, nicht aufgehoben werden. Zuwarten lässt
die Kosten anschwellen. Eine anspruchsvolle Infrastrukturinitiative
ist dringlich. Die regionalpolitisch
gebotene Förderung von Investitionen durch Investitionszuschüsse (auf die anders als bei Investitionszulagen kein Rechtsanspruch
besteht) in Regionen mit unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft
ist weiterhin notwendig, bedarf
aber keiner Ost-West-Differenzierung. Ebenfalls in Ost wie in West
ist die Förderung von Existenzgründungen eine Daueraufgabe
staatlicher Wirtschaftspolitik.
Ostdeutschland bleibt auf finanzielle Zuflüsse („Transfers") aus
Westdeutschland angewiesen. Dies
für die Zeit nach 2004 zu regeln, ist
Gegenstand des zu verhandelnden „Solidarpakts II". Die gesamten Transferleistungen gehen über
die Zahlungen im Solidarpakt hinaus.
397
ZEITGESPRÄCH
Rückgang der
Transferzahlungen?
Zum einen zielen die Transfers
auf einen Ausgleich der niedrigen
Steuerkraft. Die originäre Steuerkraft Ostdeutschlands liegt bei
34% des westlichen Wertes. Der
Rückstand reflektiert die geringere
Wirtschaftskraft, die niedrigeren
Einkommen (und damit einen
geringeren Progressionseffekt im
Steueraufkommen), aber auch
Steuervergünstigungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
Ohne die Auffüllung durch Transfers könnten die öffentlichen Aufgaben in Ostdeutschland nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Mit steigender originärer
Steuerkraft werden die Auffüllbeträge allmählich abschmelzen.
Doch sind nur graduelle, keine
sprunghaften Verbesserungen zu
erwarten.
Zum anderen geht es um die
Mitfinanzierung von Sozialleistungen. Die in Ostdeutschland bestehenden Ansprüche auf Sozialleistungen, insbesondere Arbeitslo-
sengeld und Renten, übersteigen
das eigene Beitragsaufkommen;
die fehlenden Beträge werden
durch Mittel aus westdeutschem
Beitragsaufkommen ausgeglichen.
Ein Abschmelzen der Transfers
setzt voraus, dass die Gesamteinkommen und damit die Beitragseinnahmen beschleunigt steigen
und dass vor allem die Anzahl der
Arbeitslosen zurückgeht. Die mittelfristigen Perspektiven lassen
beides nur in begrenztem Umfang
erwarten.
Schließlich geht es um die Mitfinanzierung von Wirtschaftsförderung. Die direkte Subventionierung
der Wirtschaft absorbiert bisher
den kleinsten Teil der Transferzahlungen. Während einige Formen
der Wirtschaftsförderung weiter
notwendig bleiben (Investitionszuschüsse im Rahmen der Regionalpolitik), können andere auslaufen
(Investitionszulagen). Aus letzterem ergibt sich ein Potenzial für
das Abschmelzen von Transfers.
Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn mit dem Solidarpakt II
zugleich eine kritische Evaluation
vorhandener Förderprogramme
vereinbart würde, als Grundlage
für Anstrengungen, die Effizienz
der Wirtschaftsförderung zu verbessern.
Die Wahrnehmung der Transferzahlungen als bloße West-OstUmverteilung (gar in ein ostdeutsches „Fass ohne Boden") würde
deren Funktion nicht gerecht. Aus
deutscher (und nicht aus nur westdeutscher oder nur ostdeutscher)
Sicht geht es um zwei Punkte. Erstens werden die sozialen Folgekosten, die sich mit der Überwindung der deutschen Teilung verbinden, nicht nur Ostdeutschen
aufgebürdet, sondern gerechterweise über die Transfers von Westdeutschen mitgetragen, und dies
so lange wie ,die Folgekosten anfallen. Zweitens tragen die Transfers dazu bei, das Wirtschaftspotenzial Ostdeutschlands voll zu
entfalten. Das liegt im Interesse
der neuen Länder, aber der alten
Länder ebenfalls; denn Deutschland als Ganzes steht um so besser da, je stärker die Wirtschaft im
Osten wird.
Karl-Heinz Paque
Die ostdeutsche Wirtschaft nach zehn Jahren
deutscher Einheit: Bilanz und Perspektiven
D
ie ostdeutsche Wirtschaft ist
heute - zehn Jahre nach der
deutschen Vereinigung - eine
funktionsfähige Marktwirtschaft:
Die Allokation der volkswirtschaftlichen Ressourcen erfolgt im Wesentlichen nach Kriterien der
Knappheit, wie sie sich über
Marktpreise äußert. Insofern gibt
es keinen systemischen Unterschied mehr zwischen dem Osten
und dem Westen Deutschlands
oder auch zwischen Ostdeutschland und anderen Regionen bzw.
398
Ländern der Europäischen Union.
Gleichwohl ist die ostdeutsche
Wirtschaft in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich geblieben bzw. geworden, und dies lässt sich zumindest
an fünf stabilen strukturellen Besonderheiten festmachen.
Ostdeutschland
transferabhängig
1. Die ostdeutsche Wirtschaft
absorbiert mehr als sie produziert.
Wäre Ostdeutschland ein selbstständiges Land mit eigener volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnung,
ließe sich dies präzise an der Höhe
seines Defizits in der Leistungsbilanz ablesen. Geschätzt wird,
dass das Defizit bei 200 Mrd. DM
pro Jahr liegt. Lediglich der Mittelzufluss aus öffentlichen Kassen ist
genau zu beziffern. Er beträgt seit
1995 jährlich ziemlich konstant
190 Mrd. DM brutto und 140 Mrd.
DM netto (d.h. abzüglich der rückfließenden Einnahmen). Dies sind
etwa 4,5% des westdeutschen
Bruttosozialprodukts. Auch die
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
ZEITGESPRÄCH
Struktur dieser Transfers ist bemerkenswert konstant: Zuletzt
(1997 und 1998) waren 44% davon
Sozialleistungen, 3 1 % allgemeine
Finanzzuweisungen, 8% Subventionen und 17% öffentliche Investitionen.
Wie sich die Transfers auf konsumtive und investive Zwecke verteilen, lässt sich nicht präzise ermitteln: Sozialleistungen - immerhin 44% - fallen wohl eindeutig in
den Konsumbereich, öffentliche
Investitionen und Subventionen für
Private - zusammen 25% - in den
Investitionsbereich. Bei den allgemeinen Finanzzuweisungen - 31 %
- hängt es von den betreffenden
Gebietskörperschaften ab, wie die
Mittel verwendet werden. Konkrete Aussagen sind hier schwierig. Insgesamt dürfte es realistisch
sein anzunehmen, dass mehr als
die Hälfte der Transfers dem Konsum und entsprechend weniger
als die Hälfte Investitionszwecken
dienen.
Drei Viertel der Transfers, vor allem die Sozialleistungen und allgemeinen Finanzzuweisungen, sind
keine Sonderleistungen für den
Osten, sondern beruhen auf allgemeineren Rechtsvorschriften, die
sich aus den Konstruktionsprinzipien des bundesdeutschen Sozialwesens und des Fiskalföderalismus ergeben. Eine Kürzung dieser
Transfers ist deshalb nur möglich
im Rahmen einer breit angelegten
Reform des bundesdeutschen
Wohlfahrtsstaates. Es ist deshalb
auch nicht zu erwarten, dass sich
der Transferbedarf ohne Reformen
wesentlich verändert, wenn es
nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der ostdeutschen Wirtschaftsleistung kommt.
Ost/West-Produktionslücke
2. Die Arbeitsproduktivität in der
ostdeutschen Wirtschaft liegt
deutlich unter der im Westen. Das
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
Bruttoinlandsprodukt
pro Erwerbstätigen betrug im Osten zuletzt etwa 60% des westdeutschen Niveaus. Die gesamtwirtschaftliche Ost/West-Produktivitätslücke von 40% hat sich seit
Mitte der neunziger Jahre nicht
mehr weiter geschlossen. Im Gegenteil, sie ist im letzten Jahr sogar wieder leicht gewachsen, erstmals seit der deutschen Vereinigung.
Die Persistenz und jüngst sogar
die Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Ost/West-Produktivitätslücke lässt sich im wesentlichen durch die besondere sektorale Struktur der ostdeutschen
Wirtschaft erklären. Kernargument
ist dabei, dass die ostdeutsche
Wirtschaft noch immer zu einem
großen Teil lokale Märkte beliefert
und nur wenig „exportiert", sei es
ins Ausland oder in den Westen
des Landes. Dies zeigt sich an einer Reihe von Indikatoren:
D die weiterhin große quantitative
Bedeutung der binnenmarktorientierten Bauwirtschaft, die noch immer fast 40% der industriellen
Wertschöpfung und fast die Hälfte
der industriellen Beschäftigung
ausmacht;
D ein Verarbeitendes Gewerbe - in
Westdeutschland traditionell der
Motor der Exporterfolge -, das in
Ostdeutschland noch insgesamt
sehr klein und zu wenig exportund forschungsorientiert ausfällt;
D eine relativ starke Binnenmarktorientierung auch der Dienstleistungen, die wegen des schwachen Besatzes mit Verarbeitendem
Gewerbe vor allem die Nachfrage
der Bauwirtschaft und privater
Haushalte bedienen.
Handlungsbedarf bei der
Verkehrsinfrastruktur
3. In allen Bereichen der physischen und sozialen Infrastruktur
hat es seit der deutschen Vereinigung enorme Fortschritte gegeben, und zwar größtenteils durch
öffentliche oder staatlich geförderte private Investitionen: Verkehrsnetz, Abwasser- und Abfallentsorgung, Gewerbe- und Wohngebiete, Energie- und Wasserversorgung, Schulen und Universitäten,
Sozial- und Freizeiteinrichtungen,
öffentliche Verwaltung - in jeder
Hinsicht wurde massiv ausgebaut,
modernisiert bzw. umstrukturiert.
Überall hat dies zur Milderung der
Engpässe geführt, in einigen Bereichen zur völligen Beseitigung
und in manchen sogar zu beträchtlichem Überangebot (z.B. bei
der Erschließung von Gewerbegebieten, beim Bau von Kläranlagen).
Es verbleibt aber ein wichtiger
Bereich, in dem Wirtschaft und
Verwaltung, wie Umfragen zeigen,
weiterhin massiven Handlungsbedarf sehen: dem Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur, besonders
dem Ausbau überregionaler Straßen sowie dem Neubau und der
Instandsetzung von Regional- und
Gemeindestraßen, insbesondere
Ortsumgehungen. Tatsächlich zeigen auch objektivierbare Indikatoren, dass es in dieser Hinsicht
noch einen klaren Ost/West-Rückstand gibt, auch wenn man die im
Durchschnitt niedrigere Besiedlungsdichte Ostdeutschlands mit
in Rechnung stellt.
Hohe Arbeitslosigkeit
4. Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist unverändert hoch.
In den letzten drei Jahren lag die
Arbeitslosenquote im Bereich von
20%, etwa doppelt so hoch wie im
Westen. Rechnet man verschiedene Formen der verdeckten Arbeitslosigkeit hinzu (Personen in
Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung und Requalifizierung sowie
399
ZEITGESPRÄCH
Kurzarbeit), so erhält man Quoten
im Bereich von 25%. Berücksichtigt man ferner, dass durch die allfällige Schrumpfung der Bauwirtschaft eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Arbeitsplätzen akut gefährdet ist, ohne dass sich bereits
eine entsprechende Beschäftigungszunahme an anderer Stelle
abzeichnet, so lässt sich der Grad
der Unterbeschäftigung der Erwerbspersonen mit einigem Recht
noch höher veranschlagen.
Der hohen Arbeitslosigkeit steht
allerdings eine Erwerbsbeteiligung
gegenüber, die - am Standard des
Westens gemessen - sehr hoch
ist. Dies liegt daran, dass die Erwerbsquote innerhalb der erwerbsfähigen Bevölkerung (Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren)
in Ostdeutschland mit fast 77%
deutlich höher liegt als im Westen
mit 7 1 % Ermittelt man mit dieser
Information eine „Quote der fehlenden Erwerbsbeteiligung" - definiert als jener Anteil der erwerbsfähigen Personen, die nicht arbeitet -, so lag diese Quote für beide
Teile Deutschlands zuletzt bei etwa 37%.
Aus ökonomischer Sicht ist allerdings diese Rechnung wenig relevant, da die Messung des Auslastungsgrads des Produktionsfaktors Arbeit sich natürlich an
dem Angebot orientieren sollte,
das sich tatsächlich am Markt
zeigt, und zwar gemäß der individuellen Präferenzen der Arbeitsanbieter - konkret: der vielen Frauen,
die zur DDR-Zeit erwerbstätig waren und dies auch weiterhin sein
wollen.
Aus sozialpolitischer Sicht sind
die Dinge allerdings anders zu beurteilen: Soweit die Erwerbsbeteiligung noch in normalem Rahmen
liegt, ist damit zu rechnen, dass
die Unterbeschäftigung weniger
fatale soziale Konsequenzen hat,
400
als die sehr hohe Arbeitslosenquote suggerieren mag; denn in
vielen privaten Haushalten sollte
es dann noch mindestens eine arbeitende Person geben, die Markteinkommen erzielt und im Wesentlichen den Lebensunterhalt des
Haushalts bestreitet.
Stockung der Lohnangleichung
5. Seit Mitte der neunziger Jahre
liegen die Effektivlöhne für Arbeiter
und Angestellte in Ostdeutschland
bei 70-75% des Westniveaus.
Spätestens seit 1996 ist kein Trend
zur weiteren Ost/West-Angleichung der Löhne mehr erkennbar.
Auch das umfassendste Maß für
Arbeitnehmerverdienste, das Einkommen aus unselbständiger Arbeit pro abhängig Beschäftigten
aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bewegt sich seither kaum noch: zuletzt 73,8% des
Westniveaus (1998) nach 74,4%
(1997) und 73,6% (1996). Die
Lohnangleichung ist also anscheinend zu einem Stillstand gekommen, trotz der schrittweisen Steigerungen der tariflichen Mindestlöhne, die in den meisten Tarifvereinbarungen festgeschrieben sind.
Tatsächlich hat es in Ostdeutschland seit 1994 in vier von fünf
Jahren in der Industrie eine negative Lohndrift gegeben, also eine
geringere Steigerung der Effektivais der Tariflöhne.
Der Hauptgrund für die Stockung der Lohnangleichung liegt
in der Verbandsflucht der Arbeitgeber, die in den letzten Jahren
stark zugenommen hat - bis hin zu
einem Niveau, das einer faktischen
Deregulierung der Lohnsetzung in
weiten Teilen der Wirtschaft
gleichkommt. Umfragen zeigen,
dass derzeit fast 80% der ostdeutschen Industrieunternehmen keinem tariffähigen Arbeitgeberverband angehören, davon überdurchschnittlich viele kleinere und
mittlere Unternehmen; 55% aller
Industriearbeiter und -angestellten
sind in nichttarifgebundenen Unternehmen tätig.
Konsequente Standortpolitik
erforderlich
Soweit die fünf strukturellen
Besonderheiten. Sieht man von
der Flexibilität am Arbeitsmarkt ab,
so sind sie durchweg als ein Rückstand zu interpretieren, und zwar
als ein Rückstand auf dem Weg zu
einer „normalen" Volkswirtschaft,
die in der Lage ist, zumindest auf
längere Sicht ihre konsumtive Absorption durch eigene Produktion
zu finanzieren und die eigenen
Ressourcen voll auszulasten.
Oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik muss es deshalb sein, diesen Rückstand zu beseitigen.
Um dies zu erreichen, bedarf es
einer nachhaltigen Zunahme privater Investitionen zum Auf- und
Ausbau eines Kapitalstocks, mit
dem überregional handelbare Güter und Dienstleistungen produziert werden können. Alle Anstrengungen der Wirtschaftspolitik sollten auf dieses Zwischenziel konzentriert werden. Es gilt, eine konsequente Standörtpolitik zu betreiben. Dies legt nahe, die Prioritäten
zur Vollendung des „Aufbau Ost"
zu verschieben: weg vom massiven Einsatz von Instrumenten der
Investitionsförderung und hin zur
konsequenten Beseitigung der
verbleibenden Rückstände in den
Standortbedingungen, vor allem
bei der Verkehrsinfrastruktur.
Eine solche Strategie ist nicht zu
verwechseln mit der gerade im
Westen oft gehörten pauschalen
Forderung nach Kürzung der
Transferleistungen. Denn der Grad
der öffentlichen Subventionierung
privater Investitionen ist in Ostdeutschland zwar sehr hoch; die
Gesamtsumme der Fördergelder
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
ZEITGESPRACH
macht aber nur einen geringen
Anteil des West/Ost-Transfervolumens aus. Insofern würde selbst
ein Streichen der Fördermittel nur
mäßig zu einer Abnahme der
West/Ost-Transfers beitragen.
Umgekehrt gilt: Hinter den Sozialleistungen, die weitgehend keine
Sonderleistung für den Osten darstellen, machen die Finanzzuweisungen an Länder und Kommunen
den größten Anteil der West/OstTransfers aus. Gerade diese Zuweisungen erlauben es den ostdeutschen Ländern und Kommunen erst, die laufenden Kosten des
bereits aufgebauten Infrastrukturkapitals zu tragen und jene Infrastrukturinvestitionen weiterzufinanzieren, die aus standortpolitischer Sicht dringend geboten
sind. Zum bereits vorhandenen
Kapital zählen im weitesten Sinn
auch Schulen, Universitäten und
Forschungseinrichtungen, deren
Bedeutung für die Standortbedingungen außer Frage steht.
Gleichwohl hat diese Strategie
durchaus auch Implikationen für
das Finanzgebaren ostdeutscher
Länder und Kommunen: Nur dann,
wenn deren Ausgabenstruktur eine
klare Priorität auf die Verbesserung
der Standortbedingungen durch
Investitionen setzt, fügt sie sich in
eine sinnvolle Gesamtstrategie
des Aufbau Ost. Dass dies nicht
durchweg der Fall ist, zeigt allein
schon der Personalbestand im öffentlichen Dienst, der in allen
Ländern des Ostens pro Kopf über
dehn der westdeutschen Flächenländer liegt. In eindeutig nichtinvestitiven Bereichen wie Soziale
Sicherung, Gesundheit, Sport und
Erholung und politische Führung
ist der Ost/West-Personalüberhang über 20%; im Hochschulwesen gibt es dagegen im Vergleich zum Westen einen Unterbesatz von rund 15% Bei derartiger Prioritätensetzung müssen
WIRTSCHAFTSDIENST 2000/VII
sich die ostdeutschen Länder und
Kommunen tatsächlich fragen lassen, ob nicht doch ein Teil der
Transfers in konsumtive statt investive Verwendung überführt wird.
Langfristig gute Aussichten
Trotzdem sind die beliebten Vergleiche mit Problemregionen, die
dauerhaft zu Subventionsempfängern wurden und auf eigene Anstrengungen verzichteten, derzeit
völlig fehl am Platz. Ostdeutschland ist kein Mezzogiorno, im
Gegenteil: Die ostdeutsche Wirtschaft ist eine funktionierende
Marktwirtschaft. In wichtigen Bereichen ist der Osten im Vergleich
zum Westen eindeutig die anpassungsbereitere und flexiblere Region. Dies gilt vor allem für den
Arbeitsmarkt: Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt höher als im
Westen, und es gibt faktisch keine
flächendeckenden Tarifverträge
mehr, und zwar nicht nur im
Dienstleistungssektor,
sondern
auch in der Industrie.
Trotz dieser Flexibilität hat sich
der Aufbau einer gesunden und
ausreichend großen industriellen
Basis als weit schwieriger erwiesen, als viele ursprünglich annahmen. Dass das Startniveau für den
Wiederaufbau des industriellen
Kapitalstocks seit Mitte der neunziger Jahre so niedrig ist, kann
man auch den starken Lohnsteigerungen in der Frühphase der Vereinigung anlasten, die einen Teil
des industriellen Kapitalstocks obsolet machten. Dies ist aber heute
Geschichte: Inzwischen hat der
ostdeutsche Arbeitsmarkt jene
Flexibilität, die von Ökonomen aus
standortpolitischer Sicht angemahnt wird. Die heute zählenden
Engpässe liegen an anderen Stellen: einerseits noch immer bei der
Infrastruktur, andererseits an der
Verfestigung regionaler Arbeitsteilungen aufgrund von Agglome-
rationseffekten, die in gesunden
industriellen Ballungszentren des
Westens produktivitätsfördernd
wirken, im Osten aber noch fehlen.
Der Staat kann helfen, die Engpässe bei der Infrastruktur im weitesten Sinn zu beseitigen, aber er
kann nur wenig tun, um industrielle Ballungsprozesse darüber hinaus zu fördern.
In dieser Hinsicht gibt es keinerlei Patentrezepte, nur noch wohlfeile Empfehlungen für ein kluges
Standortmanagement. Wissenschaftlich begründet ist auch ein
Appell an die Geduld: Das wirtschaftliche Wachstum und Aufholen in sogenannten strukturschwachen Regionen verläuft typischerweise diskontinuierlich, d.h.
in Schüben. Auch richtige standortpolitische Weichenstellungen
brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu
tun - nicht zuletzt über das Preissystem. Wird aber eine Region
über einen längeren Zeitraum als
zentral gelegener, gut erschlossener und preisgünstiger Standort
bekannt (und auch entsprechend
von der Politik „vermarktet"), so
kann es in relativ kurzer Zeit zu jenen Ballungen von Industrie und
Dienstleistungen kommen, die
dem Wachstums- und Aufholprozess die erwünschte Dynamik
verleihen.
Die europäische und die amerikanische Wirtschaftsgeschichte
sind voll von Beispielfällen, wo
dies geschah, zuletzt in Irland und
in einigen Problemregionen Englands und Schottlands. Viel seltener - und oft durch Sonderfaktoren erklärbar - sind die Fälle auf
Dauer zementierter Unterentwicklung. Es gibt nach zehn Jahren
Aufbau Ost keinen erkennbaren
Grund, warum gerade Ostdeutschland ein solch schweres
Schicksal beschieden sein sollte.
Zu Resignation besteht also kein
Anlass.
401