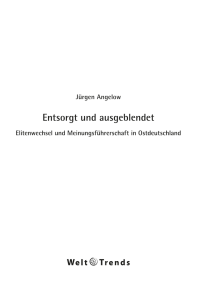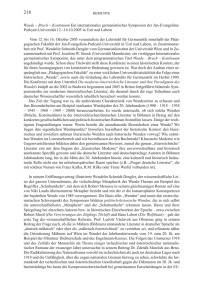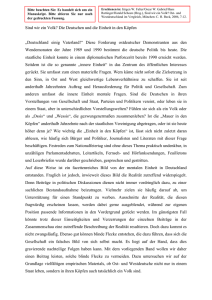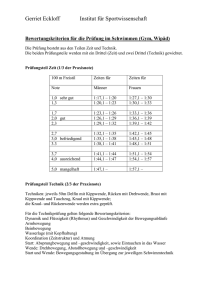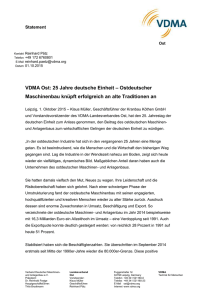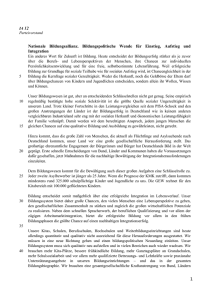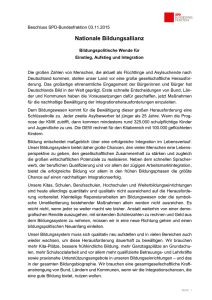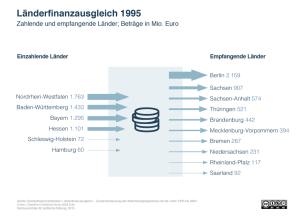Wie ostdeutsche Frauen über Ostdeutsche reden.
Werbung
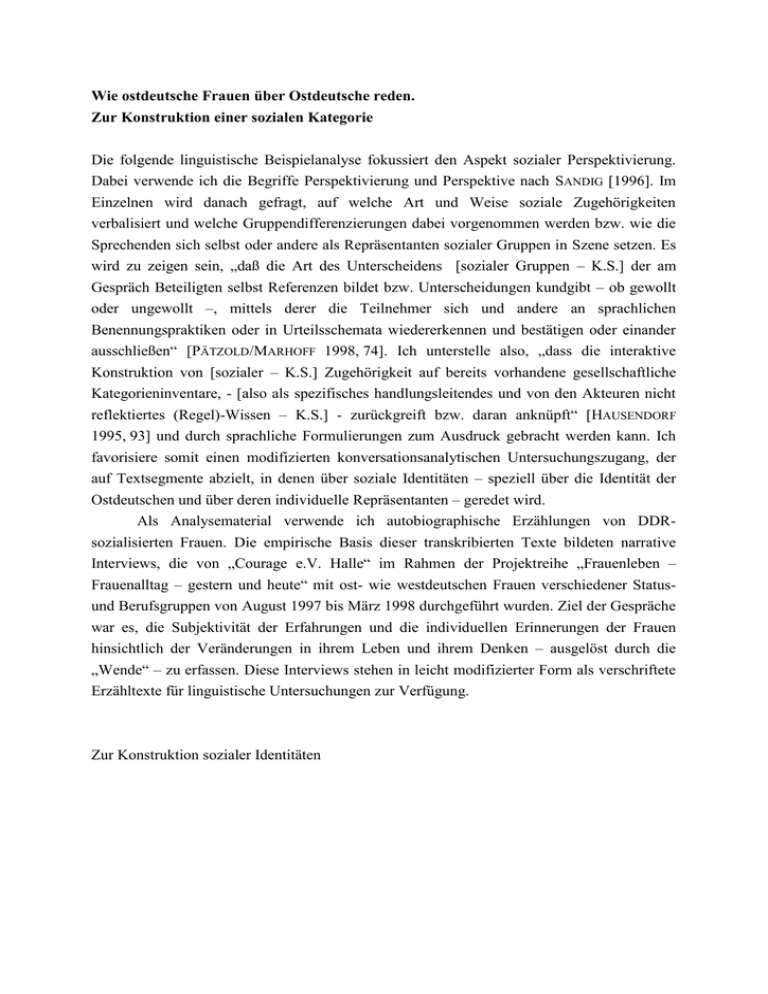
Wie ostdeutsche Frauen über Ostdeutsche reden. Zur Konstruktion einer sozialen Kategorie Die folgende linguistische Beispielanalyse fokussiert den Aspekt sozialer Perspektivierung. Dabei verwende ich die Begriffe Perspektivierung und Perspektive nach SANDIG [1996]. Im Einzelnen wird danach gefragt, auf welche Art und Weise soziale Zugehörigkeiten verbalisiert und welche Gruppendifferenzierungen dabei vorgenommen werden bzw. wie die Sprechenden sich selbst oder andere als Repräsentanten sozialer Gruppen in Szene setzen. Es wird zu zeigen sein, „daß die Art des Unterscheidens [sozialer Gruppen – K.S.] der am Gespräch Beteiligten selbst Referenzen bildet bzw. Unterscheidungen kundgibt – ob gewollt oder ungewollt –, mittels derer die Teilnehmer sich und andere an sprachlichen Benennungspraktiken oder in Urteilsschemata wiedererkennen und bestätigen oder einander ausschließen“ [PÄTZOLD/MARHOFF 1998, 74]. Ich unterstelle also, „dass die interaktive Konstruktion von [sozialer – K.S.] Zugehörigkeit auf bereits vorhandene gesellschaftliche Kategorieninventare, - [also als spezifisches handlungsleitendes und von den Akteuren nicht reflektiertes (Regel)-Wissen – K.S.] - zurückgreift bzw. daran anknüpft“ [HAUSENDORF 1995, 93] und durch sprachliche Formulierungen zum Ausdruck gebracht werden kann. Ich favorisiere somit einen modifizierten konversationsanalytischen Untersuchungszugang, der auf Textsegmente abzielt, in denen über soziale Identitäten – speziell über die Identität der Ostdeutschen und über deren individuelle Repräsentanten – geredet wird. Als Analysematerial verwende ich autobiographische Erzählungen von DDRsozialisierten Frauen. Die empirische Basis dieser transkribierten Texte bildeten narrative Interviews, die von „Courage e.V. Halle“ im Rahmen der Projektreihe „Frauenleben – Frauenalltag – gestern und heute“ mit ost- wie westdeutschen Frauen verschiedener Statusund Berufsgruppen von August 1997 bis März 1998 durchgeführt wurden. Ziel der Gespräche war es, die Subjektivität der Erfahrungen und die individuellen Erinnerungen der Frauen hinsichtlich der Veränderungen in ihrem Leben und ihrem Denken – ausgelöst durch die „Wende“ – zu erfassen. Diese Interviews stehen in leicht modifizierter Form als verschriftete Erzähltexte für linguistische Untersuchungen zur Verfügung. Zur Konstruktion sozialer Identitäten Die These der interpretativen Soziologie (Ethnomethodologie, Konversationsanalyse, symbolischer Interaktionismus), dass soziale wie individuelle Identitäten in interaktiven und biographischen Prozessen konstruiert werden, hat u. a. dazu geführt, dem Problem sozialer Kategorisierung bzw. Identifizierung auch in der Sprachwissenschaft größere Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Zusammenhang sind für pragmalinguistische Untersuchungen im Besonderen die Arbeiten des amerikanischen Soziologen Harvey SACKS entscheidend geworden. Im Folgenden wird ein Diskurs in so genannter In-group-Situation untersucht, d.h., die jeweils kommunizierenden Personen gehören derselben sozialen Gruppe an. Es werden im Besonderen jene Diskursausschnitte einer linguistischen Analyse unterzogen, in denen die Interagierenden sich selbst und andere als Repräsentanten der sozialen Identität ‚Ostdeutsche’ bzw. ‚DDR-Sozialisierte’ thematisieren bzw. in denen sie generierend auf diese sozialen Kategorien Bezug nehmen. Nach DRESCHER/DAUSENDSCHÖN-GAY [1995; vgl. auch HAUSENDORF 1995] unterscheide ich grob zwei Verfahren des Kategorisierens: das Evozieren und das Etikettieren.4 HAUSENDORF [1996, 134 und 138] spricht in diesem Zusammenhang vom Elaborieren und vom Markieren. Bei ersterem werden Eigenschaften, Handlungen, Einstellungen (category-bound activities) von Personen und sozialen Gruppen sprachlich expliziert, ohne schließlich auch entsprechende verbale Etiketten für die auf diese Weise nur implizierten sozialen Kategorien zu benutzen. Demgegenüber zeichnet sich das Verfahren des Etikettierens gerade dadurch aus, dass das Kategorisieren über die Explikation eines sprachlich geronnenen „sozialen Etiketts“ (social label) erfolgt. Daran kann sich letztlich eine Diskursarbeit, die diese benannte soziale Identität elaboriert, anschließen, muss es aber nicht. Wenn man akzeptiert, dass infolge gesellschaftlicher Umbruchsituationen Betroffene sicher geglaubtes Alltagswissen infrage stellen, dann dürfte angesichts der politischen Wende in Ostdeutschland kein Zweifel daran bestehen, dass ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger in besonderem Maße von solchen „Wissensumbrüchen“ betroffen waren und wohl noch immer betroffen sind. Das sollte sich u. a. gerade auch darin zeigen, wie ostdeutsche Sprecherinnen und Sprecher die konversationelle Aufgabe des Kategorisierens lösen. Zu vermuten war, dass die sprachlich Handelnden auf ihre bewährten Kategoriensets zu nationalen, ethnischen und politisch-kulturellen Identitäten nach den gesellschaftlichen Ereignissen von 1989/90 nicht in gleicher Weise wie vor diesen zurückgreifen konnten. D. h. mit anderen Worten, dass die Interagierenden diesbezüglich kommunikative „Probleme“, die ohne die gesellschaftliche Umbruchsituation nicht oder zumindest nicht in gleicher Art und Weise aufgetreten wären, bewältigen mussten. Es war also davon auszugehen, dass Ostdeutsche in ihren sprachlichen Diskursen nach der Wende einen erhöhten kommunikativen Aufwand betrieben haben bzw. betreiben, um mit den Verfahren des Etikettierens bzw. Evozierens soziale Kategorisierungen vorzunehmen. Damit bieten „ostdeutsche Sprachdiskurse“ eine Chance für eine linguistische Analyse, die auf handlungsleitendes Wissen, eben auf jenes, das beim Kategorisieren bzw. Identifizieren während der sprachlichen Kommunikation Anwendung findet, abzielen will. Analysebeispiel: Nachweis der interaktiven Konstruktion der sozialen Kategorie „DDRSozialisierte“ Textausschnitt 1: (1) Was Wende für mich bedeutet? (2) Also, erst mal ist die Wende für mich keine Revolution, wie es häufig gesagt wurde. (3) Das war eigentlich in der politischen Reflexion in unserem Bekanntenkreis oder in der Familie von Anfang an mein Standpunkt. (4) Darüber hinaus bedeutet die Wende für mich, sowohl persönlich, als auch in der gesamten beruflichen Entwicklung, wirklich einen Wendepunkt, von dem aus man neu beginnen mußte. [...] (5) Das war für mich einerseits weder etwas, was nur durch äußere Einwirkung hervorgebracht wurde noch irgend etwas, das man selbst herbeigeführt hat. (6) Andererseits war es vorher ja wirklich schon so, daß man selbst gesehen hat, daß es so nicht weitergeht. (7) Da war dann die Wende auch so etwas, wie eine Auflösung eines Knotens – mit dem einen war Schluß, jetzt mußte man halt sehen, wo das andere hingeht. (8) Das ist für mich die Wende gewesen. (9) Wobei es für mich nie das war, was manche dann darüber sagten – eben im positiven Sinne eine Revolution, oder später negativ unter dem Schlagwort, „die Revolution frißt ihre Kinder“. (10) Das war halt ein Wendepunkt, an dem etwas Neues losging, mit Chancen und eben mit Risiken. (11) Aktiv habe ich an diesen Prozessen eigentlich nicht teilgenommen. [ungekürzter Eingangsturn der Interviewten] Mit diesem Turn übernimmt die Interviewte zum ersten Mal die Sprecherrolle. Der Gesprächsbeitrag zeichnet sich dadurch aus, dass die sprachliche Selbstverortung in Bezug auf eine soziale Kategorie zunächst n i c h t realisiert wird. Lediglich das verwendete Modalverb in der Prädikation des Attributsatzes – von dem [Wendepunkt] aus man neu beginnen mußte (4) – lässt möglicherweise einen Hinweis auf das unmittelbare, persönlich nicht zu beeinflussende Betroffensein vom „Wende“-Geschehen und damit auf die ostdeutsche Identität der Sprechenden erahnen [vgl. auch (5)]. Eine diesbezüglich verbal eindeutige soziale Identifizierung wird erst mit der Feststellung: Aktiv habe ich an diesen Prozessen eigentlich nicht teilgenommen (11) erreicht, denn die „Frage“ nach einer aktiven Beteiligung an den Wendeereignissen scheint nur in Hinsicht auf DDR-Bürgerinnen und -Bürger sinnvoll zu sein. Offensichtlich wird für die Erzählende in diesem Gesprächsabschnitt nicht die sprachliche Identifikation als Ostdeutsche, sondern als eine Person, für welche die Wende keine Revolution war (2), in Opposition zu jenen Ost- wie Westdeutschen, die darüber sagten – eben im positiven Sinne eine Revolution, oder später negativ unter dem Schlagwort, „die Revolution frißt ihre Kinder“ (9), zum eigentlichen Ziel der konversationellen Kategorisierungsaufgabe. Die Sprecherin positioniert sich also aus der Jetzt-Perspektive des Interviews gegenüber Westund Ostdeutschen hinsichtlich einer bestimmten Bewertung der gesellschaftlichen Ereignisse im Herbst 1989. Dafür stehen ihr natürlicherweise keine „fertigen“ lexikalischen Benennungseinheiten zur Verfügung. Da die entsprechenden sozialen Kategorien als solche (noch) gar nicht existieren, fehlen auch diesbezügliche sprachliche Etiketten. Das bedeutet aber, dass die Erzählende nur auf das Verfahren des Evozierens zurückgreifen kann, um die Kategorisierungsaufgabe zu lösen. In diesem Sinne müssen notwendigerweise Evaluationen zum gesellschaftlichen Umbruchgeschehen bzw. persönliche Einstellungen dazu zum entscheidenden Gesichtspunkt avancieren, um sozial differenzieren und typisieren zu können. Textausschnitt 2 (1) Obwohl, wenn man dann sah, wie viele dann gleich so in den Westen geströmt sind – das war für uns, für mich und meinen Mann, auch nichts. (2) Wir haben damals noch auf Rügen gelebt, und die erste Begegnung mit dem Westen lag für uns im Norden. (3) Ende November sind wir dann mal mit der Fähre nach Trelleborg rübergefahren und haben uns Schweden angeguckt. (4) Das war nun unsere persönliche Begegnung mit dem Westen, und die war sicher ganz positiv. (5) Wir sind dort auch mal ins Kaufhaus gegangen, um zu sehen, was es alles zu kaufen gibt und haben uns die westliche Lebensweise im Norden angesehen. (6) Was wir dann später im Westen erlebt haben, war dann schon nicht mehr mit dieser Euphorie versehen. (...) In diesem Textsegment knüpft die Interviewte an typische ostdeutsche Verhaltensweisen und Einstellungen in Bezug auf die Ereignisse unmittelbar nach der Grenzöffnung an: ... wie viele dann gleich so in den Westen geströmt sind (1), die erste Begegnung mit dem Westen [...] war sicher ganz positiv (2-4), Wir sind dort auch mal ins Kaufhaus gegangen, um zu sehen, was es alles zu kaufen gibt (5). Zum einen bewertet sie diese negativ, um ihre individuelle Identität sowie die ihres Ehemannes gegenüber der allgemeinen sozialen Kategorie zum Ausdruck zu bringen: ... das [überfallartige Strömen in den Westen] war für uns, für mich und meinen Mann, auch nichts (1), Was wir dann später im Westen erlebt haben, war dann schon nicht mehr mit dieser Euphorie versehen (6). Zum anderen identifiziert sich die Sprecherin auch mit diesen Einstellungen und Verhaltensweisen: unsere persönliche [erste] Begegnung mit dem Westen, und die war sicher ganz positiv (4), Wir sind dort auch mal ins Kaufhaus gegangen (5) und impliziert damit – wohl eher unbewusst – ihre Ost-Zugehörigkeit. Interessant ist, dass im Verlauf des Interviews noch einmal die Gegenstandsaspekte ‚Reisen in den Westen’ und ‚Einkaufen im Westen’ thematisiert werden [vgl. Textabschnitt 3]. Textausschnitt 3 (1) Wir [die Erzählerin und ihr Ehemann] sind nicht diejenigen, die zum Kaufrausch neigen. (2) Man braucht bestimmte Sachen, man sucht sie sich aus und es ist schön, daß man nicht immer beim Discounter kaufen muß. (3) Aber auch bei der Wohnungseinrichtung waren wir nicht diejenigen, die als erstes alles rausgeschmissen haben und unbedingt neu kaufen mußten. (4) Wir haben gesagt, wir kommen noch ganz gut damit zu Rande und haben dann peu a peu ausgetauscht. [...] (5) Die Reisefreiheit war auch ein wichtiges Resultat der Wende, das auf jeden Fall. (6) Aber das wäre für mich kein Grund gewesen, wie manche andere angegeben haben, die die Ziele der Wende immer auf diese Reisefreiheit reduziert haben, irgendwo über die grüne Grenze zu gehen oder sich irgendwo abzusetzen dafür. (7) Das war es für mich nicht. (8) Man ist ja in die andere Richtung gereist [...] – das hat man dann schon gemacht. (9) Als Beschränkung habe ich das eigentlich erst später empfunden, im Zusammenhang mit den Fragen, die uns dann im Ausland gestellt wurden von den Schweizern oder den Franzosen, die wir auf Island getroffen haben. (10) Da hat man erst im Nachhinein so dieses Perverse gemerkt, daß dieser Vorhang da war – [...] Dieses Mal wird präziser und detaillierter auf die scheinbar typischen Verhaltensweisen Bezug genommen. Es geht nicht mehr schlechthin um den Einkaufsbummel im Westen unmittelbar nach der Wende, sondern um das Zum-Kaufrausch-Neigen (1-4), und es geht nicht mehr einfach um die Euphorie der ersten „West-Besuche“, sondern um die von den DDR-Bürgerinnen und -Bürgern geforderte und von den damaligen Machthabenden nicht gewährte Reisefreiheit, wodurch die Fluchtwelle im Herbst 1989 und letztlich die Wende ausgelöst worden sein sollen (5-10). Zu beiden Gegenstandsaspekten nimmt die Sprechende distanziert über verbale Negation Stellung: Wir [sprechendes Ich und Ehemann] sind nicht diejenigen, die zum Kaufrausch neigen (1), wir waren nicht diejenigen, die als erstes alles rausgeschmissen haben und unbedingt neu kaufen mußten (3) bzw. Aber das [die nicht gewährte Reisefreiheit] wäre für mich kein Grund gewesen, wie manche andere angegeben haben, [...], irgendwo über die grüne Grenze zu gehen oder sich irgendwo abzusetzen dafür (7). Auf diese Art und Weise kontrastiert die Sprechende klar ihre individuelle Identität gegenüber anderen Repräsentanten der sozialen Kategorie. Sie charakterisiert sich als eine Person, die nach der Wende nicht zum Kaufrausch neigte und die vor der Wende die Beschränkung der Reisefreiheit nicht als solche empfunden hatte und somit auch keine Fluchtambitionen hegte. Insofern wird von dieser interviewten ostdeutschen Frau prototypisches Wissen über DDRBürger(innen) bzw. über DDR-Sozialisierte, das sich z. T. sogar erst mit und nach den Wende-Ereignissen etabliert hat, aufgebrochen. Textausschnitt 4: (1) Es war auch kein angestammtes Geschäftsfeld mehr, wo ich der Firma abgekauft habe und wo es auch wirklich so war, daß da langjährige Erfahrungen und einfach Fakten auf dem Tisch liegen. (2) Man war in einen anderen Bereich gegangen, wo ich, das muß ich sagen, auch mit meinem Gewissen Probleme gekriegt habe. (3) Das hing sicher auch mit dieser OssiMentalität zusammen – wenn man was macht, dann macht man es eigentlich korrekt und gründlich und es geht schon gar nicht, die Leute anzulügen. [...] (4) Ich habe mich dann mit meinem Chef hier in Halle, das war auch ein Ossi, darüber verständigt, dass wir eine andere Auffassung darüber haben, wie man arbeiten sollte. (5) Wenn man irgend etwas übernimmt, daß man dann auch sehr gründlich dabei ist. (6) Man verkauft nicht irgend etwas nach außen und macht einfach das Alte weiter nach dem Motto: seht mal zu, das dürfte doch kein Problem sein, wir haben das schon in einem anderen Bereich gemacht, da macht ihr das da halt auch so. [...] (7) Ich weiß, das ich das nicht kann, soll es aber verkaufen, als wenn es das Nonplusultra wäre für den Auftraggeber. (8) Da habe ich dann aber auch selber die Initiative ergriffen, bin zu diesem Superkaufmann [ein Westdeutscher] nach Hause gefahren und habe ihm das geschildert und einfach gesagt, ich kann so jetzt nicht weitermachen. [...] Der Textausschnitt nimmt Bezug auf die eineinhalbjährige Erwerbstätigkeit der Interviewten in einer ostdeutschen Filiale einer westdeutschen Firma Anfang der neunziger Jahre. Auffällig ist, dass sich in dieser Passage die Erzählende – neben anderen Personen – e r n e u t selbst über das Verfahren des Etikettierens als Ostdeutsche identifiziert: Ossi-[Mentalität] (3); das war auch ein Ossi; wir (4). Die verwendeten sprachlichen Etiketten werden darüber hinaus von der Sprechenden durch die explizite Zuschreibung einer für typisch erachteten Einstellung der Ostdeutschen (wir; man) aufgefüllt: dass wir eine andere Auffassung darüber haben, wie man arbeiten sollte (4). Den thematischen Schwerpunkt des Textausschnittes bildet schließlich der detaillierte kontrastive Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschen hinsichtlich der Arbeitseinstellung. Wie sich die beiden sozialen Kategorien diesbezüglich voneinander unterscheiden, wird allerdings nur implizite zum Ausdruck gebracht, indem die Erzählende mittels affirmativer und verneinender Aussagen lediglich die ostdeutsche Arbeitsauffassung beschreibt: dann macht man es eigentlich korrekt und gründlich (3), sehr gründlich dabei (5), es geht [...] nicht, die Leute anzulügen (3), [M]an verkauft nicht [...] nach außen (6) und sich anschließend selbst evaluiert: ich [habe], das muß ich sagen, auch mit meinem Gewissen Probleme gekriegt (2), Ich weiß, daß ich das nicht kann, [nämlich die Arbeit korrekt und gründlich unter diesen Bedingungen erledigen] (1), soll es [das Arbeitsergebnis] aber verkaufen, als wenn es das Nonplusultra wäre für den Auftraggeber (7), ich kann so jetzt nicht weitermachen (8). Deutlich wird die positiv bzw. für moralisch „wertvoll“ bewertete Einstellung zur Erwerbsarbeit, die DDR-Sozialisierte auszeichnen soll: Sie arbeiteten und arbeiten gründlich, korrekt, engagiert und in Einklang mit dem eigenen Gewissen. Insofern lässt die Erzählende dieser Einschätzung entsprechend auch Taten folgen. Sie ergreift die Initiative zu einer Aussprache mit ihrem westdeutschen Abteilungschef – diesem „Superkaufmann“ (8) – und kündigt letztlich der Firma. Anzumerken ist, dass in einem Zusammenhang wie diesem, in dem der kontrastive Vergleich der sozialen Kategorien ‚Ostdeutsche/Westdeutsche’ eine moralische Überlegenheit der Ostdeutschen demonstriert, das Verfahren des Etikettierens einen wichtigen Stellenwert inne hat, um sich sozial eindeutig zu identifizieren. Das Evozieren steht dabei lediglich im Dienst des Etikettierens. Textausschnitt 5: [...] (1) Trotzdem würde ich das in der Öffentlichkeit kolportierte Bild von der Generation der 30-jährigen „jung, dynamisch, flexibel“ nicht so ohne weiteres für uns (die Erzählerin und ihr Ehemann) annehmen. (2) Diese typische Biographie haben wir ganz bestimmt nicht – [...] (3) Wir sind nicht gegangen, und ich glaube, nicht nur wegen einer gewissen Trägheit oder weil wir halt nicht so weltoffen sind oder wie auch immer – sondern weil wir auch gesagt haben, es kann ja wohl nicht sein, dass alle weggehen. [...] (4) Und dann war da auch unsere Mentalität, wo ich mir gesagt habe, es wäre für mich doch in Vielem ein ganz schönes Verstellen gewesen. [...] (5) und wenn man da permanent aufpassen muß und quasi eine Schere im Kopf hat, das kann ich nicht lange mitmachen. (6) Das war auch ein Grund, warum wir nicht dorthin gegangen sind. (7) Und deshalb sind wir nicht so flexibel, wie man das von solchen Typen, die nur Karriere machen wollen, erwartet. [...] (8) Wir haben beide in unserer Arbeit nicht so vordergründig auf das Finanzielle gesehen, sondern brauchen sie auch zur Selbstbestätigung und aus Spaß an der Freude. [...] (9) Deshalb ist unser Leben vielleicht nicht so klassisch das Leben dieser gedachten Generation. Interessant an diesem Textausschnitt ist, dass sich die Sprechende zunächst ohne Bezugnahme auf die Opposition ‚Ostdeutsche/Westdeutsche’ über Verneinung des sprachlichen Etiketts Generation der 30jährigen (1) identifiziert: [ich] würde das in der Öffentlichkeit kolportierte Bild von der Generation der 30jährigen [...] nicht so ohne weiteres für uns [die Erzählerin und ihr Ehemann] annehmen (1). Darüber hinaus benennt sie typische Merkmale dieser negierten sozialen Kategorie: jung, dynamisch, flexibel (1), typische Biographie (2). Diese im Großen und Ganzen positiv konnotierten Merkmale lassen verständlich werden, dass die vorausgegangene NichtIdentifizierung der Sprechenden mit dieser sozialen Kategorie einer Rechtfertigung bedarf. Zu diesem Zweck greift die Erzählende die bereits genannten kategoriengebundenen Eigenschaften noch einmal auf und konkretisiert bzw. kontrastiert sie durch sprachliche Negation: nicht gegangen nicht nur wegen einer gewissen Trägheit oder weil wir halt nicht so weltoffen sind (3), nicht so flexibel, wie man das von solchen Typen, die nur Karriere machen wollen, erwartet (7), Wir haben beide in unserer Arbeit nicht so vordergründig auf das Finanzielle [ge]sehen (8). Auf diese Art und Weise gelingt es der Erzählenden, sich selbst und ihren Ehemann im Fokus der sozialen Kategorie der ‚Generation der 30jährigen’ individuell zu verorten. Neben dieser Identifizierung als Nicht-typische-Dreißigjährige indiziert die Sprechende ihre soziale Zugehörigkeit als Ostdeutsche. Dazu dienen einerseits deiktische Sprachmittel: Wir sind nicht gegangen (3), warum wir nicht dorthin gegangen sind (6), wenn man da permanent aufpassen muß (5) und andererseits das Thematisieren von category-bound activities wie ‚spezifische Mentalität’ und ‚Einstellung zur Erwerbsarbeit’: Und dann war da auch unsere Mentalität - wo ich mir gesagt habe, es wäre für mich doch in Vielem ein ganz schönes Verstellen gewesen (4), und wenn man da permanent aufpassen muß und quasi eine Schere im Kopf hat, das kann ich nicht lange mitmachen (5) bzw. Wir haben beide in unserer Arbeit nicht so vordergründig auf das Finanzielle gesehen, sondern brauchen sie auch zur Selbstbestätigung und aus Spaß an der Freude (8). Diese Interpretation als category-bound activities wird durch Textausschnitt 4, in der sich die Erzählende generalisierend zur Ossi-Mentalität äußert, gestützt. Die Interviewte gibt sich also letztlich auf Grund ihrer ostdeutschen Sozialisation als untypische Dreißigjährige aus. Somit findet hier die Kontrastierung von Ost- und Westzugehörigkeit sozusagen erst vor dem Hintergrund einer anderen sozialen Kategorie, der der Dreißigjährigen, statt und erfolgt ohne erneut auf das Verfahren des Etikettierens zurückzugreifen. Fazit Das Analysebeispiel sollte demonstrierten, wie die konversationelle Aufgabe, sich als Ostdeutsche bzw. DDR-Sozialisierte zu verorten, von der interviewten Frau gelöst worden ist. Als Ergebnis meiner Analysen bleibt darüber hinaus zu konstatieren: Das Verfahren des Evozierens fand häufiger als das des Etikettierens Anwendung. Das Etikettieren wurde im Besonderen dann genutzt, wenn sich die jeweils Sprechende mit der sozialen Kategorie der DDR-Sozialisierten bzw. mit bestimmten prototypischen Merkmalen dieser Kategorie identifizierte, meist im Sinne einer positiven Bewertung aus der aktuellen Zeitperspektive heraus und in Kontrastierung zur sozialen Kategorie der Westdeutschen. Das Evozieren bot dagegen die Möglichkeit, interne Differenzierungen zur poltischkulturellen Identität der DDR-BürgerInnen bzw. zu der der Ostdeutschen vorzunehmen sowie neue soziale Kategorien unabhängig von der Ost-West-Zugehörigkeit zu „etablieren“. Das wurde zum einen über die Verneinung spezifischer category-bound activities erreicht und zum anderen über die Evaluierung gesellschaftlicher Ereignisse und Vorgänge vor und nach der „Wende“ aus der Perspektive einer potentiellen Repräsentantin einer erst noch zu entwickelnden sozialen Kategorie. Quantitativ überwiegt die Negation von category-bound activities bzw. von seitens der Interviewten als typisch erachteten Merkmalen, die Repräsentanten bereits bestehender sozialer Alltagskategorien auszeichnen, um sich eben von diesen verfestigten Kategorien bis zu einem gewissen Grade zu distanzieren. Demgegenüber fällt der Anteil des „potentiellen Etablierens“ neuer Merkmale bzw. neuer Kategorien eher bescheiden aus. Wesentlich scheint aber zu sein, dass sich die Sprechenden bei ihrer verbalen Selbstverortung mit dem gefestigten kategoriengebundenen Alltagswissen nicht zufrieden geben, sondern es modifizieren und neu organisieren, was wiederum als Ausdruck der Suche nach der eigenen Identität interpretiert werden könnte. In Bezug auf die Kategorie ‚DDR-Bürgerin’ ist der Hang zu einer internen Differenzierung auffällig, eben zur individuellen Identifikation als Nicht-typischeRepräsentantin dieser verfestigten Alltagskategorie. Zu diesem Zweck wählen die Interviewten häufig jene kategoriengebundenen Verhaltensweisen und Einstellungen aus, die primär von der sozialen Perspektive der Westdeutschen aus determiniert erscheinen und negativ bewertet sind (jammern, in den Westen wollen, zum Kaufrausch neigen). Über die sprachliche Negation dieser category-bound activities verdeutlichen die interviewten ostdeutschen Frauen andere Gruppenanschlüsse, die zum Verständnis ihrer individuellen Identität notwendig erscheinen. Bei Berücksichtigung der spezifischen Interaktion des narrativen Interviews ist meines Erachtens darin aber keine „Falle“ der Selbstverortung [vgl. WOLF 1995] zu sehen, insofern als die individuelle Ausnahme hier nicht die soziale Regel, sprich: die soziale Kategorie, bestätigt. Ich meine, dass solche autobiographischen Erzählungen, gerade in ihrer Zusammenschau, deutlich werden lassen, dass prototypisches Wissen um die Kategorie ‚DDR-Sozialisierte’ von den Sprechenden als den eigentlichen Repräsentanten dieser Kategorie im Sinne einer korrektiven Spezifizierung aufgebrochen wird. Eine Erklärung dafür zu finden ist schwierig. Setzte man voraus, dass sich die ostdeutschen Sprecherinnen auf diese Art und Weise von einem aus westdeutscher Perspektive stigmatisierten „Stereotyp“ abheben wollten, dann könnte mit GOFFMANN argumentiert werden: „Das stigmatisierte Individuum zeigt eine Tendenz, seines-»gleichen« gemäß dem Grad, in dem ihr Stigma offenbar und aufdringlich ist, in Schichten zu gliedern. Es kann jenen gegenüber, die evidenter als es selbst stigmatisiert sind, die Verhaltensweisen einnehmen, die die Normalen ihm gegenüber haben“ [1996, 133f.]. Dies würde für den geschilderten Fall aber nur bedingt zutreffen. Die Sprechenden gehen nämlich mit ihrer individuellen Identifizierung als nicht-„stereotype“ DDR-Bürgerinnen zu einem großen Teil gerade das Risiko des Gesichtsverlustes gegenüber Westdeutschen (den Normalen, den Nicht-Stigmatisierten) ein, wenn sie bekennen, dass sie die DDR als nicht so schlimm empfunden haben und dass sie nicht aktiv am Wendegeschehen beteiligt gewesen sind. Insofern erscheint es mir legitim, im Zusammenhang mit den verbalen Kategorisierungen dieser Interviewten von einer Dekonstruktion sozialen Wissens zu sprechen, die selbstverständlich auch immer eine konstruktives Element impliziert.