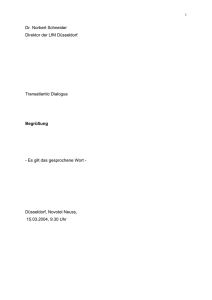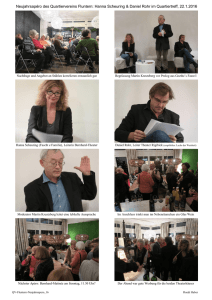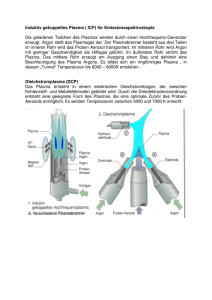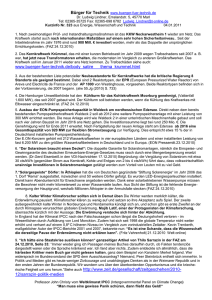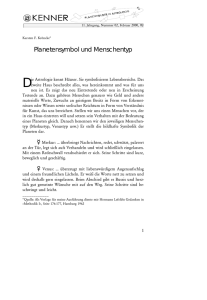Kultur. - Chris von Rohr
Werbung

Kultur. | Samstag, 14. November 2015 | Seite 23 Hart, aber liebeshungrig Soft, aber wuchtig Schauspiel-Premiere. Ein schwuler König macht aus ­ asallen Rebellen in Ewald Palmetshofers «Edward II – V Die Liebe bin ich». Jetzt am Theater Basel. Seite 25 Baloise-Finale. Die erfahrenen Poprocker Toto und der Westschweizer Newcomer Bastian Baker haben das Finale der Baloise Session bestritten. Zeit für eine Bilanz. Seite 27 Chris von Rohr, der Jimi Hendrix der Schreibmaschine, über Liebe, Leben und Sterben Der Rocker als Komponist des Wortes Freistil Letzter Vorhang für Stadelmaier Von Michael Bahnerth Von Christine Richard Das Buch heisst «Götterfunken» und zwischen den Buchdeckeln stecken die «besten Kolumnen» von Chris von Rohr, etwas über 50 sind es. Ja, der letzte und ewige Rocker der Schweiz schreibt auch, und zwar gut. Er schreibt aus mehreren Gründen gut. Erstens hat er etwas zu sagen, zweitens muss es dringlich raus aus ihm, drittens ist er Romantiker und glaubt deswegen immer noch an die grosse Liebe, viertens hat er eine alte Seele, fünftens eine Ahnung von der universellen Traurigkeit und Einsamkeit der Welt und sechtens auch eine von den paar universellen Freuden, die einem die Welt hin und wieder offeriert, und siebtens ist er ein Jimi Hendrix im Labor der Worte. Die Schwierigkeit ist, dass ich hier über einen schreibe, der zum Freund geworden ist, seit wir uns vor einem Jahr in seinem Piratennest in Solothurn getroffen und zwei Stunden lang gesprochen haben. Nie werde ich den Satz vergessen: «Don’t verzettel yourself.» Seither schreiben wir uns, zur Hauptsache E-Mails, mal länger, mal kürzer, mal wie Männer, mal wie kleine Jungs, und meistens im Irgendwo dazwischen. Uns verbinden ein paar Leidenschaften und ein paar existenzielle Nöte, wahrscheinlich ist deshalb das Gespräch vom letzten November nie abgerissen; Frauen, Sex, Griechenland, die Unausweichlichkeit des Todes und die Sehnsucht nach einem Leben, das die Musik des ungezügelten, wilden, unberechenbaren, sehnsüchtigen trunken Machenden in sich trägt. An diesem Donnerstagnachmittag, an dem ich das hier tippe, hat er eine Mail geschrieben, nicht wie oft in Grossbuchstaben, sondern in ganz kleinen. Das heisst immer, dass es dann ernster ist. «weisst du, michali», schreibt er, «ich schreibe einfach swin­ gend über das leben und sterben im dis­ neyland switzerland – wo zurzeit vor allem die humorlosen, moralisierenden, lustfeindlichen, knochenlosen gummi­ tiere regieren. ich tue das aus der warte eines zeitgenossen, der mit freude dem leben noch seine bezaubernden, berau­ schenden seiten abgewinnen kann, es zelebriert, ohne dabei zu vergessen, DASS ES VIEL ELEND UND WIDER­ SPRUCH IN DIESER WELT GIBT, UND DASS DAS ENDE SCHON NAHE IST ... schlicht ein paar zeitlos gültige wahrhei­ ten, um die menschen im besten fall zum kreativen denken und besser leben – not more, not less.» Das alles ist «Götterfunken», es ist ein kleines Feuerwerk, Notizen aus der Welt eines Menschen, der nicht bloss ist, um einfach nur zu sein. Chris von Rohr hat noch eine Kolumne geschickt, eine bisher nur im Buch veröffentlichte Kostprobe: «Das Unwort», und sie geht so: Das Beste am Theater ist, dass man eine grosse Familie bildet. Man streitet sich bis aufs Messer, Nerven liegen blank, das Seelenkostüm ist zerfetzt – aber man trifft sich immer wieder gern. Auf der Bühne, in der Kantine, zu Premieren und Beerdigungen und zu Premieren, die Beerdigungen sind. Nur die bösen Onkels, sie fehlen seit ein paar Jahren beim Familientreffen. Die bösen Onkels des Theaters, das sind die Theaterkritiker. Die grossen Namen, die hauptberuflichen Theaterkritiker sterben aus. Henning Rischbieter, gestorben 2013. Hellmuth Karasek, gestorben 2015. Peter Iden, Privatier. Reinhardt Stumm, Privatier. Günter Rühle, C. Bernd Sucher und Benjamin Henrichs – seit Jahren pensioniert. Alles Leute, die Bücher geschrieben haben und Kulturpolitik mitgestaltet haben in Jurys, städtischen Gremien. Auch Gerhard Stadelmaier hat sich jetzt sang- und klanglos verabschiedet. Er war der letzte Recke der deutschen Theaterkritik, seine Besprechungen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) waren gefürchtet. Fürchterlicher war nur, wenn er überhaupt keine Besprechung schrieb, weil der Theaterabend unter aller Kanone war und es Stadelmaier zu dumm war, auf Spatzen zu schiessen. Einmal erschien von ihm in der FAZ statt einer Theaterkritik eine leere Spalte – so schlimm hatte das Freiburger Theater eine Uraufführung von Botho Strauss in den Sand gesetzt. Als junge Theaterkritikerin waren die bösen Onkels mein Vorbild. Ihre Premierenberichte kleckerten nicht mit Details, sie klotzten. Klare Ansage. Sie waren stilbildend, meinungsbildend, mächtig. Man wollte wissen, was sie zu sagen hatten. Benjamin Henrichs gehörte eher zur Sorte der guten Onkels. Hatte der Traditionalist Stadelmaier das postdramatische Theater in Grund und Boden gestampft, hob es Henrichs mit Fingerspitzen wieder auf. Lesen wollte und musste man sie beide. Und zwar von vorne bis hinten, denn ihre Besprechungen waren in sich geschlossene, originäre Werke. Die bösen und guten Onkels erzählten nicht einfach nur nach, was sie auf der Bühne zu sehen glaubten. Sie setzten vielmehr den Bühnenschöpfungen eigene, eigensinnige Sprachkunstwerke entgegen. Was sie also trotz aller Feindschaft innerlich mit der Theaterfamilie verband, war die gleiche Freude am Gestalten einer eigenen Welt. Ihre Kritiken hatten Auftrittsqualität. Das gilt ebenso für ihre Person, sie waren Männer mit Persönlichkeit. Sage niemand, die Zeit für Theater und Theaterkritiken sei vorbei. So breit wie heute ist nie zuvor über Theateraufführungen diskutiert worden. ­Leider passiert das kaum noch in Printmedien, sondern eher im Internet. Auch dass Stadelmaier die FAZ verlässt, stand zunächst im Internetportal Nachtkritik – erst viel später verabschiedete sich die FAZ von ihrem ­wichtigsten Theaterkritiker. «Was tue ich hier eigentlich? Ich schreibe. Das ist mein Job. Aha. Warum und wozu? Vermutlich habe ich einen endogenen Drang, über das menschliche Treiben zu sinnieren, und indem ich meine Beobachtungen aufschreibe, erkläre ich sie mir sogleich. Jetzt kommt schon wieder meine böse Zunge, die keift, ich könne ja ­meinen Quassel ebenso gut für mich in meinem Compi behalten. Aber Zung­ chen, ich bitte dich, es ist doch ein Geben und Nehmen – ich lese ja selber so gern und höre auch anderen gern zu, will wissen, was in deren Kopf und Seele köchelt. Lebensgeschichten kann ich kaum widerstehen und irgendwie ­müssen ja auch noch die Rechnungen bezahlt werden. Das Wunder der Sprache, Buch­ staben und Wörter machen es möglich, dass wir uns einander mitteilen, immer wieder aufs Neue. Allerdings gibt es Begriffe, die in mir einen Fluchtreflex auslösen. Mein persönliches Unwort, das mich fast zum Davonspringen bringt und das ich von ganzem Herzen verabscheue, ist Abschied. Wie das schon tönt! Geschiedener, hau ab! Scheiden, Not more, not less.Chris von Rohr mit einer bunt gemischten Liebeserklärung an das Leben in der Hand. Foto Florian Bärtschiger abfahren ... das ist derart negativ und traurig. Das ist nicht einfach ein bitzeli Tschüss sagen am Bahnhofsperron, Tage zählen, ein kurzer Unterbruch des Zusammenseins ... Echter Abschied ist kohlrabenschwarz und meist eine ­Tragödie! Bei diesem Wort kommt mir in den Sinn, wie ich weinend mit dem Halsband in der Hand aus der Tierklinik flüchtete. Dann das Sackgassengefühl beim Tod meiner Eltern. Und jetzt die Worte eines Freundes, der gerade zusieht, wie seine erwachsene Tochter mit Umzugsschachteln hantiert und die Räume des gemeinsamen Erlebens ver­ lässt. Obwohl, man sollte ja freudig ­herumhüpfen, wenn ein Kind so gut zurechtgewachsen ist, dass es stolz und selbstsicher mit seinen Habseligkeiten aus dem Haus spazieren kann. Es ist ja bereit und die Abnabelung natürlich. Das ist die praktische Verstandesebene, aber dann gibts halt auch die ­emotionale. Auch bei mir und meinem ­Tochterherz bahnt sich das an, und ich geniesse jeden Tag, an dem sie noch da ist, wie eh und je. Und so kommen mir wieder die blut­ ten Kinderfüessli in den Sinn, wie sie aus dem Bébécabriolet herausluegen, und ich schnäutze die Nase beim Gedanken daran, wie man die Kleine damals hin­ ten an den Latzhosen hochheben und zum Glucksen bringen konnte. Und es roch so gut, als sie noch ein Baby war. Wie junge Säuli ..., kein Scherz! Riechen Sie mal an jungen Säulis! Dann all die Stunden, die man gemeinsam vor dem Einschlafen erlebt hat, sei es mit einer Guetenacht­ geschichte oder einfach nur Händchen haltend. Und am Morgentisch, wo wir mehr oder minder wach dem Alltag ­entgegentraten, bevor die Schule rief. Ja, es wird wehtun, wenn nichts mehr da ist, wo es hingehört, und nichts mehr ist, wie es mal war. Meine liebe Leserschaft, die meisten von Ihnen kennen wohl dieses Gefühl: Wir lassen unsere Kinder in diese kon­ fuse, grobe Welt hinaus und wissen, dass sie eigentlich dafür vorbereitet sind, es auch wollen, und trotzdem zweifeln wir und möchten ihnen all die schmerz­ haften Erfahrungen, die ein Leben so mit sich bringt, ersparen. All die Ent­ täuschungen und zerplatzten Träume. Büne Huber mit seinen Ochsnern hat das wunderbar besungen im Song «Da für Di»: «I wünsche dr aues Glück vor Wäut & ne guete Ängu, wo ging zue dr luegt, wo di behüetet & beschützt, wüu hinger auem wunderderschöne, da war­ tet mängisch scho dr Schmärz … we du rüefsch & di niemer ghört … I bi immer für di da.» Ja, was können wir auch anderes, als da zu sein, wenn sie uns brauchen? Oder die grosse Liebe, die wir schmerzvoll ziehen lassen mussten. Ein beelendendes Gefühl. If you love some­ body, set them free, klingt es in meinem Kopf! Ja, ja sicher …, das ganze Leben ist ein Abschied. Auch meine Trennung von Krokus anno 1983 tat deutlich mehr weh als ein blauer Mosen am Schienbein. Es waren harte, graue, sinnlose Jahre, wo ich ­meines Babys entrissen wurde und in ein tiefes Loch fiel. Über Jahre war die Band meine Familie, der Tourbus meine Wohnung, die Bühne meine Stammbeiz und die Bassgitarre mein Lieblingsspielzeug. Dann der abrupte Abschied. Erst später erkannte ich den grösseren Sinn dahin­ ter. Dieser Abschied war eine Chance des Wachstums und der Weiterentwicklung für mich. Er eröffnete mir ganz neue Wirkungsfelder. Und heute sind wir ­Krokusse, nach einer längeren ­ Abstinenz und Denkpause, schon seit bald acht Jahren wieder gereift, ­ friedlich und freudig zusammen. Irgendwie unglaublich. Trotzdem: Abschied ist wirklich ein gruseliges Wort. Seien Sie froh, wenn Sie gerade keinen Grund haben, es in den Mund zu nehmen. Das Gegenteil davon müsste ergo in meinem Mund zergehen wie ein Nidletäfeli. Wie heisst es? Anvereinigung? Hä ...? Es wohlet mir nicht bei dieser verbalen Gegensatzfindung. Lieber schaffe ich mir ein persönliches, heiliges, elftes Gebot, das ich mir mögli­ cherweise noch auf die Innenseite der WC-Tür schreibe: DU SOLLST ZUSAM­ MENFÜGEN, NICHT TRENNEN! Sehen Sie, diese Kolumne ist wirk­ lich mehr als ein Job – sie ist echte Lebenshilfe für mich! Lachen Sie mich ruhig aus. Dann sind wir schon zwei. Das vereint uns.» Chris von Rohr: Götterfunken.Giger Verlag. 200 Seiten, 29.90 Franken. Buchpräsentation am Mittwoch, 18. November 2015. Thalia Bücher, Freie Strasse 32. 19.30 Uhr. Spielberg feiert Filmpremiere «Bridge of Spies» in Berlin Berlin. Zur Europapremiere seines als Oscar-Kandidaten gehandelten Agenten-Thrillers «Bridge of Spies» ist Hollywoodregisseur Steven Spielberg an die Originalschauplätze des Kalten Krieges nach Berlin gereist. Spielberg bringt brisante Zeitgeschichte ins Kino. In ­ «Bridge of Spies» mit Tom Hanks geht es um den Agentenaustausch zwischen Ost und West im Kalten Krieg. In Berlin liess sich Spielberg am Freitag Fragen zur Tagespolitik gefallen. Zum angespannten ­Verhältnis von Russland und den USA meinte der Filmemacher, die Situation heute sei nicht mit dem Kalten Krieg vergleichbar: «Aber es ist etwas Frost in der Luft.» SDA