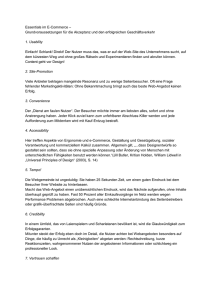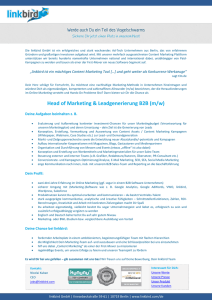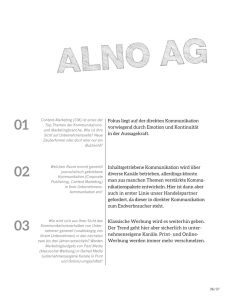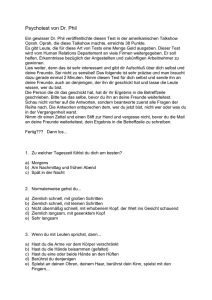Dr. Norbert Schneider Direktor der LfM Düsseldorf Transatlantic
Werbung
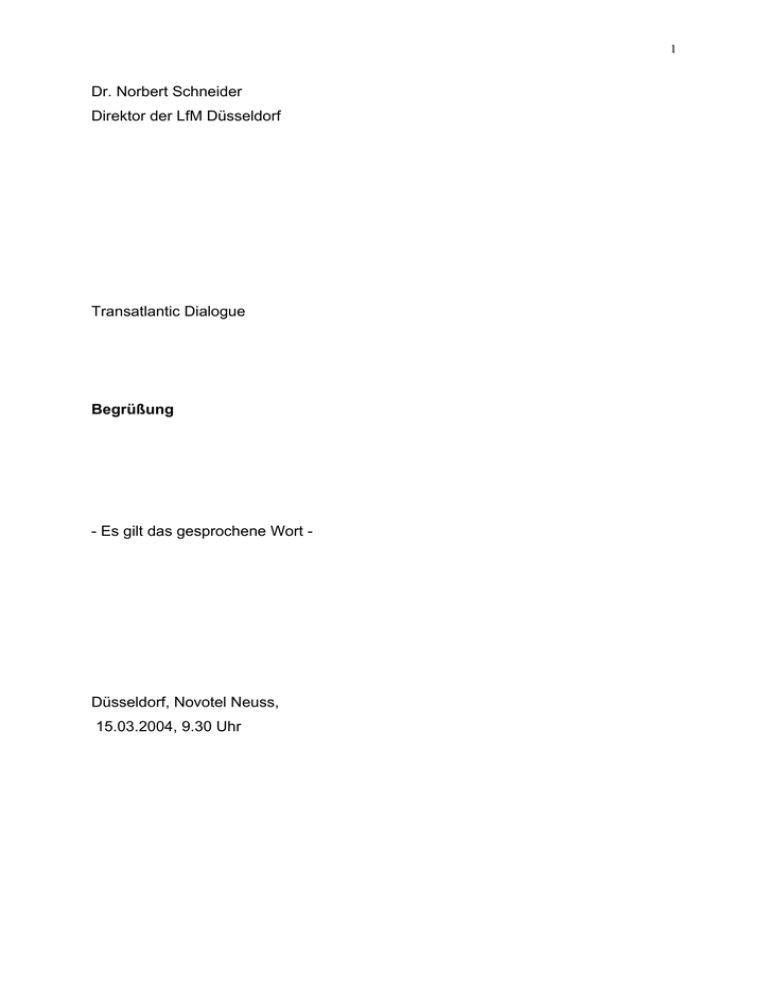
1 Dr. Norbert Schneider Direktor der LfM Düsseldorf Transatlantic Dialogue Begrüßung - Es gilt das gesprochene Wort - Düsseldorf, Novotel Neuss, 15.03.2004, 9.30 Uhr 2 Anrede. Zwei deutsche Journalisten haben sich am letzten Wochenende zum Thema Werbung geäußert. Beide Texte, sehr subjektiv der eine und im Bemühen um viel Objektivität der andere, annoncieren je auf ihre Weise: In der Werbelandschaft ist Bewegung. Benjamin Henrichs, eine der besten Federn im deutschen Journalismus, schreibt in der Süddeutschen Zeitung – nein, nicht über Goethe, was er auch könnte, sondern über Werbung. Doch wenigstens in Anknüpfung an Goethe, an seinen “Faust” und dessen, wie Henrichs sagt “berühmteste erotische Werbung der deutschen Literatur”: “Mein schönes Fräulein, darf ich wagen...?” Fast noch ins Zitat hinein bricht es aus dem Liebhaber der Werbung, bricht es aus Henrichs heraus. Dieser einschmeichelnde Gestus komme in der heutigen Werbung kaum mehr vor, klagt er. Stattdessen eine Werbung, die “fast nur noch an den Sparer und Spießer” appelliert, “der in jedem von uns hockt”. “Die Werbung lockt nicht mehr, sie drängt sich auf, sie redet in unser Leben hinein, laut, dreist und pausenlos.” Statt der Verführung regiere die “plumpeste Anmache”: “Ruf mich an! In 47 Sekunden bist du fix und fertig”. Darin sieht er “notorische Taktlosigkeit, die sich für Flottheit hält”. Einige Dauerhelden der Werbung seien längst zu wahren Folter-Stars geworden “wie die Milchschnitten-Klitschkos, der Gummibär-Gottschalk oder der Milka-Schmitt”. Es wäre leicht möglich, die Klageliste von Henrichs zu verlängern. Er sehnt sich nach einer Werbung zurück, die “nicht stumpf, sondern wach macht.” ”Sie kann das utopische Gefühl in uns befeuern,” sagt er, “nicht nur das Schnäppchen-Fieber.” Werbung könne nerven, aber sie könne auch Spaß machen. “Man spürt,” so sein Resüme, “in den letzten Jahren deutlich, wie der Spaß schwindet und die Folter sich verschärft.” Aber an wem liegt´s? “Vielleicht”, spekuliert Henrichs, “sind die eigenen Nerven schlechter geworden. Vielleicht aber haben die Werbeprofis, die Nervensäger also, ihre Kunst mittlerweile verlernt, verraten oder verdorben.” Das ist eine Stimme unter vielen, meine Damen und Herren, freilich eine aus einem klugen Kopf mit einem ziemlich klaren Blick. Es ist die Stimme eines enttäuschten Liebhabers, und ich behaupte einfach einmal, dass es davon nicht wenige gibt. Der 3 Grund ist nicht, dass früher ohnehin alles besser war, etwa mit der lila Pause als dem Beitrag der Werbung zum Rinderwahn. Das ist nicht das Gefühl, dass sich alles abnutzt durch Wiederholung. Eher ist es so, dass wir durch ein ziemlich kreatiefes Tal gehen. Vor allem aber ist es so, dass die Werbung wie einiges andere auch in der Medienlandschaft, sich in einer Phase des Umbruchs, des Übergangs befindet. In der Anpassung an einige neue Rahmendaten wie zum Beispiel ein Publikum, das sich beim Ausgeben von Geld zunehmend schwerer tut, das es wirklich billig haben möchte. Wie zum Beispiel durch den Umstand, dass man nicht mehr nur in Werbeblöcken auftritt, als spot, sondern vermehrt dort, wo man sich eigentlich gar nicht aufhalten darf, im Programm selbst. Mehr und mehr sitzt die Werbung auf dem Schoß des content, pausbäckig und ungeniert, in der Gewissheit freilich, dass man das so recht gar nicht wahrnehmen kann. Hier setzt die Annonce des zweiten Journalisten ein, eine Recherche von Volker Lilienthal von epd medien. Für ihn fallen derzeit eine Reihe von Reinheitsgeboten, etwa zwischen Werbung und Programm, aber nicht durch Gesetze, sondern durch das Leben. TV-Sender mit klammen Budgets zum Beispiel suchen nach neuen Finanzquellen. Das ist plausibel, wenn die Einnahmen sinken. Aber sie finden diese Quellen überwiegend in der düsteren Grauzone zwischen Werbung und Programm, in Mischformen von content und Werbung, die man mit bloßem Auge nicht mehr erkennt, Mischformen der Botschaften und solchen der Medien. Kooperation heißt hier das ziemlich harmlos klingende, geradezu euphemistische Deckwort. Und wer könnte dagegen sein? Kooperation ist zunächst einmal etwas zutiefst Positives. Unter einer winzigen Voraussetzung. Wir, die Zuschauer und auch wir, die Aufsicht, wüssten nun einmal zu gerne, wer hier mit wem kooperiert und vor allem: zu welchen Bedingungen. Nur dann können wir beurteilen, wer das Programm, den content, eigentlich bezahlt und damit bestimmt. Denn das wollen wir ja nicht wissen, weil wir neugierig wären, was wir auch sind. Sondern, weil wir wissen wollen, wer das Programm bestimmt. Nichts gegen Mischformen! Bastarde sind meist sogar besonders reizvoll. Die Hybriden verbinden oft scheinbar Unvereinbares auf aparte Weise. Doch sie müssen ihre Bestandteile als solche zu erkennen geben. Wir müssen wissen, wer beteiligt ist und 4 zu welchen Konditionen. Wir brauchen mit einem Wort Transparenz. Erst dann können wir sagen, ob wir die Mischung wirklich haben wollen und ob sie erlaubt ist. Transparenz ist überflüssig, wenn nach den Reinheitsgeboten gebraut wird. Sie wird zur wichtigsten Frage, wenn fröhlich und lautlos zugleich gemischt wird. Zwischen Programm und Werbung. Aber auch zwischen den Medien. Zwischen den Plattformen. Wenn alte Grenzen fallen. Wenn, um es ein wenig platt zu sagen, jeder macht, was er will. Oder etwas feiner: Wenn sich jeder seine eigenen Gesetze gibt. Wenn ein Star gemacht wird - sagen wir: einer aus der Musikszene -, indem er multimedial promoviert wird, im Radio, im Fernsehen, im Kino, in der Zeitung, im Programm, in der Werbung und doch niemand diese Multimedialität erkennen kann bis auf die paar wenigen, die sie organisieren, dann haben wir Transparenz noch vor uns. Wenn ein TV-Movie aus Gebühren, aus Werbeeinnahmen und aus unerklärten dritten Quellen bezahlt wurde, dann haben wir Transparenz noch vor uns. Ich will nicht falsch verstanden werden. Nicht die Mischung ist das Problem, das Cross over, die Multimedialität, die Ubiquität in den Medien, eines Menschen, eines Produkts, einer Dienstleistung. Das ist so reizvoll und phantasievoll wie die Mischungen, die den Ruf von Spitzenköchen begründen, die ihre Zutaten benennen. Ein Problem entsteht, wenn man nicht mehr sagen kann, was woher kommt. Wenn es keine Stammrolle gibt. Wir, das Publikum, wir, die Aufsicht, wollen wissen, was woher kommt. Beim Rindfleisch ebenso wie beim Fernsehen. Mir scheint, dass neben vielen andern Indizien auch diese beiden Texte vom vergangen Wochenende je auf ihre Weise und beide ohne es zu wissen, diesen transatlantischen Dialog, den sechsten seiner Art, preludiert haben. Einfallsreichtum und Transparenz könnten zwei Rahmenbegriffe sein, in denen sich der Dialog bewegt. Ich begrüße Sie ganz herzlich, vor allem unsere Gäste aus USA, dem Land, in dem der Frühling immer etwas früher ausbricht als bei uns. Ich freue mich über Ihr Interesse, und ich erhoffe mir Informationen und Positionen über eine Landschaft, die sich ohne Frage im Umbruch und, wie ich hoffe, auf dem Weg zu neuen Klarheiten befindet. 5