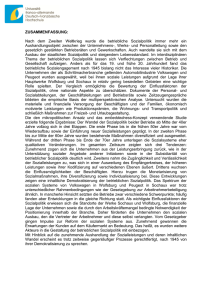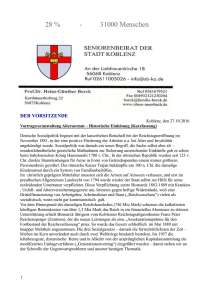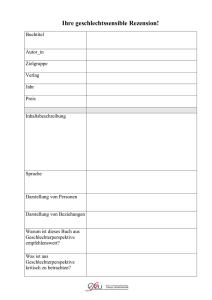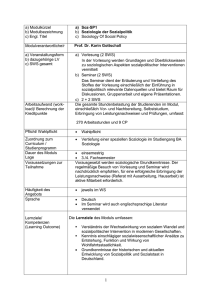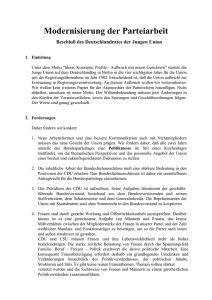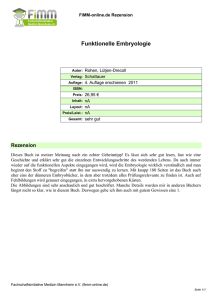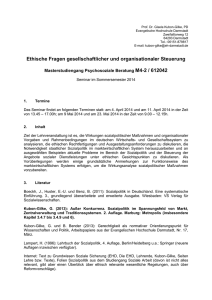Deutsche Sozialpolitik und Sozialpolitikanalyse am Scheideweg
Werbung

Rezension REZENSION Deutsche Sozialpolitik und Sozialpolitikanalyse am Scheideweg Eine kritische Rezension von Manfred G. Schmidt: Sozialpolitik in Deutschland. Historische Entwicklung und internationaler Vergleich. 2. Auflage. Leske + Budrich Verlag, 1998, 334 Seiten. 1. In den letzten Jahren ist eine Fülle von Scheideweg- und Zukunftsbüchern auf den Markt gekommen: Sozialpolitik am Scheideweg, Arbeitsmarktpolitik am Scheideweg, die Zukunft des Wohlfahrtsstaates, die Zukunft der Europäischen Union, die Zukunft der Erde und der Zivilisation und dergleichen mehr sind Titel, die die Regale der Buchhändler und ihrer Kunden zieren und die, so muß man vermuten, mindestens die finanzielle Zukunft der Autoren absichern, jedenfalls zumindest teilweise. Seltener hingegen erscheint ein Buch, das die Scheidewege der Vergangenheit untersucht, und das auch noch international vergleichend. Schon deshalb muß man die neue "vollständig neubearbeitete und erweiterte Fassung" - so die Herausgeber im Vorwort - und neu betitelte Auflage von Manfred G. Schmidts erstmals 1988 erschienener Studie zur "Sozialpolitik in Deutschland" begrüßen. Sie sorgt nicht nur für willkommene Abwechslung und Ablenkung von der allgemeinen Scheideweg- und Zukunftsliteratur: Indem sie historische und internationale Fragestellungen anspricht, regt sie auch dazu an, die Forschung auf diesen Gebieten auf eine bessere Grundlage zu stellen. Man kann nämlich nicht die Scheidewege von heute und schon gar nicht die möglichen Zielkonflikte und Probleme der Zukunft verstehen, wenn man die Zielkonflikte und Scheidewege der Vergangenheit nicht richtig im Griff hat. In dem Buch beschränkt Manfred G. Schmidt, der nach Jahren in Heidelberg nun in Bremen forscht und lehrt, sich auf eine Analyse zentralstaatlicher Sozialleistungen. Andere Sektoren der Sozialpolitik (Gesundheit, Ausbildung und Sozialfürsorge), ihre Finanzierung (Steuer und Beitragsfinanzierung) sowie Fragen kommunaler Daseinsvorsorge (Armenfürsorge - Sozialhilfe), und der privatöffentlichen (z. B. betriebliche, gewerkschaftliche, privatwirtschaftliche Leistungsformen) werden nicht bzw. nur am Rande, behandelt. Wie schon in der ersten Auflage ist das Buch in drei Teile gegliedert, jeder mit mehreren Abschnitten. Im ersten Teil beschreibt Schmidt die historische Entwicklung der zentralstaatlichen Sozialleistungen in Deutschland von 1871 bis heute. Im Vergleich zur ersten Auflage ist ein neuer Abschnitt über die Entwicklung der Sozialpolitik in der ehemaligen 82 DDR und, natürlich, ein Abschnitt über soziale Sicherung im wiedervereinigten Deutschland dazugekommen. Nach sechs eher deskriptiven Abschnitten schließt Schmidt diesen Teil ab-mit einer Analyse der Strukturen und Trends der Antriebsund Bremskräfte des zentralstaatlichen Leistungssystems. Der zweite Teil ist weniger deskriptiv angelegt und beinhaltet eine Reihe von international vergleichenden Analysen. Die ersten beiden Abschnitte untersuchen die Entstehung und Expansion von zentralstaatlichen sozialen Sicherungssystemen in den entwickelten Industrieländern, und in den beiden folgenden Abschnitten untersucht der Autor die Determinanten der staatlichen Sozialausgaben und des sogenannten "Dekommodifizierungsgrades". In diesen Abschnitten wird die Parteiendifferenzthese, die Unterschiede der Staatstätigkeit auf Differenzen der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierungen zurückführt, und die Theorie des Soziologen Esping-Andersen, der sogenannten "Drei Welten des Wohlfahrtsstaats", im Detail diskutiert. In den letzten beiden Abschnitten vergleicht Schmidt erstmals die soziale Sicherung in westlichen Demokratien, sozialistischen Ländern und Staaten der Dritten Welt, danach widmet er sich kurz der Entwicklung der Sozialpolitik der Europäischen Union. Letztgenannter Abschnitt ist neu im Vergleich zur Erstauflage. Der dritte Teil beinhaltet eine breit angelegte wirtschaftliche (erster Abschnitt), gesellschaftliche (zweiter Abschnitt) Und politische (dritter Abschnitt) Wirkungsanalyse, die unter anderem Zielkonflikte, die Rolle und Funktion, aber auch die Leistungsprofile der staatlichen Sozialsicherung anspricht, bevor er den vierten Abschnitt mit einer kurzen Kosten-Nutzen-Analyse der Sozialpolitik abschließt. Das Buch erscheint in der Reihe "Grundwissen Politik" und ist ursprünglich für die Lehre an einer Fernuniversität verfaßt worden. Es ist selbstverständlich, daß Manfred G. Schmidt die Aufgabe, ein Lehrbuch und nicht eine Monographie zu schreiben, sehr ernst genommen hat. Das Buch hat nicht die Tiefe und Stringenz einer Monographie, aber dies hat Schmidt auch gar nicht angestrebt. Mehr noch: Eine der großen Leistungen dieses Buches ist es, daß es das Material klar und ohne unnötigen Jargon darstellt. Vom berüchtigten Beamten- und Akademiker-Deutsch findet man nur wenige Spuren. Ich verstehe zwar nicht den Sinn spekulativer Begriffe wie "anonyme Sozialpolitik des Marktmechanismus" (Seiten 199 und 226 [zweimal]), aber solche Schönheitsfehler gibt es nur wenige in einem Buch, das sprachlich sehr durchgearbeitet und gelungen ist und für Studenten gut zugänglich sein sollte. Wie so oft der Fall bei Büchern deutscher Verlage, hat auch dieses Buch leider kein Register, und das erschwert ganz offensichtlich das Arbeiten mit dem Buch. Auf der anderen Seite ist es auch klar, daß Manfred G. Schmidt seine Aufgabe nicht als die bloße Anfertigung von Unterrichtsmaterial gesehen hat. In dem Buch werden neue Forschungsbefunde präsentiert, und in seinem Vorwort heißt es: "Geschrieben wurde das Werk mit dem Ziel, den neuesten Stand der Forschung zur Sozialpolitik in Deutschland, einschließlich ihres historischen und internationalen Vergleichs, sachgerecht zusammenzufassen" (Seite 11). Die erste Auflage ist weit über die Proseminare der Hochschulen hinaus gelesen worden und hat eine Generation von Doktoranden und jüngeren Politik- und Sozialwissenschaftlern mitgeprägt, jedenfalls im Hinblick auf die Frage, was man unter Sozialpolitik versteht und worum es geht, wenn man politologische Sozialpolitikanalyse betreibt. Es ist zu erwarten, daß 83 i I Rezension Rezension die neue Auflage einen ähnlichen Einfluß ausüben wird. Um das Buch richtig einzuschätzen, muß man es in seiner Doppelfunktion als Lehrbuch und (nicht-technischen) Forschungsbericht betrachten. Die klassischen und neueren Formen der Politikfeldanalyse hätten Schrnidt geholfen, eine klarere Perspektive in die historischen Ausführungen zur Entwicklung des Sozialleistungssystems in Deutschland (Teil 1) und den anderen entwickelten Industriestaaten (Teil 2 Abschnitt 1 u. 2) einzubringen. Die Analyse der historischen Entwicklung, die ja eine Hauptratio des Buches ist, hat mich besonders enttäuscht. In dem Teil über Deutschland analysiert Schmidt zwar die bekannten Grundsatzentscheidungen, er steuert aber keine neuen Ideen bei, die nicht schon aus den Abhandlungen der Historiker bekannt wären. Eine besondere politologische Perspektive findet man hier nicht. Die Darstellung der Einführung der Sozialversicherung im Kaiserreich - die Grundsatzentscheidung aller deutschen sozialpolitischen Grundsatzentscheidungen - ist eine besondere Schwachstelle des Buches. Wo er in anderen Abschnitten des Buches geschickt verschiedene Ansichten zu den behandelten Themen gegenüberstellt und oft auch die Hintergründe und Konsequenzen dieser Ansichten diskutiert, werden im Abschnitt über die Sozialversicherungspolitik im Kaiserreich sich gegenseitig ausschließende Erklärungsansätze kommentarlos dahingestellt und zusammengeworfen. Vom policy making im Kaiserreich bekommt man in Schrnidts Darstellungen keinen klaren Eindruck. Man muß allerdings in diesem Zusammenhang sogleich betonen, daß die gegebene Vorlage zur Analyse von Politik im Kaiserreich alles andere als ideal ist - um es milde auszudrücken. Die deutsche Kaiserreichhistoriographie ist ein Phänomen an sich, das von Begriffen und sogenannten wissenschaftlichen Kriterien charakterisiert ist, die man sonst nirgendwo findet. Ich habe große Sympathie für Schmidt, der in der modemen Politikwissenschaft geschult ist, denn man kann sogleich ahnen, wie er sich im Umgang mit der Literatur zur Politik im Kaiserreich quält und den Kopf zerbricht. Es ist oft schwer und manchmal auch unmöglich, aus diesen "Geschichten" einen klaren Sinn herauszufiltern. 2. Mir hat Teil 3 am besten gefallen. Hier wendet Manfred G. Schmidt die klassische Politikfeldanalyse an, die er in Deutschland zusammen mit seinem ehemaligen Kollegen Klaus von Beyme in dem Buch "Politik in der Bundesrepublik Deutschland", veröffentlicht im Jahre 1990, entwickelt hat. In der vergleichenden Literatur hat die Politikfeldanalyse ihre exemplarische Anwendung gefunden in dem inzwischen klassischen Lehrbuch von Heidenheimer, Hedo und Teich Adams (Comparative Public Policy. The Politics of Sodal Choice in America, Europe and Japan" [Erstauflage 1976, Dritte Auflage 1990]). Wenn ich schnell etwas über ein bestimmtes Politikfeld in der Bundesrepublik wissen will, greife.ich immer zuerst nach dem Buch von Schmidt und von v. Beyme.lch hätte es gerne gesehen, wenn Schmidt - wie Heidenheimer u. a. - diesen Ansatz der Politikfeldanalyse zur Grundlage für das ganze Buch genommen hätte, anstatt ihn hinten ins relative Abseits zu stellen. Zielkonflikte und Streit um die Rolle und Funktion des Systems der sozialen Sicherung sowie Sorgen um das Leistungsprofil dieses Systems sind ja keine neuen Erscheinungen, sondern haben die ganze Geschichte der sozialen Sicherung geprägt. An wichtigen Wendepunkten der Geschichte sind die verschiedenen Industriestaaten, einschließlich Deutschland, zu verschiedenen Grundsatzentscheidungen hinsichtlich solcher Konflikte und Streitigkeiten gekommen, die dann wiederum die weitere Entwicklung der sozialen Sicherung mitbestimmt haben. Es ist die Hauptaufgabe der vergleichenden historisch-institutionellen Politikanalyse, diese Grundsatzentscheidungen mit Hilfe moderner Theorien zu erklären und die Konsequenzen dieser Entscheidungen nachzuvollziehen. In den letzten zehn Jahren hat die Politologie in der historischen Politikfeldanalyse enorme Fortschritte gemacht. Obwohl Schmidt seinen Ansatz als einen "erweiterte(n) politisch-institutionalistische(n) Ansatz" (Seite 20) bezeichnet, nimmt er jedoch die neue Theorieentwicklung und -perspektive auf diesem Gebiet nur wenig zur Kenntnis. Der zentrale Begriff der "Pfadabhängigkeit", mit dem Politikwissenschaftler die beobachtete Unbeweglichkeit und Kontinuität der Strukturen von Politiksystemen zu begreifen versuchen, wird erst auf Seite 288 erwähnt, er hätte aber die historischen Analysen in den Teilen 1 und 2 informativer gestalten und strukturieren können. In Deutschland spielen diese neuen Theorieansätze eine große Rolle in der sogenannten "Transformationsforschung" - d. h. der Forschung zur Transformation und Entwicklung der neuen politischen Systeme in Osteuropa -, die in Berlin von Helmut Wiesenthai, aber auch an anderen Berliner Lehrstühlen betrieben wird. Auf der internationalen Bühne sind diese Theorieansätze aber im hohen Maße in der Forschung der Entwicklung der Sozialpolitik vorangetrieben worden. Haben diese internationalen Theorieentwicklungen noch nicht die deutschen Sozialpolitikforscher erreicht, oder sollten sie nur noch nicht den Weg nach Heidelberg und Bremen gefunden haben? 84 Viel wäre gewonnen, wenn Schmidt, was man eigentlich von einem Professor der politischen Wissenschaft hätte erwarten können, wenigstens die wesentlichsten Entscheidungsstrukturen des föderalen politischen Systems des Reichs dargestellt hätte. Dies hätte geholfen, Klarheit in das Chaos zu bringen. Zum Beispiel beschreibt Schmidt im Detail die inneren Gedanken von Bismarck, findet aber dann, daß er kaum noch Einfluß auf die Sozialversicherungsgesetzgebung hatte, weil die wesentlichen Entscheidungen im demokratisch gewählten Reichstag gefallen waren. Wenn Bismarcks Einfluß im großen und ganzen also unsignifikant war, warum muß man dann unbedingt eine kleine Abhandlung zu den inneren Gedanken dieses Herrn lesen? Es verwirrt doch nur eine komplexe Frage. Mehr noch: Im Abschnitt über Sozialpolitik im Wiedervereinigungsprozeß (1989 und später) wird Helmut Kohl überhaupt nicht erwähnt, und seine inneren Gedanken werden schon gar nicht abgehandelt. Aber mir scheint, daß Kohl einen größeren Einfluß auf konkrete sozialpolitische Strategien der deutschen Geschichte gehabt hat als Bismarck. Es wäre hilfreich gewesen, hätte Schmidt sich generell entscheiden können, ob überhaupt und inwiefern er die Rolle der deutschen Kanzler in der Entwicklung der deutschen Sozialpolitik behandeln wollte und dann mit einiger Konsequenz seine analytische Strategie verfolgt hätte, statt einen (unsignifikanten) Kanzler zu behandeln und andere (signifikante) Kanzler nicht. Eine historisch-politische Längsschnittanalyse von den 85 Rezension Rezension sich ändernden Rollen der Kanzler, wie sie in den Politikwissenschaften anderer Länder üblich ist, hätte eine neue politologische Dimension in das Buch eingebracht, die man bei Historikern selten findet, da sie sich ja auf begrenzte Zeitperioden beziehen. Eine solche Analyse hätte auch zu interessanten Ländervergleichen führen können. In Großbritannien kann man verfolgen, wie sich die Macht des Premier gegenüber dem Parlament in diesem Jahrhundert stark vergrößert hat. Man spricht davon, daß Großbritannien von einer "gewählten Diktatur" regiert wird. Obwohl es klar ist, daß der Bundeskanzler nicht die gleiche Macht hat wie der britische Premier, so wäre es doch interessant, nicht zuletzt für Studenten, hätte Politikprofessor Schmidt es gewagt, der Frage nachzugehen, ob und inwieweit man während dieses Jahrhunderts von einer ähnlichen Vergrößerung der Macht der deutschen Kanzler in sozialpolitischen Fragen sprechen kann. Leistungsempfänger ständig zwischen dem staatlichen und dem kommunalen System hin und her geschoben wurden. Wenn man die gesamte Geschichte des deutschen Sozialleistungssystems betrachtet, wird es deutlich, daß die 1960er und 1970er Jahre, in denen das zentralstaatliche System fast ein absolutes Monopol über Sozialleistungen hatte, ein Ausnahmefall waren. Diese Ausnahme wird bei Schmidt aber auch bei vielen anderen seiner Generation - als allgemeingültiges deutsches Modell dargestellt. Allgemein leidet Schmidts Analyse zur Entwicklung der sozialen Sicherung in den Industrieländern (Teil 2 Abschnitte eins und zwei) unter der fehlenden politologischen Perspektive. In seiner Analyse vertritt Schmidt die These der deutschen Pionierrolle. Nachdem andere Länder das wunderschöne deutsche System entdeckt haben, sind sie auf eine Aufholjagd gegangen, die letztendlich zum internationalen Siegeszug der zentralstaatlichen Sozialversicherung geführt haben soll. Selbst die Studenten der Fernuniversität werden wohl ahnen, daß so ein Wettlauf nie stattgefunden hat und die Entwicklung nicht so gewesen ist. Es wäre hier angebracht gewesen, hätte Schmidt einige Beispiele zu den Grundsatzentscheidungen in anderen Ländern und die Konsequenzen dieser Entscheidungen eingebracht. Verschiedene Länder sind verschiedene Wege gegangen und haben ungleiche Pfade verfolgt. Die skandinavischen Länder z. B. haben sehr stark auf freiwillige Kranken- und Arbeitslosenversicherungsordnungen gesetzt, die dann vom Staat und den Kommunen subventioniert wurden. Freiwillige Arbeitslosenversicherungsordnungen in Verbindung mit den Gewerkschaften gibt es heute noch in Dänemark und Schweden. Dä·nemark hat nie ein beitragsfinanziertes Rentensystem gehabt. Die angelsächsischen Länder haben ein betriebs bezogenes System sehr stark entwickelt. Eine Angestelltenrentenversicherung, in Deutschland 1911 eingeführt, haben die Engländer nie gehabt. Wo die deutschen Angestellten ihre Rente vom staatlichen System bekommen, bekommen die englischen "white-collar workers" ihre Rente vom Betriebsrentensystem. Im weiteren Zusammenhang ist die Fixierung Schmidts in allen Teilen des Buches auf zentralstaatliche Sozialleistungen unangebracht. Die politisch wichtige Debatte der letzten Jahre über die angemessene Aufgabenverteilung zwischen zentralstaatlichen, kommunalen und im weitesten Sinne privaten Trägem der sozialen Sicherung wird nicht erwähnt, das ist schon vom Standpunkt der Lehre her problematisch. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der Forschung ist diese Zentralstaatsfixierung unangemessen. Wie es den Lesern der ZSR bekannt sein wird, war schon bei der Einführung der Sozialversicherung im Kaiserreich die Frage der Aufgabenverteilung zwischen Reich, Kommune und privaten Träger und die damit verbundenen Ziel- und Verteilungskonflikte eine der entscheidenden Kontroversen. Das Leistungssystem der Weimarer Republik funktionierte wie ein Verschiebebahnhof, wo 86 Schließlich hätte nicht nur die historisch-institutionelle Analyse, sondern auch seine Diskussion von Esping-Andersens Theorie der "Drei Welten des Wohlfahrtsstaats" davon profitiert, hätte Schmidt die Politikfeldanalyse in Teil 3 stärker betont und entwickelt. Vor allem hätte er die Diskussion zu diesem Punkt viel kürzer halten können. Schmidt nimmt sich viele Seiten in Teil 2, um die Klassifizierung der Industrieländer in sozialdemokratische, liberale und konservative wohlfahrtsstaatliche Regime und den höchst fragwürdigen "Dekommodifizierungsindex" zu diskutieren. Aber in Teil 3 wird die im großen und ganzen unkontroverse Forschung über die Leistungsprofile der sozialen Sicherungssysteme nur ganz kurz behandelt, meist auf der Grundlage der Forschung von Bremer Kollegen. Eine internationale Kapazität wie Richard Hauser (Frankfurt) hingegen wird nicht erwähnt. Esping-Andersen und sein Gefolge stuft, wie bekannt, Deutschland als konservatives Wohlfahrtsstaatsregime ein. Wenn jedoch, wie Schmidt selbst in Fußnote 992, Seite 274 sagt, daß "bei der Armutsbekämpfung und der Verminderung von Einkommensungleichheiten durch Steuern und Sozialabgaben ( ... ) Deutschland bemerkenswert gut ab(schneidet)", kann man fragen, warum es überhaupt relevant ist, Deutschland als einen konservativen Wohlfahrtsstaat darzustellen. Schmidt kritisiert zwar die Theorie von Esping-Andersen, aber er geht nicht weit genug. Die Esping-Andersen Geschichte ist vor zehn Jahren konzipiert worden, seitdem aber ist die vergleichende und auch die nationale (z. B. deutsche) Forschung der Leistungsprofile der sozialen Sicherungssysterne weit vorangekommen. Zusammen mit der Entwicklung der historischinstitutionellen Perspektive ist dies wohl das größte Wachstumsgebiet der internationalen Sozialpolitikforschung gewesen. Schmidt hätte diese Forschung generell stärker betonen können, aber auf jeden Fall hätte er einige ihrer Befunde im EspingAndersen Abschnitt einbringen müssen, um deren Theorie richtig ins Bild zu setzen. Man muß hoffen, daß die neue Rot-Grüne Mehrheit konservativ bleibt und nicht versucht, an einem System allzusehr herumzuschustern, das sich gut bewährt hat. Die gute Bewertung Deutschlands in der Armuts- und Ungleichheitsbekämpfung sollte heute niemand überraschend und bemerkenswert finden. In diesem Zusammenhang muß man davor warnen, daß die wiederholte Charakterisierung des deutschen Systems als "konservativ" in Teilen der deutschen akademischen Diskussion ein völlig verzerrtes Bild des heutigen deutschen Systems darstellt und eine Belastung für die politische Diskussion ist. Nun ist es ja - Gott sei Dank - so, daß solche Ideen nur einen geringen Einfluß auf die konkrete Politik haben. Also wäre vielleicht eine andere Warnung angebracht: Weil es so sehr der allgemeinen Vernunft widerspricht, das deutsche System als rückständig-konservativ darzustellen, können solche Ausführungen dazu beitragen, den Politik- und Sozialwissenschaftlern einen 87 Rezension Rezension schlechten Ruf zu geben. In England werden die Sozialpolitikanalytiker schon öfter als Mitglieder von "the chattering classes" (die quatschende Klasse) abgestuft. Ich kann mir auch schon vorstellen, daß einige Studenten der Fernuniversität sich darüber wundern, was die Hochschulforscher so treiben, wenn sie solche Geschichten im Detail lehren und die Studenten es lernen müssen. Es müßte jetzt an der Zeit sein, Esping-Andersen ins Regal zu stellen und sich anderen, fruchtbareren Forschungsansätzen zuzuwenden. schnitt 4 unterzieht er sie einer ähnlichen Analyse mit Bezug auf den "Dekommodifizierungsindex", kommt aber, nicht überraschend, zu einem ähnlichen Resultat wie in seiner Analyse der Sozialleistungsquote.) Wie Schmidt hervorhebt, sind die wichtigsten Determinanten der Sozialleistungsquote sowie deren Veränderungen die Entwicklung der Seniorenquote und der Arbeitslosenquote. Hier bin ich mir mit Schmidt natürlich einig, und es gibt keinen Grund zum Streit. Diesen aber gibt es hinsichtlich seiner Analyse der Effekte von politischen Parteien. Auf der Basis einer Einschätzung ihrer Haltung zum Sozialstaat, teilt Schmidt die Parteien der 18 Demokratien in vier Gruppen ein - Links, Mitte, Liberal und Rechts. Demnach ist die CDU z. B. keine Partei der Rechten, sondern eine der Mitte, weil sie den Sozialstaat unterstützt. Der Einfluß der Parteien auf die Politik eines Landes sind am Kabinettsitzanteil gemessen. Auf dieser Grundlage findet er in seinem Test, daß Linksparteiregierungen, Mitteparteiregierungen und liberale Parteiregierungen einen ähnlich großen positiven Effekt auf die Regierungspolitik (Sozialleistungsquote ) haben. Hier stimmt also die Parteiendifferenzthese nicht. Dieser Befund stimmt auch damit überein, daß man, wie Schmidt selbst hervorhebt, in Deutschland keine Unterschiede unter Linksparteiregierungen (SPD und andere) und Mitteparteiregierungen (CDU und andere) in der Regierungspolitik (Sozialleistungsquote) nachweisen kann. In Deutschland gibt es nach der Definition von Schmidt keine Rechtsparteien. Nur Regierungen der Rechtsparteien kann ein negativer Effekt auf die Regierungspolitik (Sozialleistungsquote ) nachgewiesen werden. Rechte Parteien gibt es aber hauptsächlich nur in den anglo-sächsischen Ländern (für die Details siehe Tabelle 1 im European Journal). Es tut mir leid, dieser Befund erscheint mir trivial und tautologisch. Was er als Beweis der Parteiendifferenzthese darstellt, ist in der Realität ein versteckter Ländervergleich. Ich gehe davon aus, daß alle Leser dieser Zeitschrift wissen, daß die anglosächsischen Länder eine niedrigere Sozialleistungsquote haben als die meisten anderen entwickelten Demokratien. Jetzt versammelt Schmidt alle bürgerlichen Parteien aus den anglo-sächsischen Ländern in einer Gruppe und nennt sie konservative Parteien. Die bürgerlichen Parteien aus den Ländern mit hoher Sozialleistungsquote werden in anderen Gruppen gesammelt und bekommen andere Namen: Liberale oder Parteien der Mitte. Hokuspokusfidibus, der Beweis ist gegeben, daß konservative Regierungen zu niedrigeren Sozialleistungsquoten führen als alle anderen Regierungen. Hätte er alle bürgerlichen Parteien in eine Gruppe gesammelt, hätte er keinen signifikanten Effekt politischer Parteien auf die Regierungspolitik gefunden. Seine Parteiendifferenzthese wäre dann falsifiziert. Was bei Schmidt völlig fehlt, ist eine Analyse von Wählerpräferenzen - wie sie entstehen, wie sie von dem sozialpolitischen System beeinflußt sind und wie sie die Spielräume der Parteien begrenzen. Die letzten beide Punkte müßten einleuchtend sein und sind einfach zu illustrieren. Heute geben die Deutschen und Briten ähnlich viel aus für die Rentenunterstützung, aber, wie bekannt, ist die Verteilung zwischen öffentlichen und privaten Leistungen sehr unterschiedlich. Für die Wählerpräferenzen sind diese Unterschiede aber entscheidend. In Großbritannien kann keine Partei (Linke oder Rechte) eine Wahl mit dem Programm gewinnen, ein deutsches zentralstaatliches Rentensystem einzuführen. Der "median voter" oder der typische 3. In diesem Buch spielt die Parteiendifferenzthese eine wichtige Rolle. Auf diesem Gebiet der Forschung des Einflusses der politischen Parteien auf die Staatstätigkeit hat Manfred G. Schmidt sich international einen Namen gemacht und seinen ersten Forschungspreis (1981) erhalten. Ohne daß ich behaupten kann und will, daß ich alle Publikationen Schmidts kenne, scheint es mir, daß er den Großteil seiner Forschung der Verteidigung der Parteiendifferenzthese in ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen gewidmet hat. Mehr noch: für viele jüngere deutsche Politologen ist politologische Sozialpolitikforschung identisch mit Forschung zu diesem Thema. Man hat den Eindruck, daß sie keine anderen Ansätze kennen als die Parteiendifferenzthese. Dies ist nicht der Ort, die Parteiendifferenzthese im Detail zu diskutieren. So eine Diskussion müßte die weitere Parteienforschung aufzeichnen und auch weitere Beiträge neben denen von Schmidt einbeziehen. Die Parteienforschung beinhaltet natürlich viel mehr als Schmidts Parteiendifferenzthese, aber die Aufgabe ist hier, sein Lehrbuch zu rezensieren. In diesem Zusammenhang finde ich es überhaupt überraschend, daß Schmidt so sehr seine eigenen Interessen und Hypothesen in einem Lehrbuch hervorhebt. In England z. B. ist das nicht üblich, und wo es vorkommt, kommt es bei den Studenten nicht gut an. Aber vielleicht ist der Respekt der Studenten vor Hochschullehrern in Deutschland größer als in England? (Eigene Forschung wird in Sonderseminaren und nicht im Grundstudium vorgetragen.) In dem Buch präsentiert Schmidt neue Tests und Argumente für seine Hypothesen, die an andere Arbeiten von ihm anschließen, die unlängst in der Fachliteratur erschienen sind (European Journal of Political Research, 1996, S. 155-183; GabriellNiedermayerlStöss: Parteiendemokratie in Deutschland. Opladen 1997). Ohne Zugang zu diesen anderen Beiträgen (insbesondere die Tabelle 1 im European Journal) ist es schwer, sich kritisch mit Schmidts Ausführungen im Lehrbuch auseinanderzuset~ zen, was man schon von einem didaktisch-pädagogischen Standpunkt aus problematisch finden muß. Man muß hoffen, daß für die Studenten der deutschen Universitäten incl. Fernuniversität das European Journal greifbar ist. Schmidt will zeigen, daß "die Effekte politischer Parteien auf die Regierungspolitik" von "hervorragender Bedeutung sind" (Seite 210). Aber dies zeigt seine Analyse nun nicht. Um seine These zu beweisen, untersucht er die Determinanten der Sozialleistungsquote (Tabelle 7) und die Determinanten der Veränderung der Sozialleistungsquote (Tabelle 8) in 18 Demokratien in der Periode 1960-1992. (In Teil 2 Ab- 88 89 Rezension Rezension Angestellte ("white-collar worker") würde nie für so eine Partei stimmen. Die Kathedersozialisten an den Hochschulen wären die ersten, die auf die Straßen marschieren würden, wenn eine Regierung (Linke oder Rechte) des University Superannuation Scheme (das betriebliche Rentensystem für die Hochschullehrer) verstaatlichen würde, genauso wie ihre deutschen Kollegen keine Regierung (Linke oder Rechte) unterstützen würden, die ihnen die Beamtenrechte wegnehmen würde. Genau umgekehrt ist die Lage in Deutschland - jedenfalls war es so bis zur Wiedervereinigung, als die Ostdeutschen in das System kamen. Jede Partei (Linke oder Rechte), die das staatliche Rentensystem grundsätzlich ändern wollte, könnte nicht gewinnen. Starke Eigeninteressen, die an die beiden sehr verschiedenen sozialen Sicherungssysteme gebunden sind, bestimmen die Wählerpräferenzen und die Rahmenbedingungen der Parteienkonkurrenz in beiden Ländern. 1957er Rentenreform beschlossen war. Die Gegner der Expansion mußten sich der politischen und sozialökonomischen Realität anpassen, einschließlich der neuen Zuteilung von Rentenrechten und -ansprüchen. Schwerer ist es zu erklären, wie diese Zustände zustande gekommen sind. Hier muß man historisch vorangehen und sich mehr Mühe geben als Schmidt (und die deutschen Politologen) es tun, um die wichtigen "Grundsatzentscheidungen" zu verstehen. Im Hinblick auf Sozialleistungen und Unterschiede im Rentensystem muß man mindestens eine Reise zurück in die 1950er Jahre antreten. Hier kann ich natürlich nicht im Detail darauf eingehen, wie und warum Deutschland und Großbritannien in der Nachkriegszeit verschiedene Pfade eingeschlagen haben, will aber nichtsdestotrotz ein paar Punkte skizzieren. Festzuhalten ist, daß es in den 1950er Jahren keinen wesentlichen Unterschied in der Grundphilosophie der englischen Konservativen und der deutschen Christdemokraten gab. Die Engländer waren "all nation Tories" , und die Deutschen wollten Wohlstand für alle. Die deutschen Christdemokraten waren unter keinen Umständen eine Partei der Verstaatlichung - wie schon der sogenannte Subsidiaritätsstreit zeigte. Eigentlich waren die Engländer eher auf Verstaatlichung eingestellt - die Tories hätten den neu gegründeten National Health Service abschaffen können, taten es aber nicht. Es müßte auch klar sein, daß ein entwickeltes privates System - mit einer staatlichen oder kommunalen Grundsicherung - der Grundphilosophie einer sozialen Marktwirtschaft eher entsprochen hätte als ein System, in dem die mittleren Einkommensgruppen durch den Staat ihre Rente bekommen. Daß die Deutschen mehr und die Engländer weniger christlich gewesen sein sollten, ist natürlich Unsinn. Auf jeden Fall habe ich nie verstanden, warum es besonders unchristlich sein sollte, eine betriebliche statt einer staatlichen Rente zu bekommen. Der Unterschied zwischen bedürfnisgeprüften Leistungen und Versicherungsleistungen hat auch wenig mit Christentum zu tun. Wichtig ist es jedoch, sich zu erinnern, daß sowohl in der englischen wie auch der deutschen Partei entscheidende Richtungskämpfe über die angemessene Entwicklung in der Rentenfrage ausgefochten wurden. Daß dieses Faktum oft vergessen wird, und z. B. bei Schmidt in seinen historischen Ausführungen keine Erwähnung findet, liegt vor allem daran, daß die Geschichte und die Ansichten der Sieger immer eine stärkere Betonung finden als die der Verlierer, obwohl vom Gesichtspunkt der Forschung die Ansichten der Verlierer oft viel interessanter sind. Man will die alten Streitigkeiten nicht noch einmal durchleben, wenn der Zug schon abgefahren ist. Aber grundsätzlich entwickelte die CDU erst einen einheitlichen Konsens zur Expansion des öffentlichen Rentensystems, nachdem die 90 Warum die Expansionslinie in Deutschland, nicht aber in Großbritannien gewann, ist eine komplexe Frage und hatte mehrere Gründe. Ich habe an anderer Stelle argumentiert, daß die Rentenreform in Deutschland grundsätzlich eine Frage der Aufgabenverteilung zwischen Staat und Kommune war. Adenauer und seine Freunde wollten unbedingt vermeiden, daß das Verschiebebahnhofsprinzip der Weimarer Zeit, das er ja selbst als ehemaliger Oberbürgermeister von Köln miterlebt hatte, sich wieder in der Bundesrepublik abspielte. Die kommunalen Nachkriegsfinanzen waren noch eingeschränkter als die Kommunalfinanzen der Weimarer Zeit - sie bekamen erst 1969 eine bessere Grundlage - und reichten nicht aus, eine Flut von Sozialhilfeempfänger im Rentenalter sowie Arbeitslose zu finanzieren. Die Erhöhung der zentralstaatlichen Leistungen hat diese Entwicklung vermieden. In Großbritannien, wo alle Sozialleistungen seit der Beveridge Reform der Labourregierung unmittelbar nach dem Krieg zentralstaatlich organisiert waren, gab es dieses Problem nicht. Diesen Erklärungsansatz muß man wahrscheinlich ergänzen mit einer Untersuchung der Bedingungen der Entwicklung eines betrieblichen Rentensystems. Heute wissen wir relativ wenig über die deutsche Entwicklung, aber hoffentlich werden neuere Arbeiten zu diesem Thema von Winfried Schmähl und seinen Mitarbeitern uns bald über dieses Thema besser informieren. Einiges ist allerdings schon bekannt: So gab es z. B. trotz staatlicher Angestelltenversicherung in der Vorkriegszeit ein entwickeltes betriebliches Rentensystem. Weniger klar ist es, wieviel davon nach dem Krieg noch übrig war. Das englische System war schon intakt und expandierte kräftig in den 50er Jahren. Wir wissen auch, daß die für ein betriebliches Rentensystem so wichtigen Finanzmärkte sehr unterschiedlich funktionierten, und daß sie in Großbritannien weniger restriktiv waren als in Deutschland, aber den Details müßte man noch nachforschen. Gleichgültig, ob man in den Details dieser Ausführungen übereinstimmt oder nicht, so zeigen sie doch eindeutig, daß Parteien mit ähnlichen Philosophien sehr unterschiedliche realpolitische Strategien verfolgen können, je nachdem wie die gegebenen Umstände gestaltet sind. Grundsatzentscheidungen, die an einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte getroffen werden, haben aber langfristige Konsequenzen, auch für die Parteiphilosophie. Ähnlich große Unterschiede, wie man sie heute zwischen der CDU und den britischen Konservativen findet, kann man auch zwischen den linken Parteien beobachten. Die schwedische und die dänische Sozialdemokratische Partei unterstützen die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung; ein Programmpunkt, den die deutsche Sozialdemokratische Partei schon 1913 aufgegeben hat. Die neue englische Labourregierung will unter keinen Umständen ein deutsches Rentenversicherungssystem einführen. Nach Schmidts Kriterien müßte diese Partei wohl dann als eine konservative Partei eingestuft werden wie schon bei einigen Kathedersozialisten in Großbritannien geschehen. Es sollte klar sein, daß solche Einstufungen und Etikettierungen für die politische Analyse und die Glaubwürdigkeit der Akademiker nicht sonderlich hilfreich sind. Für eine Analyse der Rolle der Parteien und der Differenzen zwischen ihnen kommt man um die historische Analyse 91 Rezension nicht herum, und arbiträre Gruppeneinteilungen helfen uns schon gar nicht, ein besseres Verständnis zu entwickeln. ZEITSCHRIFT FÜR 4. Abschließend und zusammenfassend möchte ich nochmal betonen, daß man ein Buch, das die Sozialpolitik aus historischen und internationalen Gesichtspunkten untersucht, immer hoch leben lassen muß. In einem Markt, der von der allgemeinen Scheideweg- und Zukunftsforschung dominiert wird, haben Forschungsansätze, die zu verstehen versuchen, wie das heutige System zustande gekommen ist, eine schwere Existenz. Betont werden muß auch noch einmal, wie wichtig es ist, daß ein bekannter Politologe es auf sich genommen hat, den langen historischen Blick auf die sozialpolitische Entwicklung zu werfen. Anders als in der Politologie anderer Länder ist die politologisch-historische Längsschnittanalyse in der deutschen Politologie schwach entwickelt. Schmidts Werk stellt einen ersten vorsichtigen Schritt dar, die Angst der Politologen vor der Geschichte - oder sollte man lieber sagen: ihre Angstvor den Geschichtsmonopol der deutschen Historiker - zu überwinden, und er leistet damit einen Beitrag, den internationalen Anschluß zu finden. Enttäuscht bin ich gewesen, weil ich finde, Schmidt ist damit nicht weit genug gegangen. Pfadabhängigkeit gibt es nicht nur in der Sozialpolitik, sondern auch in der Forschung, aber mit kritischen Auseinandersetzungen kann man hoffen, die gegebene Richtung zu ändern. Nicht nur die deutsche Sozialpolitik, sondern auch die deutsche Sozialpolitikanalyse steht vor einem Scheideweg. Ich bin überzeugt, daß Studenten das Buch mögen werden, vor allem dann, wenn noch ergänzendes Material dazu kommt, und sie im Unterricht ermuntert werden, sich mit dem Lehrstoff kritisch auseinanderzusetzen. Wie man jedoch aus Schmidts Buch erkennt, müssen die deutschen politologischen Sozialpolitikforscher noch einiges leisten, bis sie den Anschluß an die internationale Sozialpolitikforschung und an die Kollegen in der Berliner Transformationsforschung finden. Dr. Christian ToJt, Birmingham und Florenz HERAUSGEBER UND SCHRIFTLEITUNG: ANSCHRIFT DER SCHRIFTLEITUNG: 45. Jahrgang S"~;tlt,el",m PROF. DR. FLORIAN TENNSTEDT, KASSEL· HORST HEINKE, WIESBADEN· WOLFGANG WRUCK, WIESBADEN MARKTPLATZ 13, 65183 WIESBADEN FEBRUAR 1999 Heft 2 "Alter(n) - Gesellschaft - Politik" Alter und Altern werden zunehmend zu Themen, die ein allgemeines öffentliches Interesse hervorrufen. Sie sind in ihren vielfachen Erscheinungsformen und ihrer Relevanz nicht mehr aus der gesellschaftlichen und politischen Diskussion wegzu. denken. Dabei geht es inzwischen keineswegs mehr nur um die demographische Entwicklung und ihre mannigfaltigen, bereits eingetretenen oder noch zu erwartenden Folgen, die mit dem "Altern der Gesellschaft" prognostiziert werden. Neben der quantitativen Entwicklung wird seit Ende der achtziger Jahre ein eher qualitativer "Strukturwandel des Alters" konstatiert, der zunehmend über den Kreis älterer und alter Menschen hinaus einen gesamtgesellschaftlichen Wandel der Sozialstruktur prägt. Einen Niederschlag findet diese Entwicklung auch in sich wandelnden Lebensverläufen (Altern). Im Kontext übergreifender sozialer Wandlungsprozesse der Gesellschaft - der Ökonomie und Sozialpolitik, der Lebens- und Arbeitsverhältnisse, der Familie und anderer sozialer Netze und Versorgungsformen - gewinnen demographische Veränderungen wie auch der Altersstrukturwandel eine besondere Brisanz: Wie sollen die Vergesellschaftungsweisen im Lebensverlauf bis ins Alter hinein künftig aussehen, wenn die derzeit noch praktizierten zunehmend unter Legitimationsdruck geraten und auf mittlere und längere Sicht nicht mehr praktikabel, nicht mehr finanzierbar und nicht mehr sinnvoll erscheinen? Welche Formen der gesellschaftlichen Integration, Beteiligung und Versorgung sind für die verschiedenen Altersgruppen, für Frauen und Männer, für Erwerbsfähige und Nichterwerbsfähige angesichts des hohen und noch steigenden Anteils älterer und alter bis hochbetagter Menschen an der Bevölkerung denkbar, erstrebenswert und realisierbar? Befinden wir uns bereits mitten in einem Generationenkonflikt um die knapper werdenden Ressourcen, um Arbeit, um Einkommen, um soziale Sicherung und um Lebensqualitätschancen? Oder wird der vielzitierte angeblich drohende "Krieg zwischen den Generationen" (Gronemeyer) überschätzt und herbeigeredet, während 93 92